Sudetendeutsche Zeitung
Reicenberger











❯ Samstag, 9. September im Schloß Bellevue in Berlin Sonderzug aus Prag
Sudetendeutschen Landsmannschaft








Landsmannschaft
Die Tschechische Republik und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sind neben Thüringen die Partner beim diesjährigen Bürgerfest des Bundespräsidenten am Samstag, 9. September, im Schloß Bellevue in Berlin, dem Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier.
Beim Fest im Schloßpark feiert der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sein 25jährige Bestehen und präsentiert eine Auswahl aus den Zehntausenden Projekten, die mittlerweile gefördert wurden. Außerdem werden per Sonderzug von Prag nach Berlin Gäste aus Tschechien an-
❯ Bürgermeisterin verteidigt den Bagger-Einsatz und spricht von dem Plan, einen würdigen Ort zu schaffen
reisen. „Unser großes Potential in Deutschland, Tschechien und in Europa sind die lebendigen Zivilgesellschaften“, erklären Petra Ernstberger und Tomáš Jelínek, die Geschäftsführer des DeutschTschechischen Zukunftsfonds. Eine besondere Einladung hat der Bundespräsident seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel ausgesprochen, der bei seinem Berlin-Besuch im März sagte, daß er gern an dem Event teilnehmen würde. Kostenfreie Tickets für das Bürgerfest können am 14. August über die Webseite www. buergerfest-bundespraesident. de/tickets/ bestellt werden.

Dem Tschechischen Fernsehen war es einen großen Bericht wert: In Hermsdorf in der Region Braunau hat die dortige Bürgermeisterin Jana Králové rund 50 sudetendeutsche Gräber einebnen lassen. Sie selbst spricht von einem „Mißverständnis“.
Wegen der Sommerpause erscheint die nächste Ausgabe der Sudetendeutschen Zeitung am 25. August. Redaktionsschluß für Veranstaltungshinweise ist Freitag, 18. August, 18.00 Uhr. Redaktion und Verlag wünschen allen Lesern eine schöne und erholsame Urlaubszeit.
Zerbricht die VisegrádGruppe?
Die Zeiten, in denen die Länder der Visegrád-Gruppe (V4) – also Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei – zu den meisten außenpolitischen oder EUAngelegenheiten einer Meinung waren, sind vorbei.
Die V4 sei keine homogene Kraft mehr, die dank ihrer Einheitlichkeit in der EU ihre Anliegen durchdrücken könne, sagte Tschechiens Minister für EU-Angelegenheiten, Martin Dvořák (Stan), in einem Interview für die Presseagentur ČTK.
Unterschiedliche Haltungen innerhalb der V4 waren in letzter Zeit etwa zum Thema Migrationspolitik deutlich geworden, wobei Tschechien die neuen EUAsylregeln unterstützt, Polen und Ungarn sie aber ablehnen.

Und die Slowakei hat unlängst sogar den ungarischen Botschafter einbestellt. Auslöser war eine Verbalattacke von Ungarns Premierminister Viktor Orbán unter anderem gegen die Slowakei.

Im Zuge der Urbarmachung durch das Kloster Breunau war Hermsdorf von deutschen Auswanderern im 13. Jahrhundert gegründet und 1353 erstmals urkundlich erwähnt worden. Bis zur Vertreibung lebten in Hermsdorf fast ausschließlich Sudetendeutsche. Der Friedhof ist Zeugnis dieser jahrhundertealten Geschichte.




Gegenüber dem Tschechischen Fernsehen rechtfertigte die Bürgermeisterin das Einebnen zunächst damit, daß es sich um eine „gefährliche Ruine“ handele, die mit Gras überwuchert sei. Sie bezeichnete das Ganze als „aufgeblasene Luftnummer“ und als „Mißverständnis“. Den Vorwurf, Gräber zu beseitigen, wies sie vehement zurück. Später erklärte die Bürgermeisterin, daß es der Gemeinde nicht darum gegangen sei, die Gräber zu zerstören, sondern vielmehr darum, das Friedhofsgelände zu verschönern, damit es eine würdige Erinnerung an die ursprünglichen Bewohner darstelle. Ihr zufolge habe der Bagger versehentlich etwa fünf Grabsteine vom Friedhof entfernt.




„Der eingeebnete Teil des Friedhofs ist mit Scherben von Grabsteinen bedeckt, auf denen die Namen der deutschen Verstorbenen zu lesen sind“, berichtete dagegen der tschechische Fernsehredakteur Vlastimil Weiner in seinem Bericht. Die nicht zerstörten Grabsteine seien ins zwölf Kilometer entfernte Barzdorf gebracht worden, wo sie auf einem Haufen liegen.
Bürgermeisterin Jana Králové sagte dem Tschechischen Fernsehen: „Als ich davon erfuhr, ordnete ich sofort an, daß die Grabsteine wieder aufgestellt werden. Wir haben keine Gräber zerstört. Der Plan war, die beschädigten
❯ Erklärung des Bundesvorstands der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Wortlaut Gräber
Steine von den Gräbern zu entfernen, den Friedhof zu säubern und die umgefallenen Grabsteine wieder aufzustellen. Wir wollten diesen Teil des Friedhofs in einen würdigen Ort verwandeln – auch für unsere Sudetendeutschen, die hierher reisen.“



Deutliche Kritik an der Einebnung übte im Tschechischen Fernsehen dagegen Martin Dzingel in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Regierungsrates für nationale Minderheiten. Dzingel verwies darauf, daß in Tschechien auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit leben, die von diesem Fall direkt betroffen sind: „Infolge der Vertreibung der überwiegenden Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde den Überlebenden die Grabpflege verweigert, die aufgrund aller abgetrennten Bindungen an ihre Heimat – die heutige Tschechische Republik – bis heute andauert. Die Friedhöfe und Grabstätten der Ureinwohner sind heute die einzige öffentliche Gedenkstätte für diejenigen, die im Laufe der Jahrhunderte ihre Heimat aufgebaut und die kulturellen, wirtschaftlichen, architektonischen und anderen Werte geschaffen haben, die wir heute noch pflegen.“ Torsten Fricke Mehr zum Thema auf Seite 3
Mit dem Vorfall in Hermsdorf und dem generellen Thema „Erhalt und Pflege sudetendeutscher Gräber“ hat sich der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft in seiner Sitzung am Samstag beschäftigt und eine einstimmige Erklärung verabschiedet. Der Wortlaut:

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft begrüßt die positive Entwicklung im tschechisch-deutschen, tschechisch-bayerischen und
tschechisch-sudetendeutschen Verhältnis, die auch eine gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit in vielen praktischen Fragen ermöglicht oder erleichtert.
Ein solcher positiver Schritt war die Konferenz über Erhalt und Pflege sudetendeutscher Gräber in der Tschechischen Republik, zu der der tschechische Außenminister Jan Lipavský sowohl führende Repräsentanten und Fachleute der deutschen Minderheit als auch der Sudetendeutschen Volksgruppe ins
Prager Außenministerium eingeladen hatte. Die Beratungen waren erfolgreich. Man einigte sich darauf, daß diese Gräber ein wichtiger und untrennbarer Bestandteil des gemeinsamen Kulturerbes sind.

Jetzt wird auf Fachebene weiter an diesem wichtigen Thema gearbeitet. Umso bestürzender sind Nachrichten, wonach die Bürgermeisterin der Gemeinde Hermsdorf/Heřmánkovice bei Braunau offenbar dabei ist, den dortigen historischen Friedhof zu zerstören.


Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft appelliert an alle beteiligten Seiten, dieses Vorhaben unverzüglich einzustellen und in Gespräche mit den Vertretern der Betroffenen, also der Deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und der Sudetendeutschen Landsmannschaft, einzutreten, um eine Regelung zu finden, die sowohl der jahrhundertelangen deutschen Kultur in den Böhmischen Ländern also auch dem Respekt vor den Toten gerecht wird.

Die österreichische Botschaft hat wieder einen zweiten ranghohen Diplomaten bekommen. Der neue Zugeteilte heißt
Stephan Rutkowski (Foto: Mitte), der in Begleitung des Pressesprechers der Botschaft, Andreas Wiedemann, dem Prager Sudetendeutschen Büro seinen Antrittsbesuch abstattete.

SL-Büroleiter Peter Barton erklärte den hohen Gästen die Arbeit seines Büros, das seit nunmehr 21 Jahren der tschechischen Ö entlichkeit und Politik als Verbindung zu den früheren
deutschsprachigen Bewohnern dieses Landes inmitten Europas dient. Neben Politikern sind es auch Diplomaten verschiedener Botschaften der Welt, die sich hier informieren wollen. Die Republik Österreich wurde 1945/46 zur zweiten Heimat der Sudetendeutschen, die zu ihren südlichen Nachbarn vertrieben wurden.
Die österreichischen Diplomaten diskutierten anschließend mit Barton über den aktuellen Stand der (sudeten)deutsch-tschechischen Beziehungen und über weitere Verbesserungsmöglichkeiten.
❯ In Oppeln wurde im vergangenen Herbst das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen erö net
Im Zentrum der ehemaligen preußischen Kreisstadt und heutigen Hauptstadt der Woiwodschaft Oppeln haben in der Nähe des Mühlgrabens, der ein Abzweig der Oder darstellt, viele Institutionen der deutschen Minderheit in Polen ihren Sitz.
Die über 120 000 Einwohner zählende Stadt Oppeln, nur 100 Kilometer von Breslau stromaufwärts entfernt, hat rund 35 000 Studenten an einer Universität, einer Technischen Universität und vielen Hochschulen, hat ein Theater, eine Philharmonie und viele Museen, darunter das von Erzbischof Nossol 1987 gegründete Diözesanmuseum und das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen in Lamsdorf-Oppeln.
Seit dem 11. September 2022 gibt es nun auch ein zentrales Museum über die Deutschen in Polen. Das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen, in der Spitalgasse angesiedelt und auch am Mühlgraben gelegen, wurde von Rafał Bartek, dem Vorsitzenden der soziokulturellen Gemeinschaft der Deutschen in Polen, Andrzej Buła, dem Marschall der Woiwodschaft Opole (Oppeln) und Tadeusz Chrobak, Direktor der Öffentlichen Woiwodschaftsbibliothek in Oppeln, eröffnet. Anwesend waren auch der deutsche Botschafter in Warschau, Thomas Bagger, die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Nathalie Pawlik, der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Bernd Fabritius, und der Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Hartmut Koschyk.
Seit November 2022 ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich (Dienstag bis Freitag 10.00 bis 16.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr). Das Haus wurde aus den Mitteln des Verbandes der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen über die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens erworben.
Für Sanierungsarbeiten und Ausstattung gab das Bundesministerium für Inneres und für Heimat knapp zwei Millionen Euro, für die Dauerausstellung knapp drei Millionen Euro. Das polnische Ministerium für Inneres und Verwaltung steuerte 65 000 Euro für den Ausstellungsteil „Die Deutschen in Polen heute“ bei. Die laufenden Kosten werden durch die Woiwodschaft Oppeln über die Woiwodschaftsbibliothek Oppeln getragen.
Die vier Etagen beherbergen eine konzentrierte Darstellung der Geschichte der Deutschen in Polen, nicht so sehr die regionale Geschichte in Oppeln oder Breslau. Die erste Etage umfaßt die Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg, wobei den Ausgangspunkt die heilige Hedwig von Schlesien bildet, die auch nach
Nur zwei Wochen Urlaub für Minister
Seit Montag regieren in Prag die Stellvertreter. Tschechiens Premierminister Petr Fiala hat seinem Kabinett jedoch nur einen kurzen Urlaub von zwei Wochen genehmigt. Bereits am 16. August steht die erste Kabinettssitzung auf dem Programm. Regierungssprecher Václav Smolka verriet gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, daß der Regierungschef seinen Urlaub in Kroatien verbringt.
Tschechien beim
Ukraine-Gipfel
Der Staatssekretär im Außenministerium, Jan Marian (Stan), wird für Tschechien am Ukraine-Friedensgipfel am 5. und 6. August im saudi-arabischen Dschidda teilnehmen. Das internationale Treffen geht auf eine gemeinsame Initiative der USA und der Europäischen Union zurück. Ziel ist es, eine breite internationale Unterstützung für einen Frieden zu finden, dessen Bedingungen die Ukraine bestimmen soll. Insgesamt werden Vertreter aus 30 Staaten an dem Treffen teilnehmen. Rußland ist nicht eingeladen.

Depeche Mode
erneut in Prag
hat der Minister für Industrie und Handel, Jozef Síkela (Stan), erklärt. Tschechien würde somit mit großem Vorlauf die Vorgaben der EU erfüllen. In der vergangenen Woche hatte der Minister zudem mitgeteilt, daß im ersten Halbjahr 2023 in Tschechien kein Gas aus Rußland verbraucht worden sei. Seit der Schließung der Nord-Stream-Leitung werde der Rohstoff aus Norwegen über Deutschland eingeführt. Flüssigerdgas käme zudem aus Belgien und den Niederlanden nach Tschechien.
Der Retter der jüdischen Kinder
Aussage der polnischen katholischen Bischöfe 1965 in ihrer Botschaft an ihre Amtsbrüder der Deutschen Bischofskonferenz in der Bundesrepublik Deutschland zur Versöhnung folgendermaßen charakterisiert wurde:
„Man sieht sie allgemein – von einigen nationalistischen Fanatikern abgesehen – als den besten Ausdruck eines christlichen Brückenbauers zwischen Polen und Deutschland an, wobei wir
polnische Mehrheitsgesellschaft darstellt, etwas über die deutsche Minderheit zu erfahren.
Die zweite Etage widmet sich den schwierigen Jahren zwischen Kriegsende 1945 und 1989. In Silhouetten huschen Menschen auf der Flucht vorbei, werden wichtige Dokumente wie der Standpunkt der Solidarność 1981 zu den nationalen Minderheiten gezeigt, worin diese erklärte, daß allen Minderheiten „die freie
schaulich macht. Zu sehen ist auch das legendäre Plakat, das am 12. November 1989 in Kreisau Deutsche aus Polen zur Versöhnungsmesse mit Bundeskanzler Helmut Kohl und dem ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten Polens, Tadeusz Mazowiecki, hochhielten: „Helmut, Du bist auch unser Kanzler.“
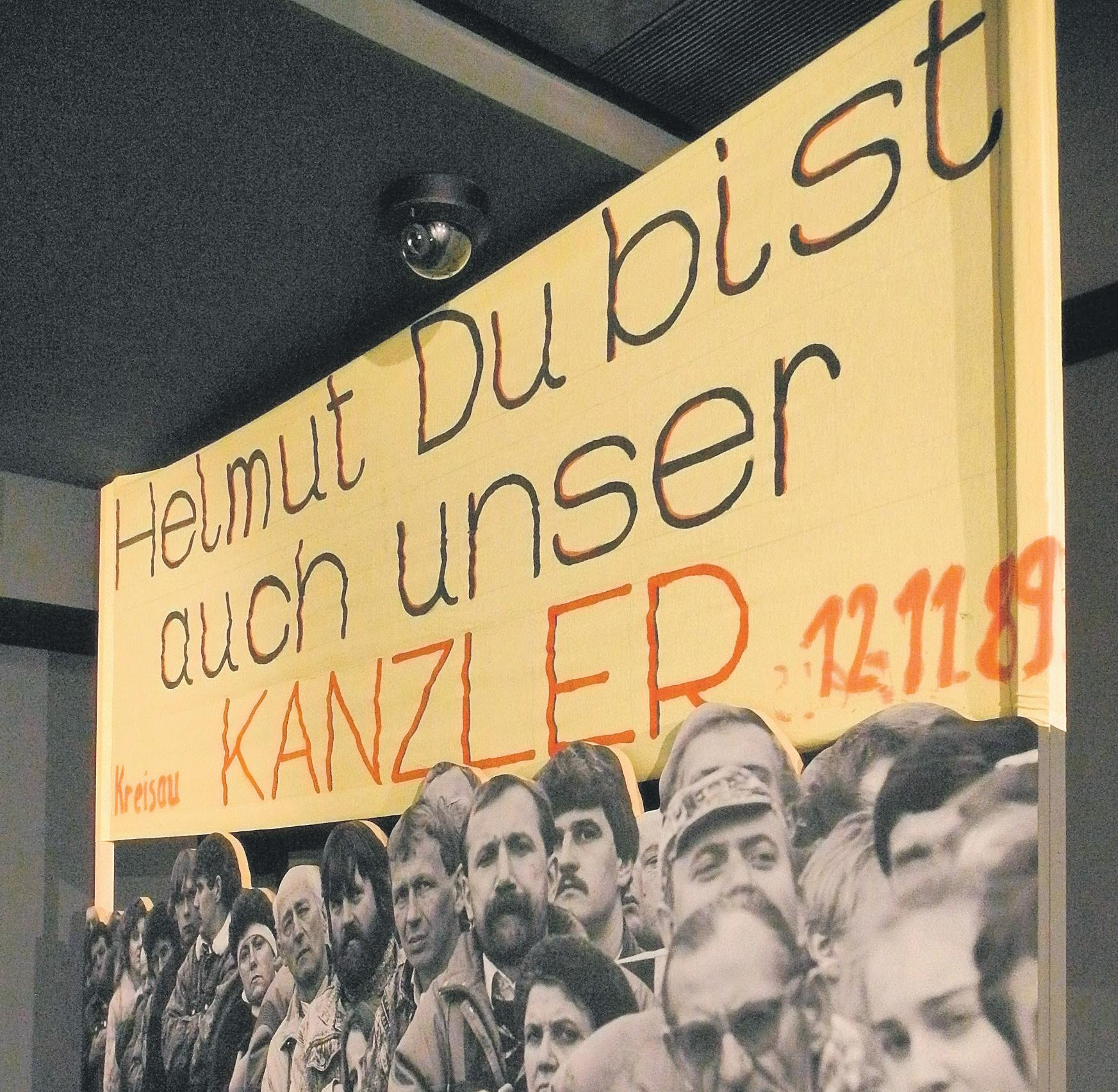
Dazu kommen Video- und Audio-Stationen mit eindrücklichen Erinnerungen von Zeitzeugen, die über das Leben als Deutscher in Polen nach 1945 berichten.
Ein weiterer Bereich der Ausstellung ist der Zeit nach 1990 gewidmet. Im Sejm von 1991 bis 1993 saßen sieben Abgeordnete der deutschen Minderheit, seit längerer Zeit ist es nur noch einer. Ein ganzer Raum widmet sich den Perspektiven und Schwierigkeiten der deutschen Minderheit heute. Es gibt auch einen Raum für Sonderausstellungen. Dort zeigt man gerade im Rahmen eines Projektes „Minderheiten im Dialog“ eine jüdische Malerin aus Breslau, die über ihre Identität als Jüdin in ihren Werken reflektiert.
Die großen Open-Air-Konzerte sind zurück: Über 60 000 Fans haben am Samstag in Prag das Konzert der britischen Rockband Depeche Mode besucht. Die Band eröffnete das Prager Konzert mit dem Song „My Cosmos Is Mine“ vom neuen Album „Memento Mori“, dem Namensgeber der aktuellen Tour. Mit zwei Millionen verkauften Tikkets ist die Tour durch Europa und Nordamerika bereits komplett ausverkauft. Die Band hat deshalb beschlossen, weitere Konzerte zu geben. So tritt Depeche Mode erneut in Prag auf, und zwar am 22. und 24. Februar in der O2-Arena.
Tschechien meldet volle Gasspeicher
Tschechiens Gasspeicher sind aktuell zu 90 Prozent gefüllt. Sie enthalten mehr als 3,1 Milliarden Kubikmeter des Rohstoffs,
Die Verleihfirma See Saw Films hat die Premiere des Films „One Life“ (Ein Leben) über Sir Nicholas Winton für September beim Filmfest im kanadischen Toronto angekündigt. Winton hatte vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs insgesamt 669 mehrheitlich jüdische Kinder aus der besetzten Tschechoslowakei nach Großbritannien gebracht und ihnen damit vermutlich das Leben gerettet. Die Hauptrollen in dem Filmdrama spielen Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter und Johnny Flynn. Börsenmakler Winton war 1938 als Ehrenamtlicher in der Jüdischen Gemeinde Prag tätig und kehrte im Januar 1939 nach Großbritannien zurück. Eine wichtige Rolle für seine Entscheidung, die Kinder in sein Heimatland zu holen, spielte das Novemberpogrom 1938, das als „Reichskristallnacht“ bekannt wurde. Den ersten Flugtransport von Prag nach London organisierte Winton am 14. März 1939.
Veto gegen Auftritt von Anna Netrebko
Der Prager Kulturstadtrat und stellvertretende Oberbürgermeister, Jiří Pospíšil (Top 09), empfiehlt dem Prager Gemeindehaus, das im Oktober geplante Konzert der Opernsängerin Anna Netrebko abzusagen. Die gebürtige Russin, die sich öffentlich von Putin nicht distanziert hat, steht wegen des Ukraine-Kriegs auf der Sanktionsliste. Der Weltstar lebt mittlerweile in Österreich und hat neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
uns freuen, auch auf deutscher Seite recht oft dieselbe Meinung zu hören.“
Der Beitrag der Deutschen zur Geschichte Polens, aber auch die wandelnde Ausdehnung Polens werden an Beispielen und multimedialen Schaumonitoren veranschaulicht. Die gesamte Beschriftung ist durchgehend Deutsch und Polnisch gehalten, sodaß die Ausstellung nicht nur eine Vergewisserung der Deutschen als Minderheit ermöglicht, sondern auch ein Angebot für die
Entfaltung ihrer Kultur und deren Weitergabe an künftige Generationen gewährt werden müsse“. Ausgestellt werden auch Listen von polnischen Bürgern deutscher Abstammung, die im Rahmen einer von Johann Kroll initiierten Aktion 1988 gesammelt wurden. Auch die Auswanderungswelle von Spätaussiedlern, insbesondere in den 1980er Jahren, wird in Zahlen dokumentiert. Zum Inventar gehört ebenfalls eine typische Auswanderungskiste, die die Dramatik an-
Auf der dritten Etage kommt der Tritt ins Freie. Eine Dachterrasse, die auch für Veranstaltungen genutzt wird, läßt einen den Blick streifen über den Mühlgraben, den Nebenarm der Oder, der das Oppelner Venedig beheimatet, hin zum Piastenturm, den letzten Rest des zwischen 1928 und 1931 abgerissenen Schlosses, der das Wahrzeichen Oppelns ist.
Kinder- und Jugendgruppen, deutsche Freundschaftskreise aus ganz Polen, aber auch Gruppen aus der Mehrheitsgesellschaft Polens gehören mittlerweile zu den Besuchern der Ausstellung. Auch Sudetendeutschen sei diese nicht sehr weit von der tschechischen Grenze gelegene Geschichtslehrstunde über die deutsche Minderheit in Polen anempfohlen. Ulrich Miksch

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Der Erhalt der sudetendeutschen Gräber in der Tschechischen Republik, der Ausbau des digitalen Angebots und ein Rückblick auf den Sudetendeutschen Tag waren die wichtigsten Themen bei der Online-Konferenz des Sudetendeutschen Heimatrates.
Als „Hochfest der Sudetendeutschen“ bezeichnete in seiner Begrüßung der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, Franz Longin, den zurückliegenden Sudetendeutschen Tag an Pfingsten in Regensburg.
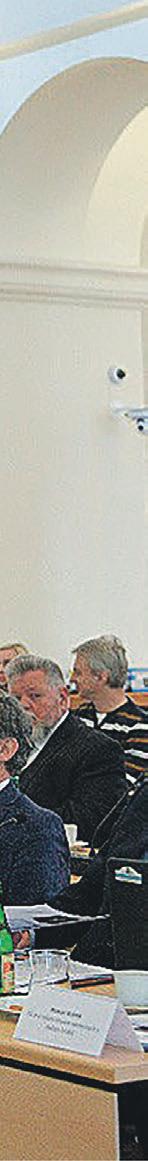
„Man hat gespürt, daß die andere Seite sich zu uns hingewendet hat, das hat mich gefreut“, sagte Longin und verwies auf die Rede des tschechischen Bildungsministers Mikuláš Bek, der als erster offizieller Vertreter einer tschechischen Regierung auf einem Sudetendeutschen Tag eine Rede gehalten hat.
Ein weiteres Thema war die digitale Präsenz, die der Bundesverband mit Homepage und Social Media vorantreibt. So gibt es seit einem Jahr den auf die Heimatlandschaften bezogenen Internetauftritt www.sudeten.net

über den Mathias Heider, der das Projekt leitet, einen Zwischenstand gab. Nach dem erfolgreichen Relaunch der Webseite der Sudetendeutschen Landsmannschaft (www.sudeten.de) werde im Herbst ein Update von www. sudeten.net mit weiteren Funktionen folgen. Neben den Daten zu Personen der Heimatkreise werden dann auch Informationen zu den Orten sowie weitere Informationen abrufbar sein.
Mitglieder des Heimatrates sollen im Vorfeld die Erweiterungen testen und gegebenenfalls Feedback geben und Korrekturen machen.

Heider wies auch darauf hin, daß die Neuanmeldungen insbesondere im Zuge des Sudetendeutscher Tags zugenommen
haben. „Das Potentzial ist vorhanden, ab Herbst erwarten wir eine Steigerung. Sudeten.net ist das am schnellsten wachsende Angebot im Vergleich zu Facebook und Instagram“, blickte er nach vorne. Das Projekt sei deshalb auch nach einem Jahr nicht abgeschlossen und werde in den kommenden Jahren weiterentwickelt. Über die verschiedenen Facebook-Gruppen und Social-Media-Aktivitäten berichtete Markus Decker, SL-Landesobmann in Hessen. „Die Entwicklungen sind über die Jahre gut dynamisch“, stellte er fest und verdeutlichte dies auch an Hand des Anteils der wachsenden Zahl an Beiträgen, Kommentaren und Reaktionen. „Aktuell gibt es neben der Netzwerkgruppe 14 Gruppen von Heimatlandschaften, von denen die zum Riesengebirge mit sieben Jahren die älteste ist, während die anderen Gruppen erst seit circa zwei Jahren präsent sind“, berichtete Decker und stellte fest: „Die Gruppen sind dynamisch unterwegs, es geht rund um die Uhr.“ Positiv ist auch, daß bislang nur eine Person gesperrt werden mußte, was den ordentlichen Umgang untereinander belege. Grundsätzlich wünschte er aber weitere Administratoren und Moderatoren der FacebookGruppen, um zeitnah und aktuell tätig werden und gegebenenfalls reagieren zu können. Als Hesse habe er eine Facebook-Präsenz der SL-Landesgruppe Hessen umgesetzt, ähnliches sähe Decker gerne für Bayern und Ba-
den-Württemberg. Etwa 25 Prozent der Gruppenmitglieder seien Tschechen. Inhaltlich ginge es vorwiegend um Termine und Veranstaltungen, Ahnen- und Heimatforschung sowie private Familieninformationen. Über sudetendeutsch-politische Themen würde man sich vor allem in der Netzwerkgruppe austauschen.
Ein wichtiges Thema für den Sudetendeutschen Heimatrat bleibt der Zustand und die Pflege der deutschen Gräber und Friedhöfe. Über die jüngsten Entwicklungen informierte Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broß-
mann. Im Nachgang zu der am 28. April im tschechischen Außenministerium in Prag stattgefundenen Konferenz zum Thema „Gräber der Deutschen und anderer Nationalitäten in der Tschechischen Republik“ berichtete Broßmann, daß die ursprünglich in kürzeren Abständen angedachten Treffen noch nicht realisiert werden konnten, weil die tschechische Gruppe zunächst Fahrten zu den Friedhöfen unternehmen wolle.

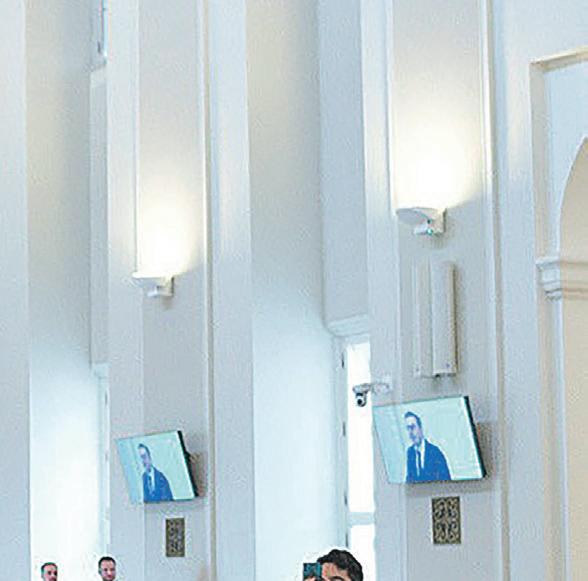



Auch das in diesem Kontext von der tschechischen Regierung in Auftrag gegebene Projekt wer-
de sich wohl noch verzögern. Der Bundeskulturreferent wies zudem auf eine in Bayreuth stattgefundene Tagung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zur Thematik „Heimatvertriebene und Heimatverbliebene –zwei Seiten der gleichen Medaille“ hin mit Teilnehmern unter anderem auch aus Polen und den baltischen Ländern.
Auch bei dieser Konferenz ging es um Gräber und Friedhöfe. „Es tut sich was in Tschechien bezüglich der deutschen Gräber. Das Thema wird aktuell und kann auch auf andere Ge-

biete übergreifen“, faßte Broßmann zusammen. Auch an die erste Jahrestagung des Beirats der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Tschechien am 14. Juli in Selb erinnerte er. Am 20. April war der Beirat gewählt worden, dem vier Untergruppen bzw. Arbeitskreise zu verschiedenen Themen zuarbeiten sollten. „In den Arbeitskreisen war zunächst kein SL-Vertreter vorgesehen“, kritisierte Broßmann. Doch es sei gelungen, in drei der vier Arbeitskreise sudetendeutsche Vertreter zu entsenden. Er selbst wirke im Arbeitskreis „Kultur“ mit, in dem die Themen Gräber, Friedhöfe, Kirchen und Denkmäler behandelt werden, zumal diese Bereiche stark in den Grenzregionen verbreitet sind.
Toni Dutz, der auch Bürgermeister von Wiesau ist, regte an, Bürgermeister in Tschechien in die Friedhofs- und Gräberthematik einzubeziehen. Da im Heimatrat heuer keine Wahlen anstehen, können bei der Jahrestagung im Herbst auf dem Heiligenhof – so Vorsitzender Longin – Sachthemen behandelt werden. Brennend sei aber auch die Suche nach Ortsund Kreisbetreuern. Zu diesem Punkt gab es seitens der Mitglieder mehrere Diskussionsbeiträge. So soll überlegt werden, wie man den Nachwuchs für diese wichtige Aufgabe motivieren könnw.

„Wichtig ist auch, die Museen und Heimatstuben zu retten. Corona hat die Situation verschärft“, fügte dazu Decker an. Broßmann nannte schließlich drei Aspekte, die es zu beachten gelte: die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die geschichtliche Dimension und das Wirken auch hinsichtlich der Leute in Tschechien. Der Bundeskulturreferent: „Die Arbeit erfolgt hüben und drüben.“ Markus Bauer

❯
Landesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern in Erding

Völkerverständigung und die Unterstützung einer gerechten Aufarbeitung der Geschichte sind zwei Seiten der selben Medaille, hat Steffen Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern, auf der Landesversammlung in Erding den eingeschlagenen Kurs erneut bekräftigt.
In seiner Rede stellte Hörtler vor allem die Klausurtagung in Südtirol und die große Beteiligung am Brünner Versöhnungsmarsch heraus: „Es ist gehörig Bewegung in unserer SL-Arbeit und vor allem: Wir kommen in unseren heimatpolitischen Anliegen sichtbar und spürbar voran.“
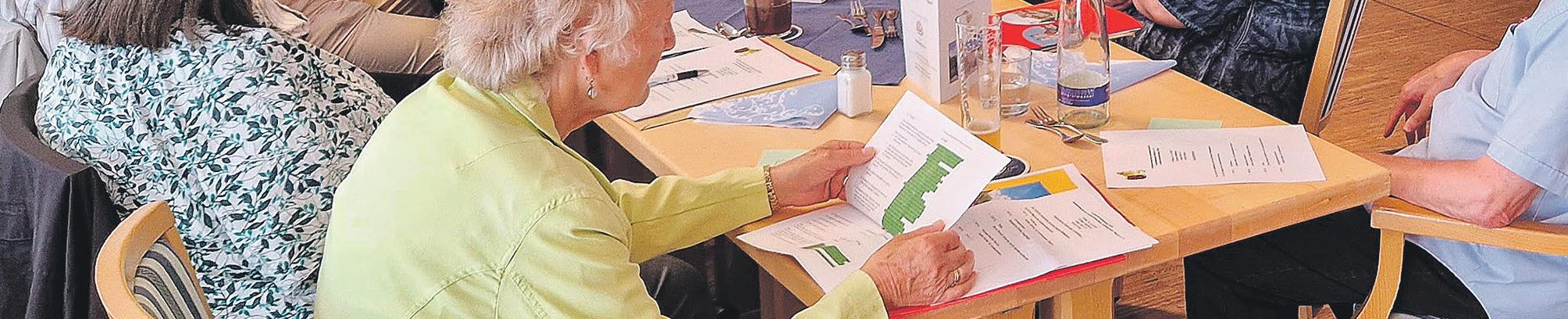


Bewußt habe man sich in diesem Jahr entschieden, die Landesversammlung in Erding stattfinden zu lassen, da hier die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen, Ulrike Scharf, daheim ist.
Im Erdinger Weißbräu, dem Stammhaus der weltberühmten Weißbierbrauerei, die seit 1886 im Familienbesitz ist, konnte Hörtler dann neben der Staatsministerin auch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt (siehe unten), und Werner Brombach, den Inhaber von Erdinger Weißbräu, begrüßen.
In Anbetracht des russischen Überfalls auf die Ukraine sei, so der Landesobmann in seinem Rechenschaftsbericht, die Arbeit aller Landsmannschaften, die Kontakte mit den Staaten und den Menschen in Mittel- und Südosteuropas pflegten, heute wichtiger denn je. Die Hoffnung, daß ukrainische Kriegsflüchtlinge schnell wieder in ihrer Heimat zurückkehren können, habe sich im Laufe des Jahres als Trugschluß erwiesen. „Dieser furchtbare Krieg tobt leider weiter“, bedauerte Hörtler.
Rückblickend auf das erste Halbjahr 2023 sagte Hörtler, der Versöhnungsmarsch in Brünn sei mittlerweile „die wichtigste heimatpolitische Maßnahme in der Heimat“. Der Landesobmann: „Diese Begegnung findet auch in der tschechischen Öffentlichkeit ein immer größeres positives Echo.“
Beeindruckend sei auch die Klausurtagung des Landesvorstandes in Südtirol gewesen. So wurden die Sudetendeutschen im Südtiroler Volksgrup-
peninstitut vom Ehrenpräsidenten und Karls-Preisträger Christoph Pan zu einem intensiven Austausch empfangen. Politischer Höhepunkt war der Empfang durch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher im Landeshaus am SilviusMagnago-Platz in Bozen.
Die Landesgruppe Bayern habe, so Hörtler, mittlerweile ein großes Netzwerk aufgebaut und arbeite aktiv in verschiedenen Organisationen mit, so im Bund der Vertriebenen, in der Paneuropa-Union, der Bayerischen Einigung, der ARGE Grenzlandturm in Neualbenreuth und im Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerk. Die Landesgruppe sehe sich zudem als „Partner der demokratischen Parteien“. Hervorragende Verbindungen bestünden außerdem mit dem Tschechischen Generalkonsulat in München, der Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin und mit der Deutschen Botschaft in Prag. Botschafter Andreas Künne sei ein wichtiger und treuer Partner der Sudetendeutschen in Tschechien, so Hörtler.
Ein weiteres wichtiges Projekt sei die Erfassung der Vertriebenendenkmale in Bayern. Dieter Heller, der das Projekt federführend verantwortet, sei es gelungen, auch die Vertriebenenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Sylvia Stierstorfer, „mit ins Boot zu holen“ und über diese Kooperation die bayerischen Heimatpfleger für das Thema zu sensibilisieren: „Das Ziel ist klar: Uns geht es darum, daß die Denkmale langfristig im Erhalt gesichert sind.“
Zum Abschluß seines Rechenschaftsberichtes dankte der Landesobmann seinem gesamten Vorstand für die allzeit loyale und freundschaftliche Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank ging an die Fachreferentinnen. Dr. Sigrid Ullwer-Paul hat die Landesfrauentagung zu einem wichtigen Termin nicht nur im Terminkalender der Volksgruppe, sondern auch in der Patenstadt der Sudetendeutschen, der Stadt Regensburg, gemacht, wo die Frauentagung regelmäßig stattfindet. Die Fachvorträge und auch das kulturelle Rahmenprogramm sind jedes Jahr so attraktiv, daß sich selbst Bischof Dr. Rudolf Voderholzer es sich nicht nehmen läßt, daran teilzunehmen.
Landeskulturreferentin Margaretha Michel bringt zweimal jährlich unter dem Titel „Dischkurieren“ einen interessanten und vielseitigen Kulturbrief heraus. Dieser wird über die Volksgruppe hinaus von Experten und Interessierten sehr geschätzt. Michel leistet auch großartige Kulturarbeit über die Grenzen hinweg. All diese kulturellen und heimatpolitischen Aktivitäten bedürfen allerdings einer soliden finanziellen Grundlage. Diese Voraussetzungen leistet in einer immens wichtigen Arbeit die Landesfinanzreferentin Hannelore Heller. Wie jedes Jahr wurde ihr Kassenbericht einstimmig genehmigt. Ein wichtiger Tagungsordnungspunkt war die Anpassung der Satzung der Landesgruppe. Zum einen waren Änderungen erforderlich, da der Paragraf 3 (Zweck) der Bundessatzung rechtskräf-
❯ Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe auf der Landesversammlung der SL Bayern in Erding


tig ist; zum anderen ging es um die Anpassung des Delegiertenschlüssels von 100 auf 25 Mitglieder. Damit ist in Zukunft einer höheren Anzahl an Landsleuten die Möglichkeit eröffnet, die grundsätzlichen Entscheidungen der Landesgruppe in der Landesversammlung mitzubestimmen. 85 Prozent der Delegierten stimmten für die Satzungsänderungen.
Unter den Gästen der Landesversammlung waren Heimatpflegerin Christina Meinusch, Bundeskulturreferent Ulf Broßmann, ein Team vom Heiligenhof sowie Abordnungen der Wischauer, der Böhmerwäldler und der Kuhländler in ihren Trachten.
Traditionell hatte die Landesversammlung mit einem Geistlichen Grußwort begonnen, das der örtliche Stadtpfarrer Martin Garmaier sprach. Der Geistliche hob hervor, daß Vertreibungen von Volksgruppen sich leider bis heute „wie ein roter Faden“ durch die Geschichte zögen. Alttestamentarisch erinnerte er an die Israeliten, die nicht nur einmal vertrieben wurden. Am Schluß seiner Worte gedachten alle der Verstorbenen der Volksgruppe mit einem „Vaterunser“.
Einen besonderen Auftritt hatte Eberhard Heiser. Als dienstältester Stellvertreter gratulierte er im Namen aller Landsleute dem Landesobmann zu seinem 50. Geburtstag, den Steffen Hörtler erst vor kurzem mit vielen Gästen auf dem Heiligenhof gefeiert hatte.
Andreas Schmalcz/Frank Altrichter
Auf der Landesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, MdEP a. D. Bernd Posselt, in seiner Rede die starke Stellung der Sudetendeutschen als vierten Stamm in Bayern unterstrichen und die positiven Entwicklungen im deutschtschechischen Verhältnis gelobt.
Posselt, dem die Verbindung von Europa und Heimat seit jeher am Herzen liegt, zitierte in seiner Rede den ersten tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der Europa einmal als Heimat der Heimaten definiert hatte. Außerdem spannte er einen weiten sudetendeutschen Bogen von Argentinien bis Waldkraiburg.
Vor über zwanzig Jahren, so erzählte Posselt, habe er Landsleute in Buenos Aires besucht, deren Vorfahren in den 1920er Jahren nach Argentinien ausgewandert waren. Dort wurde er auch mit Emilie Schindler bekannt gemacht, der Witwe des am 28. April 1908 im mährischen Zwittau geborenen Oskar Schindler, dessen Todestag sich im nächsten Jahr am 9. Oktober zum 50. Mal jährt.
In einem intensiven Gespräch, so Posselt, sagte die damals schon hochbetagte Dame plötzlich, sie wolle heim. Doch wo ist dieses „daheim“? Ihre alte Heimat Nordmähren war es nicht mehr, auch Deutschland als Ganzes war es nie gewesen. So fand man die Lösung, Emilie Schindler den Lebensabend im Adalbert-Stifter-Heim in Waldkraiburg, der sudetendeutschen Altersresidenz, verbringen zu lassen. Leider sah sie Waldkraiburg nicht mehr lebend, auf dem
Weg dahin verstarb sie in Berlin. Aber ihre letzte Ruhestätte ist nun dort, wo viele Sudetendeutsche nach der Vertreibung eine neue Heimat gefunden haben. Weiter in seiner Rede ging Posselt auf die vielen positiven Entwicklungen im deutsch-sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis ein, wie den Besuch des tschechischen Premierministers Peter
Fiala in Regensburg aus Anlaß der Eröffnung der Bayerisch-Böhmischen Landesausstellung und die Eröffnung der Deutsch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb mit Staatspräsident Petr Pavel.

Der Volksgruppensprecher unterstrich auch die Bedeutung der Sudetendeutschen in der deutschen Politik. In keinem anderen Bundesland, schon gar
Ende Juli erlebte ich im Hörsaal des Münchener Botanischen Gartens die Freisprechungsfeier eines meiner jungen Mitbrüder zum Gärtnergesellen. Wir haben in unserer Ordensgemeinschaft nicht nur Patres für den geistlichen Dienst, sondern auch Brüder, die sich einem Beruf widmen oder in verschiedenen praktischen Bereichen unserer Klöster tätig sind. Bruder Klaus absolvierte in den letzten Jahren seine Lehre in unserer überregional bekannten Klostergärtnerei in Gars am Inn. Dort wird er auch weiterhin arbeiten. Mit Genugtuung stelle ich als sein Ordensoberer fest: In diesem Beruf ist er in seinem Element.
Das bringt mich heute auf die folgenden Gedanken: Eigentlich sehnt sich jeder Mensch danach, in seinem Element zu sein. Das gilt beruflich genauso wie auf der Beziehungsebene. Wenn jemand im richtigen Element ist, kann er aufblühen. Das Leben macht ihm Freude. Es gelingt. Ein Hauch von „Leben in Fülle“, wie es Jesus im Johannesevangelium verspricht, ist dann möglich. Es lohnt sich deshalb, darüber nachzudenken, was ich für mein Dasein brauche, um in meinem Element zu sein. Gerade der Sommer mit seinen Erholungszeiten bietet dazu eine besondere Gelegenheit.
Das richtige Element hilft uns, so sagte ich, aufzublühen. Jetzt im Sommer erfreue ich mich besonders an den Sonnenblumen, die in Gärten und auf Feldern blühen. Sicher geht es nicht nur mir so. Die Sonnenblume braucht nicht viel Pflege. Aber sie braucht die Sonne und mit der Sonne Licht und Wärme. Sie ist so sehr auf diese Elemente angewiesen, daß sie sich im Laufe eines Tages mit ihrem gelbfarbigen Blütenkopf immer dorthin wendet, wo die Sonne scheint. Wenn sie Licht und Wärme hat, ist sie in ihrem Element. So ist sie ein Symbol für unsere menschliche Existenz.
Niemand lebt gerne im Schatten oder in der Dunkelheit. Wir sehnen uns nach Wohlwollen, Güte, Barmherzigkeit, nach Vertrauen, Anerkennung, Aufmerksamkeit und Dankbarkeit, mit einem Wort: nach Liebe. Sie ist für uns wie die Sonne, die für die Sonnenblume lebensnotwendig ist. Wo auch immer wir Liebe und all ihre wunderbaren Begleiterscheinungen spüren, werden wir uns dorthin wenden. Dann sind wir wahrhaft in unserem Element. Dann geht es uns gut. Dann können wir aufblühen und wie von selbst, ebenfalls der Sonnenblume gleich, Freude verstrahlen.
nicht auf Bundesebene, hätte die Volksgruppe einen so guten Stand wie im Freistaat Bayern, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Posselt lobte in diesem Zusammenhang die hervorragende Arbeit der Landesgruppe Bayern unter Obmann Steffen Hörtler, die daran einen maßgeblichen Anteil hätte, und sicherte der Landesgruppe weiterhin seine volle Unterstützung zu. AS/FA
Ein Mitbruder, der kürzlich mit 102 Jahren starb und wie Bruder Klaus in unserer Garser Klostergemeinschaft lebte, wurde einmal nach seiner persönlichen Lebensweisheit gefragt. Seine Antwort: „Dem Herrgott vertrauen, das Beten nicht vergessen und mit guten Menschen zusammen sein.“ Die dritte Aussage ließ mich aufhorchen. Natürlich sind Gottvertrauen und Beten von grundsätzlicher Bedeutung. Aber wir sollten nicht vergessen, daß wir uns gute Menschen suchen, die uns liebevoll und wertschätzend begegnen. Dann können wir uns wie die Sonnenblume von allem Schattenhaften und Dunklen abwenden. Dann sind wir im richtigen Element.
 Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen
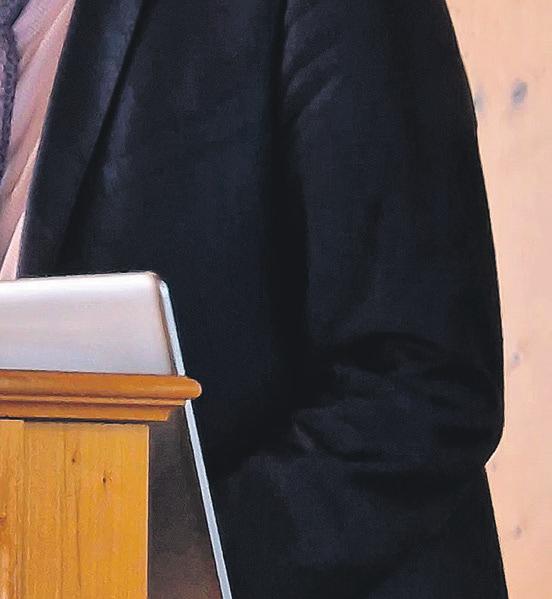

Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
� Gedenkmesse für Felicitas Hart
Grenzen überschreiten und Versöhnung leben: Darauf war das Leben der Waldsassener Unternehmer-Persönlichkeit und überzeugten Europäerin Felicitas Hart ausgerichtet. Dieser Grundsatz prägte auch das grenzüberschreitende Requiem im Juli in der Stiftsbasilika im oberpfälzischen Waldsassen
Pilsens Altbischof František Radkovský, Dekan Thomas Vogl, Pfarrer Ferdinand Kohl und Pfarrvikar Gerald Obumneke Nwenyi feierten die Messe. Musikalisch umrahmt vom Basilika-Chor unter Kirchenmusikdirektor Andreas Sagstetter, schlugen bereits die Klänge des böhmischen Komponisten Jan Nepomuk Škroup eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Den Kirchenzug begleitete die Stadtkapelle Waldsassen unter Franz Bartel. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Kirche dies- und jenseits der Grenze waren unter den Gästen. Dekan Vogl verknüpfte in seiner Predigt das Hohe Lied der Liebe aus der Lesung mit der griechischen Philosophie, der Liebe in ihren drei Erscheinungsformen Eros, der körperlich-leidenschaftlichen Hingabe, Agape, der seelischen Verbindung, auch zu Gott, und Philia, der freundschaftlichen Zuneigung zu den Mitmenschen. Insbesondere die Philia habe Felicitas Hart verkörpert. Zeitlebens sei sie dies- und jenseits der Grenze europäische Brückenbauerin gewesen, habe in ihrem Haus europäische Gastfreundschaft gepflegt, lebendiges Wissen geschätzt, Kraft aus ihrem tiefen Glauben und Inspiration aus Philosophie, Kunst und klassischer Musik geschöpft. Als tiefgläubige Christin sei sie überzeugt gewesen, daß nur bei Gott die Seele zur ewigen Ruhe gelange. Im Leben stellte sich Felicitas Hart stets den Herausforderungen. Nach dem Abitur wollte sie lieber Medizin oder Germanistik als Betriebswirtschaftslehre studieren. Doch der Verlust ihres Bruders Hanns 1945 nach russischer Gefangenschaft führte sie nach München, wo sie als eine der ersten Frauen Be-
triebswirtschaftslehre studierte, um das elterliche Unternehmen mitzuführen. Das Studium Generale ermöglichte ihr, entsprechend ihrer Neigung zusätzlich die theologisch-philosophischen Vorlesungen Romano Guardinis zu besuchen. Nach dem Tod ihres Vaters Josef Steiner führte sie die Brauerei mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreich weiter. Sie blieb zeitlebens ihrem Leitspruch „Amor vincit omnia“ treu und vollbrachte mit ihrem Mann Anton ein großes Lebenswerk.
Bischof Radkovský würdigte Felicitas Hart als leuchtendes Vorbild. Gerade in den heute so bewegten Zeiten der Kirche brauche es mehr Vorbilder wie sie. Volksgruppensprecher Bernd Posselt würdigte Felicitas Hart auch im Namen des Oberbürgermeisters von Eger als eine der letzten Zeitzeuginnen der Euregio Egrensis.

Seit dem ersten Zusammentreffen zwischen ihm und der Familie Hart anläßlich des SL-Wirtschaftspreises sei man eng ver-
tas Hart habe diese tiefe Überzeugung, die ihr Ehemann Anton Hart zeitlebens praktiziert und vorgelebt habe, geteilt und unterstützt.
Nach seinem Tod 2004 habe Felicitas Hart mit ihrem Sohn Luis-Andreas diesen Geist bis zuletzt 2022 im Sinne der Völkerverständigung und Völkerversöhnung in die Sudetendeutschen Tage eingebracht. Ganz besonders habe sie sich gefreut, daß durch ihr Engagement ein Abbild der Wallfahrtskirche Maria Loreto einen würdigen Platz im neuerbauten Sudetendeutschen Museum in München gefunden habe. Vor allem habe sie sich dafür engagiert, daß als Höhepunkt des ersten grenzüberschreitenden Sudetendeutschen Tags 2022 die Messe in Maria Kulm stattgefunden und an der sie teilgenommen habe.

Posselt: „Ich verneige mich vor Felicitas Hart als großartige Zeitzeugin der Euregio Egrensis, als eine von christlichen Wer-
sellschaft 1519 Waldsassen würdigte Felicitas Hart als die stets sympathisch-bescheidene, zutiefst menschliche und dennoch starke Frau im Hintergrund von Anton Hart. Bruno Salomon vom Förderverein Maria Loreto dankte Felicitas Hart als engagiertem Gründungsmitglied. Mit Sachverstand und intellektueller Fähigkeit, mit Organisationstalent und Gastfreundschaft habe sie den Wiederaufbau der Wallfahrtskirche, vor allem die künstlerische Ausgestaltung, aktivkreativ begleitet.
Beim anschließenden Empfang in der Aula des Klosters Waldsassen hieß Luis-Andreas Hart die Gäste im Sinne seiner Mutter willkommen, die eigentlich dort ihren 95. Geburtstag mit Freunden in großer Dankbarkeit habe feiern wollen. Denn nachdem sie vor einigen Jahren wie durch ein Wunder eine Operation im Deutschen Herzzentrum München überlebt habe, sei sie um so mehr vom tiefen Glauben und der Überzeugung geprägt gewesen, daß es auch heute noch Wunder gebe.
Während des Empfangs untermauerte Luis-Andreas Hart mit Bildern ihren geglückten Lebensweg, insbesondere die von spirituellen Fügungen geprägte Zeit am Tegernsee. Nicht nur dort habe sie regelmäßig an den kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen und täglich im Fitnesscenter trainiert. Bis zuletzt sei sie geistig und körperlich vital gewesen, bis eine unglücklich verlaufende ärztliche Erstversorgung ihr Leben, ihre Vision und Mission plötzlich und unerwartet beendet habe.
bunden gewesen. Als engagierte Europäerin sei es ihr, so Posselt, bis ins hohe Alter ein tiefes Anliegen gewesen, die Besucher der vielen kulturellen, gesellschaftlichen Veranstaltungen für den europäischen Versöhnungsgedanken zu begeistern. Felici-
ten getragene unternehmerische Persönlichkeit, die Völkerversöhnung vorbildlich lebte und prägte. Aus tiefstem Herzen und innerster Überzeugung war sie Europäerin.“
Helge Döll von der Königlich Privilegierten Schützenge-
Luis-Andreas Hart: „Wir gedenken Felicitas Hart als erfolgreicher Persönlichkeit, als einer der letzten Zeitzeuginnen der Euregio Egrensis. Mit ihrem von christlich-sozialen Werten getragenen, unternehmerischen Wirken an der Seite ihres Mannes Anton Hart hat sie den europäischen Versöhnungsgedanken mitgeprägt. Ihre gemeinsamen Spuren in der Euregio Egrensis sind und bleiben paneuropäisch präsent, weit über die Grenzen der Region hinaus.“ sst

Am 13. August feiert Marie-Luise Kotzian, Pionierin und musisches Multitalent mit Eghalanda Wurzeln, im bayerischschwäbischen Augsburg 75. Geburtstag.
Frostige Stimmung? Wenn Marie-Luise Kotzian kommt, beginnt Tauwetter. Das beginnt bereits 1947: Ihr Vater, ein 1946 aus dem eghalandrischen Ort Steinbach im Kreis Falkenau vertriebener Architekt, strandet im bayerisch-schwäbischen Vöhringen. 1947 heiratet er die Vöhringerin Pia Häger. In einer Zeit, als die Stimmung gegenüber den Vertriebenen frostig ist, ist die Geburt Marie-Luises ein frühes Zeichen des beginnenden Tauwetters zwischen Einheimischen und Neubürgern.
Wie ihr Vater ergreift MarieLuise den Beruf des Architekten. Außerdem engagiert sich die perfekt Zweisprachige – schwäbisch und eghalandrisch – bei der SdJ und der DJO. Bald steigt sie in höhere Positionen auf und wird Mädelführerin. Bei einem Fackelzug lernt die 17jährige
den gleichaltrigen Ortfried Kotzian – dessen Wurzeln in Hohenelbe im Riesengebirge liegen – kennen. „Das ist die Richtige“, denkt sich Kotzian, der später das Bukowina-Institut in Augsburg und das Haus des Deutschen Ostens in München leiten wird sowie heute als Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung das Sudetendeutsche Museum in München überwacht.
Sie heiraten 1970.
Marie-Luise verdient als Architektin Geld, Ortfried studiert und promoviert. 1973 kommt Ruth-Maria zur Welt, heute Grundschulrektorin im bayerisch-schwäbischen Friedberg, verheiratet mit Christian Geier und Mutter von Paul und Simon. Ihr folgt 1976 Iris Marie, heute mit Stefan Beierl verheiratete Sopranistin und Mutter des gemeinsamen Sohns Josef. Die jüngste Tochter Heidelinde wird 1979 getauft. Sie ist mittlerweile Diözesanreferentin der Diözese Augsburg.
2024 wird Marie-Luise im 50. Jahr Klöppelkurse leiten. Sie beginnt damit, als Klöppeln noch verpönt ist und wenige Leute wissen, worum und wie es geht. Auch hier heizt sie dem trennenden Eis ein und beschert Tauwetter. Ebenso bemerkenswert sind ihre Landkarten. Als noch keine Drohne die Heimat vermessen kann, zeichnet sie Karten der Minderheiten und Volksgruppen sowie die Siedlungsgebiete der Deutschen in Ost- und Südosteuropa, die die Bundeszentrale für Politische Bildung nachdruckt. Wieder leistet sie Pionierarbeit. Sie gestaltet und begleitet Ausstellungen des Bukowina-Instituts und ist Redakteurin von Ausstellungskatalogen. Das musische Multitalent besucht auch Kurse bei dem österreichischen Kunstprofessor Heribert Losert, dessen Wurzeln im mährischen Troppau liegen.
„Als wir vor fünf Jahren 70 Jahre alt wurden, wollten die Kinder unbedingt mit Ortfried und mir
die Heimat besuchen. Heuer tun wir das wieder. In wenigen Tagen fahren wir – 13 Mann und ein Hund – ins Riesengebirge“, erzählt sie.
Auch Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert: „MarieLuise Kotzian ist eine Frau, die modern und traditionsbewußt, humorvoll und kämpferisch, freundlich und durchsetzungsstark für unsere Volksgruppe, in der sie durch ihre Herkunft und ihre Heirat verwurzelt ist, eintritt. Die Palette ihrer Tätigkeiten reicht von Klöppelkursen bis zur kompetenten Mitwirkung in heimatpolitischen Gremien. Ihr ist auch zu verdanken, daß nicht nur ihr Mann Ortfried, sondern auch die nächste und die übernächste Generation ihrer Familie unsere Reihen nicht nur verstärken, sondern kulturell beleben und erneuern. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen viel Glück, Gesundheit und Gottes reichen Segen.” Die Landsleute gratulieren einer wunderbaren Eisbrecherin und nachgeborenen Egerländerin, die ihnen Tauwetter beschert. Nadira Hurnaus
Ende Juli feierten das Sudetendeutsche Musikinstitut und die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste den 80. Geburtstag von Dietmar Gräf (Þ SdZ 23/2023), des aus Marienbad stammenden Trägers des Sudetendeutschen Kulturpreises 2001, im Sudetendeutschen Haus in München mit einem rauschenden Konzert.
Bevor irgendwer irgendetwas sagte, spielte das Stuttgarter Ensemble „Malinconia“ die Dietmar-Gräf-Komposition „De Melancholia a gioa“ für Klaviertrio.
Erst danach begrüßte AkademiePräsident Günter J. Krejs die Gäste.

Unter ihnen waren Gräfs Patensohn Serafín Unglert mit Schwester Fiorenza und Mutter
Manuela, Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann mit seiner Frau Hildegard, Michael Henker vom Sudetendeutschen Museum, Walter RösnerKraus, Vorsitzender des Akademie-Kuratoriums, Paul Hansel, lange Jahre Ministerialdirigent im Schirmherrschaftsministerium und gegenwärtig Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes
Oberbayern, Armin Rosin, Träger des Großen Sudetendeutschen Kulturpreises 2003, Wolfram Hader, Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises 2019, Stefan Samerski, Kirchenhistoriker und seit 2018 Vizepräsident der Akademie, Hansjürgen Gartner, mit seinem Zwillingsbruder

Joachim Lothar Träger des Großen Sudetendeutschen Kulturpreises 2018, Monsignore Karl Wuchterl, ehemaliger Visitator für die Seelsorge an den Sudetendeutschen und Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, Ingrid Sauer, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv für das Sudetendeutsche Archiv zuständig, Dolmetscherin Grudrun Heißig mit ihrem Mann, dem Paläontologen Professor Kurt Heißig,
für Dietmar Gräf, Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises 2001
und Wolfgang Freytag, Ministerialrat im Schirmherrschaftsministerium. Dieser überbrachte die Glückwünsche der Bayerischen Staatsregierung und der Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf.
Bevor Laudator Andreas Wehrmeyer, Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts, sprach, spielte „Malincoina“
Franz Schuberts Stück „Heimat“ für Violoncello und Klavier und Dietmar Gräfs Sonate „Mythos des Sisyphos“ für Violine und Klavier. Aus der Laudatio: „Von Marienbad verschlug es die Familie nach der Flucht Ende 1945 ins oberfränkische Bayreuth. Gräfs Vater, der Solotrompeter im Marienbader Sinfonieorchester war, mußte von nun an den Lebensunterhalt mit Tanz- und Unterhaltungsmusik bestreiten.“
Mit fünf habe Gräf Schlagzeug, mit neun Violine, mit zehn Klavier, und mit zwölf Jahren Trompete zu spielen begonnen. Nach Handelsschule und Drogistenlehre habe Gräf die Kirchenmusikschule in Regensburg besucht und Abitur am Abendgymnasium gemacht. Mit 23 Jahren sei er Musiklehrer im Internat Etterzhausen der Regensburger Domspatzen, zwei Jahre später Domkapellmeister in Eichstätt geworden. „Doch für einen künstlerischen Freigeist wie Gräf, der sich nicht widerstandlos kirchlichen Autoritäten zu beugen gewillt war, konnte das nur eine Zwischenstation sein.“ Er habe Schulmusik in München und das Konzertfach Or-
gel in Würzburg studiert. Am meisten habe ihn der aus Karlsbad stammende Pianist, Organist und Komponist Oskar Sigmund geprägt. In München habe er in Musikwissenschaft, Didaktik der Musik und Pädagogik promoviert. Zwei kapitale Buchpublikationen seien „Die Veränderbarkeit der Einstellung zur Musik durch Werkanalyse“ und „Der Choral Gregors des Großen“. Zudem habe er an der Schulbuchreihe „Spielpläne Musik“ für Gymnasien mitgewirkt. Gräf sei Schulmusiker an Gymnasien in München, Bamberg und Mindelheim gewesen und habe Lehraufträge an der Universität München gehabt. Er leite den von ihm ins Leben gerufenen Förderkreis für Symphonie- und Kammerkonzerte sowie den überregional bekannten Chor „Musica Sacra“ in Bad Wörishofen. Er habe mehrere Kammermusikensembles initiiert, sei Gastdirigent namhafter Symphonieorchester gewesen und habe viele Jahre als Intendant und Musikalischer Leiter des KneippMusik-Festivals in Bad Wörishofen gewirkt. Gräf habe ein facettenreiches, mehr als 500 Werke umfassendes kompositorisches Œuvre geschaffen. „Gräf ist in der Fülle


seiner Begabungen und Tätigkeiten schwer auf einen Nenner zu bringen, ein schnelles Resümee verbietet sich. Nicht einen Lebenslauf gebe es von ihm, wie er mir einmal sagte, sondern eine Auffächerung in X-Lebensläufe – als Komponist, als Dirigent, als Pianist, als Pädagoge, als Wissenschaftler und als Mensch. In der Summe all dieser Besonderungen ist er ein viel gefragter Zeitgenosse, und so kennen wir ihn alle als Tatmenschen, als den hurtig von Ort zu Ort Eilenden – und weniger Weilenden.“ Das heiße nun aber nicht, daß es dem Schöpfer Gräf an innerer Sammlung und Einkehr mangele. Im Gegenteil: Nirgends gebe es Beliebiges, Zerfransendes. Gräfs Schaffen sei geerdet und reflexionsgesättigt. Er setze sich wohlbegründete Vorgaben, wie etwa die Prädisposition des Tonmaterials in modalen Strukturen zeige. Nur als Ausgang, nicht als Ziel. Entscheidend sei der freie, undogmatische, ja sogar spielerische Umgang mit derlei Strukturen. Das Gesetzte schaffe sich insoweit seine Widerstände selbst.
„Konstruktion und Ausdruck, Theorie und musikalische Praxis gehören für Gräf aufs Engste zusammen. Es ist eben die-
se spannungsreiche Vielfalt, die das Schaffen von Dietmar Gräf so anspruchsvoll einerseits, so attraktiv, ja sinnlich andererseits macht.“
Nach dieser Würdigung spielte „Malinconia“ Widmar Haders Ballettmusik „Trauertanz. Hommage an Käthe Kollwitz“ für Violine, Klavier und Violoncello und gab die Uraufführung von Franz Ludwig Marschners „Trio“ in c-Moll op. 30 für Klavier, Violine und Violoncello.
Doch nachdem Akademiepräsident Günter J. Krejs das Geburtstagskonzert beendet und zum anschließenden Geburtstagsempfang entlassen hatte, verlangte das Publikum eine Zugabe, und zwar vom Geburtstagskind. Und das bot mit dem mexikanischen „Jarabe Tapatío“ ein fulminat rasendes Finale.
Jarabe heißt Sirup und ist ein mexikanischer Tanz mit mehreren Teilen, wechselnden Taktarten – hier 6/8, 2/4 und 3/4 –und Tempi. Tapatío werden die Menschen aus Guadalajara, der zweitgrößten mexikanischen Stadt, genannt. Von dort stammt „Jarabe Tapatío“. Die US-Amerikaner brachten nach dem Krieg die gekürzte und verfälschte Version „Mexican Hat-Dance“ nach Deutschland.
Gräf erklärte Ulf Broßmann später: „Da wurde zum Beispiel aus dem 6/8-Takt ein 2/4-Takt gemacht. Nicht so wirkungsvoll, nicht so attraktiv. Alle Aufnahmen, Interpretationen oder Improvisationen, die ich kenne, sind zu langsam. Alles ist dem europäischen Unterhaltungsmusik-
Geschmack angepaßt. Meine Version beruht auf dem Vorspiel meines mexikanischen Studienkollegen und Freundes Felipe Ramírez. Er wurde immerhin Domorganist und Professor für Orgel und Komposition am Konservatorium in Santiago de Querétaro. Ich habe das Stück nach Gehör aufgeschrieben und die Begleitung bis heute dazu improvisiert. Meines Erachtens ist dies die beste nach Deutschland gebrachte Version, die allerdings nirgends gedruckt ist. Es gibt auch keine gute beziehungsweise gar keine Aufnahme.“
Dieses Stück dokumentiert eine weitere Facette der von Wehrmeyer genannten spannungsreichen Vielfalt des Dietmar Gräf. Zeitlebens befaßte er sich mit der Volksmusik fast aller Herren Länder wie China, Japan, Indien, Afrika, Israel, dem islamisch-arabischen Raum, Andalusien, Portugal, Ungarn oder Böhmen.
Gräf: „Jedes Land ist fast eine Welt für sich, alles ein Faß ohne Boden. Man denke nur an die vielen verschiedenen Rhythmen, Harmonien, Instrumente und vor allem Tongeschlechter oder Modi, Improvisationen und so weiter. Das meiste an ethnologischer außereuropäischer Musik ist bis heute mündlich überliefert. Hinzu kommt die oft schwierige Grenze zwischen Volksmusik, volkstümlicher Musik, Folklore oder ethnologischer Musik, alles mit Hunderten von Arten und Unterarten.
In Ungarn gibt es beispielsweise Volksmusik des niederen und höheren Adels, der ,Zigeuner‘, der Städter und die Musik der Bergbauern. Deren rund 20 000 Lieder, Instrumentalstükke und Tänze haben Zoltán Kodály und Béla Bartók mühselig erforscht. Nicht vergessen darf man darüber hinaus die mannigfaltige Volks-Kirchenmusik.“
Wir wünschen uns noch viele Dietmar-Gräf-Geburtstagskonzerte. Da Capo! Encore! Zugabe! Nadira Hurnaus
Ende Juli verlieh Albert Fürakker MdL, Bayerischer Staatsminister für Heimat, im Heimatministerium im mittelfränkischen Nürnberg der gebürtigen Böhmerwäldlerin Inge Schweigl einen der neun Bayerischen Dialektpreise 2023.
Der mit je 1000 Euro dotierte Preis würdigt besondere regionale Verdienste im Bereich Dialektpflege und Dialektforschung. Für jeden Regierungsbezirk, also für Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben ist eine Auszeichnung vorgesehen. Zusätzlich gibt es einen Preis für die Mundartpflege der Sudetendeutschen, des Vierten Stammes, sowie einen Sonderpreis.



Christina Meinusch, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, hatte die 1939 geborene Inge Schweigl für den Preis vorgeschlagen. Der Wortlaut ihrer Begründung: „Inge Schweigl wurde als siebenjähriges Mädchen aus Krummau/Český Krumlov im Böhmerwald vertrieben. Sie gehört zu den wenigen noch lebenden Mundartsprechererinnen und Mundartsprechern, die ihren Dialekt noch in der Heimat gesprochen haben. Zeit ihres Lebens hat sie das Böhmerwäldler Idiom gepflegt. Sie gilt als eine der besten und authentischsten Mundartsprecherinnen ihrer Heimatregion. Schweigl sammelte 200 Volkslieder aus dem Böhmerwald und für Archive des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Diese sang sie für den Bay-
Im Freundeskreis Sudetendeutscher Mundarten engagierte sie sich seit der Gründung im Jahr 1977 aktiv und war noch in diesem Jahr beim alljährlichen Mundartseminar und der Jahrestagung der Mundartfreunde als Teilnehmerin dabei. Im Rahmen dieses Engagements moderierte sie auch viele Jahre das Programm der Mundartfreunde bei den alljährlichen Sudetendeutschen Tagen.
Für ihr Engagement wurde sie 2006 mit der Adalbert-StifterMedaille und 2014 mit dem Kulturpreis für Volkstumspflege der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet. Vor allem durch das Sammeln und Dokumentieren von Volksliedern in Mundart und Mundartbegriffen aus dem Böhmerwald leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation dieser Mundart. Dank ihrer Teilnahme an Mundartseminaren gibt sie ihr Wissen, aber vor allem den authentischen Klang ihres Dialekts an nachfolgende Generationen weiter.“

erischen und den Süddeutschen Rundfunk auf Tonträger und dokumentiert sie so. Als ausgebildete Märchenerzählerin und pas-
sionierte Mundartsprecherin gab sie die Nachschrift von Gustav Jungbauers ,Böhmerwaldmärchen‘ von 1923 heraus.
„Der Dialekt ist die Sprache der Heimat. Oder umgekehrt: Dialekt ist da, wo man verstanden wird. Er schafft ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit. Dabei zählt die Dialektvielfalt zum kulturellen Erbe Bayerns und prägt die regionale, lokale Kultur sowie Identität. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger haben zur Stärkung, Pflege und Erforschung der Mundarten beigetragen. Dieses Engagement würdigen wir zum fünften Mal mit dem Dialektpreis Bayern 2023“, freute sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der diesjährigen Preisverleihung in seinem Ministerium in Nürnberg.
Nadira Hurnaus



Die Reihe „Kunst und Krempel“ präsentiert immer wieder Gegenstände, die auch die reichhaltige Schaffenskraft in den böhmischen Ländern zeigt. Daß aber ein persönliches Vertreibungsschicksal so unmittelbar in einer Expertise zu einem Gemälde zum Ausdruck kommt, ist äußerst selten. Dies geschah aber in der Sendung vom 24. Juni, die in Herzogenburg bei Sankt Pölten in Niederösterreich aufgezeichnet wurde.
Diesmal ging es um ein Gemälde von 1910, das eine alte Frau im Profil darstellt. Auf das Witwentum verweist ein schwarzer Schleier. Das Bild stammt von dem 1889 in Wien geborenen österreichischen Maler Fritz SchwarzWaldegg. Die Mutter der heutigen Besitzerin hatte das Portrait in den 1950er Jahren in Linz gekauft. Sie schenkte es ihrer Tochter zur Matura. Auf die spätere Fra-
ge, warum sie damals einem jungen Mädchen ein Gemälde einer alten Frau geschenkt habe, antwortete diese nur: Es war der ein-
die dargestellte Dame sie an ihre Mutter erinnerte, die sie in Krumau zurückgelassen hatte. Folglich hieß das Bild in der Fa-


Sie erkannten in dem Bild eine frühe Übung in der Tradition der Wiener Secession, orientiert an Arbeiten von Gustav Klimt

signation in der Lebensrückschau aus.

zig wertvolle Gegenstand, den ich hatte. Und dies verwies auf das Vertreibungsschicksal der Familie. Sie stammte aus Krumau und hatte buchstäblich nichts Wertvolles mit nach Oberösterreich retten können. Die Mutter hatte das Gemälde gekauft, weil
milie nur „die Großmutter“. Und man wußte, daß der Maler einen Namen hatte.
Inwiefern dies stimmte, bestätigten die beiden Experten Hans Ottomeyer, Kunsthistoriker aus München, und Herbert Giese, Kunsthistoriker aus Wien.

der 1890er Jahre oder dem Lehrer von Schwarz-Waldegg an der Wiener Akademie der Bildenden Künste, Rudolf Bacher. In dem Profil erkannten sie das Bemühen, jemanden verstehen zu wollen. Und wirklich strahlt das Bild Altersweisheit und ein wenig Re-

An diesem Studienkopf, an dem sich der Maler erprobt habe, erkenne man die Qualität des später expressionistischen Künstlers. Vom später als Parade-Expressionisten bekannten Schwarz-Waldegg seien nicht viele Werke erhalten, so die Experten, da er wegen seiner jüdischen Herkunft, obwohl er konvertiert sei, Berufsverbot erhalten habe und 1942 deportiert und spätestens 1943 umgebracht worden sei. Die Experten waren also ganz angetan vom Gemälde der alten Dame, wünschten dem Bild einen anderen Rahmen und eine nötige Reinigung, die etwas kosten könnte. Gaben dem Bild einen geschätzten Wert von 1500 bis 1800 Eu-
ro und verwiesen doch auf seine tendenzielle Unverkäuflichkeit wegen des Motivs – wer kauft ein Bild einer alten Frau? Die Experten stuften, der Virtuosität der Malerei und des bekannten Namens wegen, das Gemälde als museumswürdig ein. Sie empfahlen das Belvedere in Wien, dem sie es doch schenken solle. Da die Besitzerin keine Erben hat, will sie es wohl überlegen, wenn sie selbst „Auf Wiedersehen“ sage. Am Ende war die Besitzerin doch froh über die Expertise, daß das von ihrer Mutter gekaufte Bild als einzig wertvoller Gegenstand, den diese nach der Vertreibung besaß und der an die Großmutter und übertragen wohl auch an Krumau und die Heimat erinnerte, doch etwas wert sei, vor allem künstlerisch. Ulrich Miksch
❯ SL-Kreisgruppe Regensburg/Oberpfalz
Ende Juli eröffnete die Falkensteiner Vorwaldgemeinde Altenthann im ehemaligen Pfarrhof die Ausstellung „Flucht und Vertreibung – damals und heute“, an der SL-Ortsgruppen der oberpfälzischen SL-Kreisgruppe Regensburg beteiligt waren.


Die Sudetendeutschen und jugendliche Ukrainer stehen in Altenthann im Landkreis Regensburg im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung „Flucht und Vertreibung – damals und heute“. Bei der offiziellen Eröffnung umrahmten zwei Mädchen und ein Junge aus der Ukraine die Veranstaltung musikalisch am Piano.

Kreisheimatpfleger Hermann Binninger hieß an die 70 Teilnehmer herzlich willkommen und freute sich über ein volles Haus. Grußworte sprachen der Stellvertretende Landrat Willi Hogger, die Bürgermeister Harald Stadler aus Neutraubling, Harald Herrmann aus Altenthann und die Zeitlarner Bürgermeisterin Andrea Dobsch.
Die Ausstellung ist außerordentlich vielschichtig und verzahnt geschickt zwei Zeitepochen. Ausgewählte Exponate von den SL-Ortsgruppen Neutraubling und Regenstauf sowie Fotos, Presseberichte und ErlebnisSchilderungen erinnern an die Vertreibung der Sudetendeut-
schen durch die Tschechen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Jugendliche Ukraine-Flüchtlinge aus der Brückenklasse der Realschule Regenstauf stellen in Vitrinen Gegenstände aus, die sie aus der Heimat mitgebracht haben.

Grundschüler aus Aufhausen und Altenthann haben in einem Unterrichtsprojekt Bilder in vielen Variationen zu der Frage gestaltet, was sie bei einer eventuellen Flucht im Koffer so alles mitnehmen würden.
Franz Weschta, Obmann der SL-Kreisgruppe Regensburg, ist Zeitzeuge der Vertreibung. Er erzählte, wie er als fünfjähriger Bub
Bilder einer Ausstellung
im Winter 1945/1946 sein Bettpolster auf dem Schlitten an den USA-Soldaten vorbei über die tschechisch-bayerische Grenze geschmuggelt hatte.
20 Jahre später unterrichtete Weschta hier in Altenthann als Junglehrer im ersten Dienstjahr in der 2. und 3. Klasse 46 Jungen und Mädchen. Mit zwei ehemaligen Schülern gab es in der Ausstellung nach nun 58 Jahren ein erstes Wiedersehen.
„Flucht und Vertreibung – damals und heute“ bis 29. Oktober an jedem ersten und letzten Sonntag im Monat 13.00–16.00 Uhr im ehemaligen Pfarrhof von Altenthann.
❯ Handwerkskammer für Mittelfranken

Die Bubenreuther Instrumentenmacher Thomas Dotzauer und Peter Riedl wurden von der Handwerkskammer für Mittelfranken geehrt.
Im Auftrag des Präsidenten der Handwerkskammer für Mittelfranken in Nürnberg, Thomas Pirner, überreichte der Innungsobermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen, Günter Lobe, dem Zupfinstrumentenmachermeister Thomas Dotzauer und dem Bogenmachermeister Peter Riedl den Goldenen Meisterbrief.

❯ SL-Bezirksgruppe Oberfranken/Bayern
Trotz der langen Anfahrt ins oberbayerische Erding und der Hitze war die SL-Bezirksgruppe Oberfranken bei der Hauptversammlung der SL-Landesgruppe Bayern (➞ Seite 5) gut vertreten.
Thematisch ging es um die Anpassung der Landessatzung an die Bundessatzung. Bestimmte Formulierungen aus der Anfangszeit wurden weiter gefaßt. Dazu gilt ein Grundsatzprogramm, das die gesamte Thematik der Sudetendeutschen Frage einschließt.
Als SL-Landeskulturreferentin nahm Margaretha Michel Stellung zu den neueren Verbes-
serungen im sudetendeutschtschechischen Verhältnis, die im jetzigen Kulturheft „Dischkurieren“ der SL-Bezirksgruppe angesprochen werden. Die Tschechen hätten auch bestimmt, daß die verbliebenen sudetendeutschen Gräber in Böhmen erhalten würden. Die Gefallenendenkmale der ehemaligen deutschen Orte würden vom tschechischen Militär gepflegt.
Als Obfrau von Oberfranken erklärte Michel, daß unsere östlichen Nachbarn sich um ein freundliches Miteinander bemühten bei Reisen von Oberfranken aus. Gleiches gelte für Fahrten der Landesgruppe.
Bernhard Kuhn
❯ SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken
Anfang Juli feierte das mittelfränkische Rückersdorf Kirchweih, und die SL-Ortsgruppe feierte mit.
Obfrau Bärbel Anclam hatte im Festzelt reserviert. In ihrer Begrüßung freute sie sich, daß trotz der Hitze so viele gekommen seien. Auch Altbürgermeister Peter Wiesner und Mitglieder der Ortsgruppen LaufHeuchling und Röthenbach waren gekommen. Bürgermeister Johannes Ballas begrüßte die Gäste und wünschte vergnügte Stunden. Wie im vergangenen Jahr war das Trio „Altfränkisch“ für die musikalische Unterhaltung zuständig. Ihr großes Repertoire sorgte für gute Laune; Lie-
der zum Mitsingen und Mitklatschen, Darbietungen zum Schunkeln sowie Witze zur allgemeinen Erheiterung sorgten für einen zünftigen Kirchweihnachmittag. Einige Paare wurden von der flotten Musik zum Tanzen animiert.
Mit einem Schubkarrenrennen klang die Kirchweih aus. Den Schubkarren der SL hatten Karin Walz und Irmtraut Wiemer mit Geschick, Kreativität und Blumen aus den eigenen Gärten geschmückt. Der engagierte Fahrer Lars Niggemann belegte für die SL den dritten Platz.
Die Ortsgruppe lädt zu ihrem traditionellen Weinfest am 6. September um 14.30 Uhr beim Schmidtbauernhof ein. Judith Will
„Durch Ihre regionale Verwurzelung und Ihre soziale Verantwortung tragen Sie dazu bei, daß unser fränkisches Zentrum des Musikinstrumentenbaues so lebenswert ist“, würdigte Innungsobermeister Günter Lobe die Arbeit und Schaffenskraft, durch die die beiden Meister in 35 oder mehr Jahren meisterlicher Tätigkeit in ihrem Handwerk eine erhebliche Vorbildfunktion erlangt hätten.

Der Goldene Meisterbrief sei ein Zeugnis dafür, daß sie ihre Handwerkskunst beherrschten und wahre Alleskönner seien. Deshalb betrachte er den Goldenen Meisterbrief sinnbildlich als die Lorbeeren, die es nach vielen Jahren des Engagements, Durchhaltevermögens und Leistungswillens nun zu ernten gelte. Der Goldene Meisterbrief stehe auch für den Verdienst jahrzehntelanger Ausbildungsleistung, so der Obermeister weiter.
„Das ist eine der herausforderndsten Aufgaben, die Sie als Handwerksmeister haben. Sie ermöglichen vielen jungen Leuten eine Ausbildung und eine Zukunftsperspekti-

ve in der Heimat und tragen maßgeblich zu deren Persönlichkeitsentwicklung bei“, würdigte er die Geehrten. Neben der hohen Ausbildungsund Arbeitsleistung der Handwerksmeister betonte Lobe die Wichtigkeit der Familien, die den nötigen Rückhalt böten und einen erheblichen Beitrag zum Erfolg eines selbstständigen Betriebs leisteten.
Thomas Dotzauer fertigt in der fünften Generation Mandolinen. Seine Großeltern Franz und Josefine Dotzauer kamen 1945 aus Schönbach im Egerland nach Tennenlohe und führten dort die Herstellung von Mandolinen und Gitarren fort. Thomas Dotzauer begann seine Ausbildung 1977 bei der Tennenloher Firma Arnold und legte 1983 vor der Handwerkskammer Nürnberg die Meisterprüfung ab.
Peter Riedl prägt in der dritten Generation seinen Namen in die Bogenstangen. Er erlernte den Bogenbau in der Meisterwerkstätte Roderich Paesold. Als 18jähriger legte Riedl die Gesellenprüfung ab und vertiefte sein Fachwissen bei dem Bubenreuther Bogenmacher Rudolf Neudörfer. Sein Können und Bestreben nach handwerklicher Leistung führte 1987 zur Ablegung der Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Nürnberg.
Die Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen hat derzeit 50 Mitglieder, davon haben 35 den Meisterbrief und von diesen wiederum 20 den Goldenen Meisterbrief. Derzeit sind fünf Mitglieder der Innung bestrebt, den Instrumentenmachermeister bei der Handwerkskammer zu erlangen. Heinz Reiß
� Verdiente Schlesierin
Am 15. Juli starb die gebürtige Oberschlesierin Hedwig „Hedi“ Lowak im 103. Lebensjahr in Wien. Marion Breiter vom Humanitären Verein der Schlesier, Jägerndorfer und Freudenthaler in Wien gedenkt ihrer.

Wenn du nur nicht einmal so viel weinst, wie du lachst“, sagte ihre Mutter immer zu ihr. Sie sollte recht behalten. Hedi Lowak erlebte schwere Zeiten mit Flucht und Vertreibung aus dem heute polnischen Neuland bei Neiße in Oberschlesien an der tschechischen Grenze. In Wien wurde sie ausgebombt, verlor eine Tochter und ihren Mann. Und dennoch oder gerade deswegen bewahrte sie sich ihren Humor. Wir alle kannten sie als außergewöhnlichen Menschen, dessen sonniges Gemüt schwere Zeiten überstrahlte und ansteckend auf andere wirkte. Lachtaube wurde sie im Humanitären Verein der Schlesier, dessen Mitglied sie war, genannt. Immer ein Scherzchen oder einen Witz auf den Lippen, brachte sie uns stets zum Lachen. Das Leben ist schließlich ernst genug – auch das hatte sie in hohem Maß erfahren.
„Mach dir keine Sorgen, es kommt eh, wie es kommen soll“, war eine der Lebensweisheiten, die sie mir mitgab. Ebenso, daß man Geduld haben muß:
„Nur net brumma, s‘ wird scho kumma.“ Das Schlesische in all seinen Ausprägungen, die schlesische Wesensart, Kultur und insbesondere die schlesische Mundart waren Hedi bis zuletzt Herzensanliegen. Bei Vereinstreffen, Weihnachtsund anderen Feiern trug sie im Haus der Heimat gerne Gedichte, teils auswendig, vor. Bei meinem letzten Besuch sagte sie verschmitzt: „Ich bin Schlesierin.“
So gab sich Hedi große Mühe, mir ihre Mundart beizubringen. Manchmal wären wir beide fast verzagt, aber eines Tages strahlte sie: „Sehr gut!“
Ihr Erbe, ihre Muttersprache, bleibt erhalten, ein Stück von Hedi bleibt bei uns. Mir war sie eine liebevolle Lehrmeisterin. Sie vermittelte mir ihre Sprache, aber auch viele Erinnerungen, Gedanken, Erfahrungen. Viel Freud und Leid durfte ich mit ihr teilen. Dazu gehörte die Vergangenheit, in die sie immer wieder gerne und in erstaunlich lebendigen Farben eintauchte. Wenn sie von ihrer Kindheit in Neuland bei Neiße – dort war sie am 11. Januar 1921 als jüngste Schwester von drei Brüdern zur Welt gekommen – erzählte, sah ich förmlich die blonden Zöpfe der quietschvergnügten Hedi fliegen. Ich sah, wie sie mit den Bauerskindern auf den Höfen spielte, wie sie später in der Pfefferkuchenfabrik arbeitete und auf dem gläsernen Boden des Tanzlokals herumwirbelte. Hedl liebte Tanzen, und selbst an ihrem 99. Geburtstag wagte sie mit Bundesobmann Erich Lorenz im Haus der Heimat ein Tänzchen.
Zu Hause in Schlesien lernte sie ihren späteren Mann Leopold Lowak, Wiener und zu der Zeit Stabsoberfeldwebel, kennen. Die Geschichte ihrer Flucht aus Schlesien ins Sudetenland, wo sie Verwandte hatte, berührte mich immer wieder. Ich fror förmlich mit
ihr in diesem eisigen Winter, als sie bei 24 Grad Kälte mit ihrer Mutter, ihrer Schwägerin, ihrem Kleinkind, ihrem Säugling und weiteren Kindern aus Angst vor den Russen hastig aufbrach.
Bei all den Reisen in die Vergangenheit stand Hedi doch mit beiden Beinen in der Gegenwart. Über Politik und Gesellschaft sprach sie gern und verstand die Anliegen der jungen Leute. Besonders überraschte sie ihre Umgebung immer wieder mit ihrem ausgezeichneten Gedächtnis, das sie bis ins hohe Alter von 102,5 Jahren nicht im Stich ließ. Mut und Kraft gab ihr ihr tiefer Glaube. In diesem war sie erzogen worden, mit ihm bewältigte sie alle Hürden ihres langen Lebens und in ihm schlief sie friedlich ein.
Hedi war ein Unikat –Schlesierin von Gemüt wie Aussehen. Genau so wird sie für immer in unseren Herzen bleiben. So sehen wir sie auf ihrer Wolke hoch oben im Himmel sitzen. Und wenn es ganz still ist, weht der Wind ihr fröhliches Lachen zu uns herüber. Vielleicht, ja vielleicht erzählt sie Petrus und den Engeln gerade einen besonders lustigen Witz
Seit 1977 war Hedi Mitglied im Humanitären Verein der Schlesier, Jägerndorfer und Freudenthaler in Wien. 1993 wurde ihr die Silberne Ehrennadel, 1999 das Verbandsabzeichen in Gold, 2002 die Goldene Nadel der SLÖ verliehen. Seit 2020 war Hedwig Lowak Ehrenmitglied.
Zum Verein gekommen war sie durch ihre Tätigkeit bei dem Likörerzeuger Altvater Gessler – J. A. Baczewski in Wien. Ihre Freundin Steffi Sauer hatte sie zu Gessler vermittelt, und Hedi war mit Steffi eine der tragenden Mitarbeiterinnen des Betriebs. Die Erzeugung des Altvater Kräuterlikörs und des Jägerndorfer Magenbitters gehörte ebenso zu ihren Tätigkeiten wie die Betreuung des Gessler-Standes auf Messen. Dort schenkten sie die Spirituosen in kleinen Stamperln aus. Als sie eines Tages Leute des Vereins an ihrem Stand besuchten, kamen sie mit dem Verein in Berührung und traten diesem bei. Hedi und Steffi waren immer gleich angezogen, viele Kleidungsstücke nähten sie selbst. Im Verein traten sie wie Zwillinge auf, wurden von vielen dafür gehalten und hatten den Spitznamen Gessler-Zwillinge. Noch eine Gemeinsamkeit hatten sie: ihre Liebe zum Altvater-Likör. Hedi liebte bis ins hohe Alter ihr tägliches Stamperl Kräuterlikör, nur den heutigen tschechischen Altvater mochte sie gar nicht. „Darin fehlen die geheimen Tropfen“, sagte sie. Diese stellte Gessler nach dem geheimen Familienrezept her und hütete sie streng. Hedi durfte sie in Gesslers Abwesenheit im Herstellungsprozeß hinzufügen, was eine besondere Ehre war. Noch lange nachdem das Unternehmen geschlossen worden und die Familie in die USA ausgewandert war, führte Gesslers Sohn die GesslerZwillinge jedes Mal, wenn er in Wien war, zum Essen aus und zeigte so seine Dankbarkeit für ihren engagierten Einsatz für den Betrieb.
� Deutscher Böhmerwaldbund
Am letzten Juliwochenende feierte der Deutsche Böhmerwaldbund (DBB) in seiner Patenstadt Passau sein 31. Bundestreffen.
Das Südmährertreffen beginnt mit einem Totengedenken am Ostlandkreuz oberhalb Geislingens.
� Südmährerbund
Im baden-württembergischen Geislingen an der Steige fand am Wochenende das 75. Bundestreffen der Südmährer statt. Gefeiert wurde auch die seit 70 Jahren bestehende Patenschaft der Stadt über die vertriebenen Südmährer.
Das Treffen begann am Samstagmorgen mit dem Niederlegen eines Kranzes am Ostlandkreuz auf der Schildwacht oberhalb Geislingens. Damit wurde der Toten gedacht. Das Kreuz hatten die Südmährer 1950 als Mahn- und Gedenkmal errichtet.
In der Jahnhalle fand dann die Vorstandssitzung des Südmährerbundes statt. Am Nachmittag tagten die vier Heimatkreise Neubistritz, Zlabings, Nikolsburg und Znaim einzeln. Dem folgte die Versammlung aller Delegierter des Südmährerbundes.
Im Biergarten neben der Jahnhalle fand der Patenschaftsabend anläßlich 75. Bundestreffen und 70 Jahre Patenschaft statt. Grußworte entboten Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer und Wolfgang Daberger, Erster Vorsitzender des Südmährerbundes. Die südmährische Singund Spielschar „Moravia Cantat“ und die Stadtkapelle Geislingen begleiteten den Abend musikalisch.
Der Sonntagmorgen begann mit einem Festgottesdienst in der Jahnhalle, den der Wiener Domdekan Prälat Karl Rühringer und der Geislinger Dekan Martin Ehrler zelebrierten. Nach der Totenehrung fand der Festakt zum 75. Bundestreffen und zum 70. Patenschaftsjubiläum statt. Grußworte sprachen Oberbürgermeister Frank Dehmer und Franz Longin, Ehrenvorsitzender des Südmährerbundes.
Jiří Kacetl, Hauptredner des Sudetendeutschen Heimattages in Klosterneuburg 2020 und Mit-Initiator des Projekts „Haus der Geschichte Butschitzer-Bornemann in Znaim“, erhielt heuer den Südmährischen Kulturpreis.
Festreden hielten Klaus Hoffmann, Obmann der SL-Landesgruppe Baden-Württemberg, und Nicole Razavi MdL, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg. Das Schlußwort sprach Wolfgang Daberger. Dem Festakt folgten die Heimattreffen der Ortsgemeinschaften in der Jahnhalle.
Passau erwies sich am Wochenende als besonderer Gastgeber: Als Patenstadt beim 31. Bundestreffen der Böhmerwäldler hat sie am gestrigen Sonntag zur Kundgebung in den Großen Redoutensaal eingeladen. Die Stadt Passau übernahm bereits 1961 die Patenschaft über die Böhmerwäldler und stiftete einen Böhmerwäldler Kulturpreis. Der diesjährige Preis wurde am Samstag im Großen Rathaussaal an Emma Marx und Lenka Hûlková für ihren Einsatz für die Geschichte des Böhmerwaldes und seiner Bewohner verliehen.
Nachdem Johann Slawik, Stellvertretender DBBBundesvorsitzender, die Gäste begrüßt und der Toten gedacht hatte, hob Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper hervor, wie eng die Beziehungen zwischen dem Böhmerwald und der Dreiflüssestadt seien. Anschließend ging er in einer kurzweiligen Rede auf die historischen Wurzeln ein. „Bis zum 17. Jahrhundert gab es einen regen Handel zwischen Böhmen und Passau. Allein auf dem Goldenen Steig waren täglich 1300 Pferde zwischen Prachatitz und Passau unterwegs. Für diese Strecke brauchte man damals drei Tage. Aber im 17. Jahrhundert hat dann Kaiser Leopold we-
� Bruna
gen des Salzes dazwischen gefunkt.“ Erst 1884 habe der Böhmerwaldbund die gemeinsame Geschichte wieder aufgegriffen. Heute sei es für Passau als Patenstadt eine besondere Ehre, sich genau dieser Gemeinsamkeit zu versichern und alte Bande zu pflegen.
Der Böhmerwaldbund sorge dafür, daß nach den tiefsten Tiefen des schrecklichen 20. Jahrhunderts mit Krieg, Diktatur und Vertreibung die Heimat nie vergessen werde, ebenso wenig das erlittene Unrecht. Dennoch werde die Hand zur Versöhnung gereicht. „Auch wenn sich vieles ändert im Laufe der Geschichte, die Verbundenheit zur Heimat wird sich nie ändern. Wir
werden dem Böhmerwald immer die Treue halten“, versprach der Oberbürgermeister, was mit anhaltendem Applaus der Gäste, von denen viele in der erneuerten Festtagstracht erschienen waren, quittiert wurde.
Der Passauer Vizelandrat Hans Koller betonte, daß er den Böhmerwaldbund als Mahner für Frieden sehe. „Die heutige Generation kann sich das kaum mehr vorstellen, aber Heimat ist mehr als der Ort, an dem man wohnt, es ist ein Gefühl. Und die Vertreibung hat den Böhmerwäldlern ihre Wurzeln abgeschnitten.“
Daß der DBB vor Veränderungen stehe, daraus machten weder Elisabeth Januschko, Bundesvorsitzende der Böhmerwaldjugend, noch DBB-Bundesvorsitzende Birgit Kern in ihren Festreden einen Hehl. „Unser letztes Treffen fand vor vier Jahren in Passau statt, und besonders nach der harten Corona-Zeit merkt man nun, daß der Besuch für viele Landsleute mittlerweile zu beschwerlich wird“, sagte Kern. Dennoch freue sie sich, daß man in Passau eine wunderbare Möglichkeit zum Austausch habe. Das sei von unschätzbarem Wert, stimmte Elisabeth Januschko zu. Beim Singen, Tanzen und in Gesprächen lebe man Heimat. „Auch wenn sich vieles geändert hat nach Corona, ist es um so schöner, wenn in Passau nun junge Familien dabei sind, die unsere Tradition fortsetzen.“
Sandra Hiendl
Ende Juli wurde im Foyer des Rathauses im oberbayerischen Waldkraiburg die Ausstellung „Deutsche Brünner Persönlichkeiten aus sechs Jahrhunderten“ eröffnet.
In der Ausstellung soll gezeigt werden, daß Brünn auf talentierte Menschen eine große Ausstrahlung hatte. Diese Persönlichkeiten waren Brücke zwischen Deutschen und Slawen.
Ihre Aufgabe sieht die Bruna in der Erhaltung heimatlichen Kulturguts, der Überlieferung der gesellschaftlichen und strukturellen Eigenarten des Brünner
Deutschtums und der Förderung des Europagedankens.
Bei der Eröffnung sprachen Waldkraiburgs Bürgermeister Robert Pötzsch und Stephan Mayer MdB. Pötzsch wies auf die Herkunft und die noch lebenden Traditionen der Vertriebenen und Flüchtlingen hin, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem ehemaligen Militärgelände der Wehrmacht eine neue Stadt aufgebaut hätten. Mayer sieht eine zunehmende Besserung der Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen, mittlerweile auch zur tschechischen Regierung. In seinem Vortrag über

� Bruna-Kreisverband München
Mähren sprach Bruna-Bundesvorsitzender Rudolf Landrock über die Geschichte und über noch bestehende Probleme in dem Miteinander von Vertriebenen und Tschechen.
Die Ausstellung, die es in einer deutschen und in einer deutschtschechischen Version gibt, war unter anderem auch schon im Wiener Haus der Heimat zu sehen. Es werden noch Ausstellungsorte gesucht.
Bis Ende August im Waldkraiburger Rathaus Montag bis Freitag 8.00–12.00, Donnerstag 13.00–18.00 Uhr.
Ihren heurigen Ausflug machte die Bruna-München heuer per Bus nach Waldkraiburg.
Unter der Leitung des Stellvertretenden Bruna-Bundes- sowie -Kreisvorsitzenden Dietmar Schmidt besuchte eine fröhliche Gruppe von Brünnern das Stiftungsmuseum Bilder erzählen – Sammlung Peter Schmidt. Eingangs gab es eine Einführung über den Museumsträger, die private Stiftung des Peter Schmidt. Ihn hatte es infolge von Flucht und Vertreibung nach Waldkraiburg verschlagen. Dort begann er seine Karriere als erfolgreicher Unternehmer.
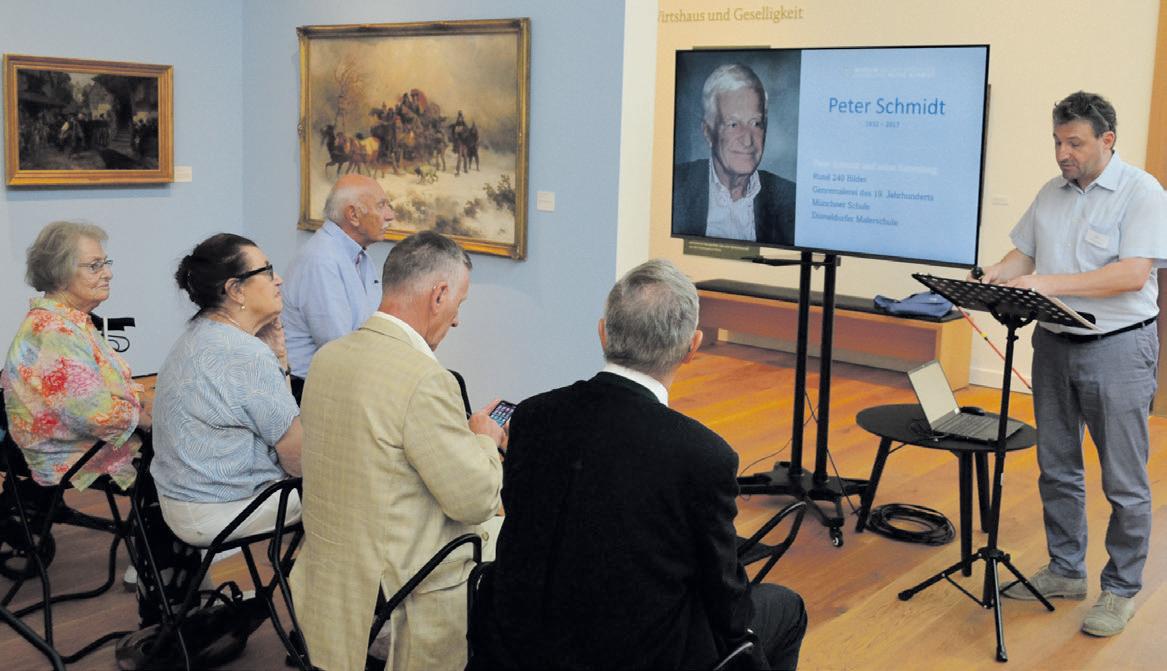
Die Sammlung umfaßt rund 200 Bilder aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie ist thematisch gegliedert. Zu jedem Thema gehören mehrere Bilder aus der Münchener Schule und der Düsseldorfer Malerschule.
tenmalerei stellt Begebenheiten wie Lausbubenstreiche, Hochzeiten oder Leben in der Wirtshausstube dar.
Eine Filmvorführung mit Erläuterungen des 2017 verstorbenen Peter Schmidt ergänzte und vertiefte die einleitenden Worte des Museumsführers. Abgerundet wurden Film und Vortrag durch einen Rundgang, bei dem man die Bilder betrachten konnte.
Anhand einzelner Bilder wurde die Genremalerei erklärt. Zu sehen sind Szenen aus dem Leben der einfachen Leute. Diese Sit-
Anschließend ging es in einen lauschigen Biergarten, in dem sich alle Brünner an Speis‘ und Trank laben konnten. Bei angenehmen Temperaturen und anregenden Gesprächen verging die Zeit im Fluge. Rudolf Landrock
Lila Lavendelfelder gibt es nicht nur in der Provence, sondern auch im Böhmischen Mittelgebirge. Steffen Neumann berichtet.
Wieviel verschiedene Schattierungen von Lila sind möglich? Geht es nach Simona Görtlerová sind es 24. Denn genau so viele lila Lavendelsorten wachsen in ihrem Garten. Den Bienen scheint das egal zu sein. Sie sorgen für dieses angenehme Grundbrummen. Ein ordentliches Gewitter warf über Nacht einige Blumentöpfe um und sorgte gleichzeitig für etwas Abkühlung. Doch nun scheint die Sonne schon am Morgen aus Leibeskräften, und die Bienen fallen in Heerscharen in Görtlerovás Garten ein.
Die Frau, Ende 40, ist seit dem Morgen auf den Beinen. Sie kennt den Ablauf sehr genau. „Die Tiere haben eine klare Ordnung. Den Bienen ist der Morgen vorbehalten. Um Mittag kommen dann die Schmetterlinge und Hummeln, und am Abend sind es die Nachtfalter“, stellt sie fest.
Als Gärtnerin weiß man so etwas. Da hat sie nicht nur den Rhythmus eines Tages im Blut, sondern den eines ganzen Jahres.
Und dieser Jahresplan sagt: Jetzt ist Juli – die Hochzeit des Lavendel. Jetzt sind die drei bis vier Wochen angebrochen, in denen er in voller Blüte steht. Wer schon einmal seinen Urlaub in der Provence verbracht hat, der weiß das. Aber Simona Görtlerovás Garten befindet sich nicht in der fernen Provence, sondern am Südhang des Böhmischen Mittelgebirges. Konkret im Schatten der wohl markantesten Burgruine Nordböhmens, der Hasenburg, tschechisch Hazmburk.
Wobei Schatten angesichts der schon jetzt hoch am Himmel stehenden Sonne nicht ganz das richtige Wort ist.
„Wir befinden uns im Regenschatten des Erzgebirges“, stellt Görtlerová klar. Das heißt, ihr Garten bekommt deutlich mehr Sonnentage ab als andere Ge
genden in Mitteleuropa. „Dazu kommt der Basalt unter uns“, nennt Görtlerová den zweiten Grund für das spezielle Mikroklima, das das prächtige Gedeihen des Lavendels ermöglicht. Der Basalt, der an den einstigen Vulkanen der umliegenden Berge wie auch der Haselburg zutage tritt, ist ein riesiger Wärmespeicher. Das schwarze Gestein speichert die Wärme so kolossal gut, daß der Boden im Winter fast vollständig von Frost verschont wird. Deshalb wächst Lavendel hier in dem kleinen Dorf
 � Klapay/Böhmisches Mittelgebirge
� Klapay/Böhmisches Mittelgebirge
Klapay/Klapý am Fuße der Hasenburg. Bis Simona Görtlerová das realisierte, mußten mindestens zehn Jahre entbehrungsreicher Arbeit vergehen. Am Anfang stand vor mehr als 30 Jahren ihre Lehre zur Gartenarchitektin im inzwischen als UNESCOWeltkulturerbe gewürdigten Landschaftspark um die Schlösser Eisgrub und Feldsberg in Südmähren, am anderen Ende der Republik. Das waren zugleich die einzigen Jahre, in denen sie von der Heimatscholle im Böhmischen Mittelgebirge entfernt war. Denn wer wie Görtlerová aus einer Familie stammt, die hier seit Jahrhunderten zu Hause ist, geht nicht so einfach weg. Auch wenn diese Familie deutschstämmig ist und nach dem Zweiten Weltkrieg vom Staat verfolgt wurde. Damals mußten alle Deutschen raus aus der Tschechoslowakei. Nur drei Gruppen durften bleiben: tschechischdeutsche Mischehen, Antifaschisten und unersetzbare Fachkräfte.
„Meine Großmutter war Deutsche, der Großvater Tscheche“, ordnet Görtlerová ihre Vorfahren der ersten Gruppe zu. Sie, die das Erbe ihres Dorfes weitertrugen, wurden zu Exoten. Daß sie als halbe Deutsche fortan unter Dauerverdacht standen, war das eine. Daß sie ihren Grund und Boden verloren, das andere. Immerhin durften sie in Haus und Garten als Mieter bleiben, wo die Großeltern fortan zur Aufbesserung des Mittagstisches wirtschafteten.
So fing die Geschichte vom Lavendelgarten nach 1989 an. Der Garten trägt übrigens den deutschen Namen Anette, „nach meiner Mutter Anna“, sagt Görtlerová. Als sie als junges Mädchen ihre Lehre im Gartenparadies Eisgrub beendete, bekam die Familie ihr Eigentum zurück. Da auch ihre Schwester ausgebildete Gärtnerin ist, lag es nahe, daraus ein Geschäft zu machen. Sie bauten Blumen an. Der Verkauf lief sehr gut. Bis zu sechs Geschäfte hatten sie zeitweise in der Region. Doch das Unternehmen brachte sie an den Rand der Erschöpfung. „Nach Abzug für Mieten und Personal blieb uns am Ende fast nichts, außer sehr

viel Arbeit“, erzählt Görtlerová. Deshalb gaben sie die Blumengeschäfte nach zehn Jahren bis auf eins auf. „Wir suchten etwas, das sich besser mit unserem Leben vereinbaren ließ.“ Und so seien sie auf den Lavendel gekommen. Zu ihrem Leben damals um die Jahrtausendwende gehörte auch das Ende ihrer Ehe. Sie blieb mit den Kindern allein. Ohne familiäre Unterstützung war das regionale Blumenimperium nicht mehr zu halten.
Also behielten sie einen Blumenladen im nahen Libochowitz/Libochovice und konzentrierten sich auf den Garten. Aus der Trockenheit machten sie eine
köstlicher Lavendelkuchen mit Kaffee serviert wird. Und natürlich fragt die Saisonkraft: „Möchten Sie den Kaffee mit Lavendelgeschmack?“ Einmal die Woche wird sogar frisches Lavendeleis geliefert.
Doch Laden, Café und Garten sind noch nicht alles. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem sich unsere Gäste wohlfühlen“, sagt Simona Görtlerová. Aus Sicht der leidenschaftlichen Gartenarchitektin blieb da allerdings ein Problem: „Rein gartentechnisch ist Lavendel eigentlich eine langweilige Pflanze. Sie blüht drei bis vier Wochen im Jahr und das war es dann“, erzählt Görtlerová.
zugsort, an dem sie mal abschalten und sich etwas Gutes gönnen können.
sie dann wieder zum Fasching öffnet und das Lavendeljahr von vorn beginnt.
Tugend und bauten Lavendel an. Daß sie sich heute über 24 Sorten freuen kann, ist auch das Ergebnis einer jahrelangen Zucht. „Wir ziehen unsere Pflanzen inzwischen selbst und verkaufen sie“, erklärt sie. Das ist aber nur ein kleiner Teil ihres Geschäfts. Vor allem verwenden sie den Lavendel beziehungsweise die ölhaltigen Körner, aus denen die Blüten sprießen, für ihre Produkte: Lavendeltee zur Beruhigung, Lavendelsalbe zur Hautpflege, Lavendelkissen für den besseren Schlaf, Lavendelseife zum Reinigen, Lavendelsirup für den Geschmack, kurzum Lavendel in allen Spielarten. Das alles erwartet die Gäste am Ende des Gartens liebevoll verpackt in Regalen, Schächtelchen und auf Tischen. Daneben befindet sich ein kleines überdachtes Sommercafé, in dem erwartungsgemäß
Deshalb steht sie nicht zwischen Lavendelfeldern, sondern in einem aufregenden, bunten Garten, in dem das ganze Jahr über etwas blüht. All das ist platziert in ein postkartenreifes Arrangement mit gewundenen Wegen, Pergolas, Pavillons und einem kleinen Teich. Immer wieder laden lauschige Bänke zum Verweilen ein. „Das ist ein Frauengarten“, lautet Görtlerovás Beschreibung. Sie meint damit: keine komplizierten Extravaganzen, an denen sie schwer zu tragen hat. Eben alles, was man so ohne Mann gut hinbekommt.
„Ab Anfang Juni bis Anfang September haben wir jeden Tag außer montags geöffnet“, lädt Görtlerová zum Besuch ein. Schon ab neun Uhr kommen die ersten Gäste. Sie nutzen den Garten als Oase. Die meisten Gäste schwärmen von dem Rück
Hinter der Verkaufstheke neben den Regalen führt eine Treppe in den Keller. Hier hat Görtlerová eine kleine Ausstellung über Lavendelsorten und seine Verarbeitung eingerichtet. Das meiste davon machen sie selbst. Zunächst heißt es warten, bis der Lavendel vollständig verblüht ist. Erst dann wird er geschnitten. „Am häufigsten wird dafür der Echte Lavendel verwendet, lateinisch Lavandula angustifolia genannt“, zeigt Görtlerová auf die wohl bekannteste Lavendelpflanze, die wir von den ProvenceFotos kennen. „Nach dem Schnitt werden die Lavendelkörner ordentlich abgeschüttelt, dreimal gewaschen und dann getrocknet“, beschreibt Görtlerová die Arbeit, die meist ab Ende August ansteht. Die weitere Arbeit findet dann bereits im Herbst statt, wenn der Garten nicht mehr jeden Tag geöffnet hat. Es wird Tee gemischt und durch ein Verfahren, die Mazeration, wird der Duft oder der Geschmack für Sirup, Öl oder Seife herausgelöst. Einen Teil der Produkte lassen sie auch extern herstellen. Verkauft wird aber nur im eigenen Garten. Gartenpflege, Verarbeitung, Verkauf, gelegentliche Schauführungen –viel Arbeit für eine Person. „Wir sind ein reiner Familienbetrieb oder genauer: ein Frauenbetrieb“, lacht Görtlerová. Hinter der Verkaufstheke steht ihre Mutter. Den Garten bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihrer Schwester. Die Verarbeitung teilt sie sich mit ihrer Mutter. An Wochenenden bietet ihre Schwester zusätzlich einen Weinverkauf an. Seit diesem Sommer konnte sie erstmals eine Saisonkraft für die Theke hinzugewinnen, die nicht zur Familie gehört. „In der Saison bleibt uns nur der Montag, um den Garten wieder in Schuß zu bringen und einmal durchzuatmen“, sagt sie. Ab September hat sie nur am Wochenende geöffnet. Auch wenn der Lavendel längst verblüht ist, kommen die Menschen zu ihr. Zu Allerseelen hat sie extra geöffnet, und im Dezember ist LavendelAdvent und sind LavendelWeihnachten, bis
Simona Görtlerová kann sich zugutehalten, die Lavendelzucht für die Tschechen mitentdeckt zu haben. Sie ist aber nicht mehr allein. Auf regionalen Märkten bieten Erzeuger ihre Lavendelprodukte an. In Schidowitz/ Židovice, einem Dorf bei Raudnitz/Roudnice nad Labem, betreiben die Eheleute Nový seit elf Jahren eine Lavendelfarm. Wer den Elberadweg verläßt und auf der linken Elbseite fährt, kommt fast daran vorbei. Die Felder hier erinnern am ehesten an die Provence. Auch die Novýs sind ein reiner Familienbetrieb, den sie sogar nur im Nebenberuf betreiben. Sie verkaufen vor allem die Pflanzen. Fotografen bieten sie einen besonderen Service. Für einen ordentlichen Aufpreis dürfen sie die Felder mal für ein paar Stunden für sich allein haben. Der Eintritt in den Garten von Görtlerová ist übrigens gratis. Ihre Besucher kommen inzwischen auch von weiter her. „Paradoxerweise läßt sich aus dem Dorf niemand blicken“, stellt sie fest, und das obwohl sie dafür gesorgt hat, daß Klapay nicht mehr nur das Dorf am Fuße der Hasenburg ist. Im Gegenteil, die vielen Gäste führten schon zu Beschwerden, vor allem an Wochenenden, wenn es im Garten schon mal voll werden kann. „Wir haben inzwischen einen extra Parkplatz, immerhin da hat uns die Gemeinde unterstützt“, sagt sie. Die deutschtschechische Familie mit der Pflanze, die eigentlich in der Mittelmeerregion wächst, ist für viele im Dorf immer noch ein bißchen exotisch. Für die Görtlers ist es einfach nur Heimat. Auch wenn sie ihren Garten anderen überlassen haben, wohnen sie immer noch hier. „Hier beginnt das Grundstück meiner Schwester“, zeigt sie hinter die Verkaufstheke. Auf der anderen Seite wohnt ihre Mutter, und gleich am Eingang beginnt ihr Neffe ein Haus zu bauen. „Meine Kinder wohnen nicht mehr hier. Sie haben Wirtschaft und Jura studiert und heute Jobs, die nicht so aufs Dorf passen. Aber sie kommen regelmäßig vorbei“, erzählt sie. Inzwischen gibt es auch wieder einen Mann in ihrem Leben, der sehr gut mit ihr und ihrem „Frauengarten“ leben kann. Daß es mit dem Lavendelgarten auch irgendwann mal ohne sie weitergeht, macht ihr keine Sorgen. „Ich bin ja noch eine Weile da, und wer weiß, vielleicht begeistern sich ja irgendwann meine Enkel für den Garten.“
Ob sich Katharina von Redern um 1600 vorstellen konnte, daß in dem von ihr gegründeten Hohenwald einmal nur noch ein einziges Haus existiert, der Aussichtsturm als Ruine vorhanden ist, auf den weitläufigen Wiesen Rinder friedlich grasen und ganz oben moderne Windmühlen ihren Platz gefunden haben? Und dann komme ich noch mit dem Wunsch zu meinem 70. Geburtstag um die Ecke: An diesem Tag möchte ich in Hohenwald/ Vysoký, dem Heimatort meiner Mutter aus der Familie Franz Zücker, Haus-Nr. 22, sein.




Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
sollte eben ein richtiges Heimatbild werden.
Schon seit meiner Kindheit verbrachte ich mit meinen Eltern stets einige Urlaubstage im Isergebirge. Sie blieben mir vor allem in Erinnerung wegen der ausführlichen Wanderungen, von denen ich als Kind wegen der Kilometeranzahl nicht immer begeistert war. Da meine Eltern die tschechische Sprache beherrschten, gab es nie irgendwelche Probleme im Kontakt mit den Einwohnern. Meine ersten von mir verwendeten tschechischen Wörter waren Zmrzlina für Eis und Rohlík für Hörnchen.
Die Wanderungen im Isergebirge machten mir in den folgenden Jahren zunehmend Freude, und auch mein Mann teilte die Begeisterung. Meine Eltern haben uns viel von ihren Heimatorten und dem Leben dort erzählt. Nach ihrem Tod setzten mein Mann und ich die Tradition fort. Ich interessierte mich sehr für die geschichtliche Entwicklung
Hohenwalds. 2015 trafen wir dort, während wir mit einem Plan der früheren
Wohnhäuser durchs Gelände streiften, Michal Frydrych, der die Ländereien mit Viehzucht bewirtschaftet. Trotz Sprachschwierigkeiten verstanden wir uns in einem Gemisch von Deutsch, Tschechisch und Englisch. Auf meinen Wunsch führte er uns zur Quelle, wegen der Hohenwald der Sage nach 1605 von Katharina von Redern gegründet wurde.
Daß wir 2016 Michal Frydrych erneut unerwartet trafen, erschien uns wie ein wundersamer Zufall. Damals schenkte er mir einen Schlüssel für die Absperrtore, damit ich immer ungehindert das Gelände betreten kann. Als wir nach weiteren Besuchen auch 2020 wieder nach Hohenwald wollten, war die Grenze am Abend zuvor wegen Corona geschlossen worden. Glücklicherweise hatten wir eine Unterkunft auf deutscher Seite in Ol-
bersdorf bei Zittau in der Hotelanlage Töpferpark gebucht. So kamen wir bei einer Busrundfahrt auch auf den Töpferberg und konnten dort von der Böhmischen Aussicht Hohenwald wenigstens aus der Ferne sehen.
Vor wenigen Wochen ging nun mein großer Wunsch in Erfüllung. Genau an meinem 70. Geburtstag konnte ich in Hohenwald sein. Ich wanderte zum ehemaligen Aussichtsturm hinauf, und nach fast vier Jahren Abwesenheit interessierte es mich sehr, ob die Quelle noch vorhanden ist. War es wieder nur ein Zufall, daß diesmal drei Arbeiter bei den Windkraftanlagen standen?
Ich fragte sie nach der Quelle in einem Gemisch aus Deutsch und dem tschechischen Wort Pramen für Quelle. Zunächst war nicht erkennbar, ob sie mich verstanden. Aber ein guter Wille ist immer der beste Weg. Als Übersetzungshilfe dienten das Handy des jüngeren Herrn und einige englische Worte. Sie fragten, ob ich in Hohenwald geboren sei. Ich verneinte, erwähnte aber meinen 70. Geburtstag. Daraufhin gratulierten sie mir ganz herzlich und gingen mit mir zur Quelle. Sie ist noch immer vorhanden, wenn auch nur als geringer Rest. Mein Mann hatte sich inzwischen im Auto ein bißchen ausgeruht, denn am Vormittag hatten wir schon eine Wanderung im Gebirge, ausgehend
von Klein Iser, unternommen.
Am folgenden Tag starteten wir nach Karolinthal/Peklo, dem Heimatort meines Vaters. Zunächst erforderte die schmale Zufahrtsstraße von Raspenau/Raspenava aus wieder unsere volle Aufmerksamkeit.
Bei unserem Rundgang stellten wir erfreut fest, daß in den vergangenen Jahren weitere Häuser sehr schön restauriert worden waren und eventuell auch wieder Sommergäste beherbergten. Da hatte ich ein Aquarell von Alfred Ullrich (* 1921 in Karolinthal, † 2009 in Gera) vor Augen, das an Karolinthal in vergangener Zeit erinnert, als es auch das Kirschendorf genannt wurde. Er beschreibt, welche Erinnerungen er mit Karolinthal verbindet. Über sein Aquarell schrieb
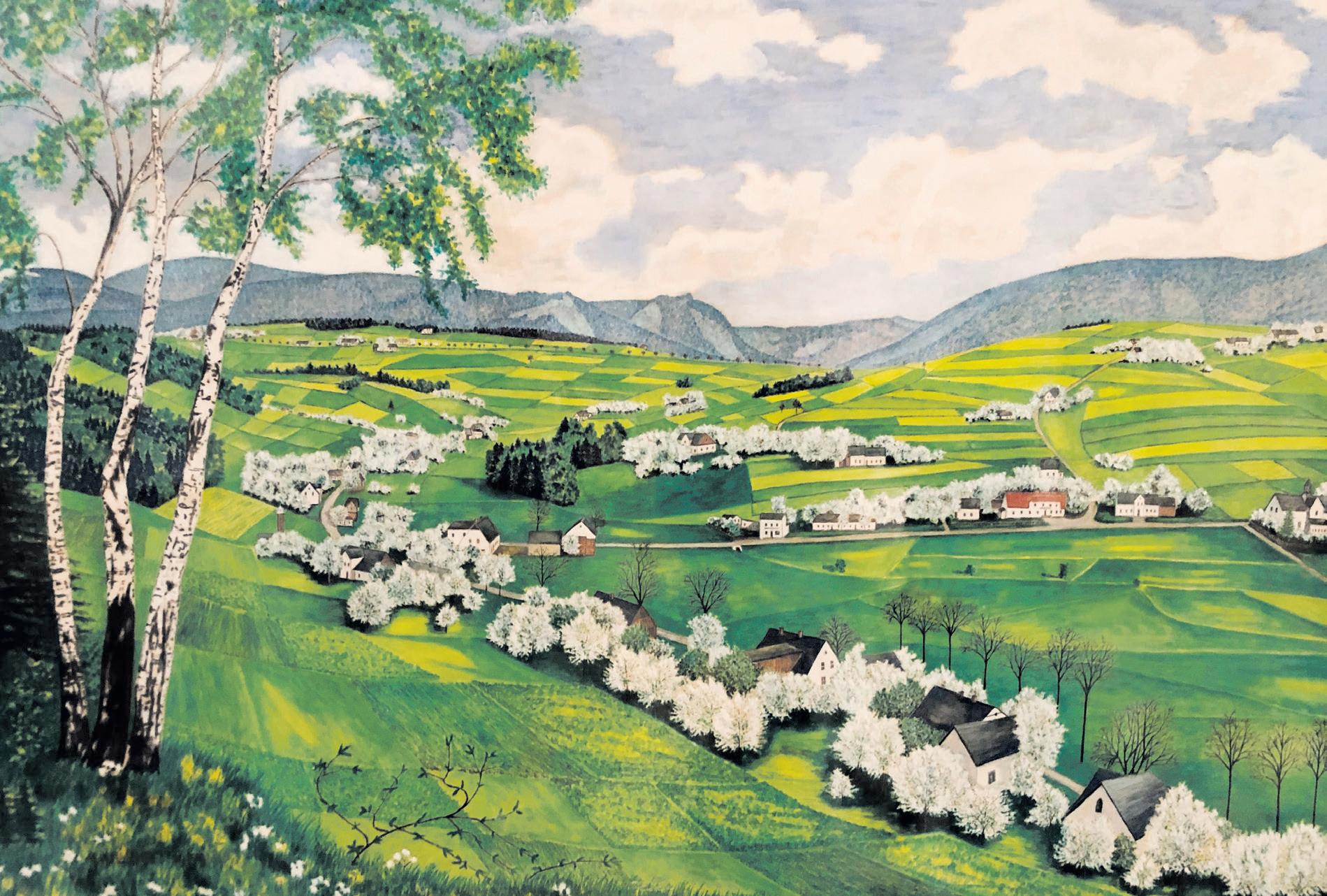
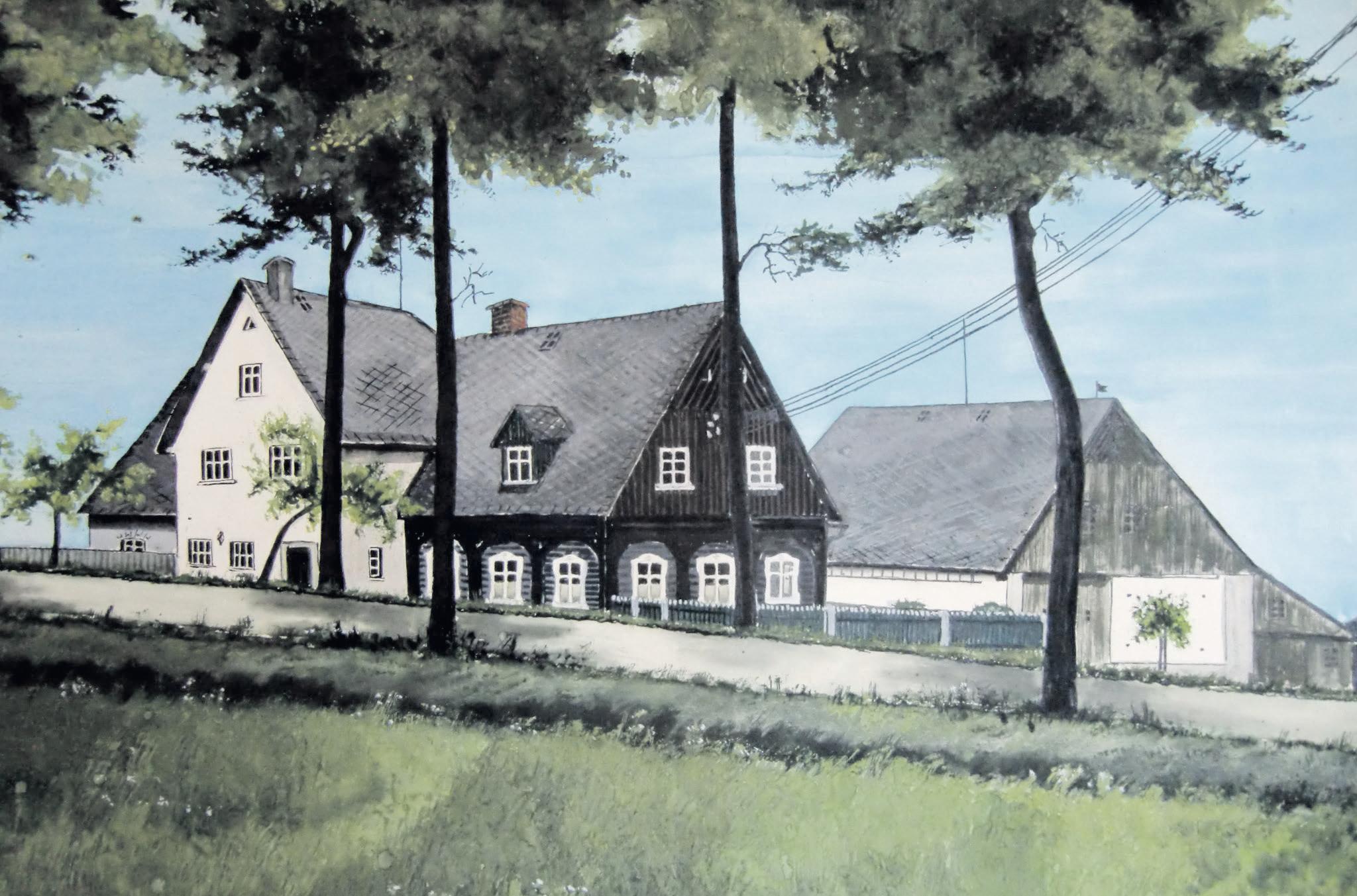
Alfred Ullrich im Jahre 2000:
„An diesem Bild in der Größe von 57 mal 40 Zentimeter habe ich drei Jahre lang gemalt. 1959 habe ich es vollendet, und seitdem hängt es in meiner Stube.
Als Vorlage benutzte ich eine Ansichtskarte von Karolinthal, deren Aufnahme wohl um 1925 gemacht wurde. Natürlich konnte ich keine künstlerische oder moderne Malweise anwenden, denn es ging mir um die kleinsten Einzelheiten. Deshalb wurde es eine langwierige und aufwendige Arbeit – es
Da ein Landschaftsbild aus Vorder-, Mittel- und Hintergrund bestehen soll, habe ich das Motiv der Ansichtskarte ausgeweitet. Vorder- und Hintergrund (Wolkenhimmel) habe ich gänzlich neu angefügt. Meine Beobachtungen in der Natur kamen mir da zugute. Die Ansichtskarte wird am linken Rand mit dem Spritzenhaus begrenzt. Da ich aber den Vordergrund mit den Birken gestalten wollte, erweiterte ich den linken Bildrand. Daher kamen noch Überschar mit dem Riegel und der Tafelfichte (1122 Meter) in das Bild. Den oberen Rand habe ich durch Wolken erweitert.
Diese Wolken fand ich früher als nicht gut gelungen. Als mich Erich Schindler (1921–1996), der auch in Karolinthal geboren war, Ende der 1970er Jahre in Gera besuchte, fand er die Wolken besonders schön, und seitdem gefallen sie mir auch. Betrachtet man dieses Heimatbild eingehend, wähnt man sich in die Jugendzeit zurückversetzt. Da klingen im Ohr die Volksund Heimatlieder, die wir früher in der Schule gesungen haben wie ,Im schönsten Wiesengrunde, da liegt mein Heimathaus‘ oder ,Wo ich im Vaterhaus auf grüner Wiese stand ... Es war im Böhmerland, wo meine Wiege stand‘ und ,Blaue Berge, grüne Täler, mitten drin ein Häuschen klein, herrlich ist dies Stückchen Erde, denn ich bin ja dort daheim‘.“
Alfred Ullrich befaßte sich intensiv mit der Geschichte seines Heimatortes Karolinthal. Auch mein Vater Erich Schindler hinterließ viele Notizen über Karolinthal.
Die Abbildung des Aquarells und die Beschreibung dazu erhielt ich von Ron Ullrich, dem Enkel von Alfred Ullrich. Durch meine Beiträge im „Friedländer Heimatbrief“ war ich schon vor etlichen Jahren mit ihm in Kontakt gekommen. Er hat die Aufzeichnungen seines Großvaters geordnet und bewahrt.
Obwohl wir nur kurz im Isergebirge, der Heimat meiner Vorfahren, weilten, kehrten wir mit vielen schönen Eindrükken nach Hause zurück. Dieser herrlichen Berglandschaft fühlen wir uns eng verbunden und hoffen, daß unser nächstes Wiedersehen nicht in zu weiter Ferne liegt. Gerlinde Bahre
� Reichenberg
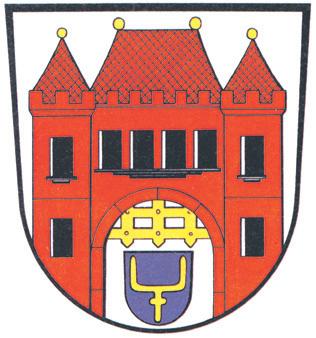
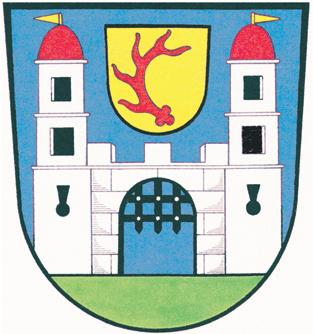
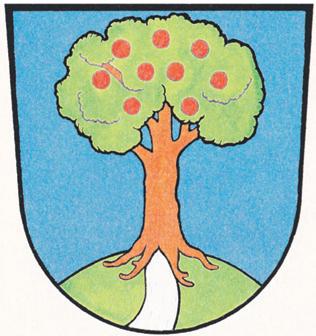
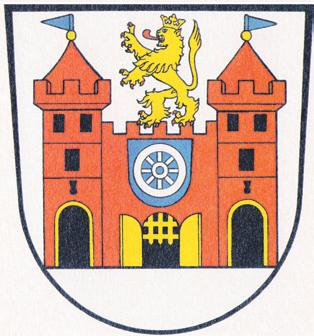
Der heimliche Traum des Direktors des Technischen Museums in Reichenberg, Jiří Němeček, ging in Erfüllung. Das Museum präsentiert seit Mitte Juli den wertvollen Wagen RAF 18/22, der zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in Reichenberg hergestellt wurde. Den Schatz leiht das Nationale Technische Museum in Prag für lange Zeit den Reichenbergern. „Als wir das Museum vor neun Jahren gründeten, war dies eines unserer Ziele“, sagte Němeček.
RAF steht für Reichenberger Automobil-Fabrik. „Der Oldtimer RAF 18/22 ist das einzige erhaltene Fahrzeug dieses Typs auf der Welt“, erläuterte Eva Daňková, Managerin des Technischen Museums Reichenberg. Das ausgestellte Fahrzeug ist auf dem ursprünglichen Fahrgestell mit einer modernen zweiten Karosseriekonstruktion nach dem leichten Nutzfahrzeugtyp FW 25 aufgebaut. Die Renovierung wurde von den Arbeitern der Firma Liaz Holýšov im Jahr 1976 durchgeführt. „Ich hoffe, daß die Rückkehr des RAF-Fahrzeugs nach Reichenberg der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem Nationalen Technischen Museum ist“, meinte Direktor Němeček.
Die Reichenberger Automobil-Fabrik (RAF) wurde von Baron Theodor von Liebieg, Oskar von Klinger und Manfred Ginskey im Nordwesten der Monarchie Österreich 1907 gegründet, und ein Jahr später wurden die ersten RAFAutomobile produziert. Die Motoren stammten von der Reichenberger Firma Linser, die seit 1900 Fahrräder und später Motorräder produzierte. 1912 fusionierte RAF mit Laurin & Klement, und viele Konstruktionen wurden von Laurin & Klement übernommen. Die Produktion der RAF-Wagen endete 1916.

Die RAF-Automobile wurden von Geschäftsleuten und Anwälten, Ärzten und dem Adel bevorzugt. Zeitgenössischen Quellen zufolge fuhren sie den österreichischen Kaiser und König Franz Joseph I., Prinz Alain Rohan oder Graf Clam-Gallas. RAF hatte auch einen Lizenzvertrag mit der Daimler Motor Company in Coventry zum Bau der Knight-Motoren mit Schiebersteuerung. Das war ein großes Privileg, weil immer nur eine Firma in einem Land die Lizenz erhielt. Die Fabrik stellte schätzungsweise rund 3000 Fahrzeuge her. Experten zufolge existieren heute weltweit nur noch zehn Exemplare.
Das 2014 eröffnete Technische Museum Reichenberg steht auf dem ehemaligen Ausstellungsgelände an der Masaryk-Straße nahe des Nordböhmischen Museums. In vier Pavillons sind Autos, Motorräder, Fahrräder und Eisenbahnlokomotiven zu sehen. Ein Schwerpunkt ist die Geschichte der regionalen Straßenbahn. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr. Petra Laurin

Friedland. Der Lokomotivführer Josef Klima (1854–1923) wurde auf dem Friedhof beigesetzt. Seine letzte 100 Jahre alte Ruhestätte wird jetzt als Müllkippe für Bauschutt benutzt.Hier befindet sich auch das Grab von Barbara Klima (1852–1921). Am Abend des 28. Dezember 1936 starb Josef Klima, Holzbildhauer und Kriegsinvalide aus dem Ersten Weltkrieg, mit 48 Jahren im Bezirkssiechenhaus. Der Verstorbene wurde am 31. Dezember 1936 von der Totenhalle des Friedhofes zu seiner letzten Ruhstatt geleitet. Sein Name „Josef Klima – Kriegsinvalide“ wurde von der Friedhofswand abgeschlagen. Auch er war hier beerdigt worden. Text und Bild: Stanislav Beran
Ende April segnete Pfarrer Pavel Andrš aus Raspenau das renovierte Wegekreuz auf dem Hemmrich, das an einem alten Pilgerweg steht.
Das alte Kreuz steht auf einem Granitsockel auf dem Buschullersdorfer Sattel oder Hemmrich im Kreis Reichenberg und ist Teil eines alten Pilgerwegs. Dieser führt von Reichenberg durch die prachtvollen Buchenwälder des Isergebirges nach Haindorf zur Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung. Das Kreuz konnte dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Buschullersdorf und des Vereines Patron restauriert und in seine ursprüngliche Form zurückversetzt werden.
Auf Anregung der Gemeinde nahm der Verein Patron die Renovierung dieses alten und historischen Denkmals in Angriff. Für die Erneuerung des Kreuzes hatte sich insbesondere die Stellvertretende Bürgermeisterin Jiřina Vávrová von der Gemeinde Buschullersdorf stark eingesetzt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 40 000 Kronen. Geplant war nicht nur, daß das Kreuz erneuert wird, sondern auch, daß der gesamte Platz um das Kreuz herum im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen umgestaltet wird.
Die Gemeinde Buschullersdorf übernahm den größten Teil der Kosten für die Erneuerung des Kreuzes und spendete 30 000 Kronen. Den Rest übernahm der Verein Patron. Der Verein versucht in erster Linie, Bergdenkmale zu renovieren. Von Zeit zu Zeit werden auch religiöse Denkmale renoviert. Alleine hätte es der Verein nicht gemacht, aber hier kam der Anstoß von der Gemeinde Buschullersdorf.
An der Feier beteiligten sich auch die Mitglieder des Vereines Patron, die sich aktiv an der Renovierung beteiligt hatten.
Durch ihre Hilfe konnte dieses kleine Juwel vor dem Verfall gerettet werden. Ihnen ist es zu verdanken, daß das in einem desolaten Zustand befindliche Kreuz, das nach dem Tod von Franz Hausmann
Friedland. Die Ruine des am 12. September 2021 komplett ausgebrannten zweistöckigen Wohnhauses in der Bahnhofstraße 769 befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. Die Brandursache bleibt wohl weiterhin ungeklärt. In dem Haus, das zu den schönsten Häusern der Stadt gehörte, lebte bis zum Jahr 1938 die jüdische Ärztefamilie Altschul. Hauseigentümer war damals der Friedländer Bezirksoberarzt, Sanitäts-Oberkommissar und Zahnarzt Dr. Albert Altschul (*29. November 1886), der das Gesundheitswesen in Friedland über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Text und Bild: Stanislav Beran



Franz und Liesl Hausmann, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in dem ehemaligen Forsthaus am Hemmrich niedergelassen hatten, gepflegt. Gemeinsam kümmerten sie sich um viele Denkmale im Isergebirge, und es ist sehr unwahrscheinlich, daß sie das Denkmal, auf das sie jeden Tag von ihrem Fenster aus blickten, vernachlässigt hätten. Außerdem gingen sie an ihm täglich vorbei zum Brunnen, um Wasser zu holen, und nutzten die Wiese hinter dem Kreuz als Weide. Alte Fotos belegen dies. Das ehemalige Forsthaus des Försters Franz Hausmann, der ein großer Liebhaber des Isergebirges war, ist heute auch unter dem Namen „Bei der Ziege“ bekannt. Es handelt sich um ein einzigartiges Gasthaus mit ausgezeichneter Küche und origineller Bedienung. Bestandteil des markierten Wanderweges ist auch der zehn Kilometer lange Lehrpfad Buschullersdorfer Wälder und Felsen, der Besuchern aller Alterskategorien auf interessante Weise mit Spielen und Aufgaben die geschützten Pflanzen- und Tierarten im Reservat vorstellt.

Das Leben des pensionierten Försters Franz Hausmann nahm ein tragisches Ende. Nach langem Leiden verließ er im Alter von 79 Jahren diese Welt freiwillig. Er hatte in den letzten Monaten seines Lebens unter äußerst heftigen Kopfschmerzen gelitten.
langsam in Vergessenheit geriet, jetzt wieder in neuem Glanz strahlt.
Besonders bemerkenswert ist auch, daß die Buchenwälder zwischen den Orten Buschullersdorf und Bad Liebwerda, die sich auf 27 Quadratkilometer Fläche erstrekken, im Juli
2021 zum Natur- und Kulturerbe der UNESCO ernannt wurden. Es ist das erste tschechische Naturdenkmal, das diese Auszeichnung erhielt. Der Sattel ist der höchste Punkt des Pilgerweges. In der Vergan-
genheit war es auch die einfachste Stelle zur Überquerung des Isergebirges.
Die ruhige Ortschaft im nordwestlichen Vorgebirge des Isergebirges ist das Tor zum gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet. Buschullersdorf liegt zwischen dem Haindorfer und Buschullersdorfer Kamm, die sich im Buschullersdorfer Sattel berühren. Das Gebiet unter dem Sattel herum wird auch Hemmrich genannt.
In der Vergangenheit wurden entlang der gesamten Pilgerroute etwa alle 500 bis 600 Meter Kreuze oder andere sakrale Denkmale errichtet. Dieses Kreuz, das zum Gebet und zur Besinnung mahnt, ist eine der Stationen des alten Pilgerweges und befindet sich am höchsten Punkt des Buschullersdorfer Sattels. Die Pilger stiegen von Buschullersdorf auf, und auf der anderen Seite ging es dann nach Haindorf hinab.
Das alte Kreuz war bereits in einem sehr schlechten Zustand. Jahrzehntelang war das Denk-
mal nicht gepflegt worden. Bei den Renovierungsarbeiten wurde auch das ursprüngliche Bildmotiv, das sich auf dem Sockel befand, wiederhergestellt. „In den alten Aufzeichnungen der Pfarrei habe ich herausgefunden, daß es ein Bild der Sixtinischen Madonna war“, sagte Jiřina Vávrová.
Mehr als ein herzlicher Dank für die hervorragende Zusammenarbeit ging an alle, die sich an der Erneuerung des historischen Kreuzes beteiligt haben. Dazu gehören auch die Restauratorin Vanessa Trostová, der Schmied Jan Moravec und der Maler Pavel Koňařík. Gedankt wurde auch der Forstwirtschaft der Tschechischen Republik, die die Restaurierung des Kreuzes auf ihrem Grundstück, das sich gegenüber einer Gaststätte befindet, ermöglichte.
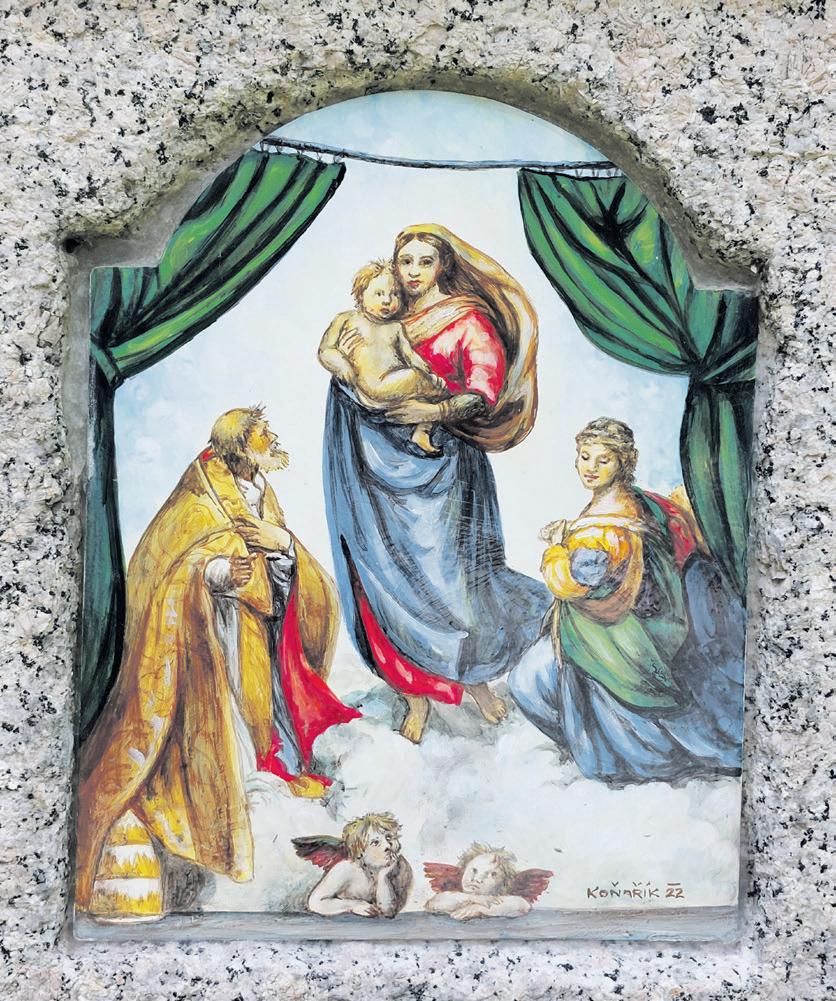
Der Buschullersdorfer
Förster Franz Hausmann und seine Frau Liesl lebten
lange Jahre im Forsthaus in Buschullersdorf. Dieses Haus wird heute nach seinem Namen Hausmannbaude, tschechisch Hausmanka, genannt.
In der Vergangenheit wurde das Kreuz von dem Ehepaar
Den Zeitpunkt seiner Reise in die Ewigkeit hat er selber festgelegt. Er erhängte sich an einem Baum. Man fand ihn erst nach zwei Tagen und brachte zu seinem Gedenken eine kleine Gedenktafel an einem benachbarten Felsen an. Nach seinem Tod geriet er dennoch bald in Vergessenheit.
Franz Hausmann wurde am 19. Februar 1885 in Friedland geboren. Gestorben ist er am 16. September 1964. Seine Beerdigung fand am 23. September 1964 um 15.00 Uhr im Reichenberger Krematorium statt. Seine Spuren enden auf dem Friedhof in Raspenau, wo er seine letzte Ruhestätte fand. Seine Frau Elisabeth – genannt Liesl – überlebte ihren Mann um fast 40 Jahre. Sie starb am 24. November 2001 in Friedland. Ob sie ihre letzte Ruhestätte im selben Grab wie Franz Hausmann gefunden hat, ist allerdings fraglich. Ihr Name befindet sich nämlich nicht auf seinem Grabstein. Stanislav Beran
Der restaurierte gekreuzigte Christus strahlt wieder. Pavel Koňařík schuf dieses Abbild der Sixtinischen Madonna. Bilder: Stanislav Beran � Buschullersdorf/Kreis Reichenberg
Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Eichwald/Kreis Teplitz-Schönau
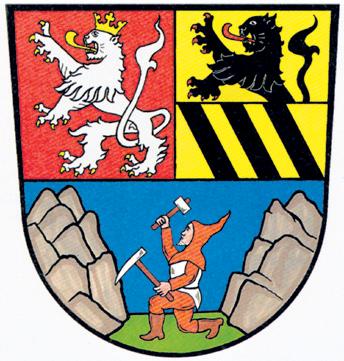
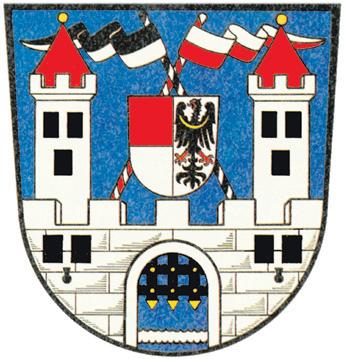

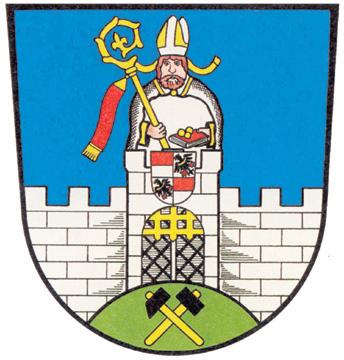
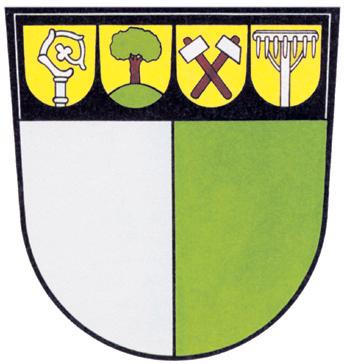

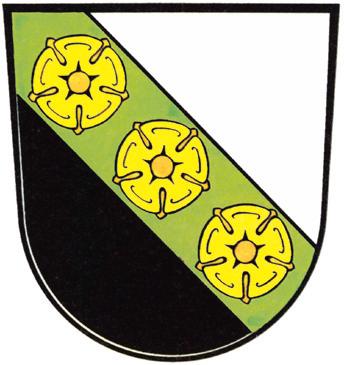

Ende Juli eröffnete das Informationszentrum Eichwald im Haus des Porzellans die Ausstellung „Madonna auf Wanderschaft“ über die Geschichte des Fürstenauer Altars. Jutta Benešová berichtet.
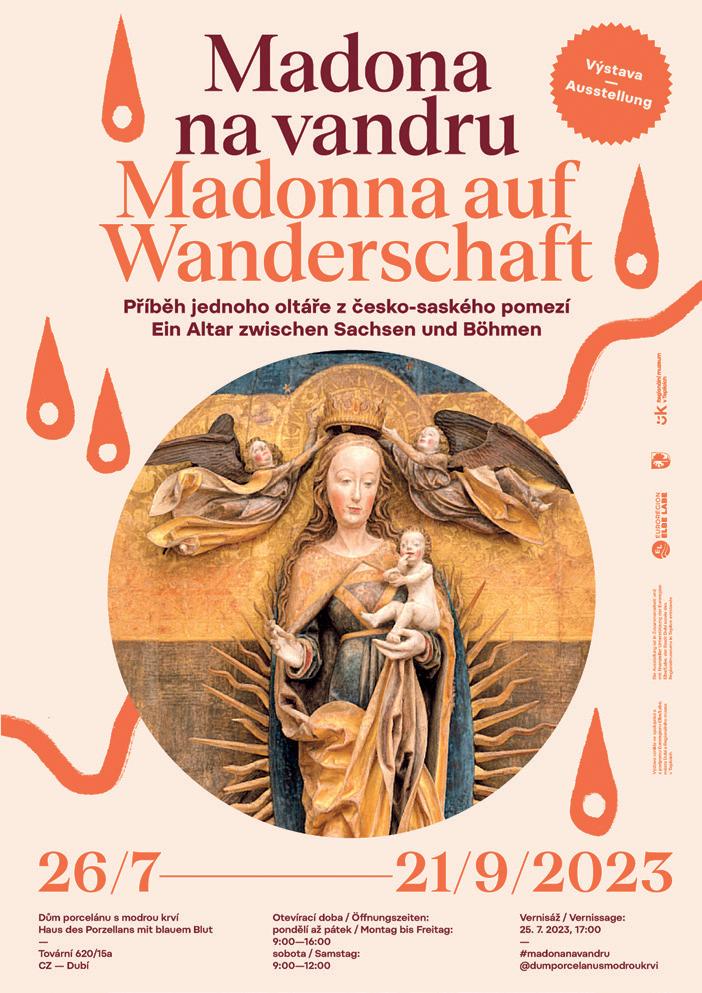

Grüß Gott! Willkommen Pilger und Pilgerin, folgt meinen Spuren über Grenzen hinweg, über Ländergrenzen, Konfessionen, Kulturen, Sprachen und Zeiten. Gemeinsam werden wir nicht nur die sächsisch-böhmische Grenze überschreiten, sondern uns auch unter Katholiken und Protestanten mischen, Bergwiesen und Kirschgärten durchstreifen und ein wenig den Schleier lüften, hinter dem sich Kult und Kunst manchmal verbergen. Wir werden Verehrung sehen und Schändung, vom Ruhm hören und vom jahrzehntelangen Vergessen. Und das alles vor dem Hintergrund der vielen Geschichten, die sich um einen Altar ranken, der der Jungfrau Maria geweiht wurde. Dort, wo ich längere Zeit verweilte, werden auch wir haltmachen. Unterwegs werdet ihr mehrmals zwischen Sachsen und Böhmen hin und herwechseln, aber keine Sorge, ihr braucht keinen Reisepaß. Folgt einfach meinen Spuren, und ihr werdet euch nicht verlaufen! Kommt mit, laßt uns aufstehen und in die Geschichte eintauchen!“ Mit diesen Worten hatte ein Plakat für die Ausstellung geworben.
Der spätgotische Flügelaltar, der um 1495 entstand, war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Altar der Rosenkranzbruderschaft in der Dominikaner-Klosterkirche Sankt Heinrich im sächsischen Pirna. Für diese Hypothese spricht eine Reihe von Indizien. Das sind die Ikonographie des Altars mit der Betonung der
Freuden der Jungfrau Maria, das für die Rosenkranzbruderschaft typische Motiv der Assumpta, die Inschrift mit einem Zitat aus dem Ave Maria in der Aureole, sowie der dominierende Einfluß der Schrift der Legenda aurea des Dominikaners Jacobus de Voragine.


Außerdem sind Verbindungen der Herren von Bünau zu dem Kloster und zum sächsischen Dorf Fürstenau, wohin der Altar später gebracht wurde, belegt. Dank der beweglichen Flügel konnte der Altar je nach Kirchenjahr und den Bedürfnissen der Rosenkranzbruderschaft an-
zu einem festen Begriff in der Region geworden. Auch wir berichteten bereits über das Kirschfest an der Stelle, wo einst die Kapelle mit dem Marienaltar stand (➝ HR 33+34/2022). Auf Anregung des Kurators Jan Kvapíl war nun mit finanzieller Unterstützung der Euroregion Elbe/ Labe und unter Mitwirkung des Regionalmuseums und der Stadt Eichwald diese Ausstellung entstanden. Sie ist zweisprachig, ein sehr natürliches Modell des Fürstenauer Altars, umgeben von zahlreichen Informationstafeln, die Vergangenheit und Gegenwart dieses einzigartigen Kunstwerks dokumentieren, das wie kein anderes die enge Verbindung zwischen Sachsen und Böhmen zeigt. In den letzten Jahren erkundete auch die Archäologin Lucie Kursová die Stelle, an der einst die Marienkapelle in Vorderzinnwald stand. Ihr verdanken wir zwei Vitrinen mit Artefakten der ehemaligen Kapelle wie Glasscherben und Bleiumrahmungen der Fenster sowie Fußbodenfliesen, aber auch Schriftstücke, die die Schenkung des Altars von der Gemeinde Fürstenau an Böhmisch Zinnwald dokumentieren. Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung und wird im November in Dresden und Anfang 2024 in Pirna und Lauenstein laufen.
große Bedeutung des Altars als Bindeglied zwischen Sachsen und Böhmen. Eichwalds Bürgermeister Jiří Kašpar freute sich, daß die Ausstellung solch reges Interesse gefunden habe, und erwähnte auch die Unterstützung seiner Stadt für weitere Treffen von Deutschen und Tschechen wie beim Grenzbuchenfest. Die Teplitzer Museumsdirektorin Jana Lišková, lobte die Zusammenarbeit bei den Vorbereitungen zur Ausstellung und dankte speziell ihren Mitarbeiterinnen Bohuslava Chleborádová und Lucie Kursová für die tatkräftige Unterstützung.
Die zahlreichen auch deutschen Gäste waren durch den Zinnwalder Chronisten Wolfgang Mende, den Direktor des Pirnaer Museums, René Misterek, und die Leiterin des Schloßmuseums Lauenstein, Gabriele Gelbrich, vertreten. Senator Hynek Hanza, Petr Fišer, Leiter des Georgendorfer Vereins und Herausgeber der „Erzgebirgszeitung“, der Historiker Vít Honys und weitere Persönlichkeiten waren ebenfalls gekommen. Für die musikalische Begleitung sorgte Michael Pospišil, ein Kenner der Marienwallfahrten. Bei einen Imbiß kam es zu einem regen Gedankenaustausch.
Einladung zur Hauptversammlung des Heimatkreisvereins Teplitz-Schönau Freundeskreis in Teplitz-Schönau im Hotel Prince de Ligne am Donnerstag, 31. August, 16.00 Uhr, Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung
2. Gedenken unserer Verstorbenen und der Opfer des Krieges in der Ukraine
3. Feststellung der Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung (einfache Mehrheit)
4. Bericht des Vorsitzenden über die Tätigkeit des Vereins
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes
8. Entlastung des Schatzmeisters
9. Verschiedenes, Vorschläge, Wünsche
gepaßt werden. Im 16. Jahrhundert wurde er mit marianischen Reliefs ergänzt. Heute steht der restaurierte Altar im Teplitzer Regionalmuseum im Schloß. Zur Ausstellungseröffnung waren erstaunlich viele Gäste gekommen. Ist doch der Fürstenauer Altar, für den 1887 eigens eine Kapelle im ehemaligen böhmischen Vorderzinnwald errichtet worden war, seit einigen Jahren
Bereits Mitte Juli eröffnete an gleicher Stelle im Erdgeschoß des Info-Zentrums eine Ausstellung über die reiche Bergbau-Geschichte von Böhmisch Zinnwald. Sie gibt eine besondere Einstimmung für die nun eröffnete Ausstellung „Madonna auf Wanderschaft“ im Obergeschoß.
Jan Kvapíl eröffnete die Ausstellung und dolmetschte die weiteren Reden. Rüdiger Kupsch, Geschäftsführer der Euroregion Elbe/Labe, betonte die
Am 19. und 20. August findet am Grenzübergang Zinnwald wieder das bekannte Grenzbuchenfest statt, das schon zu einer lieben Tradition für alle diesseits und jenseits der Grenze geworden ist. Gleichzeitig findet aber auch das Marienfest in Ossegg statt, wozu auch Führungen durch die prächtig renovierte Klosterkirche gehören. Es gibt also genug Gelegenheiten zu grenzüberschreitenden Begegnungen und dem allmählichen Zusammenwachsen im Geiste der Versöhnung beider Völker.
■ Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August: Treffen der Heimatgruppe Graupen und Umgebung. Freitag ab 18.00 Uhr gemütliches Beisammensein mit Freunden aus Graupen im Restaurant Pod Kaštany, Revoluční 133, Maršov, 417 42 Krupka. Samstag Ausflug nach Aussig mit Besuch der Ausstellung „Naši Němci – Unsere Deutschen“ im Stadtmuseum, Seilbahnfahrt auf die Ferdinandshöhe/Větruše, dort Mittagessen; anschließend Gedenken auf der Dr.-EdvardBeneš-Brücke vor der Tafel „Zum Gedenken an die Opfer der Gewalt vom 31. Juli 1945“; 19.00 Uhr Festveranstaltung im Hotel-Restaurant Rosenburg, Horská 12, 417 41 Krupka mit Mitgliedern der Stadtverwaltung, Gästen und Freunden aus Graupen. Sonntag Besuch des Gottesdienstes in der Basilika der Schmerzhaften Mutter Gottes in Mariaschein; Mittagessen im Restaurant Mückentürmchen. Auskunft: Sibylle Schulze, Müggelschlößchenweg 36, 12559 Berlin, Telefon (0 30) 64 32 66 36, eMail sibyllemc@web.de

Museumsdirektorin Jana Lišková, Eichwalds Bürgermeister Jiří Kašpar, Kurator Jan Kvapíl und Rüdiger Kupsch, Geschäftsführer der Euroregion Elbe/Labe.
Artefakte der verschwundenen Kapelle in Vorderzinnwald.
■ Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: 9. Teplitz-Schönauer Kreistreffen in der Heimat. Donnerstag eigene Anreise nach Teplitz-Schönau (Teplice), Hotel Prince de Ligne (Zámecké náměstí 136); 19.00 Uhr dort Abendessen; anschließend zwei Dokumentarfilme über die Zeitzeugen Pater Benno Beneš SDB (1938–


WIR
Jan Kvapíl mit Jiří Bartoš und Marek Fanda. Bartoš und Fanda verantworten die künstlerische Gestaltung der Ausstellung.


2020) und Hana Truncová/John (1924–2022). Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Saubernitz (Zubrnice) im Böhmischen Mittelgebirge; dort Besichtigung des Freilichtmuseums; anschließend Mittagessen in der Dorfgaststätte und Weiterfahrt nach Leitmeritz (Litoměřice); von dort Schifffahrt auf der Elbe mit Kaffee und Kuchen nach Aussig (Ústí nad Labem); Rückfahrt zum Abendessen in der Teplitzer Brauereigaststätte Monopol. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt in die Königstadt Kaaden (Kadaň); dort Besichtigung des Franziskanerklosters mit Mittagessen in der Klostergaststätte und Rundgang; anschließend Kranzniederlegung auf dem Friedhof am Denkmal für die Opfer des 4. März 1919; 19.00 Uhr festliches Konzert in der Schönauer Elisabethkirche; anschließend Abendessen im Wirtshaus. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienstmöglichkeit in der Dekanatskirche Johannes der Täufer am Schloßplatz und eigene Heimreise. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag inklusive drei Übernachtungen, Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, allen Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Schiff und Konzert pro Person im Doppelzimmer 435 Euro, im Einzelzimmer 520 Euro. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Auskunft: Erhard Spacek, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail spacek@teplitz-schoenaufreunde.org
Wir wünschen unseren treuen Heimatruf-Abonnenten, die im August Geburtstag feiern, von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes überreichen Segen.
■ Bilin. Dr. Gerda Plattig/Schlager, Steinforststraße 30, 91056 Erlangen, 17. August 1940.
■ Rothaugest/Kreis Bilin. Dr. Alois Hartmann, Kettelerstraße 36, 63303 Dreieich, 1. August 1932.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
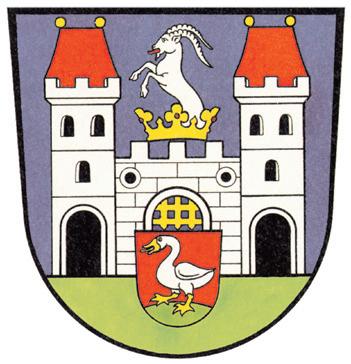
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der fünfte Teil über den Dechanten František Lorenc (1882 –1941).
■ Bischofteinitz. Am 28. Juni starb die heimatverbliebene
Landsmännin Maria Steinbach im Alter von 94 Jahren in Bischofteinitz. Sie war uns bei unseren Verbliebenen-Treffen stets

eine große Hilfe. Maria bereitete unsere Treffen vor und half, wenn nötig, als Dolmetscherin aus. Bei unserem Abschluß-Treffen am 18. März war sie noch mit dabei, doch mithelfen konnte
Maria nicht mehr. Ausgeholfen hat uns dafür Inge Burešová, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Auch sie ist deutscher Abstammung. Mit einem Blumengruß haben wir uns bei der
Beisetzung in Bischofteinitz am 10. Juli von Maria verabschiedet. Möge sie in Frieden ruhen. Den Angehörigen gilt meine aufrichtige Anteilnahme.
Marianne MaurerChrista Bucher berichtet über die Orgel der ehemaligen Grafenrieder Sankt-Georgs-Kirche.
Niemand weiß, wie lange die Orgel in dem alten Schuppen im Klentscher Pfarrgarten lag, wer sie abgebaut und dorthin gebracht hatte. Nur eines konnte man erkennen: Dies wurde in aller Eile getan. Und es handelt sich um eine alte Orgel, weil neben den zahlreichen Brettern samt Ornamenten eine Kiste mit Orgelpfeifen aus Metall stand. Nur durch Zufall entdeckte man sie, weil der Schuppen ein neues Dach brauchte und deshalb ausgeräumt werden mußte. Mittlerweile weiß man, daß es sich um die Orgel aus Grafenried handelt. Und die wird nun originalgetreu rekonstruiert. Diese freudige Nachricht von der Existenz der Grafenrieder Orgel verkündete der frühere Ortsbetreuer des Pfarrsprengels Grafenried, Hans Laubmeier, beim Grafenrieder Treffen (➝ HB 30/2023).
Die Orgel befindet sich derzeit in Metzling-Trebnitz im ehemaligen Landkreis Bischofteinitz in einer Orgelwerkstatt. Dort soll sie restauriert werden. Das bestätigte Pfarrer Johannes Nepomuk Bejcek aus Brünn, in dessen Besitz sich die Orgel befindet. „Ich habe schon lange nicht mehr daran geglaubt, daß unsere Orgel noch existiert“, freute sich Laubmeier. Zwar sei bei ihm kurzzeitig Hoffnung aufgekeimt, als die Kirche in Wassersuppen renoviert worden sei. Diese habe sich aber schnell wieder zerschlagen.
Zuzana Langpaulová habe jedoch in Erfahrung gebracht, daß sich in der Orgelwerkstatt in Trebnitz eine zu restaurierende Orgel befinde – die Grafenrieder Orgel. Davon wollte sich Laubmeier selbst ein Bild machen. Er fuhr mit einigen Begleitern nach Trebnitz, um sich über
den Stand der Restaurierungsarbeiten zu informieren. Marek Vorlíček nahm die Besucher in der Orgelwerkstatt in Empfang und führte sie in eine Lagerhalle, in der zehn Orgeln standen. Laubmeier konnte die Grafenrieder auf Anhieb erkennen. Vorlícěk, der nicht nur Orgelrestaurator, sondern auch Musiker,
gewesen, daß sie vom Orgelbaumeister Johann Nikolaus Gartner aus Tachau stamme.
Er, so Vorlíček, sei daraufhin nach Grafenried gefahren, um die Kirche zu besichtigen. Dabei habe er aber feststellen müssen, daß es hier keine Kirche mehr gebe. Er habe also eine Orgel bei sich in der Werkstatt gehabt, die
Lorenc sieht auch die Notwendigkeit, einen neuen Friedhof anzulegen, da der gegenwärtige fast komplett belegt ist. Die Grabstättengebühren fließen in den neuen Friedhofsfonds im Patronatsamt.

Spender aufgelistet. Ingesamt haben 273 Einzelpersonen beziehungsweise Familien durch kleinere und größere Spenden dieses Glockenprojekt ab dem Jahr 1932 unterstützt. Leider werden die zwei großen dieser 1936 geweihten Bronzeglocken am 2. Februar 1942 wieder vom Turm genommen und für den Zweiten Weltkrieg (1939–1945) eingeschmolzen.
Sänger, Chorleiter, Dirigent und Organist ist, erzählte, wie die Orgel gefunden wurde. Der Klentscher Pfarrer habe ihn damals – vor mittlerweile 17 Jahren – angerufen. Er habe sich dann die Orgel beziehungsweise das, was von dieser noch übrig gewesen sei, angeschaut und sofort erkannt, daß es sich hier um ein einzigartiges Stück handle. Er habe zu recherchieren begonnen und im Archiv von Bischofteinitz Dokumente gefunden, die die Orgel eindeutig der Grafenrieder Kirche zugeordnet hätten. Außerdem sei an typischen Merkmalen schnell klar
keine Heimat mehr gehabt habe. Vier Jahre später habe er sich an Pfarrer Bejcek aus Brünn gewandt, der bereits mehrere Orgeln gerettet habe. „Das war ein Glückstag für die Orgel.“
Dann begannen die Restaurierungsarbeiten. Da die Orgel mehr als 300 Jahre in einer konstanten Feuchtigkeit gestanden habe, sei es besonders wichtig, diesen Zustand auch in der Halle herzustellen, meinte Vorlíček.


Das zum Restaurieren benötigte Holz müsse außerdem besondere Kriterien erfüllen. Es müsse bei dieser Orgel Fichten- oder Tannenholz aus der Region sein,
im Winter geschlagen und an der Luft getrocknet. Für eine Orgel sei es ideal, wenn eine Restaurierungszeit 18 Monate dauere.
Wie lange die Restaurierung der Grafenrieder Orgel dauere, richte sich nach den Förderund Spendengeldern. Erst wenn wieder eine bestimmte Summe zusammengekommen sei, könne man weiterarbeiten. Als hervorragend bezeichnete Vorlíček, daß gut 70 Prozent des Orgelgehäuses und der Verzierungen vorhanden seien. Fehlen würden die einmanualige Originalklaviatur, die aber anhand von Fotos rekonstruiert werden könne, und das Windwerk, also der Blasebalg. Von den circa 200 Metall- und 102 Holzpfeifen, die eine Länge von 15 Zentimetern bis 2,60 Meter hätten, seien 30 Prozent vorhanden. Um die Fehlenden zu ersetzen, habe man erst einmal die Zusammensetzung der Zinn-Blei-Legierung bestimmen müssen, denn die neuen Pfeifen sollten den Klang des Originals – eine Barockorgel –wiedergeben.
Die 100prozentige Bestätigung, daß diese Orgel die von Orgelbauer Johann Nikolaus Gartner aus Tachau gefertigte Orgel ist, war ein gefaltetes Papierblatt im Hohlraum des Orgelschrankes, auf dem der Name des Orgelbauers und das Auftragsdatum stehen, also dessen Visitenkarte. Die Grafenrieder Orgel hatte Glück im Unglück: Sie ist in die Hände eines Detektivs gefallen, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und zusammen mit seinen fünf Kollegen die Orgel wieder in ihren Originalzustand zurückversetzen wird. Kirchenmaler, die der Orgel und ihren Ornamenten wieder Farbe geben, und die Pfeifensetzer werden dem wertvollen Barockinstrument sein einstiges Aussehen aus dem Jahr 1789 zurückgeben.
Am 15. November 1936 erhalten drei neue Glocken für die Hostauer Dechanteikirche die Glockenweihe. Die Firma Richard Herold in Komotau ist zuvor von Dechant Lorenc beauftragt worden, Ersatzglokken für die am 24. Februar 1929 zerbrochenen Stahlglocken anfertigen zu lassen. Die neuen Bronzeglokken wiegen 698 Kilogramm und 499 Kilogramm. Als neue dritte Glocke wurde ein Wandlungsglöckchen mit 23 Kilogramm angeschafft. Die großen Glocken erhalten die Namen ihrer Vorgänger: Mater Dolorosa und Johannes Nepomuk. Hinsichtlich der Stimmung der Glocken auf dem Kirchenturm ergibt sich aus dem Ton e‘ für die alte Stahlglocke von 1878 und den Tönen g‘ und a‘ für die beiden neuen Glocken ein sogenanntes Te-Deum-Geläute. Die feierliche Glokkenweihe nimmt Prälat Wenzel Feierfeil vor, der auch die Festpedigt hält. Zwölf Geistliche aus der näheren Umgebung assistieren dabei.
Die Rechnung vom 18. November 1936 der Firma Herold beträgt 23 981,85 Kronen. Zuzüglich für Zimmermanns- und Schlosserarbeiten sowie Spesen belaufen sich die Kosten auf insgesamt 27 637,15 Kronen. Die Pfarrgemeinde hat viel gespendet, so daß nur 4000 Kronen Schulden zur Begleichung der Rechnungsposten übrig bleiben.
In einem eigenen Journal hat Dechant Lorenc die einzelnen
Am 30. April 1937 kommt der Prager Weihbischof Johann Remiger (1879–1959, beigesetzt im Liebfrauendom zu München), in Vertretung des Diözesanbischofs von Budweis, Šimon Bárta, nach Hostau, um das Sakrament der Firmung zu spenden. In seiner Begleitung befinden sich der Budweiser Kanoniker Josef Neubauer und der Zeremoniar Jaroslaus Kadlec. Die hohen Gäste sind in der Hostauer Dechantei bis zum 6. Mai 1937 untergebracht, von wo aus sie die Pfarreien Muttersdorf, Waier, Melmitz und Schüttarschen visitieren.
Bei seinem Eintreffen in Hostau wird der Weihbischof von Bürgermeister Franz Bauriedl zusammen mit der gesamten Stadtverwaltung, den Beamten des Bezirksgerichts, des Steueramts, der Leitung des Militärgestüts und der Gendarmerie empfangen. Ferner sind alle Vereine, die Lehrer mit der Schuljugend, zahlreiche Gläubige und die Geistlichen aus der Nachbarschaft gekommen. Lorenc beschreibt den Verlauf als schön und erhebend, auch nennt er den Weihbischof liebenswürdig und leutselig. Am 1. Mai kommt sogar der Patronatskommissar Karl Heger aus Bischofteinitz, um den Bischof zu begrüßen.
Über die auch am 1. Mai 1937 in Hostau stattgefundene Generalvisitation gibt das Protokoll des bischöflichen Konsistoriums in Budweis vom 20. September 1937 Auskunft. Darin wird festgehalten, daß der äußere bauliche Zustand der Dechanteikirche gut ist, und daß sie im Inneren angemessen restauriert worden sei. Fortsetzung folgt
■ Sonntag, 27. August, 11.00
Uhr, Muttersdorf: Gottesdienst anläßlich des Patroziniums in der Sankt-Bartholomäus-Kirche. Bereits am Freitag, 25. August beginnt das Dorffest mit Spielen,
Tanz und Musik. Auskunft: Ortsbetreuer Roland Liebl, Paul-Gerhardt-Straße 14, 71672 Marbach am Neckar, Telefon (0 71 44) 3 91 77, eMail roland.liebl@gmx. net

Herzlich gratulieren wir im August Sigmar Mahal, Ortsbetreuer von Schiefernau, am 8. zum 84. Geburtstag; Andreas Zuber, ehemaliger Ortsbetreuer von Schiefernau, am 10. zum 92. Geburtstag; Manfred Maschauer, Mitarbeiter des Heimatboten, am 12. zum 85. Geburtstag; Anna Hitzler, Ortsbetreuerin von Murchowa, am 16. zum 93. Geburtstag
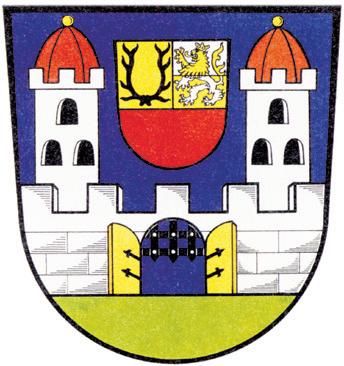
sowie Walter Schröpfer, Ortsbetreuer von Rindl und Ehrenkreisrat, am 20. zum 83. Geburtstag. Wir wünschen den Landsleuten alles Gute, Gottes Segen sowie noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer

Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon

@online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02,
Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
n Sonntag, 20. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
to mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
Häuserreihe in Zummern, davor war früher der Dorfweiher. Rechts Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Flegels Neffe und Professor Dr. Willy A. Flegel auf dem alten Weg von Zummern nach Neustadtl.
� Zummern
Im Dezember hatten wir per Mail vereinbart, daß wir uns am Montag, den 12. Juni um 12.00 Uhr an der Bushaltestelle in Zummern treffen. Beide stammen wir von Zummerauern ab: Willy
A. Flegels Mutter stammt aus dem Haus Nr. 18 der Familie Rötsch, und ich aus der Neumühle, Zummern Nr. 40.
Die Mutter Flegels lebt im südhessischen Dieburg und ist nicht mehr reisefähig. Ihr Sohn Willy kam aus Washington DC, wo er außerordentlicher Professor am Georgetown University Medical Center ist. Diese Universität ist die älteste römisch-katholische, von Jesuiten geleitete Universität in den USA. Sie hat ihren Sitz im noblen Washingtoner Stadtteil Georgetown und ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt. Flegels Spezialgebiet ist Transfusionsmedizin.
Nur fünf Minuten verspäteten wir uns. Ich kam aus Altenmarkt an der Alz und Flegel brachte eine südkoreanische Pathologin aus seiner Klinik und den Sohn seines Cousins mit, der eben Abitur gemacht hatte. Wir gingen durch Zummern, tschechisch Souměř.
Bis auf wenige Anwesen sind die Häuser restauriert und die Gärten gepflegt. Doch scheinen mehr als die Hälfte der Häuser nur wochenends bewohnt zu sein. Dort, wo der Weg nach Godrusch führte, wurden schöne Bungalows gebaut, die Gärten sind sehr groß und gepflegt. Das Haus der Familie Rötsch suchten wir vergebens, es steht nicht mehr. Es hatte die Hausnummer 18 und stand schräg gegenüber der Dorfmühle mit der Nummer 23, die Joseph Himmel betrieb. Heute ist nur mehr der Bach unter der kleinen Brücke zu erkennen.

Unser nächstes Ziel war die Neumühle mit der Hausnum-

mer 40, mein Geburtsort. Willy
A. Flegel war noch nie hier gewesen. Von dem ehemaligen Besitz steht heute noch ein Holzplatz mit Sägewerk den ein Gat-
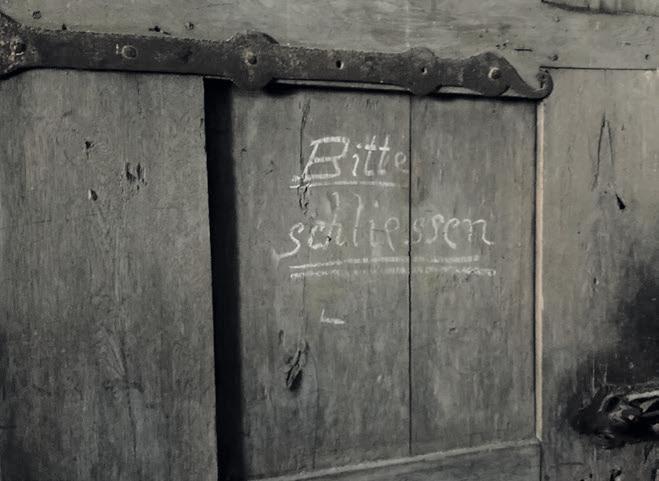
An den Friedhof grenzte das Judenviertel, dessen Häuser großteils renoviert sind. Wir standen am Haus Nummer 20, wo im Hinterhof die 1938 zerstör-
haus sehen. Im Stadtplan des Neustadtler Heimatbuches fand ich als Geburtshaus von Edmund Weil das Haus mit der Nummer 20, das nahe am Judenviertel steht. Fotografien wurden gemacht.
n Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram; 17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Lore-

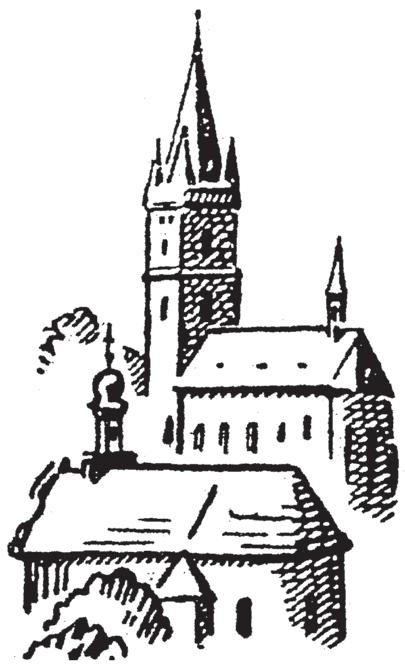

n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
ter umgibt. Vom Wohnhaus erkennt man das Blechdach. Alles ist stark eingewachsen und verändert. Wir fuhren weiter zum Neustadtler Friedhof. Hier gibt es kein Grab der Familie Rötsch, aber eines der Familie Wolf, das eine Familie Tesar be-



te Synagoge war. Aus der Neustadtler Judengemeinde stammte Edmund Weil. Er wurde hier am 16. April 1879 geboren, studierte Medizin und wurde Universitätsprofessor an der Deutschen Karls-Universität in Prag. Er war dort Lehrstuhlinhaber und
Anna Sudová aus Haid öffnete uns das Tor zur katholischen Pfarrkirche des heiligen Wenzel. Hierher waren unsere Vorfahren eingepfarrt. Hier steht das Taufbecken, wo sie getauft wurden. In der Sakristei fand ich, wie vor 20 Jahren, den schön bemalten Schrank mit den Pfarrergewändern und vor allem die schöne gotische Muttergottes in der Nische über der Eingangstür. Durch die Tür, die zur Stiege zur Kanzel führt, gelangten wir in das Untergeschoß des romanischen Turms, wo ein altes Taufbecken aus Granit steht. An der Türe steht noch mit Kreide geschrieben „Bitte Türe schliessen“. Ich erklärte Flegel und seinen Mitreisenden den Hochaltar, die Kreuzwegstationen und die Gemälde im Chorraum, die Pfarrer Vladimír Born hatte renovieren lassen. Wir besuchten die große Statue des heiligen Johannes von Nepomuk und fuhren dann weiter nach Haid, wo wir das Mittagessen nachholen konnten. Die Reisegesellschaft Flegel übernachtete im Hotel Merica und fuhr am nächsten Tag in den Böhmerwald nach Oberplan zum Haus von Adalbert Stifter.

Die zweisprachige Inschrift: „In dankbarer Erinnerung an Monsignore Vladimír Born, den Erneuerer unserer Wallfahrt in den Jahren 1990 bis 2016. Am 8. September weihte Monsignore Tomáš Holub, II. Bischof von Pilsen, die Loreto ein.“ Das war anläßlich 350 Jahre Wallfahrt zur Loreto in Haid.
n Eschowitz. Am 24. Juni starb Anna Luft/Lamm im Pflegezentrum Pur Vital im oberbayerischen Trostberg mit 103 Jahren. Sie kam am 12. November 1919 als drittes von fünf Kindern der Eheleute Lamm in Eschowitz zur Welt. Nach achtjähriger Schulzeit begann sie auf dem Gutshof zu arbeiten, auf dem bereits ihr Vater arbeitete. Zwar wäre sie lieber Floristin geworden, doch die Berufsschule war weit weg und das Geld knapp. So arbeitete sie bis zur Vertreibung 1946 in der Land- und Hauswirtschaft.
verladen, die uns nach Deutschland bis hin nach Traunstein brachten.“
Neustadtl: Willy A.

setzt hat. Zwei schwarze Glastafeln mit den Namen Tesar sind an den Grabstein der ehemals Wolfschen Gruft geschraubt. Wir finden an der westlichen Friedhofswand noch gut erhaltene Steine mit den Namen Prinz, Himmel, Höring und Hamperl. Das Gras war gemäht.

Direktor des serologischen Instituts. In jungen Jahren starb er an einer Fleckfieberinfektion am 15. Juni 1922 in Lemberg. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte er einen Impfstoff entwickeln und erlag einem Selbstversuch.
Professor Willy A. Flegel, auch Serologe, wollte dessen Geburts-
Das war ein schönes Treffen in der gemeinsamen Heimat Zummern und Neustadtl.
Willy Flegel schwärmte davon, was wohl die Amerikaner aus der Story machen würden: Edmund Weil, aus dem kleinen Judenviertel in Neustadtl, Lehrstuhlinhaber an der Karls-Universität in Prag, Serologe, Tod durch Selbstversuch. Ich bat ihn, das doch zu realisieren.
Wolf-Dieter Hamperl
Über diese berichtete sie dem „Trostberger Tagblatt“ anläßlich ihres 103. Geburtstages: „60 Kilogramm durften wir mitnehmen, und wir wurden in Viehwaggons
Mit Mutter und zwei Brüdern kam sie bei einem Bauern unter. Über weitere Stationen strandete sie in Trostberg, wo sie den Marienbader Anton Luft kennen und lieben lernte. Sie heirateten 1956, Sohn Sepp kam zur Welt, doch 1972 erlag Anton Luft einem Betriebsunfall. Anna Luft nahm ihre Mutter zu sich. Die paßte auf Sepp auf, und Anna verdiente den Lebensunterhalt. 2004 starb Sepp mit nur 55 Jahren. Große Freude bereitete ihr ihr Enkel Joachim, der sich bis zu ihrem Tod liebevoll um sie kümmerte. Möge sie in der ewigen Heimat in Frieden ruhen. nh
Wir gratulieren folgenden treuen Abonnenten des Tachauer Heimatboten, die im August Geburtstag feiern, von Herzen und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
n Maschakotten. Am 20. Luitgard Puhr/Wurdack (Räs‘n, HausNr. 12), 87 Jahre. Reinhold Wurdak Ortsbetreuer
n Strachowitz. Am 29. Josef Hermann (Gauchala), 82 Jahre. Werner Schlosser Ortsbetreuer
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im August Helga Ernst, Stellvertretende Ortsbetreuerin von Ratzau, am 3. zum 62. Geburtstag und Manfred Maschauer, Ortsbetreuer von Neuzedlisch, am 12. zum 85. Geburtstag
Wir wünschen alles erdenklich Gute, Gesundheit sowie Gottes reichen Segen und danken für den Einsatz für unsere Heimat. Sieglinde Wolf
❯ Kultur
Der Wissenschaftler stammte aus dem deutsch-böhmischen
❯ Aus der alten Heimat
Am 22. Juni konnte Monsignore Havelka im Hotel Stephan in Leitmeritz vierzehn ehemalige Bewohner des Kreises Leitmeritz begrüßen.
Sie kamen ehemals aus Leitmeritz, Lobositz, Schüttenitz, Skalitz und Trschebautitz. In einzelnen Gruppen besuchten sie ihre alten Heimatorte und kamen meist am Abend wieder im Hotel Stephan zusammen.
Die Schüttenitzer Gruppe fuhr am Freitag zur Lorette, zur Skalitzer Einsiedelei, zum Schüttenitzer Friedhof und anschließend nach Nutschnitz zum Mittagessen. Abends trafen wir uns im Dom, wo Bischof Jan Baxant sein goldenes Priesterjubiläum mit einem Hochamt feierte. Vierzig Priester, sieben Domherren und ein hervorragender Chor begleiteten den Jubilar.

Samstag war zuerst ein Stadtgang angesagt, dann fuhren wir zur Felsenburg Bürgstein bei Böhmisch Leipa. Alle bewältigten die 140 Stufen auf den Felsen. In Graber gab es die Pestsäule und auf dem Friedhof eine Tafel, die auf die ehemalige Deutsche Bevölkerung hinweist, zu sehen.
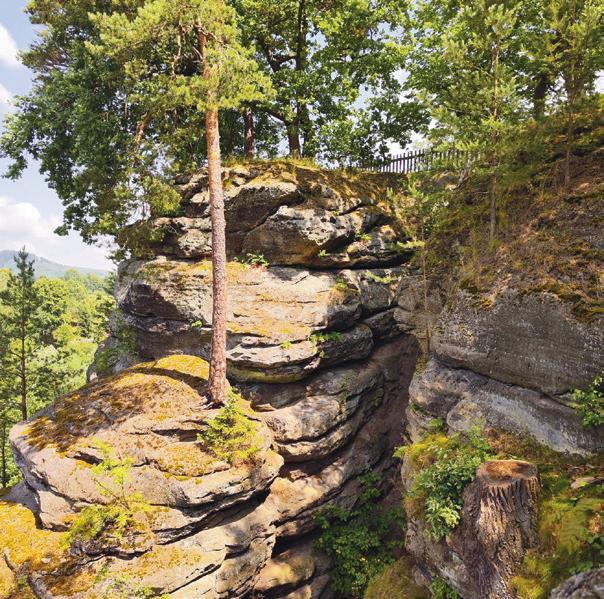

Petrus und Paulus. Hier war auch der Leitmeritzer Bischof anwesend, der die deutschen Kirchenbesucher in deutscher Sprache begrüßte. Monsignore Havelka hatte im Schüttenitzer Schloß für alle Besucher des Gottesdienstes ein Buffet aufgebaut. Wir saßen eine geraume Zeit beisammen und auch Bischof Baxant fand Zeit, sich mit uns zu unterhalten. Es wurde ein langer Abend.

Radon wurde am 16. Dezember 1887 in Tetschen geboren. Hier besuchte er auch die Grundschule und ab 1897 das Gymnasium in Leitmeritz. 1905 übersiedelte er mit seinen Eltern nach Wien.
1910 promovierte Radon an der Universität in Wien zum Doktor der Philosophie. Das Wintersemester verbrachte er auf Grund eines Stipendiums in Göttingen, wo er unter anderem Vorlesungen von David H ilbert hörte. Danach war er Assistent an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn und von 1912 bis 1919 Assistent an der Lehrkanzel Mathematik II der Technischen Hochschule in Wien, 1913/14 habilitierte er sich an der Uni Wien.
1919 wurde Johann Radon als außerordentlicher Professor an die neu gegründete Universität Hamburg berufen. 1922 erhielt er eine Professur an der Universität Greifswald und 1925 an der Universität Erlangen. Ab 1928 war er Ordinarius an der Uni Breslau. Wegen der drohenden Belagerung durch die Rote Armee mußte er im Januar 1945 mit seiner Familie Breslau verlassen. Auf Umwegen gelangten sie nach Innsbruck, wo die Schwester seiner Frau lebte. Nach einem Zwischenspiel an der dortigen Universität wurde er am ersten Oktober 1946 zum Ordinarius am Mathematischen Institut der Uni Wien ernannt. Im Studienjahr 1954/55 war er Rektor der Universität Wien.
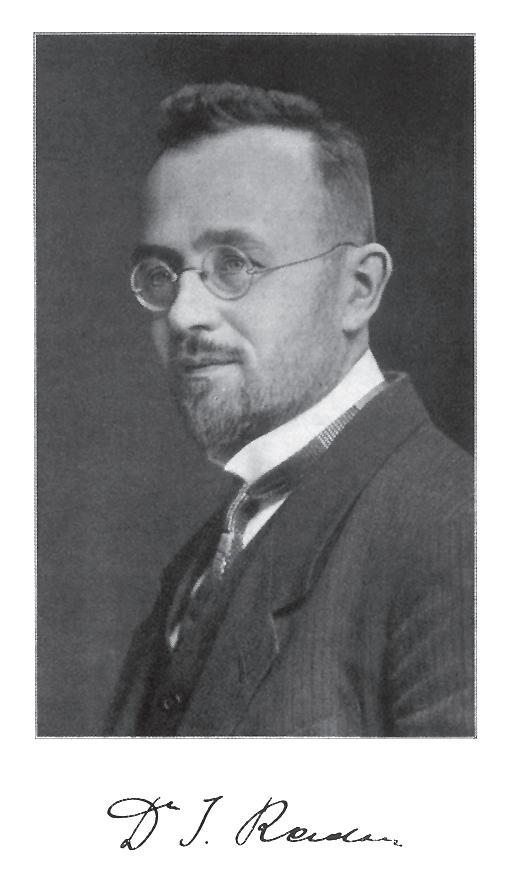
Seit 1939 korrespondierendes Mitglied, wurde Radon 1947 wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und von 1952 bis zu seinem Ableben war er Sekretär ihrer mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse. In den Jahren von 1948 bis 1950 war er ebenfalls Präsident der österreichischen Mathematischen Gesellschaft.
Am Sonntag fuhren wir über Pokratitz, Mentau, Welbine „ins Gebirge“, wie unsere Vorfahren sagten. Dann ging es nach Triebsch und um den Geltsch herum nach Lewin. In der alten Rundkirche sahen wir den eingemauerten Deckenschlußstein mit dem Lewiner Kater, der aber wohl ein Löwe sein soll. Abends versammelten wir uns in der Schüttenitzer Kirche zur Messe für die Kirchenpatrone
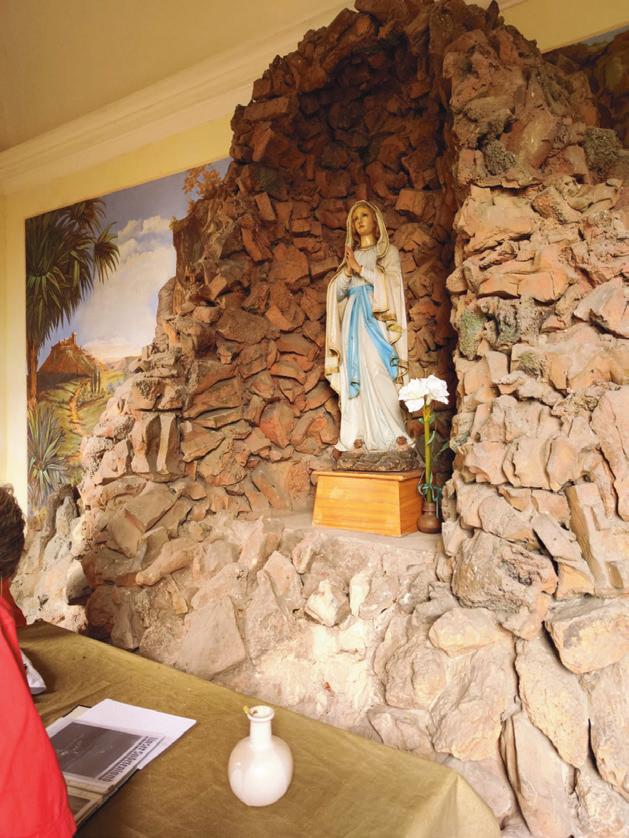
Am Montag fuhren wir nach Dubitz und konnten im Dubitzer Kirchlein eine stille Andacht halten und die Aussicht genießen. Der Abschluß war in der Ferdinandshöhe in Aussig bei einem schmackhaften Mittagessen.
Die Tage bei schönem Wetter vergingen schnell und am nächsten Tag wurde die Heimreise angetreten. Geplant ist, im Juni 2024 wieder in die alte Heimat nach Leitmeritz zu fahren.
1916 erfolgte seine Schließung der Ehe mit der Hauptschullehrerin Marie Rigele, die naturwissenschaftliche Fächer unterrichtete. Drei Söhne des Ehepaares starben in jugendlichem Alter, die 1924 geborene Tochter Brigitte studierte in Innsbruck Mathematik und wurde dort promoviert. 1950 heiratete sie den österreichischen Mathematiker Erich Bukovics.
R adon, der am 25. Mai 1956 in Wien starb, war ein äußerst vielseitiger und produktiver Wissenschaftler. Mit seinem Namen verbunden ist vor allem die Radon-Transformation, die in der Computertomographie verwendet wird. Mit Hilfe dieser Technik werden beim Patienten die inneren Organe untersucht und auch Geschwüre aufgespürt. Auch die Radonzahlen, der Satz von Radon sowie der in der Maßtheorie bedeutsame Satz von Radon-Nikodym verweisen auf seine wissenschaftlichen Er folge.
❯ Geschichte
Georg Pohlai
Der 1884 in Tschalositz bei Leitmeritz geborene Gustav Standera besuchte die Lehrerbildungsanstalt in Komotau.
Er legte dort auch die Fachlehrerprüfung ab. Als recht junger Lehrer kam er ins Riesengebirge und unterrichtete in Mönchsdorf, dann in Keilbauten, Spindelmühle und zuletzt in Siebengründen. Kaum jemand kannte die Geschichte des
Fremdenverkehrsortes Spindelmühle und des Riesengebirges so gut wie er. Als Lehrer gelang es ihm, gerade die Baudenkinder zur Liebe zu ihrer schönen Gebirgsheimat zu erziehen. Die Spindelmühler wählten Standera zu ihrem ehrenamtlichen Gemeindevorsteher, mit Funktion eines Bügermeisters. Als Obmann des Kurvereins gab er die Reiseführer 1925-1930 heraus und war ebenfalls der
Obmann des Wintersportvereins sowie Ehrenmitglied verschiedener anderer Vereine. Im Radio Prag hielt er öfters Vorträge über Fremdenverkehrswerbung für Spindelmühle und das Riesengebirge.

Sein Büchlein „Rübezahl im Riesengebirge“ (dreißig Sagen) wurde von Erwachsenen und Kindern gern gelesen. Der Verfasser, welcher 1939 im Alter von 55 Jahren in Spindelmühle starb,
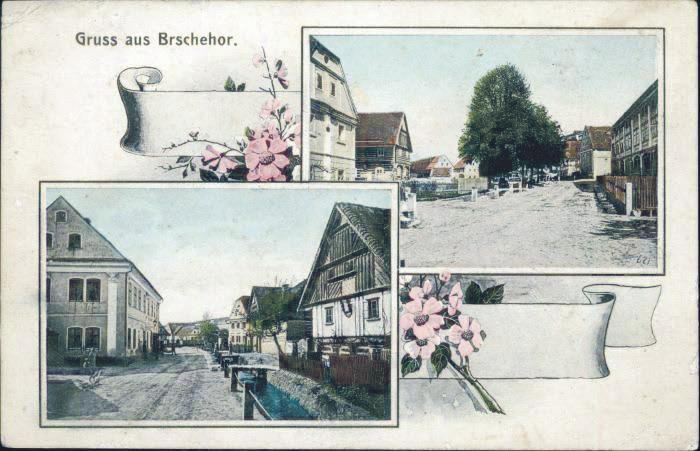
Im Jahre 2003 gründete die österreichische Akademie der Wissenschaften das „Institute for Computational and Applied Mathematics“ und benannte es nach Radon. 2009 wurde eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus enthüllt. Helmut Hoffmann ❯ Geschichte
Sven Pillat bietet mit dieser von ihm eingesendeten, alten Postkarte mit nachkolorierten Fotos
einen Einblick in den idyllischen und ländlichen Ort Brschehor vor über einhundert Jahren. HT

hat diese Sagen nach mündlichen Angaben gesammelt.
Der Ort Spindelmühle im Bezirk Hohenelbe entwickelte sich ab 1867 zu einem angesehenen Erholungsort im Riesengebirge. Viele Hotels und Gaststätten wurden für die Touristen gebaut. Die Spindlerbaute in 1.208 Metern Höhe liegt an der Straße Spindelmühle-Hain, ein Übergang über den Riesengebirgskamm. Helmut Hoffmann

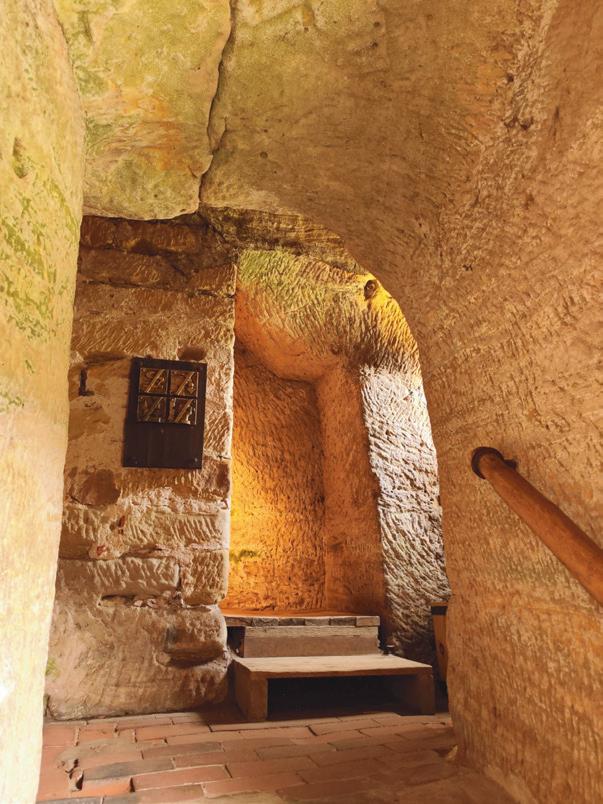 . Betreuer Wedlitz, Drahobus, Straschnitz, Laden, Julienau, Brzehor: Sven . Redaktion: Heike Thiele, Eulengasse 16, 50189 Elsdorf, Tel. 02271 805630, eMail: thiele.heike@gmx.de. Redaktionsschluß: 15. Vormonat.
Aufsicht zur Felsenburg.
Die Lorette in Schüttenitz.
Panorama der Elbschleife.
. Betreuer Wedlitz, Drahobus, Straschnitz, Laden, Julienau, Brzehor: Sven . Redaktion: Heike Thiele, Eulengasse 16, 50189 Elsdorf, Tel. 02271 805630, eMail: thiele.heike@gmx.de. Redaktionsschluß: 15. Vormonat.
Aufsicht zur Felsenburg.
Die Lorette in Schüttenitz.
Panorama der Elbschleife.
� Wie es früher war
Koll konnte alles. Eigentlich hieß er Karl, aber alle nannten ihn Koll.
Koll kam aus Tetschendorf, nahe bei Auscha. Mit seinen Eltern und den zwei Geschwistern, Mädchen, bewirtschafteten sie eine kleine Landwirtschaft.
Koll hatte jedoch ein Problem, er war klein und hatte einen Höcker, einen Buckel nannte man das damals. Was ihm aber niemand absprach, waren seine geistigen Fähigkeiten. Er war nicht nur belesen, sondern handwerklich konnte er fast alles. Die ganze Familie hatte es 1946 in die SBZ, die Sowjetische Besatzungszone verschlagen, nach Mecklenburg an die Ostsee. In dem Ostseebad gab es keine Landwirtschaft, so daß man die schwere Arbeit der Harzgewinnung aufnahm.
Die Wohnung für alle Familienmitglieder bestand aus einem einzigen Zimmer in einer Sommerpension. Eltern, Geschwister
� Mundart
und ein Enkelsohn mußten damit zurechtkommen. Weil es keinen Ofen gab, organisierte Koll eine Blechtonne und baute daraus einen Ofen. Darauf konnte man kochen und die notwendige Wärme im Winter war gesichert. Lebensmittel waren knapp und so wurden zum Beispiel der Zucker und das Brot auf einer Briefwaage abgewogen. Knapp war der Aufstrich für das Brot. Koll wußte sich zu helfen. Von einem Bauern bekam er Zuckerrüben, eingetauscht gegen einen geflochtenen Korb. Für die Vorarbeiten, um Sirup herzustellen, baute er eine Presse und ein entsprechend großes Sieb. Für uns Vertriebenenkinder war das alles spannend, wie es sich so entwickelte . Die Zuckerrüben wurden gesäubert, dann zu Schnitzeln geraspelt und auch diese Raspel hatte Koll gebaut. Anschließend kamen die Zuckerrübenschnitzel in einen großen Topf. Da kam das nächste Problem.
Auf dem selbstgebauten Ofen war es nicht möglich, den schweren Topf auf die Herdplatte zu setzen. Im Flur gab es einen alten, gußeisernen, hohen Zimmerofen. Die obere Fläche war relativ klein, doch konnte man mit Geschick den Topf auf diese Fläche hochhiefen. Eigentlich war das lebensgefährlich, doch es gab keine andere Lösung. Der Ofen hatte für diesen Zweck einen Nachteil. Die Feuerung lag zu tief, doch Koll baute ein Zwischendeck ein, so daß sich das Feuer dicht an der Kochplatte ausbreiten konnte. Alles funktionierte recht gut.
Die weichen Zuckerrübenstücke wurden dann gepreßt und man hatte einen schleimigen Saft. Der mußte weiter aufgekocht werden. Es wurde dauernd gerührt und der ganze Flur stand unter Wasserdampf und es wurde recht ungemütlich und anstrengend dazu.
Diese, unsere dritte Feuerstelle, war ein Küchenofen, genannt
S woor ain Juli fimfundvazich.
Ee Tscheche hotte sich bai uns schunn aikwortiert.
Ee bimscha Ziss iss mit enn Moon kumm und hout uff hulpriches daitsch gesoot: „Diesa Herr ward jetzt dou woon“, mier hettn olle Schlissl uffn Tiesch hielej sulln. Dar iss imma mit enna Pistoule r immgefluffn. Und wenn doss Viechzaig gebrillt hout, musste die Gruußl frohn, ebbse Futta aus dar Schaine hulldn durfte. Unsa naia Hausbewohna iss imma mitgangn.
� Leserbriefe
Dann, zahnten Juli ess wieda ee Ziss kumm und hout gesoot, dossma ai z weij Schtundn ausn Haisl misstn, fa jedn durftn 25 Kilo mitgenumm wardn, wossma halt suu gebraucht hout. Wail die Laite gesot hottn, mir kejm noch drai Wuchn wieda hemm, hout halt die Gruußl Wesche zunn Woschn aigepockt, die saubere houtse ain Schranke gelussn. Suu saima halt mit unsan Lettawanl fort-gemocht. S woor ee heeßa Toog, Dou saima halt die Allee nundagefohrn, hottn olls letztn daan Paachmiller getruffn. Dann gings zunn
„Hexe“, die ein Handwerker aus Fliegermaterial hergestellt hatte. Das Material war Leichtmetall oder Aluminium, er war aber mit Schamottsteinen ausgelegt. Sicherheitshalber war die Ofentür so klein, daß ein Brikett genau hineinpasste. Um mehr Hitze zum Kochen zu erreichen, feuerten wir mit harzigem Holz. Wir kamen damit ganz gut zurecht.
Mit der Sirupkocherei auf unserem Ofen klappte es ganz gut, bis sich durch die Hitze der Ofen sanft neigte und der große Siruptopf herunter zu fallen drohte. Der dickflüssige, dunkle Sirup war gerade fertig und die Erwachsenen nahmen schnell den Topf von der Ofenplatte. Wir hatten noch einmal Glück gehabt.
Selbstverständlich bekamen wir einen Teil des köstlichen Brotaufstrichs mit. Der Belag für das Brot war für die nächste Zeit gesichert. Koll hatten wir das zu verdanken. Hans Stelzig
� Mundart
Bahnhoufe. Unsa Z aig wurde imma wieda vu daan Tschechn durchsuchcht, ebbse nouch woss gebrauchn kenndn. Dar ganz Plotz vorn Bahnhoufe woor vull Handwaanln und Laitn.
Doss Rimschtiehn woor nie groode schiene. Erscht olls die Sunne balde undagiehn wullde, honnse uns ai uffene Koulnwoon getriebn. Enge woors.
Erscht n andan Frieh worma ai Pirna. Jetz weerma daheeme, honn die R aichsdaitschn gesoot. Jetz sain die Seemanns nimmej ai Schittenz.
Einsender: Georg Pohlai

Franz Stolz liefert aktuelle Anmerkungen zum Artikel über die Kapelle „St. Johannes der Täufer“, welcher im letzten Leitmeritzer Heimatboten im Juli veröffentlicht worden ist.
Im Juni 2022 war ich mit meinen Freunden Ewald und Jan in Kamaik.
95 Jahre
25.08.1928, Melitta Röder, geb. Hegen, früher Krscheschitz
20.08.1928, Ingobert Stiebitz, unbekannt
10.08.1928, Edith Hartmann, geborene Beiersdorf, früher Michelsberg
09.08.1928, Bertl Neumann, geb. Halank, früher Graber
05.08.1928, Ernst Girschik, früher Leitmeritz
90 Jahre
25.08.1933, Herta Hinze, geborene Schröter, früher Skalitz bei Schüttenitz
25.08.1933, Alma Grund, früher Kottomirsch
11.08.1933, Helene Meissner, geb. Schüller, früher Triebsch
85 Jahre
19.08.1938, Klaudia Kaffarnik, geb. Ronke, früher Leitmeritz
08.08.1938, Sieglinde Staffek, früher Wchinitz
02.08.1938, Friedrich Baumruck, früher Suttom
80 Jahre
04.08.1943, Christine Führich, früher Podiwin
65 Jahre
05.08.1958, Joachim Fritsche
Amöneburg
Alt-Lenzel
17.08.1930, Fritz Hautke
Auscha
11.08.1951, Ursula Kopphold, geborene Strupp-Piller
Fulda
25.08.1930, Dr. Wolfgang
Hamberger
Gastorf
10.08.1951, Lothar Mikule
25.08.1957, Christiane Horatzek
Gießdorf

08.08.1937, Alfred Fuchsa
Erich Hofmann präsentiert Humoristisches aus Krscheschitz:
ENochbor, dan sei Weib gestorb‘n wor, kom zum Glöckner und soot‘n, doß ar se obleit‘n sull1). Dernoucharn 2) ein Hie- und Harrejd‘n mejnte ar: „Ich weß ni, sull ich no moul heirot‘n obar 3) ni.“ Dou soote dar Glöckner: „ Tu ock de Alde arscht begrob‘n!“ Josef Stibitz
Erläuterungen: 1) daß er die Sterbeglocke für sie läuten möge, 2) dann, danach, 3) oder.
Einsender: Erich Hofmann
� Poesie
nach circa fünfundzwanzig Minuten die St. Johannes Kapelle. Sie befindet sich baulich in einem guten Zustand und verfügt über eine Infotafel, leider nur in tschechischer Sprache. Die Türen sind schwer verriegelt, aber über eine Öffnung kann man einen Blick in das Innere der Kapelle werfen. Der

eine Andacht in der Kapelle halten kann, da es in der Umgebung sehr viele Waldameisen gibt. Wir konnten das am eigenen Leib erleben. Es ist kaum möglich an einer Stelle zu verweilen, ohne daß einen die Ameisen belästigen. Anschließend umrundeten wir
Eine Volksweise Mich rührt so sehr böhmischen Volkes Weise, schleicht sie ins Herz sich leise, macht sie es schwer.
Wenn ein Kind sacht singt beim Kartoffeljäten, klingt dir sein Lied im späten Traum noch in der Nacht.
Magst du auch sein weit über Land gefahren, fällt es dir doch nach Jahren stets wieder ein.
Maria RilkeRainer
An die Heimat
Kein Herrgott kann‘s so wenden, daß ich vergessen müßt das Land, das mir auf Erden am allerliebsten ist.
Fernblauende, ihr Berge, ihr dunklen Felsenseen, ihr gottesfreien Wälder, o Heimat, du bist schön.
15.08.1929, Helga Wurm
09.08.1934, Kurt Scheibel
02.08.1935, Klaus Wimmer
05.08.1935, Gertrud Bierwirth, geborene Christ
03.08.1937, Irene M. Petri, geborene Ringelhaan
11.08.1937, Hildegard Kahleis
06.08.1939, Ingeborg Bauer
13.08.1944, Ingrid Herbert, geborene Springer
21.08.1954, Dr. Ralf-Bertram
Dienel
09.08.1940, Renate Glatz, geborene Husarek
Lewin
02.08.1927, Oswald Hortig
Libenken
12.08.1925, Christine Hasler, geborene Stolz
Lichtowitz
12.08.1927, Eva Schlicker, geborene Tattermusch
Lucka
30.08.1971, Annett Liebich, geborene Glässner
Mirschowitz
08.08.1922, Hildegard Schebler, geborene Storch
Mladei
31.08.1930, Edith Schlutow, geborene Steinmetzer
Netluk
25.08.1931, Herta Ringström, geborene Nitsch
Petrowitz
23.08.1932, Anna Schuster, geborene Trenkler
Pokratitz
12.08.1950, Dr. Ulf Pillat
Radaun
25.08.1929, Erhard Kleinert
12.08.1934, Margit Heinze, geborene Kraus
13.08.1961, Günter Schubert
Roche
Haber
18.08.1932, Emil Herschke
Johnsdorf
24.08.1940, Eveline Rudolf
Kalwitz
16.08.1932, Lydia Drüen, geborene Werner
Klokotsch, Gemeinde Koblitz
25.08.1939, Marianne Pocher, geborene Wagner
Krscheschitz
07.08.1930, Erna
28.08.1931, Walter
Kwitkau (Böhm. Leipa)
02.08.1939, Ingeburg Georgi, geborene Köhler
Laden
04.08.1940, Gerlinde Huber, geborene Wallentin
Leitmeritz
18.08.1922, Helga Lehnert, geborene Ritschel
26.08.1924, Gertrud Lohnes, geborene Sperlich
25.08.1926, Kurt Schams
20.08.1932, Eva Geier, geborene Huber
� Leserbriefe
17.08.1930, Hedwig Glink, geborene Jebautzke
Schüttenitz
07.08.1936, Georg Pohlai
14.08.1939, Sieglinde Pfeiffer, geborene Strahler
Simmer
26.08.1941, Erika Mühlhaus, geborene Rösler
Sobenitz
04.08.1959, Gerhard-Karl Schwarz
Trebnitz
29.08.1936, Maria Völkl, geborene Pollak
Tschalositz
29.08.1940, Rainer Geppert
Webrutz
22.08.1931, Margit Schäfer, geborene Truxa
Werbitz
11.08.1935, Eva-Maria Albrecht, geborene Fritsch
Wscheratsch
10.08.1932, Waltraut Mühlich, geborene Kaschte unbekannt
05.08.1937, Margit Krege, geborene Schuender
Ergänzend zum Reisebericht
„Wir waren zu Hause“ habe ich diese nette Postkarte von der Reisegruppe mit Edith Kley, Georg
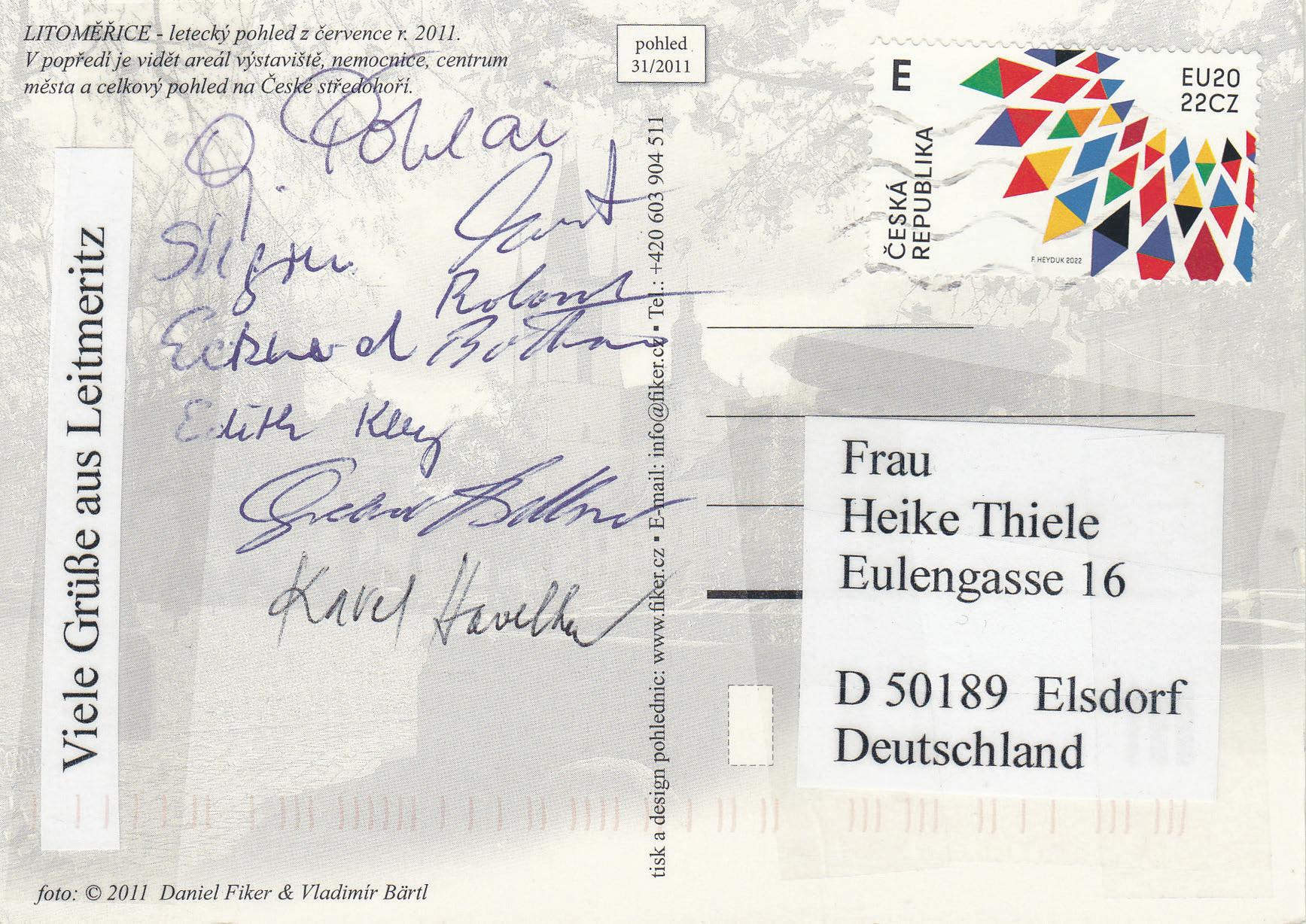
Wir parkten im Schatten der Burgruine und machten uns bei sommerlichen Temperaturen auf den Weg, der durch einen Wegweiser deutlich gekennzeichnet ist. Mit ruhiger Gangart im schattigen Wald erreichten wir
Altar ist in gutem Zustand. Mittlerweile wachsen nicht nur alte Eichen, sondern auch Kiefern und Kirschbäume im Umfeld der Kapelle. Pfarrer Havelka hatte uns schon erzählt, daß er kaum noch

genossen den Ausblick ins weite Elbetal. Mit diesem Eindruck beendeten wir unseren kleinen Ausflug in die geschichtsträchtige und landschaftlich beeindruckende Gegend. Franz Stolz Vielen Dank für die Eindrücke!
Im fernen, fernen Lande lausch‘ ich zum Herzen hin: Mir rauschen alle Buchen des Böhmerwaldes drin.
Hans Watzlik
Einsender beider Gedichte: Georg Pohlai
Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

Betreuer der Heimatkreise – Aussig: Brigitta Gottmann, Hebbelweg 8, 58513 Lüdenscheid, Tel. 02351 51153, eMail: brigitta.gottmann@t-online.de – Kulm: Rosemarie Kraus, Alte Schulstr. 14, 96272 Hochstadt, Tel. 09574 2929805, eMail: krausrosemarie65@gmail.com – Peterswald, Königswald: Renate von Babka, 71522 Backnang, Hessigheimerstr. 15, Tel. 0171 1418060, eMail: renatevonbabka@web.de – Heimatgruppe Graupen, Mariaschein, Rosenthal und Umgebung: Sibylle Schulze, Müggelschlößchenweg 36, 12559 Berlin, Tel. 030 64326636, eMail: sibyllemc@web.de – Redaktion: Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: aussiger-bote@t-online.de – Redaktionsschluß: jeweils der 15. des Vormonats.
� Die Unternehmerfamilie Maresch

Die Beziehung von Nordböhmen zu den kleinen mystischen Wesen ist seit jeher sehr eng. Es gibt zahlreiche Orte in unserer Region, an denen der Legende zufolge Zwerge gelebt haben sollen. In verschiedenen Kulturen stellten Zwerge den Archetyp von Wesen dar, die den Übergang zwischen dem irdischen Dasein und der Welt der Toten und Götter verkörperten und noch heute fester Bestandteil der Kultur ihres Landes sind.
Die Ausstellung 2019 in Aussig beleuchtete die Geschichte der Zwerge im Laufe der Jahrhunderte. Zwergenfiguren gab es bereits in der Barockzeit. Der Untergang der Zwerge begann, als Künstler der Avantgarde den Gartenzwerg zum Kitsch erklärten. Die Ausstellung trat mit vielen kunstvollen Museumsstücken den Gegenbeweis an. Hauptdarsteller der Ausstellung waren natürlich die berühmten Maresch-Zwerge, von denen nur noch wenige Stücke erhalten sind und die noch heute unter Sammlern als „Rolls Royce“ unter den Zwergen gelten. Diese Art der Zwerge kam um 1870/1880 aus Thüringen und bildete wohlhabende Bergleute ab. Man erstand sie, um die Wohlhabenheit ihres Besitzers auszudrücken.
Johann Maresch gründete 1841 Ecke Materni- und Teplitzer Straße gemeinsam mit Adolf Bähr die erste Industriefabrik in Aussig. Sie produzierte Haushaltsartikel aus Siderolith, einem haltbaren porzellanähnlichen Steingut. Begehrte Artikel waren der „Garten-Kürbis“ mit der spitzen roten Kappe aber auch Gartenzwerge. Ab 1860 übernahm
Ferdinand Maresch war eines von 10 Kindern; er folgte 1873 seinem Vater Johann als Inhaber der Maresch-Fabrik nach. Ende des 19. Jahrhunderts galt Maresch als einer der größten Keramikproduzenten in Nordwestböhmen. Hergestellt wurden aus Siderolith hauptsächlich Figuren für Interieur, wie Tabakdosen und Tintenfässer und Exterieur, wie Kunstterrakotten und Majoliken. Verkaufsschlager aber waren nach wie vor die Gartenzwerge. Maresch gilt als der weltweit älteste Fabrikant von Gartenzwergen. Noch heute gehen Maresch-Zwerge über Auktionen in alle Welt, bis Australien, Südafrika oder in die USA. Der berühmteste Zwerg aus der MareschProduktion ist wohl der auf dem Albumcover von Beatles-Mitglied George Harrison.


Die Mareschs – mehr als Zwergen-Fabrikanten:
Johann Maresch (1821 - 1914) setzte sich schon früh für die ein

der Bezirksvertretung. In seiner Zeit fand der Ausbau der Straßen nach Wannow und Salesel sowie nach Prödlitz und Herbitz statt.
Ferdinand Maresch (18541940) übertraf noch seinen Vater. Die Gründung des „Ruder- und Eislaufvereins von 1874“ geht auf ihn zurück. Er saß im Verwaltungsrat der „Aussiger Bürgerliches Brauhaus AG“ und war für den Ankauf der Schönpriese ner Braustätte (später „Zlatopra men“) mitverantwortlich.
Mit 30 Jahren wurde er Mit glied des Stadtrates. Ihm ob lagen die städtischen Finan zen. So war er an der Entste hung des Stadtteils Kleische beteiligt, indem er Grund stücke für eine Wohnsied lung ankaufte. Auf seine In itiative hin erwarb die Stadt 1893 gewinnbringend die Wäl der an den Elbhängen zwischen der Ferdinandshöhe und Qua len. Die Erbauung des Städti schen Elektrizitätswerks und der Ausbau der elektrischen Straßenbahn gehen auf ihn zurück. Ebenso nahm er sich der Entwicklung von Bil dung und Kultur an und wurde Vorsitzender der Aussiger Museumsgesell schaft. Deshalb befindet sich noch heute in den Sammlungen des Mu seums eine große An zahl von Produkten aus Mareschs Fabrik. 1893 wurden das Gymnasium, die Realschule und die Staats gewerbeschule auf sein Betrei ben hin erbaut. Als Mitglied der Regionalversammlung im Jahr 1903 setzte er die Regulie rung der Elbe zwischen Weg städtl und Aussig durch. 1909 machte er sich um die
dient. 1911 erhielt er die höchste Anerkennung seiner Heimatstadt und wurde mit der „Ehrenbürgerwürde“ der Stadt Aussig ausgezeichnet.
2004, zu seinem 150. Geburtstag, widmete die Stadt Aussig Ferdinand Maresch eine Ausstellung und ein großes „Zwergenfest“.

Dr. Walther Maresch, zweitältester Sohn Ferdinands, führ
Freitag, 18. August 2023: Anreise und je nach Ankunft, Zeit für Rundgänge, Besichtigungen in Graupen, Mariaschein usw. Ab 18.00 Uhr ein gemütlicher Abend im Restaurant Pod Kastany.
Samstag, 19. August 2023:
Ausflug nach Aussig. Wir besuchen das Museum der Stadt Aussig mit der Ausstellung „Unsere Deutschen“. Anschließend geht es mit der Seilbahn auf die Ferdinandshöhe / Větruše zum Mittagessen. Danach Weiterfahrt zur Beneš-Brücke und zur Gedenktafel „Zum Gedenken an die Opfer der Gewalt vom 31. Juli 1945“.
� Vor 210 Jahren
18.00 Uhr: Festveranstaltung mit Abendessen im Hotel-Restaurant Rosenburg.
Wir freuen uns auf den gemütlichen Abend mit Mitgliedern der Stadtverwaltung, sowie Gästen und Freunden aus Krupka.

Sonntag, 20. August 2023:
9.00 Uhr: Besuch des Gottesdienstes in der Basilika der „Schmerzhaften Mutter Gottes“ in Mariaschein.
Zum Abschluß des Treffens Mittagessen im Restaurant Mükkentürmchen.
Informationen bei: Sibylle Schulze, Müggelschlößchenweg 36, 12559 Berlin, Tel. 030-64326636 eMail: sibyllemc@web.de
Die Schlacht bei Kulm
Am 29. und 30. August 1813 fand die Schlacht bei Kulm statt. Winzig und voller Details werden ganze Szenen aus der Geschichte, rund 150 Einzeldioramen mit 300.000 Figuren im Deutschen Zinnfigurenmuseum auf der Plassenburg in Kulmbach, der größten Zinnfigurensammlung der Welt, dargestellt.
Auch das Geschehen der Schlacht bei Kulm wird auf einer Fläche von ungefähr 4 Quadratmetern historisch getreu nachgestellt. Damals wurden die französischen Invasionstruppen unter dem Kommando des
� Leserbrief
französischen Generals Dominique Vandamme von den verbündeten Truppen der Österreicher, Russen und Preußen geschlagen. Wenig späger erfolgte die Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Leipzig. (Eine interessante Konstellation, wenn man auf das aktuelle Kriegsgeschehen schaut…). Das Museum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene: 4 Euro, Kinder und Schüler bis 18 Jahren: Eintritt frei, Studenten, Rentner, Behinderte: 3 Euro. kw

Quelle: Helmut Hoffmann
140. Geburtstag von Prof. Dr. F. J. Umlauft
Als zurückgehaltene „Spezialisten“ war es uns gelungen, dank einer von Richard Reitzner ausgestellten Zuzugsgenehmigung, im Mai 1948 nach Bayern „herauszukommen“. Meine Familie und mich verschlug es ins Lager „Festspielhügel Bayreuth“. Ich sollte nach dreieinhalb Jahren Unterbrechung meinen Oberschulbesuch wieder aufnehmen und mußte dazu eine Aufnahmeprüfung in mehreren Fächern ablegen, unter anderem auch in
Latein bei Prof. Dr. Umlauft. Zu meiner Überraschung gab er mir keine schriftliche Arbeit, im Gegenteil, wir verließen das Klassenzimmer und gingen in den Hofgarten. Auf einer Bank examinierte er mich mündlich und sagte zum Abschluß: „Ich gebe dir schon eine Drei, wir sind schließlich Sudetendeutsche und müssen zusammenhalten.“ Das war der Schlüssel zu meinem Wiederstart in die Schule. Peter Hucker, Bielefeld
Heimatfreundin Erika Frenzel erinnerte mit einem Zeitungsartikel über den Altvaterturm am Wetzstein bei Lehesten / Thüringer Wald an das 20-jährige Jubiläum, das der „Turm für die Ewigkeit“ im nächsten Jahr feiern wird.
Bei der Eröffnung im Jahr 2004 war auch eine Delegation des damaligen Aussiger Hilfsvereins anwesend, angeführt von seinem Vorsitzenden Günter Gierschik. Im Gepäck war eine Bronzetafel, die ein Künstler nach den Vorgaben des Hilfsvereins Aussig angefertigt hatte. Der Text lautet:
„ZUM GEDENKEN AN DIE
UNZÄHLIGEN DEUTSCHEN
MÄNNER, FRAUEN UND KIN-
DER, DIE BEI DEM MASSAKER AUF DER ELBEBRÜCKE IN AUSSIG AM 31. JULI 1945 ER-
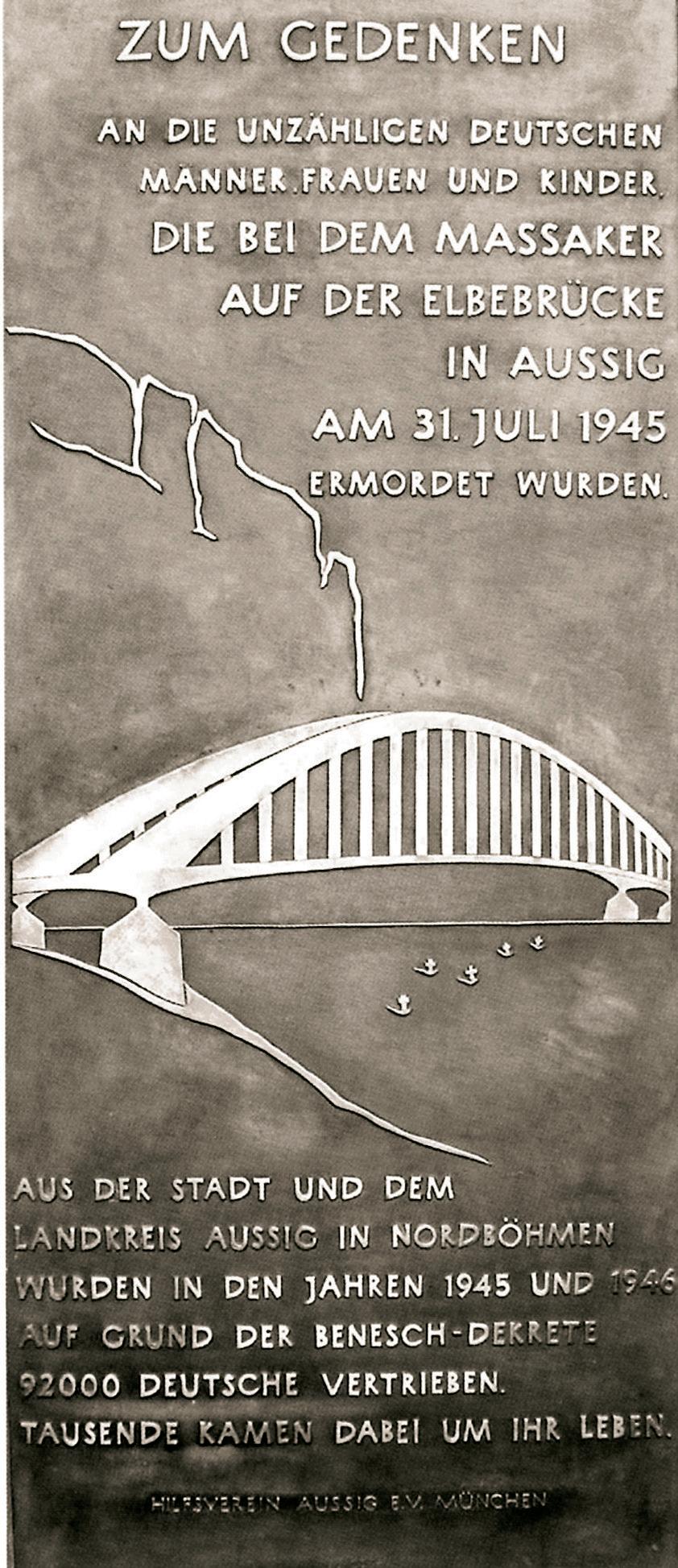
MORDET WURDEN.
AUS DER STADT UND DEM
LANDKREIS AUSSIG IN NORD-
BÖHMEN WURDEN IN DEN
JAHREN 1945 UND 1946 AUF
GRUND DER BENESCH-DEKRETE 92000 DEUTSCHE VERTRIEBEN. TAUSENDE KAMEN
DABEI UM IHR LEBEN.
HILFSVEREIN AUSSIG E.V.
MÜNCHEN
Der Altvaterturm steht unübersehbar am höchsten Punkt Ostthüringens auf 792 Metern. Er gilt als Wahrzeichen gegen Vertreibung und für Versöhnung.
Sein Vorgängerbau, die „Habsburgwarthe“ auf 1492 Metern, wurde 1902 in Nordmähren am Altvater erbaut und hatte für die
Deutschen im Altvatergebirge eine hohe symbolische Bedeutung. Nach der Vertreibung verwitterte der Turm und wurde 1957 von den Tschechen abgerissen. Bei den Heimatvertriebenen wurde der Wunsch nach dem Wiederaufbau eines „Altvaterturms“ immer größer. Nach Jahrzehnten der Suche wurde 1995 der Bauplatz auf dem Wetzstein in Thüringen gefunden. An dieser Stelle stand bis in die 1970er Jahre der wegen Baufälligkeit gesprengte Bismarck-

Das Kulmer Fest am Dreifaltigkeitssonntag fiel diesmal auf den 4. Juni. Für unsere betagten Heimatfreunde wird es immer beschwerlicher, in der heißen Jahreszeit eine Reise in die Heimat anzutreten. Einschließlich der Kulmer Adelsfamilie von Westphalen-Fürstenberg und der Heimatfreunde vom Kulturverband kamen wir immerhin auf fast 20 Teilnehmer. Besonders freuten wir uns über den Besuch einer 90-jährigen Dame, die von ihrer Tochter aus Berlin nach Kulm gebracht und von Kurt Richters Bruder wieder nach Hause gefahren wurde. Überhaupt fühlten wir uns bei der Familie Richter wieder wie zuhause.
„Die Nacht der offenen Kirche“ fiel zufällig auf Samstag, 3. Juni. Eine kleine Gruppe ließ es sich nicht nehmen, zu dieser Gelegenheit die Kirche in Mariaschein zu besuchen. Zu meiner Enttäuschung wurde seit 2008, als ich die dortige Orgel durch großzügige Spenden mit Lammlederstücken und Gummituch reparieren lassen konnte, nichts mehr getan. Auch zur Renovierung fehlt das nötige Geld.
Das Kulmer Fest begann wie immer mit meinem Orgelspiel in der St. Gallus Kirche. Die Orgel von 1852 wird viel zu selten ge-
� Meldungen Saaz bewirbt sich um den Titel Unesco-Weltkulturerbe
genommen haben, den Besucher bis ins 10. Obergeschoß. Auf den Etage sind Dokumentationen, Ausstellungen sowie eine Gaststätte untergebracht. Die freie Aussichtsplattform befindet sich auf 824 Metern mit einem fantastischen Blick ins Land.
In der angebauten „ElisabethKapelle“ befinden sich noch einmal 600 Ortsgedenktafeln. Unsere Platte mit der Erinnerung an das Massaker in Aussig am 31. Juli 1945 wurde neben der Gedenktafel zum Brünner Todesmarsch im Außenbereich angebracht. Außerdem sind Reliefs der Berggeister Altvater und Rübezahl zu finden.
Der Altvaterturm ist ein Ort der Erinnerung, aber auch der Versöhnung. So nahmen an der Einweihung auch zwei tschechische Pfarrer teil.
Saaz zählte im Mittelalter zu den größten und reichsten Städten Böhmens. Das verdankte sie ihrem größten Schatz, dem Hopfen. Der Hopfen wächst immer noch in den Niederungen der Eger, wird in Saaz verarbeitet und in alle Welt versandt.
Kein Wunder, daß sich die Bewerbung als Unesco-Weltkulturerbe auf den Hopfen stützt. Sie trägt den Titel: „Saaz und die Hopfenlandschaft rund um die Stadt“.
Es gibt ein Hopfenmuseum, Bürgerhäuser, in denen der Hopfen getrocknet wurde und das sogenannte Prager Viertel mit seinen heute noch 31 Kaminen, von denen der älteste 140 Jahre alt ist. Bei der Hopfenverarbeitung wurde der Hopfen im Schwefelrauch konserviert. Wegen des unangenehmen Geruchs wurden die Ka-

Ringplatz in Saaz 2009. Die Besuchergruppe aus Aussig vor dem „kleinsten Hopfenfeld der Welt“.

mine bis zu 36 Meter hoch gebaut und sind eine Art Erkennungsmerkmal von Saaz.
Die Stadt bezeichnet sich als ein unentdecktes Juwel, das sich durch den Unesco-Titel eine Belebung des Fremdenverkehrs verspricht. Wir drücken die Daumen! kw Quelle: Sächsische Zeitung, 28.4.2023, Foto: kw
Altvaterturm 2005.
Foto: Marco Anders
Links: Die Aussiger Gedenktafel am Altvaterturm.
Foto: Archiv
turm. 1999 erfolgte der erste Spatenstich, 2002 konnte Richtfest gefeiert werden und 2004 war die Einweihung des neuen Altvaterturms. Zu diesem Anlaß kamen Hunderte Besucher aus allen Heimatlandschaften der Sudetendeutschen, Tschechen, aber auch Ortsansässige auf den Wetzstein bei Lehesten.
Im Treppenhaus des Altvaterturms begleiten 23 Doppelwappen der sudetendeutschen Heimatgemeinden sowie der Städte und Dörfer, die Vertriebene auf-
� Neuauflage zum Jubiläumspreis
spielt und ich mußte mich sehr anstrengen, sie „anzuschlagen“. Auch für diese Orgel werden in Kulm Spenden gesammelt, aber es sind viel zu wenige. Angeblich soll die Kirche sogar verkauft werden. Für die wenigen Besucher, die alle 14 Tage zur Messe
Der Altvaterturmverein veranstaltet jedes Jahr ein Altvaterturmfest am Wetzstein. Bei vielen Heimattreffen steht ein Besuch am Altvaterturm auf dem Programm. So erinnert sich Erika Frenzel an ein Treffen der Herbitzer und Prödlitzer in Wurzbach, bei dem der Altvaterturm besucht wurde: „Wir, die jetzigen ‚Alten‘ waren 1945 die ‚Kindergeneration‘. Wir waren auch bei der ‚Wilden Vertreibung‘ am 26.7.1945 dabei, als es zu Fuß über das Erzgebirge am Mückentürmchen vorbei nach Geising ging. Möge der ‚Turm für die Ewigkeit‘ als Mahnmal Bestand haben, besonders in der heutigen Zeit.“ kw
Quelle: Leserbrief Erika Frenzel, Berga, früher Herbitz
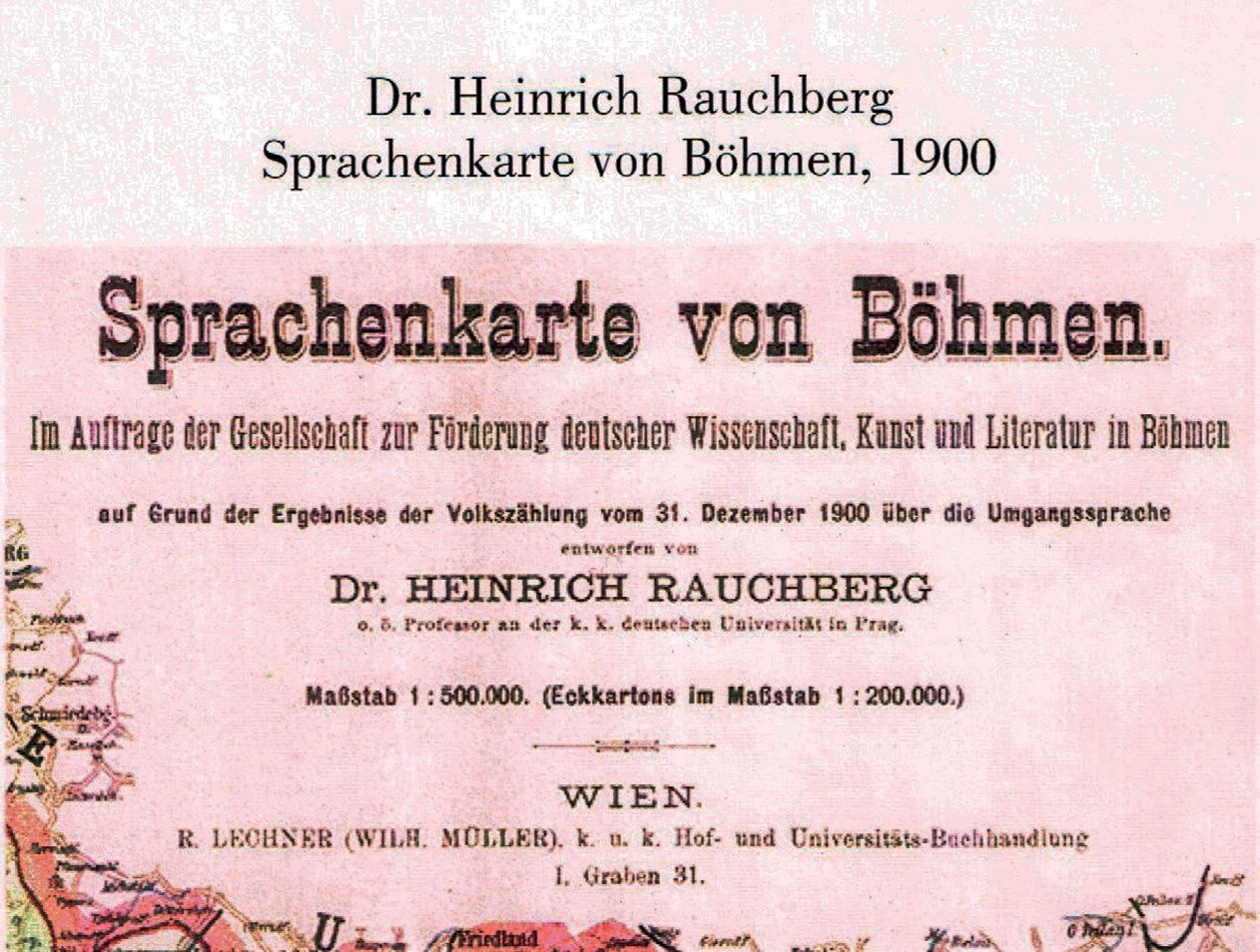
DDer Kulturverband der Deutschen in Aussig trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat im Cafe des Aussiger Stadtmuseums. Wie man sieht, wird der Kreis immer kleiner. Aber keiner ist vergessen. Diese Zusammenkunft galt dem im März verstorbenen Hansi Adamec.
Von links: Ingrid Schuster-Sudhüs, Mirek Rössler, Jaroslav, Neffe von Frau Schuster, Zdenka Kovarová, Herr Bauer, Sohn von
n 100. Geburtstag: Am 17. 8. Hedi FOCKE geb. Lösel aus Nestomitz, Teichplatz 31.
n 99. Geburtstag: Am 12. 8. Gerlinde KULA geb. Martinetz aus Libochowan. – Am 30. 8. Erna LANGER geb. Köcher aus Nestomitz in 65197 WiesbadenKlarenthal, Goerdelerstr. 47, App. 147. – Am 12. 8. Verina LANGHAMMER geb. Günther aus Aussig, Sandhöhe 12. –Am 2. 9. Milli ZAHN geb. Grau aus Kwitkau in 60437 Frankfurt, Am Markstein 5.
n 98. Geburtstag: Am 8. 8. Edith PREMKE geb. Happich aus Türmitz, Sandgasse in 06406 Bernburg, Solbadstr. 2 b. – Am 10. 8. Erna BUCKO geb. Stumpf aus Arbesau in 91083 Baiersdorf, Sockfriedstr. 2.
n 97. Geburtstag: Am 8. 8. Gertrud FRÖHLICH aus Karbitz. – Am 11. 8. Elisabeth LUTZ geb. Klein aus Arbesau Nr. 142. – Am 19. 8. Roland GIRA aus Schreckenstein. – Am 28. 8. Ilse KALINA-KOSSEG geb. Richter aus Wicklitz in 76187 Karlsruhe, Saarlandstr. 11.
n 92. Geburtstag: Am 23. 8. Eleonore BECKER geb. Forscht aus Kulm.
n 90. Geburtstag: Am 3. 8. Christina STALTMAIER geb. Seidel aus Kleinpriesen in 82327 Traubing, Tutzinger Str. 6. –Am 23. 8. Sieglinde DÜRR geb. Lenhart aus Schwaden.
n 89. Geburtstag: Am 21. 8. Josef WIETHE (Zilln-Peppi)aus Ebersdorf.
n 85. Geburtstag: Am 28. 8. Loni MAIER geb. Struppe aus Troschig. – Am 29. 8. Walter DOUBEK aus Kosten in 15713 Königswusterhausen, Pappelallee 8. Tel. 03375-502776.
n 84. Geburtstag: Am 25.8. Inge WIETHE (Ehefrau von Zilln-Peppi).
n 83. Geburtstag: Am 24. 8. Prof. Dr. Erika GROTHE geb. Oppelt aus Wannow Nr. 18 in 99097 Erfurt, Haselnußweg 6.
erscheinen, lohnt sich kein Aufwand mehr… Anschließend zogen wir weiter zur Horka-Kapelle. Sie wurde 1691 von Graf Kolowrat-Krakowsky als Kapelle der Hl. Dreifaltigkeit errichtet, aus Dankbarkeit für die Verschonung vor der Pest im Jahr 1680. 1830 ließ der neue Besitzer von Kulm, Josef Klement Graf von Westphalen, unter der Kapelle eine Familiengruft errichten. Die Messe hielt wie in den Jahren zuvor Generalvikar a.D. Havelka. Diesmal hatte er eine Überraschung für uns: er hatte einen Kammersänger vom Aussiger Stadttheater eingeladen, der im Anschluß an den Gottesdienst einige geistliche Lieder wie das „Ave verum“ sang. Wir können nur hoffen, daß der Funke auf unsere Kinder und Enkel überspringt, damit sie die Heimat ihrer Ahnen auch weiterhin besuchen und ihre Schätze bewahren. Rosemarie Kraus, früher Kulm
Anläßlich des 25-jährigen Bestehens des „BöhmischeDörfer-Verlages“ wurde die detaillierte deutsch-tschechische Sprachenkarte / Nationalitätenkarte, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erarbeitet wurde, erneut gedruckt. Erstmals herausgegeben wurde sie 1904 von dem Wissenschaftler Prof. Dr. Heinrich Rauchberg. Die Karte weist die Bevölkerungsverhältnisse zu Zeiten der großen Volkszählung von 1900 auf. Durch acht verschiedene Farbnuancen wird die wahre proportionale Verteilung der beiden großen nationalen Bevölkerungsgruppen deutlich gemacht. Auf vergrößerten Ausschnittskarten in den Ecken des Blattes werden die deutschen Sprachinseln separat dargestellt: die sogenannte Sprachzunge von Neubistritz-Neuhaus, die Budweiser Sprachinsel, die Sprachzunge von Stecken mit Iglau und das Nordböhmische Kohlenrevier mit Brüx, Dux, Bilin bis Teplitz-Schönau.
Auch sehr kleine Dörfer sind namentlich aufgeführt. Ein Begleitheft ergänzt mit Tabellen die farblich differenziert dargestellten „96 politischen Bezirke Böhmens nach den Umgangssprachen der anwesenden staatsangehörigen Bevölkerung“.
Als Original ist die Landkarte sehr selten – hier vorliegend als hochwertiger preiswerter Nachdruck. Die Karte im Format etwa 70 x 100 cm und im Maßstab von etwa 1:500.000 wurde bereits vor Jahren aufwändig digital restauriert um wieder bis ins kleinste Detail lesbar zu sein.
Der Jubiläums-Preis der gefalteten Karte mit mehrseitigem Begleitheft beträgt innerhalb Deutschlands nur 25 Euro (portofrei). Bestelladresse: BöhmischeDörfer-Verlag, Wolfgang W. Marko, Wilhelm-Leuschner-Str. 42, 54292 Trier. Tel. 0651 28983 eMail: markowolfgang @markobuch.de Quelle: SdP 14.6.2023
n 96. Geburtstag: Am 13. 8. Edeltraud KONRAD geb. Winkler aus Karbitz in 76199 Karlsruhe, Pfauenstr. 15.
n 95. Geburtstag: Am 1. 9. Maria HACKER aus Aussig in 85221 Dachau, Himmelreichweg 34.
n 94. Geburtstag: Am 23. 8. Alois ULLRICH aus Mariaschein in 41179 Mönchengladbach, Mennrathschmidt 32.
n 93. Geburtstag: Am 23. 8. Walter KUPKA aus Schreckenstein, Hebbelstr. 226 in 06124 Halle, Zerbsterstr. 27.
n 79. Geburtstag: Am 20.8. Rita MÜLLER (Tochter vom Kühnel Peppi aus Gartitz 10) aus Deutsch-Neudörfel 15 in 18422 Pantelitz, Hauptstr. 22.
n 75. Geburtstag: Am 15. 8. Norman STARK (Sohn von Lieselotte Stark aus Aussig).
n 74. Geburtstag: Am 21. 8. Heinrich HOLLUBE aus Aussig, Resselstr. 4, (Enkel von Wenzel und Maria Hollube geb. Stolz aus Schreckenstein).
Bitte melden Sie Todesfälle weiterhin der Redaktion. Auch Geburtstage, die noch nicht veröffentlicht sind (mit Datenschutzerklärung!) nehmen wir gern in die Liste auf.
Redaktion Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, eMail: aussiger-bote@t-online.de.
Walter Focke aus Nestomitz am 16. 7. 2023 in Calbe (Saale), 90 Jahre.
Susanne Hupfer geb. Malik in Herbitz am 18. 6. 2023 in Striegistal, 94 Jahre.
Hubert Soutschek aus Schöbritz
am 25. 5.2023 in Seligenstadt, 91 Jahre.
Margit Sperlich geb. Skebra aus Aussig, Chotekgasse, verst. am 23. 7.

Bund der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Telefon (0 92 31) 6 612 51, Telefax (0 92 31) 66 12 52, eMail bundesvorstand@egerlaender.de
Bundesvüarstäiha (Bundesvorsitzender): Volker Jobst. Spendenkonto: Bund der Egerländer Gmoin e.V., Brunnenkonto, IBAN: DE28 7805 0000 0810 5621 57
Egerland-Museum Marktredwitz , Fikentscherstraße
� Bubenreuth – Streich- und Zupfinstrumentenmacher-Innung Erlangen Zeitreise
Am 15. Juli 2010 öffnete die neue Dauerausstellung in den beiden Kellerräumen des Bubenreuther Rathauses ihre Pforten, welche immer einen Besuch wert ist. Die konzipierte Ausstellung präsentiert die „Vision Bubenreutheum“ des am 13. September 2009 gegründeten Bubenreuther Museumsvereins. Die Schau ist Keimelle für das neu entstehende „Bubenreutheum“ – ein Museum von überregionaler Bedeutung.
� Bubenreuth – Ehrung der Handwerkskammer
Der Goldene Meisterbrief wurde dem Zupfinstrumentenmachermeister Thomas Dotzauer und dem Bogenmachermeister Peter Riedl verliehen.

Im Auftrag des Präsidenten der Handwerkskammer Nürnberg, Thomas Pirner, überreichte der Innungsobermeister der „Streich- und Zupfinstrumentenmacher-Innung Erlangen“, Günter Lobe, dem Zupfinstrumentenmachermeister Thomas Dotzauer und dem Bogenmachermeister Peter Riedl den Goldenen Meisterbrief.
„Durch Ihre regionale Verwurzelung und Ihre soziale Verantwortung tragen Sie dazu bei, daß unser fränkisches Zentrum des Musikinstrumentenbaus so lebenswert ist“, würdigte der Innungsobermeister Günter Lobe die Arbeit und Schaffenskraft, durch welche die beiden Meister in rund 35 Jahren meisterlicher Tätigkeit in ihrem Handwerk eine erhebliche Vorbildfunktion erlangt hätten. Der Goldene Meisterbrief sei ein Zeugnis dafür, daß sie ihre Handwerkskunst beherrschen und wahre Alleskönner seien. Deshalb betrachte er
den Goldenen Meisterbrief sinnbildlich als die Lorbeeren, die es nach vielen Jahren des Engagements, Durchhaltevermögens und Leistungswillens nun zu ernten gelte.
Der Goldene Meisterbrief stehe auch für den Verdienst jahrzehntelanger Ausbildungsleistung, so der Obermeister weiter.
„Das ist eine der herausforderndsten Aufgaben, die Sie als Handwerksmeister haben. Sie ermöglichen vielen jungen Leuten eine Ausbildung und eine Zukunftsperspektive in der Heimat und tragen maßgeblich zu deren Persönlichkeitsentwicklung bei“, würdigte Lobe die Geehrten.
Neben der hohen Ausbildungs- und Arbeitsleistung der Handwerksmeister betonte Lobe die Wichtigkeit der Familien, welche den nötigen Rückhalt bieten und einen erheblichen Beitrag zum Erfolg eines selbständigen Betriebs leisten würden.
und Gitarren fort.
Dotzauer begann seine Ausbildung im Jahr 1977 bei der Tennenloher Firma Arnold. Er legte im Jahr 1983 vor der Handwerkskammer Nürnberg die Meisterprüfung ab.
Peter Riedl prägt in der dritten Generation seinen Namen in die Bogenstangen. Er erlernte den Bogenbau in der Meisterwerkstätte Roderich Peasold.
Als Achtzehnjähriger legte Riedl die Gesellenprüfung ab und vertiefte sein Fachwissen bei dem Bubenreuther Bogenmacher Rudolf Neudörfer. Sein Können und Bestreben nach handwerklicher Leistung führte im Jahr 1987 zur Ablegung der Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Nürnberg.
Die Dauerausstellung steht in der Tradition der von 1979 bis 2009 gezeigten Instrumentenausstellung der „Streich- und Zupfinstrumentenmacher-Innung Erlangen“, welche Gerold Karl Hannabach aufbaute und mit Hingabe leitete. Dem Verein Bubenreutheum geht es um die einmalige Geschichte von Aufnahme und Integration am Beispiel Bubenreuths und um den Aufbau einer europaweit einmaligen Musikinstrumentensammlung des 20. Jahrhunderts, welche in einem würdigen Gebäude mit Ausstellungs-, Depot- und Veranstaltungsräumen realisiert werden soll. Die Ausstellung zeigt den Aufstieg Bubenreuths vom agrarisch geprägten Ort zum europäischen
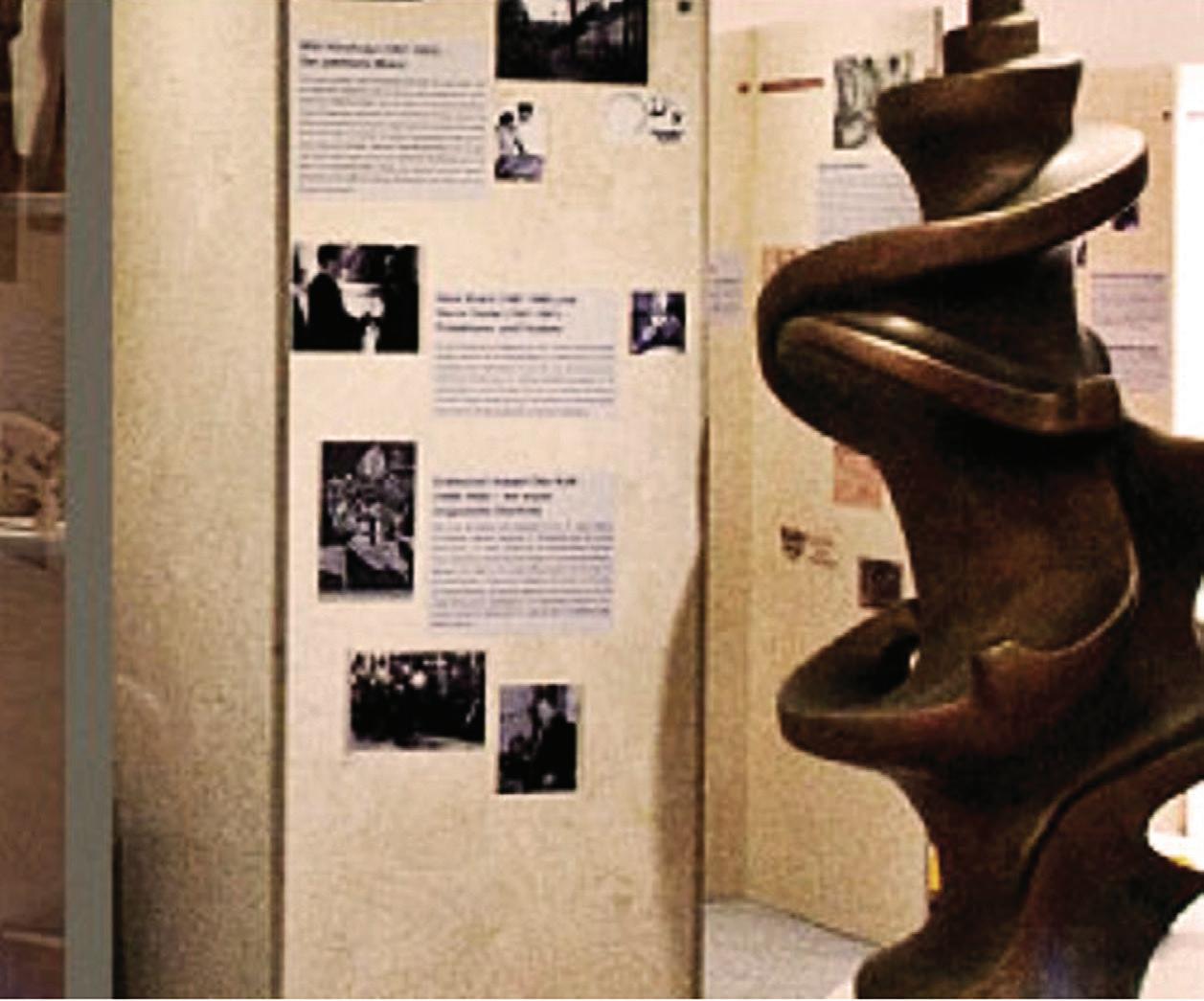

Zentrum des Saiteninstrumentenbaus. Dies wurde durch die enorme Integrationsleistung der 500 Einheimischen möglich, welche nach dem Zweiten Weltkrieg 2000 Instrumentenmacher aus dem böhmischen Musikwinkel aufnahmen.
Seither spielten und spielen national und international renommierte Künstler auf Instrumenten aus Bubenreuth: ob Yehudi Menuhin, das Bayerische
Rundfunkorchester, die Bamberger Symphoniker, Charles Mingus, Attila Zoller, Elvis Presley, Peter Kraus, die Rolling Stones oder die Beatles. Alle wußten und wissen fränkische Instrumente zu schätzen.
In der Ausstellung wird daher anhand von Musikinstrumenten, Exponaten, informativen Texten und Bildern von Musikern ein großer Bogen gespannt: von der klassischen Musik über den Jazz bis hin zu Schlager und Pop. Eine für viele Zielgruppen interessante Zeitreise durch die Geschichte und Entwicklung der Musikstile kann so in Bubenreuth unternommen werden.
Zudem erzählt die Ausstellung anhand des Schicksals der Geigenbauer das traurige Kapitel von Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert. Aber sie spricht auch von der erfolgreichen Integration in der Nachkriegszeit. Die Metropolregion Nürnberg zählte kürzlich nur noch rund 125 Werkstätte, die sich um das Instrumentenbauzentrum Bubenreuth gruppieren.
� Die nächsten Termine
Thomas Dotzauer fertigt in der fünften Generation Mandolinen.
Seine Großeltern Franz und Josefine Dotzauer kamen im Jahr 1945 aus Schönbach (Luby) nach Tennenlohe. Sie führten dort die Herstellung von Mandolinen
In der „Streich- und Zupfinstrumentenmacher-Innung Erlangen“ befinden sich derzeit insgesamt 50 Mitglieder. Davon haben 35 Mitglieder den Meisterbrief, und von diesen wiederum haben 20 Mitglieder den Goldenen Meisterbrief. Derzeit sind fünf Mitglieder der Innung bestrebt den Instrumentenmachermeister bei der Handwerkskammer zu erlangen. Heinz Reiss
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
n Samstag, 5. August:
Hutzennachmittag im Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach. Kontakt unter eMail: iris.plank@egerlaender-offenbach.de
n Freitag, 11. August:
Gäuboden-Festzug in Straubing. Anmeldung beim Landesvüarstäiha Helmut Kindl unter eMail helmut.kindl@t-online.de
n Sonntag, 13. August: Egerländer Gebetstag in Maria Kulm.
n Samstag, 9. September, bis zum Sonntag, 10. September: Heimattage Baden-Württemberg in Biberach.
n Sonntag, 17. September, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr: 70 Jahre Egerländer Gmoi Offenbach und 65 Jahre Egerland-Jugend Offenbach. Willy-Brandt-Halle, Dietesheimer Straße, Mühlheim.
n Sonntag, 1. Oktober: Erntedank-Festzug zur Fürther Kärwa. Anmeldung bei Ingrid De-
Je mehr Begeisterte sich dem Projekt Bubenreutheum anschließen und damit den Aufbau einer überregionalen, bedeutsamen, kulturellen Begegnungsstätte unterstützen, desto näher rückt die Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens. Verein Bubenreutheum
istler von der Gmoi Nürnberg unter eMail deistler@egerlaender.de

n Dienstag, 3. Oktober:
Landeshauptversammlung des BdEG-LV Hessen.
n Samstag, 14. Oktober, um 15.00 Uhr: Hutzennachmittag. Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach.
n Samstag, 28. Oktober, und Sonntag, 29. Oktober: Kulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin in Marktredwitz.
vereinigt mit
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN
Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de
Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de
Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de
Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46
Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
� Heimatverband der Falkenauer e.V.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Der Heimatverband der Falkenauer e.V. lädt alle Interessierten zu seiner Hauptversammlung Anfang September in Schwandorf/Bayern ein:
Ort: Konrad Max Kunz Saal in der Oberpfalzhalle Schwandorf/Bayern
Zeit: Sonntag, 3. September 2023, um 10.00 Uhr
Tagesordnung
1. Begrüßung und Situationsbericht durch den Vorsitzenden
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
2. Feststellen der Beschlußfähigkeit
2. Kassenbericht durch den Vorsitzenden
3. Verabschiedung des bisherigen Vorstandes
4. Vorstellung der beiden Abwickler (Liquidatoren) gemäß §14
5. Sonstiges
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Satzungsartikel Paragraph 3 Absatz 4:
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber)
Bei Auflösung des Vereins oder bei Änderung des Vereinszweckes ist das Vermögen in ideelle und reelle Werte zu scheiden.
Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
a) die ideellen Werte, bestehend aus den Gegenständen, welche nur von historischem Wert oder Erinnerungswerte sind, fallen in das Eigentum der Patenstadt Schwandorf in Bayern.
b) das sonstige bewegliche und unbewegliche Vermögen ist nach Erfüllung der darauf haftenden Verbindlichkeiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit der Auflage in das Eigentum zu übergeben, eine Falkenauer Stiftung nach Maßgabe der gemeinnützigen und mildtätigen Zwecke des Vereins zu errichten. Sollte zu gegebener Zeit die Sudetendeutsche Landsmannschaft nicht mehr bestehen, so fällt auch das ihr zugedachte Vermögen mit der gleichen Auflage an die Patenstadt Schwandorf in Bayern. Bei dieser Verteilung des Vermögens ist dem Finanzamt die ständige Unterrichtung zwecks Überwachung der Wahrung des Gemeinnützigkeitscharakters rechtzeitig anzubieten.
Textvorschlag für den neuen Paragraphen 3 Absatz 4: Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen nach Erfüllung der darauf haftenden Verbindlichkeiten in das Eigentum der Patenstadt Schwandorf in Bayern, die es unmittelbar und ausschließlich zu gemeinnützigen und/oder mildtätigen Zwecken zu verwenden hat. Bei dieser Verteilung des Vermögens ist dem Finanzamt die ständige Unterrichtung zwecks Überwachung der Wahrung des Gemeinnützigkeitscharakters rechtzeitig anzubieten.
Gegenstände zur Geschichte des Falkenauer Gebietes und seiner Bewohner gehen in das Eigentum der Stadt Schwandorf mit der Maßgabe über, sie in unserer Patenstadt Schwandorf zukünftigen Generationen zugänglich zu machen.
Folgender Zusatz soll aufgrund von Rückmeldungen mit aufgenommen werden:
Soweit die Stadt Schwandorf für diese Gegenstände und Dokumente keine Verwendung findet, sollen diese dem Sudentendeutschen Museum überlassen werden. Die Rückgabe von Leihgaben ist den Leihgebern beziehungsweise deren Erben anzubieten.
Neuer Paragraph 3 Absatz 4: Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereines oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen nach Erfüllung der darauf haftenden Verbindlichkeiten in das Eigentum der Patenstadt Schwandorf in Bayern, die es unmittelbar und ausschließlich zu gemeinnützigen und/oder mildtätigen Zwecken zu verwenden hat. Bei dieser Verteilung des Vermögens ist dem Finanzamt die ständige Unterrichtung zwecks Überwachung der Wahrung des Gemeinnützigkeitscharakters rechtzeitig anzubieten.
Gegenstände zur Geschichte des Falkenauer Gebietes und seiner Bewohner gehen in das Eigentum der Stadt Schwandorf mit der Maßgabe über, sie in unserer Patenstadt Schwandorf zukünftigen Generationen zugänglich zu machen. Soweit die Stadt Schwandorf für diese Gegenstände und Dokumente keine Verwendung findet, sollen diese dem Sudetendeutschen Museum überlassen werden. Die Rückgabe von Leihgaben ist den Leihgebern beziehungsweise deren Erben anzubieten.
� Veranstaltungshinweise
Nachfolgend erinnern wir an die nächsten bevorstehenden Termine:
n Samstag, 12. August: Steinbach Prösau Oberreichenauer Treffen zu Maria Himmelfahrt: 14.00 Uhr: Treffen beim Prösauer Kriegerdenkmal mit kurzem Gedenken. Anschließend gemeinsame Fahrt zum Steinbacher Kriegerdenkmal mit Totengedenken.
� „BMW Group“ eröffnet neues Testgelände
In Falkenau rollen jetzt BMWs ohne Fahrer über das Gelände: Die BMW Group hat Ende Juli 2023 ihr „Future Mobility Development Center“ (FMDC) feierlich eröffnet. 300 Millionen Euro investierte der Autobauer in das neue, 600 Hektar große Testgelände, welches weltweit das größte des Unternehmens ist.
Im ehemaligem Tagebau „Uhelna Sokolov“ wird auf einer Gesamtlänge von 25 Kilometern und in einer Höhenlage von 80 Metern die Zukunft des fahrerlosen Autofahrens erprobt.
„Mit unserem neuen ,Future Mobility Development Center‘ haben wir ein weltweit einzigartiges Testgelände geschaffen, exklusiv entworfen für die höchst anspruchsvolle Erprobung von automatisiertem Fahren und Parken“, sagte BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber bei der feierlichen Eröffnung.


Getestet werden dort alle erdenklichen Fahrsituationen in der Stadt, auf dem Land und auf der Autobahn, wie Weber bestätigte. Das Besondere dabei ist, daß alle Test-Module auf dem Gelände direkt hintereinander ohne Stopp durchfahren können.
„Das macht unsere Erprobung maximal realistisch, sicher und kundennah“, so Entwicklungsvorstand Weber.
Im Kreis Karlsbadsieht man die Teststrecke als Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Beim BMWEntwicklungszentrum sollen über 100 Fachkräfte eine Anstellung finden.
„Wir sind jetzt einer der wenigen Orte weltweit mit solch einer Infrastruktur und erwarten, daß sich nicht nur schlaue Köpfe im Kreis Karlsbad ansiedeln, sondern daß der Standort weiter ausgebaut werden kann“, sagte
Kreishauptmann Petr Kulhánek (52 Jahre, parteilos) bei der offiziellen Einweihung. Neben der Verwendung von Grünstrom wurde ein innovatives Wasserbewirtschaftungssystem installiert: Regenwasser wird gesammelt und zur Bewässerung der Strecken genutzt. Auch der Schutz und die Förderung der heimischen Artenvielfalt wurden bei der Planung berücksichtigt: Auf dem gesamten Gelände installierte man Amphibienleitanlagen. Somit will man einen sicheren Überweg für die Tiere über die Teststrecke gewährleisten.
Danach treffen wir uns wie im Vorjahr im „Steinbacher Wirtshäusl“. Auch interessierte Gäste aus der Umgebung sind herzlich willkommen. Dies gilt insbesondere auch für die „Daheimgebliebenen“.
n Sonntag, 13. August: 10.00 Uhr: „Egerländer Gebetstag“ in Maria Kulm (Heilige Messe). Anschließend „Wallfahrertreffen“ und Mittagskonzert der Egerländer Blaskapelle
Münchenreuth am Marktplatz.
–Kontakt: Gerhard Hampl, Telefon (0 91 31) 50 11 15, email geha2@t-online.de


–Kontakt: Bruno Püchner, Telefon (0 81 65) 39 47, email Bpuechner@t-online.de
n Sonntag, 3. September: 10.00 Uhr: Hauptversammlung des Heimatverbandes der Falkenauer e.V. im Konrad Max Kunz Saal in der Oberpfalzhalle Schwandorf/Bayern.
Wir gratulieren allen, die im August in Falkenau Geburtstag haben, und wünschen ihnen alles Gute und Gesundheit im neuen Lebensjahr:
– 97 Geburtstag am 6. August: Paulus, Elfriede, geborene Zeitler, (Krainhof);
– 96. Geburtstag am 20. August: Luber, Helga, geborene Harbauer, (Falkenau);
– 96. Geburtstag am 22. August: Lenz, Alois, (Falkenau);
– 95. Geburtstag am 24. August: Müldner, Karl, (Falkenau);
– 94. Geburtstag am 30. August: Marterer, Josef, (Zieditz);
– 91. Geburtstag am 24. August: Flachsland, Maria geborene Brückner, (Birndorf);
– 88. Geburtstag am 03. August: Müller, Gerda, (Zwodau);
– 88. Geburtstag am 04. August: Blassl, Paul, (Maria-Kulm);
– 88. Geburtstag am 23. August: Hiebl, Ingeborg, (Falkenau);
– 86. Geburtstag am 26. August: Weber, Walter, (Lanz);
– 84. Geburtstag am 19. August: Weber, Irmtraud, geborene Ebert, (Falkenau);
– 82. Geburtstag am 31. August: Behnke, Sigrid, geborene Weitzer, (Falkenau);
– 80. Geburtstag am 29. August: Leonhardt, Horst, (Falkenau);
– 79. Geburtstag am 11. August: Heinisch-Spinka, Ing. Rautgunde, geborene Spinka, (Falkenau);
– 75. Geburtstag am 10. August: Hartl, Reiner, (Haberspirk).
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING vereinigt mit
Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11;
Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende
Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de

JAHRGANG 72
Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Lexa Wessel, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Sengerhof in Bad Neualbenreuth – weiter auf Seite 24
Im Sengerhof in Bad Neualbenreuth konnte der Vorsitzende des „Egerer Landtag e.V.“ am Freitag, den 2. Juni 2023, die Ausstellung „Museale Schätze aus Eger und dem Egerland“ der Öffentlichkeit vorstellen.

� Geigenbauschule Eger
Eine neunköpfige Gruppe junger Menschen im Alter zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren aus aller Welt nahmen im Juli dieses Jahres erfolgreich im Rahmen des schon zur Tradition gewordenen Austauschcamps am Kurs zum Bau von Musikinstrumenten an der Geigenbauschule Eger teil.
Die Organisation der internationalen Veranstaltung lag in den Händen des örtlichen Rotary Clubs in Zusammenarbeit mit der Integrierten Mittelschule Eger, zu der die Geigenbauschule gehört.

Die Geigenbauschule in Eger kann dieses Jahr auf eine 150jährige Tradition zurückblicken. Ursprünglich in der nördlich von Eger liegenden Geigenbauerstadt Schönbach/Luby u Chebu im Jahr 1873 gegründet erwarben in ihr ganze Generationen junger Menschen Wissen, Fertigkeiten und vor allem das Können, aus hochwertigen, teils exotischen Hölzern wohlklingende Streichinstrumente zu bauen. Sie wurde erst 2005 aufgrund


der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen als Folge der Samtenen Revolution im böhmisch-sächsischen Musikwinkel von dort nach Eger verlegt. Sie hat sich inzwischen zum wichtigen Zweig der Integrierten Mittelschule Eger entwickelt und sorgt dafür, daß eines der schönsten und edelsten Handwerke auch für die Zukunft erhalten bleibt.
Bei einem Besuch im Januar dieses Jahres im Rathaus in Bad Neualbenreuth lernten sich Altbürgermeister Albert Köstler und Dr. Wolf-Dieter Hamperl kennen. Er suchte nach einer Möglichkeit, die hervorragenden musealen Exponate des Vereins „Egerer Landtag e.V.“, die in der Geschäftsstelle in Amberg gefunden worden sind, auszustellen. Köstler bot „seinen“ Sengerhof an, einen hervorragend renovierten Egerländer Vierseithof.
Die Idee wurde in die Tat umgesetzt. Hamperl brachte die Exponate dorthin, und Köstler stellte eine große Vitrine zur Verfügung und arrangierte eine sehr schöne Präsentation der Egerer Kunstwerke. Der dritte Bürgermeister Johannes Saalfrank begrüßte die Gäste im Innenhof und würdigte die Tätigkeit von Hamperl im Aufsichtsrat der „Stiftung Egerer
Stadtwald“, welcher öfters Anträge auf Förderung von Projekten in Bad Neualbenreuth behandelt.
Hamperl stellte den zahlreichen Interessenten, darunter auch dem Ehepaar Rubik und Georg Gottfried von dem Vorstand des Egerer Heimatvereins, den „Egerer Landtag e.V.“ vor. Er erinnerte daran, daß die vertriebenen Egerer dort im Ort einen Gedenkstein errichtet und sich maßgeblich am Bau der Kapelle
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
Der vierzehntägige Ferienkurs der Geigenbauschule war auf das Ziel ausgerichtet, Jugendlichen mit eigenen Händen funktionierende, das heißt auch spielbare Musikinstrumente bauen zu lassen.
„Dies ist das vierte internationale Camp, das wir als einer der wenigen im Rahmen internationaler Jugendbewegungen durchführen. Das Besondere an der Veranstaltung ist, daß hier Teilnehmer aus aller Welt aus vorgefertigten Halbzeugen eine Gitarre oder Geige bauen sollen“, erklärt Jiří Pátek, Organisator des Kurses und Direktor der Geigenbauschule. Nach Eger kamen junge Menschen aus Spa-
nien, Taiwan, Schweden, Dänemark, der Türkei, Litauen, Kroatien und aus Israel. „Sie waren in zwei Gruppen unterteilt. Während des Kurses entstanden unter Betreuung des Lehrpersonals wunderschöne Instrumente: fünf Geigen und vier Gitarren“, bilanzierte Pátek.
Aber auch an ein Freizeit- und Kulturprogramm wurde gedacht. Die Kursteilnehmer nutzten die Möglichkeit, Eger und Prag zu erkunden sowie die benachbarten deutschen Städte Hatzenreuth und Adorf zu besuchen.
Ein Rundgang durch Waldsassen und ihre Basilika war genauso vorgesehen wie der Besuch des Naturschutzgebietes Soos. Die Jugendlichen verbrachten auch aktiv einige Zeit auf den Sportplätzen der Stadt und im Freizeitzentrum Aquaforum der Kurstadt Franzensbad. Auch einen Besuch des zur selben Zeit laufenden Internationalen Filmfestivals in Karlsbad ließen sich die Gäste nicht entgehen. dr violinschool.eu idnes.cz
„Maria Frieden“ und des Grenzlandturms beteiligt haben. Der Vorsitzende bedankte sich ganz besonders bei Altbürgermeister Köstler, welcher für die schöne Aufstellung und Beschriftung der Exponate gesorgt hatte. Hamperl stellte dann die besonderen Exponate der Egerer Kunst und Volkskunst vor, darunter vier Stationen eines Kreuzwegs mit Aquarellen Egerer Maler und geschliffenen... Bitte umblättern
Wir gratulieren allen, die im Monat August in Langgrün/Kreis Luditz-Buchau Geburtstag haben, und wünschen ihnen alles erdenklich Gute und viel Gesundheit im neuen Lebensjahr:
– 90. Geburtstag am 1. August: Berta Gaisbauer, geborene Nürnberger, (Hein Koal), Wilhelm-KöhlerStraße 22, 86956 Schongau;
– 88. Geburtstag am 1. August: Maria Steinhauser, geborene Bartl, (Lang Gasthaus), Ludwig Richter Straße 34, 80687 München;
– 81. Geburtstag am 2. August: Erna Kerschl, geborene Keil, (Schlossa), Michaelsbucher Straße 48, 94447 Plattling;
– 92. Geburtstag am 3. August: Margareta Vierheller, geborene Nürnberger, (Picha), Ernst Ludwig Straße 7, 64401 Groß Bieberau;
– 86. Geburtstag am 10. August: Richard Fladerer, Am Taubenacker 7, 91166 Georgensgmünd;
– 83. Geburtstag am 16. August: Werner Bröckl, (Mundl), Chamer Straße 42, 93455 Traitsching/Wilting;
– 86. Geburtstag am 23. August: Frieda Cornelius, geborene Brunner, (Wulfschneida), 35638 Leun;
– 78. Geburtstag am 23. August: Anneliese Richter, geborene Müller, (Streia), Eichelsheimerstraße 9, 68163 Mannheim;
– 74. Geburtstag am 28. August: Ilse Hubich, geborene Schneider, (Streia), Rosenstraße 20, 67699 Heiligenmoschel.


... Spiegelrahmen, sowie das Buch „Hochzeitszug“ mit zwölf bearbeiteten Eichenblättern, auf denen Personen des Hochzeitszugs in Miniaturmalereien aufgeklebt sind.
Weiter kann man einen Patenbrief aus dem Jahr 1820 sehen sowie weitere Aquarelle der Malerfamilie Wolf, welche man über die Grenze retten konnte. Auch Ansichten des mittelalterlichen Eger und ein Ölbild der Stadt aus den 1930er Jahren sind ausgestellt. Besonders beeindruckend ist das Porträt eines Egerer Kaufmanns, welches man aus dem
Rahmen genommen und gerollt über die Grenze bringen konnte, daneben eine Vertreibungskiste.
Ein besonderes Stück ist der Zinnkrug aus dem Jahr 1799 mit Egerer Punze und eingraviertem tanzendem Paar, wobei die Bekleidung der damaligen Zeit interessant ist.
In der Vitrine nebenan ist ein Zinngerät ausgestellt, das der frühere Vorsitzende Ingenieur Uhl der Gemeinde Bad Neualbenreuth zum Geschenk gemacht hatte. Auch Egerländer Frauenschmuck und ein Huas-
naontoudara aus dem Besitz der Egerer Familie Christoph Reinl sind ausgestellt.
Für die Zukunft ist angedacht, die restaurierten Exponate fest im Sengerhof zu etablieren.
Der Sengerhof ist das Kulturund Dokumentationszentrum der Fraisch. Die Ausstellung ist bis zum Ende der Saison zu sehen.
Die Öffnungszeiten und angebotene Führungen sind in der Gäste-Information Bad Neualbenreuth/Sybillenbad zu erfahren, unter der Telefonnummer (0 96 38) 93 32 50. frl
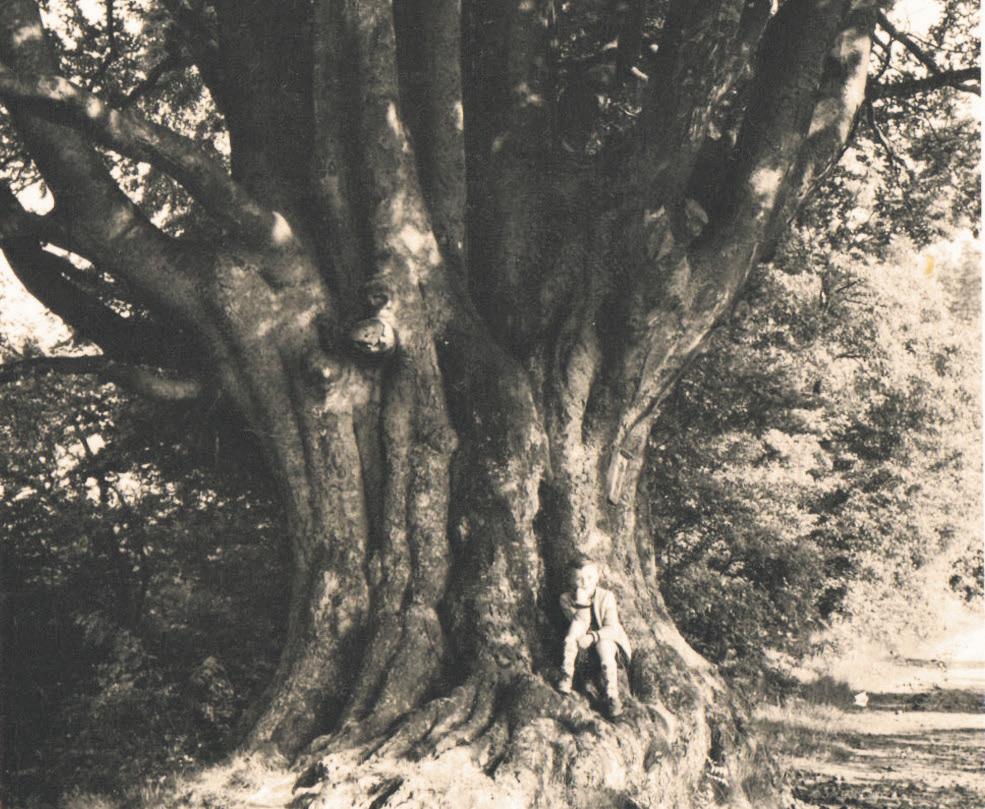
Der Muglbach entspringt am Südwesthang des 865 Meter hohen Schopfberges in der Tschechischen Republik.

Der Muglbach schlängelt sich auf einer Länge von etwa 15 Kilometern, so wie er ursprünglich vor hunderten von Jahren mit vielen Windungen durch die Neualbenreuther Fraisch floß, einem kleinen Gebiet am Fuße des Tillenberges.
Früher fanden sich am Bachlauf ein halbes Dutzend Mühlen, und noch heute wird die Muglmühle von dem Gewässer angetrieben.
Die Bezeichnung „Mugl“ leitet sich vom slawischen Wort „mohyla“ für „Hügl“ ab. Dem-
Ein Küchenchef im Royal York Hotel in Toronto bedankte sich einst für die „Egerer Zeitung“, wie Wolf-Dieter Hamperl erzählt:

Vor Jahren traf in der Geschäftsstelle des „Egerer Landtag e.V.“ in Amberg ein
Brief aus den USA ein, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Gerhard Zechel aus Baxter Cres/
Burlington, bedankt sich, daß er die „Egerer Zeitung“ erhalten hat.
Er schreibt: „Der Inhalt ist immer sehr aufschlußreich. Schon viele Jahre sind vergangen, da ich Eger (Bahnhofstraße Nummer 3) verlassen habe (geboren im Jahr 1933 im August).
Aber ich denke immer noch an die schönen Stunden, die ich bei meinen Großeltern hatte, mit Fo-
rellenfangen und vielem mehr. Die Zeiten vergehen und man meistert sein Leben in anderen Ländern.“ Dem Schreiben legte er eine schöne alte Karte von der Franzensquelle in Franzensbad bei. Außerdem legt er eine Postkarte bei, die das Royal York Hotel Toronto/Kanada mit seinen 1200 Betten darstellt, wo er dreizehneinhalb Jahre lang Küchenchef gewesen ist (1957).
nach ist der 761 Meter hohe Muglberg der namensgebende Hügel.
Märchenhaft stürzt der Muglbach-Wasserfall in der Nähe von Altmugl im kühlen Schatten des Waldes die Felsstufen aus 480 Millionen Jahren altem Schiefer herab – nicht besonders tief, aber umso malerischer. Wer die Fantasie spielen läßt, kann sich dort leicht die Wohnstätte eines Wassergeistes oder einer guten Fee vorstellen. Kein Wunder, daß sich um das idyllische Gewässer zahlreiche Sagen und Mythen ranken. Bevor der Muglbach die Grenze zur Tschechischen Republik passiert und in der Nähe des Wallfahrtsortes Maria Loreto in Altkinsberg in
die Wondreb fließt, gibt es kurz vor der Einöde Muglmühle den zauberhaften Wasserfall. Zu finden ist dieser von Bad Neualbenreuth kommend in Richtung Mähring. Von Altmugl aus führt ein Weg hinab zur Muglmühle, wo der Wasserfall zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar ist. Das Wasser ist dort so rein, daß man getrost davon kosten und sich erfrischen kann. Weitere Wanderwege führen zum Rundweg „Von Eisenhämmern, Töpfern und Schindern“. Stiftland und Steinwald, Ferienregion Stiftland, Basilikaplatz 3, 95652 Waldsassen, Telefon (0 96 32) 8 81 60
B
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der
Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22.

Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE 1
� August 1923 – weiter auf Seite 26

72. JAHRGANG Dezember 2022 FOLGE 11
Liebe Leser der Karlsbader Zeitung,
An erster Stelle soll heute eine besondere Gratulation stehen – nicht zum Geburtstag, sondern zur Verleihung eines Preises.
Da ich davon ausgehe, daß Sie, liebe Leser, auch die anderen Artikel derjenigen Ausgaben der Sudetendeutschen Zeitung lesen, in welcher unser Blatt erscheint, haben Sie sicherlich in der Nummer 28 vom 14. Juli auf Seite 13 im „Egerländer“ schon den Bericht zu „Roland Helmer gewinnt den Kulturpreis“ gelesen. Als Vertreter des Karlsbader Kreises freuen wir uns ganz besonders über diese Würdigung, denn Helmer ist ein gebürtiger Fischener!
Den Ausführungen zu Leben und Werk des Künstlers muß ich nichts weiter hinzufügen –Sie sind schließlich bereits informiert (oder können das noch nachholen).
Einige von Ihnen haben vielleicht auch die Ausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie gesehen, in welcher die abstrakten, leuchtend farbigen Arbeiten Helmers mit Strichzeichnungen von Christian Thannhäuser konfrontiert wurden. Leider lief sie nur über fünf Wochen lang, und ich hatte zu spät davon erfahren, um Sie noch rechtzeitig vorab informieren zu können.
Der Heimatverband und alle Landsleute gratulieren Roland Helmer herzlich zu der Auszeichnung!
Und nun zu den Geburtstagen unserer aktiven und ehemaligen
Gemeindebetreuer im August:
Wir wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit zum:
–80. Geburtstag am 02. August Walter Schöniger (Satteles), 91126 Schwabach; –83. am 03. Manfred Hubl (Engelhaus), 94315 Straubing; –81. am 18.
Karlsbad Stadt

Gemeindebetreuerin Pia
Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Liebe
Landsleute, der Sommer hat schon etliche schwülheiße Tage mit heftigen Gewittern gebracht – vermutlich dauert diese Wetterlage noch an, wenn Sie diese Ausgabe der Karlsbader Zeitung erhalten. Aber am Ende des Monats könnte es langsam besser werden – ich würde mich sehr über einen Spätsommer mit angenehmen Temperaturen und
n 01. August 1923: Bezirkshauptmann Schreitter-Schwarzenfeld legt sein Amt nieder und tritt die ihm verliehene Stelle als Konzeptsbeamter bei der Bezirksverwaltungskommission an.
n 2. August 1923: Warren G. Harding, Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, stirbt in San Francisco an einem Schlaganfall.
n 4. August 1923: P. Josef Bergmann, gewesener Dechant in Karlsbad, tritt seine Stelle als Kommandeur in Eger an.
n 4.–6. August 1923: Antonín Švehla, tschechoslowakischer Ministerpräsident, und Ion Costantin Brătianu, rumänischer Ministerpräsident, weilen hier zur Kur. Letzterer spendet 500 Kronen für die Armen. Das Stadttheater wird auf weitere zwei Jahre an Oskar Basch verpachtet, da die alte Pacht mit dem 30. September abläuft.
n 6. August 1923: Der 13. Zionistische Kongreß wird im Grandhotel „Schützenhaus“ in Karlsbad eröffnet. 400 Delegierte aus der ganzen Welt nehmen daran teil.
n 17. August 1923: Egon Jordan, Sohn des gewesenen Bezirkshauptmanns von Karlsbad, gastiert mit Erfolg im Stadttheater.
n 19. August 2023: Gedächtnisgottesdienst für die gefallenen Helden Karlsbads in der Dekanalkirche.
Monsterkonzert der Vereinigung der Berufsmusiker im Posthof um halb 11.00 Uhr vormittags. Aufgeführt wurde die „Alpensymphonie“ von Richard Strauß, Dirigent ist Generalmusikdirektor Robert Manzer.
Im Café Posthof wird anläßlich des am 25. August beginnenden großen Bundesfestes die Kunstausstellung „Alt-Karlsbad im Bilde“ eröffnet.
Herbert Kraus (Gfell), 68647 Biblis; –71. am 29. Dr. Joachim Ruppert (Schönfeld), 64342 Seeheim-Jugenheim.


Eine sehr schöne Idee hatte unser Vorstandsmitglied Rudi Baier: Auf seine Einladung hin besuchten Irena Kašaková und Pavel Padua aus der Ortsgruppe Karlsbad die Landshuter Hochzeit. Er berichtet: „Vom Treiben in der Altstadt und vom Hochzeitszug mit den über 2000 Mitwirkenden waren beide sehr be-

geistert, haben sie doch so ein historisches Ereignis in dieser Größe noch nie erlebt. Von der Burg Trausnitz und den ,Spielen im nächtlichen Lager‘ war Pavel sehr angetan. Die beiden Tage bei sommerlicher Hitze werden den beiden Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.“ Herzlichen Dank an Rudi, daß er den beiden Freunden dieses unvergeßliche Erlebnis bereitet hat. Abschließend nochmals der Hinweis auf die geplanten Tref-
fen. Es stehen bevor:
–das Drahowitzer Treffen am Sonntag, den 10. September 2023, findet wie gewohnt im Kapellenhof in Roßtal statt;
–die Hauptversammlung des HVdK am 24. September, findet ebenfalls im Kapellenhof in Roßtal statt.
Im Kapellenhof ist auch eine Möglichkeit zur Übernachtung gegeben.
Herzliche Grüße, Pia Eschbaumer
n 7. August 1923: Patriarch Erzbischof von Warschau Kakowski, der Brünner Bischof Dr. Klein, der Prager Weihbischof Dr. Sedlak, und der Führer der slowenischen katholischen Partei Kanonikus Korvschec, weilen zur Kur in Karlsbad.
Zimmerbrand im Haus „Parzenzo“.
n 8. August 1923: Der als Philanthrop wohlbekannte Inhaber eines Reisebüros in Karlsbad, Rudolf Mayer, verstirbt im Alter von 61 Jahren.
n 12. August 1923: Eine selten große Menge von Ausflüglern besucht Karlsbad.
n 20. August 1923: Professor Dr. Adolf Pleischl, ein um Karlsbads Quellen-Versendung hochverdienter Gelehrter und Ehrenbürger von Karlsbad, verstorben 1867 in Wien, liegt am Sankt Marxer Friedhof begraben und muß, da dieser Friedhof aufgelassen wird, exhumiert und in den Zentralfriedhof in Wien verlegt werden. Die Stadt Karlsbad trägt die erforderlichen Kosten per 1 555 200 deutsch-österreichischer Kronen, da die Nachkommen Pleischls mittellos sind.
Die städtische KohlensäureVerflüssigungsanstalt wird an Ludwig Eberhard auf sechs Jahre verpachtet.
Das Restaurant „Panorama“ wird an Bernard Brum auf drei Jahre verpachtet. n 24. August 1923: In Karlsbad findet der Reichsverbandstag des Ärzteverbandes der Tschechischen Republik statt. n 25.–27. August 1923: Bundesfest und 29. HauptverBitte umblättern auf Seite 20
blankgeputztem Himmel freuen!
Am 15. August begehen die Christen das Hochfest Mariä Himmelfahrt, den höchsten der Marienfesttage, welcher in vielen Gegenden sogar ein gesetzlicher Feiertag ist und mit Wallfahrten begangen wird. Ich verbinde mit diesem Tag auch eine Phase des Wetterwechsels: In meiner Erinnerung ist oft um diesen Termin herum eine Regenfront mit Wind und kalten Temperaturen herangezogen, und wenn sich dann alles beruhigt hatte, konnte man wieder durchatmen. Wie auch immer das Wetter sein wird, wir wünschen unseren Geburtstagskindern einen fröhlichen Tag und gratulieren herzlich zum: –89. Geburtstag am 24. August Steidele/Hahn, Paula, (Kirchenplatz), 88255 Baienfurt;
–85. am 28. Hüber, Manfred, (Kunststraße), 35638 Leun/Lahn; –84. am 15. Pickert, Gerda, (Arco), 90475 Nürnberg. Leider muß ich wieder einen Todesfall melden: Soeben teilte mir Traudl Kleedorfer-Fritsch mit, daß ihre Freundin aus frühesten Jugendtagen, Anna Bekker, geborene Syba, bereits am 20. Februar/Feber dieses Jahres gestorben ist. Ihren 95. Geburtstag am 29. Juni, zu welchem wir ihr hier und auch brieflich gratuliert hatten, durfte sie also garnicht mehr erleben. Da ihr Mann bereits vor einem Jahr verstorben ist und die beiden keine Kinder hatten, kümmerte sich vor allem ihr Patenkind, die Tochter von Kleedorfer, um sie. Diesen beiden gilt in erster Linie unsere Anteilnahme.
In der Juli-Ausgabe der Karls-
bader Zeitung habe ich von der Wiedereröffnung des Kaiserbades berichtet. Weiteres dazu schreibt in dieser Ausgabe Susanne Pollak, die Geschäftsfüh-
rerin unseres Heimatverbandes.
Schon im Juni gab es von mir
einen Hinweis auf das Filmfest in der ersten Juliwoche. Ein Bericht dazu erschien auf Seite drei der
Sudetendeutschen Zeitung, Nummer 28 vom 14. Juli, also in der Nummer, welche auch die JuliAusgabe unserer Karlsbader ZeiBitte umblättern
tung enthielt, so daß Sie sich alle dort informieren können.
Zufälligerweise war unter den Fotos zum Filmfest, die Herr Foglar uns zuschickte, auch eines, das sehr freundliche Erinnerungen in mir weckt. Sehen Sie genau auf das Bild mit dem Blick über die Tepl zum Hotel Pupp: Dort sehen Sie im Hintergrund eine Brücke. Sie spannt sich zwischen Alter und Neuer Wiese und mündet dort genau vor dem Hotel „Embassy“ (nicht zu verwechseln mit dem „Ambassador“ am anderen Ende der Stadt, dem früheren „Schützenhaus“).
Dieses Brücklein dient aber nicht nur zur Überquerung der Tepl, sondern ist auch mit Tischen bestückt. Bei schönem Wetter serviert dort das Restaurant des „Embassy“ Speis und Trank (eine sportliche Angelegenheit für die Kellner, welche mit ihren Tabletts über die Straße und ein paar Stufen hinauf laufen müssen). Einige Male habe ich mich dort schon nach einer Wanderung durch die Wälder mit Kaffee und böhmischen
Mehlspeisen (Liwanzen, Powidltatschkerln) gestärkt und dabei die wunderbare Aussicht hinauf zur König-Otto-Höhe genossen.
Ich habe es bestimmt mindestens einmal schon geschrieben:
In Karlsbad läßt es sich nicht nur gut kuren, sondern auch wunderbar um die Stadt herum wandern – kann man so nicht auch jüngeren Leuten einen Aufenthalt schmackhaft machen?
Es grüßt Sie herzlich, Pia Eschbaumer
Im Stadtkreis: Drahowitz
Gemeindebetreuer Erwin
Zwerschina, Am Lohgraben 21, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Telefon (0 96 61) 31 52, Fax (0 96 61)
8 13 78 37
Im Monat August gratulieren wir herzlich zum Geburtstag zum:
–96. Geburtstag am 30. August Kveim/ Keil, Marianne, (Schellingstraße 198), N-4950 Risör; –94. am 11. Stark, Helmut, 74906 Bad Rappenau; –84. am 08. Plößl/ Zuleger, Brigitte, (Egertalstraße 204), 93053 Regensburg; –84.
Kohlhau
am 25. Ehm, Horst Alois (Gewerbegasse 161), 85247 Schwabhausen. Erinnern möchte ich nochmal an unser Drahowitzer Treffen am Sonntag, den 10. September 2023, wie gewohnt im Kapellenhof in Roßtal. Dort ist auch eine Übernachtungsmöglichkeit für alle gegeben, die nicht an einem Tag hin- und zurückreisen wollen.
Ihr Erwin Zwerschina
Espenthor
Gemeindebetreuer Rudolf
Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de Wir gratulieren zum Geburtstag all denen, die in den nächsten Tagen Geburtstag feiern. Wir wünschen Ihnen allen alles erdenklich Gute, vor allem wünschen wir Ihnen Gesundheit und Gottes Segen, und den Kranken gute Besserung.
Liebe Landsleute, nur noch wenige Landsleute werden sich an den Hauptlehrer Hans Schiffner erinnern, der am 4. Oktober 1975 in Ebermannstadt verstorben ist. Sein
Wirken in Espenthor verdient sicherlich eine ausführliche Würdigung, da er das kulturelle Leben in Espenthor wesentlich mitgestaltet hat.
Man erinnert sich an verschiedene Theateraufführungen in „Wallischs Gasthaus“, zum Beispiel an „Das Nullerl“, „Die Waffen nieder“, „Rudolf von Habsburg“ und weitere. Diese studierte er in den ersten Jahren seines Schaffens in Espenthor nicht nur ein, sondern spielte auch selbst mit.
Außerdem erwarb er sich große Verdienste als Chorleiter des Gesangsvereins sowie als Feuerwehrhauptmann. Nicht zuletzt war er in über 25jähriger Tätigkeit als Lehrer an der hiesigen Volksschule.
Zu erwähnen bleibt noch, daß er einige Zeit lang auch Bürgermeister war, was seine vielseitigen Fähigkeiten gleichzeitig bezeugen dürfte.
Ihr Gemeindebetreuer
Rudi Baier



Gemeindebetreuer Albin Häring, Clemens-Brentano-Str. 22, 35043 Marburg/L.-Cappel, Telefon/Fax (0 64 21) 4 53 02 Herzliche Geburtstagsgrüße und gute Wünsche für das neue Lebensjahr übermittle ich im Monat August zum: –93. Geburtstag am 08. August Ilse Müller, geborene Beck, Hauptstraße 14, 95138 Bad Steben – eine treue Leserin unserer Karlsbader Zeitung; –82. am 12. Herbert Köhler, (Sohn von Anton und Berta Köhler/Brandl).
Leider habe ich von zwei Sterbefällen zu berichten:
Am 10. Mai 2023 verstarb im Alter von 84 Jahren Franz Schöniger in Michelsneukirchen im Bayerischen Wald.
Franz Schöniger war mein Cousin: Seine Mutter Leopoldine (Poldi) Schöniger, geborene Häring, war die Schwester meines Vaters. Sein Vater Anton Schöniger war im Zweiten Weltkrieg gefallen.
Im Zuge der Vertreibung kam Franz mit seiner Mutter und mit seiner Schwester Judith nach Michelsneukirchen. Judith, verheiratete Dobmeier, geboren im Jahr 1933, verstarb bereits im Jahr 2019.

Franz war von Beruf Heizungsmonteur. Er engagierte sich sehr in den Vereinen an seinem Wohnort und war mehrere Jahre lang Feuerwehrkommandant. In Michelsneukirchen baute er mit seiner Mutter ein Haus.
Um ihn trauern seine Ehefrau Fanny, eine Tochter, zwei Söhne und zwei Enkelkinder.
Am 29. Juni 2023 verstarb, 90 Jahre alt, Gertrud Schloßbauer in Poing. Dort wohnte sie seit der Vertreibung, in dem Haus, das ihre Eltern errichteten. Sie war unverheiratet und beruflich als kaufmännische Angestellte und Sekretärin in einem holzverarbeitenden Betrieb tätig.
Ihr Bruder Herbert Schloßbauer wohnt im selben Ort und in derselben Straße. Ihm und seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. Ich selbst habe in ihr wieder jemanden von den wenigen Kohlhauern, die mit mir Kontakt hielten, verloren.
Albin Häring
Im Landkreis:
Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Telefon (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf. Preis@t-online.de
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag senden wir im August zum: –87. Geburtstag am 07. August Kurt Rödig, 85037 Ingolstadt; –85. am 25. Georg Siegl, 91174 Spalt.
Es gibt einen Trauerfall: Herbert Leidel teilte mir mit, daß seine Mutter Irmgard Leidel/Fuchs am 11. Juli 2023 zu Hause friedlich eingeschlafen ist.
Irmgard Leidel/Fuchs, geboren am 21. September 1932 in Altrohlau, war über viele Jahre unsere stete Begleiterin, wenn wir per Kleinbus an Christi Himmelfahrt zum Altrohlauer Kirchenfest fuhren.
Im Namen aller Altrohlauer bekunde ich den Angehörigen unser zutiefst empfundenes Mitgefühl.
Altrohlau-Chronik – 14. Teil von Dr. Alois Tröber
Im Jahr 1899: Am 15. Mai wird die Bahnlinie von Karlsbad („Buschtiehrader Bahnhof“ auf der Zettlitzer Höhe – später „Rosenbühl“, im Volksmund „Laushübl“ genannt) nach Neudek nach zehnjährigem Papierkrieg in Betrieb genommen. Die Genehmigung zum Bau erfolgte bereits 1884. Später wurde die Strecke bis Johanngeorgenstadt weitergeführt.
Der Bau der Bahnstrecke sowie auch des Bahnhofes, auf 391 Metern über Normalnull, erfolgt zwischen 1896 und 1899 vorwiegend durch italienische Arbeitskräfte. Diese sind im Haus der Rohm Malerei, Nummer 246, in zwei Räumen des Erdgeschosses untergebracht und leben dort ganz nach italienischer Art (mit eigenem Koch). Geleitet wird das Bauvorhaben von zwei italienischen Ingenieuren. Am Abend nach der Arbeit singen die Italiener Volkslieder aus ihrer Heimat. Die Arbeiten am Baukörper haben nicht nur für viel Aufregung gesorgt, sondern auch ihre Opfer gefordert.
Als letztes Teilstück wird nach Vertragsunterzeichnung im Jahr 1897 über die Gleismitbenutzung zwischen den bauenden Eisenbahngesellschaften „Lokal-Eisenbahngesellschaft“ (Teilstreckenbau Neudek–Neurohlau) und der „Buschtiehrader Eisenbahngesellschaft“ (Teilstück Karlsbad–Altrohlau) die Strecke zwischen Altrohlau und Neurohlau gebaut. Die Häuser Nummer drei und sieben müssen dem Bahnbau weichen und werden abgerissen. Die errichtete Bahnlinie bewirkt eine weitere Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Altrohlau (seit 5. August 1870 besteht bereits die Buschtiehrader Eisenbahnverbindung Prag–Rakonitz–Karlsbad und seit 19. September 1870 auch die Verbindung zwischen Karlsbad und Eger. Die erste Begehungskommission zum Buschtiehrader Bahnhof tagte schon am 9. Juni 1869). Vor dem Bahnbau mußten die Altrohlauer Porzellanfabriken ihre zu versendenden Waren mittels Pferdefuhrwerken zum Karlsbader Bahnhof schaffen. Auch örtliche Landwirte leisteten dort Spanndienste als lohnenden Nebenerwerb. Einige haben sich ganz auf diesen Fuhrbetrieb umgestellt.

Selbst nach Inbetriebnahme der Strecke Karlsbad–Johanngeorgenstadt blüht der Fuhrbetrieb der Landwirte weiter, da es den Fabriken an Gleisanschlüssen (außer der Victoria) mangelt. Auch die Rohstoffe Kaolin, Feldspat, Quarz und der Brennstoff Kohle müssen weiter mit Pferdefuhrwerken herantransportiert werden. Über die Rohlau führt seit dem Bau der Reichsstraße und besonders seit dem Bahnbau eine neue (heutige) Brücke, die entschieden höher angelegt wird.
Im September: Die Eintragung im Handelsregister des Egerer Kreisgerichts zur ersten Porzellanfabrik in Altrohlau lautet: „Fa. Altrohlauer Porzellanfabriken Moritz Zdekauer“ (als Zweigniederlassung der Kommanditgesellschaft in Prag. Kommanditisten: Dr. Karl Ritter Freiherr von Zdekauer, Gabriele, Marianne und Alice von Zdekauer).
Der Keramiker Viktor Schäffner wird nach Kündigung der beiden Direktoren A. Schäferling und W. Schreiber mit der Oberleitung der „Zdekauer“ betraut. A. Sattler wird kaufmännischer Direktor.
Um 1900: Neu erschlossen wird gegen Mitte der 90er Jah-
re auch das Ranftviertel mit den Häusern Henzl Nummer 190, Wild Villa Nummer 244, Ranft Hotel Nummer 248, Lano Nummer 249, Heinzl Johann Nummer 250, Bolland/Holleschovsky Nummer 252. Vom Ranft Hotel bis zum Haus Nummer 283 bei den Horak Häusern (Singerviertel) ist eine Querstraße direkt zum Bahnhof geplant, welche aber nie zur Ausführung kommt.
Überall in Altrohlau wird gebaut (1900 bis 1904 entstehen rund 50 Häuser). Am regsten ist die Bautätigkeit weiter im Ranft Viertel, wo insgesamt 13 neue Häuser entstehen, wie zum Beispiel die Mannl Villa Nummer 264, Fleischer Otto Nummer 265, Wiesinger Marie Nummer 266, Blankenburg (Ofensetzer, Ofenkacheln) Nummer 270, Kollmer/Ranft – zuletzt Henzl Bruno Nummer 278, Holdschik – zuletzt Deml Nummer 280, Gasthaus Bummelstübl Jakob Kraus – zuletzt Tröber Nummer 281, Lorenz/Jirsa Nummer 288, Ranft Hinterhaus Nummer 299, Bachmann Nummer 301.
Die Konzession vom Ranft Hotel wird auf das Bummelstübl übertragen. In der Hauptstraße entstehen fünf neue Häuser, davon einige größere Mietshäuser, wie das Moder Haus Nummer 274 oder das Köhler Haus Nummer 284. Weiter entstehen die Gebäude der Gutherz/Epiag Nummer 276 sowie die Häuser Möckl Nummer 286 und Morz Nummer 300.

Auf der Londoner Haich kommen neun Häuser hinzu, zum Beispiel Siegerts Erben Nummer 275, Schlee Nummer 290, Sabathil Nummer 291, Konsum Verein Nummer 296, bei den Hofmann Häusern Dennl Nummer 279, Goblirsch Nummer 304 und Lohwasser Nummer 308.
Im Singerviertel errichtet man die Häuser Horak/Pilz Nummer 268, Tausch Nummer 283 und die Gärtnerei Scherbaum/ Gottwald Nummer 309. In der Allianzgasse sind es die Häuser Bräutigam Nummer 262, Dutz Nummer 307, Leipold Nummer 302. In der Friedhofstraße kommen die Häuser Helfert Nummer 269, Hofmann/Pollak Nummer 273 und Rohleder Nummer 293 hinzu; am Kukkuck Krahl Nummer 267 und Schwengsbier Nummer 289. Am Kirchenplatz kommt hinzu Hopf Ernst Nummer 282, am Katzberg das Dietl Wirtshaus Erzgebirgrer Hof Nummer 285 und Hopf Franz Nummer 287. In der Merangasse kommt die Gottl Villa Nummer 295 dazu.
Am Schneiderberg werden die ersten Häuser errichtet: Ullmann Nummer 298 (neben der Schneider-Fabrik), an der Neudeker Straße der Habl-Hof Nummer 306 (später Blaschek – zuletzt Rohm). Am Richterberg entsteht die Richter Tischlerei Nummer 277. Das Schwergewicht der Bautätigkeit liegt in den 20er Jahren und später. (Fortsetzung folgt)
„D’Eadöpflsuppn“
„In da äiaschtn Zeit håbms döi gunga Weiwa neat imma leicht mitn Kochn. Glei könna sie häian: ,Dös håut ma Mutta a sua gmacht‘ oder ,Sua wöi ba meina Mutta schmeckt des neat!‘ Jå, d‘Mutta koa ebm åls vül bessa, wal da gout Bou döi vülln långa Gåua ba ihra Kuchl afgwåchsn is. An Moa wår d‘Eadöopflsuppn nöi recht. ,Da Eadöpflsuppn is jå gånz goat‘, sågt a, ,owa meina Mutta ihra wår vüll bessa, sua bringst du sie hålt neat zsåmm!‘ Stöllts enk vüa, wöi dåu dean gunga Weiwla wår. Sie wollt doch neat zruckstäih, prowiert ållahånd mit da Eadöpflsuppn u fräigt a ra wenig üm, dafüahrt owa no, daß


d’onnan d’Eadöpflsuppn a no mit Wåssa kochn. Da Moa owa bleibt ba seina Riad. Wos sua ra Köche asstäih mou, wåu sie doch gwieß ‘s Besta leistn wüll. Wieda ra mål d‘Eadöpflsuppn droa u dåu wülls löiwa Glück, daß sie unvaseahns oabrennt, sua richte oabrennt. Wos wird ma Mannerl heint ålls wissen u sogn, denkts Weiwl ban Aftrogn. Er schöpft asse, fängt oa zan Löffln u dåu kröign seina Aigla r‘an Glånz u er sågt gånz glücklich: ,Heint is sie recht d’Eadöpflsuppn, heint håst meina Mutta ihr Rezept gfunna, sua moußt sie imma måchn!‘“ Einen sonnigen, nicht zu heißen August wünscht der gesamten Leserschaft, Rudi Preis
Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de Wir gratulieren zum Geburtstag all denen, die in den nächsten Tagen Geburtstag feiern. Wir wünschen Ihnen allen alles erdenklich Gute, vor allem wünschen wir Ihnen Gesundheit und Gottes Segen, und den Kranken gute Besserung. Liebe Edersgrüner, im „Karlsbader Badeblatt“ von 1956 konnte ich folgenden Beitrag finden: „Die Gemeinde Edersgrün hat folgende Verluste in den Weltkriegen zu beklagen: Erster Weltkrieg 1914/1918: Max Hammerschmidt, Josef Lill, Franz Pecher, Wilhelm Tilp, Anton Rau und Wenzl Wirkner.
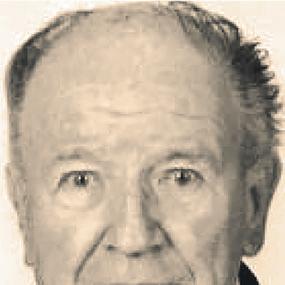
Zweiter Weltkrieg 1939/1945: Rudi Bernhardt, gefallen 31. Januar 1942 in Rußland, Ernst Bernhardt, gefallen 17. Juni 1944 in Frankreich, Josef Frisch, gefallen 15. Februar 1945 in Luxemburg, Anton Pecher, gestorben am 14. Januar 1949 unmittelbar nach Rückkehr aus serbischer Kriegsgefangenschaft an den Folgen der großen Entbehrungen, Anton Rödig, gefallen 3. Juli 1942 in Rußland. Vermißt werden aus dem Weltkrieg 1939/1945: Ernst Schneider, geboren am 15. Oktober 1915, vermißt in Rußland, Willi Wirkner, geboren am 31. März 1910, vermißt in Rußland, und Ernst Zimmermann, geboren am 21. Dezember 1904, vermißt in Rußland.“ Ich wünsche Ihnen noch erholsame Augusttage. Ihr Gemeindebetreuer Rudi Baier
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail Rudolf. Kreisl@gmx.de Wir sind nun mitten im Sommer angelangt, Sie halten gerade die AugustAusgabe unserer Heimatzeitung in der Hand. Früher, in unserem von Bauern geprägten Dorf, war zu dieser Zeit die Ernte in vollem Gang. Mir ist vor einigen Tagen ein altes Gedicht untergekommen, das zu dieser Zeit paßt. Der Verfasser ist mir unbekannt. Der Titel lautet „Vuar(n Schnid“: „Wenn i draß im Summa gäih, oft sua af ran Roinla stäih Bitte umblättern
� August 2023 – Fortsetzung zu Seite 26
batråcht mia(r)‘s Wintakua(r)n, dös si niedaduckt am Bua(d)n künnt’s mia(r vüa(r, als wenn die Ährn, beten töin za Gott, dem Herrn.
u
Daß ea(r)‘s nemma möcht‘ in Hout, schicken möcht‘ die Sunnaglout, dann dazwischn a(r) an Reng, niat za viel u niat za weng, daß ea(r)‘s möcht‘ niat niedaschlogn innan håißen Gwittatog’n.
Daß ea(r)‘s måchen möcht‘ reat schwa, daß die Arma Bråut kröig’n a.
Dös denk‘ i mia(r öfta holt, siah i schimman s‘Kua(r)n wöi Gold.“
Wir lesen uns wieder im September, wenn die Ernte so langsam zu Ende geht.
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Langgrün
Dr. Peter Rau, Mittelehrenbach 136, 91359 Leutenbach, Telefon (0 91 99) 4 60, Fax (0 91 99) 69 70 84, eMail rau. peter@gmx.net
Nach langer Zeit habe ich kürzlich wieder einmal eine Information zu Langgrün erhalten – leider keine schöne:
Verstorben ist am 5. Juli Edith Wagner im Alter von 91 Jahren. Sie lebte in Großhabersdorf. Um sie trauern ihre Tochter Ingried und ihr Enkel.
Den Angehörigen gilt meine herzliche Anteilnahme, insbesondere deshalb, da ich Frau Wagner persönlich gekannt habe.
Allen Lesern eine schöne Zeit, mit freundlichem Gruß, Peter Rau
Lichtenstadt
Gemeindebetreuerin Magdalena Geißler, Karlsbader Straße 8, 91083 Baiersdorf-Hagenau, Telefon (0 91 33) 33 24; Heimatstube in 90513

Zirndorf, Fürtrefflicher Straße 8; betreut von Christina Rösch-Kranholdt, Egloffsteiner Ring 6, 96146 Altendorf, Telefon (0 95 45) 35 98 13.
Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag im Monat August zum:
–94. Geburtstag am 12. August Rosl Litz, geborene Pökelt, 91315 Höchstadt; –91. am 22. Erna Heinlein, geborene Dengler, 91077 Neunkirchen a.Br.;
–86. am 25. Christl Schmidt, geborene Preis, 96032 Hof/Saale;
–86. am 17. Renate Berger, geborene Schreiber, 90587 Veitsbronn; –82. am 24. Marianne Bauer, 83417 Kirchanschöring;
–78. am 16. Reinhard Häuser. Wenn wir uns wünschten, nur glücklich zu sein, ginge das sicher in Erfüllung. Aber wir wünschen uns, glücklicher als andere zu sein. Doch das ist nicht möglich, denn wir halten die anderen immer für glücklicher als sie sind.
Magdalena Geißler
Am 20. Juni fuhren wir (Leni, Ursel, ich und Daniel) wieder nach Lichtenstadt, um die Gedenkstätte von dem Unkraut zu befreien. Als wir am Friedhof ankamen, waren wir entsetzt, wieviel Unkraut schon wieder gewachsen war. Erst im April waren wir doch vor Ort gewesen. Zwei Stunden waren wir damit beschäftigt, diesen Platz wieder ansehnlich zu gestalten. Was ich persönlich nicht verstehen kann, ist, warum diese Gedenkstätte so groß sein mußte? Denn es besteht eigentlich von niemandem großes Interesse daran, ab und zu diesen Platz zu besuchen – außer von meiner Familie. In ein paar Wochen wird dieser Ort wieder verwahrlost sein und keinem mehr gerecht werden. Deshalb muß überlegt werden, wie es weitergehen soll. Feststeht, daß in Lichtenstadt keiner mehr da ist, der ab und zu einmal die Gedenkstätte pflegt. Bei unserem nächsten Besuch werden wir uns mit dem Bürgermeister und seiner Dolmetscherin treffen, um zu klären, was in Zukunft zu tun ist. Mein Vorschlag wäre es, nur den Mittelteil zu behalten, rechts und links die Platten zu entfernen und Rasen oder Bodendecker zu pflanzen. Für Ihre Vorschläge und Ideen haben wir jederzeit ein offenes Ohr.


Christina und Daniel
Rodisfort
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de Wir gratulieren herzlich zum 90. Geburtstag am 02. August Rudolf Leger, 71069 Sindelfingen/Maichingen.
Schnell ist wieder einmal die Zeit verstrichen, und wir halten mitten im Sommer die Ausgabe des Monats August unserer Heimatzeitung in unseren Händen.
Wie ich Ihnen in der Juli-Ausgabe schon mitgeteilt habe, ist unser Landsmann Heinrich (Heiner) Grund verstorben. Vor zwei
Jahren, am 1. September 2021, durfte er noch bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Er wurde im August 1946 als 15jähriger aus seinem geliebten Rodisfort vertrieben.
Der Zug brachte ihn mit anderen Rodisfortern nach Auerbach/ Oberpfalz und danach nach Rothenbruck. Im Jahr 1958 zog der ehemalige Bahnbeamte dann mit seinen Eltern nach Neuhaus/ Pegnitz, wo man Grund und Boden erwarb und darauf ein Haus baute.
Bereits als Neunjähriger lernte er noch im Egerland das Akkordeonspielen und entdeckte die Welt der Musik. In seiner zweiten Heimat, in Bayern, lernte er bei Paul Stefl und zusätzlich bei Obermusikmeister Hans Horst in Hartenstein Posaune, Bariton, Kontrabaß und Schlagzeug spielen.
Ebenfalls in seiner Heimat Rodisfort begann er beim „KåuaSchousta“ (Kauer-Schuster) eine Schuhmacherlehre. Von 1947 bis 1950 ließ er sich dann in der „Neuen Heimat“ im Schuhmacherhandwerk weiter ausbilden und legte die Prüfung dazu ab. Später (1952–1955) studierte Grund am Musik-Konservatorium in Nürnberg. Er belegte dort die Nebenfächer Klavier, Gehörbildung, Harmonielehre, Musikgeschichte und Orchester. Während eines Ferienjobs bei der Bundesbahn blieb er 1955 beim Staatsunternehmen Bahn „hängen“ und verdiente von da an dort seine Brötchen.
Im Jahr 1957 heiratete Grund seine Gretel. Sie schenkte ihm zwei Kinder, die Tochter Cornelia und den Sohn Peter. Leider verstarb seine Frau am 12. August 1997 plötzlich an einem Aneurysma. Seitdem lebte Heinrich Grund mit seinem Sohn Peter und dessen Familie im selbsterbauten Haus in Neuhaus/Pegnitz. Sehr viel Freude machten ihm auch die vier Enkelkinder.
Musik ist und war sein Leben: Seit 1949 wirkte der Neuhauser in Musikkapellen mit. Am Anfang saß er in den Reihen der Musiker und nahm die Instrumente in die Hand, und 1972 tauschte er sie dann in den Dirigentenstab um. Damals übernahm er von Hans Bauer die Musikkapelle Neuhaus und leitete sie bis 1987.
Kurze Zeit später setzte Grund den Stab in Velden an, wo er bis in die 1990er Jahre vor der „Mannschaft“ stand.
Die Erfolge des gebürtigen
Egerländers sind nicht von der Hand zu weisen: Erste Ränge mit Auszeichnungen und Belobigungen bei Wertungsspielen, verschiedene Rundfunk-Live-Sendungen und Aufzeichnungen, Schallplattenaufnahmen, sowie die erfolgreiche Entsendung von Schülern zu „Jugend musiziert“. Gewürdigt wurden die Leistungen des Vollblutmusikers 1973, als Grund von dem Nordbayerischen Musikbund die goldene Ehrennadel für die Verdienste um die Deutsche Volksmusik bekam, und im September 1988, als er von dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Auszeichnung als staatlich anerkannter Leiter im Laienmusizieren erhielt.
Seine alte Heimat Rodisfort hat er nie vergessen. Er besuchte mehrmals im Jahr sein Rodisfort, die Eger, die Wenzelskirche, den Friedhof, das Haus seiner Eltern, aus dem er vertrieben wurde, und auch das Gasthaus zur Spitz, wo er sich oft die gute Egerländer Küche schmecken ließ.
Ein arbeitsreiches, künstlerisches Leben ging zu Ende. Im Bayreuther Krankenhaus konnte man nichts mehr für ihn tun. Er erwarb nicht nur in Neuhaus viele Verdienste, was spürbar an den vielen Trauergästen war. Diese geleiteten ihn mit zwei Blaskapellen durch Neuhaus zum Friedhof, wo er nun seine letzte Ruhe fand. Die Blaskapelle verabschiedete ihn am Grab mit dem „Eghalanda Nausschmeißer“.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.
„Es koa(n koina dåubleibm af dera schäin Ear(d)n; A jedra mouß fuart, owa koina gäiht gearn.
Ho(b Dånk füa(r da(n Goutsa(n, füa(r d‘ Plåugh u füa(r d‘Möih! Wåiß Gott, as Basåmmsa(n mit Dia(r woa(r oft schäi(n.
Du håust’s üwaståndn, füa(r imma da(n Rouh! Mia(r hobms hålt nuch vua-r-uns u werkeln sua zou.
Wöi Gott wüll, mogh’s kumma, wöi Gott wüll, mogh‘s wearn! ‘s Lebm is nea-r-a Hutza af dera schäin Ear(d)n!“
Ich freue mich schon darauf, Sie alle im September wieder gesund und munter hier begrüßen zu dürfen, dann hoffentlich einmal wieder mit angenehmeren Nachrichten.
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Schneidmühl
Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030
Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de
Wir gratulieren zum Geburtstag all denen, die in den nächsten Tagen Geburtstag feiern. Wir wünschen Ihnen allen alles erdenklich Gute, vor allem wünschen wir Ihnen Gesundheit und Gottes Segen, und den Kranken gute Besserung. Liebe Schneidmühler, unter der Überschrift „Bergmännische Städte und Dörfer“ ist auch der Ort Schneidmühl im Internet zu finden. Dort heißt es: „Schneidmühl befindet sich am Rande des Kaiserwaldes am Lamitzbach. Nördlich liegt der Flughafen Karlsbad, im Westen der Stausee Donawitz. Seit 1597 stand im zur Herrschaft Petschau bei Tepl gehörigen Tal des Lamitzbaches eine Mühle, deren Existenz seit den 1620er Jahren schriftlich belegt ist. In der Steuerrolle von 1654 sind für Schneidmühl, das zum Kataster Funkenstein gehörte, sechs Beisassen, darunter drei Köhler ausgewiesen. Während der Herrschaft von Dominik von Kaunitz wurde das Dorf vergrößert. 1840 bestand es aus 92 Häusern und hatte 579 Einwohner. 1939 lebten 835 Einwohner im Ort Schneidmühl, am Ende des Krieges noch 817 Einwohner. 561 Einwohner waren es am 1. Januar 2021.“
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Sommertage und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Gemeindebetreuer
Rudi Baier



Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
Alles Gute wünschen wir zum Geburtstag zum: 101. Geburtstag am 18. August Adelgunde Kundrat/ Faber, 85354 Freising.
Da ich mich, wie Sie alle wissen, unserer Mundart verschrieben habe, will ich Ihnen heute einmal einen nicht so bekannten Dichter vorstellen: Johann Jakob Lorenz, geboren am 28. Oktober 1807 in einem kleinen Anwesen in Eger am Anger. Er war gerne in der
Heimat unterwegs. Somit lernte er seine Heimat genau kennen, die Sprache des Volkes, seine Sitten und Gebräuche. Das alles erweckte sein poetisches Empfinden. In diesen Jahren entstanden des Dichters schönste Dialektdichtungen.
Die derbe, resolute Bäuerin führt uns das Gedicht ,,‘s Bauanwei am Mark“ vor Augen. Die Bäuerin, die auf dem Markt ihre Waren verkaufen will, ereifert sich über die Städterinnen, welche an allem etwas auszusetzen haben, dabei ungeniert alle Waren betasten und von allem kosten wollen:
„‘s Bauanwei am Mark“ „Bål råppt ma döi in‘s Kraut –zussat ümm dråa u käut! Wal ich ia’s niat grod ümmasünst gebm kåa, wiad’s fålsch u schreit:
Ös schnäuzt’s enk in d’Händ u gäitts åffa’s Kraut damit häa, r ös Säu! Sie schnäuzt si owa grod asua, mi håißt s‘ denna a dreckats Bauanwei.
An Geest strupfm s‘ ma van Schmettn oia, d’Butta zwackn s‘ åa mid Fingan, kulschwåaz, als wenns Mist glodn häidn u ålrid A’n ånara; an Quark fressn s‘ ma brockn-weis weg, dös is grod as. Såggt ma wos, håißt’s: ,Dau wiads zougäih ümm ara Bröckl Kas!‘“
Im Gedicht klagt sie über die Kaufleute in der Stadt, die hohe Preise fordern, als ob die Bauern das Geld haufenweise zu Hause hätten. Sie geht gar nicht gerne in die Stadt. Anders sei es bei den Männern. Die benutzen jede Gelegenheit, um in das Gasthaus zu kommen, wo sie saufen und raufen.
Die Frau schildert nun im weiteren drastisch, wie es dabei zugeht. Die Städter seien allerdings kaum besser, obwohl sie sich über die Bauern lustig machten. Die Bauern prahlen gerne mit ihrem Besitz und geraten sich meist dadurch in die Haare:
„,Ich‘ bäigt dar-r-Åi, ,ich ho du‘ an gräißt’n Huaf unta Enks dreian‘
,Owa ich ho’s måißt Göld unta r Enk ålln!‘
,Ih‘, schreit a Ånara, ,ih ho du an gräißtn Ocks’n unta r Enk.‘ ,U ih ho d‘ schwast Sau alåi.‘“
Das war eine kleine Kostprobe von Dr. Johann Jakob Lorenz, welcher bereits am 1. Dezember 1860 im Alter von nur 53 Jahren verstarb.
Ich freue mich schon darauf, Sie alle im September wieder gesund und munter hier begrüßen zu dürfen.
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
�
In dieser Folge der Reihe „Verdiente Karlsbader“ erzählt Rudi Baier über das Leben und Wirken von Robert Kampe, früherer Direktor des Quellenamtes im Weltkurort Karlsbad:
Robert Kampe, Direktor des Quellenamtes im Weltkurort Karlsbad, wurde am 12. Januar 1884 in Böhmisch Leipa geboren. Sein Vater Isidor Kampe war Oberrealschulprofessor. Seine Mutter Maria Rosalia, geborene Tschäpper, war die Tochter eines k.k.-Landgerichtsrates.
Nach dem Abitur im Jahr 1901 studierte er an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag und erwarb 1908 das Diplom als Bauingenieur.
In den Jahren 1903/1904 leistete er den militärischen Pflichtdienst ab. Von 1906 bis 1908 war er Assistent am Lehrstuhl für Mechanik. Am 1. September 1908 trat er als Quelleningenieur in die Dienste der Stadt Karlsbad. Die Karlsbader Quellen befanden sich seit der Jahrhundertwende in einem Zustand des Rückgangs der Schüttung. Bei seinen Untersuchungen richtete Kampe sein Augenmerk in erster Linie auf den Gehalt der Quellen an freiem blasenförmigem Kohlensäuregas. Er kam dabei zur Überzeugung, daß die Karlsbader Quellen nicht durch ihnen aus der Grube zufließendes Wasser beeinflußt wurden, sondern durch das Abströmen von Gas infolge der Druckentlastung durch ei-
nen Wassereinbruch (1901) und das Sümpfen im Bergwerk. Er ließ den Untergrund abdichten und beseitigte die Mängel.
Im Jahr 1911 wurde er zum Direktor des neu geschaffenen Quellenamtes in Karlsbad. 1914 promovierte er an der Deutschen TH in Prag zum Dr. techn. mit der Dissertation „Über den natürlichen Mechanismus des Karlsbader Sprudels“ und habilitierte sich 1922 als Privatdozent für Grundwasser- und Quellenkunde.
Im Ersten Weltkrieg stand er als Reserveoffizier an der Ostfront. 1920 bis 1927 war er Gastdozent des jährlich abgehaltenen Karlsbader Internationalen ärztlichen Fortbildungskurses für Balneologie und Balneotherapie. Er regte den Bau des Gasbades in Karlsbad an, welches 1927 eröffnet wurde. 1930 wurde Kampe zum außerordentlichen Professor ernannt. In Karlsbad widmete er sich der weiteren Erforschung der Heilquellen, ihrer Sanierung durch neuzeitliche Fassungen, Neubohrungen zur Wasser- und Kohlensäuregasgewinnung unter Anwendung der von ihm entdeckten neuen Gesetze.
1937 übernahm Kampe das Quellenamt der Preußischen Staatsbäder in Bad Ems, welches nach dem Zweiten Weltkrieg zum Staatlichen Quellenamt des Landes Rheinland-Pfalz wurde. Zugleich aber nahm es weiterhin die Aufgaben der Betreuung der Mineralbrunnen und
Heilquellen der ehemals preußischen Staatsbäder der Länder Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wahr. Im Jahr 1955 faßte Kampe in Bad Ems eine gasführende Quelle als sechs Meter hohen Springer, den nach ihm benannten „RobertKampe-Sprudel“.
Auch im Ruhestand blieb Kampe Berater des Quellenamtes und zahlreicher Mineral- und Heilbrunnen im In- und Ausland. Kampe war der Begründer der wissenschaftlichen Mineralquellentechnik und galt auf seinem Arbeitsgebiet auch international als führender Experte.
Aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen erhielt Kampe zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Er war Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Prag (1924), erhielt 1944 den einzigen Kolbenheyer-Kulturpreis der Stadt Karlsbad und wurde 1959 Ehrenbürger der Universität Gießen. Am 11. März 1966 verstarb Kampe in Bad Ems.
Von Rudi Baierund drei Fachlehrer.
sammlung des „Bundes der Deutschen in Böhmen“ wird hier abgehalten. Der Festzug am Sonntag, den 26. August, verläuft großartig. Die Stadt ist festlich geschmückt.
n 26. August 1923: General Pellé, gewesener Generalissimus der damaligen tschechoslowakischen Armee, ist zur Kur hier eingetroffen. Später beschwert er sich und hetzt in der „Stardin Listy“ gegen den deutschen Charakter der Kurstadt.
n 28. August 1923: Seit dem Jahr 1919 gibt es in Karlsbad um 3000 Wähler mehr.
Eine tschechische Bürgerschule für Karlsbad wird errichtet und in dem neuen Schulgebäude in Fischern untergebracht. Die Schule hat einen Direktor
�
Der Heimatverband und die jeweiligen Ortsbetreuer wünschen auch allen Jubilaren aus den zuvor nicht aufgeführten Gemeinden, besonders aber den nun namentlich genannten treuen Abonnenten der Karlsbader Zeitung alles Gute zu ihrem Geburtstag, ein erfülltes und gesundes neues Lebensjahr!
Dallwitz
03. August: Isolde Schmidt, 95447 Bayreuth, 98. Geburtstag.
21. August: Gertrud Rauch/ Rau, 87439 Kempten, 88. Geburtstag. Ellm
13. August: Siglinde Simson/ Müller, 89176 Augsburg, 84. Geburtstag.
Engelhaus
03. August: Manfred Hubl, 94315 Straubing, 83. Geburtstag. Gfell
18. August: Herbert Kraus (Hausnummer 40), 68647 Biblis, 81. Geburtstag.
27. August: Dr. Rudolf Leger, 63607 Wächtersbach, 75. Geburtstag.
Hartmannsgrün
06. August: Herbert Wirth, 60437 Frankfurt, 93. Geburtstag.
18. August: Gerlinde Tischner/Götz, 85095 Denkendorf, 84. Geburtstag.
Lichtenstadt
16. August: Erika Weber/ Zulegen, 90614 Ammerndorf, 77. Geburtstag.
17. August: Renate Berger/ Schreiber, 90587 Veitsbronn, 86. Geburtstag.
24. August: Marianne Bauer, 83417 Kirchanschöring, 82. Geburtstag.
Meierhöfen
19. August: Erika Roith/ Schimmer, 78078 Mönchweiler, 84. Geburtstag.
23. August: Brigitte Jürgens/ Köhler, 41464 Neuss, 76. Geburtstag.
Pirkenhammer
24. August: Karin Herb/Ullmann, 87600 Kaufbeuren, 85. Geburtstag.
Putschirn
04. August: Rainer Arlt, 91074 Herzogenaurach, 79. Geburtstag.
11. August: Sieglinde Schindler/Lohwasser, 92681 Erbendorf, 94. Geburtstag.
27. August: Brunhilde Arlt/ Hegen, 91074 Herzogenaurach, 80. Geburtstag.
31. August: Rudolf Eisenkolb, 83209 Prien/Chiemsee, 85. Geburtstag.
Rittersgrün
31. August: Manfred Grimm, 82291 Mammendorf, 83. Geburtstag.
Ruppelsgrün
09. August: Irene Thiriat/Limlei, 88214 Ravensburg, 82. Geburtstag.
Sachsengrün–Ranzengrün–Oberlomitz
17. August: Poldi Enterrottacher/Grund (Oberlomitz, beim Merkl), 94. Geburtstag.
17. August: Konrad Pecher (Sachsengrün Hausnummer 16), 90587 Kleinwelsbach, 85. Geburtstag.
18. August: Fritz Klier (Ranzengrün Hausnummer 24, beim Tächl), 87740 Bad Griesbach, 97. Geburtstag.
Schobrowitz
24. August: Eveline Jordan/ Wirth, 91522 Ansbach, 82. Geburtstag.
Welchau
06. August: Karl Felber (W39), 16303 Schwedt, 91. Geburtstag.
25. August: Erika Nagengast-Bernt, 91336 Heroldsbach, 91. Geburtstag.
30. August: Gertraud Schneider, 82. Geburtstag.
Zettlitz
08. August: Liesl Hauschka/ Blechschmitt, 35394 Giessen, 95. Geburtstag.
Ohne Ortsangabe
02. August: Walter Schöniger, 91126 Schwabach, 80. Geburtstag.
12. August: Andrea Windisch, 83043 Bad Aibling, 47. Geburtstag.
17. August: Rudolf Kühnl, 85635 Höhenkirchen, 94. Geburtstag.
28. August: Manfred Hüber, 35634 Leun/Lahn, 85. Geburtstag.
Der Gemeindebetreuer Peter Böhme meldet für Aich zwei Todesfälle:
Wie er durch deren Sohn kürzlich erfahren hat, ist Edith Schmidt, geborene Schimmer, welcher noch zu ihrem 95. Geburtstag am 24. Juni gratuliert wurde, bereits am 30. September 2022 verstorben.
Außerdem starb vor wenigen Wochen, am 25. Juni 2023, Emma Mestrovic, geborene Unger, in ihrem 96. Lebensjahr.
Allen Verwandten und Angehörigen der beiden gilt unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme.
n 29. August 1923: Bei der Markthalle werden Notstandsarbeiten durchgeführt: Beräumung, Planierung und anderes.
Notar Josef Hüttisch begeht seinen 70. Geburtstag.
n 30. August 1923: Umrechnung: Eine Million Mark = 2,95 Kronen.
n 31. August 1923: Symphoniekonzert im Posthof unter Mitwirkung des Professors Willy Schweyda vom Prager Konservatorium, gewesener Konzertmeister der Kurkapelle.

Im August bewilligt die Stadtvertretung die Aufschließung des oberhalb der Panoramastraße gelegenen städtischen Grundes als Baugrund zwecks Verbauung desselben durch die Baugenos-
senschaft „Eigenheim“ für Kleinwohnhäuser.
Für die Erbauung eines Verkaufsstandes bei der Egerbrücke wird dem Sattlermeister Anton Egerer eine 80 Quadratmeter große Baufläche auf 15 Jahre zu einem jährlichen Anerkennungszins von 800 Kronen überlassen. Von den 31 städtischen Sicherheitswachleuten, welche bei der Verstaatlichung nicht vom Staat übernommen wurden, werden einige in den Ruhestand übernommen, weil sie eine mehr als 40jährige anrechenbare Dienstzeit hinter sich haben. Weitere werden in den Ruhestand übernommen, obwohl sie die nötigen anrechenbaren Dienstjahre noch nicht haben, aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses.
Liebe Heimatfreunde, liebe Leser der Karlsbader Zeitung! Hoffentlich geht es Ihnen soweit gut bei dem wechselhaften Sommerwetter, einmal enorme Hitze und Schwüle, ein anderes Mal wieder Gewitter mit Starkregen und fallenden Temperaturen. So wollen wir Sie mit unseren Beiträgen erfreuen und begeistern.
Sommer 2023 in Karlsbad: Wiedereröffnung Kaiserbad Karlsbad am 17. Juni 2023 mit einem Galakonzert des Karlsbader Symphonieorchesters mit dem jungen Violinisten Daniel Matejča aus Prag. Zur Aufführung kam unter anderem Antonín Dvořáks „Neue Welt“. Am 18. Juni 2023 war für alle Besucher die Eröffnung des weltberühmten Kaiserbades, erbaut 1895 von dem Architekten-Duo Ferdinand Fellner und Hermann Heller.
Nach einer umfangreichen Rekonstruktion, welche zweieinhalb Jahre dauerte und viel Geld kostete, konnten die Besucher die Kaisertherme wieder von Innen bewundern. Nach und nach bekommt das Gebäude ein Informationszentrum, eine Ausstellung über Balneologie, ein Café sowie eine Räumlichkeit für das Karlsbader Symphonieorchester. Mit Recht erhoffen sich die Stadt Karlsbad und ihre Region mehr Besucher aus Nah und Fern, die das prächtige Gebäude sowie die kulturellen Ereignisse erleben wollen. Das erneuerte Kaiserbad soll eine Verbindungsbrücke zwischen Vergangenheit und Zukunft werden.
Ein weiterer Höhepunkt in der schönen Stadt Karlsbad in diesem Sommer war vom 28. Juni bis zum 06. Juli das „Internationale Filmfestival Karlovy Vary“.

Aber es gibt auch einen negativen Bericht über Karlsbad: Radio Prag vom 15. Juni 2023 „Der beste Ort zum Leben in Tschechien“ sei erstens Prag, zweitens Königgrätz, drittens BöhmischMährische Höhe (Vysočina) und auf dem letzten Platz der Kreis Karlsbad. Die Auswertung betrifft: Gesundheits- und Sozialversorgung, attraktivste Hochschulen, beste Abiturergebnisse in tschechisch und Mathematik; auch die Durchschnittslöhne in den anderen Regionen sind höher.
Karlsbader Museum und Archiv in Wiesbaden, Oranienstraße 3: Jeden ersten Samstag im Monat von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr sind wir für Sie da;
auch in den Sommermonaten erwartet Sie von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr das Ehepaar Dr. Horst und Christa Engel. Die nächsten Termine sind: 05. August und 02. September.
Haben Sie besondere Anliegen, dann rufen Sie bei Dr. Engel an: Telefon (06 41) 4 24 22. Zu erreichen sind wir ab Wiesbaden Hauptbahnhof mit der Buslinie 16 bis zur Haltestelle Landesbibliothek.
Mitgliedschaft im Heimatverband der Karlsbader e.V.:
Neu hinzugekommen sind Gisela Forster aus Pfaffenhofen an der Ilm und Dr. jur. Harald von Herget in Starnberg, die wir herzlich in unseren Reihen begrüßen.
Bitte werden auch Sie Mitglied in unserer Gemeinschaft, ein Anmeldeformular sende ich Ihnen gerne zu. Rufen Sie mich an: Susanne Pollak, Telefon (0 81 42)
1 23 03.
Bund der Deutschen – Landschaft Egerland – Ortsgruppe Karlsbad: August ist noch Ferienzeit, und wir wünschen Ihnen weiterhin gute Erholung ohne Streß. Am 07. September 2023 herzliche Einladung zur Vorstandsversammlung mit Kaffeeklatsch an alle Freunde, um 15.00 Uhr im Egerländer Hof in Karlsbad.
Vorschau auf den Oktober:
–05. Oktober um 15.00 Uhr im Egerländer Hof;
–26. Oktober (Donnerstag) um 15.00 Uhr Kranzniederlegung am Friedhof Karlsbad zu Allerheiligen.
Herzliche Gratulation zum
Geburtstag! Wir wünschen viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr zum:
–88. Geburtstag am 01. Juli Ingeborg Suchankova; –87. am 02. Klaus Schleicher; –74. am 10. Eva Papankova; –79. am 19. Jana Dockalova; –85. am 28. August Manfred Hüber; –84. am 30. Rosl Schleicher; –76. am 30. Bruno Fischer; –84. am 27. September Marie Hradkova. Alles Gute auch denen, die nicht genannt sind. Unsere Bücherecke: n Einwohnerverzeichnis der Kurstadt Karlsbad, der Stadt Fischern und der Marktgemeinde Drahowitz. Es handelt sich um die 324 Seiten des äußerst seltenen Adreßbuches von 1938/1939 mit dem Redaktionsstand von 1937. Preis: 29,00 Euro. n Karlsbader Historische Schriften Band 2. Eine kenntnisreiche Betrachtung über Karlsbad als Kur- und Genesungsstadt. Preis: 19,80 Euro. n Karlsbader Schicksalstage 1939 bis 1946. Von Professor Dr. Rudolf Schönbach. Preis: 4,50 Euro. n Zwischen Grenzen und Zeiten. Egerländer Landsleute erzählen, zusammengestellt von Hans Bohn. Preis: 6,00 Euro. Alle Preise inklusive Porto und Verpackung.
Bestellungen bei Susanne Pollak, Estinger Straße 15, 82140 Olching, email heimatverband@ carlsbad.de Herzliche Grüße und eine gute Zeit wünsche ich Ihnen! Ihre Susanne Pollak