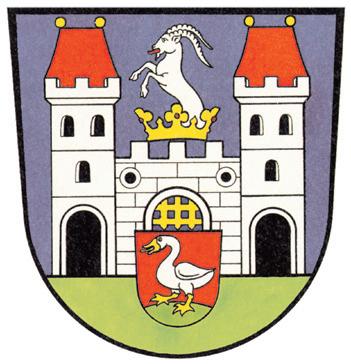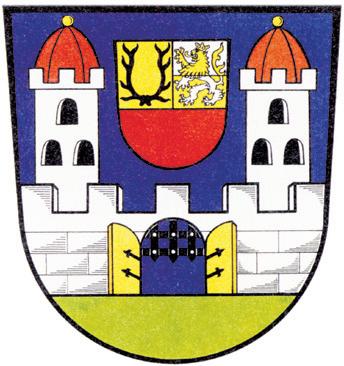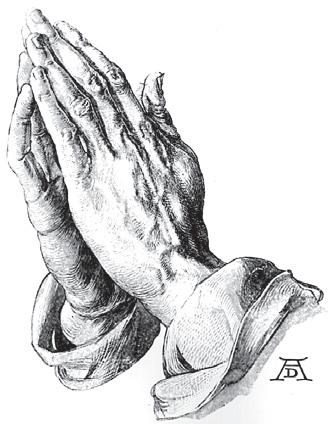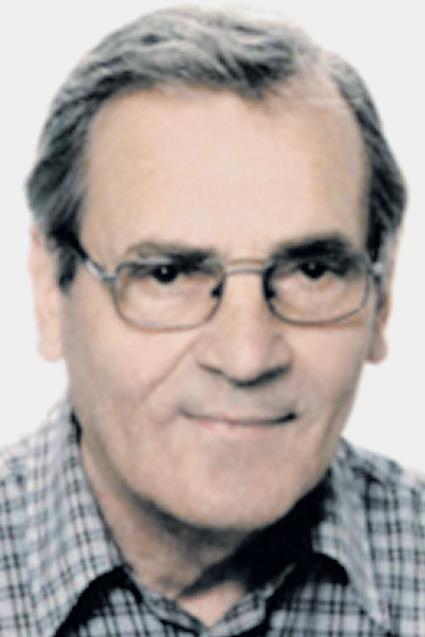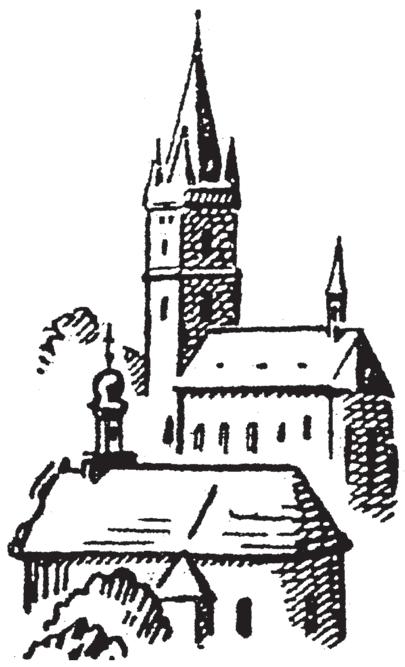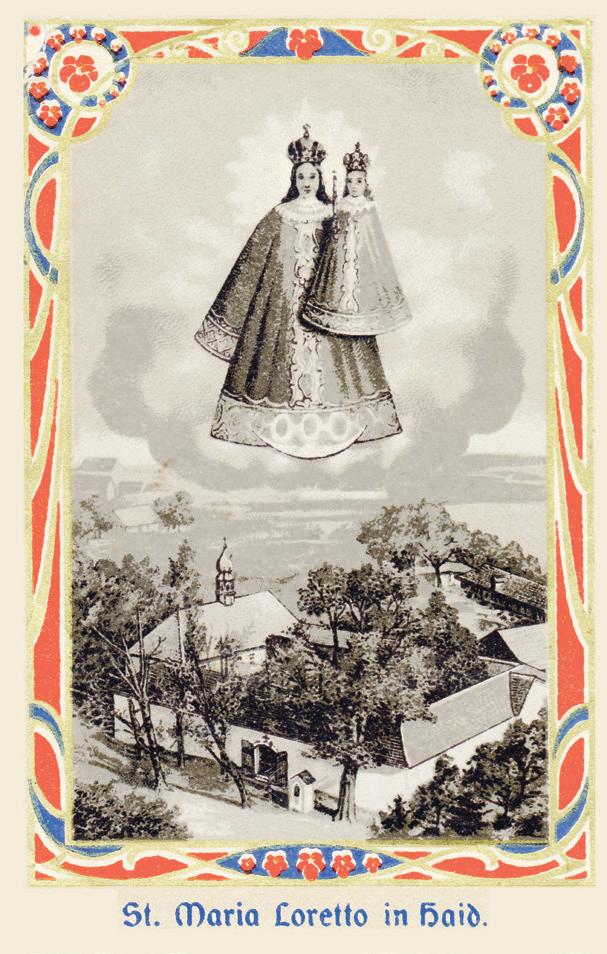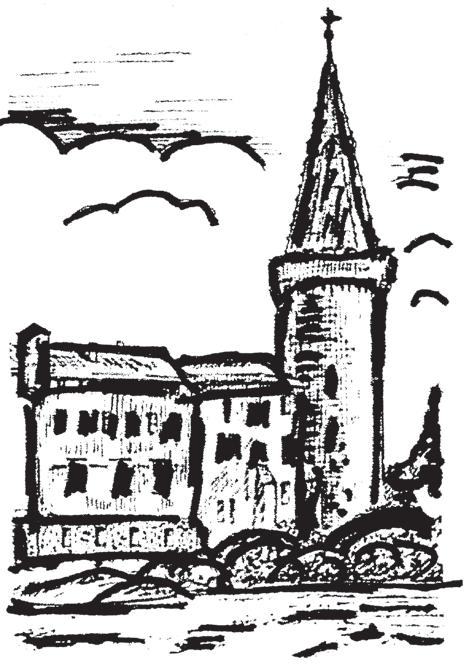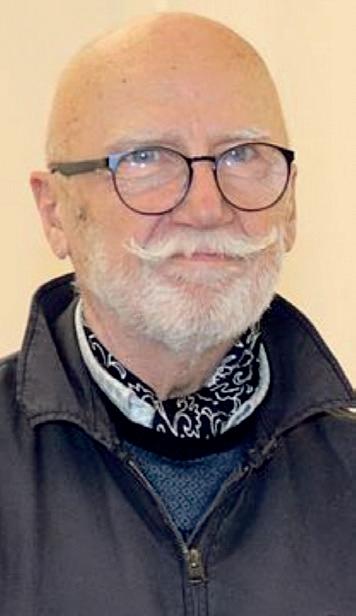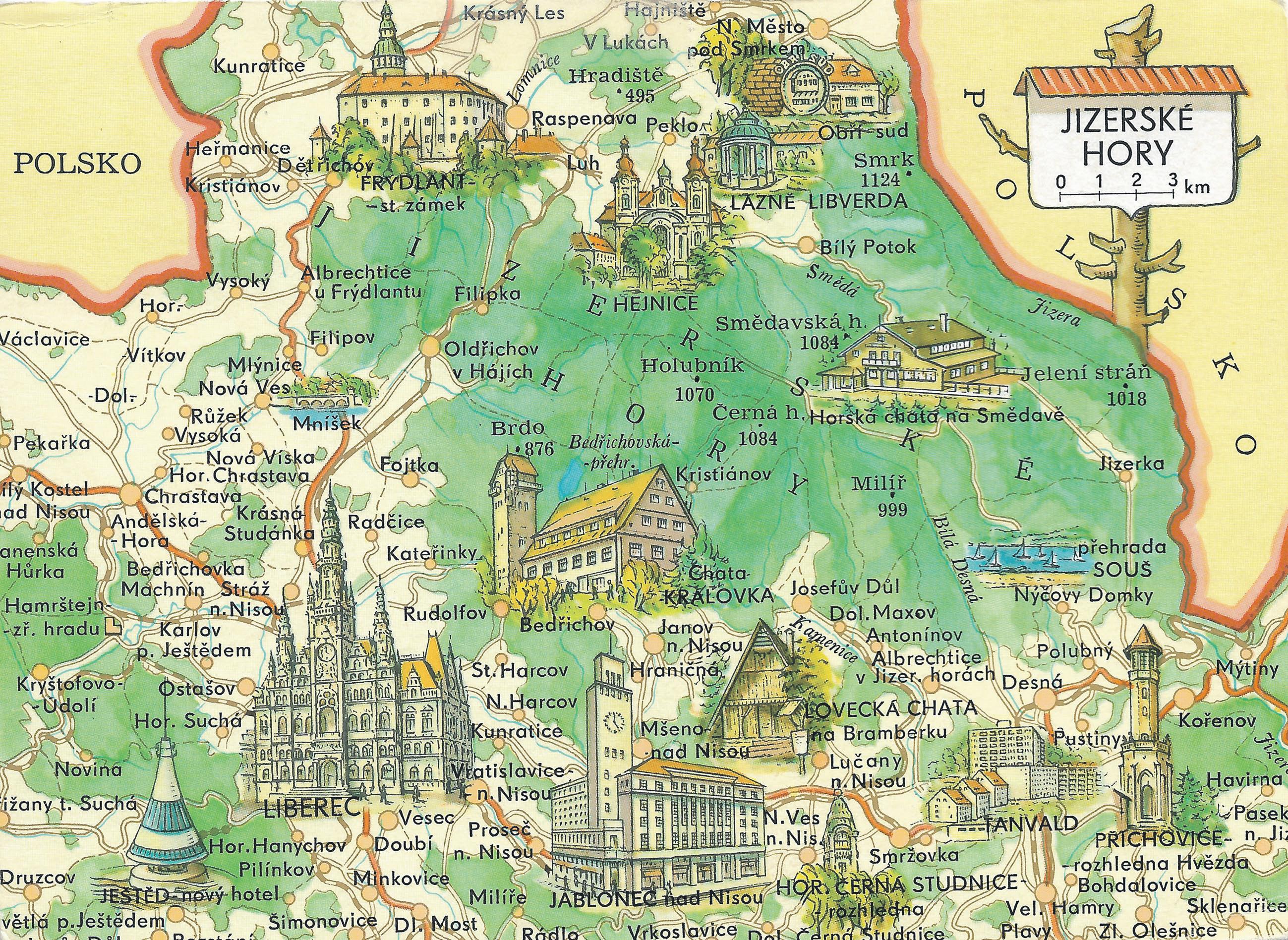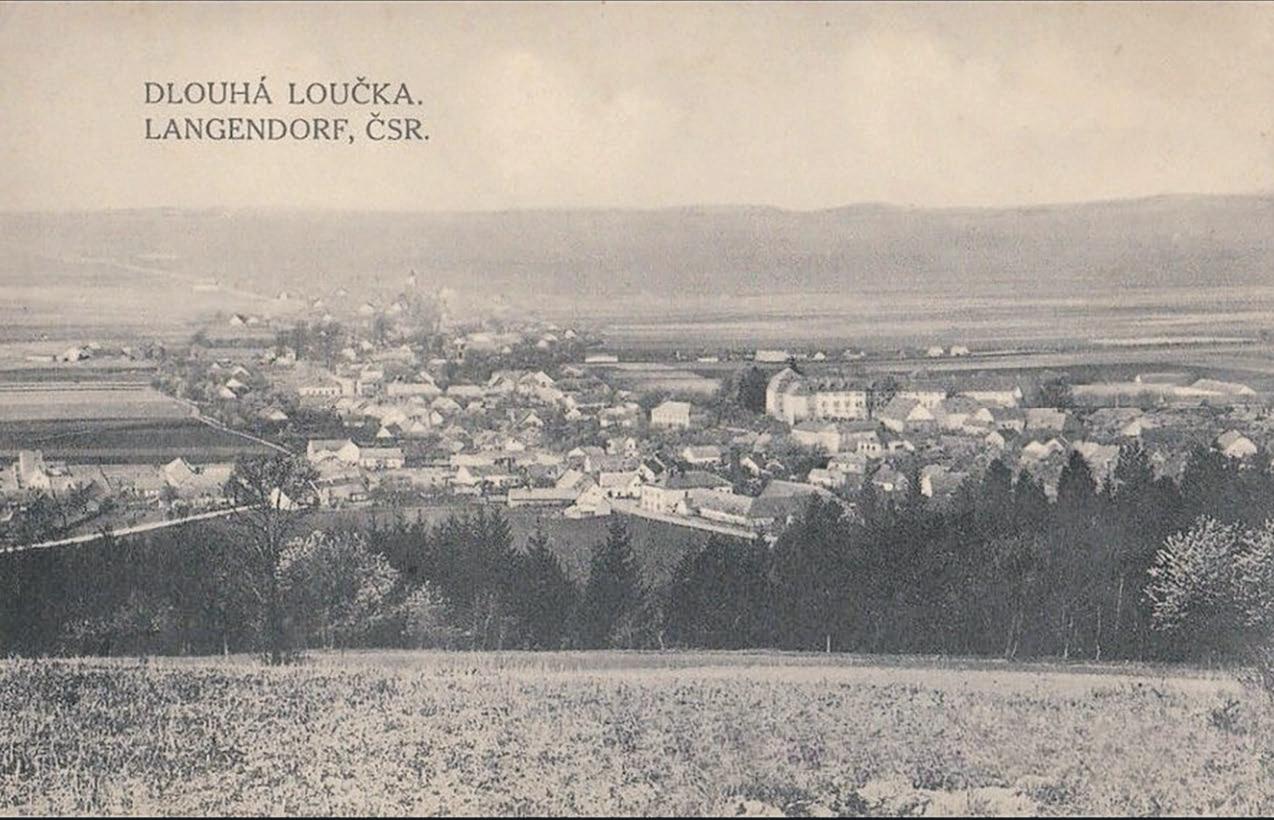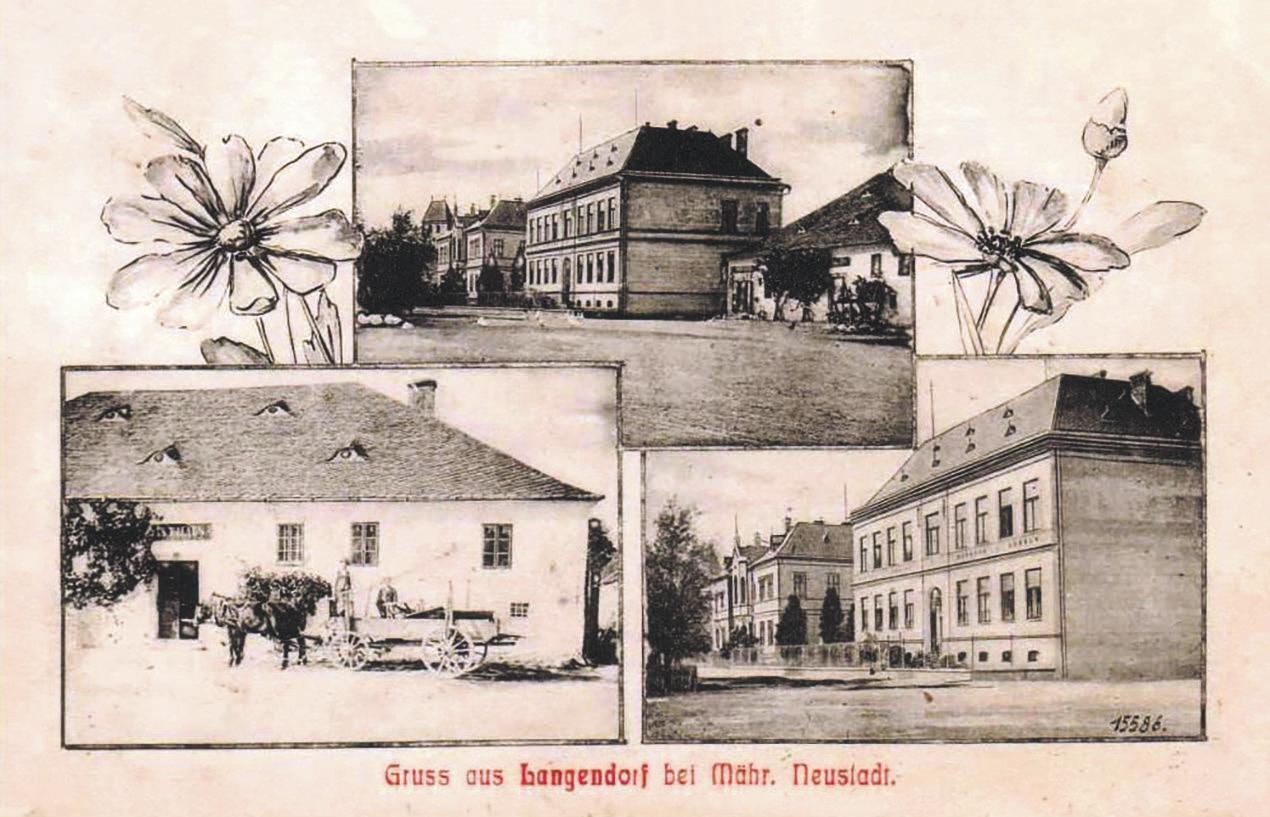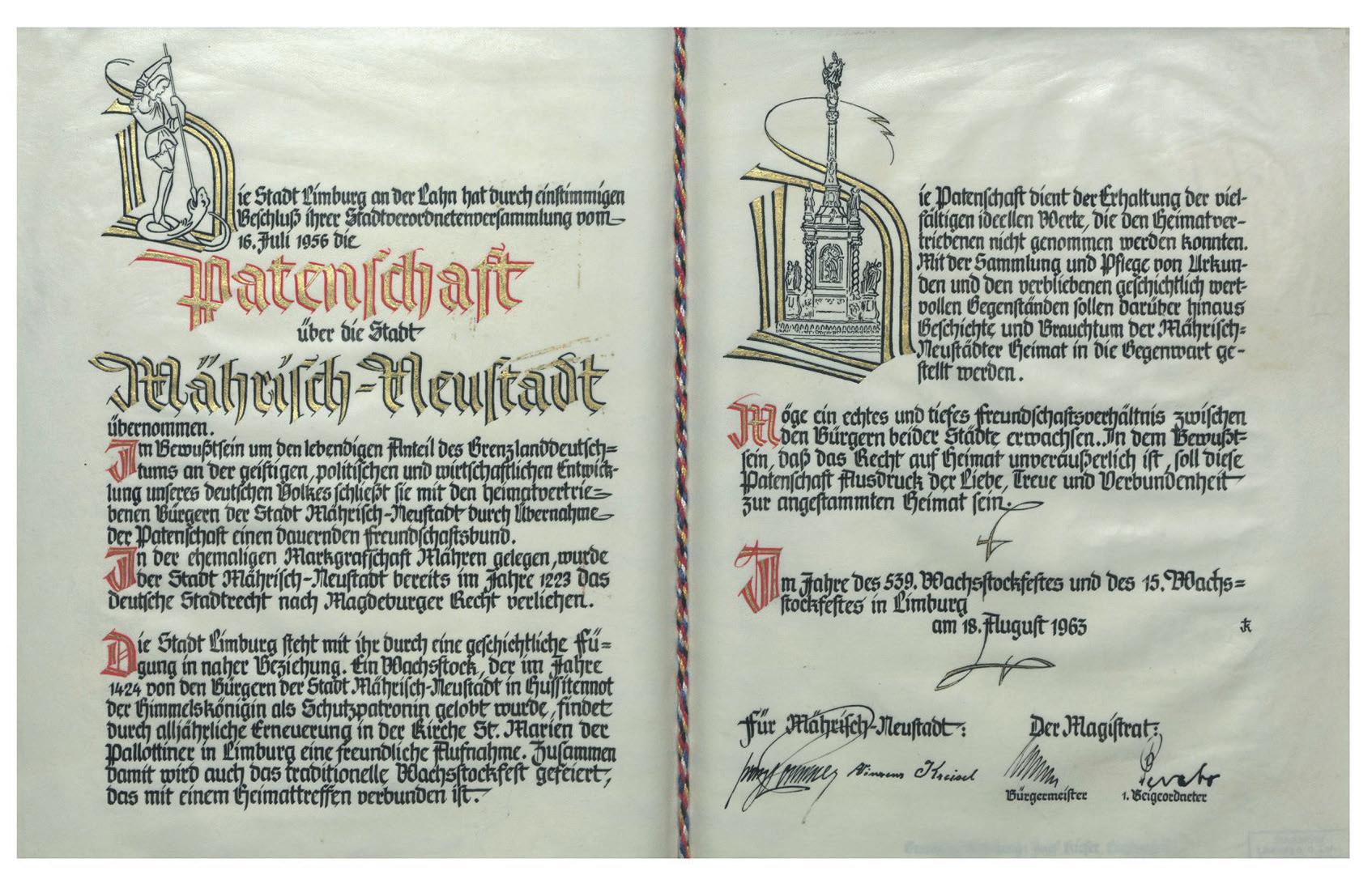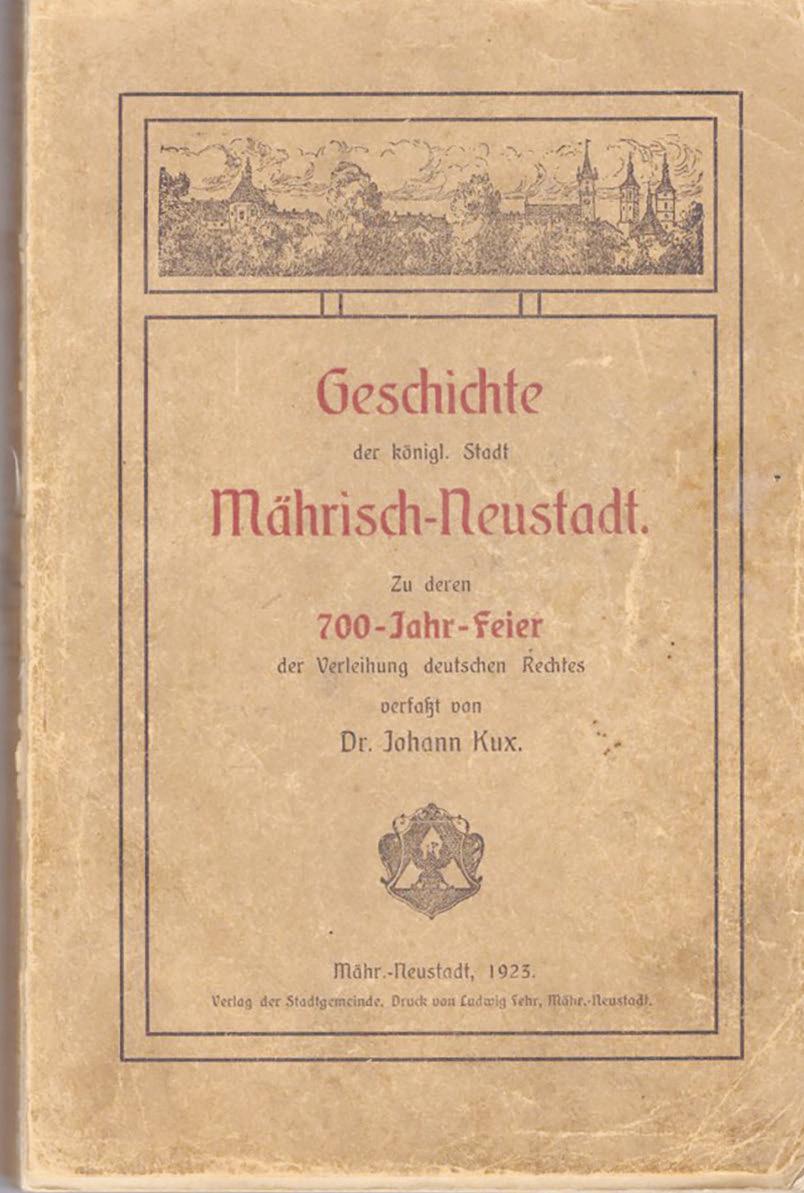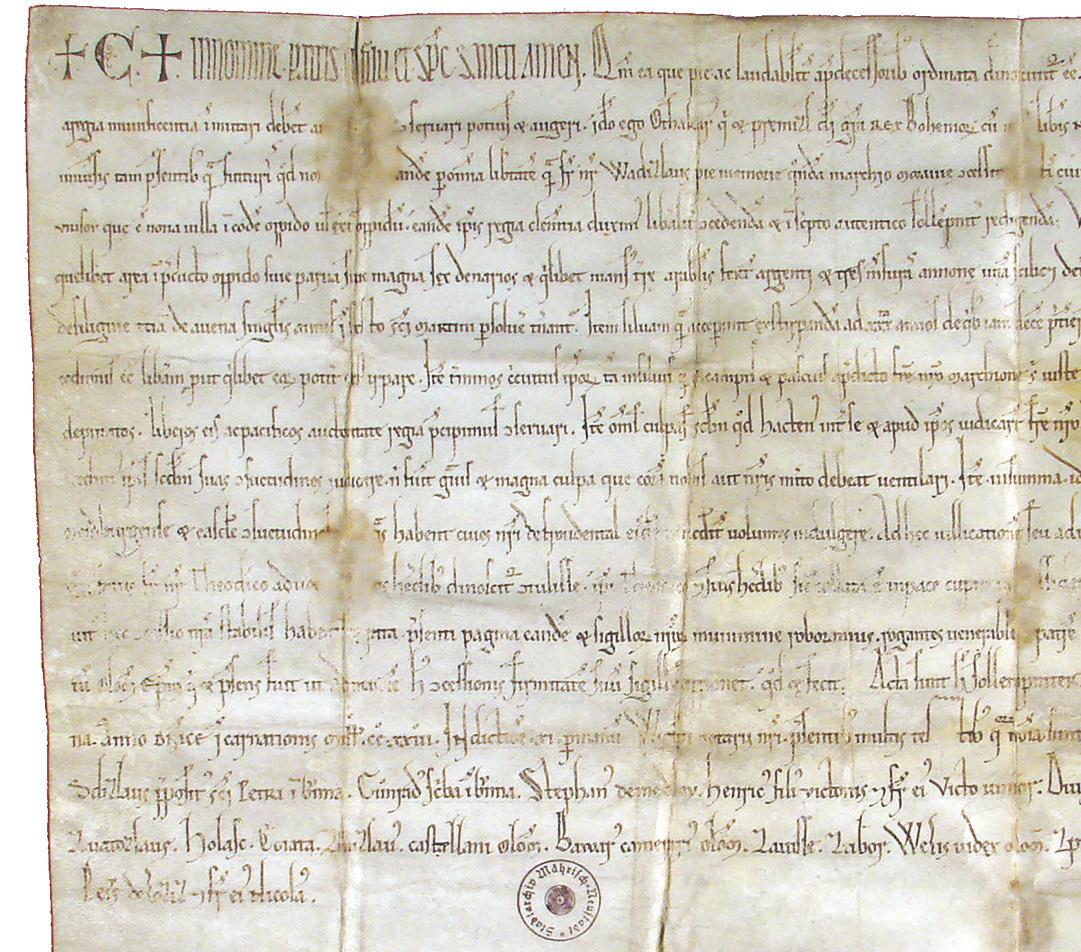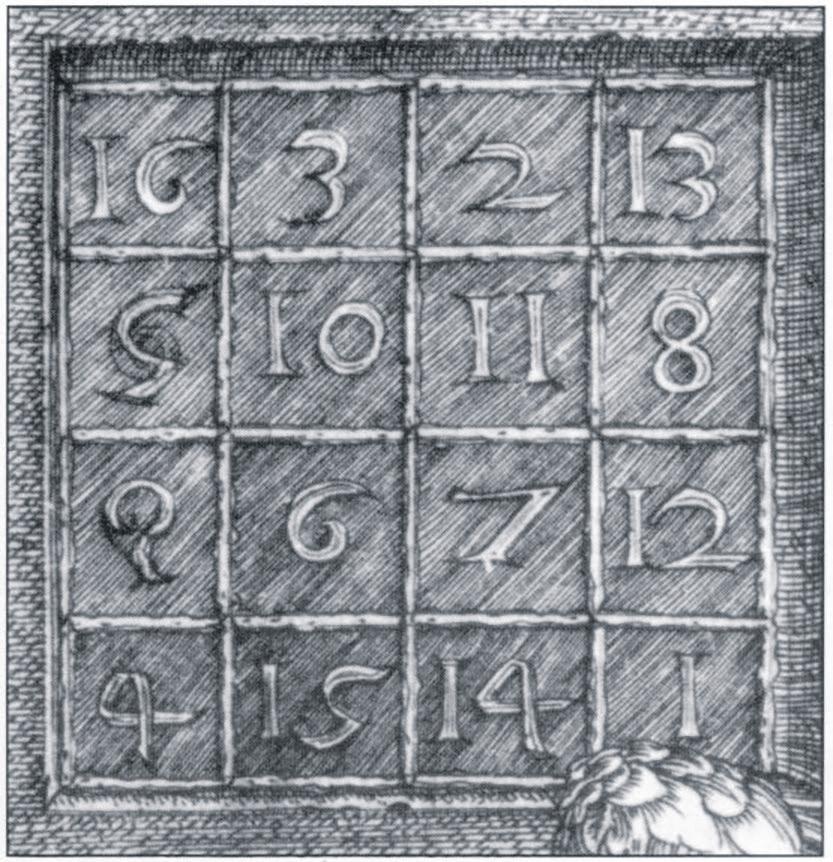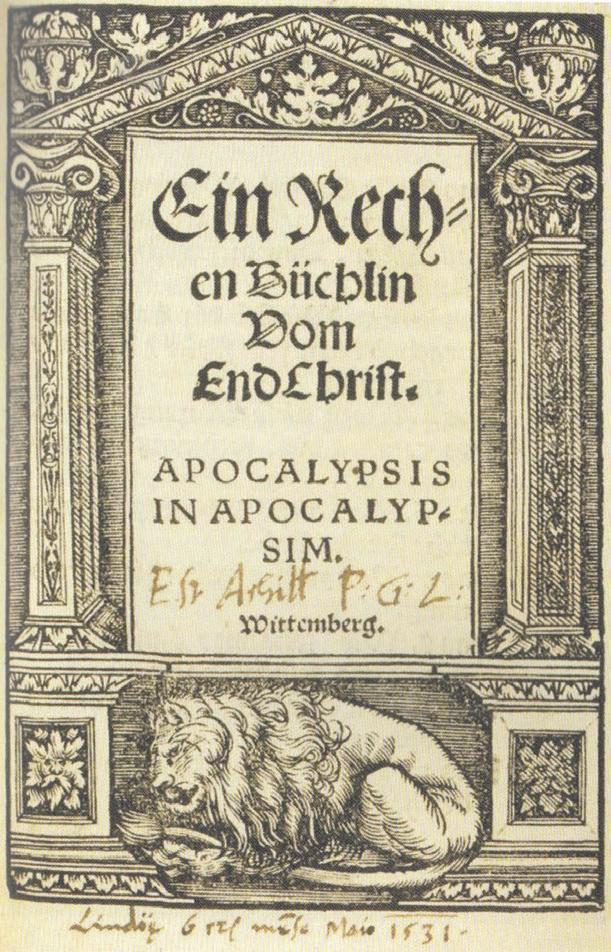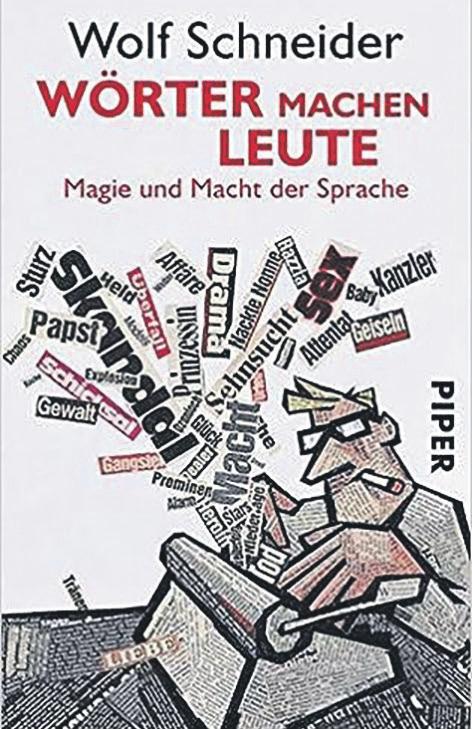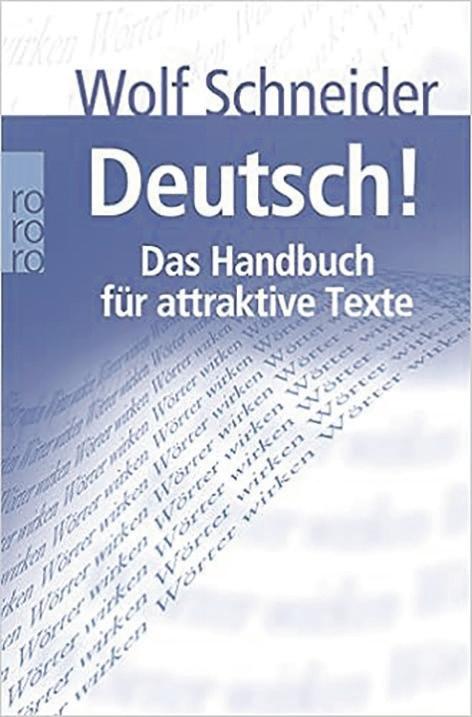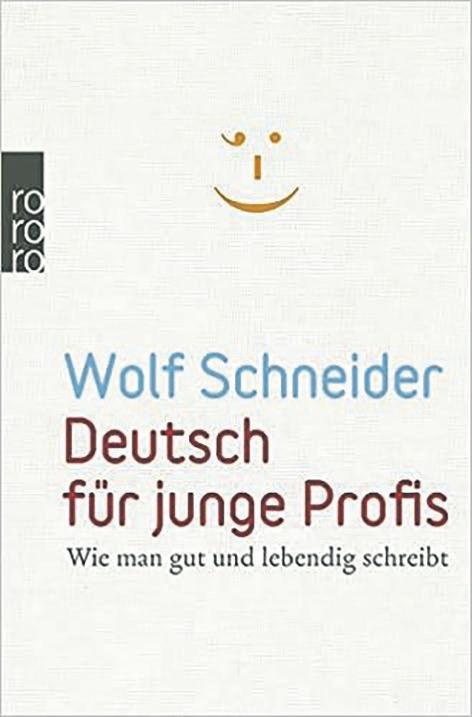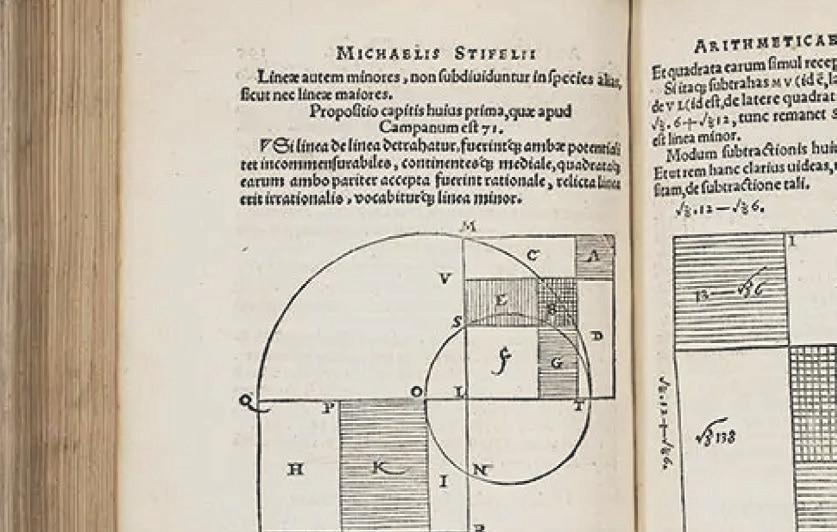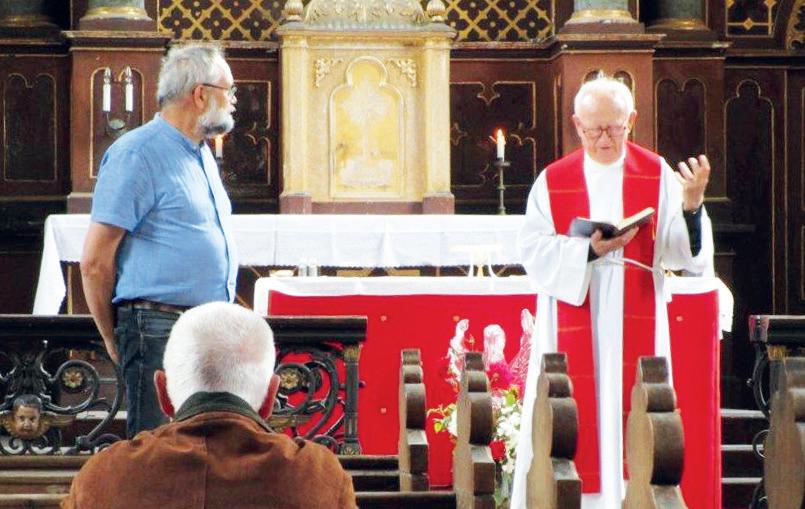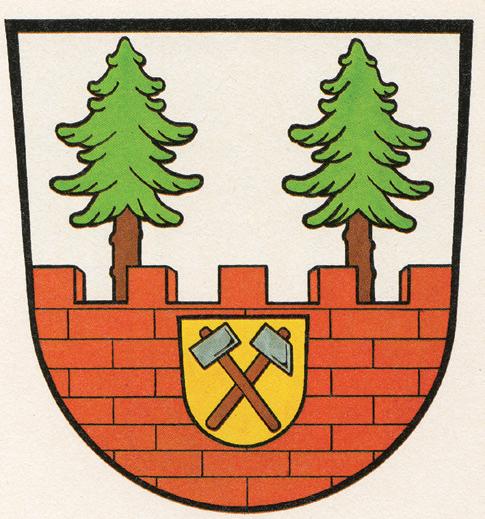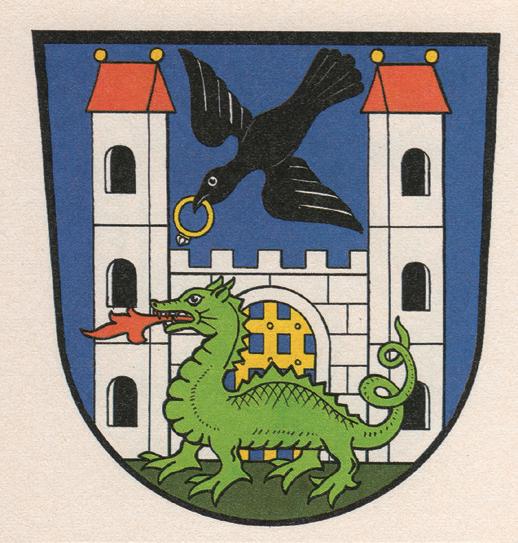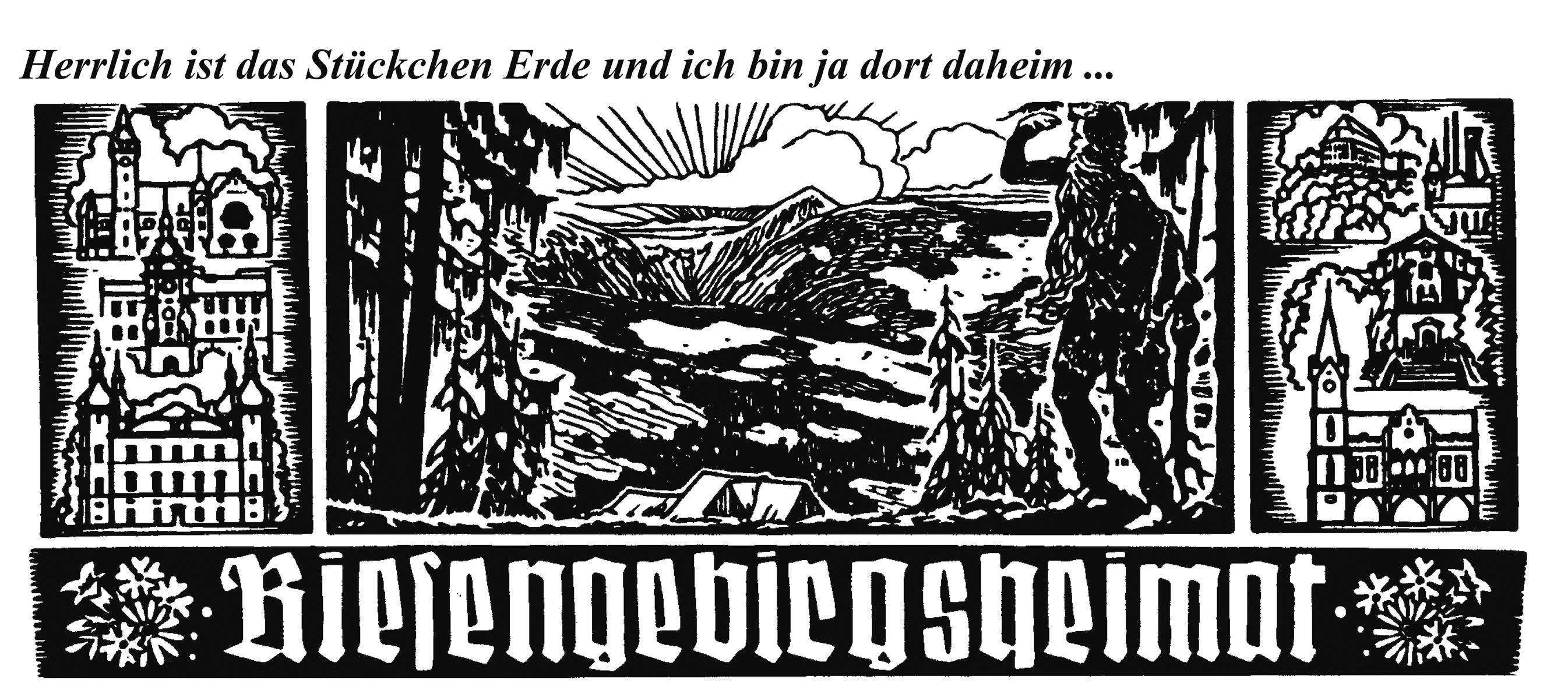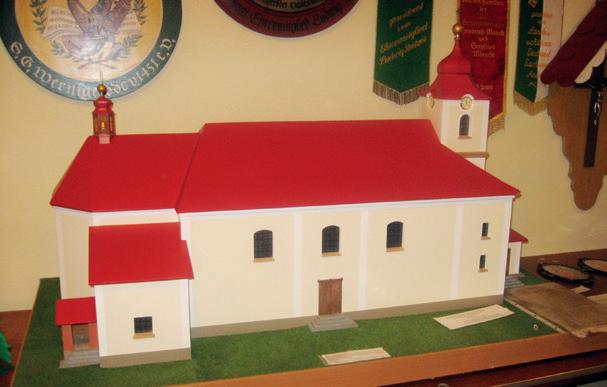Sudetendeutsche Zeitung
Reicenberger Zeitung
75 | Folge 33 + 34 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 25. August 2023
❯ Tschechische Staatsspitze gedenkt der Niederschlagung des Prager Frühlings vor 55 Jahren durch Truppen des Warschauer Paktes
Sudetendeutsche Zeitung
Neudeker Heimatbrief
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Sudetendeutschen Landsmannschaft Zeitung
Reicenberger Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung
Zeitung






Neudeker Heimatbrief
Neudeker Heimatbrief
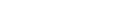
VOLKSBOTE HEIMATBOTE


gernden, angetretenden Landsern hochwertige Lebensmittel verbrannt. Andere Heimkehrer von dem Amis erzählten, sie hätten Tabak kaufen müssen, denn nur so hätten sie auch Zigaretten bekommen, den Tobak warf man weg.
zur Lagerbesichtigung. Als er mich auf einem Bündel Stroh mit durchnässtem Verband so liegen sah, stieß er mich mit seiner Stiefelspitze
❯ Robert Fremr Umstrittener Richter zieht
Konsequenzen
Weil er als Richter unter den kommunistischen Machthabern in den 1980er Jahren 170 Urteile gegen Republikflüchtlinge gefällt hatte, ebbte die Kritik an der Nominierung von Robert Fremr zum Verfassungsrichter nicht ab. Am Montag zog Fremr die Konsequenzen.
Das Mißtrauen, das ihn begleitet, würde die Glaubwürdigkeit des gesamten Verfassungsgerichts beeinträchtigen, begründete Fremr, warum er nicht mehr als Verfassungsrichter zur Verfügung stehe. Fremr:
„Das will ich keinesfalls, weil ich selbst das Verfassungsgericht für unser glaubwürdigstes staatliches Organ sowie einen wichtigen Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in diesem Land halte.“
Gleichzeitig bestritt er, ein regimetreuer Richter gewesen zu sein, und betonte, daß er seinen Rückzug keineswegs als Geständnis betrachte: „Bis 1989 gibt es etwa eintausend Urteile von mir, die im Kontext der 1980er Jahre stehen. Ich respektiere voll und ganz, daß einige dieser Entscheidungen aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vollständig erklärt werden können.“
Nach dem Auftauchen der Informationen über Fremrs Tätigkeit zu kommunistischen Zeiten hatte Staatspräsident Petr Pavel dessen Ernennung zum Verfassungsrichter verschoben, obwohl diese bereits vom Senat gebilligt worden war.
Präsident Pavel: „Rußland zeigt, daß es sich seit 1968 nicht verändert
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch die Niederschlagung des Prager Frühlings vor 55 Jahren wieder ins Bewußtsein der tschechischen Öffentlichkeit gerückt. Bei der zentralen Gedenkfeier am 21. August vor dem Haus des Tschechischen Rundfunks war die gesamte Staatsspitze vertreten.


Daß sowohl Staatspräsident Petr Pavel als auch Premierminister Petr Fiala ans Rednerpult traten, unterstrich die Bedeutung des Gedenktages.
Das Staatsoberhaupt erzählte, wie es die Niederschlagung des Prager Frühlings erlebt hatte: „An diesem Tag war ich fast sieben Jahre alt. Meine Oma saß am Radio und sagte, die Russen hätten uns überfallen. Das hat mich verwirrt. Ich verstand nicht,
geht am 21. August 1968 ein russischer Panzer in Flammen auf.
wie wir von jemandem überfallen werden konnten, der uns schon einmal befreit hatte.“
Diese traumatische Erfahrung der Besatzung habe bei vielen Bürgern Demütigung und Enttäuschung ausgelöst, ein Gefühl,
das derzeit die Menschen in der Ukraine erlebten, obwohl das Land nur sein Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen wolle, sagte Pavel und stellte fest: „Rußland zeigt, daß es sich seit 1968 nicht verändert hat.“
hat“
Der Einmarsch in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 habe das Wesen des sowjetischen Denkens und der russischen Politik vollständig offenbart, ergänzte Premierminister Petr Fiala und sagte: „Leider hat es zwei lange Jahrzehnte gedauert, bis das verbrecherische Regime schließlich unter der Last seiner eigenen Fehler zusammengebrochen ist.“


Die Niederschlagung des Prager Frühlings habe alle Hoffnungen und Träume der Tschechen und Slowaken beendet, daß es möglich sein könnte, „grundlegende bürgerliche Freiheiten mit der Herrschaft einer Partei und der Vorherrschaft einer fremden Macht in Einklang zu bringen“, so Fiala.
Der Premierminister: „Freiheit gibt es entweder für alle oder für keinen. Die Geschichte hat er-
neut bestätigt, daß Demokratie, Menschenrechte und Bürgerrechte nicht tröpfchenweise rationiert werden können und daß diese Grundrechte nicht ohne Souveränität, ohne Pluralität der politischen Kräfte und ohne offene öffentliche Debatte existieren können.“
Gleichzeitig warnte Fiala mit Blick auf den Ukrainekrieg auch davor, Moskau irgendwelche Zugeständnisse zu machen, um die Kampfhandlungen zu beenden:
„Die Geschichte erinnert uns daran, wie töricht es ist, mit denen, die nicht an diese Grundsätze glauben, Kompromisse schließen zu wollen. Denn wer die Freiheit nicht in ihrer Gesamtheit respektiert, wird immer versucht sein, sie einzuschränken und zu verfälschen.“
❯ Tschechien setzt Frist bis zum 31. Dezember 2023, bevor Grundstücke oder Häuser an den Staat fallen Grundeigentümer gesucht: ARD weckt falsche Hoffnungen
Eine Meldung der Tagesschau hat für Aufsehen gesorgt –und falsche Erwartungen geweckt. Auf ihrer Webseite www. tagesschau.de hatte die ARDRedaktion berichtet, daß es in Tschechien derzeit 150 000 Grundstücke und Immobilien gebe, deren Eigentümer nicht bekannt seien. Dabei zitierte die Tagesschau das tschechische Amt für die Vertretung des Staates in Vermögensangelegenheiten (UZSVM) und wies auf eine wichtige Frist hin: Wer sich als Eigentümer oder Erbe nicht bis zum 31. Dezember 2023 meldet, dessen Grundstück oder Immobilie falle an den tschechischen Staat.
Bei uns steht seit der Meldung der Tagesschau das Telefon nicht mehr still“, berichtet Andreas Miksch, der Bundesgeschäftsführer der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Der Grund: Viele Sudetendeutsche, deren Familien im Zuge der Vertreibung enteignet wurden, sa-
hen in dem Aufruf der staatlichen Behörde die Chance, ihre Grundstücke und Immobilien zurückzubekommen. Ein Trugschluß, den die Tagesschau in ihrem Bericht nicht aufgeklärt hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der aus dem Exil zurückgekehrte Präsident der Tschechoslowakei, Edvard Beneš, 1945 eine Reihe von Dekreten erlassen, nach denen die sudetendeutschen Landsleute kollektiv entrechtet und enteignet wurden. An der daraus folgenden innertschechischen Rechtslage hat sich auch nach dem Bericht der Tagesschau nichts geändert.
In den Grundbüchern wurden damals die entsprechenden Grundstücke und Immobilien der Sudetendeutschen nur mit dem Wort „konfisziert“ gekennzeichnet. Anschließend zogen infolge der staatlich verordneten Vertreibung Tschechen in die Häuser der sudetendeutschen Landsleute ein. Dabei unterließen es die tschechischen Behörden oftmals, die neuen Eigentü-

mer auch ins Grundbuch einzutragen. Über 70 Jahre später sind jetzt viele Eigentumsverhältnisse nicht mehr nachvollziehbar. Allein in der Region Reichenberg gibt es 1478 Grundstücke und 45 Gebäude, deren Eigentümer unbekannt sind.
Insbesondere für die Kommunen sind diese vermeintlich eigentumslosen Immobilien ein Problem. „Bei Bauarbeiten wie dem Verlegen von Wasserleitungen stoßen die Behörden immer wieder auf Grundstücke mit unbekannten Besitzern. Sie brauchen die Zustimmung des Eigentümers, wenn sie weiter bauen wollen. Das blockiert die Entwicklung der Gemeinden“, erklärte Michaela Tesařová, Sprecherin des Amtes für die Vertretung des Staates in Vermögensangelegenheiten, gegenüber der Tagesschau Über ein anderes Beispiel berichtete die Tagesschau ebenfalls: In der 200-Einwohner-Gemeinde Kanitz befindet sich eine neugotische Grabkapelle, die ein
ungarischer Baron 1862 für seine verstorbene Schwester errichtet hatte. Die Gemeinde würde das halbverfallene Gebäude gerne renovieren, müßte dafür aber den rechtmäßigen Eigentümer kennen. „Im Grundbuch wird ein längst verstorbener Nachkomme des Barons als Erbe aufgeführt. Wer nach ihm einen Anspruch auf die Kapelle hatte, ist unklar. Und so bleibt die Restaurierung des neugotischen Gebäudes bisher ein frommer Wunsch der Gemeinde“, schreibt die Tagesschau in ihrem Online-Bericht.
Eine weitere große Lücke in den Grundbüchern entstand 1993 mit der Teilung der Tschechoslowakei in die Tschechische Republik und in die Slowakische Republik. Zwischen beiden Ländern wurde eine Grenze gezogen, und viele Grundstücke wurden damit geteilt. Manche der neu entstandenen Grundstücksteile können inzwischen keinem Eigentümer mehr zugeordnet werden.
„Die Mehrheit der Immobilien


mit unbekanntem Besitzer liegt deshalb im Grenzgebiet“, sagt Tesařová.
Um Ordnung in diesen Grundstücksdschungel zu schaffen, hat das tschechische Parlament bereits 2014 das Zivilgesetzbuch reformiert. Kernpunkt ist eine zehnjährige Übergangsfrist, innerhalb der Eigentümer, die Grundstücke oder Immobilien nach 1948 erworben haben, oder deren Erben ihre Ansprüche anmelden können, bevor die Immobilien an den Staat fallen. Die Frist läuft am 31. Dezember 2023 ab.
Die Liste der sogenannten unzureichend identifizierbaren Eigentümer wird vom Grundbuchamt auf seiner Website veröffentlicht. Sie enthält Daten zu mehr als 150 000 Immobilien in ganz Tschechien, von denen 147 000 Grundstücke und 3500 Gebäude sind. Der Link:
https://www.uzsvm.cz/ nedostatecne-urcite-

 Torsten Fricke
Torsten Fricke
identifikovani-vlastnici Pavel Novotny/Torsten Fricke
VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Landsmannschaft
Die Zeitung der Sudetendeutschen
Wie aus zwei Kindern der Vertreibung ein Ehepaar wurde (Seite 3) Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Jahrgang
IN DIESER ZEITUNG
HEIMATAUSGABEN
VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
VOLKSBOTE Heimatbrief
HEIMATBOTE
VOLKSBOTE
Präsident Petr Pavel bei der Kranzniederlegung vor dem Tschechischen Rundfunk.
Dieses Bild ging um die Welt: In der Prager Innenstadt
Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen) Verlagsort Nürnberg Folge 6 Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge vereinigt mit Folge 224 Jahrgang 74 Jahrgang 2022 Autobiographie von Hans Bayer, geb. 1924 in Sternberg Kapitel 7: Wieder daheim Da ich einer der Wenigen war, der sich noch auf eigenen Beinen bewegen konnte, bestimmte man mich zum Transport-Führer. Mit einem Ackerschlepper, an den man einen Wagen hing, brachte man uns auf deutsches
-
-
Premierminister Petr Fiala bei seiner Ansprache. Fotos: Zuzana Bönisch/Hrad ČZ, Vlada ČZ, CIA an und forschte „schto bolnoj“ (was hast du für eine Krankheit)? Sofort fielen mir die Worte meines Doktors ein, dessen auf den Lippen. Kurze Zeit darauf hielt ein Sanitätsauto, man lud Waldeck. Wie man vermuten kann, lag die Klinik in einer Ecke Stationsschwester. Sie war eine weißhaarige, liebevolle Pflegerin. Mittags gab es meistens Eintopf, da das Haus seine eigene Gärtnerei unterhielt.
Gebiet. Hier verlud man uns zunächst in Viehwaggons nach Sie hatten einen Reisegefährten mit offenem Waden- und Schienbeinbruch, in dessen Wunden Schmeißfliegen durch den Gips gekommen waren. Die Maden fraßen in seinem Fleisch und der Gestank war nicht zu ertragen. Der arme Kerl hielt es vor Schmerzen nicht mehr aus. stellte mich der diensthabenden Schwester als Transportführer vor. Die Schwester hieß wie ich und rief sogleich eine Ambulanz an. Wir kamen in ein kurzes Gespräch. Als sie hörte, daß ich Sudeten-senen Briefumschlag. 150 Mark waren darin! Ich wollte das Geld nicht annehmen, sie versicherte mir aber, dies sei eine Kollekte, die man ihr mit der Auflage gegeben hätte, sie einem würdigen Heimkehrer auszuhändigen. Meinen Hinweis, ob ich denn so eine Knochenarbeit von der Bundesrepublik erhalten habe. In meiner bescheidenen Meinung hätte man diesen kleinen Betrag als Versuch der Wiedergutmachung für den Verlust meines elterlichen Erbes, wie dem Verbot eine Universität zu besuchen, da ich als AngehöHier bedanke ich mich bei meinen ehemaligen SS-Kameraden, die als gute Christdemokraten in Bonn Volksvertreter spielen. Verzeihung, sie sind wohl „Exkameraden“. Die Lok war bereit, uns heim den Namen des Ortes, wo wir in ein Quarantänelager mußten. Vor der Entlausung mußte ich aufpassen, daß auch jeder hineinging! Ein deutsches Fräulein kam mit einem Iwan am Arm daher. Ich Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge Robert Fremr Foto: Wikipedia
Art, wie ich reagiert hatte, war die einzige Erklärung für mich, daß mich ein gepflegter Herr in Zivil ansprach und sich nach meinem Beruf erkundigte. Wahrheitsgemäß antwortete ich „noch gar nichts“. versprach mir kostenlose Teilnahme an einem Lehrerausbildungskurs. Wenn ich nur angenommen hätte! Bestimmt wäre ich ein Lehrer und ein guter Kommunist geworden,Show in Holland). In diesem Lager kamen wir mit Heimkehrern aus westlichen Gefangenencamps zusammen. Als manch einer von ihnen erzählte,
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der 1894 in Karlsbad geborene Metzger Carl Weidl alias Raymon verließ im Jahr 1925 seine sudetendeutsche Heimat. Eine neue Wirkungsstätte fand er in der Stadt Hakodate im Süden der japanischen Insel Hokkaido.
In der Ära des Kaisers Taisho (1912–1926) war es eine Pionierarbeit, den Einheimischen beizubringen echte deutsche Fleischspezialitäten zu essen, aber es gelang ihm perfekt. Seine Nachkommen, die ihm die japanische Frau schenkte, und deren Kinder führen dieses Familienunternehmen bis heute und verkaufen Wurstwaren in ganz Japan.

Der Familiengründer wohnte bis zu seinem Tod im Jahr 1897 in einem Haus im historischen Teil Hakodates, das im Fachwerkstil erbaut wurde. Heute be ndet sich im Erdgeschoß ein Geschäft, das die Raymon-Produkte verkauft. Der erste Stock zeigt eine interessante und aufschlußreiche Dauerausstellung über die Geschichte des Unternehmens. Peter Barton, der Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, war seit 1994 schon öfter in Hakodate. Auch diesmal ließ er sich von einem Verkaufsstand im großen Kaufhaus der Stadt beeindrukken. Der Sudetendeutsche Weidl oder Raymon gehört heute o ziell

zum „Stolz von Hakodate“. Barton fotogra erte bei seinem Sommeraufenthalt eine Straßenbahn, die das Firmenlogo und Weidls Porträt

trägt. Die Hakodater sind stolz auf den Unternehmer, der im fernen Japan sudetendeutsche Geschichte schrieb.
❯ Nutzer, die die Akku-Roller nicht in den extra ausgewiesenen Parkzonen abstellen, werden zur Kasse gebeten

Prag geht gegen eScooter vor
In Paris sind die hippen LeiheScooter in ein paar Tagen Geschichte. Im Frühjahr hatten sich in einer Volksabstimmung 89 Prozent der Bürger für ein Verbot ausgesprochen, das jetzt zum 1. September in Kraft tritt. Auch in Prag sind viele Bürger zunehmend genervt von im Weg liegenden eScootern, rücksichtslosen Fahrern und der verheerenden Ökobilanz. In der tschechischen Hauptstadt werden deshalb ebenfalls Maßnahmen ergriffen.

Auch in anderen europäischen Metropolen versucht die Politik, rücksichtslose eScooterfahrer einzubremsen. So bleiben in den Niederlanden eScooter generell verboten. In Großbritannien dürfen die Akku-Roller in nur wenigen, ausgewiesenen Testgebieten und nach einem absolvierten Sicherheitstraining benutzt werden. Im norwegischen Oslo gilt ein Nachtfahrverbot, um Trunkenheitsfahrten zu verhindern, und im finnischen Helsinki wurde aus dem gleichen Grund die Höchstgeschwindigkeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr auf 15 km/h reduziert. In Italien wird gerade ein Gesetz vorbereitet, das Helmpflicht, Haftpflichtver-
Wirtschaft: Minus wird größer
Im April hatte das tschechische Finanzministerium noch einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,1 Prozent prognostiziert. Nach neuen Berechnungen geht Finanzminister Zbyněk Stanjura (ODS) jetzt von einem Minus von 0,2 Prozent aus. Der Grund sei, so das Regierungsmitglied, daß die Bürger weiter sparen und größere Ausgaben verschieben. Für das kommende Jahr erwartet Stanjura dann eine spürbare Belebung der tschechischen Wirtschaft mit einem Plus von 2,3 Prozent. Im April hatte sein Ministerium aber noch auf ein dreiprozentiges Wachstum gehofft.

Staatsbesuch aus Israel
Die tschechische und die israelische Regierung planen für den 9. Oktober eine gemeinsame Kabinettssitzung in Prag, hat das Nachrichtenportal Seznam Zprávy mit Berufung auf die tschechische Botschafterin in Israel, Veronika Kuchyňová Šmigolová, berichtet. Demnach wird auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nach Prag kommen.
Bürger vertrauen
Präsident Petr Pavel
bei einer Zahl um 13 Millionen Reisenden gelegen. Das neu erwartete Ergebnis liege allerdings immer noch um 20 Prozent unter dem des Vor-Corona-Jahrs 2019, sagte der Vorstandsvorsitzende der Betreibergesellschaft Letiště Praha, Jiří Pos. Für das kommende Jahr erwartet man auf dem Prager Flughafen eine Steigerung um etwa zehn Prozent auf 14,9 Millionen Passagiere. Neue Brennstäbe für das AKW Temelin
Im südböhmischen Atomkraftwerk Temelín ist am Freitagabend der zweite Reaktorblock vom Netz genommen worden. Es handle sich um eine geplante Abschaltung, die ungefähr zwei Monate dauern werde, sagte AKW-Sprecher Marek Sviták der Presseagentur ČTK. In den kommenden Wochen soll knapp ein Drittel der 163 Brennstäbe in dem Reaktorblock ausgetauscht werden. Zudem sollen ausgewählte Sicherheitselemente kontrolliert werden wie die Hauptzirkulationspumpe oder die Turbinen. Mit seinen beiden Kernkraftwerken Temelín und Dukovany erzielt Tschechien 38 Prozent des nationalen Energiebedarfs und exportiert Atomstrom auch nach Deutschland. Mit dem Bau von Mini-AKW vom Typ Small Modular Reactor will Tschechien bis 2024 die CO2-neutrale Stromgewinnung auf 50 Prozent des nationalen Bedarfs ausbauen.
ne Reduzierung des eScooter-Bestands vereinbart. So ist in Prag 1, 2 und 3 das Abstellen der eScooter nur noch in extra ausgewiesenen Parkzonen erlaubt. Wer sich nicht daran hält, dem werden über die Online-Buchung automatisch 500 Kronen (knapp 21 Euro) als Strafgebühr berechnet. Außerdem mußte der Anbieter Lime eine Telefon-Hotline einrichten, über die Bürger falsch geparkte eScooter melden können. Und im ersten Stadtbezirk wird der Bestand von derzeit 2500 eScootern auf maximal 1500 reduziert.
Unter den Verfassungsorganen genießt weiter Präsident Petr Pavel mit 58 Prozent Zustimmung das größte Vertrauen der tschechischen Bürger, hat das Meinungsforschungsinstituts
CVVM ermittelt. Dagegen sackten sowohl die Regierung von Premierminister Petr Fiala als auch das Abgeordnetenhaus um sieben Prozentpunkte auf 25 Prozent. Dem Senat vertrauen aktuell 36 Prozent der Tschechen.
Mehr und weniger Flugpassagiere
Netrebko-Konzert in Prag abgesagt
sicherung und Strafen bei Falschparken beinhaltet. In Kroatien ist das Tragen eines Helms bereits Pflicht. Und in Deutschland sind eScooter nur auf Radwegen und Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, dürfen sie auf die Fahrbahn ausweichen. Verboten ist das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen.

Außerdem müssen die Benutzer mindestens 14 Jahre alt sein. Beim Alkohol gelten die Grenzen wie für Autofahrer, warnt der ADAC: „0,5 Promille, bei Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille und 0,0 für Fahranfänger.“

In Prag haben die Verantwortlichen mit dem Anbieter Lime strengerer Regelungen sowie ei-




In Pardubitz habe man zudem eine Geschwindigkeitsreduzierung durchgesetzt, hat der dortige Verkehrsstadtrat Jan Hrabal (Partei Ano) gegenüber Radio Prag erklärt: „Die eRoller fahren mit 25, manchmal auch 30 Stundenkilometern. Mit den Betreibern haben wir nun verabredet, daß sie die Höchstgeschwindigkeit auf 20 Kilometer in der Stunde senken. Zudem gibt es im Zentrum Zonen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung. An diesen Orten, an denen sich nämlich mehr Fußgänger bewegen, beträgt das Maximum 15 Stundenkilometer.“

❯ Zentrale Auftaktveranstaltung zum Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen am Samstag in Berlin
Minister Peter Beuth hält Festrede


„Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ lautet das Motto des diesjährigen Tages der Heimat des Bundes der Vertriebenen. Bei der zentralen Auftaktveranstaltung am Samstag in der Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt in Berlin hält der hessische Innenminister Peter Beuth die Festrede. Das Grußwort spricht Oleksii Makeiev, der Botschafter der Ukraine in Deutschland.
Zum Auftakt wird BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius die Gäste begrüßen und zur aktuellen Lage sprechen. Am Ende der Veranstaltung erfolgt das Geistliches Wort und Gedenken durch Weihbischof Dr. Reinhard Hauke, den Bevollmächtigten der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und Aussied-
lerseelsorge. Im Anschluß an den Festakt findet um 15.30 Uhr die Kranzniederlegung an der Ewigen Flamme auf dem TheodorHeuss-Platz statt. Redner sind hier Staatssekretär a. D. Rüdiger


Jakesch, Vorsitzender des Berliner Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen, Stefan Evers, Bürgermeister und Senator für Finanzen des Landes Berlin sowie Minister Beuth und
BdV-Präsident Fabritius. Mit dem Tag der Heimat wird an die Kundgebung vor dem Stuttgarter Schloß am 6. August 1950 erinnert, bei der die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verkündet wurde. Deren Kernelemente sind der Verzicht auf Gewalt und Rache. Der BdV überträgt den Festakt ab 12.00 Uhr live über seinen YouTube-Kanal unter dem Link https://www.youtube.com/c/ bdvbunddervertriebenen TF
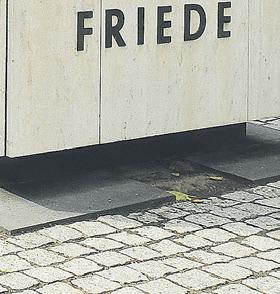
Der Václav-Havel-Flughafen in Prag rechnet mit mehr Reisenden als ursprünglich gedacht. So dürften in diesem Jahr rund 13,6 Millionen Passagiere den Flughafen nutzen, gaben die Betreiber am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die vorherigen Schätzungen hatten
Nach Protesten im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist das für Oktober in Prag geplante Konzert von Weltstar Anna Netrebko abgesagt worden. Die in Rußland geborene Operndiva besitzt neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft und hat Wohnsitze in St. Petersburg, New York und Wien. Obwohl Netrebko im März 2022 öffentlich erklärt hatte, sie „verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich“, wurde sie wegen ihrer früheren Nähe zu Wladimir Putin Anfang 2023 von der Ukraine mit Sanktionen belegt und mußte weltweit immer wieder Konzerte nach Protesten absagen.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546



Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 33 + 34 | 25.8.2023 2
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
PRAGER SPITZEN
Torsten Fricke
Dauerärgernis eScooter: Wie hier an der Münchner Hackerbrücke werden die Akku-Roller von vielen Benutzern einfach auf dem Gehweg liegengelassen. Foto: Mediaservice Novotny
Nach dem Festakt ndet die Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Theodor-Heuss-Platz statt. Fotos: Ulrich Miksch, Anastasia Makeieva, privat
Botschafter Oleksii Makeiev.
Innenminister Peter Beuth.
Die Wege ihrer Familien hatten sich bereits im Frühjahr 1945 in Tetschen-Bodenbach in Nordböhmen gekreuzt: Jahrzehnte nach der Vertreibung trafen sich Erika Klein und Hans Dietrich als Lehrerkollegen in Ingolstadt wieder, verliebten sich und heirateten. Nach und nach entdeckten sie ihre gemeinsame Vergangenheit. Seit ihrem Ruhestand widmet sich die Gymnasiallehrerin für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde der Familienforschung hat ihre eigene Vertreibungsgeschichte als Beitrag in dem vom Historischen Verein Ingolstadt herausgegebenen Buch „Zwischen Kreuztor und Neuem Schloß, Erlebte Geschichten und Geschichte, Ingolstädter erzählen ihre eigenen Erlebnisse in der Stadtgeschichte nach 1940“ veröffentlicht.

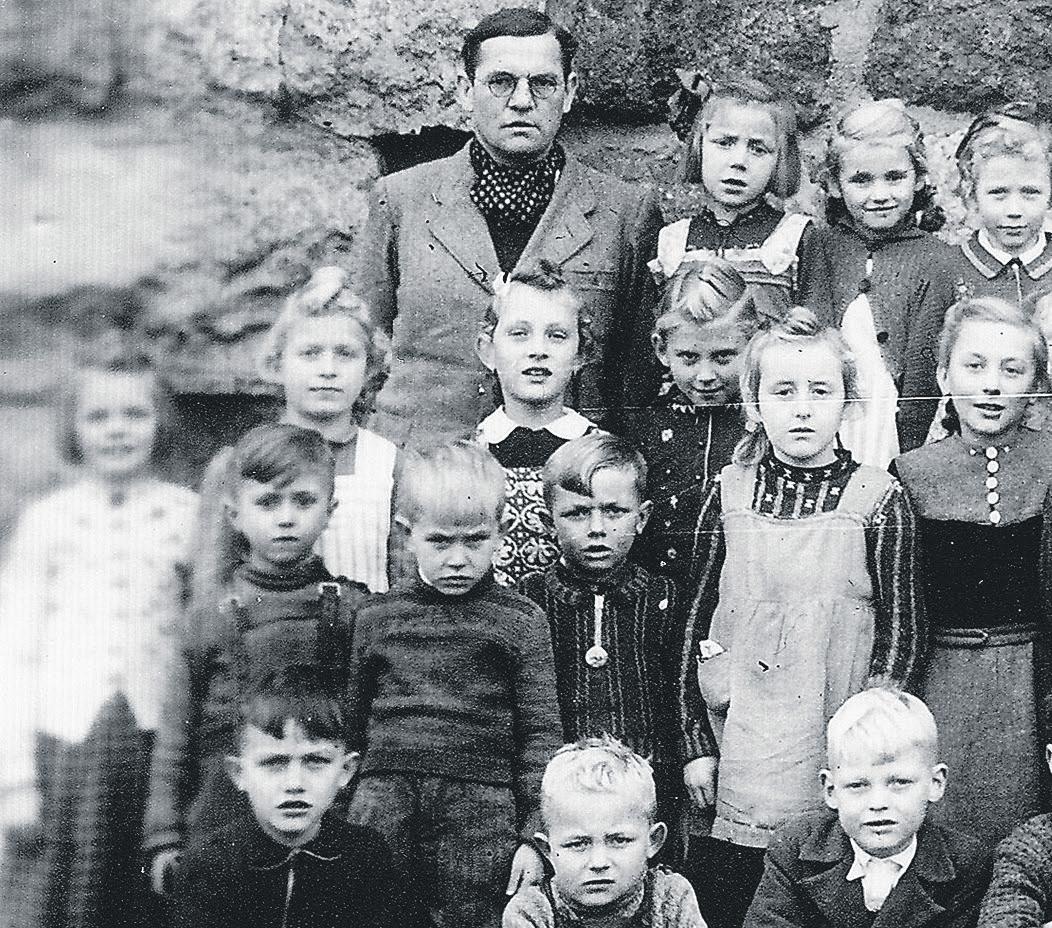
Von Erika Dietrich


Tetschen-Bodenbach in Nordböhmen war eine malerisch gelegene Doppelstadt an der Elbe. Es lag etwa 15 Kilometer südlich der Grenze zwischen Sachsen und der Tschechoslowakei und hatte 1939 rund 32 000 Einwohner. Dominiert wurde es vom Schloß der österreichischen Adelsfamilie Thun-Hohenstein, das auf einer felsigen Anhöhe über der Stadt thronte. Es war bis 1932 in ihrem Besitz. Von dieser Stadt, in der meine Eltern lebten, weiß ich nur noch wenig aus eigener Erinnerung. Allerdings:
Als ich drei Jahre alt war, riß ich einmal aus und rannte vom Lebensmittelgeschäft meiner Eltern in Richtung Bahnhof, um meine Großmutter abzuholen. Doch unterwegs erkannten mich Kunden unseres Geschäftes, sie informierten meine Eltern. Ganz schnell wurde ich wieder zurückbefördert. Dieser Bahnhof in Bodenbach, durch welchen Fernzüge an der Grenzstadt vorbei nach Dresden, Berlin und Prag rasten, bekam eine seltsame Bedeutung für mich. Erst Jahrzehnte später sollte ich das erkennen.
Im Februar 1945 kam es zu der schrecklichen Bombardierung Dresdens, das nur rund 60 Kilometer entfernt war. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar soll man bis in Tetschen ein „dumpfes Grollen und Zittern“ bemerkt haben, das durch die Bombenabwürfe der englischen und amerikanischen Luftwaffen-Geschwader verursacht wurde. „…, auch der Feuerschein war die ganze Nacht hindurch zu sehen“ heißt es bei Alfred Herr (Herausgeber) im Werk „Heimatkreis Tetschen-Bodenbach“. Meine ältere Schwester wußte noch später, daß Menschen, die während der nächsten Tage von Dresden nach Tetschen kamen, schlohweiße Haare hatten, die ihnen zu Berge standen. Das Grauen dieser schrecklichen Bombennächte in Dresden war ihnen immer noch ins Gesicht geschrieben und hatte sie innerhalb einer ganz kurzen Zeit schwer gezeich-
Eine alte Postkarte zeigt das an der Elbe gelegene Tetschen-Bodenbach. Noch heute be ndet sich hier der wichtigste Eisenbahngrenzübergang zwischen Deutschland und Tschechien. Foto: Archiv Familie Dietrich
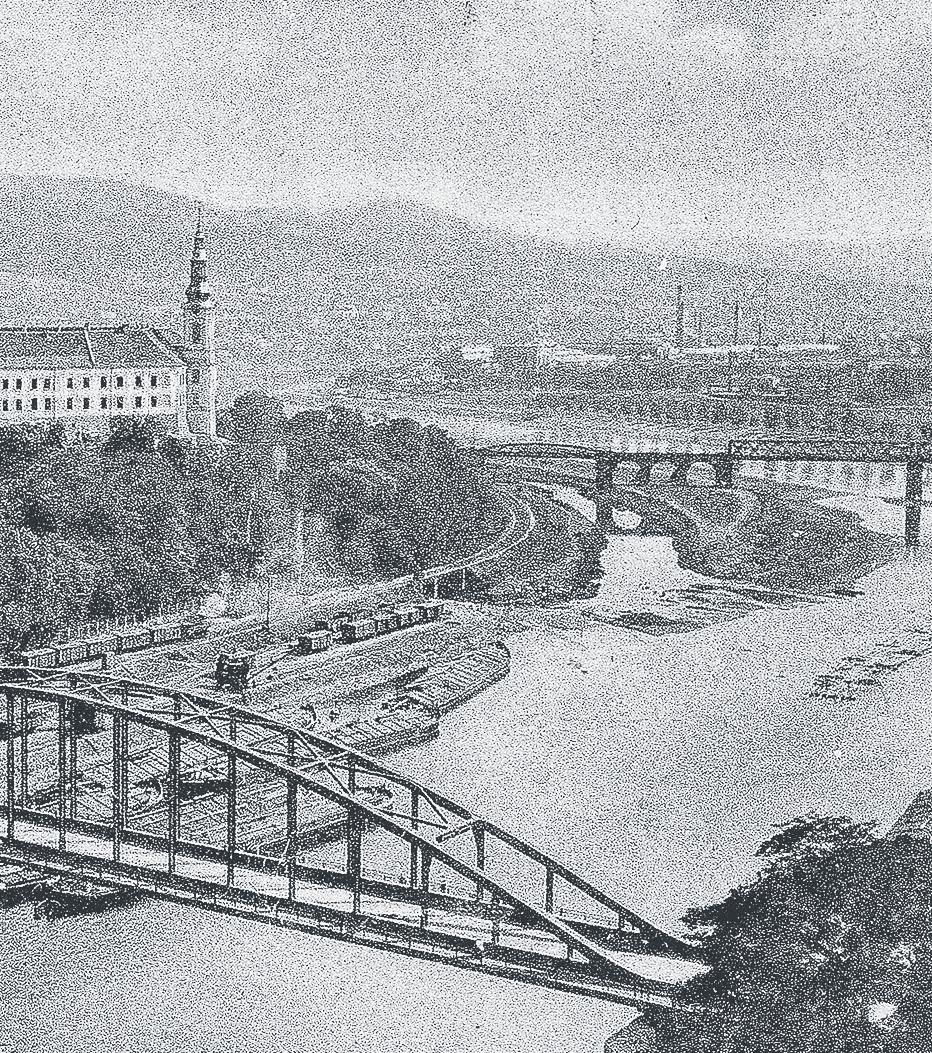
Ingolstadt und ein ungewöhnliches Wiedersehen
Wie aus zwei Kindern der Vertreibung ein Ehepaar wurde
legte Brote essen konnten, deren Belag dicker war als die Scheibe selbst, war für uns unbegreiflich und unerhört.
Unser Leben in Sachsen wurde durch die politischen Umstände und durch die Ernährungslage immer bedrängter. Ein Arzt sagte meiner Mutter, die Kinder bräuchten dringend eine Luftveränderung. Sie hatten Hungerödeme und dünne Ärmchen. Meine Eltern sollten handeln. Sie verstanden den Hinweis und flohen mit den beiden jüngeren Kindern und der Großmutter Ende 1947 bei Nacht und Nebel zwischen Plauen und Hof nach Bayern. Die beiden älteren waren schon ein paar Tage vorher auf Schleichwegen vom Vater über die Grenze gebracht worden. Das dürftige Reisegepäck war in Rucksäcken und auf einem Leiterwagen verstaut. Nach einer Zwischenstation in Hohentrüdingen im Ries fand mein Vater eine Wohnung in Dillingen an der Donau und arbeitete bei der Firma Gubi wieder in seinem früheren Beruf als Feinkostkaufmann. Zunächst war er Filialleiter, nach vielen Jahren machte er sich wieder selbständig.
net. Durch den Bahnhof von Tetschen-Bodenbach fuhr damals ein Zug mit Menschen aus Schlesien, die eigentlich wie Tausende anderer Vertriebene in Dresden Station machen wollten. Zu einer der betroffenen Familien gehörte auch meine spätere Schwiegermutter. Sie war 19 Jahre alt und hochschwanger. Aus Lauban kommend, das 30 Kilometer südöstlich von Görlitz lag, sollte dieser Zug die Menschen nach Dresden bringen. Es war der letzte Zug, der vor der anrückenden Roten Armee Schlesien ver-
bedeutend war. Dieser letzte Zug wurde vom Lokführer umgeleitet. Statt nach Dresden fuhr er nach Bad Schandau, durch das enge Elbetal im Erzgebirge und an Tetschen-Bodenbach vorbei in Richtung Prag. Ein unbekannter Lokführer, der durch sein mutiges Handeln viele Menschenleben rettete.
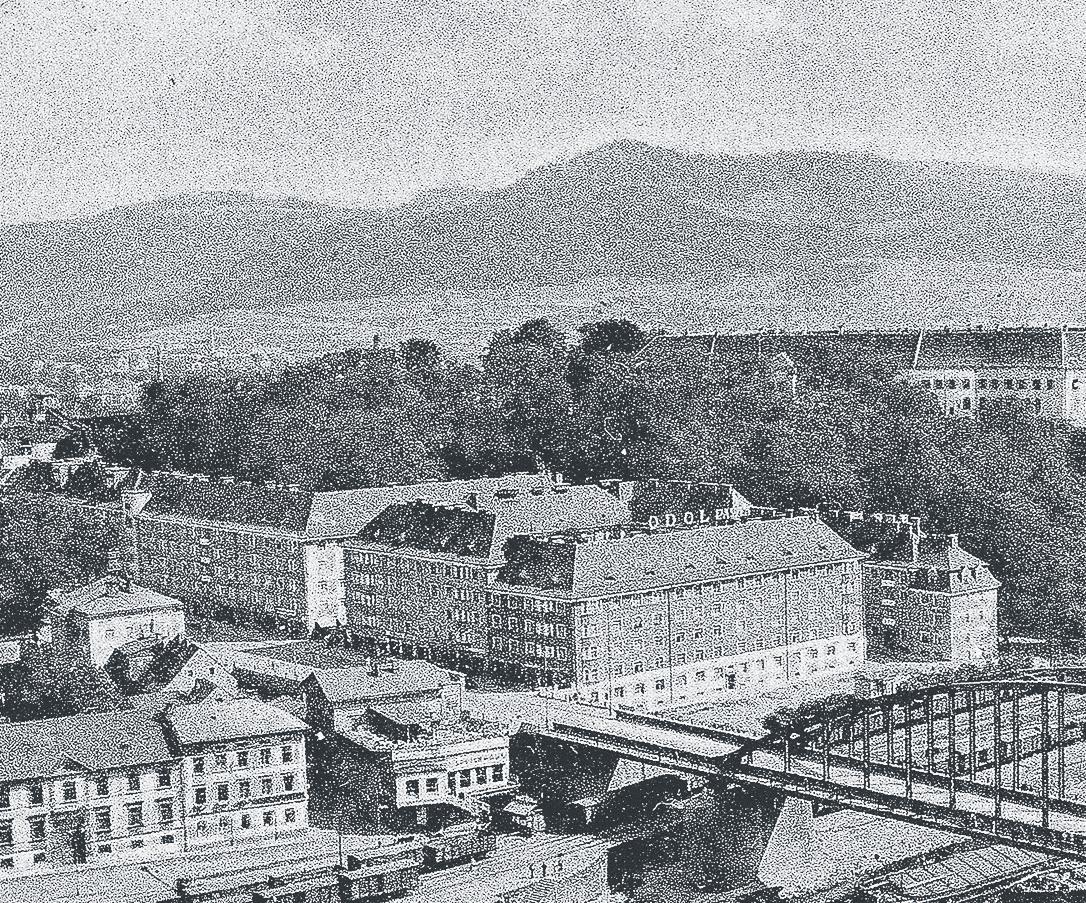
Für einen Augenblick waren meine spätere Familie und ich mit meinen Eltern und Geschwistern uns sehr nahe. Die echte Begegnung erfolgte aber erst Jahrzehnte später in Ingolstadt.
den, in welchem Würste und weiterer Proviant versteckt waren.
Kurz nach Prag begannen bei Ursula die Wehen. Opa Willy, der Schlossermeister war und später Eisenbahner in MünchenFreimann, lief durch den ganzen Zug und fragte nach einem Arzt.

Im letzten Waggon traf er auf eine Ärztin. Es war die Frauenärztin, bei welcher Ursula in Lauban bereits in Behandlung war. Die Erleichterung war groß. Der Zug stand zwei bis drei Tage östlich von Prag still, und die Geburt des Buben verlief gut. Ein gesundes, lebendiges Kind war am 15. Februar 1945 auf die Welt gekommen, während viele tausende Erwachsene und Kinder am 13. und 14. Februar (einem Aschermittwoch) in Dresden verbrannt und erstickt waren.
Die Mitreisenden sammelten für das kleine Wesen und gaben der Mutter eine Glückwunschkarte mit, auf der sie unterschrieben hatten. Sie sollte später zum überlieferten Familienschatz gehören. Schließlich ging die Fahrt weiter, das Ziel war Österreich. Zunächst war die Familie also gerettet.
In Gmunden am Traunsee erhielt man eine Unterkunft, und bald kehrte auch der Vater –nach schrecklichen Erlebnissen – aus dem Krieg zurück. Das Leben 1945 und 1946 war hart und entbehrungsreich. Nach einem Jahr wurden die Deutschen aus Gmunden nach Bayern abgeschoben.

ließ. Der Lokführer schien aber etwas erfahren zu haben, daß die Stadt in diesen Tagen gefährdet war. Die Barockstadt Dresden galt lange Zeit als sicher, als nicht gefährdet durch Bombenangriffe, da sie militärisch nicht

Meine spätere Schwiegermutter Ursula wurde von den Eltern ihres Mannes begleitet.

Ihr Ehemann war noch an der Front im Osten. Für das erwartete Kind war unter anderem ein Steckkissen mitgenommen wor-
In Tetschen-Bodenbach kam es bei Kriegsende nicht zur Flucht, vielmehr wurde die deutsche Bevölkerung enteignet und ausgewiesen, so wie es auch meiner Familie erging. In den Ge-
meinden Nordböhmens gab es einst ein gutes Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen. Dies litt aber durch die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, durch Hitlers Besetzung der Tschechoslowakei, durch Lidice und durch die Beneš-Dekrete. Durch eine Amnestie waren damit Verbrechen und Ausschreitungen für rechtens erklärt worden. Wir mußten die Wohnung mit allem Besitz verlassen und durften nur mit dem Rucksack Papiere und ein Minimum an Gepäck mitnehmen.
Ich aber besuchte die Oberrealschule, zuerst in Dillingen, später in Günzburg. Nach dem Abitur bewarb ich mich um ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung und studierte in München Germanistik, Geschichte und Sozialkunde für das Lehramt am Gymnasium. Einen Teil meiner Referendarzeit verbrachte ich am Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt. Ein Zimmer hatte ich in der Hohe-Schulstraße gefunden neben dem Georgianum, später im Taschentorturm.
Während der ersten Lehrerkonferenz am Scheiner-Gymnasium saß ich einem Kollegen gegenüber, der Mathematik und Physik unterrichtete und der sehr schweigsam war. Beim Mittagessen mit Kollegen beim Hugl-Wirt in der Schutterstraße kamen wir ins Gespräch. Ich erfuhr nach und nach die Familiengeschichte und lernte die Eltern und die vier Großeltern des Kollegen kennen, welche die Flucht überstanden hatten.
So begegnete ich dem Sohn Hans dieser Familie, dem ich in Tetschen, ohne es zu wissen, schon einmal räumlich sehr nahe gewesen war und dessen Leben im Februar 1945 an einem seidenen Faden hing.



Mein Vater brachte meine Mutter, uns vier Kinder und meine Großmutter nach Freiberg in Sachsen zu einem Kriegskameraden. Dort lebten wir kurze Zeit in einer Baracke, dann bei zwei älteren Fräulein in einem kleinen Haus. Auch wir mußten hungern wie die Familie meines späteren Mannes in Österreich. Als wir Kinder einmal auf der Straße mit einem kleinen Osterhasen-Fuhrwerk spielten, kamen ein paar russische Jungen vorbei und traten alles zusammen. Daß sie be-
Im Bräustüberl von Kloster Andechs tauschten wir eines Tages unsere Telefonnummern auf einem Bierfilzl aus und beschlossen zu heiraten. Damit war ich endlich in Ingolstadt gelandet.
Ich schlug hier Wurzeln, unterrichtete 29 Jahre lang meine Fächer am Apian-Gymnasium und machte zahlreiche Exkursionen und Projekte mit Schülern, unter anderem über das europäische Comenius- beziehungsweise Erasmuswerk mit Danzig und mit Guadalcanal bei Sevilla.
3
❯ Zeitzeugin Erika Dietrich berichtet über ihren langen Weg nach
AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 33 + 34 | 25.8.2023
Vom 13. bis 15. Februar 1945 bombardierten die Allierten Dresden. Die Stadt wurde dabei komplett zerstört. Die Zahl der Todesopfer wird auf 25 000 geschätzt. Foto: Von Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer / CC-BY-SA 3.0
1948 in der ersten Klasse der Volksschule in Hohentrüdingen mit Lehrer Winter: Erika Klein im Matrosenanzug in der letzten Reihe, davor Bruder Hans mit gesticktem Hosenträger. Fotos: Familie Dietrich
Weihnachten 1948 in Dillingen: Emil und Irmgard Klein mit den Kindern Susanne, Erika, Hans und Walter.
Zeitzeugin Erika Dietrich.
❯ Musikakademie Theresienstadt präsentierte in der Deutschen Botschaft ein Werk der jüdischen Künstlerin Rachel Danzinger van Embden
Konzertreihe erinnert an verfolgte Komponisten
Wider das Vergessen: Jenen Komponisten wieder eine Stimme geben, die von den Nationalsozialisten verfolgt und in der Regel ermordet wurden, dies ist das Ziel des deutsch-tschechischen Projekts Musica non grata. Bei der Aufführung am 17. August in der Deutschen Botschaft in Prag präsentierte die Musikakademie Theresienstadt ein Werk der jüdischen Komponistin Rachel Danzinger van Embden.
Bis zur Machtergreifung der Nazis war die in Amsterdam geborene Wahl-Berlinerin eine sehr erfolgreiche Komponistin. 1910 brachte sie mit „Die Dorfkomtesse“ ihre erste Operette auf die Bühne. Dieses Werk war, so der Deutsche Botschafter Andreas Künne in seiner Begrüßung, „die erste Operette einer weiblichen Komponistin überhaupt“. Über ihr weiteres Schicksal sind nur Bruchstücke bekannt. Als sicher gilt, daß drei ihrer vier Töchter von den Nazis nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz beziehungsweise im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurden. Ihr selbst, so deuten neue Recherchen an, soll 1939 oder 1940 mit einer weiteren, deutlich jüngeren Tochter die Flucht nach England gelungen sein, wo sie 1946 verstorben sein soll.
„Die Komponistin hat eine sehr traurige Biographie. Sie war eine unglaublich erfolgreiche Operettenkomponistin, wurde von den Nazis verfolgt. Heute kennt sie keiner mehr, sie ist völlig
❯ Recherchereise nach Deutschland und Tschechien
in Vergessenheit geraten, obwohl sie traumhaft schöne Musik schrieb“, erklärt der Leiter der Musikakademie Theresienstadt, Kai Hinrich Müller. Gerade in Prag seien, so Botschafter Künne, die
von den Nazis verfolgten Künstler „Teil des einzigartigen tschechisch-jüdischdeutschen Kulturerbes. Mit Musica non grata wollen wir einen Beitrag leisten zur Aufarbeitung des Unrechts.“
Sieben Schweden erforschen
ihre sudetendeutschen Wurzeln
Mit zwei Automobilen fuhren sieben Nachfahren sudetendeutscher Sozialdemokraten von Malmö und Umland aus Südschweden Anfang August in die Vergangenheit ihrer vier Familien, die entweder 1938 direkt aus der Tschechoslowakei oder dann nach der Vertreibung Ende der 1940er Jahre aus Westdeutschland nach Schweden emigrierten.
Die Landschaften, die Orte, Dörfer wie Städte in Nord- und Westböhmen, hatten sie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit ihren Angehörigen besucht. Diesmal jedoch gingen sie den Darstellungen des Schicksals der Vertreibung in Deutschland und Tschechien auf die Spur, die in den letzten Jahren entstanden sind. Berlin mit seinem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung bildete den Ausgangspunkt, dann folgte der Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“ in Aussig und schließlich wurde als Schlußpunkt das Sudetendeutsche Museum in München aufgesucht.
Die Enkelgeneration, die in Schweden außer der innerfamiliären Überlieferung kaum Einordnungen ihres Familienschicksals erfahren konnte, war um so dankbarer, in Deutschland wie in Tschechien Hilfe finden zu können. Die Familien Hofbauer und Mlnarik emigrierten 1938 aus Prag, kamen aus Teplitz-Schönau und aus Tuschkau und Hradzen etwa 30 Kilometer westlich von Pilsen.
Die Familien Weigel und Knobloch emigrierten nach der Vertreibung aus Losdorf bei Tetschen-Bodenbach und aus der Nähe von Haida; Antifa-Transporte führten sie erst nach Hessen und nach Bayern, von wo aus sie 1948 und 1950 nach Schweden gelangten. Interessant in diesem Zusammenhang war nach dem Besuch der Dauerausstellung das Zusammentreffen mit dem Archivar Jörg Schlösser, der über Möglichkeiten der Familienforschung im Haus, aber auch per Internet informierte und auf eine kleine Sammlung von Exponaten eines DSAPlers im Schaubereich der Bibliothek verweisen konnte, darunter eine Antifa-Transportliste aus Haida, allerdings waren diese sozialdemokratischen Familien etwas früher auf den Weg gegangen als die Knoblochs aus Falkenau-Kittlitz, die erst im Oktober
Die Fäden von Marias
Mantel
Wenn Mariä Himmelfahrt vorbei ist, so heißt es, merkt man dem Sommer seine Müdigkeit an. Das schöne kirchliche Fest am 15. August mit seinem reichen Brauchtum markiert den Übergang vom Hochsommer zum Spätsommer. Dieses Jahr war das zwar von den Temperaturen her nicht zu bemerken. Gerade in der Augustmitte suchte uns eine Hitzewelle heim, die viele Menschen stöhnen ließ. Und selbst jetzt, da wir auch schon das Fest Maria Königin am 22. August hinter uns haben, ist es noch ziemlich heiß.
Doch der Hochsommer neigt sich dennoch dem Ende zu. Mir ist das neulich bei einer längeren abendlichen Autofahrt bewußt geworden. Die Getreidefelder sind mittlerweile kahl. Nur mehr der Mais wartet auf seine Ernte. Vor allem aber bricht die Dämmerung viel früher herein, als es noch vor einem Monat der Fall war. Das Tageslicht nimmt deutlich ab. Bald werden auch die Ferien wieder zu Ende sein. Viele haben den Urlaub bereits hinter sich. Ein neues Schulund Arbeitsjahr steht vor der Türe. So erleben wir bei aller Hitze doch schon ein wenig von der Müdigkeit des Sommers.
1946 ausreisten.
Durch das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Hag-Kehl konnte die schwedische Gruppe auch den Bundestag besuchen, vor allem im Keller die Kunst-Installation des Franzosen Christian Boltanski „Archiv der Deutschen Abgeordneten“ von 1999, wo alle demokratisch gewählten Abgeordneten bis 1999 durch einen Metallkasten mit Aufkleber repräsentiert werden. Darunter die drei sudetendeutschen Sozialdemokraten Richard Reitzner, Wenzel Jaksch und Ernst Paul, der von 1949 bis 1969 Mitglied des Deutschen Bundestages, ab 1938 bis 1946 aber die Hauptperson im schwedischen Exil war.
Auf dem Weg nach Aussig streifte die
bei waren. Sie hatten vor über zehn Jahren den Nachlaß ihres Großvaters in das Collegium Bohemicum gegeben, und schließlich landeten einige Dokumente in der Ausstellung als Beispiel für einen der Wege von Sudetendeutschen nach 1938, nämlich den Weg ins Exil. Eindrückliche Aufnahmen des MuseumsFotografen über den Besuch der schwedischen Gruppe stehen seitdem auf Facebook.
Ein Abstecher nach Teplitz-Schönau zum Redaktionsgebäude der „Freiheit“, dem Arbeitsplatz und dann noch zum Wohnhaus von Josef Hofbauer schloß sich an. Auch in Leitmeritz und in Hradzen bei Pilsen wurden Orte der Vorfahren aufgesucht. In Hradzen, wo Eva Ce-
ist beispielsweise aufbewahrt – auch in München zu finden ist.
Zum Abschluß wurde das Sudetendeutsche Museum besucht mit einer offiziellen Führung, die einen guten Überblick über die Sammlung geben konnte. Das Václav-Havel-Zitat im Eingangsbereich des Sudetendeutschen Museums „Nichts Geringeres und nichts Größeres als das Erlebnis namens Heimat“ könnte auch als Motto über der Reise der schwedischen Nachkommen sudetendeutscher Sozialdemokraten durch Deutschland und Tschechien gestanden haben. Die Gruppe tauchte in die Vergangenheit ihrer Familien ein und begegnete doch auch den heutigen Generationen, die sich mit diesen Musseen etwas aus ihrer Geschichte gemacht haben, die ihre Familien bewegte und die sie übrigens alle noch deutsch sprechen läßt. Einer, Peter Sjunnesson aus der Familie Knobloch, hat sogar Germanistik studiert und spricht auch gut Tschechisch.
Für einige war die Reise in München noch nicht zu Ende. Eva Cesar reiste noch nach Bonn ins Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo sie noch einiges Interessantes im Seliger-Archiv fand.
Zum diesjährigen Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel habe ich eine Legende gehört, die ich bisher noch nicht kannte. In ihr geht es ebenfalls um den Wechsel von einer Jahreszeit zur nächsten. Die Muttergottes sei nach ihrer Entschlafung von Engeln in den Himmel getragen worden. So wird es ja auch auf vielen Bildern dargestellt. Einige Engel sollen allerdings etwas unachtsam gewesen sein. Sie hätten, als sie mit Maria durch die Lüfte geschwebt seien, deren seidenen Mantel nicht fest genug gehalten. Der Wind habe ihn fortgetragen, und er habe sich allmählich in tausende Fäden aufgelöst. Es seien ganz feine, silbern schimmernde Fäden gewesen, die allmählich wieder auf die Erde geglitten seien.
Gruppe Haida und Losdorf, wo das Haus des Vaters und Großvaters der Weigels aufgesucht wurde und ein SmartphoneKontakt der 21-jährigen Nadja mit ihrem 86-jährigen Großvater Friedrich Weigel in Schweden hergestellt werden konnte, der dort aufgewachsen war. Er war bei der Reise über elektronische Brücken also mit dabei. In Losdorf steht auch noch eines der ersten Kudlich-Denkmale, das hier 1892 errichtet worden war.
In Aussig empfing die Gruppe der Direktor des Collegium Bohemicum in der Ausstellung „Unsere Deutschen“, an der noch immer gearbeitet und verbessert wird. Eine besondere Ehre war es für Petr Koura, daß die beiden Enkel Peter und Robert von Josef Hofbauer da-

sar noch mit ihrer Großmutter deren Schwester 1998 besucht hatte, wohnt nun eine andere Familie, mit deren Tochter Eva in einem kleinen Gespräch ihre Kenntnisse über Hradzen und ihre Herkünfte austauschten.

In München schließlich wurde die Gruppe von Ingrid Sauer im Bayerischen Hauptstaatsarchiv begrüßt, wo das Sudetendeutsche Archiv eingearbeitet wird. Viele Dokumente zu den Herkunftsorten, aber auch zu Personen hatte Sauer herausgesucht und sie dort durch die Gruppe einsehen. Ein erster Eindruck, der den Schweden nahebrachte, was alles auch aus dem schwedischen Exil – der Briefwechsel von Ernst Paul in Stockholm mit Karl Kern in Malmö
Und die Weigels und Peter Sjunnesson von der Knobloch-Familie konnten auf ihrem Rückweg nach Malmö in Berlin auch noch den 91-jährigen Erich John aus Kartitz aufsuchen. Der Schöpfer der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz in Berlin und Designer so vieler Alltagsgegenstände in der DDR empfing die Schweden mit einer Beichte. Als in den 1950er Jahren die erste Ikea-Filiale im Westteil von Berlin aufmachte, strömten auch die Studenten der Formgestaltung von der Kunsthochschule Weißensee im Ostteil Berlins dahin und waren beeindruckt, wie man mit einfachen Materialien doch formschöne, interessante Produkte herstellen konnte. Sein Interesse und seine Bewunderung für skandinavisches Design seien seitdem ungebrochen.
Und auch Helena Weigel und Peter Sjunnesson hatten einen direkten Bezug zu Erich John. Die Weltzeituhr war in ihren Deutsch-Lehrbüchern in Schweden abgebildet. Nun lernten sie den Schöpfer persönlich kennen, und er war, wie sie es vorher nicht wußten, ein Sudetendeutscher. Ulrich Miksch

Wenn man im Spätsommer und Frühherbst draußen unterwegs sei, so die Legende, begegne man diesen Fäden. Sie seien an Büschen und Blumen zu sehen, ebenso wie an den Gesimsen und Fensternischen von Häusern. Manchmal machten sie sich auch an den eigenen Kleidern oder im Haar fest. Jeder mache spätestens im September Bekanntschaft mit diesen feinen Fäden. Sie seien, so die fromme Geschichte, eine Erinnerung an das Erdenleben der Jungfrau Maria und daran, daß sie nun im Himmel in mütterlicher Sorge weiterhin für uns da sei.

Mir gefällt diese Legende auch deswegen so gut, weil ich mich deutlich erinnere, daß ich als Kind einmal die Frage stellte, woher denn diese Fäden stammten, und die Antwort erhielt: „Das ist im Altweibersommer so.“ Mir wurde dann auch erklärt, daß die Fäden von Spinnen stammten, aber ich fand sie weiterhin geheimnisvoll. Damals war ich ein Kind, jetzt bin ich ein Erwachsener, auf Vernunft bedacht. Doch manche Naturphänomene vermögen uns vielleicht auch als Erwachsene für die Geheimnishaftigkeit der Welt öffnen, auch wenn wir sie rational erklären können.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München



❯ Mut tut gut
AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 33 + 34 | 25.8.2023 5
Die Gruppe aus Schweden besuchte auch das Sudetendeutsche Museum in München. Foto: Ulrich Miksch
Applaus für den Auftritt der Musikakademie Theresienstadt im Kuppelsaal der Deutschen Botschaft. Fotos: Musica non grata Botschafter Künne.
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon eMail
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
� Riesengebirge und Vorpommern
Osterreiten und Tonnenabschlagen
Tradition ist, daß wir Riesengebirgler besonders zu den Feiertagen wie Silvester, Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weihnachten der Sitten und Gebräuche unserer Heimat gedenken und Parallelen zu unseren jetzigen Wohnorten ziehen. Heute erinnere ich an die Tradition festlicher Ausritte zu Pferde.
Da denken wir in unserer Riesengebirgsheimat speziell an das Osterreiten. Wie der Name schon sagt, ist dies eine Ostertradition. So wird in dem Gedenkbuch von Hermanitz berichtet, daß im Jahre 1936 am Ostersonntag nach längeren Jahren des Vergessens der jahrhundertalte Väterbrauch unserer Ahnen wiederbelebt worden sei. Junge Männer aus Hermanitz, Gradlitz und Wölsdorf trafen sich unter Leitung eines jungen Bauern aus Prode gegen halb sieben in der Früh, erhielten vom Pfarrer das Kreuz und trugen es zu Pferde um die Felder, um Gottes Segen für Wachstum, Gedeihen und eine gute Ernte zu erbitten. Unter Glockengeläut kehrten sie nach etwa zweistündigem Ausritt zurück, und nach einer kleinen Gedenkrede wurde gemeinsam
in der Kirche das Osteramt gefeiert. In dieser Form war das Osterreiten auch in anderen Gemeinden unsrer Heimat üblich.
Einen ganz anderen Ursprung hat das alljährlich im Sommer in Vorpommern vorwiegend auf
Krieges (1618–1648) zurück. Der wahrscheinlichste Ursprung liegt jedoch nach dem Ende der schwedischen Besatzungszeit von 1648 bis 1815.
In jener Zeit mußten die Fischer den Zehnten vom Fisch-
33+34/2023
Tonnenabschlagen in Vorpommern.
dem Fischland und auf dem Darß durchgeführte Tonnenabschlagen, heute mit dem Charakter eines Volksfestes. Sein Ursprung wird unterschiedlich gedeutet. Erste Beschreibungen gehen bis in die Zeit des Dreißigjährigen
� Erfolgreicher Maler aus dem Egerland
Am 29. Juni – 23 Tage nach seinem 93. Geburtstag – starb Helmut Glaßl, Kunstmaler, Vorstandsmitglied des Egerer Landtags, Kulturwart der Eghalanda Gmoi, Träger des Bundesehrenzeichens der Eghalanda und der Bürgermedaille der Gemeinde Bubenreuth aus Schönbach im Kreis Eger. Landsmann und Künstlerkollege Hatto Zeidler gedenkt seiner.
Immer wieder habe ich ihn angerufen. Einmal die Woche vielleicht, manchmal auch öfter. Und immer wieder habe ich mich gefreut, mit jemandem in der schönen Egerländer Mundart sprechen zu können. Am 29. Juni habe ich wieder angerufen, da war eine jüngere Frau am Telefon und fragte mich auf Hochdeutsch, was ich wolle. „Den Helmut Glaßl sprechen“, sagte ich, und da antwortete sie: „Das geht nicht, der ist heute Nachmittag gestorben.“ Am 11. Juli waren wir dann in Bubenreuth zur Beerdigung. Er hat seine Frau Hanni nur um 66 Tage überlebt.
Im Zuge der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung
fang abgeben. Da dies zur damaligen Zeit nicht als Frischware möglich war, wurden die Fische eingesalzen und in Eichenfässern abgeliefert. Nach Abzug der Besatzungsmacht wurden aus Freude die noch verbliebenen
PERSONALIEN
Helmut Glaßl †
aus der Tschechoslowakei nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam Helmut Glaßl als Schüler nach Merlau ins Hessische. Dort lernte er Schreiner. Später zog es ihn nach Bubenreuth ins Fränkische, wo ein Großteil der Geigenbauer aus seiner Heimat-
fand Kunden, die seine Bilder kauften, und so malte er im Lauf der Jahre mehr als 20 000 Bilder, allesamt Öl auf Leinwand.
So wurde Helmut Glaßl ein überaus erfolgreicher Maler, was ihm sowohl Bewunderung wie auch Neid einbrachte. Alles, was
Heringsfässer aufgehängt und darunter durchreitend mit harten Schlägen mit schweren Knüppeln so lang bearbeitet, bis sie schließlich völlig kaputt waren. Daraus entwickelte sich schließlich das heutige Volksfest des Tonnenabschlagens. Dabei gibt es differenzierte Ebenen der Königswürden. Der Reiter, der den Boden aus dem Faß, schlägt, wird Bodenkönig. Der Stäbenkönig muß das letzte Stück des Bauches oder Stäbens herausschlagen. Wer das letzte Stück der Tonne abschlägt, wird zum Tonnenkönig. Am Abend wird dann zum großen Tonnenball geladen. Dem eigentlichen Tonnenabschlagen geht ein festlicher Umritt durch das geschmückte Dorf voraus, bei der der vorjährige Tonnenkönig von zu Hause abgeholt wird. Organisiert wird es vom örtlichen Verein des Tonnenbundes. Dessen Mitglieder werden Tonnenbrüder beziehungsweise -schwestern genannt. Die große Bedeutung dieser Tradition wird durch die Tatsache belegt, daß das Tonnenabschlagen zum Immateriellen Kulturerbe Deutschlands erklärt wurde. Peter Barth

stadt Schönbach sich angesiedelt hatte.
Helmut Glaßl hatte schon als Schüler gemalt und entwickelte sein außergewöhnliches Maltalent autodidaktisch weiter. Er
� Viel geehrter Landsmann aus dem Isergebirge Helmut
Helmut Hempel, langjähriger aus Grottau-Kohlige im Kreis Reichenberg stammender Obmann der oberfränkischen SLOrtsgruppe Warmensteinach, feierte am 14. August 85. Geburtstag.
Nichts Neues im Fichtelgebirge können wir vermerken. Helmut Hempel „regiert“ weiter kraftvoll im Fichtelgebirge,
in SL-Orts-, -Kreis- und -Bezirksgruppe, in der Heimatgruppe, im BdV und im Glasmuseum Warmensteinach.
Überall tritt er als Sudetendeutscher auf. Sein Leistungen sind allgemein anerkannt. Etwas langsamer geht es mit dem Reisen, und seine Frau Gudrun hat Augenprobleme.
er besaß, hat er durch seiner eigenen Hände Arbeit redlich erworben.
So wie ich seinen Fleiß und sein Können bewundere, so habe ich auch immer das Ehepaar
Glaßl mit seinem einzigen behinderten Kind bewundert. Silvia, das Kind, litt an einer unheilbaren Muskelkrankheit, konnte nie selbständig essen oder trinken, hat aber dank seiner literarischen Hochbegabung eine Fülle wunderbarer Geschichten und Gedichte verfaßt, die sie ihrer Mutter diktierte. Sie sind in dem Buch „Dank an Silvia“ erschienen. Silvia Glaßl starb im Alter von 22 Jahren. Die Begräbnisfeier für Helmut Glaßl war ausgesprochen würdig. Er hatte die Bubenreuther Blasmusik bestellt. In der Halle hing sein letztes Bild. Es zeigt einen ruhigen Fluß mit alten und jungen Schwänen im Vordergrund. Im Wasser, das er so unvergleichlich gut malen konnte, spiegelt sich der Himmel. In der Bildmitte liegt ein am Ufer vertäuter leerer Kahn.
Ist es der Kahn, mit dem er selbst in ein anderes Land übersetzen wollte?
Als der Sarg ins Grab hinuntergelassen wurde, spielte die Blasmusik das Lied „Böhmischer Wind“. Das Lied ist mir noch tagelang nachgegangen.
Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinen wie der SL, dem BdV, dem Spiel- und Sportverein Warmensteinach, dem Fichtelgebirgsverein, dem Gesangverein, dem Roten Kreuz, der Leutelt-Gesellschaft, der KAB und betreut auch seinen Heimatortsverein Wetzwalde/Kohlige
mit. Für all das erhielt er zahlreiche Ehrungen. Vor allem wir von der Kreisgruppe können ihm nur danken für all das, was er geleistet hat. Besonders erfreulich ist seine stabile Gesundheit. In dem Sinne wünschen wir ihm und seiner Familie viel Kraft und Gottes Segen. Im Namen aller Freunde und Bewunderer gratuliert Margaretha „Gretl“ Michel
FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 6
Unser Angebot
Hempel 85
Vor 25 Jahren eröffnete im Kärn tener Nötsch im Gailtal im Geburtshaus des Malers
Franz Wiegele das Museum der Künstlergruppe Nötscher Kreis. Es macht das Œvre dieser Maler zugänglich, dokumentiert ihr Leben und gewährt einen Einblick in ihre Verbindungen zur Kunstszene ihrer Zeit. Mitbegründer war Anton Kolig (1886–1950). Er kam in Neutitschein im Kuhländchen zur Welt und ist der bedeutendste Vertreter des österreichischen Farbexpressionismus. Seit 25 Jahren bietet das Museum jährlich wechselnde Ausstellungen und geht der Bedeutung, Positionierung, Wirkung und Nachhaltigkeit dieser Malergruppe nach.
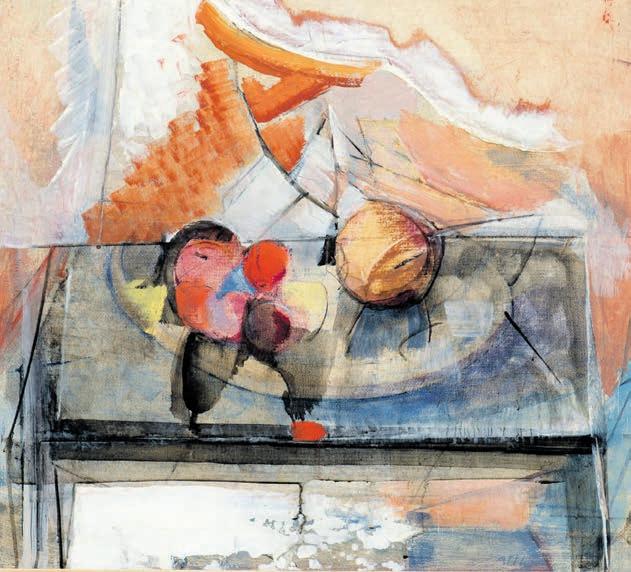


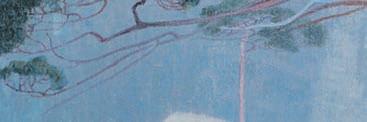



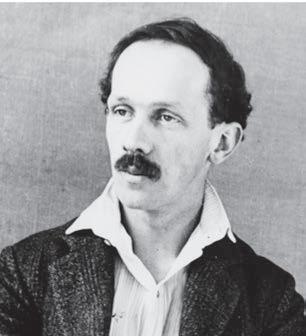

In der Jubiläumsausstellung
steht der Nötscher Kreis im Mittelpunkt. Werke von Se bastian Isepp, dem ältesten Künstler dieser Verbindung von befreundeten Malern, erzählen von den Anfängen und leiten über zu den beiden Hauptvertretern Franz Wiegele und Anton Kolig, die sich vorwiegend mit der künstlerischen Wiedergabe des Menschen auseinandersetzten.
Erö˜ nung am 16. Mai 1998
Zusätzlich vermitteln Arbeiten von Gerhart Frankl, Wolfgang von Schaukal und Theodor Herzmansky einen Eindruck von Anton Koligs Idee einer eigenen Malschule in Nötsch und sei nem Wunsch, diesen Ort zu einem Kärntener Barbizon zu ma chen. Schließlich runden die Landschaftsbilder Anton Mahringers, der sich intensiv und kontinuierlich mit den vielfältigen Naturformen des Gailtales beschäftigte und dabei seinen unverwechselbaren Stil entwickelte, die Schau ab.
Das Museum des Nötscher
Krei ses wurde am 16. Mai 1998 er öffnet und ist dem Leben und
Das Kärntener Barbizon
lose Gruppierung bestand aus befreundetenMalern.Einige waren in dieser Region zur Welt gekommen wie Sebastian Isepp (1884–1954) und Franz Wiegele (1887–1944), andere waren von auswärts nach Nötsch gezogen wie der Kuhländler Anton Kolig (1886–1950) und der Württemberger Anton Mahringer (1902–1974). Die Gruppe war ein künstlerisches Phäno men innerhalb der österreichischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und prägte vor allem die Kunst der Zwischenkriegszeit entscheidend.
Werk der Künstler des Nötscher Kreises gewidmet, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrer sehr individuellen Malerei die österreichische Kunst entscheidend mitgestalteten. Diese
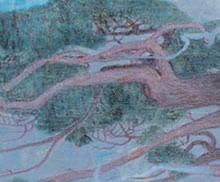
Das Museum ist im Geburts haus Franz Wiegeles unter gebracht und versteht sich als Dokumentationsstätte der vier Künstler. Es möchte in seinen Ausstellungen einen re prä-
sentativen Querschnitt durch ihr Œuvre und anhand von zeitgenössischen Fotografi en und eigenhändigenNiederschriften einen Einblick in die persönlichen Lebensumstände ermöglichen. Außerdem will das Muse um ihre zahlreichen interes santen Verbindungen zu Künstlerkollegen,Kunsthistori kern und Intellektuellen ihrer Epoche transparent machen. Anton Kolig stammte aus dem Kuhländchen. Er kam am 1. Juli 1886 als Sohn des Zimmer- und Kirchenmalers Ferdinand Kolig und dessen Frau Maria, geborene Fiedler, in Neutitschein zur Welt. Er studierte ab 1904 mit Oskar Kokoschka an der Kunstgewerbeschule in Wien. 1907 wech selte er an die dortige Akademie der bildenden Künste, wo er bei Heinrich Lefl er, Rudolf Bacher und Alois Delug studierte.
bruch des Ersten Weltkriegs überrascht, fl oh überstürzt aus Frankreich und ließ seine Bilder zurück. Über Italien erreichte er Österreich.
Im April 1916 rückte Kolig als Landsturmmann zur Hilfsdienstleistung in das Not reservespital in Klagenfurt ein, arbeitete ab Juli an der Südfront, wurde jedoch 1917 zum Ersatzbataillon des Schützenregiments 31 nach Teschen eingezogen. Erst im September 1917 gelang die Aufnahme als Kriegsmaler in die Kunstgruppe des k. u. k. Kriegspressequartiers. Dies geschah auf Betreiben des
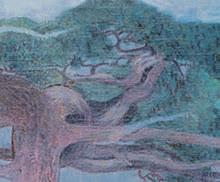
Dich ters Richard von Schaukal (1874–1942), Ministerialrat im Ministerium für öffentliche Arbeiten, der Kolig „für das bedeutendste Talent unter den jungen österreichischen Malern“ hielt. Kolig arbeitete an der Kärntner Front bei der 10. Armee.

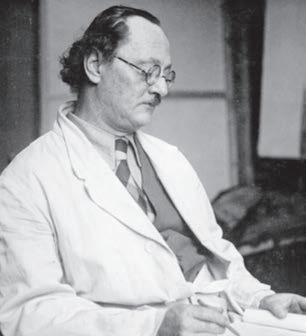
Ende 1917 beauftragte ihn der Kärntener Landdeshauptmann Le opold Freiherr von Aichel burgLabia mit einem als Ge schenk für Kaiser Karl I. be stim mten Flügelaltar der Kärntner Schützen, von dem Kolig vier Flügel voll endete. Als er 1928 zwei Angebote für Professuren in Prag und Stuttgart erhielt, entschied er sich für die württembergische Aka demie, wo er viele später be deutende Maler ausbildete.
Koligs Fresken im Klagenfurter Landhaus (1930) wurden 1938, nach dem Anschluß Österreichs, von den Nationalsozialisten ebenso vernichtet wie sein Mosaik im Salzburger Festspielhaus. Auch weitere Werke wurden aus Galerien entfernt. Adolf Hitler soll sich persönlich gegen die spätexpressionistische Kunst Koligs ausgesprochen haben.
Kolig blieb bis Herbst 1943 in Stutt gart, wo er sich allerdings immer weniger wohlfühlte und schließlich nach Nötsch zurückkehrte. Dort lebte er mit seiner Frau Katharina, den Töchtern Ma rie Antoinette, Dulla, Traut und Sybilla sowie dem Sohn Thad däus direkt neben den Wiegeles. Am 17. Dezember 1944 wur de Kolig mit seiner Familie bei einem Bombenangriff in seinem Haus verschüttet und schwer verletzt; sein Freund Wiegele starb. Ein großer Teil von Koligs Werk wurde dabei vernichtet. Ko lig rang sich, körperlich schwer gezeichnet und stark gehbehindert, in seinen letzten Lebensjahren noch zu einer neuen Gestaltungsweise durch, die die Kraft der Farben in den
Hier lernte er Sebastian Isepp und Franz Wiegele aus Kärnten kennen sowie in den folgenden Jahren bei gemeinsamen Aufenthalten deren Heimatort Nötsch im Gailtal im Bezirk Villach-Land. 1911 heiratete er Katha rina, die Schwester seines Studienkollegen Franz Wiegele, und übersiedelte nach Nötsch.
Mit Oskar Kokoschka (1886–1980), Anton Faistauer (1887–1930), Sebastian Isepp und seinem Freund Franz Wiegele trat er 1911 bei der Ausstellung des Ha genbunds erstmals mit seinen Wer ken an die Öffentlichkeit. Auf Empfehlung von Gustav Klimt (1862–1918) und Carl Moll (1861–1945) erhielten Ko lig und Wiegele 1912 ein Sti pendium für einen Aufenthalt in Paris, wo sich Anton Kolig zunächst im Louvre mit der modernen Malerei auseinandersetzte. 1914 wurde er in Marseille vom Aus-


Vordergrund rückte. 1948 gab es drei größere Werkschauen. Am 17. Mai 1950 starb Kolig an den Spätfolgen der beim Bom benangriff erlittenen Verletzungen. Susanne Habel Bis Sonntag, 29. Oktober: „25 Jah re Museum des Nötscher Kreises“ in A–9611 Götsch im Gailtal, Museum des Nötscher Kreises, Haus Wiegele Nr. 39. Mittwoch bis Sonntag 14.00–18.00 Uhr.

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 7
❯ Anton Kolig und der Nötscher Kreis
Anton Mahringer: „Sankt Georgen mit blauem Berg“ (1906, Ausschnitt).
Anton Kolig: „Kindergruppe vor dem Fenster (1911, Privatbesitz). Bild: Auktionshaus im Kinsky GmbH
Franz Wiegele: „Die Schwestern“ (1925, Privatbesitz). Bild: Graphisches Atelier Neumann, Wien
Sebastian Isepp: „ Der blaue Berg“ (um 1906).
Anton Mahringer: „Apfelstilleben“ (1965). Bild: Atelier F. Neumüller Wien, Kunstsammlung des Landes Kärnten MMKK.
Anton Kolig Anton Mahringer
Sebastian Isepp Franz Wiegele
Ende Juli bis ersten Augustsonntag veranstaltete die Henselgesellschaft auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die Jubiläumssingwoche „100 Jahre Finkenstein“.





Eine fröhliche Schar von fast 50 Sangesfreudigen hatte sich zu dieser Woche eingefunden. Das Hauptaugenmerk der Sing wochentage richtete sich natürlich auf das Singen.
Die Tage begannen mit dem Morgenkreis, den Hanne Preisenhammer gestaltete. Sie berichtete über Hermann Claudius, Hermann Derschmidt, Karl Josef Pimmer und Josef Lidl, die alle mit Walther Hensel wesensverwandt und zum Teil in der Singwochenarbeit tätig gewesen waren. Zwei Morgenkreise widmete sie dem Lindenbaum.
Motette und Kantate
Das umfangreiche Singen unter der Leitung von Herbert Preisenhammer, Gerlind Preisenhammer und Irmtraud Mielebacher war geprägt von einstimmigen Liedern bis hin zur Motette „Dank sagen wir alle“ von Heinrich Schütz. Als besonderer Höhepunkt wurde eine Kantate aus dem Nachlaß von Walther Hensel über das Schönhengster Volkslied „Ich wollt, wenn‘s Kohlen schneit“ erarbeitet. Am Nachmittag kamen die einzelnen Gruppen wie Instrumental-
Gemeinschaftsstifter Musik
ginn der Singwochen 1923 bis heute sowie die Feierstunde anläßlich 100 Jahre Finkenstein 1923 bis 2023.
wegung“ in Wort und Bild, der viel Neues und Wissenswertes für die Anwesenden enthielt. Er sagte:
Gemeinschaft rezipierbar, also leicht verständlich sein müsse. Zwischen den einzelnen Beiträgen wurde viel gesungen und musiziert.
Werk -, und Handarbeitsgruppen zum Üben und kreativen Gestalten zusammen.
Dank der großen Anzahl der Instrumentalisten bildeten sich ein Streichquintett, eine Stubenmusik, eine große Blockflötengruppeund eine Tanzmusik aus Streichern, Blockflöten,Klarinette und Gitarre. Diese begleiteten oft den Chor in unterschiedlicher Besetzung sowie die Volkstänze beim Üben und Einstudieren.
Der große Höhepunkt der Woche war am Samstag die umfangreiche Ausstellung mit Bildern und Publikationen vom Be-
Herbert Preisenhammer begrüßte dazu die Sänger und Musikanten sowie die Ehrengäste Steffen Hörtler, Hausherr des Heiligenhofs, Andreas Wehrmeyer, Leiter des Sudetendeutschen Musikinstituts, SLBundeskulturreferent Ulf Broßmann, Andreas Schmalcz als Ver treter der Sudetendeutschen Heimatpflegeund Reinhold Frank, Vorsitzender, und Stefanie Falk, Stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SingTanz- und Spielkreise in BadenWürttemberg, die Grußworte sprachen. Auch ein Grußwort von Irene Kunc vom Begegnungszentrum Walther Hensel in Mährisch Trübau wurde vorgelesen. Zum Schluß begrüßte Herbert Preisenhammer den Musikwissenschaftler Wolfram Hader, Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wis senschaften und Künste.
Hader hielt den Festvortrag „Musikanschauung und Musikpraxis der Jugendmusikbe-
„Musik sollte nach Auffassung der Jugendmusikbewegung der Schaffung von Gemeinschaft dienen. Die gemeinschaftsstiftende Wirkung war für die Jugendmusikbewegung das entscheidende Qualitätskriterium für Musik.“
Als gemeinschaftsstiftend habe der Jugendmusikbewegung zum einen Musik gegolten, die in einer Zeit entstanden sei, in der es noch eine intakte „Volks-
gemeinschaft“ gegeben habe –als solche Zeiten seien Mittelalter, Renaissance und Barock angesehen worden. Musik müsse aber auch bei der Ausübung Gemeinschaft stiften: durch eine relative Gleichberechtigung der einzelnen Stimmen und die Einsicht des Einzelnen in den Sinn seiner Stimme im Satzgefüge. Weitere Kriterien für eine gemeinschaftsstiftende Musik seien für die Jugendmusikbewegung gewesen, daß ihre Ausübung auch durch Laien möglich sein müsse und daß sie von einer

Der nächste Höhepunkt war am Nachmittag die Einweihung der Walther-Hensel-Linde, die ihren Platz auf einer Wiese am Heiligenhof erhielt. Gerlind
Preisenhammer begann mit den Worten „Wir haben uns bei einem Baum versammelt, einer Linde, unserer Linde. Diese Linde ließen wir pflanzenim Gedenken an die allererste Singwoche, die Walther Hensel vor 100 Jahren in Finkenstein bei Mährisch Trübau durchführte.“
Ich sagte: „Du wächst fern der Heimat Walther Hensels in fremder Erde, und so soll diese Erde aus Mährisch Trübau, –dankenswerterweise von Frau Irene Kunc aus Mährisch Trübau geschickt – dir Gedeihen und Wachstum bringen. Dem Himmel wachs entgegen, Du Baum der Erde stolz. Ihr Wetter, Stürm‘ und Regen Verschont das heil’ge Holz.“
Am Nachmittag gab es Singen und Musizieren mit all den erarbeiteten Werken. Den Ausklang der Singwoche bildete ein lustiger Abend. Dabei wurde gesungen, musiziert, getanzt und vorgelesen. So ging diese Singwoche zu Ende, und der Abschied war schwer, doch die Aussicht auf die nächste Singwoche 2024 tröstete die Teilnehmer.
Helmut Preisenhammer

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 8
❯ 100 Jahre Finkensteiner Singen auf dem Heiligenhof gefeiert
Ausstellung der Werk- und Handarbeiten.
Chor mit Instrumenten bei der Feier.
Einweihung der Walther-Hensel-Linde.
Mineth-Volkstanz aus dem Kuhländchen.
Professor Dr. Ulf Broßmann, Andreas Schmalcz, Steffen Hörtler, Dr. Andreas Wehrmeyer und Herbert Preisenhammer
Dr. Wolfram Hader
❯ SL-Kreisgruppe Erlangen/Mittelfranken
Bürgermeister chauffiert Landsleute
Die mittelfränkische SL-Kreisgruppe Erlangen besuchte Eger und das Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz.
Mitglied Helga Burkhardt ist die Heimatkreisbetreuerin von Eger. Über Jahrzehnte betreute sie das dortige Begegnungszentrum (BGZ) und prägte als BdEG-Schatzmeisterin das Egerland-Kulturhaus mit. Davon profitierte nun die Kreisgruppe. Schon einen Monat zuvor hatten Burkhardt und Kreisobmann Christoph Lippert mit einem Vortrag und Videos auf die Fahrt eingestimmt. Und noch ein prominenter Egerländer war an Bord: Norbert Stumpf, Bürgermeister von Bubenreuth, bekennender Sudetendeutscher mit Wurzeln in Schönbach und begeisterter Hobby-Busfahrer, chauffierte die Landsleute höchstpersönlich.
Ernst Franke vom Bund der Deutschen Landschaft Egerland empfing die Gäste in Eger und berichtete von seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des BGZ, das sich insbesondere um die Deutschstämmigen bemüht, die der Vertreibung nach dem Krieg entgangen waren und noch in der Region leben. Franke führte die Gruppe auch kompetent durch die alte Reichsstadt, die nach dem Niedergang während des Kommunismus heute wieder in altem Glanz erstrahlt. Beson-

ders bewegend war der Besuch in der Stadtkirche Sankt Nikolaus. Burkhardt zeigte das Taufbecken, in dem sie die Heilige Taufe empfangen hatte. „Wenn ich die Augen schließe, sehe ich meine Mutter und meine Großeltern dort vorne in der Bank sit-
zen“, schilderte sie ihre Erinnerungen, die beim Besuch ihrer Heimatkirche wieder lebendig geworden waren. Nach einem böhmischen Mittagessen nahmen die Teilnehmer Kurs auf das zweite Ziel: das Egerland-Kulturhaus in Markt-
Der eindrucksvolle EgerlandBrunnen vor dem EgerlandKulturhaus ist der Schlußpunkt eines erlebnisreichen Tagesausflugs der Erlanger Sudetendeutschen nach Eger/ Cheb und Marktredwitz.

❯ SL-Kreisgruppe Städtedreieck-Burglengenfeld/Oberpfalz
redwitz. Dort führte sie Robert Grötschel durch die Dauerausstellung und erläuterte die Exponate. Die Sonderausstellung „Allerley kunststück. Reliefintarsien aus Eger“ hatte es den Besuchern besonders angetan. Vielen war diese außerordentliche Kunstfertigkeit Egerer Handwerker von vor dem Dreißigjährigen Krieg bisher nicht bekannt gewesen. Engagiert und liebevoll betreut wurden die Besucher aus Erlangen in dieser Ausstellung ausgerechnet von einer angeheirateten Nichte des Erlanger Alt-Oberbürgermeisters Dietmar Hahlweg.
Nach einem Halt im Museumscafé besuchte die Gruppe den Egerland-Brunnen. Den eindrucksvollen Brunnen finanzierte der BdEG ausschließlich aus Spenden und Zuwendunge, ein enormer Kraftakt, wie Burkhardt berichtete. Das Ergebnis war aber den Aufwand allemal wert, darin waren sich die Besucher einig. Dies ist ein Egerländer Monument, das auch den kommenden Generationen Zeugnis von Kultur und Schaffenskraft dieses Volksstammes sein wird.
In Bubenreuth entsteht gerade auf Norbert Stumpfs Initiative ein neues Kulturzentrum. Im Egerland-Kulturhaus gewann er wertvolle Anregungen, die nun seinem Projekt in Bubenreuth zugute kommen werden. ht
In der Falkenauer Heimatstube
Am letzten Julisonntag besuchte die oberpfälzische SL-Kreisgruppe Städtedreieck-Burglengenfeld auf Einladung von Wilhelm Dörfler die Falkenauer Heimatstube in Schwandorf.
Bereits 1954 wurde der Heimatverein gegründet, und 1963 gab es über 300 Falkenauer Mitglieder bundesweit. 1983 eröffnete Rudolf Götzel das Museum. Seit 2005 ist Wilhelm Dörfler im Museumsverein aktiv, kümmert sich um den Erwerb und Erhalt der 10 000 Exponate und führt die Besucher
durch die sorgfältig eingerichteten Räume.
Dörfler betonte, daß die Stadt Schwandorf dankenswerterweise alle Kosten für den Verein tra-
❯ SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken
ge. In Kürze werde das Museum Eigentum der Stadt, da es wahrscheinlich keinen nachfolgenden Falkenauer Verein mehr gebe.
Dörfler berichtete auch von dem Leidensweg seiner Familie. Der sei mit Zwangsarbeit von 1945 bis 1949 im Innern der Tschechoslowakei verbunden gewesen und habe erst dank der Vermittlung des Schweizer Roten Kreuzes zu einer Zuzugsgenehmigung nach Schwandorf geführt. Deshalb habe er vier Schuljahre versäumt.
Zu den Ausstellungsstücken gehörten das Modell eines Egerlän-
❯ SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld/Sachsen-Anhalt
Auch heuer fuhr eine siebenköpfige Delegation der sachsen-anhaltinischen SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld
Anfang Juli nach Deutschneudorf, Komotau und Kaaden. Gustav Reinert, langjähriger Obman der sachsen-anhaltinischen SL-Kreisgruppe Wittenberg, berichtet.
der Vierseithofs und der Pfarrkirche von Falkenau, außerdem ein Bild des Egerländer Blasmusikdirigenten Ernst Mosch. Dessen ursprüngliche, jetzt tschechische Heimatgemeinde Zwodau/Svatava trägt sich angeblich mit dem Gedanken, für ihren berühmten Sohn ein Denkmal zu errichten.


Die über 20 Gäste aus Burglengenfeld wurden nach den ausführlichen Erklärungen mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Mit einem Buch über den Kirchenmaler Maurus Fuchs bedankte sich Kreisobfrau Sigrid Ullwer bei Dörfler für den überaus informativen Nachmittag. Das nächste Bundestreffen der Falkenauer ist am 3. September in der Oberpfalzhalle in Schwandorf.
Solidarität, Hoffnung und Zuversicht
Zum Monatstreffen der mittelfränkischen SL-Ortsgruppe Rückersdorf kamen wieder viele Mitglieder in den Schmidtbauernhof.
Obfrau Bärbel Anclam bedauerte eingangs den Tod von sechs Mitgliedern, freute sich aber über vier neue Mitglieder.
Außerdem dankte sie ihrem Helferteam für seine stete und engagierte Arbeit. Anschließend überraschte sie alle mit Pfirsichbowle.
Danach stellten sich die Referenten Wolfram Bauer und Michael Geier vor. Bauer sei Erster und Geier Zweiter Vorsitzender der Tafel Nürnberger Land. Das seien sie bereits seit mehrere Jahren und wollten nächstes Jahr aufhören. Deshalb suchten sie Nachfolger. Der Vorstand bestehe aus acht Mitgliedern: zwei Vorsitzende, Schatzmeisterin, Schriftführer und Beisitzer sowie ein Jurist und die Beisitzerin für die Schülertafel. Ein Platz sei derzeit unbesetzt. Diese Tätigkeiten würden ehrenamtlich geleistet. Es gebe aber auch mehre-
re Festangestellte wie drei Fahrer – rüstige Rentner – und einen Lagerarbeiter sowie zwei Bürokräfte. Diese erhielten den Mindestlohn. Die Tafel Nürnberger Land sei 1999 entstanden und blicke 2024 auf 25 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Es gebe die neun Ausgabestellen Altdorf, Burgthann, Feucht, Hersbruck, Lauf, Röthenbach an der Pegnitz, Schnaittach, Schwaig und Schwarzenbruck. In Altdorf und Feucht würden zweimal pro Woche Lebensmittel ausgegeben, in Lauf einmal.
In Feucht sei das zentrale Warenlager beziehungsweise das zentrale Logistik-Verteilerzentrum. Hier würden die Lebensmittel gesammelt, sortiert und an die Ausgabestellen verteilt. Dies geschehe mit drei Kühltranspor-
tern, private Autos seien für Trokkenware wie Reis, Nudeln oder Toilettenpapier im Einsatz. Hygiene werde ganz großgeschrieben, denn das Gesundheitsamt prüfe unangemeldet.
Lebenshaltungskosten und Inflation stiegen stetig, Strom und Energie würden immer teurer. Gleichzeitig brauchten immer mehr Menschen die Hilfe der Tafeln. Deshalb seien sie auf immer mehr Geld- und Naturalienspenden angewiesen. Der Tafelkunde brauche eine Bescheinigung zum Bezug der Lebensmittel und zahle dafür drei Euro.
Wenn etwas übrig bleibe, werde das an „Foodsharer“ oder übriges Brot und Brötchen an Schweinebauern gegeben. Die Tafel sei ein zertifizierter Betrieb. Sie sei ein eingetragener Verein und damit selbständig. Momen-
tan versorge die Tafel Nürnberger Land rund 4500 Menschen mit bezahlbarem Essen.
2007 sei in Zusammenarbeit mit der Georg-Kurlbaum-Stiftung die Schülertafel gegründet worden. Die Schülertafel unterstütze zum Beispiel bedürftige Schüler. Sie biete ein Frühstück in der Schule an, gewähre Zuschüsse für einen Aufenthalt im Schullandheim und so weiter.
Am Ende des interessanten und aufschlußreichen Vortrages waren die Zuhörer nachdenklich geworden. Bärbel Anclam dankte Bauer und Geyer mit je einer Flasche Wein und einer Spende der SL. Und manch einer wurde Mitglied der Tafel. Aber alle wissen jetzt, daß die Tafel für Solidarität und Hoffnung und Zuversicht steht.
Die SL-Ortsgruppe Rückersdorf lädt zum Weinfest am 6. September um 14.30 Uhr auf den Schmidtbauernhof ein. Anmeldung: Telefon (09 11) 57 63 76, Mobil (01 74) 1 67 50 96, eMail otmar.anclam@gmx.de Gabi Waade
Die Fahrt führte über Freiberg ins Erzgebirge. In der Baude auf dem Schwartenberg aßen wir zu Mittag. Danach ging es hinunter nach Deutschneudorf. Vor dem dortigen Gedenkstein fand das jährliche Gedenken an den Todesmarsch am 9. Juni 1945 der deutschen Männer aus Komotau nach Deutschneudorf und wieder zurück statt.
Zuvor hatte Kreisobfrau Anni Wischner eine Blumenschale der Kreisgruppe vor den Gedenkstein gestellt. Reden hielten der Bürgermeister von Deutschneudorf, ein Vertreter des Landkreises und der CDU, die Komotauer Heimatkreisbetreuerin Hedwig Gemmrig sowie die ehemalige Ortspfarrerin. In der Gedenkrede wurden die unmenschlichen Beneš-Dekrete gerügt, die eine solche Tat zugelassen und heute noch Bestand hätten. Der Anton-Günther-Chor aus Seifen begleitete das Gedenken musikalisch.

Beim Kaffeetrinken in Deutscheinsiedel wurden bei angenehmen Unterhaltungen unterschiedliche Meinungen ausgetauscht, vor allem wenn es sich um Politik und „Ossis“ oder „Wessis“ handelte. Anschließend ging es nach Komotau ins Quartier im Hotel Zu den zwei Bären. Bei einem abendlichen Spaziergang zeigte Anni Wischner ihr einstiges Elternhaus.
Am Sonntag ging es zuerst auf den Komotauer Friedhof zur Gedenkstätte für die hier vor der Vertreibung bestatteten Deutschen. Auch hier wurde eine Blumenschale niedergestellt. Anschließend wurde der Friedhof besichtigt. Traditionell ging die Fahrt anschließend nach Platten, wo uns immer eine gute Suppe und ein ausgezeichnetes Schnitzel serviert werden und ein gepfleg-


tes Bier das Ganze veredelt. In Quinau besuchten wir die renovierte Wahlfahrtskirche. Danach wollten wir in dem uns bekannten Waldhotel Partisan Kaffee trinken, doch das hatte seine Existenz aufgegeben. So fuhren wir in das Grundtal mit seinen drei ehemaligen Brettmühlen, die jetzt Gasthäuser sind. In der ersten Mühle, der einzigen offenen, kehrten wir zu Kaffee und Eis ein. Anschließend fuhren wir talaufwärts zum nächsten Parkplatz und wanderten bergaufwärts zur 1,2 Kilometer entfernten Krimaer Talsperre und zurück. Trotz der Hitze machten alle mit. Den Anstrengungen des Tages folgten nur noch die Einkehr in unserem Hotel und Nachtruhe.
Am letzten Tag, fuhren wir nach Kaaden auf den Friedhof. Auch vor die Gedenkmauer für die am 4. März 1919 vom tschechischen Militär erschossenen Deutschen stellte Anni Wischner eine Blumenschale. Damit erwiesen wir den Menschen, die für die Rechte der Deutschen in der neu gegründeten Tschechoslowakei auf die Straße gegangen waren und dabei ihr Leben hatten lassen müssen, unsere Ehre. Auch an den anderen Gedenkmauern, die an die einstigen Kaadener Deutschen erinnern, die im Krieg irgendwo den Tod fanden, wurde ein stilles Gedenken erbracht. Ebenfalls für die Opfer von 1945 stellten wir eine Schale zum Gedenken ab. Damit war die letzte Aufgabe dieser Fahrt erfüllt. Da wir auf der Heimfahrt die Kerzenwelt in Kühberg besuchen wollten, wählten wir den kürzesten Weg über den Grenzübergang Weipert. In der Grenzstadt Weipert konnten wir im Duty-free -shop einkaufen und in der Gaststätte zu Mittag essen. Danach ging es hier über die Grenze nach Kühberg in die Kerzenwelt und zurück nach Bitterfeld.
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 9
Bild: Simon Schuster
Modell eines Egerländer Vierseithofs. Bild: Josef Paul
Die Bitterfelder Delegation mit Gustav Reinert und Anni Wischner sowie ihre Blumenschale am Gedenkstein in Deutschneudorf.
Wolfram Bauer und Michael Geier.
Gustav Reinert und Anni Wischner auf dem Kaadener Friedhof vor der Gedenktafel für die Opfer des 4. März 1919.
Bitterfelder Blumen auf dem Komotauer Friedhof.
Landsleute auf Gedenkfahrt
Franz Longin MdL a. D., Manfred Zaiß, Christoph Zalder, Waltraud Illner, Peter Sliwka, Dr. Karin Eckert, Christoph de Vries MdB, Alt-Stadträtin Bärbel Häring, Stadträtin Iris Ripsam MdB a. D., Konrad Epple MdL und Adolf Klohs. Bilder: Helmut Heisig
� UdVF-Landesgruppe Baden-Württemberg
Charta-Feier im Schloßhof
Mit einer Feier erinnert die UdVF-Landesgruppe BadenWürttemberg alljährlich an die Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen am 5. August 1950 in Stuttgart. Zu diesem Gedenken waren auch heuer zahlreiche Gäste zur Gedenktafel vor dem Ehrenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart gekommen.
Unter den Gästen begrüßte die UdVF-Landes- und Kreisvorsitzende Iris Ripsam
Konrad Epple MdL, den Stellvertretenden OMV-Bundesvorsitzenden Christoph Zalder und Alt-Stadträtin Bärbel Häring. Aber auch Franz Longin, der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, und Ernst Gierlich, der Vorsitzende der Kulturstiftung der Vertriebenen, waren gekommen. Festredner war Christoph de Vries MdB, Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutsche Minderheiten der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag. Die Bläsergruppe Feuerbach umrahmte die Feier musikalisch.
Iris Ripsam ist die Initiatorin der alljährlichen Feierstunde auf dem Stuttgarter Schloßplatz. Sie und ihr Sohn Fabian erinnerten in ihrer Begrüßung an die Unterzeichnung der Charta vor 73 Jahren, mit der die Heimatvertriebenen ein Zeichen der Versöhnung, des Friedens und der Zukunft gesetzt hätten.
Christoph de Vries würdigte den 73. Jahrestag der Charta-Unterzeichnung. Er sagte, der 5. August solle ein Datum sein, das nicht nur im kollektiven Gedächtnis der Heimatvertriebenen, sondern des ganzen deutschen Volkes verankert sei. Die Charta gehöre zu den grundlegenden politischen Dokumenten des Nachkriegsdeutschlands und habe das Selbstverständnis und Handeln der deutschen Heimatvertriebenen wie kein zweites Dokument geprägt.
Dabei lobte der Hamburger Christdemokrat, dessen Mutter und ihre Familie 1945 in Heidelberg eine neue
Heimat gefunden hatten, den Weitblick, den die Heimatvertriebenen schon damals mit der Verkündung der Charta besessen hätten. Sie hätten sich neben dem Verzicht auf Rache und Vergeltung vor allem für ein freies und geeintes Europa sowie für die Beteiligung am Wiederaufbau Deutschlands und Europas ausgesprochen. Und wovon die Verfasser der Charta 1950 nur zu träumen gewagt hätten, sei in Erfüllung gegangen. Die Mauer sei gefallen, in Mittel- und Osteuropa hätten friedliche Revolu-
� Ackermann-Gemeinde und Sdružení Ackermann-Gemeinde
Deutsch-tschechisches Picknick
Zwar kein Weltrekord, aber der längste deutsch-tschechische Picknick-Tisch gelang beim deutsch-tschechischen Picknick Anfang August in Taus/ Domažlice. Diese Aktion war der Aufmacher der von der Ackermann-Gemeinde (AG) und ihrer tschechischen Partnerorganisation Sdružení Ackermann-Gemeinde organisierten Veranstaltung. Denn neben diesem geselligen Aspekt gab es von Mittag bis zum Spätnachmittag mehrere Gespräche über deutschtschechische Themen sowie kulturelle Beiträge.

tionen stattgefunden, und die EU habe sich nach Osten erweitert.
Christoph de Vries lobte den Aufbauwillen und die Integrationskraft der Vertriebenen, die man sich heute von manchen Zuwanderergruppen, die Zuflucht in Deutschland suchten, wünsche. Die Vertriebenen seien Leistungsträger der deutschen Nachkriegszeit gewesen und hätten tatkräftig und verdienstvoll am Aufbau der Demokratie, der freiheitlichen Gesellschaft und der größten Volkswirtschaft in Europa mitgewirkt. Auch lobte er die tätige und verantwortliche Mitwirkung der Vertriebenenverbände, ohne die eine Eingliederung der Vertriebenen in dieser Form nicht gelungen wäre.
An dieser Stelle hob der Christdemokrat hervor, daß es schon immer die Union gewesen sei, die sich für die Bewahrung und Pflege des geschichtlichen und kulturellen Erbes der Deutschen in Mittelund Osteuropa eingesetzt habe. Nur die CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe seit 1949 eine Arbeitsgruppe, die sich allein mit den Anliegen der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten beschäftige und deren Vorsitzender er seit Beginn der 20. Legislaturperiode sei. Dabei erwähnte de Vries auch die erheblichen Haushaltskürzungen der Bundesregierung bei den Hilfen für die deutschen Minderheiten in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa und bei den Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa, die von der CDU/CSUBundestagsfraktion in aller Deutlichkeit verurteilt würden. „Die deutschen Minderheiten dürfen nicht im Stich gelassen werden. Deshalb werden wir dafür kämpfen, daß es bei der Unterstützung keine finanziellen Abstriche gibt.“ Es bleibe eine wichtige Aufgabe, das kulturelle Erbe des ehemaligen deutschen Ostens und der Heimatvertriebenen für die Zukunft zu sichern.
Franz Longin, der mit seinem Vater die Verkündung der Charta vor dem Neuen Schloß in Stuttgart erlebt hatte, zog in seinem Schlußwort eine persönliche Bilanz. Er sagte, daß er nicht nur allein auf die Erklärung und den Wertegehalt des Bekenntnisses der deutschen Heimatvertriebenen stolz sei. Er appellierte an die Zuhörerschaft, auch über die Vertreibung und die Charta zu sprechen, deren Geist und Würde das heutige vom Ukraine-Krieg gezeichnete Europa mehr als nötig habe.
Helmut Heisig
Petrus meinte es zunächst nicht ganz so gut. Zwar versuchten die Moderatoren Philipp Schenker und Roman Horák auf der Bühne, den Regen etwas wegzuplaudern. Doch die Grußworte zur Eröffnung waren von Regentropfen begleitet. „Ich bin fest überzeugt, daß das nette und schöne Treffen vom Wetter nicht gestört wird“, sagte der Tauser Bürgermeister Stanislav Antoš. Er habe viel über die AckermannGemeinde gehört: „Gute Herzen helfen verletzten Herzen“.
Dies sei vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg spürbar gewesen, als auf tschechischem Boden Unfreiheit geherrscht habe.
Dieses Gute im Herzen gelte gerade jetzt, wo in Europa ein Krieg herrsche. „Das Knowhow der Akkermann-Gemeinde brauchen wir, vor allem in Osteuropa mit vielen Verletzten und verletzten Herzen“, blickte Antoš auf die Ukraine. Er dankte der Akkermann-Gemeinde für die langjährige Arbeit und den Einsatz für Deutschland und Tschechien sowie deren Menschen.
Der Tauser Seelsorger Pfarrer Mirosław Gierga kommt aus Schlesien, ist aber schon lange in Taus. „Das Zusammenleben der drei Nationen Polen, Deutsche und Tschechen habe ich im Blut. Wie das Zusammenleben künftig von Ukrainern und Russen aussehen könnte, das sehen wir hier“, gab er einen überaus optimistischen Ausblick in die Zukunft.
Sogar Staatspräsident Petr Pavel hatte ein Grußwort geschickt, das AG-Bundesvorsitzender Albert-Peter Rethmann vorlas und mit viel Beifall quittiert wurde. Für die tschechische Regierung war Martin Dvořák, Minister für europäische Angelegenheiten, gekommen. Auch er dankte der Ackermann-Gemeinde für die Arbeit, „damit Nationen und Länder sich näherkommen“. Aus seiner Familiengeschichte sei ihm die Vertreibung bekannt, und er habe erlebt, wie die damaligen Außenminister Jiří Dienstbier und Hans-Dietrich Genscher kurz vor Weihnachten 1989 den trennenden Stacheldraht zwischen den beiden Ländern durchgeschnitten hätten. Als Europaminister wolle er die Basis dafür schaffen, daß die Konflikte in Europa nicht durch Krieg, sondern durch Verhandlungen und Gespräche gelöst würden. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine meinte Dvořák: „Wir wünschen beiden Seiten, daß sie einmal auch in eine Zeit kommen und mit einem langen PicknickTisch und gemeinsam feiern.“ Vor allem die Einigkeit Europas sei ein wichtiges Signal Richtung Wladimir Putin und Rußland.
Nach diesen Begrüßungsreden gab Tomáš Hrábek von der Rekord-Agentur „Dobrý Den“ den Startschuß für den Rekordversuch. Um 12.36 Uhr verkündete er das Ergebnis: 387 Deutsche und Tschechen hatten sich an der über 100 Meter langen Tafel am unteren Teil des Stadtplatzes zum Picknick eingefunden. Das bedeutet einen Eintrag in das tschechische Rekordbuch. Nachdem sich die PicknickGäste gestärkt hatten und das Wetter etwas besser geworden war, begann die erste Gesprächsrunde über „Partnerschaften und politische grenzüberschreitende Arbeit“. Unter anderem pflegt Waldmünchen eine Städtepartnerschaft mit Klentsch. „Selbstverständlich sind gegenseitige Besuche. Ich genieße die Gespräche mit den Kollegen und bin gerne bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, um die Partnerschaft voranzubringen“, stellte Waldmünchens Bürgermeister Markus Ackermann fest. Wichtig für ihn wäre eine Institutionalisierung der Kontakte zwischen Einrichtungen, die sich auf diesem Feld engagieren.
Mit Blick auf die Vertreibung der Deutschen und den vier Jahrzehnte währenden Eisernen Vor-
schaften und außerschulischem Jugendaustausch“. Kamila Novotná, Projektmitarbeiterin beim Münchener Diözesanverband der Ackermann-Gemeinde, schilderte den Weg zum ersten Tschechisch-Abitur in Bayern. Ausschlaggebend sei ihre Tochter gewesen, die diesen Wunsch gehabt habe. Daher habe sie sich dafür eingesetzt, Tschechisch als Abiturfach zu fördern. Dafür hätten eine Lehrkraft und genügend Interessenten gefunden werden müssen. Letztlich habe es eine Ausnahmeregelung gegeben, so daß in München dieses Projekt für acht Schüler bewilligt worden sei, die im Frühsommer erstmals Abitur in Tschechisch als Fremdsprache abgelegt hätten.

Thomas Scheubeck unterrichtet am Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham Tschechisch als Wahlfach. „Die Schüler dafür zu motivieren ist ein sehr hartes Geschäft“, sagte er. „Tschechisch müßte man als ganz normales Fach institutionalisieren“, forderte der Gymnasiallehrer, der sich aber nicht entmutigen lassen will.
Die Bedeutung von Kultur, Kunst und Musik beim deutschtschechischen Austausch von Kindern und Jugendlichen be-
fest. „Die Zusammenarbeit könnte aber noch mehr sein. Bayern und Tschechen verbindet so viel, daß man auch weiter entfernt noch Interesse an einer Zusammenarbeit haben könnte.“ Basis sei jedoch die Überwindung der Sprachbarriere.
hang freute sich Franz Former, Dritter Bürgermeister von Furth im Wald, das eine Städtepartnerschaft mit Taus hat, daß sich die Beziehungen normalisiert hätten: „Die Menschen beiderseits der Grenze können wieder aufeinander zugehen.“ Auch die Möglichkeit, sich auf allen Ebenen vom Kindergarten und der Schule bis zur Polizei und Feuerwehr treffen zu können, biete die Chance, in Friede und Freundschaft miteinander zu leben.
Rudolf Špoták, der in Taus lebende Hauptmann des Pilsner Kreises, verwies auf mehrere Partner in Deutschland, am stärksten sei aber die Kooperation mit der Oberpfalz. „Die Partnerschaft ist auf einem sehr guten Weg, beide Regionen bringen sich stark ein.“ Miteinander packe man Themen wie Digitalisierung oder Ökologie an. Eine zentrale Aufgabe sei die Verbesserung der Bahnverbindung zwischen Prag und München.
Florian Luderschmid, Regierungsvizepräsident der Oberpfalz und ab September Regierungspräsident von Oberfranken, nannte weitere Wirtschaftsthemen wie Arbeits- oder Fachkräftemangel und die enge Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im grenznahen Raum. „Nur so funktioniert das Zusammenwachsen.“ Aber auch gesellige und kulturelle Veranstaltungen wie das Picknick seien wichtig.

Die zweite Gesprächsrunde – sogar mit fünf Teilnehmern – widmete sich „Schulpartner-
tonte Josef Kuneš, Direktor der Jindřich-Kunstschule in Taus. „Diese Aspekte sollten immer einbezogen werden, auch tänzerisch-dramatische Elemente. Kulturschaffen, gemeinschaftliche Aktionen verbinden“, vertiefte Kuneš. Die Stellung von Tandem, des Koordinierungszentrums für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch, beschrieb Lucie Tarabová, TandemLeiterin in Pilsen. Neben den von Kuneš genannten Punkten verwies sie auf den Sport, alle Betätigungen seien bei Tandem gefragt – vor allem die Nutzung beider Sprachen. Über die Sprachen hinaus versteht die Junge Aktion der AG ihr Wirken und ihre Angebote. Für deren Bundessprecherin Theresia Bode heißt das, „sich gegenseitig zu verstehen, Verständnis für den anderen und dessen Kultur zu gewinnen – letztlich Räume zu schaffen, wo die Sprache keine Rolle spielt.“
Die dritte Gesprächsrunde bestritten Akteure, die grenzüberschreitend tätig sind. Der freie Journalist Karl Reitmeier aus Furth im Wald stellte bedauernd fest, daß in Zeitungen die Berichterstattung über grenzüberschreitende Aktionen seit der Corona-Pandemie etwas rückläufig sei, man aber im Internet und über das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) gut informiert werde. Die CeBB-Leiterin Veronika Hofinger stellte zwar positive Entwicklungen unmittelbar beiderseits der Grenze mit Schulund Gemeindepartnerschaften
Die Bedeutung der Erinnerungskultur und der gemeinsamen Geschichte von Deutschen und Tschechen hob Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein, hervor. Diese Faktoren hätten sich in den letzten 20 Jahren gut entwickelt. Die lokale und regionale Geschichte nahm sich das Projekt Hindle vor, worüber Projektkoordinatorin Kristýna Pinkrová berichtete. Dahinter steht der Verein „Das Chodenland lebt“ und wendet sich vor allem an Kinder und Jugendliche mit Vorträgen, Exkursionen, Forschungsprojekten, also mit einem praktischen Geschichtsunterricht. Klar und deutlich für sehr einfache Formate des miteinander Zusammenkommens sprach sich Pablo Schindelmann, Geschäftsführer der kürzlich zu Ende gegangenen Freundschaftswochen Selb 2023, aus. „Jede Seite wird von verschiedenen Medien informiert. Daher brauchen wir niederschwellige Angebote.“ Er schlug vor, grenzüberschreitende Aktivitäten auf Ebene der Euregio fortzusetzen. Zwischen den Grußworten und den Gesprächsrunden gab es musikalische und kulturelle Beiträge. So spielte die heimische Gruppe „Konrádyho dudácká muzika“ zünftig auf, ebenso die Volksmusikgruppe des Rohrer Sommers. Eine Premiere gab es auf dem literarischen Segment: die tschechischen Texte des Poetry Slamers Miloslav Antoš trug Roman Horák in deutsche Vers- und Reimform übertragen vor. Das grenzüberschreitende Theaternetzwerk für Jugendliche Čojč klärte über sprachliche Parallelen auf, und zum Tanzen animierte schließlich die Volkstanzgruppe des Rohrer Sommers. Nicht fehlen durfte in Taus das für diese Stadt und das Chodenland bekannte Lied „Žádnej neví co sou Domažlice“ oder „Koana woaß des, wos is Domaschlitze“, diesmal mit einem neuen, auf die Akkermann-Gemeinde abgestimmten Text von Christoph Mauerer, der gleichermaßen bei der Ackermann-Gemeinde wie auch bei der Sdružení Ackermann-Gemeinde aktiv ist. Er selbst ließ es sich nicht nehmen, als Stimmführer zu agieren. Die Gruppe „Konrádyho dudácká muzika“ und das Volksmusikensemble des Rohrer Sommers begleiteten klangvoll. Ein wunderbarer Tag sei dieses Picknick gewesen, stellte zum Schluß Albert-Peter Rethmann in seinen Dankesworten fest. Er sprach allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht hatten, großen Dank aus. Daß hier einfach Freundschaft gilt, sei deutlich zu spüren gewesen.
In Taus konnten auch die Ausstellungen „Achtung, Grenze!“ und „Verblichen, aber nicht verschwunden“ besichtigt werden. Teilnehmer des Rohrer Sommers präsentierten darüber hinaus das Schattentheater „Feuervogel“ und ein klassisches Konzert. Markus Bauer
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 10
Der mehr 100 Meter langen Picknick-Tisch auf dem Tauser Stadtplatz. Bild: Markus Bauer
Gedenkredner Christoph de Vries MdB.
Zu Gast in Bayreuth
Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) vertiefen ihre Zusammenarbeit.
Das ist das Ergebnis eines Arbeitsgespräches, das VLÖPräsident Norbert Kapeller mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrates der Stiftung Verbundenheit, Hartmut Koschyk, und dem Geschäftsführer der Stiftung, Sebastian Machnitzke, am Sitz der Stiftung im oberfränkischen Bayreuth führte. Der VLÖ vertritt die Heimatvertriebenen in Österreich und unterstützt die deutschen altösterreichischen Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa. Dies ist auch der Anknüpfungspunkt für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Stiftung und VLÖ.

Koschyk und Machnitzke informierten Kapeller über die Mittlertätigkeit der Stiftung für das Bundesministerium für Heimat für die deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa und den GUS-Staaten. Ein Schwerpunkt war die Lage der deutschen Minderheit in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges sowie die humanitären und kulturellen Aktivitäten der Stiftung in der ukrainischen Region Transkarpatien, die bis zum Ende der Donaumonarchie zu Österreich gehört hatte. Auch die Lage der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien, die nicht als vollwertige nationale Minderheit anerkannt ist, wurde erörtert.
Kapeller und Koschyk vereinbarten, mögliche Tätigkeitsfelder der Zusammenarbeit zu erarbeiten. Der Gedankenaustausch zwischen VLÖ und Stiftung soll in naher Zukunft bei einem Arbeitsgespräch am VLÖ-Sitz in Wien fortgeführt werden.
� Sing- und Spielschar der DBB-Heimatgruppe Ellwangen/Baden-Württemberg

58. Europeade in Gotha
Eine einzigartige Mischung aus Musik, Tanz, Trachten und internationaler Freundschaft erfüllte Mitte Juli die thüringische Stadt Gotha bei der 58. Europeade, dem größten europäischen Festival der Volkskunst. Unter dem Motto „Einheit in Vielfalt“ waren rund 5000 ehrenamtlich engagierte Menschen aus 23 europäischen Nationen gekommen, um die reiche Vielfalt der Volkskulturen des Kontinents zu feiern. Mittendrin war die 40köpfige Sing- und Spielschar der baden-württembergischen DBB-Heimatgruppe Ellwangen.
Die 26jährige Stefanie Januschko dirigierte den 20köpfigen Chor der Gruppe beim internationalen Chorabend. Sie beschrieb die Erfahrung als herausfordernd und dennoch bereichernd: „Es war schon schön, auf so einer großen Bühne den Chor zu leiten. Die vorherige Anspannung war natürlich auch groß.“
Der Chor sang traditionelle Lieder in Böhmerwäldler Mundart wie „D‘ Woaf“, „Hoamaterd“, „Da Weig zu mein Dianderl“ und „Feierobnd“ .
Die Tanzleitung lag bei Dorothea Hägele und Sophie Grill. Sie hatten die Teilnehmer auf die Auftritte vorbereitet. Das bunte Bild der Gruppe wurde verstärkt, weil Trachten aus dem Böhmerwald, Baden-Württemberg und dem Schönhengstgau getragen wurden – je nachdem, woher die Vorfahren der Tänzer kamen.
Felicitas Nader, 14 Jahre alt und zum ersten Mal bei einer Europeade dabei, war begeistert von der Atmosphäre. „Die Stimmung bei den Auftritten war super. Sehr gut hat mir gefallen, daß ich so viel mit den Menschen aus anderen Städten und Ländern in Kontakt gekommen bin.“
Claudia Beikircher, Vorsitzende der Sing- und Spielschar, betonte den einzigartigen Charakter der Europeade. „Wenn 184 Folkloregruppen aus ganz Europa zusammenkommen, dann ist der Geist Europas zu spüren. Jede Gruppe hat ganz individuelle Trachten, und genau das macht den Reiz der Europeade aus: Einheit in Vielfalt.“ Und auch die Ellwanger Gruppe sei
wort die Bedeutung der Völkerverständigung und der europäischen Freundschaften, die im Mittelpunkt der Europeade stünden.
Bis 2023 war die Europade in fünfzehn Ländern Europas zu Gast: elfmal in Belgien, siebenmal in Frankreich und Italien, achtmal in Deutschland, sechsmal in Spanien, je dreimal in Portugal, Dänemark und der Schweiz, zweimal in Österreich und Litauen und einmal in Finnland, Polen, Schweden, Estland und Lettland.
Stephanie Kocher dirigiert die „Missa Sancti Stephani“.
� Ackermann-Gemeinde
32. Rohrer Sommer
ein Schmelztiegel. „Viele Auswärtige aus Baunach, Nürtingen, Stuttgart und München verstärken Chor und Tanzgruppe“, sagte Beikircher.
Die Eröffnung fand in der malerischen Altstadt Gothas statt, wo Ministerpräsident Bodo Ramelow und die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach mit dem bezaubernden Konzert „Tanzen möcht ich“ für einen stimmungsvollen Auftakt sorgten. Rüdiger Heß, Präsident des Internationalen Europeade-Komitees, betonte in seinem Gruß-


„Auf dem Kontinent Europa gibt es seit sechzig Jahren mit der Europeade eine große Kulturbewegung. Sie ist jedes Jahr von Neuem das bedeutendste Festival europäischer Volkskultur und das bedarf der Anerkennung, Förderung und Wertschätzung der Europäischen Institutionen“, sagte Knut Kreuch als Oberbürgermeister der Stadt Gotha, Präsident des deutschen Trachtenverbandes und Landesvorsitzender des Thüringer Landestrachtenverbandes über die Veranstaltung.
Die Tage in Thüringen waren gefüllt mit Konzerten, Tänzen, Chören und Paraden, die die kulturelle Vielfalt Europas eindrucksvoll dokumentierten. Gotha, zum zweiten Mal nach 2013 Gastgeber der Europeade, strahlte in bunten Farben der Vielfalt und Einheit Europas. Die Europeade 2023 war zweifellos eine Hommage an das kulturelle Erbe Europas und ein Fest der Freundschaft über Grenzen hinweg.
Knapp 100 Deutsche und Tschechen aller Altersstufen nahmen vom 30. Juli bis 6. August am 32. Rohrer Sommer der Akkermann-Gemeinde teil. In den letzten Jahren ist diese traditionelle Veranstaltung auch als Deutsch-tschechische Kultur- und Begegnungswoche bekannt geworden. Die Benediktiner-Abtei Braunau im Kloster Rohr in Niederbayern war eine Woche lang erfüllt von musikalischem und kulturellem Schaffen. Höhepunkt war das Konzert in der Asamkirche mit Aufführung der einstudierten musikalischen Werke.
Neben dem Konzert gab es heuer einen weiteren Schwerpunkt. Am 5. August fand in Taus/Domažlice ein von der Ackermann-Gemeinde organisiertes deutschtschechisches Picknick statt (Ý Seite 10). Dieses bereicherten Gruppen des Rohrer Sommers zum einen mit Beiträgen, zum anderen ging es in einzelnen Arbeitskreisen auch um die Kultur der Choden, der dort beheimateten Volksgruppe.
geht darum, die gemeinsame Kultur aus der gemeinsamen Heimat weiter zu pflegen. Das tun wir beim Rohrer Sommer“, bekräftigten die Moderatoren. Besonders wiesen sie auf nicht alltägliche Instrumente im ersten Beitrag hin, der Michael Haydn zugeschriebenen „Kindersinfonie“, die unter der Leitung von Zdeněk Talácko das Jugendorchester des Rohrer Sommers spielte.
Linderöds Folkdanslag aus Schweden, die Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler aus Ellwangen und die Gruppo Folk Santu Franziscu aus Sardinien.

Bilder: Rainer Grill
Orgelfahrt nach Südböhmen
So beschäftigten sich die literarischen Arbeitsgruppen unter Anna Císlerová und Kristýna Kraus mit Märchen oder Schriftstellern und Autoren von dort. Um Musik und Tanz der Choden ging es auch in den von Paul und Ines Barth geleiteten Arbeitskreisen Volksmusik und Volkstanz, wobei auch Inhalte anderer Regionen zur Geltung kamen. Jutta Boehms Puppenspiel-Arbeitskreis studierte das Schattentheater „Feuervogel“ ein, das im Kulturzentrum Brauerei Taus aufgeführt wurde. Der religiöse Arbeitskreis kümmerte sich um die Beiträge beim Gottesdienst in Taus, und im Arbeitskreis „Holzarbeiten“ konnten die Mädchen und Buben ab vier Jahren unter anderem verschiedene Spiele oder auch Vogelhäuschen unter der Anleitung von Pavel Kučerka basteln. Beim Kreativen Gestalten unter Markéta Hirschlová wurden Stoffe bedruckt, Steine bemalt und mit Draht und Keramik allerlei geschaffen. Außerdem wurden die Körbe geflochten, in denen die Speisen und Getränke für das Picknick Platz fanden.
Bewährte Sopran-Solistinnen sind inzwischen Hildegunt Kirschner und Anna Kocher, die – am Klavier begleitet von Irina Ullmann – Felix Mendelssohn-Bartholdys „Ich harrete des Herrn“ sangen. Die „Triosonate Opus 3 Nr. 1 in EsDur“ des aus Mähren stammenden Franz-Xaver Richter spielten Johanna Boehm (Barock-Oboe), Stephanie Kocher (Barock-Viola), Simon Ullmann (Cello) und Irina Ullmann (Cembalo). Nicht alltäglich in der Besetzung –Hackbrett (Anna Kocher) und Continuo (Stephanie Kocher) – war die „Gambensonate in h-moll RV 35“ von Antonio Vivaldi. Das von Johanna Boehm geleitete Blockflötenensemble spielte das aus dem Flämischen stammende Stück „Rompeltier“. Die Höhepunkte kamen wie gewöhnlich zum Schluß: Die „Sinfonia in A-Dur“ des böhmischen Komponisten Franz Xaver Dussek, gespielt vom Orchester des Rohrer Sommers unter der Leitung von Simon Ullmann, und die „Missa Sancti Stephani“ von František Ignác Tůma, die der Chor des Rohrer Sommers unter dem Dirigat von Stephanie Kocher aufführte.
Sechs Tage lang war die Akkermann-Gemeinde der Diözese Bamberg in Südböhmen unterwegs, um die dortige OrgelLandschaft zu erkunden, aber auch um Kultur und Landschaft dieser herrlichen Region kennenzulernen.

Hier bin ich vor 80 Jahren zu meiner Erstkommunion in die Kirche eingezogen“, rief Annemarie Stretz vor der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Gojau. Die Station in ihrer Heimatgemeinde war für die 87jährige der Anlaß zur Teilnahme an der Orgelfahrt, zu der die
Bamberger Ackermann-Gemeinde und die Katholische Erwachsenenbildung eingeladen hatten. Diözesanvorsitzende Ursula
Lippert freute sich über die zahlreichen Teilnehmer. Darunter waren Böhmenfans mit und ohne Wurzeln im Nachbarland sowie Musik- und Orgel-Liebhaber.
„Damit hat sich der Aufwand gelohnt, den Orgel-Experte Professor Ulrich Theißen Pibernik und Reiseleiter Hermann Proksch geleistet haben.“ Das Ergebnis der akribischen Vorarbeiten und Absprachen war überwältigend. Die Reisegruppe gewann einen umfassenden Eindruck
von der grandiosen Kulturlandschaft Südböhmen. Theißen Pibernik präsentierte mit Unterstützung des Fürther Organisten Matthias Hofknecht 15 Orgeln unterschiedlicher Größe aus fünf Jahrhunderten mit technischen Erläuterungen und kleinen Konzerten in zwölf Kirchen in neun Städten und Klöstern.
Allein die Fahrten vom Quartier in Budweis kreuz und quer durch herrliche Landschaft mit pittoresken Orten waren ein Erlebnis. In kulturellen Zentren wie Budweis und Krummau wurden Stadtführungen angeboten. In anderen Städten blieb genügend
Zeit, um die Umgebung selbständig zu erkunden. Auch die böhmische Küche und das berühmte Budweiser Bier wurden gebührend gewürdigt.
Für den Abschluß der Fahrt hatte sich Theißen ein besonderes Schmankerl ausgedacht: der Rückweg führte durch das Obere Mühlviertel in Österreich mit Station in der PrämonstratenserAbtei Schlägl. Die Besichtigung und Vorführung der Orgeln in der prachtvollen Stiftskirche setzte einen würdigen Schlußpunkt für eine Reise, die unvergeßliche Erlebnisse beschert hatte. Christoph Lippert
In der Rohrer Kirche hießen Kai Kocher und Kristýna Kraus die Zuhörer willkommen und stellten die seit gut 40 Jahren bestehende Veranstaltung und die 1946 gegründete Akkermann-Gemeinde vor. „Es

Auszüge dieses Konzerts gab es am Tag darauf in Taus anläßlich des deutsch-tschechischen Picknicks im Refektorium der Jindřich-Kunstschule.
Markus Bauer
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 11 � VLÖ
Sebastian Machnitzke, Norbert Kapeller und Hartmut Koschyk.
Blockflötenensemble unter Leitung
Bilder:
Bauer
Hildegunt Kirschner und Anna Kocher singen „Ich harrete des Herrn“.
Das
von Johanna Boehm.
Markus
� Ackermann-Gemeinde in der Diözese Bamberg
Die Bamberger Ackerleute auf Orgelfahrt.
Bild: Günther Sieber
Chorabend mit Dirigentin Stefanie Januschko.
70 Jahre
Patenschaft
Am letzten Juliwochenende feierten die Südmährer im baden-württembergischen Geislingen an der Steige ihr 75. Bundestreffen und 70. Jahre Patenschaft der Stadt Geislingen über die vertriebenen Südmährer.
Am Ostlandkreuz legten die Vorsitzende Adelheid
Bender-Klein und Geislingens Oberbürgermeister Frank
Dehmer einen Kranz nieder und gedachten ihrer Toten.
Hans-Günter Grech, Obmann des Kulturverbandes der Südmährer in Österreich, rezitierte Gedichte.



Dem folgten eine Vorstandssitzung und eine Tagung der Heimatkreise. Bei der Delegiertenversammlung berichtete Bender-Klein über die Veranstaltungen des Vorstandes im letzten Jahr. Weiters informierte sie, daß der Erste Vorsitzende Wolfgang Daberger am 30. Juni sein Amt niedergelegt habe. Schatzmeister Peter Sliwka berichtete über die Finanzlage.
Der Josef-LöhnerPreis ging an Herta Braun, langjährige Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle. Die Laudatio hielt der Geschäftsstellenleiter Volker App.


Den Professor-Josef-Freising-Preis erhielt Robert Stejskal, seit mehr als 20 Jahren Ortsbetreuer von Zlabings. Laudator war Kurt Strommer.
Den bunten Patenschaftsabend anläßlich des 75. Bundestreffens und des 70.
Patenschaftsjubiläums gestalteten die „Stadtkapelle Geislingen“ und die südmährische Sing- und Spielschar „Moravia Cantat“. Bei der Stadtkapelle fiel den Österreichern auf, daß sie viele Musikstücke von österreichischen Komponisten spielte. In den Pausen bot „Moravia Cantat“ Volkstänze. Je später der Abend wurde, desto besser wurde die Stimmung! Zum Schluß schwangen noch einige Paare das Tanzbein. Ein gelungener Abend zu einem besonderen Jubiläum. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, den Domdekan Prälat Karl Rühringer aus Wien/Groß Tajax und Dekan Martin Ehrler aus Geislingen zelebrierten. Die Deutsche Messe von Franz Schubert wurde mit Begleitung der Stadtkapelle Geislingen gesungen. Eingezogen wurde mit dem Kreuz mit der Dor-


❯ Kulturverband Graslitz/Egerland
Eine fränkische Stadt mit böhmischer Geschichte
Interessante Exkursionen gehören beim Kulturverband Graslitz – dem Verein der Deutschen und der Freunde der deutschen Kultur – zum Vereinsleben. So starteten gut 50 Freunde Anfang Juli eine Fahrt ins mittelfränkische Lauf an der Pegnitz. Diese Stadt ist mit der Geschichte Böhmens eng verbunden, die dort gut erhalten zu bestaunen ist. Die Idee zu diesem Ziel hatte Margaretha Michel, Obfrau der SL-Bezirksgruppe Oberfranken.
tureis. Diese verborgenen Gänge und Räume wurden von den Laufer Altstadtfreunden in mühevoller Arbeit beräumt und Besuchern zugänglich gemacht.
von Prag nach Nürnberg gesichert und unter seiner Kontrolle.
Lauf wurde als befestigte Stadt ein regionales Wirtschaftszentrum mit einer Münzstätte und einer Geleits- und Zollstation.
nenkrone sowie mit Fahnenabordnungen der Ortsgruppen. Anschließend ehrte Adelheid Bender-Klein die Toten, die Stadtkapelle spielte „Der gute Kamerad“. Den Festakt leiteten Grußworte von Oberbürgermeister Frank Dehmer sowie von Franz Longin, Ehrenvorsitzender des Südmährerbundes, ein. Anschließend wurde der Znaimer Jiří Kacetl mit dem Südmährischen Kulturpreis ausgezeichnet. Laudatorin Adelheid Bender-Klein sagte, Jiří sei ein langjähriger Freund der Südmährer. Er habe an vielen Veranstaltungen der Südmährer teilgenommen, so an der jährlichen deutschen Messe in der Nikolai-Kirche in Znaim sowie an der Organisation vieler Veranstaltungen wie der Präsentation des Vertreibungsbuches aus dem Heimatkreis Znaim. Er präsentiere viele Ausstellungen für das Museum in Znaim. Zuletzt habe er sich um die Wiederbelebung des Butschitzer-Bornemann-Hauses bemüht. Die Verleihung des Kulturpreises erfolgte durch Oberbürgermeister Frank Dehmer, begleitet von langem Applaus der Südmährer! Anschließend folgten die Festansprachen. Erste Rednerin war Nicole Razavi MdL, Baden-Württembergs Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen. Sie dankte den Vertriebenen für ihre Verdienste um den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg und für ihr Wirken als Brükkenbauer bei der Vereinigung von Baden und Württemberg. Sie sagte, daß es 150 Patenstädte in BadenWürttemberg gebe.
SL-Landesobmann Klaus
Hoffmann ging in seiner Rede auf die Vertreibung ein. Mehr als 1000 Transporte in Viehwaggons hätten Deutschland erreicht. Mehr als 400 000 Vertriebene seien in BadenWürttemberg geblieben.
Vor den Hymnen dankte Adelheid Bender-Klein den Festrednern und den Südmährern für ihr Kommen. Nach den Hymnen fand das Heimattreffen hauptsächlich in der Jahnhalle statt.
Heuer kamen übrigens mehr Besucher zum Bundestreffen als voriges Jahr. Somit gilt noch immer der Wahlspruch „Südmähren lebt!“. rp
Die beiden Stadtführer begrüßten die wissenshungrigen Teilnehmer. Da nicht alle Mitglieder des Vereins die deutsche Sprache so gut beherrschen, wird dabei immer eine deutsch- und eine tschechischsprachige Führung organisiert. Der Weg führte zuerst in die malerischen Gassen der Laufer Altstadt zu der Ruine der ehemaligen Glokkengießer- und Spitalkirche und dem angrenzenden Spital. Das im Jahr 1374 von dem kinderlosen Nürnberger Bürger und Glockengießer Hermann Kessler und seiner Frau gestiftete Spital nebst der Kirche wurde nach der kriegsbedingten Zerstörung im Jahre 1553 wieder aufgebaut und diente lückenlos bis zum Jahr 2014 seiner Funktion als soziale Einrichtung für hilfsbedürftige Menschen. Die dazugehörige SanktLeonhards-Kirche ist bis heute als Ruine erhalten. Auf dem Weg zum Marktplatz öffnete der Himmel leider seine Schleusen, und es begann heftig zu regnen. Vorbei am historischen Rathaus führte unser Weg zur Herberge Zum wilden Mann. Dieses geschichtsträchtige Unterkunftshaus wurde bereits im Jahre 1414 als Fürstenherberge erwähnt. Dies kommt nicht von ungefähr, denn die einstige Goldene Straße, der Handelsweg von Nürnberg nach Prag, führte durch die Laufer Altstadt und direkt an diesem Gebäude vorbei. Und so logierten neben Handelsleuten auch berühmte Personen jener Zeit dort. 1414 war es Jan Hus auf seinem Weg nach Konstanz, und 1575 ist Kurfürst August von Sachsen mit seinem Gefolge verzeichnet. Neben der Beherbergung war es zu jener Zeit auch erforderlich, das Fuhrwerk mit den Waren sicher abstellen zu können, was im Innenhof möglich war.
Der Regen zwang uns nun unter die Erde. Wir besichtigten den verborgenen Teil der Stadt, die Keller unter den Häusern am Markt. Unter jedem Haus befindet sich in etwa zehn Metern Tiefe ein aus dem Sandstein herausgehauener Keller. Die Keller sind miteinander verbunden. Dort konnten Waren gelagert werden, und es bestand die Möglichkeit der Kühlung durch Na-
Da der Regen nicht nachließ, ging es in die evangelische Johanniskirche. Die Mehrheit der Christen in dieser Region ist evangelisch-lutherisch. Diese Kirche wurde um 1275 zunächst als Kapelle errichtet und im 14. Jahrhundert erweitert. Nach der Zerstörung der Spitalkirche Sankt Leonhard wurde sie 1553 zur evangelischen Pfarrkirche.

Die Anfänge des jetzigen Kirchenhauses liegen vermutlich zwischen 1350 und 1370. Ihr heutiges Aussehen geht auf die Zeit zwischen 1680 und 1710 zurück. Altar, Taufstein und Orgel stammen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Altar ist eine Besonderheit. Er hat acht auswechselbare Bilder des Laufer Bildhauers Balthasar Götz. Da im Mittelalter die Brandgefahr in den eng bebauten Städten groß war, wurde im Kirchturm eine Wohnung eingerichtet. Der Stadttürmer versah bis 1931 als Feuerwächter dort seinen Dienst.
Auf dem Weg zu der historischen Sehenswürdigkeit von Lauf schlechthin – der Wenzelburg – führte der Weg vorbei am Judenturm und der Reichelschen Schleife. Der Judenturm ist ein Teil der Stadtmauer, die bekanntlich die Bewohner und Reisenden vor feindlichen Überfällen schützte. Noch heute sind das Nürnberger und das Hersbrucker Tor als Ein- und Ausgang erhalten.
Die Wasserkraft der Pegnitz, die in diesem Flußabschnitt das größte Gefälle verzeichnet, war der Auslöser für die Ansiedlung von Gewerken. Was heute der elektrische Strom ist, war damals die Wasserkraft. So wurden im Flußbett die Werkstätten oftmals sogar nebeneinander errichtet, was bei Hochwasser durchaus gefährlich werden konnte. Die Wenzelburg wurde auf einer Flußinsel vor 1275 errichtet.
Diese erste Burg soll bei kriegerischen Auseinandersetzungen 1301 in wesentlichen Teilen zerstört worden sein. Kaiser Karl IV., der auch böhmischer König war, ließ sie zwischen 1357 und 1360 völlig neu errichten.

Der Erwerb großer Teile der nördlichen Oberpfalz und des östlichen Frankens, meist aus wittelsbachischem Besitz, 1353 und die offizielle Einverleibung dieses Gebiets in das Königreich Böhmen 1355 schufen jenes „Bayern jenseits des Böhmerwaldes“, wie man es aus Prager Blickrichtung nannte, das von den Historikern heute Neuböhmen genannt wird. Damit war für Kaiser Karl IV. der Handelsweg, auch Goldene Straße genannt,
Die Wenzelburg war eine böhmische Landesburg, die symbolische Bedeutung hatte. Sie war das westliche Eingangstor nach Böhmen. Der interessanteste Raum ist der Wappensaal.
An den Wänden sind die Wappen der Herzöge und Grafen, der Bistümer, der wichtigsten Städte und bedeutenden Geschlechter, die zum böhmischen Hofe gehörten. Dieser wunderbare Wappensaal entstand 1361.
Nach einer Mittagpause mit deftiger Hausmannskost ging es ins Industriemuseum. Das Gelände mit seinen denkmalgeschützten Gebäuden befindet sich zwischen der Altstadt und der Pegnitz. Arbeits- und Lebenswelten aus einem Jahrhundert Industriegeschichte werden den Besuchern hier anschaulich gezeigt. Eine historische Roggenmühle, ein wasserkraftbetriebenes Hammerwerk, eine große Dampfmaschine und eine komplett erhaltene Ventilfabrik mit transmissionsbetriebenen Spindelpressen geben einen Einblick in eine Arbeitswelt, die noch viele der Exkursionsteilnehmer aus ihrem eigenen Berufsleben kannten. Die früheren Wohn- und Lebensverhältnisse werden durch zwei komplett eingerichtete Wohnungen aus unterschiedlichen Epochen eindrucksvoll gezeigt. Im Bereich Handwerk und Gewerbe sind unter anderem ein Friseursalon, eine Schusterwerkstatt, eine Flaschnerei und eine Hutmacherei aus den 1960er Jahren aufgebaut.
Nach so viel Stadt- und Industriegeschichte ging es in das nördlich von Hersbruck gelegene Hohenstein. Die gleichnamige Burg war aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon geschlossen, aber dies war auch nicht unser Ziel. Ein Geheimtip ist das Windbeutelkaffee der Familie Eckert in diesem abgelegenen Ort. Zum Abschluß dieses geschichtlich sehr vielseitigen und interessanten Tages konnte sich jeder aus der langen Liste einen Windbeutel mit seinem Lieblingsgeschmack aussuchen.
Ein herzlicher Dank gilt Bernd Breuer, der diese Exkursion wie schon viele Male vorher finanziell unterstützte. Sie war nach Sonja Šimánkovás Worten die letzte Reise, welche sie für den Kulturverband Graslitz organisiert hatte. Wenn es dabei bleibt, war dies der krönende Abschluß ihres 14 Jahre währenden Engagements für den Verein. Sie hat es verdient, nun als Mitglied ohne Aufgaben die Arbeit ihrer Nachfolgerinnen als Teilnehmerin von schönen Exkursionen und Veranstaltungen zu genießen. Die Weichen für die Fortführung der Vereinsarbeit sind gestellt. Herzlichen Dank, liebe Sonja, für Deine langjährige aufopferungsvolle Arbeit für den Kulturverband Graslitz. Ulrich Möckel

Die Königskapelle tritt aus dem Getreidespeicher des Klosters hervor.
❯ Plaß und Metternich
Am 15. Mai vor 250 Jahren kam der österreichische Kanzler Klemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich in Koblenz, damals noch Trierer Kurstaat, zur Welt. Heute feiert nicht nur die fürstliche Residenz im Schloß Königswart zu Füßen des Kaiserwaldes, sondern auch das Kloster in Plaß nahe Pilsen dieses Jubiläum.
Im Jahre 1785 löste Kaiser Joseph II. das Zisterzienserkloster Plaß auf. 1826 erwarb Fürst Klemens Wenzel Lothar Nepomuk von Metternich (1773–1859), zu dieser Zeit Kanzler der österreichischen Monarchie und bedeutender europäischer Politiker, die Grundherrschaft Plaß. Hauptmotiv war der ausgedehnte Grundbesitz. Metternich gründete in Plaß eine Fabrik zur Gußeisenherstellung, erneuerte die Brauerei und verwandelte das Städtchen in ein Kultur- und Industriezentrum. Eine zweite Königswart wollte er nicht bauen und hätte es auch nicht können. Allein für die Errichtung der fürstlichen Residenz und den Erwerb der Grundherrschaft Plaß mußte er sich von den Rothschilds 900 000 Gulden leihen; das wären heute rund 65 Millionen Euro. Für sich ließ er nur die Prälatur des Klosters einrichten, die von dieser Zeit an Schloß genannt wurde. Der alte Konvent beherbergte nun Büros, Dienstwohnungen und Lager. Gleichzeitig ließ Metternich auch die Plasser barocke Pfarrkirche Sankt Wenzel umbauen. Nach Schleifen der Türme wurde daraus die Empire-Grabstätte der Metternichs. Heute ist dort nicht nur Klemens Wenzel Lothar Metternich beigesetzt, sondern auch weitere Familienmitglieder sowie deren Frauen und Kinder. Anläßlich des 250. Fürstengeburtstags wurde das Angebot der Besichtigungstouren des Metternichschlosses um einen neuen Rundgang erweitert. Man kann nun die Prälatur besichtigen, also die ehemalige Residenz des Abtes, die nach der Auflösung des Klosters zum Sitz von Metternichs Familie wurde. Das im Stil der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingerichtete Appartement, damals lebte Metternichs Sohn Richard (1829–1895) mit seiner Frau Pauline dort, erklären Broschüren oder ein Audioguide; deshalb kann man sich
Die Türme der erneuerten Brauerei.

VERBANDSNACHRICHTEN HEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 12
Kellertoilette von 1677.
Ein und
Der KV
Industriemuseum.
Graslitz im Laufer
Bilder: Ulrich Möckel
Domdekan Prälat Karl Rühringer aus Wien/Groß Tajax und Dekan Martin Ehrler, Adelheid Bender-Klein, Jiří Kacetl und Frank Dehmer.
Klaus Hoffmann, SL-Landesobmann und Bürgermeister, hält die zweite Festrede.
Franz Longin, Ehrenvorsitzender des Südmährerbundes, spricht ein Grußwort.
Nicole Razavi MdL, badenwürttembergische Ministerin, hält die erste Festrede.
❯ Heimatlandschaft Südmähren
Kloster ein Fürst
dort in Ruhe aufhalten, solange man will.
Die später barockisierte Klosterkirche Mariä Himmelfahrt geht auf einen romanischen Bau zurück, den der Olmützer Bischof Robert von England 1204 geweiht hatte. Dessen Disposition – ein dreischiffiges Langhaus, dessen Seitenschiffe Pfeiler trennen, Querhaus und Presbyterium mit halbrund geschlossener Apsis – ist im bestehenden Bau noch erkennbar.
Vom ursprünglich südlich anschließenden Kreuzgang gibt es keine Reste mehr. Das Langhaus wurde noch im 13. Jahrhundert nach Osten verlängert. Das Klostergeviert wurde bis 1628 neu errichtet. Nordöstlich des Chorabschlusses steht die gotische zweistöckige Königskapelle, die aus dem barocken Getreidespeicher hervortritt. Ihr Erdgeschoß ist dem heiligen Wenzel geweiht, das wesentlich höhere Obergeschoß der heiligen Maria Magdalena.
Bei der Besichtigung des Klosters gebührt nach wie vor die größte Aufmerksamkeit der Baukunst von Johann Blasius Santini-Aichel. Das Kloster steht im Tal der Schnella, wo schon im Mittelalter die Mönche einen künstlichen Kanal errichtet hatten, den sogenannten Königsstollen, mit dem eine Mühle und ein Sägewerk betrieben wurden.
Santini hatte das Projekt für den gesamten Umbau des Klosterareals erarbeitet, und zwar nicht nur des Konvents, sondern auch der monumentalen Basilika. Die Fundamente der Gebäude bestehen aus mehr als 5000 Eichenstämmen, dauernd von Wasser umspült, womit das Holz der Fundamente konserviert wird. Bei speziellen Besichtigungen sind auch Toiletten zu sehen, die die Schnella durchspült, und die sogenannten Wasserspiegel, barocke Bassins, in denen noch heute mehrmals täglich die Höhe des Wasserstands und andere Parameter gemessen werden. An einem ist unübersehbar eine Warnung in Lateinisch für die nächsten Generationen angebracht: „Aedificium hoc sine aquis ruet.“ Ohne Wasser bricht dieser Bau zusammen.
Man geht auch die Belüftungsgänge entlang, Bestandteil einer sinnvollen barocken Klimaanlage, die bei der Beseitigung der Feuchtigkeit hilft, im Winter das Gebäude heizt und im Sommer kühlt. Ein Wunder? Keineswegs, das ist nur ein weiterer Beweis von Meister Santinis Genialität – obwohl er selbst sein fertiges Werk nicht mehr erleben konnte. Nach seinem Tode 1773 vollendete der ebenfalls gefeierte Baumeister Kilian Ignaz Dientzenhofer das Werk.
Eva Obůrková/nh
� Kirchweih in Kladrau
Vertrauen in Zukunft und Leben
Gute Tradition ist seit vielen Jahren, daß der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer um den oder am 15. August in Kladrau, dem Heimatort seiner Mutter, weilt und in der dortigen Schloß- beziehungsweise Klosterkirche einen festlichen Gottesdienst zelebriert. Denn das Gotteshaus hat das Patrozinium Mariä Himmelfahrt, und dieser Gedenktag steht am 15. August im Kalender. So wohnten dem Gottesdienst auch heuer wieder viele von dort stammende Heimatvertriebene bei, aber auch Gläubige aus dieser Region. Daher war die Eucharistiefeier auch von drei Sprachen geprägt: Tschechisch, Deutsch und Lateinisch.

Doch keine Tradition ohne Neuerungen. Unter den Priestern war heuer der an der Karls-Universität in Prag lehrende Pavel Frývaldský, der aus dem Kreis Pilsen stammt und nun die Kirche in Kladrau bei einem Gottesdienst kennenlernen wollte. Für die Musik sorgte neben dem Chor der Pfarrei Sankt Jakob in Kladrau diesmal das Bläserensemble „Bloß Blech“ aus Donaustauf. Denn väterlicherseits stammten die Vorfahren von Rudi Dobner, einem Mitglied dieses Quintetts, aus Hesselsdorf im ehemaligen Kreis Tachau. Blasmusikkollege Hans Sauerer hatte den Kontakt zu Bischof Voderholzer hergestellt, so daß „Bloß Blech“ einige geistliche Stücke zum Gottesdienst beisteuern konnte. In seiner Begrüßung stellte Bischof Voderholzer fest, daß nicht nur das Hochfest der Aufnahme Marias in den Himmel gefeiert, sondern angesichts des 13. Tages im Monat auch an die Erscheinung der Gottesmutter Maria in Fatima erinnert werde. Der Fatima-Gedenktag möge auch dazu
beitragen, so der Oberhirte, zu Maria zu beten und so die Beziehung zu Gott ins Lot zu bringen.
Er dankte besonders Ortspfarrer Miroslav Martiš für die Vor-

lichen Koordinaten der Orientierung sollte es jedem Christen und jeder Christin gehen – auch in schwierigen Zeiten mit überaus großen Herausforderungen.
nisierung und Verbesserung der Welt einzutreten. Bischof Voderholzer machte darauf aufmerksam, daß in der Kirche und in der Politik die
gene Weltjugendtag in Lissabon sei ein Zeichen, daß die Kirche jung sei und eine Zukunft habe. „Damit können wir als Kirche der Gesellschaft helfen. Vertrauen haben in die Zukunft und in das Leben – darum müssen wir uns bemühen“, appellierte er an die Gläubigen.
Mit dem Dank für diesen Tag der Begegnung, für die Gemeinschaft über die Grenzen und Sprachen hinweg und für die Botschaft, die einem geschenkt werde, schloß der Oberhirte seine Ansprache.
Die Lesungen, das Evangelium und die Fürbitten wurden in tschechischer und deutscher Sprache gelesen. Der Gottesdienst wurde nach der Gabenbereitung ab dem Hochgebet Sanctus Lateinisch zelebriert. Pfarrer Martiš dankte am Schluß der Messe dem Bischof für die Feier der Eucharistie und merkte an, daß Voderholzer in Kladrau fast schon zu Hause sei.


bereitungen sowie den konzelebrierenden Mitbrüdern, allen Mitwirkenden und den Abordnungen der Marianischen Männerkongregation im Bistum Pilsen.
In seiner Predigt verdeutlichte der Bischof zunächst den Unterschied zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele. Himmel bedeute hier die vollendete und geglückte Beziehung. „Die Gemeinschaft mit Gott ist eine ewige Beziehung.“
Auf Maria bezogen heiße das, daß sie geborgen sei in der ewigen Liebe des dreifaltigen Gottes, daß sie als Erste in einer Wohnung sein könne, die Christus für uns vorbereitet habe.
Um die entscheidende Beziehung im Leben und die wesent-
� Bund der Deutschen in Böhmen
Am zweiten August-Wochenende führte der Weg des Bundes der Deutschen in Böhmen (BDB) wieder nach Chodau bei Karlsbad. Chodaus größtes Fest, das Laurentiusfest, fand statt.
„Die entscheidende Beziehung unseres Lebens ist die Beziehung zu Gott – unserem Schöpfer und Erlöser. Wo wir Gott groß schreiben und ihn die Mitte unseres Lebens sein lassen, da werden auch die anderen Beziehungen heilen. Wo wir ihn als Schöpfer anerkennen, da wird uns vollends klar, daß wir auch zur Bewahrung dieser Schöpfung aufgerufen sind.“ Vor diesem Gedanken werde auch jeder Mensch als Abbild Gottes Bruder und Schwester. Das Bild Gottes als Richter des Lebens begründe die Verantwortung des Menschen im Hier und Heute. Und schließlich bedinge das Bewußtsein der Hoffnung über Grab und Tod hinaus die innere Freiheit, für eine Huma-
Freude und die Gelassenheit, auch in Verbindung mit der Gottesdienstfeier, abhanden gekommen seien. „Der Glaube schenkt eine innere Freude, eine Gelassenheit und auch ein Vertrauen auf die Zukunft“, sagte er. Der eine Woche zuvor zu Ende gegan-
Mit einer Andacht in der Kladrauer Pfarrkirche Sankt Jakob und dem Besuch der Gräber endete der geistliche Teil der Kirchweih. Auf dem Stadtplatz war natürlich noch Gelegenheit zur geselligen Einkehr bei böhmischer Musik und ebensolchen kulinarischen Schmankerln. Markus Bauer
Bischof Voderholzer unterhält sich mit Gottesdienstbesuchern.
Die Tränen des heiligen Laurentius
rer Ireneusz Figura. In der Predigt, die Bürgermeister Pizinger für die Deutschen dolmetschte, sprach Pfarrer Rob vor allem über den Mut, welchen der heilige Laurentius habe zeigen müssen, als er den Kirchenschatz an die Mitglieder der Gemeinde verteilt und dann mit Demut den schmerzhaften Tod auf dem Rost ertragen habe.
,Tränen des heiligen Laurentius‘ genannt“, sagte Rob.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich alle zunächst am Denkmal für deutsche und tsche-
Wie schon etliche Jahre zuvor machten auch wir Egerländer aus Plachtin bei Netschetin uns auf den Weg, das Fest mit einem Trachtenträger und der Vereinsfahne zu verschönern. Es ging aber vor allem darum, sich mit Freunden zu treffen, mit Vertretern der Stadt und mit Deutschen, mit welchen die Stadt eine vorbildliche Zusammenarbeit pflegt. Dieses Jahr war der Besuch aus Plachtin etwas anders. Nicht ich, der Måla Richard Šulko, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen in Böhmen, kam mit seiner Tracht nach Chodau, sondern Vojtěch Šulko, mein Sohn und mein Stellvertreter als BDBVorsitzender. Ich nahm mein Mikrofon mit, um das Ereignis aufzunehmen und daraus eine Reportage für die Minderheitensendung des Tschechischen Rundfunks zu machen.
Als wir zwei unterhalb der Kirche ankamen, wurden wir
vom Bürgermeister der Stadt, Patrik Pizinger, und seinem Stellvertreter Luděk Soukup freundlich begrüßt: „Es ist schön, daß Sie wieder da sind!“ Die Heilige Messe zelebrierte Romuald Štěpán Rob aus Fischern, einem Stadtteil von Karlsbad. An seiner Seite stand der örtliche Pfar-

Weil in der Kirche auch kleine Kinder waren, erklärte Pfarrer Rob das Leiden des Laurentius mit dem Grillen von Pommes frites. Für mich war aber ein anderer Begriff neu: „In diesen Tagen kann man am nächtlichen Himmel Sternschnuppen betrachten, auch als Perseiden bekannt. Diese Sternschnuppen werden auch

chische Verstorbene auf dem Friedhof hinter dem Eingangstor. Außer Bürgermeister Pizinger sprach auch der Vertreter der deutschen Bevölkerung Chodaus, Josef Moder. Nach einem Gebet legte Pizinger eine
Blume nieder und lud die versammelten Menschen zum Spaziergang auf dem Friedhof ein. Die erste Station war die Grabstätte des ersten Chodauer Bürgermeisters Karl Fenkl. Die zweite gehörte der neu renovierten Grabstätte seines Nachfolgers Josef Gerstner. Insgesamt hatte die Stadt mit Hilfe des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds fünf Grabstätten renoviert. Das ist der vorbildliche Umgang einer tschechischen Gemeinde mit ihrer deutschen Geschichte. Solch ein Verhalten ist in der Tschechischen Republik nicht selbstverständlich.
Eine besondere Begegnung erlebte ich bei dem frisch renovierten Grab der Familien Lorenz und Pauli: „Ich kenne Dich von Facebook“, sprach mich Thomas Pauli an, der die Grabstätte für seine Urgroßeltern hatte erneuern lassen. Auch ein sehr gutes Beispiel, wie man sich zu seinen Ahnen verantwortungsvoll benehmen soll. Nach den Formalitäten in der Kirche und auf dem Friedhof lud der Bürgermeister zu einer Erfrischung im Pfarrgarten ein. Mit guten Gesprächen zwischen Deutschen und Tschechen ging der erste Teil des Laurentiusfestes zu Ende. Gratulation an die Stadt. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr! Richard Šulko
HEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 13
Bürgermeister Patrik Pizinger, Luděk Soukup und Josef Moder.
Vojtěch Šulko zieht mit der Vereinsfahne aus der Laurentius-Kirche aus.
Bilder: Måla Richard Šulko
Die Konzelebranten Dr. Pavel Frývaldský, Pater Rudolf Zbožínek, Bischof Professor Dr. Rudolf Voderholzer, Ortspfarrer Miroslav Martiš und Pfarrer Hans-Werner Alt. Bilder: Markus Bauer
Pfarrer Romuald Štěpán Rob und Pfarrer Ireneusz Figura feiern Eucharistie.
Metternich-Portrait von Thomas Lawrence.
Übersetzt von Jutta Benešová
Neudek Abertham
Neudeker Heimatbrief

für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Folge 648 · 8/2023
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.

Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft, Stadtsparkasse München – IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 649 (9/2023): Mittwoch, 20. September.

❯ Neudek
Eva Zormaier war unterwegs auf den Spuren ihrer aus Neudek stammenden Großmutter.

Seit ich mich erinnere, möchte ich die Heimat meiner Großmutter kennenlernen. So oft erzählte sie mir aus ihrer Kinderund Jugendzeit in der Heimat in Neudek, Bernau, Schindlwald und Schönlind. Ihre Geschichte interessierte mich schon immer. Sie ist Teil meiner eigenen Geschichte geworden. Und nun, im Sommer 2023, konnte ich endlich dorthin reisen, wo all die Erinnerungen und Erzählungen ihren Ursprung haben, wo meine Oma Josefine Pecher im Mai 1925 zur Welt kam.

„Egerland, Heimatland, wie bist Du so schön“. Weißt Du noch, Oma? Das hast Du mir so oft vorgesungen. Als wir von Karlsbad mit dem Zug nach Neudek fahren, kommt es mir wieder in den Sinn. Jetzt fahre ich genau die Strecke, die Du so oft gefahren bist. Zur Handelsschule und zum Arbeitsamt in Karlsbad oder zum Sonntagsspaziergang mit Deinen Freundinnen im Kurviertel. Als wir in Neudek ankommen, erwartet uns ein gut in Schuß gehaltener Bahnhof. Im westlichen Teil des Bahnhofsgeländes war wohl das Sammellager, von dem aus die Sudetendeutschen aus der Umgebung während der geordneten Vertreibung abtransportiert wurden. Ein Ort, an dem ich lange stehen bleibe, und der mich sehr berührt.
Wir spazieren weiter in Richtung Hauptstraße. Unsere erste Station ist der Neudeker Friedhof. Ich stelle mir vor, wie es wohl war, als Du noch als Mädchen den Weg hinauf zum Friedhofsgelände gingst. Wahrscheinlich mit einer Kerze oder einem Bündel Blumen in den Händen, um sie an das Grab Deiner lieben Mutter zu legen, die viel zu früh gestorben war. Ich wage nicht zu hoffen, die Stelle des längst aufgelösten und in Verges-

Eine Reise für die Seele
senheit geratenen Grabes zu finden. Und doch marschiere ich mit Omas Fotoalbum in der Hand den Friedhofsberg hinauf. Im Al-
bum ist ein altes Bild eingeklebt. Es zeigt Oma an der ungefähren Stelle des ehemaligen Grabes ihrer Mutter Josefa Pecher. Der Neudeker Friedhof ist sehr gepflegt, und die tschechischen Grabstätten bilden mittlerweile den Großteil der Gräber. An den Rändern findet man verlassene deutsche Gräber, manchmal nur einzelne Steinplatten, hie und da einmal geschmückt mit einer Kerze. Wir suchen gleich den von Anita Donderer und Herbert

Ich kam 1986 im niederbayerischen Passau zur Welt. Dort wuchs ich mit meinen Eltern und Großeltern in einem kleinen Bauerndorf auf. Mein Elternhaus hatten meine Großeltern 1950 in der Nachkriegszeit und nach der Vertreibung meiner Großmutter erbaut. Als Flüchtling ein Heim, eine Familie aufzubauen, war ein großes Geschenk. Noch heute bin ich dafür dankbar und staune über die Tüchtigkeit und den Fleiß meiner Vorfahren. Ich studierte an der Universität Passau Grundschullehramt und unterrichte an einer kleinen Landschule im Landkreis Passau. Mit meinem vierjährigen Sohn



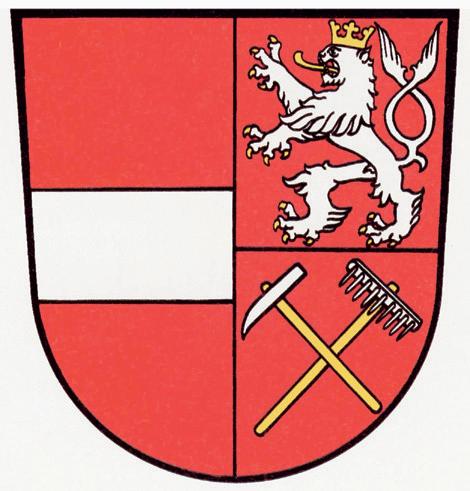
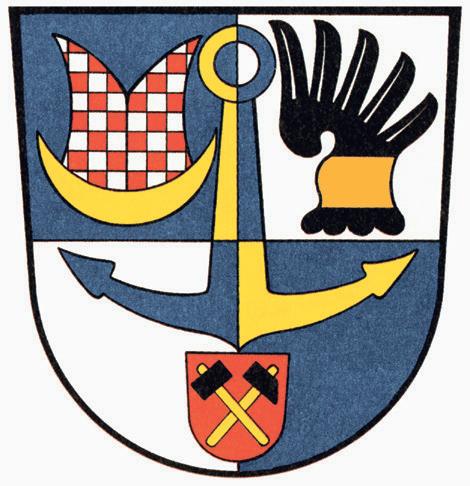
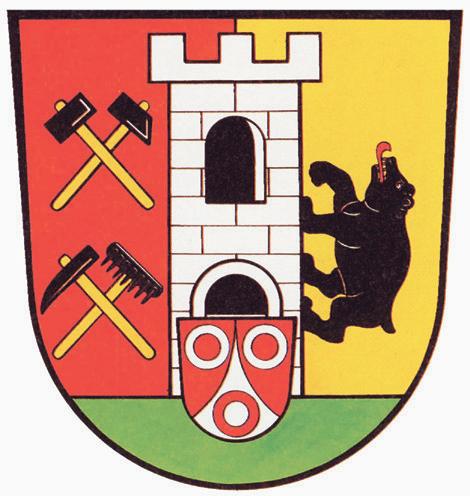
Götz in Zusammenarbeit mit der Bürgervereinigung JoN und den Städten Augsburg und Neudek angebrachten Gedenkstein auf. Ich bin dankbar für diesen schönen Ort, um meiner Vorfahren zu gedenken. Auf dem Foto in Omas Album ist kaum eine Umgebung zu erkennen, und so gestaltet sich die Suche nach der Grabstelle äußerst schwierig. Mein Mann hat die Idee, einen jungen Friedhofsarbeiter um Hilfe zu bitten. Leider kann ich kein Tschechisch, und so müssen wir uns in Englisch verständigen. Ich zeige ihm das Bild und er weiß sofort, wo die Stelle ist. Das Grab lag vom Mittelgang aus links im ersten Drittel. Was für ein Triumph!
Und wieder höre ich Dich reden, Oma: „Dou liecht se begroum, mei goude Moudda.“ Wie gerne wäre ich jetzt gemeinsam mit Dir an diesem Ort. Unsere Entdeckungsreise setzt sich fort ins Ortsinnere. Wir gehen am Schulplatz der Bürgerschu-

le vorbei und betrachten den offenen Marktplatz mit den einst wunderschönen historistischen und Jugendstil-Häusern. Ich erkenne die Schönheit, die dem Wesen und der Bebauung von Neudek zugrunde liegt und stelle mir vor, wie es früher einmal gewesen sein muß. Viele Häuser sind stark renovierungsbedürftig, viele Geschäfte und Wohnungen stehen leer. Dennoch entdecke ich an der Brücke über die Rohlau eine kleine provisorische Jugendkneipe. Offenbar gibt es eine junge Szene in Neudek. Ein Halt im Hotel Anna bringt uns wieder zu Kräften. Inhaber Josef Nádeníček ist ein aufgeschlossener Gastgeber und beantwortet Fragen über den Ort und seine Geschichte. Immer noch mit Omas Fotoalbum in der Hand geht es weiter zur Kirche Sankt Martin. Ich bin erstaunt über den ordentlichen Zustand des Gebäudes. Auf den Bildern von 2010, Omas letzter Besuch in ihrer Heimat, ist die

Eva Zormaier
und meinem Mann lebe ich am Residenzplatz in Passau. Mein Mann betreibt dort die Apotheke zum Schwarzen Adler.
Schon früh beschäftigten mich Omas Vergangenheit, ihre Geschichte und die ihrer Vorfahren im Sudetenland. Manchmal schrieb ich ihre Erzählungen auf, später ließ ich das Mikrofon am Handy eingeschaltet, während sie erzählte, und machte Videos. Auch im Internet begann
ich zu recherchieren und fand Tondokumente von Mundartsprechern aus dem Egerland und dem Erzgebirge. Nach Omas Tod im August 2022 suchte ich erneut, aber vergeblich nach diesen Aufnahmen, speziell nach einer Aufnahme mit einer Sprecherin aus Abertham. Ich meinte mich erinnern zu können, sie einst auf der Homepage der Heimatgruppe „Glück auf“ gesehen zu haben und schickte kur-
Kirche heruntergekommen und ungepflegt. Vor der Kirche ist ein schön gestalteter Platz mit Blumen. Aus Erzählungen weiß ich, daß an der Stelle des Parkplatzes vor der Kirche einst ein Pfarrhaus stand. Leider kann man die Kirche nicht betreten, sie ist durch ein Gitter am Eingang verschlossen. Nur ein Blick ins Innere ist gestattet. Hier warst Du also mit Deiner Familie in den Gottesdiensten, an Weihnachten,

Von den zwei bekannten Neudeker Adressen der Familie Julius Pecher ist nur noch eine vorhanden. Die alte Nummer 198 stand an der Stelle eines Parkplatzes unweit des Felsens. Die Nummer 365 in der ehemaligen Leipziger Straße steht gegenüber des Eisenwerks an der Straße nach Hohentanne. Zielgerichtet marschieren wir am Felsen vorbei, betrachten den Ignatz-Sichelbarth-Gedenkstein und das alte Landratsamt in seiner schönen Architektur. Auch das steht leer. Zuletzt war es eine Polyklinik.
Ostern und wahrscheinlich auch noch kurz bevor Du die geliebte Heimatstadt verlassen mußtest.
zerhand eine eMail an den Vorstand.
Das war mein Glück, denn dieser Weg führte mich zu Josef Grimm, einem gebürtigen Aberthamer und Heimatkreisbetreuer von Neudek. Mit Josef Grimm fand ich nicht nur die Tonaufnahmen wieder, sondern auch eine große Quelle für sämtliche Unterlagen, Dokumentationen, Erfahrungsberichte und ein breites Wissen über die Heimat meiner Großmutter. Ich wurde spontan Mitglied bei der Heimatgruppe „Glück auf“ und bei der SL und freue mich seither über viele neue Kontakte zum Austausch über die Heimat.
Hinter den Bäumen sieht man langsam auf der rechten Straßenseite ortsauswärts das alte gelbe Haus mit bröckeliger Fassade. „Dou hamma gwohnt. Untn links woar mei Zimmer. Ach woar des schej.“ Höre ich Dich erzählen in Deinem schönen Egerländer Dialekt. Und ich stelle mir vor, wie ihr, Du und Dein Bruder Erich, über die Schwelle der Eingangstüre geht, wie ihr vielleicht im Garten hinter dem Haus die Wäsche aufhängt oder euer Vater Julius gerade von seiner harten Arbeit im Eisenwerk nach Hause kommt. Hier war eure Mutter schon nicht mehr bei euch, und in diesem Haus habt ihr Ende Mai 1946 die Nachricht erhalten, daß eure Wohnung innerhalb von 24 Stunden zu verlassen ist, abgesperrt werden muß und ordentlich zu hinterlassen ist. Ich stehe vor dem Haus und kann kaum glauben, daß ich nun endlich hier bin. Am liebsten würde ich noch Stunden verweilen und alles wieder und wieder betrachten. Ich entdecke eine moderne, neu installierte Klingelanlage für acht Einheiten. Die Fenster sind gerade ausgetauscht und erneuert worden. Das Blechdach ist auch relativ neu. Mich beruhigt, daß dieses Gebäude, das mir so viel bedeutet, genutzt und gepflegt wird. Als Bewohner auf uns aufmerksam
Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 14
Das Haus Nummer 365 in der ehemaligen Leipziger Straße.
Der Schul- und der Marktplatz. Bilder (6): Eva Zormaier
1937 geht Familie Pecher auf dem Kreuzberg mit Bekannten spazieren.
Eva Zormaier am Denkmal für die bis 1946 Verstorbenen auf dem Friedhof.
Josefine Pecher an der Stelle, wo einst das Grab ihrer Mutter war.
2023 die erste Kreuzwegstation auf dem Kreuzberg.
Blick auf das Bahnhofsgbäude.
Die dem heiligen Martin geweihte Pfarrkirche.
werden, ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied von der Reise in die Vergangenheit, in Deine Vergangenheit. Nun bleibt uns noch eine Station. Der 695 Meter hohe Kreuzberg mit dem 2008 renovierten Kreuzweg. Es hat etwa 33 Grad, dennoch zieht es mich hinauf auf diesen Berg, von dem Du mir immer erzählt hast. Es war euer Sonntagsspaziergang, meistens mit Erich, eurer Mutter und Nachbarn und Bekannten. Nach dem ersten sehr steilen Einstieg in den Wanderweg läßt es sich im Schatten der Bäume gut aushalten. Der 1,6 Kilometer lange
Weg führt in Serpentinen hinauf, vorbei an 14 steinernen Altären mit Reliefen des Kreuzwegs Jesu. Der Neudeker Künstler Heřman Kouba gestaltete ihn äußerst schön und plastisch. Auf dem Felsen am Gipfel steht ein Kreuz, darunter ist im Felsen eine kleine Höhle zu sehen. Hier war einst die hölzerne Büste von Jesus im Kerker montiert. Nach dem Krieg und der Vertreibung konnte sie vor der drohenden Verbrennung gerettet werden. Heute ist sie wie vieles andere im Heimatmuseum für Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg zu sehen.

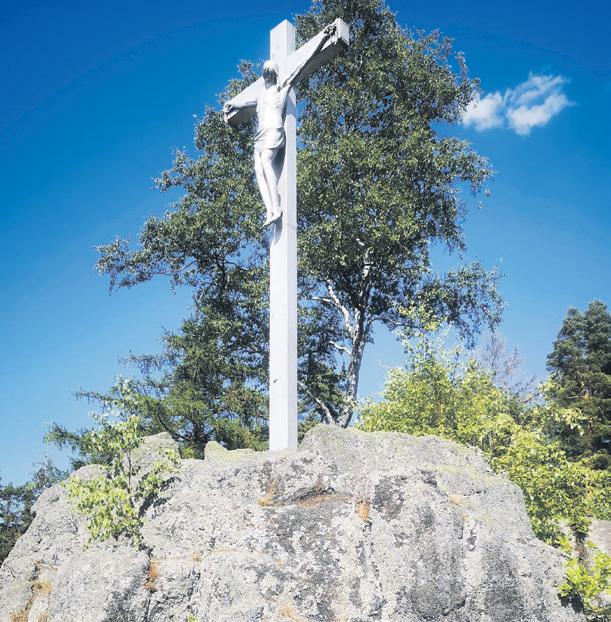
Ich genieße den Blick über Neudek und rekonstruiere das Neudek Deiner Zeit mit Papierfabrik, Wollkämmerei, Pfarrhof und einem belebten Marktplatz. Beim Abstieg fallen mir die alten Befestigungen des Weges auf, alte Steinmauern schützen die Wege vor Erdrutsch und Erosion. Ein kleiner, kantiger aber herzförmiger Stein fällt mir ins Auge. Ich hebe ihn auf, er ist etwa zwei Zentimeter breit und aus Granit. Glücklich und etwas wehmütig halte ich ihn in der Hand und nehme ihn mit als Andenken an diesen wunderbaren Ausflug in die Vergangenheit, deren Schönheit noch heute zu erkennen ist.


Ganz ohne Hoffnung auf große Entdeckungen begann ich diese Reise und kehre mit einem großen Reichtum an Eindrücken, Erlebnissen und Gefühlen wieder zurück in meine Heimat, den Bayerischen Wald. Und ich frage mich, was hast Du mir noch alles dagelassen außer der Liebe zu Deiner und meiner Heimat? Was hat Deine Vertreibung in mir ausgelöst? Ist es eine ewige Sehnsucht nach einem Ort in einer anderen Zeit? Ist es eine innere Zerrissenheit, die sich manchmal in Rastlosigkeit äußert? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, daß es eine Reise für die Seele war, und Du warst bestimmt mit dabei. Und ich höre Deine Worte: „Sie is ja so vül schaj, unser Håimat.“ Ja, Oma, schön ist sie – Deine Heimat und meine Heimat.
� Tschechische Heilbäder
Bad Luhatschowitz in Mähren
Josef Grimm kurte kürzlich mit seiner Frau Ingrid im mährischen Bad Luhatschowitz. Er berichtet.
Über Radonkuren in Sankt Joachimsthal berichtete ich bereits (Ý NHB 1/2017 und 6/2019). Um 2010 bekam ich Arthrose im linken Knie, die arthroskopisch operiert wurde. Der Erfolg der Operation ließ nach, so daß ich 2016 nur noch humpeln konnte. Da meine Mutter aus Sankt Joachimsthal stammte, wußte ich von der heilenden Wirkung von Radonbädern. Radon kommt an vielen Orten gasförmig aus der Erde, besonders intensiv in Sankt Joachimsthal. Es löst sich in Wasser und wird den Kurkliniken zugeleitet. 2016 reiste ich voller Erwartung zu einer Radonkur nach Sankt Joachimsthal. Schon nach fünf Tagen spürte ich eine wesentliche Besserung, nach zwei Wochen konnte ich fast wieder laufen wie früher. Die Wirkung läßt mit der Zeit nach, so daß ich 2018 erneut nach Sankt Joachimsthal fuhr. 2013 wurde bei mir Prostatakrebs festgestellt, der erfolgreich operiert wurde. Der PSA-Wert ist ein Maß für die Aktivität von Prostatagewebe. Er muß nach der Operation unter der Nachweisgrenze bleiben. Dies wird durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen überprüft. Bis 2016 war das Untersuchungsergebnis immer gut, aber nach der Radonkur begann der PSA-Wert wieder langsam zu steigen. Ich schöpfte noch keinen Verdacht. 2018 machte ich erneut eine Radonkur und der PSA-Wert stieg weiter. 2019 wollte ich eine weitere Radonkur machen, aber eine neu angestellte junge tschechische Kurärztin verbot mir geradezu die Kur. Radonbäder können heilend auf Gelenk- und Rückenerkrankungen und rheumatische Erkrankungen wirken, aber auch
schlummernde Krebszellen zum Wachstum anregen. Bei mir war also der Krebs zurückgekehrt.
Nach dieser Erkenntnis unterzog ich mich in Augsburg 37 Bestrahlungen, bis heute mit Erfolg. Aber Radonkuren sind für mich jetzt tabu, trotzdem muß etwas für die Kniegelenke getan werden. Im Prospekt der Sankt Joachimsthaler Kurkliniken ist auch Bad Luhatschowitz/ Luhačovice aufgeführt. Es liegt zwischen Brünn und Zlin weit
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die mit dem allgemeinen Aufschwung der Balneologie in den Ländern der böhmischen Krone einherging.
1629 bis zur Enteignung 1948 gehörte Luhatschowitz den Grafen Serényi de Kis Serény. Zu den bekanntesten Quellen gehören die nach Serényi-Grafen benannten Vincentka-, Aloiska- und Ottovkaquelle sowie die Sankt-Josefs- und die Dr.Šťastný-Quelle. Die wichtigsten
Das Gipfelkreuz am Ende des Kreuzweges. Bilder (2): Eva Zormaier
hinten in Mähren und gehört zum Bäderverbund Sankt Joachimsthal-Luhatschowitz. Mit dem Auto fährt man von Augsburg rund 700 Kilometer. Trotzdem entschied ich mich für diesen Ort. Das hat etwas mit meiner Krankenversicherung zu tun. Ich bekomme als privat Versicherter nur einen Teil der Kosten erstattet, und Kuren in Tschechien sind deutlich billiger als in Deutschland. Außerdem wollte ich Mähren kennenlernen. So war ich 2021 mit meiner Frau in Luhatschowitz und gerade eben im August wieder.
Luhatschowitz wird am Anfang des 15. Jahrhunderts erstmals schriftlich erwähnt, aber die slawische Besiedlung fand hier einige Jahrhunderte zuvor statt. Hier entspringen mehr als zehn Mineralquellen, deren heilende Wirkung schon früh erkannt wurde. Im frühen 18. Jahrhundert nahm die Kurtradition ihren Anfang, ihre Blütezeit erlebte sie
� 25. Beerbreifest im Doppeldorf Trinksaifen und Hochofen
darin gelösten Mineralstoffe sind Natrium, Kalzium, Magnesium, Chlor, Brom und Jod. Das Quellwasser ist zehn bis zwölf Grad warm. Mit dem hier gewonnenen Mineralwasser werden Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstrakts sowie des Bewegungsapparates, Diabetes und Stoffwechselstörungen kuriert. Neben Inhalationen und natürlichen Kohlensäurebädern sind Trinkkuren populär. Hierzu laden Spaziergänge im Kurpark und in dessen näherem Umkreis ein, wo die Quellen liegen. Das freundliche und gepflegte 7000-Seelen-Städtchen war immer fast nur tschechisch besiedelt. Folglich gab es hier 1945/46 keine Vertreibung und somit heute keine Ruinen oder Baulükken infolge von Abriß zerstörter Häuser. Allgemein fällt in Mähren der ausgezeichnete Zustand der Straßen, Häuser, Gärten, Kirchen und Friedhöfe auf. Der Kurort hat natürlich zahlreiche
Kurhotels. Einige beherbergen alle Einrichtungen für die Anwendungen wie Schwimmbad, Badewannen für natürliche Kohlensäurebäder, Inhalationsapparate, Liegen für Massagen oder Dry-Jet-Wasserbetten, so das zentral gelegene Hotel Palace. Aus diesem Grund logierten wir nun wieder im Palace. Die Anwendungen werden für die verschiedenen Erkrankungen von einem im Haus ansässigen Kurarzt verschrieben. Andere Hotels und viele private Pensionen bieten nur Logis oder Kost und Logis. Zu den Anwendungen muß man in ein anderes Haus gehen. Das ist eine Preissache. Der Kurpark ist groß und gepflegt und lädt zum Spazieren nach den Anwendungen ein. Den Weg zum Kurpark säumen Cafés, Bierstuben, Geschäfte für Oblaten und Souvenirläden. Österreich ist nur zwei Autostunden entfernt. Dennoch trafen wir keine österreicheichen Kurgäste. Ebenso trafen wir keine Deutschen. Wir waren beide Male die einzigen Deutschen im Hotel Palace.
Der Arzt, das Personal an der Rezeption, einige Servierkräfte im Speisesaal und etliche vom medizinischen Personal sprechen jedoch ausreichend Deutsch, so daß es keine Verständigungsschwierigkeiten gibt. Und wenn man selbst ein paar Worte Tschechisch spricht, ist das kein Schaden. Deutsche Kassenpatienten fragen vor Antritt der Kur bei ihrer Krankenkasse wegen der Kostenübernahme an. Privatpatienten erhalten je nach Vertrag in der Regel die Kosten für die Anwendungen erstattet. Die Reise, Kost und Unterkunft tragen sie in der Regel selbst, können diese Kosten aber in der nächsten Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Eine Kur in Luhatschowitz ist die weite Reise durchaus wert.
Viele Neue aus der ganzen Republik
Das 25. erneuerte Kirchweihfest in Trinksaifen und Hochofen, das Beerbreifest, wurde heuer mit großem Zuspruch gefeiert. Die Reaktionen waren ermutigend. Alle wünschten sich nächstes Jahr eine Wiederholung.
Anfang Juli feierten Heimatvertriebene mit ihren Angehörigen aus Thüringen, Hessen, Bayern und Württemberg im Doppeldorf Trinksaifen-Hochofen das 25. Trinksaifner Fest nach der Vertreibung 1946. Das Dorf wurde 1556 urkundlich erstmals erwähnt. Gewiß gab es eine verstreute Ansiedlung bereits vorher, zumal die nahe Kreis-
stadt Neudek seit 1340 bezeugt ist.
Erfreulicherweise waren diesmal neue Gäste aus Hamburg, Freising, Württemberg, Franken, Nordschwaben und aus der Stadt Bayreuth gekommen. Der Zusammenhalt mit den alten Hasen der jährlichen Begegnung war beispielhaft. Ebenso wie die Gemeinschaft mit den wenigen Heimatverbliebenen und mit den neuangesiedelten Tschechen. Begonnen wurde wie immer mit einem Gottesdienst in der Kirche Mariä Heimsuchung in Trinksaifen mit Pfarrer Thaddäus Posielek. Peter Rojík spielte die Orgel, und die Sopranistin
Věra Smrzová sang Lieder in drei Sprachen. Die Messe war mit fast 50 Gläubigen recht gut besucht.
Nach Mittagessen und Grußwort des neuen Bürgermeisters Václav Malý fuhren wir mit einem erneut von der politischen Gemeinde Hochofen gratis zur Verfügung gestellten Autobus ins Obere Erzgebirge nach Abertham. Dort besichtigten wir das neue Handschuhmuseum. Lenka Löffler führte und erklärte. In der nahen Kirche Zu den 14 Nothelfern riefen wir alle namentlich aufgeführten Heiligen um ihre Fürsprache bei Gott an. Dann ging es ins vorbestellte Café am Plessberg, wo ich die Teil-
nehmer einander etwas näher vorstellen konnte. Der Abend gehörte im Gasthaus in Hochofen traditionell einem deutsch-tschechischen Heimatabend. Diesen bestritten die Musikanten Helmut Zettl und Franz Severa auf ihren Ziehharmonikas und wir mit gemeinsamem Gesang.

Der beliebte Spaziergang am Sonntagvormittag unter Führung von Roman Kloc über die Anhöhen des Dorfs gab nicht wenigen neue familiengeschichtliche und landschaftliche Eindrükke. Ein Mittagessen schloß die kleine Reise ab, nicht ohne sich auch noch einen Palatschinken zu gönnen. Adolf Hochmuth
Folgenden Abonnenten des Neudeker Heimatbriefs gratulieren wir zum Geburtstag im August und wünschen alles Gute und Gottes Segen.
n Rostock. Dr. Ádám Sonnevend (geboren in Ungarn), 18069 Rostock, Beethovenstraße 16, 4. August 1941.
n Trinksaifen. Rudolf Schreiber (Rabenberg 20), Am Schmiedanger 10, 82346 Andechs, 20. August 1936.
WIR GRATULIEREN WIR BETRAUERN
n Gottesgab. Am 26. Juli verstarb Elisabeth Schipfel/Günther mit 91 Jahren. Sie wurde am 9. August 1931 in Gottesgab geboren und lebte seit der Vertreibung in Augsburg. 1991 bis 2012 redigierte sie das Heimatblatt „Mei Erzgebirg“ für die Kreise Preßnitz und Sankt Joachimsthal und schrieb Bücher über das Erzgebirge wie „Irrlichter“ und „Erzgebirgs-Saga“. Letzteres ist ein autobiographischer Roman über ihre Jugenderinnerungen. Darin beschreibt sie, wie sie im Winter 1945 als 14jähriges Mädchen einem von den Tschechen verfolgten Ehepaar unter abenteuerlichen Umständen zur Flucht von Gottesgab zur Grenze bei Oberwiesenthal verhalf. Mit ihrer Erlaubnis haben wir diese gefährliche Begebenheit als Weihnachtsgeschichte im Jahr 2018 im Neudeker Heimatbrief und in „Der Grenzgänger“ abgedruckt. Gott schenke unserer Heimatfreundin Frieden in der ewigen Heimat. Josef Grimm n Trinksaifen. Am 14. August starb Emil Herold mit 93 Jahren in Augsburg-Göggingen. Er war am 30. November 1929 in Trinksaifen zur Welt gekommen. Nach dem Hausname wurde er Watschn-Emil genannt. Nach dem Besuch der Volksschule wurde er Forstlehrling, anschließend war er Förster in den heimatlichen Wäldern. Am 13. September 1946 kam er im Waggon 28, Transport Nr. 33447 mit dem letzten Güterzug, der bei der Vertreibung der Sudetendeutschen aus Neudek in den Westen ging, nach Amendingen in Bayerisch-Schwaben. Dort arbeitete er zunächst bei einem Bauern. 1952 heiratete er und zog nach Haunstetten bei Augsburg, damals noch eine selbstständige Gemeinde. Die nächsten 37 Jahre arbeitete er als Arbeitsvorbereiter in der Gesellschaft für elektrische Geräte (Gefeg) in Augsburg. 1989 ging er in Rente. Damals trat er der Heimatgruppe „Glück auf“ bei und hielt ihr und dem Neudeker Heimatbrief die Treue. In der 2013 neu gegründeten Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek arbeitete er bis 2019 als Beisitzer mit. Seinem Sohn Dietmar gebührt unser aufrichtiges Beileid. Josef Grimm



TERMINE
n Freitag, 8. bis Sonntag, 10. September: 2. Treffen der Familie Kolitsch und deren Nachkommen sowie der mit ihr verwandten Familien Kraus, Grimm und Harzer in Dresden-Klotzsche. Organisation, Auskunft und Anmeldung: Wolfgang und Matthias Kolitsch, eMail mppm. kolitsch@t-online.de
NEUDEKER HEIMATBRIEF Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 15
Heimatabend mit Franz Severa in der ehemaligen Justinsklause. Führung mit Lenka Löffler im Handschuhmachermuseum in Abertham.
Der Neudeker Turm.
Das Zentrum von Bad Luhatschowitz.
Bild: Josef Grimm
Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Machendorf/ehemaliger Kreis Reichenberg
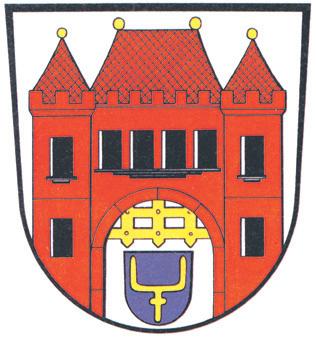
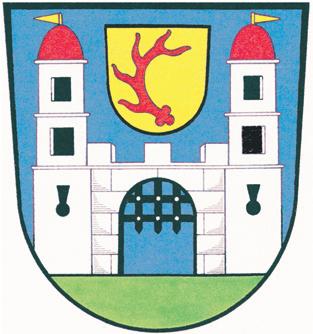
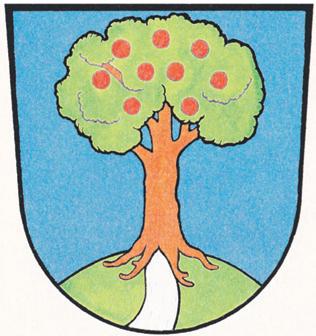
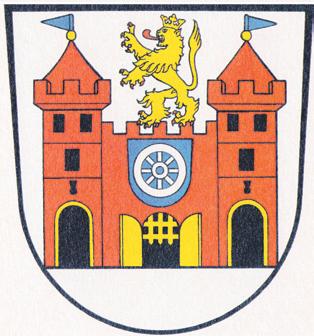
Villa wird
Gespensterhaus


Moosbewachsene Trümmer des Hauses, eingestürzte Decken, zerbrochene Fenster, die Überreste medizinischer Geräte und eine weit geöffnete Eingangstür mit einem Schild, das darauf hinweist, daß der Zutritt zum Gebäude wegen der Gefahr tödlicher Verletzungen verboten ist. Das ist die Ansicht der Kleinert-Villa im Reichenberger Stadtteil Machendorf/Machnín, die von einem großen Waldpark umgeben und von der Hauptstraße, die von Machendorf nach Christofsgrund/ Kryštofovo Údolí führt, durch eine massive Schieferwand getrennt ist.



Umstrittenes Wittighaus: von der Baude zum Luxushotel
Es gab keinen besonderen Ansturm auf das neu eröffnete Hotel mit Restaurant, das am 1. Juli eröffnet wurde. Ein paar Gäste befanden sich auf der Terrasse vor dem neuen Gebäude. Noch kurz vor Mittag war das Restaurant noch menschenleer.
Das Selbstbedienungsrestaurant heißt Smědava/ Wittig und ist von Montag bis Sonntag von zehn Uhr vormittags bis sechs Uhr abends geöffnet. Der Name dieses Restaurants steht über dem Eingang auf einem Stück rostigen Blechs. Die umliegenden Dörfer sind nicht begeistert von der Erneuerung, zu der sie sich nicht äußern konnten. Auch einige Touristen sind von dem Unbau nicht besonders begeistert. Das Isergebirge hat sein Wahrzeichen verloren und wurde durch ein modernes Wellness-Hotel ersetzt.

Das alte Wittighaus hatte eine ruhmreiche Vergangenheit. Das historische Wittighaus war einst für viele Touristen ein fester Bestandteil ihres Ausfluges in das Isergebirge. Das erste Wittighaus wurde an dieser Stelle 1841 errichtet. Am 16. Juni 1932 brannte die ursprüngliche Hütte ab, 1935 wurde eine neue Hütte gebaut. Das Gebäude, das 1935 gebaut wurde, wurde im Oktober 2021 abgerissen. Das Restaurant hatte 110 Sitzplätze, die Kapazität der Terrasse wurde mit 120 Personen angegeben.

Im umstrittenen Fall Wittighaus gehen die Meinungen
stark auseinander. Der Neubau sorgt für Diskussionen. Der Abriß löste großes Aufsehen in den sozialen Medien aus und spaltete die Gesellschaft in zwei Lager. Vielen Menschen gefällt der vollständige Abriß und die Zerstörung eines traditionellen Standortes nicht.
„Wenn Sie sich alle Grundstükke von Jindřich Řehák ansehen, werden Sie feststellen, daß sie alle auf diese Weise entstanden. Trotz des Widerstands von Denkmalschützern, Historikern und anderen Behörden verschwanden die ursprünglichen Gebäude, und es entstanden völlig andere Gebäude, die der Eigentümer für einen sehr starken kommerziellen Zweck benötigt“, betonte der Haindorfer Bürgermeister Jaroslav Demčák. Jindřich Řehák ist der Besitzer, dem auch das nahe Hotel Montanie an der Talsperre Darre und das Hotel
Antonie in Friedland gehören.
Für die Touristen steht ein Parkplatz zur Verfügung. Parken kostet umgerechnet 4,20 Euro. Für die Besucher des Hotels stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Alle Übernachtungen können nur mit Halbpension und mindestens für zwei Nächte gebucht werden. Das kostet für zwei Personen im Doppelzimmer zwischen umgerechnet 400 bis 500 Euro. Aufenthalte für einen Nacht können nur am Tag vor der Ankunft mit einem Aufpreis von umgerechnet 14 Euro pro Person gebucht werden. Die Unterkunft wird ganzjährig betrieben.

Unterkunft mit Haustieren ist in dem Hotel nur auf Anfrage gegen eine Gebühr von umgerechnet 21 Euro möglich. Auf einer Infotafel, die sich vor
Das Gebäude, das früher als Kinderaugensanatorium diente, wurde vor langer Zeit von Patienten und medizinischem Personal verlassen. An dem Gebäude, das sich im Besitz der Stadt Reichenberg befindet, haben der Zahn der Zeit, die Natur und Vandalen genagt. Seit Jahren kümmert sich niemand darum. Das gesamte Areal sowie das Gebäude werden immer noch zum Kauf angeboten. Der Bürgermeister von Reichenberg hat vor einiger Zeit angedeutet, daß er, falls bis Ende des Jahres kein Käufer gefunden werde, die Möglichkeit erörtern wolle, das Gelände als Sitz des Reichenberger Stadtwaldes und für ökologisch orientierte Aktivitäten für Schulen und gemeinnützige Organisationen zu nutzen.



Kotek planten, an die Gebäudegeschichte anzuknüpfen und in Machendorf ein modernes Sanatorium zu errichten. Das scheiterte jedoch.

Der allgemeine Verfall zeigt sich innen fast noch auffälliger als außen.
dem neuen Gebäude befindet, werden die Touristen in tschechischer und englischer Sprache über den Parkplatz informiert. Informationen in deutscher Sprache gibt es nicht. Viele der an diesem Tag auf dem Parkplatz geparkten Autos kamen aus Deutschland.

Aus Haindorf kommt man mit Bus oder Auto über die 1893 bis 1895 gebaute kurvenreiche Wittighaus-Straße, die von Weißbach hinführt, zum Wittighaus. Stanislav Beran
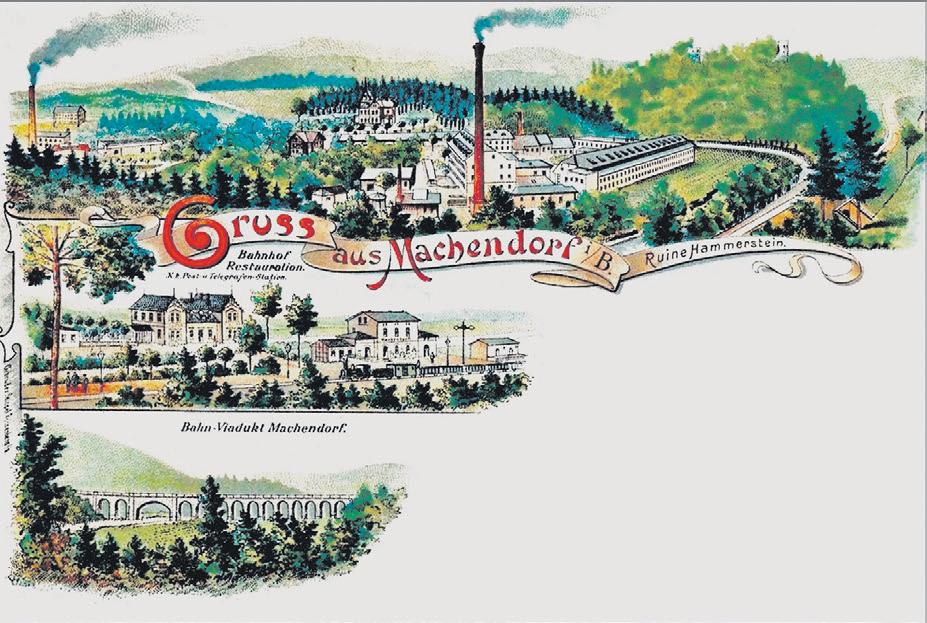

Die Villa und das Grundstück mit einer Fläche von knapp 38 000 Quadratmetern wurden bereits einmal zum Verkauf angeboten. Der Preis lag bei mehr als umgerechnet 830 000 Euro, aber es konnte kein ernsthafter Käufer gefunden werden.
Die Stadt Reichenberg besaß die einst prachtvolle und heute verwahrloste Villa bis 1999. In jenem Jahr wurde sie für den Preis von umgerechnet 58 000 Millionen an das Medizinische Rehabilitationszentrum Reichenberg, später Sanatorium Machendorf, verkauft. Die Reichenberger Ärzte unter der Leitung von Miroslav Samek und Vojtěch
Der niedrige Preis war damals an die Verpflichtung geknüpft, dort Gesundheitsdienste anzubieten. Andernfalls hätte die Stadt das Recht gehabt, das Gebäude nach zehn Jahren zurückzukaufen. Doch dazu kam es aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nicht. Außerdem ging das Unternehmen in die Insolvenz. Die Villa wurde 1882 als Familienwohnsitz von dem Politiker und Textilfabrikanten Adolf Schwab errichtet. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war die alte imposante Villa angeblich Sitz des Fabrikbesitzers Kleinert. In der Vorkriegszeit – belegt ist das Jahr 1838 – befand sich in der Machendorfer Villa ein Mütterfreizeitheim. Nach der Verstaatlichung wurde hier 1955 – also unter dem kommunistischen Regime –ein Augensanatorium für Kinder aus der ganzen Tschechoslowakei eröffnet. Seit 1999 ist die Kleinert-Villa baufällig. Der Stadt Reichenberg ist es bisher nicht gelungen, das Gebäude zu verkaufen oder einen Käufer zu finden. Wenn man sieht, wie das Gebäude heute aussieht, ist es schwer zu glauben, daß dort vor mehr als 30 Jahren noch Kinder ärztlich behandelt wurden. Die ehemalige Augenklinik, einst der Stolz von Machendorf, hat sich im Laufe der Jahre in eine Ruine verwandelt. Das Gebäude ist von holzzerstörenden Krankheiten und Schädlingen befallen und seine Statik beschädigt. Aus diesem Grund ist es vom Abriß bedroht. Das Gebäude der ehemaligen Kleinert-Villa vergammelt immer mehr. Optisch macht es einen erbärmlichen Eindruck. Es ist ein Schandfleck. Stanislav Beran
 Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel
Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel
Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 16
Kreis Friedland Kreis Gablonz
Das Wittighaus in deutscher Zeit.
Die Wittighausbaude 2005 …
Das neue Wittighaus.
…
Bilder (3): Stanislav Beran
und 2022 kurz vor dem Abriß.
Tschechisch-englische Infotafel. ❯ Isergebirge
Alte Postkarte von Machendorf mit der von Adolf Schwab erbauten Kleinert-Villa oben in der Mitte.
Die Berliner Gäste Dr. Hermann Tschiedel und sein Sohn vor dem Eingang zum Restaurant unter dem Schild Smědava/Wittig.
❯ Region Reichenberg
Zerbrechliche Schönheit
Glas- und Schmuckerzeuger zeigten und zeigen im August in der Region Reichenberg ihre Kunst. Den Auftakt machte die Ausstellung „Zerbrechliche Schönheit“ Mitte August im Eurocentrum Gablonz.

Dort waren 40 Hersteller von Perlen, Bijouterie, Glas und Weihnachtsschmuck vertreten. Außerdem meldeten sich immer mehr Interessenten, zum Beispiel Modedesigner. Die Verkaufsausstellung mit reichem Begleitprogramm zieht alljährlich Einheimische, Touristen und Händler an. Letztes Jahr kamen 8500 Besucher. Zum ersten Mal fand „Zerbrechliche Schönheit“ 2012 statt. Die Veranstaltung will demonstrieren, daß trotz Rezession, asiatischer Billigkonkurrenz und Konkurs des ehemaligen Exportkonzerns Jablonex die Bijouterie im Lausitzer- und Isergebirge weiterlebt und eine Zukunft hat. Einen Besucherrekord erlebte die Schau vor Corona mit 13 500 Gästen an vier Tagen.
Das Glas- und Bijouteriemuseum Gablonz veranstaltet heuer die Internationale Triennale für Glas- und Bijouterie Gablonz. Sie bietet drei Ausstellungen sowie ein Familienprogramm und einen Kreativ-Workshop an. Dort werden Schmuckstücke aus recyceltem Glas hergestellt.


Morgen findet in Gablonz das völlig neue Kulturfestival Gablonzer Perle statt, das die Geschichte und Traditionen der Glas- und Schmuckherstellung mit Essen, Musik und bunten Märkten verbindet.
Die diesjährige Crystal Valley Week (Kristall-Tal-Woche) wird vom 28. August bis 2. September

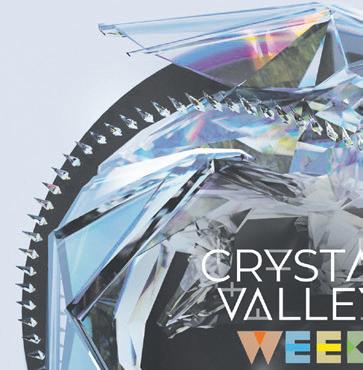
❯ Zwickau/Kreis Deutsch Gabel
Das Schindergründel
Als wir im August 1946 wie viele vor uns ein Opfer der „humanen Aussiedlung“ wurden, war ich zehn Jahre alt. Deshalb konnte ich noch nicht allzuviel gesehen haben von der schönen Umgebung unseres Heimatstädtchens Zwickau, zumal im Krieg mit seinen Sorgen und Einschränkungen die Lust auf Ausflüge und Reisen eher gering war. So beschränken sich meine Erinnerungen auf die nähere Umgebung.
In den entbehrungsvollen ersten Jahren nach der Vertreibung in die damalige Ostzone war das Heimweh besonders stark, und in der Familie wurde oft voller Sehnsucht von der schönen verlorenen Heimat gesprochen. So prägte sich mir, was ich schon kennengelernt hatte, besonders gut ein.
Ja, es war halt schön daheim. Wo konnte man nicht überall hingehen, wenn man am Sonntag einen kleinen oder größeren Spaziergang machen wollte. Da waren der Hohlstein mit seinen imposanten Felsgebilden, der Grünerberg mit dem Waldtheater, der Ortelsberg, der Hutberg, die Überschale, wo man hinwandern konnte, oder ins Tal der Einsamkeit und über den Kammweg zurück.
Etwas weiter war es für uns aus dem Niederdorfe schon bis zum Mühlstein, zur Mutter Kriesche, zum Einsiedlerstein und Betgraben oder gar zum Kleis. So kam es mir wenigstens damals vor. Und Jeschken, Lausche und Hochwald waren mir nur aus der Ferne bekannt. Am allerbesten kann ich mir noch das Schindergründl vorstellen. Dorthin sind wir manchen Sonntagnachmittag spaziert, wenn wir noch ein bißchen in den Wald gehen wollten. Wir hatten es ja nicht weit vom Niederdorfe aus. Auch unser Feld lag dort in der Nähe, und wir Kinder durften öfters zum Spielen in den Wald, wenn die Großen auf dem Acker arbeiteten.
Sorten von Bäumen. Fichten, Kiefern, Lärchen, Birken und vielerlei Büsche und Sträucher wuchsen hier. Sogar richtige Weißtannen und Seidenkiefern, die ich, ihrer weichen Nadeln wegen, besonders liebte, fand man dort.
Im Sommer, wenn die Beeren reif waren, gingen wir dort manchmal Heidelbeeren holen. Auch Kroatzbeeren, Himbeeren und Preiselbeeren gab es zu ihrer Reifezeit. Wir Kinder hatten noch wenig Ausdauer beim Heidelbeerpflücken, und sobald wir ein kleines „Tippl“, auf dem die Mutter bestand, voll hatten, sahen wir uns nach einem anderen Zeitvertreib um. Es war nicht schwer, einen solchen zu finden. Da war eine schöne, steile Lehne mit weichem Waldgras bewachsen, die sind wir auf dem Hosenboden hinuntergerutscht.
Der Mutter gefiel das weniger gut, deshalb suchte sie für den nächsten Tag extra alte Hosen heraus. Da waren auch ein paar größere Sandsteinfelsen auf denen wir gerne herumkletterten. Der eine der Felsen hatte auf einer Seite eine ziemlich gerade
se genommen oder auf den Friedhof gebracht als Gruß für die Verstorbenen. Es war übrigens Sitte, die Gräber mit weißem Sand zu umstreuen, und diesen Sand holten wir ebenfalls aus dem Schindergründl.
Auf dem Hohlstein befindet sich ein in die senkrechten Steinbruchwände gehauenes Relief des Dichters Theodor Körner. Es wurde zu seinem 100. Todestag 1913 von Oberlehrer Karl Beckert und Gendarmerie-Wachtmeister Karl Bundesmann, zwei Künstlern und Mitgliedern des Gebirgsvereins, geschaffen.

Kletterwand mit einigen Vertiefungen, in denen Hände und Füße halt finden konnten. An dieser Wand hing ich einmal und kam nicht mehr vor noch zurück. Ich hatte schon Angst abzustürzen, schaffte es aber mit großen Anstrengung doch noch, auf die obere Plattform zu gelangen. Von da fiel der Felsen nach der anderen Seite sanft ab, und man konnte bequem hinunter gelangen.
Schon damals hatte ich ein Auge für die vielfältige Schönheit dieses kleinen Wäldchens. Mein Vater hatte mich das sehen gelehrt. Da gab es alle möglichen
❯ Haindorf/Kreis Friedland
in Reichenberg laufen. Die Glasmacher werden auf den Straßen arbeiten und Glas in seinen vielen Formen präsentieren. Gleichzeitig werden sonst unzugängliche Orte geöffnet. Und das auch an ganz unerwarteten Stellen wie dem Straßenbahndepot oder im Café Post auf dem Dr.-EdvardBeneš-Platz. Die Besucher werden zum Beispiel zerbrechliches Glas mit floralen Motiven inmitten seltener Pflanzen im Botanischen Garten finden können.
Zum Festival gehören Ausstellungen, kostenlose Fahrten in einer Kristallstraßenbahn, Führungen durch den neu renovierten historischen Liebieg-Palast mit seinen historischen Kristallüstern sowie eine zweitägige Verkaufsausstellung von Schmuck und Modeschmuck in der Wissenschaftlichen Regionalbibliothek und weitere Begleitprogramme. Am 31. August wird sich der Marktplatz vor dem Rathaus in einen Kristallmarkt mit Ständen, Designerstücken, kreativen Workshops und Vorführungen verwandeln. Petra Laurin
Wenn die Zeit dafür da war, blühte hier die Bienenheide oder Erika in so intensivem Lilarot wie nirgends sonst, und manches Sträußchen wurde mit nach Hau-
Eine Höhle gab es sogar, sie war aber sehr mit Gesträuch zugewachsen. Deshalb untersuchten wir sie nicht näher, wohl auch aus Furcht vor Tieren, die wir hier vermuteten. Zum Aasfriedhof, der mitten in dem Wäldchen lag und nur dadurch, daß er durch einen baufälligen Zaun von seiner Umgebung abgegrenzt wurde, überhaupt erkennbar war, ging ich nicht gerne alleine. Es war mir da immer etwas unheimlich zumute. Besondere Freuden erwarteten uns natürlich zur Pilzzeit. War uns das Glück hold, hatten wir bald einen Korb voll mit den schönsten Exemplaren für eine feine Pilzsuppe oder gar eine ganze Mahlzeit. Da durfte einem freilich keiner zuvorgekommen sein, der die Rotkappen, Birkenpilze, Pomasliche, Hienliche und Herrenpilze in seiner Tasche heimgetragen hatte. Schon daheim in Zwickau habe ich mich gefragt, wie denn so ein schönes Fleckchen Wald zu so einem Namen gekommen ist. Das Gründl läßt zwar Schönes vermuten und schwächt den „Schinder“ etwas ab, aber mit Schinder verbindet man keine angenehme Vorstellung. Darunter versteht man jemanden, der andere quält und unterdrückt. Schinder ist auch die alte Berufsbezeichnung für den Abdecker, der an Alter und Krankheit gestorbene Tiere beseitigte, die dann auf dem Aasfriedhofe begraben wurden. So wird der Name hier seinen Ursprung haben. Viel Zeit ist vergangen. Bei einem Zwickau-Besuch vor einigen Jahren fand ich nicht einmal mehr unser Feld. Die alten Wege sind verschwunden, der Bewuchs veränderte sich, alles ist anders. Das Vergangene findet man nicht mehr dort, wo es einst war, sondern nur noch in sich, im reichen Schatz der Erinnerung, die einem nicht genommen werden kann.
Waltraud Joist
Villa wird Denkmal
Die Villa Simon in Haindorf im ehemaligen Kreis Friedland wurde zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt.
Die klassizistische Villa von Emil Simon mit Art-décoElementen in dem IsergebirgsWallfahrtsort Haindorf wurde zum Kulturdenkmal erklärt. Die Villa hatte Rudolf Bitzan entworfen. Der Baumeister Rudolf Hampel aus Friedland erbaute sie 1917 für Eduard Fritsch, den Besitzer der mechanischen Weberei Fritsch & Co. Vier Jahre später kaufte der Fabrikant Emil Simon sie zusammen mit einem großen Grundstück.

1935 renovierte Josef Franz Lange aus Raspenau zum letzten Mal die Artdéco Innneneinrichtung, nachdem der Gablonzer Exporteur Carl Witt das Gebäude gekauft hatte. Er ließ sogar eine dem heiligen Antonius geweihte Kapelle im Garten errichten. Dieses kleine Gebäude,
das auf den Fundamenten des historischen Wasserturms gebaut wurde, ist jedoch nicht erhalten geblieben.
Die mehr als hundert Jahre alte klassizistische Villa von Emil Simon diente 1946 bis 2021 als Kindergarten. Heute beherbergt sie Flüchtlinge aus der kriegsgeschüttelten Ukraine.
Die nach den Plänen von Rudolf Bitzan errichtete und später veränderte Villa ist über die
Idylle in der Sankt-Anna-Kirche
Seniorenchöre aus Gablonz und seiner Partnerstadt Kaufbeuren in Bayerisch-Schwaben treffen sich Ende August im Isergebirge und konzertieren gemeinsam. Diese Begegnung nennt sich Idylle nach dem gleichnamigen Orgelstück von Chorleiter und Organist Albin Wirbel aus Kaufbeuren-Neugablonz, das er vor fünf Jahren für die Freundschaft der beiden Städte komponiert und in Gablonz uraufgeführt hatte.

owitz. Albin Wirbel, eine rauschende Quelle voller musikalischer Energie, gibt am Tag vor dem Chorkonzert ein Solokonzert auf der kürzlich renovierten Orgel in der Gablonzer Herz-Jesu-Kirche. Mittel für die Renovierung der Orgel brachte auch sein Konzert 2018.
Stadtgrenzen hinaus für ihre architektonischen Qualitäten bekannt und zählt zu den interessantesten und ursprünglich erhaltenen Gebäuden in der Region. Sie ist nicht das einzige Kulturdenkmal in Haindorf. Das Wertvollste ist die barocke Basilika Mariä Heimsuchung, die seit 2018 zu den Nationalen Kulturdenkmalen in der Tschechischen Republik gehört.
Stanislav Beran
Heuer kommt Albin Wirbel mit seinen beiden Chören, dem Seniorenchor ,Ü60‘ und dem Kammerchor ,Bona Vox‘“, sagt Veranstalter Borek Tichý von der römisch-katholischen Pfarrgemeinde in Gablonz. Die deutschen Sänger treffen sich mit dem Gablonzer Chor „Izerína“, der im Zentrum für soziale Dienste der Stadt Gablonz unter der musikalischen Leitung von Jiří Koun beheimatet ist.

Vitrine mit deutschen Gesangsbüchern.
Die Idee für das heurige Treffen entstand nicht zufällig. Sie knüpft an die reiche Tradition des Vereinsgesangs an, die nach dem Krieg gewaltsam unterbrochen wurde. Ein Beweis dafür sind auch verlorene Gesangsbücher, die in der Eingangshalle des Hauses der Vereine von Gablonz im August ausgestellt sind. „Die wenigsten Vertriebenen hatten sie mit in die Vertreibung genommen. Und die meisten neuen Bewohner warfen sie weg“, erklärte Tichý.
Für die Öffentlichkeit sind zwei Konzerte geplant. Bei einer gemeinsamen Probe verfeinern sie das vorbereitete Repertoire für die festliche Aufführung, die am 30. August unter dem Titel „Geben und nehmen“ in der Kirche Sankt Anna stattfindet. „Der Hauptzweck unserer Veranstaltung ist, Menschen mit gleichen Interessen zusammenzuführen“, sagt Tichý. Er hofft, daß bei der Begegnung neue Kontakte und musikalische Ideen entstehen.
Die Sänger besuchen auch das Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Gablonz-Rein-
Laut Historikern gewähren die Gesangsbücher aber einen lebendigen Einblick in das frühere Leben der Menschen. Man kann dort viele echte Meisterstücke entdecken. Im „Vaterländischen Liederbuch“ von 1914 gibt es zum Beispiel das bekannte Kinderlied „Häschen in der Grube“ mit genau dem gleichen Inhalt wie in der tschechischen Fassung, wobei die deutsche Version sogar zwei Strophen hat. Man findet dort auch das beliebte Lied im Gablonzer Dialekt – das ist Paurisch – „O mann‘r Ziege ho ich Frejde“, das bei vertriebenen und verbliebenen Deutschen bis heute sehr beliebt ist.
Petra Laurin
TERMINE
■ Freitag, 1. bis Sonntag 3. September: 65. und letztes Kriesdorfer Treffen im Hotel Gondelfahrt, Großschönauer Straße 38, 02796 Luftkurort Jonsdorf, Telefon (03 58 44) 73 60.
Samstag Besuch im heimatlichen Kriesdorf. Übernachtungen bitte selbst reservieren. Auskunft: Karin und Franz Josef Schäfer, eMail schaeferkarinfranz@gmx. net
 Der Chor „Ü60“ aus Kaufbeuren.
❯ Gablonz und Kaufbeuren
Der Chor „Ü60“ aus Kaufbeuren.
❯ Gablonz und Kaufbeuren
Blick in die Ausstellung. Bild: Jana Fričová
Die Villa Simon. Bild: Stanislav Beran
REICHENBERGER ZEITUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 17
Der Gablonzer Chor „Izerína“ und seine Instrumentalisten.
Anfang August gedachte der Verein der Freunde von Sankt Katharina in Boreslau mit einem lebendigen Bild vor der Katharinenkirche sowie einem Vortrag und einer Miniausstellung in der Kirche des Julius Ritter von Payers (* 1841 in Teplitz-Schönau, † 1915 im slowenischen Veldes). Payer war ein österreichisch-ungarischer Offizier, Polar- und Alpenforscher, Kartograph und Professor der Militärakademie, der sich auch als Maler einen Namen machte. Jutta Benešová war bei dem Gedenken dabei.
Im November (➝ HR 45/2022)
berichtete ich anläßlich der Nacht der Kirchen über einen Besuch der Sankt-KatharinenKirche in Boreslau. Damals schrieb ich über die enge Beziehung der Familie Clary und Aldringen in Teplitz zu dieser Kirche, aber auch über die lange Zeit der Vernachlässigung und über die gemeinnützige Gesellschaft der Freunde von Sankt Katarina.


Die Gesellschaft versucht, mit verschiedenen Aktionen zumindest zu einer Instandhaltung der jetzigen Kirche beizutragen. Weihnachtsmessen, Aufräumaktionen auch um die Kirche herum, die dank ihrer Lage mit dem zauberhaften Ausblick auf das Tal von Teplitz mit dem Erzgebirgsmassiv ihres Gleichen sucht, oder auch Einladungen zur Nacht der Kirchen locken stets zahlreiche Besucher an.
In den Wochen der großen Hitze des diesjährigen Sommers entstand der Gedanke, eine Gedenkfeier an den Polarforscher Julius Payer zu veranstalten, um den Teilnehmern ein wenig das Gefühl einer Abkühlung zu geben. Nach dem berühmten Gemälde von Julius Payer „Nie wie-
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau
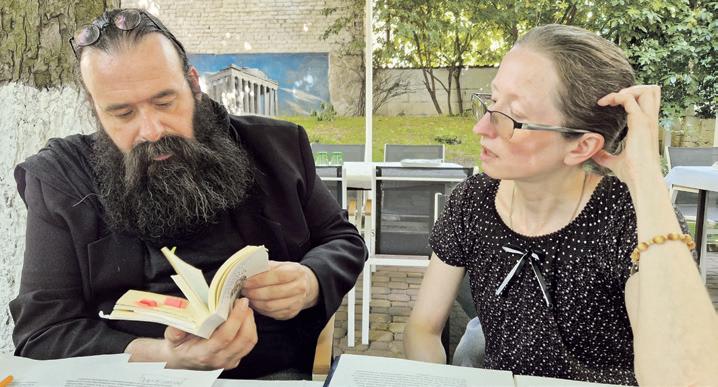

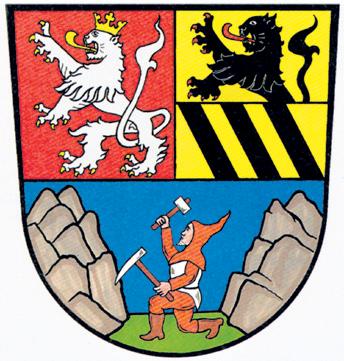
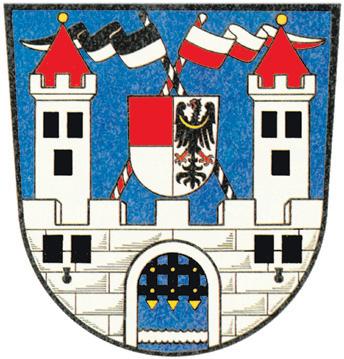

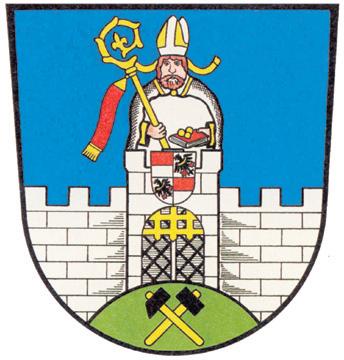
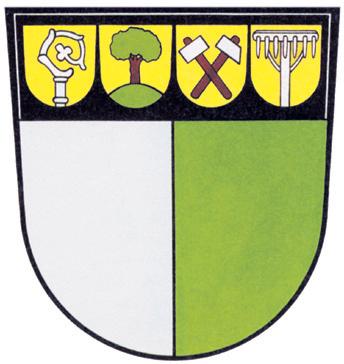



Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt
Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Komotau

Fiedlers Chronik
Auf den Webseiten der Erzgebirgszeitung www.krusnohori.cz fand unsere Korrespondentin Jutta Benešová folgenden Artikel über eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Jiří Wolf, Historiker und Mitglied des 2021 gegründeten Teplitzer Vereins, beteiligt sich als Mitarbeiter der Museen in Dux und Teplitz an Projekten, die sich der Historie unserer erzgebirgischen Region widmen. Organisatorisch unterstützen ihn bei der Veröffentlichung seiner Forschungsarbeit auch der Georgendorfer und Teplitzer Verein unter Petr Fišer.
der zurück“ sollte auf der Wiese vor der Kirche ein lebendiges Bild gestaltet werden, wie auch schon zuvor – auch einstmals im Sommer – ein lebendiges Bild der Franklin-Expedition (1845–1848) vor dem Teplitzer Gartenhaus gestaltet worden war.


Sehr aktiv bei solchen Veranstaltungen ist dabei die Teplitzer Theatergesellschaft Max Frisch, die alljährlich zu Payers Geburtstag in Schönau eine kleine Feierlichkeit organisiert. Dazu gehört
lichst alte, historisch nahe Winterbekleidung wie Fellmützen und -stiefel, alte Mäntel, Schals und Handschuhe, eventuell auch Skier, Schlitten und – ganz wichtig – Hunde mitzubringen, die bei einer Polarexpedition nicht fehlen dürfen. Weiblichen Teilnehmern wurde mit schwarzem Stift sofort ein Bart verpaßt, auch den zahlreichen kleinen Teilnehmern, die den meisten Spaß daran hatten. Polarexpeditionen waren doch immer Männersache!
Zdeněk Lyčka

Zdeněk Lyčka studierte an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität für Bergbau und Technologie in Mährisch Ostrau und an der Karls-Universität. Vor der Samtenen Revolution war er Programmierer, danach im Außenministerium. 1991 bis 1996 diente er an der Tschechischen Botschaft im dänischen Kopenhagen, 2008 bis 2012 als Botschafter. Darüber hinaus war er Direktor des Tschechischen Zentrums in Schwedens Hauptstadt Stockholm.
auch Jitka Bažantová vom Teplitzer Museum, die mit ihrem Partner Martin Ryba Vorführungen von lebendigen Bildern exzellent zu organisieren vermag.
In der Einladung für den 4. August wurde zur aktiven Teilnahme aufgerufen, das hieß mög-
Er widmete sich auch der Übersetzung nordischer und angloamerikanischer Literatur. Mit seiner Frau Viola übersetzte er grönländische Mythen und Legenden von Knud Rasmussen. Für das Buch erhielt er den Josef-JungmannPreis. 2011 durchquerte er mit drei Dänen Grönland auf Skiern. Über diese Reise veröffentlichte er das Buch „On Skis Across Greenland“. Später veröffentlichte er sein zweites Buch „Kajakfahren von Prag bis zur Nordsee“.
Natürlich entbehrt eine solche „Performance“ nicht einer gewissen Komik – aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dargestellt wurde der Entschluß der damaligen Polarexpedition, das im Eis gefangene Schiff zu verlassen und zu versuchen, zu Fuß das ret-
tende offene Meer zu erreichen. Deswegen wurden dann auch, als endlich ein einigermaßen passendes Bild zusammengestellt war, die Teilnehmer aufgefordert, nicht wie gewohnt freundlich zu lächeln, sondern eine der ernsten Situation angepaßte Mine zu zeigen. Das war bei der guten Laune nur schwer möglich, auch angesichts der Verkleidungen, die oft recht komisch wirkten, zumal sich im Sommer im Hintergrund statt Eisbergen das Erzgebirge erhob. Und statt der großen kämpferischen Schlittenhunde, die sich früher mit Eisbären anlegen mußten, standen hier außer einem vergleichsweise stattlichen Collie und zwei Terriern auch etliche kleine Kläffer. Das Bild war umwerfend!

Doch die Veranstaltung hatte auch einen ernsteren Teil, der anschließend in der Kirche stattfand. Zdeněk Lyčka, ehemaliger Botschafter in Dänemark, hielt einen Vortrag über die Vorbereitungen der Polarexpeditionen, an denen Julius Payer teilgenommen hatte. Dazu stellte das Schloßmuseum eine Sammlung von Payers Zeichnungen in der Kirche aus, mit denen er seine Erlebnisse während der Expeditionen festgehalten hatte –Kunstwerke ganz besonderer Art.
Bei einer „Afterparty“ neben der Kirche wurden bei anregenden Gesprächen Grog und Glühwein, aber natürlich auch andere kleine Erfrischungen angeboten. Die gut besuchte Veranstaltung endete mit einem Gruppenbild vor der Kirche. Dem aktiven Freundeskreis der Sankt-KatharinenKirche bleibt zu wünschen, daß seine Bemühungen um die Erhaltung der Kirche in Boreslau weiterhin Erfolg haben.
Nach vielen hundert Jahren gibt die Weltchronik des Komotauer Bürgers Fiedler ihr Geheimnis preis. Dank des DeutschTschechischen Zukunftsfonds (DTZF) entschlüsseln deutsche und tschechische Historiker und Sprachwissenschaftler gemeinsam die wiederentdeckte Handschrift des Komotauer Bürgers Andreas Augustin Fiedler aus dem 17. Jahrhundert.
Am 1. Juni 2019 trafen sich der Historiker Jiří Wolf und Jana Maroszová, Expertin für deutsche Sprache in der Barockzeit, zum ersten Mal, um sich der Fiedler-Handschrift, die in den Sammlungen des Museums in Dux entdeckt wurde, zu widmen. Dieses in Deutsch geschriebene Buch „Kuertze Beschreibung der Vornembsten Geschichten so sich a Mundo Condito Biess auff Jezige Zeit Hien unndt hehr zuegetragen haben“ aus dem vorerzgebirgischen Komotau enthält die „Geschichte der Welt“, wie Andreas Augustin Fiedler diese wahrgenommen hatte. Und sie enthält natürlich auch die Geschichte des Vorerzgebirges, in der diese Chronik entstand.
Beide Experten bewerteten das Manuskript in vielerlei Hinsicht als einzigartig und machten sich daher an die Transkription.
Nach vier Jahren Arbeit ist die Zeit gekommen, Fiedlers Weltchronik der Fachöffentlichkeit vorzustellen. Bei den geplanten Treffen mit deutschen Historikern soll die Bedeutung von Ausdrücken aus dem Altdeutschen aufgespürt werde, die bisher noch nicht entziffert werden konnten. Der Text wird von histo-
rischen und sprachwissenschaftlichen Kommentaren begleitet. Nicht zuletzt wollen sich die Experten auch auf die aufgezeichneten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Bergbau im Erzgebirge konzentrieren, das heute zum UNESCO-Welterbe gehört. Da es sich um ein interessantes Werk aus Komotau handelt, fand das erste Treffen von Historikern aus Dux und Komotau mit deutschen Kollegen aus Annaberg-Buchholz, der Partnerstadt von Komotau, Mitte Juli statt. Unsere Korrespondentin Jutta Benešová bleibt am Ball.
TERMINE
■ Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: 9. Teplitz-Schönauer Kreistreffen in der Heimat. Donnerstag eigene Anreise nach Teplitz-Schönau (Teplice), Hotel Prince de Ligne (Zámecké náměstí 136); 19.00 Uhr dort Abendessen; anschließend zwei Dokumentarfilme über die Zeitzeugen Pater Benno Beneš SDB (1938–2020) und Hana Truncová/John (1924–2022). Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Saubernitz (Zubrnice) im Böhmischen Mittelgebirge; dort Besichtigung des Freilichtmuseums; anschließend Mittagessen in der Dorfgaststätte und Weiterfahrt nach Leitmeritz (Litoměřice); von dort Schifffahrt auf der Elbe mit Kaffee und Kuchen nach Aussig (Ústí nad Labem); Rückfahrt zum Abendessen in der Teplitzer Brauereigaststätte Monopol. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt in die Königstadt Kaaden (Kadaň); dort



Besichtigung des Franziskanerklosters mit Mittagessen in der Klostergaststätte und Rundgang; anschließend Kranzniederlegung auf dem Friedhof am Denkmal für die Opfer des 4. März 1919; 19.00 Uhr festliches Konzert in der Schönauer Elisabethkirche; anschließend Abendessen im Wirtshaus. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienstmöglichkeit in der Dekanatskirche Johannes der Täufer am Schloßplatz und eigene Heimreise. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag inklusive drei Übernachtungen, Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, allen Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Schiff und Konzert pro Person im Doppelzimmer 435 Euro, im Einzelzimmer 520 Euro. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Auskunft: Erhard Spacek, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail spacek@teplitz-schoenaufreunde.org
 Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg
18 Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023
❯ Boreslau/Kreis Teplitz-Schönau
„Nie zurück“
Julius Payer malt das Bild 1892.
Das lebende Bild 2023 in Boreslau.
Blick in die Kirche und auf den Refernten Dr. Zdeněk Lyčka, rechts die Miniausstellung. Originalbilder von Julius Payer.
Historiker Dr. Jiří Wolf und Sprachwissenschaftlerin Dr. Jana Maroszová
Das Hotel Prince de Ligne auf dem Schloßplatz hinter der Pestsäule.
HEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ

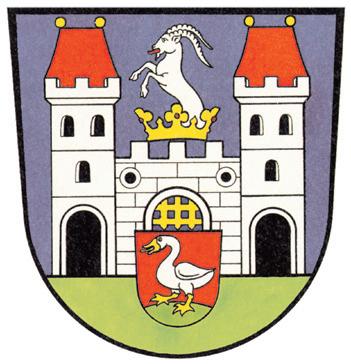
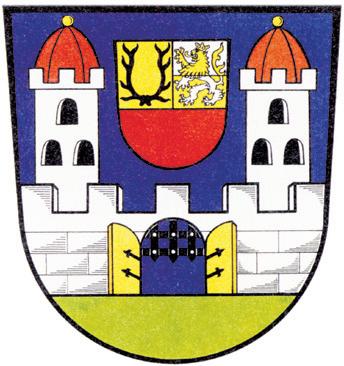
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

František Lorenc
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei 1836 bis 1938. Hier der sechste Teil über den Dechanten František Lorenc (1882–1941) und der letzte Teil der Fortsetzung.
Ronsperg. Am 1. Juli heiratet Professor Dr. Gerhard Sabathil, Botschafter a. D., im Ronsperger Rathaus. In diesem Rathaus war sein Großvater, der Ronsperger Apotheker Ernst Sabathil, bis 1945 Bürgermeister. Dessen Apotheke ist heute eine Vinothek (rechts). Gerhard Sabathils Frau Dr. Wenwen Shen stammt aus Chengdu, der Hauptstadt Sichuans. Diese Provinz der Volksrepublik China ist für ihre Pandabären und ihre scharfe Küche berühmt. Wenwen Shen lebte lange in England, Belgien, Neuseeland und Südkorea. Das Paar lebt mit seinen drei Kindern Felicity, Constantin und Sisi in München und im ungarischen Waitzen/Vác. Vor dem Ronsperger Stadtgemälde im Trausaal stehen Karin Stelzer, Trauzeugin sowie Kultur- und EU-Referentin von Furth im Wald, Gerhard Sabathils ältere Tochter Marie Pia aus Berlin mit Felicity auf dem Arm, Sisi und Wenwen Shen, Gerhard Sabathil und Constantin, Sabathils Freund Josef Müllner aus Wihorschau bei Putzeried im heutigen Kreis Taus, Bürgermeister Martin Kopecký mit Amtskette und die Standesbeamtin Marie Prančlová.

■ Schiefernau. Am 28. Januar starb der langjährige Ortsbetreuer Sigmar Mahal mit 83 Jahren in Koblenz. Am 8. August 1939 war er in Schiefernau zur Welt gekommen. Einen knappen Monat später brach der Krieg aus. Der Vater wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Er galt bald als vermißt. Im Zuge der Vertreibung kam er mit Mutter und Schwester in verschiedene Flüchtlingslager, darunter das Lager Galgenberg in Würzburg. Schließlich wurde ihnen eine Wohnung in der Zellerau zugewiesen. Sigmar durchlief viele Stationen in seinem Berufsleben und fand in Koblenz ein Zuhause. Der ledige Landsmann war ein fleißiger Besucher der Heimatkreistreffen und Kirchsprengeltreffen in Berg. 2001 übernahm er die Ortsbetreuung von Schiefernau. Am 7. Februar wurde er im unterfränkischen Margetshöchheim, dem Wohnort seiner Schwester Irmgard, beerdigt. Dankbar für Siegmar Mahals langjährige Heimatarbeit wünscht Heimatkreisbetreuer

Peter Pawlik ihm Frieden in der ewigen Heimat bei Gott. Sein aufrichtiges Mitgefühl gilt Irmgard Mahal. Nadira Hurnaus
■ Bischofteinitz. Wie Carolin Launspach im „Gießener Anzeiger“ und in der „Gießener Allgemeinen Zeitung“ berichtete, feierte Elisabeth Erbes, geborene Vondras, im hessischen Hattenrod 90. Geburtstag. Im Kreise einer großen Gratulantenschar ließ sie den Tag entspannt angehen. Schwiegertochter Gabriele Erbes hatte die Örtlichkeit des Festes entsprechend ehrwürdig dekoriert. Die Jubilarin kam in Bischofteinitz zur Welt. Sie berichtete voller Stolz, daß das
WIR BETRAUERN
■ Zetschowitz. Am 30. Juli starb Josef Friedrich mit 95 Jahren im hessischen Melsungen. Zur Welt gekommen war er am 17. Juni 1928 in Zetschowitz. In seiner im Heimatboten veröffentlichten Chronik der Trachtengruppe „Am Anfang war das Lied“ gesteht er, kein Mann der ersten Stunde gewesen zu sein. Doch er begeisterte sich schnell für die Arbeit in der Trachtengruppe und übernahm nach Rudolf Kiefners Tod 1996 deren Leitung. Er übernahm damit das Zepter in Wolfershausen, führte es erfolgreich weiter. Bei allen größeren Veranstaltungen wie Hessentage, Tage der Heimat, Stadt- oder Dorffeste und vor allen Dingen bei den Heimatkreistreffen in Furth im Wald war die Trachtengruppe des Heimatkreises im Einsatz. Für sein Wirken im Kreisrat wurde er 2019 zum Ehrenkreisrat ernannt. Nach einem Gedenkgottesdienst des Heimatkreises im Oktober in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Melsungen konnte ich dem „Stoinel Bepp“ die Urkunde überreichen. Als Wenzel Niesta 2003 die Ortsbetreuung von Zetschowitz aufgab, nahm sich Josef umgehend dieser Aufgabe an. Er erreichte, daß zu den Heimatkreistreffen wieder ein Gottesdienst in

WIR GRATULIEREN
oberpfälzische Furth im Wald, das 1957 die Patenschaft über die Vertriebenen aus Stadt und Kreis Bischofteinitz übernommen hatte, jedes Jahr zu ihrem Ehrentag eine Geburtstagskarte schicke. Erbes hatte früh den Vater verloren, der im Krieg vermißt wurden. Im Zuge der Vertreibung gelangte sie mit ihren Geschwistern Peter Vondras und Maria Seipp sowie dem Opa nach Westdeutschland. Die Ankunft in Hattenrod gestaltete sich anfangs schwierig, was sich mit den
der Zetschowitzer Kirche gefeiert werden konnte, ab 2019 sogar mit Orgelbegleitung. Dafür und für 15 Jahre Ortsbetreuung erhielt er 2019 die Große Ehrennadel. Der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Melsungen war ergreifend. Nun bleibt mir nur mehr, Josef und seiner Maria zu danken und Josef Frieden beim Herrgott zu wünschen. Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer

■ Sichrowa. Am 6. August starb Franz Vogl in einem Seniorenheim im bayerisch-schwäbischen Diedorf mit 90 Jahren. Geboren wurde er am 31. Mai 1933 in Sichrowa als Sohn der Eheleute Josef Vogl (Harnodel), Landwirt und Maurer, und Margarethe, geborene Faber aus Elsch im Nachbarkreis Tachau. Franz war zweieinhalb Jahre alt, als seine Mutter starb. Der Vater heiratete dann Anna Wartha, und Franz besuchte die Volksschule in Pernartitz. Die Vertreibung brachte die Familie über das Sammellager Holleischen und Furth im Wald ins Lager Hockenheim. Sie strandete in Wortelstetten in Bayerisch-Schwaben. Hier machte Franz Vogl den Volksschulabschluß. Im Raum Augsburg und München machte er eine Maurerlehre und wurde Maurerge-

Jahren dann zum Glück verlor. In Hattenrod lernte sie Karl Erbes kennen. Sie heirateten und bekamen den Sohn Thomas. Elisabeth Erbes arbeitete in Zigarrenfabriken in Reiskirchen und Gießen und war für die „Beringung“ zuständig. Danach wirkte sie 22 Jahre in der Gießener Klinik für Veterinärmedizin. Ihr damaliger Vorgesetzter besucht sie noch heute, so auch an ihrem 90. Geburtstag. Den feierten Familie und Nachbarn sowie Freunde und Bekannte mit ihr.
selle. 1956 baute er mit seinen Eltern in Wortelstetten sein Eigenheim. Dort wohnte er mit seiner Ehefrau Maria Mittbaurer. Der Ehe entstammen die Söhne Ludwig Josef und Franz. Nach Abschluß der Meisterschule 1976 und weiterer pädagogischer Fortbildung wurde er Fachlehrer in der Berufsschule in Augsburg. Dort unterrichtete er bis zum Ruhestand 1996. 1988 hatte er von Josef Soutschka die Ortsbetreuung für Sichrowa und Umgebung übernommen. Das bedeutete, daß er auch die Ortsbetreuung von Pscheß, Holubschen, Garassen und Wabitz übernahm. Im Ruhestand verbrachte er seine Zeit darüber hinaus in Vereinen, als Siedlervorstand und im eigenen Hausgarten. 2009 wurde er zum Ehrenortsbetreuer ernannt. Bis Ende 2017 schickte er dem Heimatboten regelmäßig Geburtstags- und Sterbemeldungen. Am 3. August 2021 starb seine Frau Maria. Seine Landsleute und der Heimatkreis mit Heimatkreisbetreuer Peter Pawlikan der Spitze sind dankbar für Franz Vogls ehrenvolle und tatkräftige Mitarbeit und trauern um ihren Landsmann. Nadira Hurnaus
Angemahnt wird, daß der Hochaltar das Sepulchrum nicht in der vorgeschriebenen Mit-te hat. Um Austausch wird gebeten. Ein Kelch und die Monstranz benötigen eine Vergoldung, die anderen liturgischen Gefäße, Bücher und Paramente sind in gutem Zustand. Ferner wird angeregt das Taufbecken mit einem Emailbecken zu versehen. Auch wird vermerkt, daß der Pfarrhof in guter Verfassung ist. Die Amtsführung Lorencens wird als sehr ordentlich gelobt. Auch das Pfarrarchiv ist in gutem Zustand. Zwar werden einige mangelhafte Einträge in den Matrikelbüchern angeführt, insgesamt aber fällt die
Bewertung positiv aus. Ferner wird vermerkt, daß die Actio catholica eingeführt ist, die sich besonders günstig auf die Restaurierungen und Anschaffungen ausgewirkt hat. Als löblich wird Lorencens Eifer zur Förderung der Caritasbewegung und der katholischen Presse gewürdigt, wenn auch ein Schriftenstand in der Kirche noch anzuschaffen ist. Abschließend wird Lorenc bescheinigt, ein eifriger Seelsorger zu sein, der es versteht, besonders mit der Jugend umzugehen, sie im Herz-Jesu-Verein zu organisieren und für die katholische Jugendbewegung zu schulen. Der letzte Eintrag des Dechanten Lorenc ist ein Bericht über den Tod und die Beisetzungsfeierlichkeiten des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten, Tomáš Garrigue Masaryk, der am 14. September 1937 auf Schloß Lana verstorben ist. Die Eintragungen enden mit der kanonischen Visitation des bischöflichen Vikars des Hostauer Vikariats, Karl Rudy, Dechant in Muttersdorf, am 9. Juni 1938.
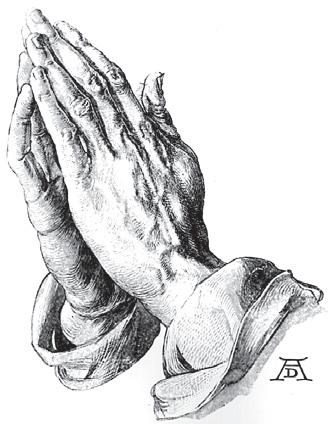
TERMINE
■ Sonntag, 27. August, 11.00 Uhr, Muttersdorf: Gottesdienst anläßlich des Patroziniums in der Sankt-Bartholomäus-Kirche. Bereits am Freitag, 25. August beginnt das Dorffest mit Spielen,

Tanz und Musik. Auskunft: Ortsbetreuer Roland Liebl, Paul-Gerhardt-Straße 14, 71672 Marbach am Neckar, Telefon (0 71 44) 3 91 77, eMail roland.liebl@gmx. net
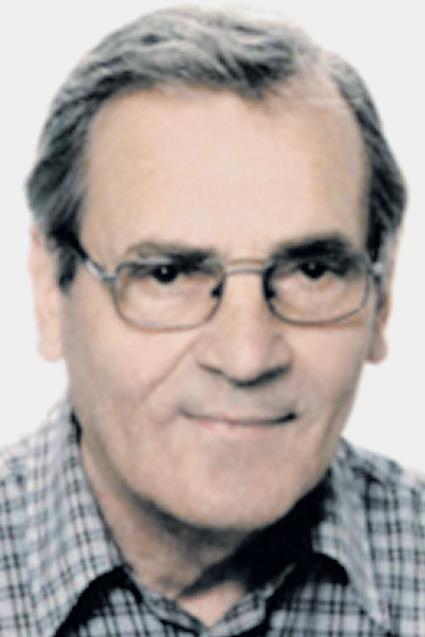
Tief drin im Böhmerwald, da ist mein Heimatort, es ist schon lange her, daß ich von hier bin fort, doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiß, daß ich den Böhmerwald gar nie vergiß
Wir nehmen Abschied von unserem geliebten Vater, Großvater und Ur-Großvater
Josef Friedrich
* 17.06.1928
† 30.07.2023
In tiefer Trauer Familie Friedrich
Die Beerdigung findet am Montag, den 21. August 2023, um 14.00 Uhr in der
Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 19
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XXXII und Schluß
Pfarrer
Die Sankt-Bartholomäus-Kirche in Muttersdorf.
Friedhofskapelle auf
Alten Friedhof
dem
in Melsungen statt.
Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

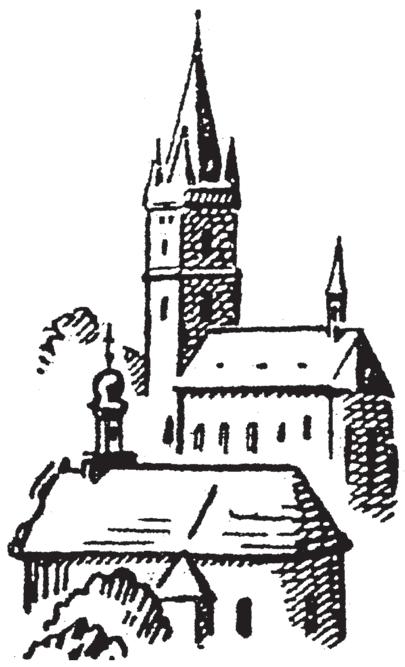
Jakobigottesdienst in der Heimat

Überraschend zahlreiche Menschen waren zum Patrozinium und zum Jakobifest Ende Juli nach Bruck am Hammer gekommen.
Echte Brucker oder mit echten Wurzeln in Bruck waren unter den Gästen zwölf, aber Planer mit Freunden aus München, Berlin, Offenbach, der Haider Gegend, Mähring und Tirschenreuth hatten sich viele vom heiligen Jakobus, dem Patron der Wanderer, nach Bruck leiten lassen. Der älteste Gast war der 92jährige total fitte Roland Mühlbauer, den seine Tochter und seine begeisterte Enkelin zum Heimatfest begleiteten. Eigentlich hatte ihn seine Enkelin, wohl die jüngste Teilnehmerin an diesem Nachmittag, gedrängt, zu diesem Fest zu fahren. Sie liebt diese Ge-
❯ Planer Künstler

gend und interessiert sich für alles, was die Heimat ihres Großvater betrifft.
Drei Priester zelebrierten die Messe. Hauptzelebrant und Prediger war Pater Klaus Kniffki SVD vom Missionshaus Sankt Peter in Tirschenreuth, Konzelebranten waren der Hausherr und Planer Pfarrer Jiří Majkov sowie Pfarrer i. R. Klaus Oehrlein. In seiner Predigt ging Kniffki auf die „Donnersöhne“ Jakobus und seinen jüngeren Bruder Johannes ein, die zwar Hitzköpfe gewesen seien, doch mit ganzem Herzen für Jesus und zum Dienen bereit gewesen seien. Dienen war sein Hauptgedanke.

Jan Knap
Von Jan Knap, einem Maler aus Plan, stammen die neuen Bilder der Seitenaltäre in der SanktJakobus-Kirche in Bruck am Hammer.
Jan Knap kam 1949 im ostböhmischen
Chrudim zur Welt.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 floh der 20jährige 1969 teils zu Fuß über Ungarn, Serbien, Slowenien und Italien in die Bundesrepublik. Von 1970 bis 1972 studierte er an der Akademie der Künste in Düsseldorf bei Gerhard Richter (* 1932 in Dresden).
1972 zog Knap in die USA, und ließ sich in New York nieder. Hier verbrachte er ein Jahr bei der USA-Armee und zwei Jahre in einem buddhistischen Kloster. 1979 gründete er mit Peter Angermann und Milan Kunc die Gruppe „Normal“. Bis heute verbindet die drei eine enge Freundschaft. 1982 bis 1984 besuchte er ein Priesterseminar in Rom. 1984 zog er nach Köln, 1989 nach Modena. Seit 1992 lebt Knap in Plan im heutigen Kreis Tachau.
Christliche Motive prägen seine Bilder, sie befassen sich mit dem Leben der heiligen Familie, mit Jesus, Maria und Josef. Diese drei Menschen beschäftigen den Künstler seit Jahrzehnten. Sein

Werk changiert zwischen bewußter Naivität und vollkommener Ernsthaftigkeit. Die Suche nach Schönheit und Harmonie steht im Mittelpunkt seiner Kunst, wie seine atmosphärisch dichten, von glücklichen Müttern und engelsgleichen Kindern bevölkerten Farbradierungen aus den Jahren 1986, 1989 und 1990 zeigen. 1984 formulierte Jan Knap folgende
neuen Grundsätze:
● „Was ist Malerei? Malerei ist ein Gebet.“
● „Warum male ich? Weil Malen wunderbar ist.“
● „Was ist Erfolg für den Maler? Erfolg ist Ewigkeit.“
● „Was fühle ich, wenn ich male? Die Sehnsucht nach Erfolg.“
● „Wie müssen Bilder sein?
Wie Frauen: Es reicht nicht, daß sie schön anzuschauen sind, wenn sie kein Herz haben.“
● „Wann bin ich ein guter Maler? Wenn meine Malerei positiv ist.“
● „Was ist positiv? Anerkennen, was ist, so wie es IST.“
● „Ist dieses Jasagen zu wenig? NEIN.“
● „Warum wäre es schlauer zu lügen? Weil die Wahrheit einfältig ist.“ Nadira Hurnaus
Gestaltet wurde der Gottesdienst vom Plößberger Quartett „Corona“ unter der Leitung von Florian Löw, dem Leiter des Tirschenreuther Gemeinschaftschores, der auch den Gottesdienst
am Samstag in Sankt Anna in Plan musikalisch begleitete. Margarethe Buchner und ich trugen die Fürbitten mit Bezug zu heutigen Problemen vor.
Für alle Gottesdienstbesucher
gab es beim Eintritt in die Kirche eine angenehme Überraschung. Als Ersatz für die verschwundenen Bilder der Seitenaltären gibt es nun wunderbare, sehr farbenfrohe Gemälde des Planer Künstlers Jan Knap (➝ siehe unten).

Nach dem Festgottesdienst gingen alle mit den Priestern zum Friedhof, wo das Totengedenken und die Gräbersegnung stattfanden. Ursula Stöckl verlas die im letzten Jahr aus dem Kirchsprengel Verstorbenen in Vertretung ihres Vaters Hans Stöckl, der leider nicht dabei sein konnte. Dann ging es ins ehemalige Gasthaus Frank, heute das Gemeindehaus, zum gemütlichen

❯ Sankt-Anna-Wallfahrt auf dem Pfaffenbühl in Mähring Feuerrede
Bei der Sankt-Anna-Wallfahrt in Mähring im Rahmen des Heimattreffens der Plan-Weseritzer gibt es zum Schluß ein Höhenfeuer hinter der Sankt-Anna-Kirche auf dem Pfaffenbühl. Volkslieder werden gesungen, Gedichte vorgetragen, Musik gespielt und eine Feuerrede gehalten. Hier ein Exzerpt aus Ingrid Lesers Feuerrede.
Zum 70. Mal treffen sich Menschen auf dem Annaberg. Hier trifft sich bereits die dritte oder sogar vierte Generation, die fortführt, was Anfang der fünfziger Jahre mutige, weitblickende Menschen begonnen haben.
70 Jahre Sankt-Anna-Kirche, so lange bin auch ich dabei. Ich wuchs langsam hinein in das Annafest und in die Heimat. Ich begriff die Sehnsucht, die ich nun selber im Herzen trage. Und später war das Höhenfeuer das Schönste, das weit hinüber leuchtete in die Heimat.

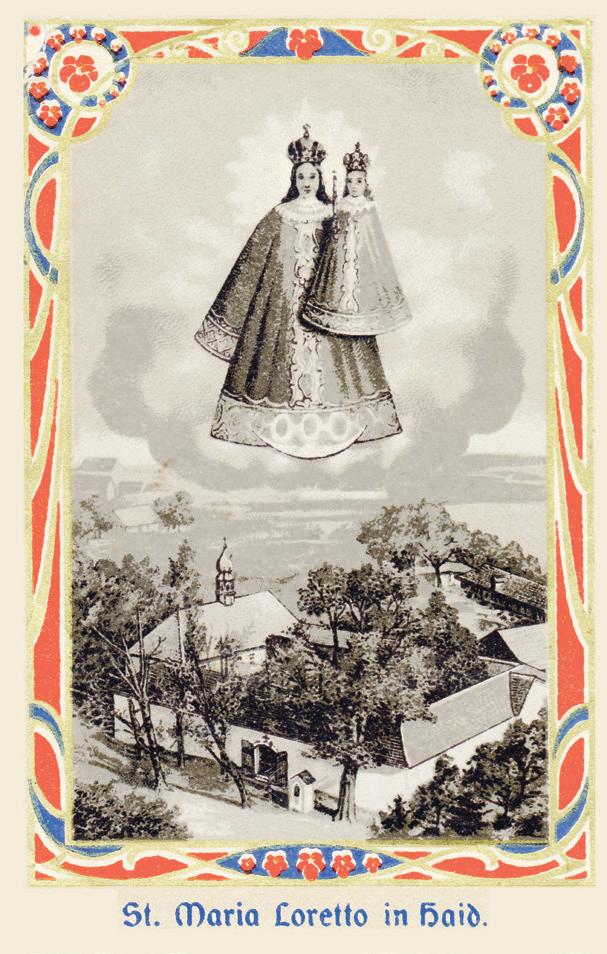
Ein Feuer zünden wir auch heute noch an, obwohl die Grenze jetzt offen ist. Feuer kann brennen und Gutes anrichten oder brennen und vernichten. Feuer kann wärmen und garen und genießbar machen. Das Feuer muß weiter brennen, um die noch rohen und ungeklärten Dinge in der Geschichte zu garen.
Die Vertreibung war für viele Menschen ein vernichten-

des Feuer. Unsere Großeltern, die Besitzergeneration, konnte dieses Feuer kaum ertragen. Sie standen mitten drinnen, viele verbrannten an diesem Unrecht. Viele trugen tiefe Narben davon, hatten einen schweren Neubeginn und litten ein Leben.
Die nachfolgende Generation, unsere Eltern, litt auch unter diesem Feuer der Vertreibung. Aber sie waren noch jung. Ihr Feuer brannte im Herzen als Liebe zur Heimat weiter. Sie setzten in Taten, in Büchern und Chroniken Zeichen. Sie brachten die Heimat aus dem Dunkel der Vertreibung wieder ans Licht. Ihre Liebe zur Heimat strahlte Wärme aus.
Wir, die Bekenntnisgeneration, haben nur noch ein bißchen Glut aus den Erzählungen unserer Großeltern und Eltern erlebt. Aber eine Glut kann wieder Feuer entfachen. Nun ist es die Aufgabe der Nachkommen in dieser Glut zu stochern, damit sie nicht ausgeht, sondern zu neuem Feu-
er für die Liebe zur Heimat und zur Geschichte entfacht.
Als Mitglied der Bekenntnisgeneration kann ich den Älteren nur Respekt zollen, wie sie mit aller Kraft und sogar trotz mancher Gebrechen die Treffen besuchen, dabei sein wollen um jeden Preis. Für sie ist die Heimat Medizin, eine Droge im positiven Sinne. Laßt das Glühen für die Heimat nie ausgehen, Versucht auch die Jungen zu entzünden, sich zu ihren Wurzeln zu bekennen. Wurzeln sind wichtig. Ein tief verwurzelter Baum steht fest, ist standhaft ihm Sturm, seine tiefen und weit laufenden Wurzeln können sich überall Nahrung holen, und seine Chance, zu überleben und nützlich zu sein, ist groß.
Sich für diese Heimat zu interessieren und mit diesem wärmenden Feuer der Heimatliebe weiterzumachen, lohnt sich. Weiterzumachen mit unserem Annafest auf dem Pfaffenbühl. Beizutragen zu einem friedlichen, christlichen Europa. Mit offenen Augen und wachen Ohren sich einzusetzten, daß das, was vor über 75 Jahren geschah, nicht mehr geschehen kann. Unsere Großeltern und Eltern führten uns in ein friedliches Europa. Nun muß die Bekenntnisgeneration das friedliche Europa erhalten, mitgestalten und unseren Nachkommen diese Aufgabe überzeugt weitergeben.
Zusammensein. Dorthin hatten die heutigen Brucker, allen voran Bürgermeister Eric Mára, zum Essen eingeladen. Es gab Schnitzel und Geschnetzeltes sowie Kaffee und Kolatschen. Ich bedankte mich für die Gastfreundschaft und bei Familie Šícha, die sich um die Kirche kümmert, sie öffnet und immer wieder dafür sorgt, daß Sankt Jakubus eine lebendige Kirche bleibt. Jan Šícha führt auch die Verhandlungen mit den Behörden, wenn es um Zuschüsse geht wie zum Beispiel für die Renovierung der Altarfiguren oder für die neuen Gemälde der Seitenaltäre. Die Besucher blieben lange, denn es gab viel zu erzählen. Schließlich meinten alle: „S‘ woa wieda a schöins Fest, hoff‘ ma, daß ma aafs Gouha wieda zammkumma kinna.“ Ingrid Leser

■ Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram; 17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
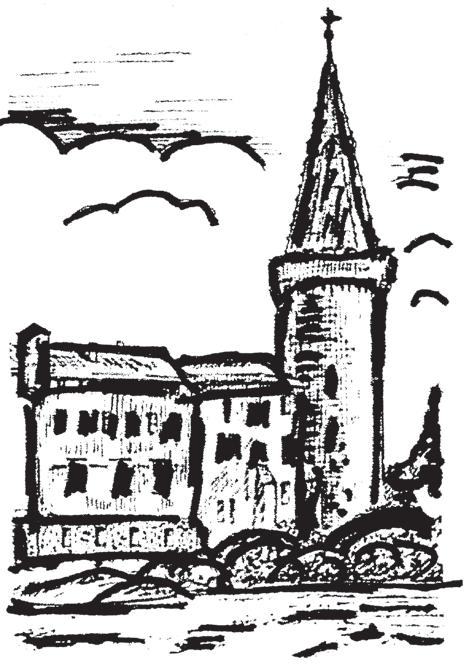
■ Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
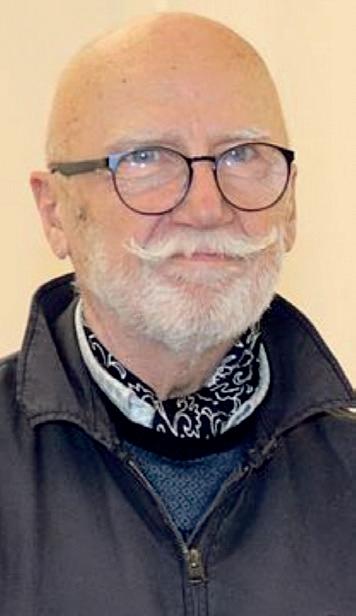
Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 20
❯ Bruck am Hammer
Die Pfarrer Klaus Oehrlein, Pater Klaus Kniffki SVD und Dr. Jiří Majkov. Die Festgemeinde vor dem Gottesdienst. Seitenaltar mit neuem Knap-Bild.
TERMINE
Sankt-Anna-Kirche auf dem Pfaffenbühl im oberpfälzischen Mähring.
Eric Mára, Bürgermeister von Bruck am Hammer, und Jan Šícha.
Der 92jährige Roland Mühlbauer mit Enkelin und Tochter.
Heimatkundliches Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Isergebirge/Organ des Gablonzer Heimatkreises e.V. Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail isergebirge@sudeten.de
TERMINE
■ Bis Sonntag, 3. September, Isergebirgs-Museum: „Was ist schön? Weibliche Schönheitsideale im Wandel der Zeit“. Große Galerie, Kaufbeuren-Neugablonz, Bürgerplatz 1. Dienstag bis Sonntag 13.00–17.00 Uhr.
■ Bis Sonntag, 3. September, Isergebirgs-Museum: „Toleranz in Comics und Graphic Novels“. Die Ausstellung ist Ergebnis des „Gramic“-Wettbewerbs des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV). Kleine Galerie, Kaufbeuren-Neugablonz, Bürgerplatz 1. Dienstag bis Sonntag 13.00–17.00 Uhr.
WIR GRATULIEREN
Wir gratulieren allen Landsleuten, die im September Geburtstag feiern können, und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Friedrichswald. Zum 90. am 8. Erna Kocks/Reckziegel; zum 87. am 10. Günter Lammel.
■ Gablonz. Zum 91. am 9. Lotte Ball/Fischer (Schillergasse 64) in Freilassing;




zum 89. am 27. Sigrid Engels/ Hübner (Brunnengasse 32) in Siegburg;
zum 83. am 13. Inge Görlach/Lampl (Blumengasse 10) in Neugablonz;
zum 81. am 3. Herbert Just (Fabrikstraße 51/Brandl) in Kaufbeuren;
zum 84. am 26. Herta Kiesewetter (Falkengasse 34) in Hamburg;
zum 80. am 1. Ingrid Preisinger (Steingasse 11) in SteyrGleink (Österreich);

zum 58. am 22. Ekkehard Redlhammer (Hüttenstraße 19) in Puchenau (Österreich);
zum 83. am 21. Inge Schlumps/ Berger (Gürtlergasse 36) in Neugablonz.
■ Grünwald. Zum 85. am 23. Fritz Waniek (Grünwald Nr. 308) in Enns (Österreich).
■ Johannesberg. Zum 88. am 28. Siegfried Neumann; zum 88. am 24. Werner Hintner; zum 87. am 10. Christa Koch/ Hannich; zum 85. am 28. Helene Wander/Pilz; zum 83. am 21. Rosemarie Berndt/Erbe; zum 82. am 24. Gitta Dube/ Pörner.
■ Kukan. Zum 84. am 4. Heinz Feix; zum 83. am 15. Ursula Neumann/Jäger in Kempten.

■ Lautschnei. Zum 88. am 20. Liesel Bieroll/Lacina in Kaufbeuren-Neugablonz.
■ Maxdorf. Zum 83. am 13. Inge Wagner/Umann (Brothäuser) in Kempten; zum 84. am 17. Ingrid Mosig/ Fleischmann; zum 88. am 3. Helga Schuster/ Reckziegel; zum 84. am 21. Walter Müller in München.
■ Neudorf. Zum 91. am 26. Rudi Kiesewetter in Fichtelberg.

■ Seidenschwanz. Zum 78. am 17. Monika Kreidel/Masopust; zum 84. am 23. Erika Unterbertinger/Schulz in Enns (Österreich); zum 82. am 18. Helga Ditte/ Juppe; zum 82. am 26. Klaus Rieger; zum 85. am 29. Renate Henninger/Dlouhy; zum 84. am 9. Gerhard Dlask; zum 84. am 8. Erika Zimmermann/Kittel. Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
■ Polaun. Wir gratulieren allen Polaunern, die im September geboren sind, auf das Herzlichste zum Geburtstag. Hans Pfeifer Ortsbetreuer
Schwabenstraße 11
87668 Rieden
Telefon (0 83 46) 98 23 69
■ Schumburg-Gistei, Unterschwarzbrunn. Die Ortsgemeinschaft gratuliert zum 84. Geburtstag am 22. Rudolf Jung in Mauerstetten. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Marschowitz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert zum 82. Geburtstag am 26. Hannelore Stengel/Ulbrich in Rammingen bei Langnau. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Labau-Pintschei. Die Ortsgemeinschaft gratuliert zum 94. Geburtstag am 23. Rudolf Donth in Roth; zum 92. Geburtstag am 27. Josef Nosswitz in Schwäbisch Gmünd;
zum 84. Geburtstag am 13. Erik Hübner in Märsta (Schweden) und am 30. Werner Blaschke in Pforzen;
zum 83. Geburtstag am 21. Inge Berger-Schlumps/Berger in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 81. Geburtstag am 14. Hans Peter Czerny in Rattiszell; zum 75. Geburtstag am 27. Johanna Blob/Lang in KaufbeurenNeugablonz;
zum 68. Geburtstag am 22. Brigitte Castro/Hübner in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 64. Geburtstag am 6. Hannelore Castro/Hübner in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 14. Geburtstag am 11. Maximilian Theileis in Lamerdingen. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Dalleschitz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert zum 84. Geburtstag am 30. Werner Blaschke in Pforzen. Hans Theileis Ortsbetreuer
❯ Wittighaus renoviert
Ein
Nachdem die Wittigbaude 2021 wegen ihres bautechnisch ausgesprochen schlechten Zustands abgerissen worden war, ist sie nun seit Beginn der tschechischen Sommerferien wieder geöffnet.
kultiger
hier hinaus – auch wegen der Heidelbeerknödel, die dort den Sommer über gekocht werden.
Ort
■ Mittwoch, 30. August bis Sonntag, 3. September, Heimatkreis Gablonz: Busfahrt nach Gablonz und ins Isergebirge. Auskunft und Anmeldung: Thomas Schönhoff, Glasstraße 6b, 87600 Neugablonz, Telefon (0 83 41) 6 54 86, eMail archiv@ isergebirgs-museum.de
❯ A bissl wos zun lachn
Fett und Waschlappen
Dou kom amoul a noubles Stoodtfräulein ei a Dorfwortshaus ann Isergeborge und tot siech ann Broutn bestelln. Dos Flejsch wor odr su elende fett, dos mr sch bale ne nundrbrochte. Dr Hund vu dan Gostworte kauerte odr undr n Tische und dou tot dos Fräulein halt dos elende Flejsch immr bricklweise dan Hunde nundrschmeißn. Dos sog odr dr Wort und sohte ibr se: „Gahn se doch dan Hunde ne dos fette Zeug, dar speit mr jo!“
Seff hotte siech a Madl ogelacht, s Trudl aus n Morgstarne. Seine Familie wor odr mit sannr Wohl gor ne eivrstandn und se totn ejgolfort o dan Trudl rimmkritisiern.
De Muttr vu Seffn sohte: „Wos? Die willste dr nahm? Nej kuck ock, dar ihre Muttr is anne Krotzborschte, ihre Schwastr is a Basn, de Grußmuttr a ales Riebeisn und ihr Brudr a elendr Lumpn.“
Druf mejnte Seff: „No jo, dou brauchn se halt noch ann Woschloppn drzune, dos de Wortschoft komplett is.“
Thomas Schönhoff
Lob der Heimat
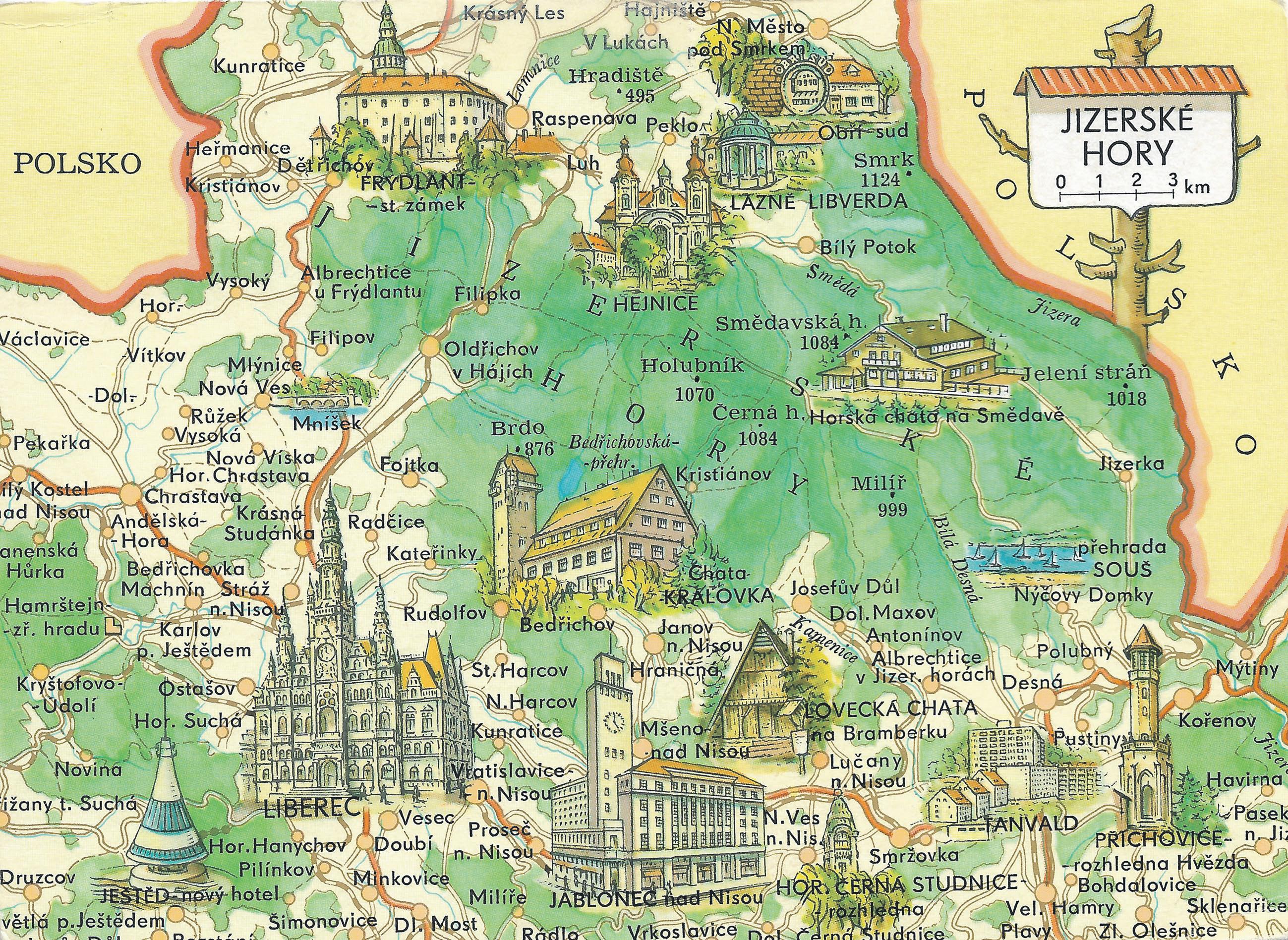
Mein schönes Isergebirge Im grünen Wäldergewand, Wie lieb ich dich von Herzen, Du leuchtendes Paradies, Das einmal mich alle Sorgen Des Lebens vergessen ließ.
Es ward mir ob deiner Schönheit Gewaltig das Herz gerührt, Als würden mir alle Wunder Der Welt vor Augen geführt.
Und ob ich bei Sturm und Regen, Beim Glanz der Sonne dich sah Im Wechsel der Jahreszeiten Gleichlieb erschienst du mir da.
Die Wunder der Welt zu schauen, Da braucht‘ ich nicht weit zu gehn; Im schönen Isergebirge, Da habe ich sie gesehn.
Vergessen Sie die gewöhnlichen beengten Zimmerchen und das vernachlässigte hygienische Umfeld tschechischer Berghütten und Pensionen. Stellen Sie sich ein nach Holz duftendes außerordentlich geräumiges Zimmer mit Bad vor, das Sie gern zu Hause hätten, und dies mit einem Ausblick auf die Natur des Isergebirges“ – mit diesen Worten wirbt das von Grund auf neue Wittighaus auf seiner Internetseite.
Direkt an Wander- und Radwanderwegen sowie Skilanglaufstrekken gelegen ist das Wittighaus sowohl im Sommer als auch im Winter eine attraktive Unterkunft für Bergsportler. Feuerstelle und Grillplatz laden in den wärmeren Monaten zu gemütlichen Outdoor-Abenden ein, während der Kamin nach einem langen Skitag wohlige Wärme verbreitet. Heute kommen vor allem Wanderer
■ Gablonz. Am 6. Juli verstarb in München Margit Nosswitz/ Scheibler im Alter von 89 Jahren. Um sie trauert ihr Sohn Manfred mit Familie.
■ Neudorf. In Neugablonz verstarb im Juli Harald Effenberger im 92. Lebensjahr. Er wirkte viele Jahre als Lehrer an der Leutelt-Schule in Neugablonz und übte in den letzten Jahren auch
„Es handelt sich um unvergleichbaren Komfort, in allen Richtungen“, meint Milan Radina, Direktor der Bergeinrichtungen der Gruppe Atonie Hotels, wozu auch das Wittighaus gehört.
Viele Ortsbewohner sind allerdings der Meinung, daß das moderne Gebäude nicht ins Iser-
Albert Streit
gebirge passe. Unzufrieden mit dem Neubau ist auch die Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik, da die neue Form der Hütte nicht der ursprünglich genehmigten entspreche.


Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Holzfäller, Köhler und Viehhirten in einer Höhe von 847 Metern auf dem Weg
WIR BETRAUERN
das Amt des Ortsbetreuers von Neudorf aus. Um ihn trauern seine Kinder mit Familien.
■ Kukan. Zu Hause in Kukan, Villengasse, verschied im Juni nach langer Krankheit Helga Krousky/Pietsch. Sie stammte aus Unter-Schwarzbrunn und wohnte seit Jahren in der ehemaligen Baumeister-Rössler-Villa in Kukan. Gern traf sie sich jedes
vom Friedländer Zipfel nach Harrachsdorf eine Wanderhütte erbaut. Während der Marienwallfahrten zogen Pilger aus Tannwald vorbei, deren Ziel die Wallfahrtskirche in Haindorf gewesen ist. Zudem befand sich dort früher eine Zollwache. 1841 wurde die erste Baude errichtet, die jedoch 1932 abbrannte. Der 1935 errichtete Vorgängerbau des jetzigen Wittighauses entstand nach einem Entwurf des Architekten František Zajdl. Mehrmals wurde er teilweise renoviert, war aber zuletzt aufgrund Holzwurmbefalls in einem bautechnisch so schlechten Zustand, daß er 2021 hatte abgerissen werden müssen. Eigentümer des Wittighauses ist Jindřich Řehák. Ihm gehören auch das Montania-Hotel an der Darre-Talsperre sowie das futuristisch aussehende Hotel Antonie in Friedland, für das er von der Europäischen Union den dritthöchsten Zuschuß für ein privates Hotel in der Tschechischen Republik erhielt. In Tschechien ist er auch in Zusammenhang in dem Fall der Bestechung von Politiker David Rath bekannt. KH
Jahr mit unserer Reisegruppe in Gablonz. Wir werden sie in lieber Erinnerung behalten.
Thomas Schönhoff Ortsbetreuer Liebe Landsleute, bitte teilen Sie Todesfälle, aber auch Geburtstage und andere Jubiläen Ihren Ortsbetreuern mit. Nur dann können Sie hier aktuelle Familiennachrichten lesen.
21 Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023
Darre-Talsperre mit Spitzberg und Schwarzbrunnkamm. Bild: Hans Pfeifer
Postkarte „Wandern durch die Tschechoslowakei. Isergebirge“.
Alle Zimmer sind mit WLAN, Sat-TV, Wasserkocher, Kühlschrank, Tresor und Bidet ausgestattet, in den Appartements gibt es zudem komplett eingerichtete kleine Küchen. Eine Nacht im Doppelzimmer inklusive Halbpension kostet knapp 100 Euro pro Person. Bilder: https://chatasmedava.cz/
Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen)
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Hoffmann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail sternberg@sudeten.de
� Schulorchester des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen zu Besuch in Mährisch Neustadt


Unglaubliche Gastfreundschaft
Eine spannende Woche voller Eindrücke durften die Musikerinnen und Musiker des Schulorchesters Laichingen beim Besuch des Partner-Orchesters in Mährisch Neustadt/ Uničov erleben. Bereits das vierte Mal traten die Laichinger mit Orchesterleiterin Tatjana Bräkow-Killius die weite Reise an. Unterstützt wurde sie dabei von Klaus-Peter Kuhn, der selbst im Orchester Cello spielt, sowie dem ehemaligen Musiklehrer Volker Hausen. Auch finanziell wurde das Orchester großzügig unterstützt: vom Häberle-Fonds mit 2000 Euro und der Volksbank Laichingen mit 1500 Euro.
� 1000 Jahre Langendorf
1023–2023
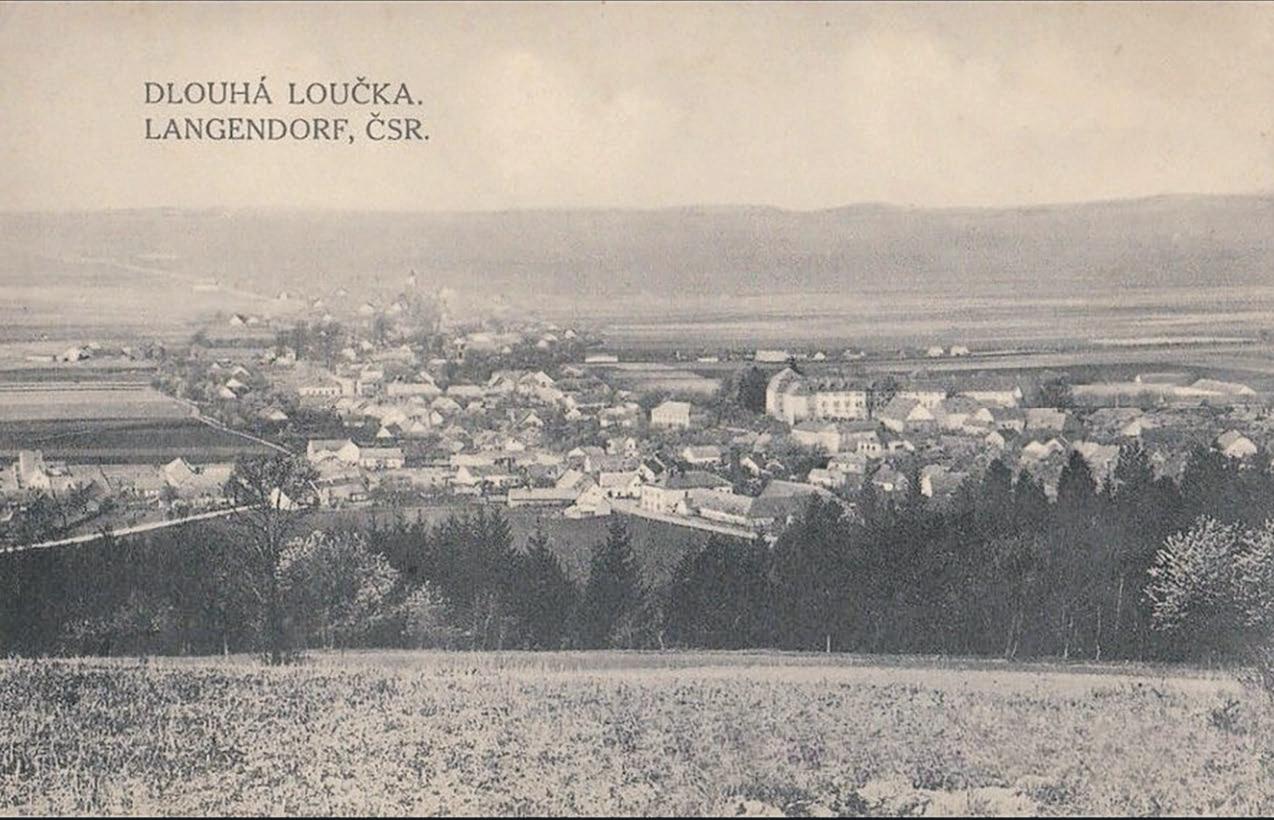
n 1023: Ersterwähnung von Langendorf – eine erste Kirche wird als Holzkirche erbaut.

n 1223: größere Besiedlung in Langendorf (Langendorf = auf beiden Seiten des Dorfbaches (Oslawa); Seehöhe von Langendorf: 256 Meter über Normalnull; am Nordrand der Hannaebene; Funde in der Nähe von Mährisch Neustadt weisen auf eine frühere Besiedlung von Langendorf hin (Unter- und Oberlangendorf).
n 1623: Langendorf wird im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) heimgesucht von schwedischen Truppen.
n 1704: Beginn des Oberschloß-Neubaus.
n 1923: Langendorfer nehmen an den Feierlichkeiten zur
700-Jahr-Feier von Mährisch Neustadt teil. Im Oberschloß wird ein Kindergarten eröffnet.
n 1933: Das Rentamt wird aufgelöst und nach Freudent(h)al verlegt.
n 1940: Zusammenlegung der beiden Gemeinden Ober- und Unterlangendorf zu Markt Langendorf.
n 1946: an Ostern erste Vertreibungstransporte von Langendorfern.
n Ab den 1980er Jahren finden Busfahrten von Deutschland nach Markt Langendorf statt.
Quelle: Chronik von Langendorf (auszugsweise) von E. Lass. Bilderserie von Langendorf, Repro: Hans H. Gold
In freudiger Erwartung traten die Schülerinnen und Schüler die Reise nach Tschechien an, spürbar war die Freude auf das Wiedersehen, da der Besuch der tschechischen Schüler in Laichingen erst ein halbes Jahr zurücklag.
In Mährisch Neustadt ist nicht nur die Begeisterung für Musik beeindruckend, sondern auch die unglaubliche Gastfreundschaft. Da werden Zimmer geräumt, um selbst in kleinen
n Mährisch Neustadt. Im September gratulieren wir zum Geburtstag:
Am 1. Marianne Schubert/Zemanek (Untere Alleegasse) zum 85. Geburtstag in Weilburg;
Am 2. Friedrich Czech (Wallgasse) zum 86. Geburtstag in Tübingen; Peter Niemann (Goeblgasse) zum 81. Geburtstag in Illertissen; Rudolf Richter (Wallgasse) zum 83. Geburtstag in Bad Grönenbach;
am 3. Wilhelm G. Peter (Parkgasse) zum 79. Geburtstag in Wiesbaden; Johann Lux (Olmützer Gasse) zum 78. Geburtstag in Bickenbach; Eva Maria Stolz/ Rotter (Krankenhausgasse) zum 87. Geburtstag in Bad Camberg; am 4. Elmar Kral (Schwabengasse) zum 80. Geburtstag in Hirschau;

am 6. Ingrid Held (Sternberger Gasse) zum 86. Geburtstag in Bad Camberg;
am 7. Karl-Heinz Zausig (Wallgasse) zum 83. Geburtstag in Reichertshofen;
am 8. Ingo Lachnit (Schönberger Gasse) zum 79. Geburtstag in Darmstadt;
am 9. Manfred Kauer (Kl. Neustift) zum 87. Geburtstag in Beselich; Klaus Reichel (Müglitzer Gasse) zum 80. Geburtstag in Heidelberg; Erwin Meixner (Wallgasse) zum 85. Geburtstag in Hegnau/Schweiz; am 10. Sieglinde Knab/Kany (Herrengasse) zum 82. Geburtstag in Hünfelden; am 11. Gerda Michel/Körner (Euglgasse) zum 83. Geburtstag in Hadamar; am 12. Horst Plhak (Bahnhofstraße) zum 83. Geburtstag in Weinbach; Helmut Tschampa (Fronfestgasse) zum 82. Geburtstag in Frankfurt am Main;
Wohnungen Gäste aufnehmen zu können, liebevoll und reichhaltig gepackte Vesperpakete werden für die Ausflugstage und
Bilder: Gymnasium Laichingen
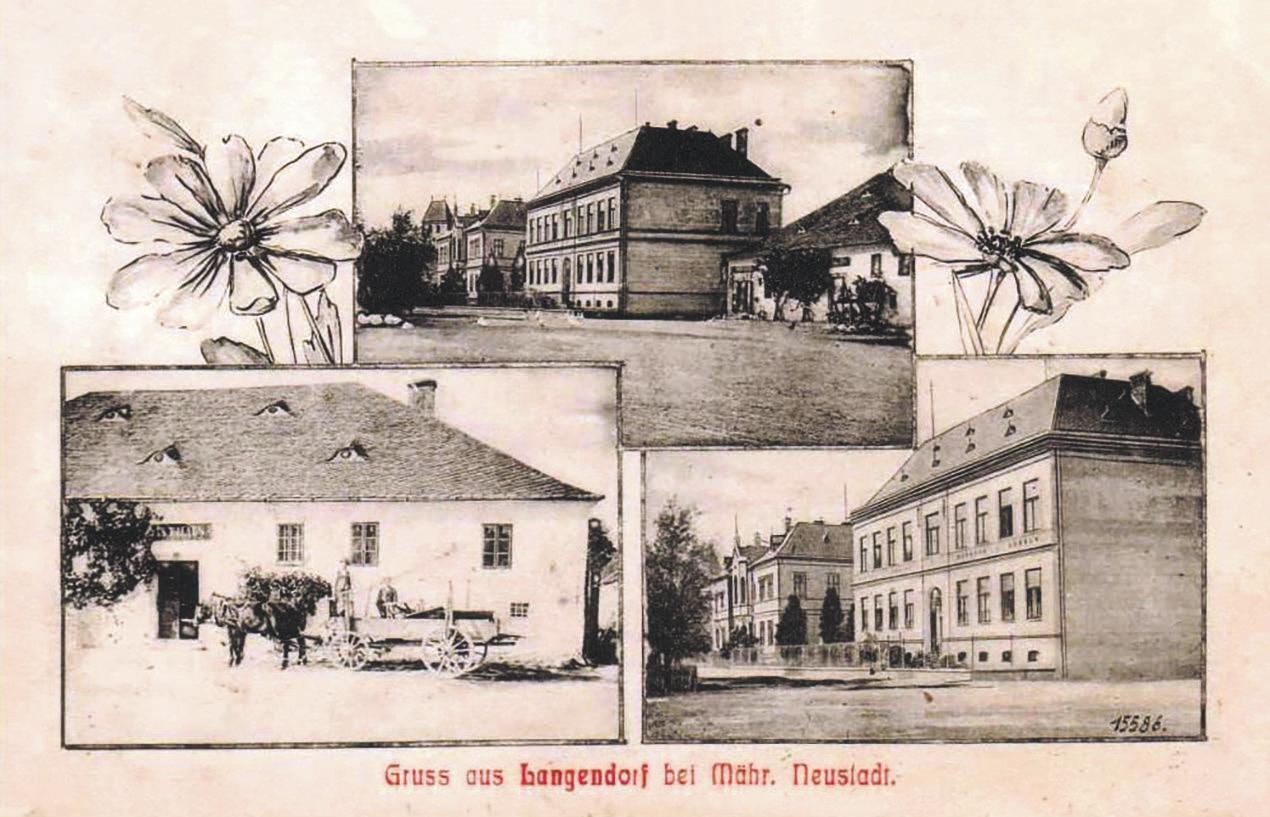

im Rathaus von Mährisch Neustadt durch Bürgermeister Radek Vincour, Ausflüge ins Umland, die Besichtigung einer Papierfabrik und einer Schokoladenmanufaktur, der Besuch der Wallfahrtskirche Svaty Kopecek und eine Führung durch die Stadt Olmütz. Mit den Gastfamilien gab es weitere Unternehmungen.
Am Donnerstag, dem Tag vor der Abreise, stand mit dem Abschlußkonzert in Mährisch Neustadt der Höhepunkt der Reise an. Hochkarätige Solobeiträge wechselten sich ab mit Orchesterstücken großer Bandbreite – von Vivaldi über Volksmusik bis hin zu bekannten Songs – bevor die gemeinsam gespielte Farandole von Georges Bizet den Abschluß bildete und auf Bitte des Publikums wiederholt wurde.
die Rückfahrt mitgegeben und zum Abschied noch Geschenke.
Zum Begleitprogramm gehörten der herzliche Empfang
WIR GRATULIEREN
Gerda Hengstermann/Schneider (Feldgasse) zum 84. Geburtstag in Limburg; am 13. Wolfgang Schlenz (Müglitzer Gasse) zum 81. Geburtstag in Hoisdorf; am 14. Erika Messinger/ Fritsch (Schönberger Gasse) zum 84. Geburtstag in Eppstein; am 15. Franz Gall (Salzgasse) zum 86. Geburtstag in Alzenau; Elisabeth Otto/Czech (Wallgasse) zum 84. Geburtstag in Dessau; Gerhard Matzek (Siedlung) zum 83. Geburtstag in Oberkochen; Anneliese Schneider/Kau-
er (Herrengasse) zum 79. Geburtstag in Mainz; am 16. Elisabeth Martin/ Chmelarz (Lange Gasse) zum 95. Geburtstag in München; Hannelore Fritz/Meixner (Wallgasse) zum 82. Geburtstag in Freiberg; am 17. Emilie Kilian/Hubral (Olmützer Gasse) zum 94. Geburtstag in Fellbach; Walter Rohm (Flurgasse) zum 83. Geburtstag in Wolfhagen, Brigitte Sippel/Jorda (Flurgasse) zum 83. Geburtstag in Senden; am 19. Sigrid Klein/Nimmerrichter (Euglgasse) zum 83. Ge-
In den Augen der Orchesterleiterinnen Tatjana Bräkow-Killius und Zuzana Loutocká ist der größte Gewinn an diesen Austauschfahrten das äußerst freundschaftliche Miteinander der beteiligten jungen Deutschen und Tschechen und damit gelebte europäische Völkerverständigung. aws
burtstag in Stuttgart; Wilfried Pilhatsch (Fronfestgasse) zum 81. Geburtstag in Bonn; am 20. Henriette Eid/Peichl (Sternberger Gasse) zum 84. Geburtstag in Limburg; Günther Reimer (Flurgasse) zum 82. Geburtstag in Hohenwettersbach; Jochen Niclasen (Wallgasse) zum 80. Geburtstag in BerlinSpandau; Anneliese Kilz/Schübl (Theoderichstraße) zum 78. Geburtstag in Wernigerode; am 21. Anneliese Aug/Müller (Euglgasse) zum 90. Geburtstag in Forchheim; am 22. Lieselotte Schorer/ Wepil (Olmützer Gasse) zum 98. Geburtstag in Ichenhausen; Heidi Berndt/Ullrich (Schönberger Gasse) zum 82. Geburtstag in Wiesbaden; Wolfgang Weigel (Stadtplatz) zum 80. Geburtstag in Klausdorf; am 23. Horst Schlenz (Müglitzer Gasse) zum 79. Geburtstag in Groß Hansdorf; am 24. Gerhard Kunz (Müglitzer Gasse) zum 95. Geburtstag in Selters; Dietlinde Langelott/Kunerth (Goeblgasse) zum 95. Geburtstag in Weilmünster; Manfred Rischke (Sternberger Gasse) zum 83. Geburtstag in Trocktelfingen; Ulrike John/Sedlatschek (Müglitzer Gasse) zum 79. Geburtstag in Forchheim; am 28. Maria Herb/Camek (Klementgasse) zum 91. Geburtstag in Sontheim; am 29. Harald Otahal (Klementgasse) zum 83. Geburtstag in Mainz; Elfriede Kramm/Grusel (Olmützer Gasse) zum 82. Geburtstag in Körle; am 29. Gerhard Vschetecka (Olmützer Gasse) zum 82. Geburtstag in Bad Schwalbach. Sigrid Lichtenthäler Ortsbetreuerin
Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 22
Orchesterleiterin Tatjana Bräkow-Killius (vordere Reihe rechts außen, in der Hocke) und ihre tschechische Kollegin Zuzana Loutocká (direkt dahinter) mit ihren Orchestern, Klaus-Peter Kuhn (ganz rechts) und Volker Hausen (ganz links), über den der Austausch zustande kam. Unten der Auftritt des Laichinger Orchesters beim Abschlußkonzert.
Die Kirche in Langendorf.
Die 800-Jahr-Feier, die dieses Jahr in Mährisch Neustadt auch mit einem reichhaltigen Jubiläumsprogramm gefeiert worden wäre, kann nur in unseren Herzen stattfinden. Aber unser Landsmann Arthur Uhrner war bei der 700-Jahr-Feier 1923 dabei und hatte seine Erlebnisse niedergeschrieben. Die sind, Gott sei es gedankt, nicht verloren gegangen.
Mährisch Neustadt kann sich rühmen, von allen Städten Mährens die älteste Stadtrechtsurkunde zu besitzen, vom Jahr 1223. Es gibt wohl ältere Städte im Lande, wie Olmütz, Brünn, Znaim und Iglau, die ihren Bestand bis gegen 1050 zurückverfolgen können, aber keine Stadt kann wie Neustadt ein älteres Datum der stadtrechtlichen Verleihung durch eine Originalurkunde nachweisen.
Und wir können dort nicht feiern
genannt wurde. Die neue Stadt erhielt jedoch den Namen „nova civitas“, Newenstadt, „Neustadt“ und ist ausschließlich von deutschen Bürgern gegründet und erbaut worden. Weil die Neustädter Stadturkunde die älteste in Mähren ist, wurde nicht das Gründungsjahr, sondern immer das Jahr der Stadterhebung – 1223 – für die Jubiläen zum Anlaß genommen. Es wurden 1723 die 500-Jahr-Feier, 1823 die 600-Jahr-Feier und 1923 die 700-Jahr-Feier besonders festlich begangen. Wie großartig diese letzte Feier war, will ich nun aus meinem persönlichen Erleben berichten.
Ein großes Plakat, auf dem ein Herold mit einer Fanfare abgebildet war, verkündete in den sudetendeutschen Ländern das große Fest. Wohl an die 50 000 konnte Mährisch Neustadt bei der 700-Jahr-Feier der Verleihung des deutschen Rechtes in der Zeit vom 12. bis 19. August 1923 als liebe Gäste aus allen Gauen des Sudetenlandes begrüßen. Vor dem bekränzten Rathaus war eine großartige Festtribüne aufgebaut. Ringsum auf dem Stadtplatz waren hohe Blumenständer mit bunten flatternden Bändern.
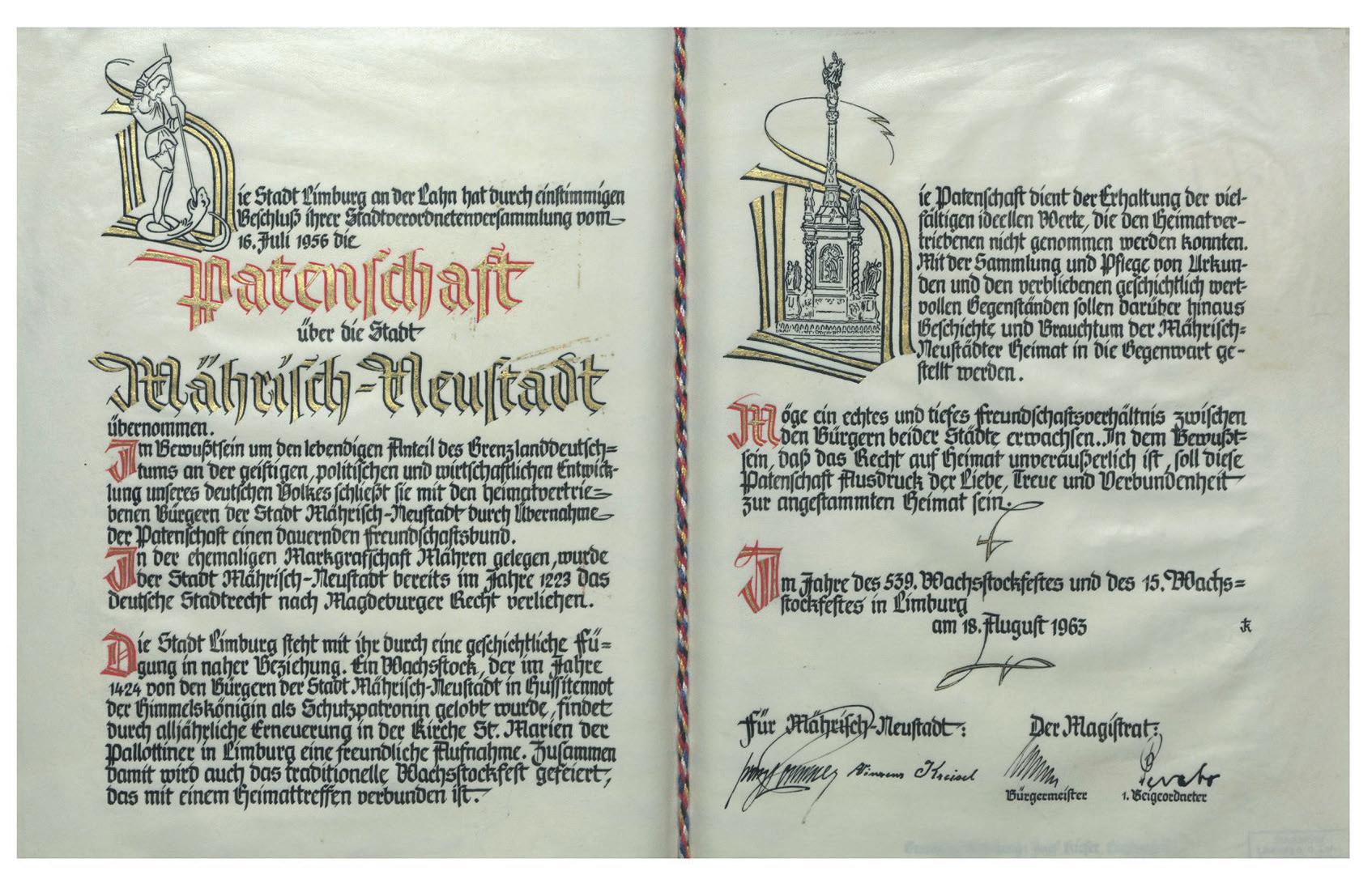
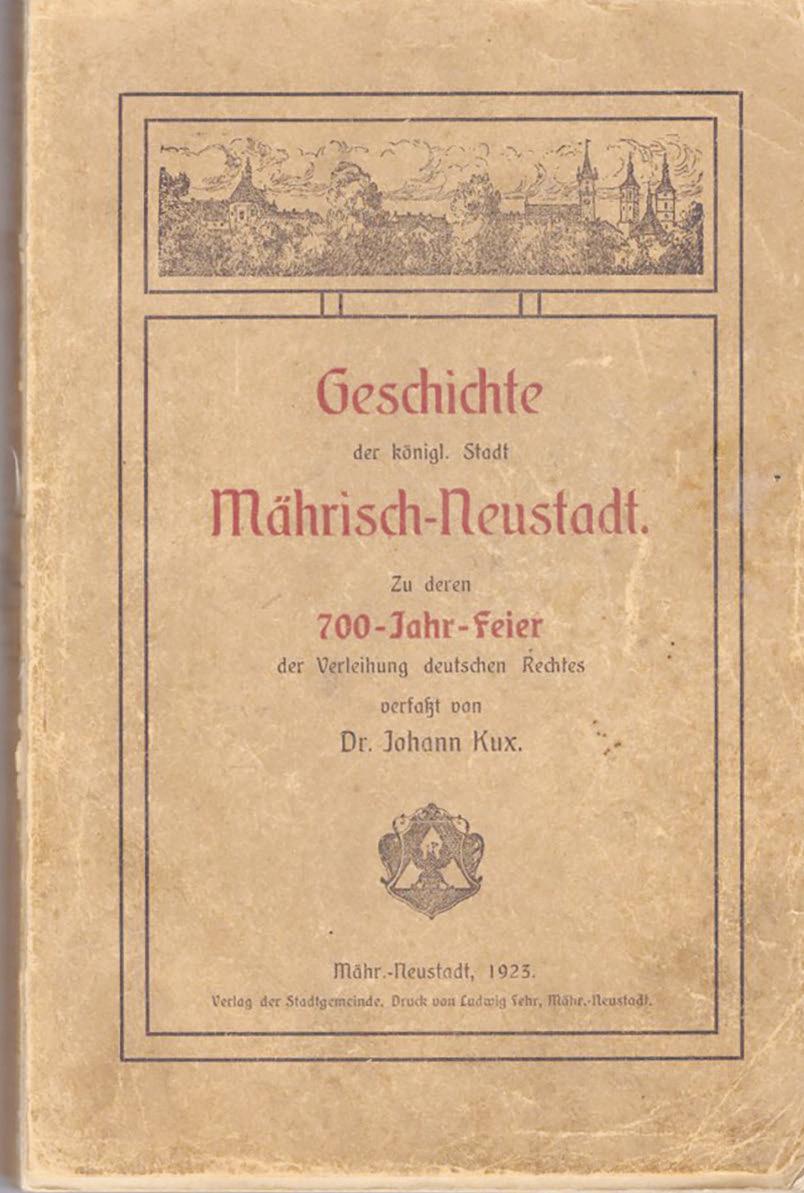
Gegründet wurde Mährisch Neustadt schon im Jahr 1213 auf dem Boden der Ursiedlung, eines landesfürstlichen Jägerhauses mit einem Hundezwinger und einigen Hütten, welche Siedlung nach dem Hundezwinger „Hundshof“, von den Tschechen Hunczov, später Uničov
Am ersten Sonntag, dem 12. August, wurde die Festwoche mit einem Turnfest auf dem neuen großen Spielplatz und am Nachmittag auf der Schießstätte Konzerte abgehalten und im Laufe des Tages verschiedene Ausstellungen eröffnet. Abends war im Schießstättensaal ein Begrüßungsabend, bei dem vom Gesangsverein das für diesen festlichen Anlaß von Viktor Zemsky verfaßte „Heimatlied des Mährisch Neustädter Ländchens“ zum ersten Mal vorgetragen wurde.
Das eigentliche Stadtfest war am Mittwoch, 15. August, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt. Am frühen Morgen um 7.00 Uhr erklangen Fanfaren vom Rat-
❯ Alte Tradition lebt weiter fort


In der Zeit um Mariä Himmelfahrt, die nach dem liturgischen Kalender auf den 15. August fällt, gedenken nicht nur wir, sondern auch die jetzigen Bürger in Mährisch Neustadt besonders der Jungfrau Maria.
Bis zur Vertreibung feierten wir in unserer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt immer am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt festlich das „Wachsstockfest“, denn am Abend vor Mariä Himmelfahrt standen im 15. Jahrhundert feindliche Soldaten vor Neustadt, die plünderten und die Stadt anzündeten. Die Bürgerwehr konnte nicht viel ausrichten, und in ihrer Angst liefen die Frauen in die Kirche, baten die Jungfrau Maria um Hilfe und gelobten, ihr zu Ehren alljährlich einen Wachsstock in der Länge der Stadtmauer zu opfern und
diesen bei Messen in der Kirche brennen zu lassen. Maria erhörte das Flehen der Frauen, erstickte mit ihrem Mantel die Flammen und die erschreckten Krieger zogen ab.

70 Jahre lang konnten wir Heimatvertriebene das Fest auch in Limburg in der Pallottiner-Kirche feiern; erst im Jahre 2021 erklärten wir Mährisch Neustädter uns damit einverstanden, daß das Fest wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückkehrt. Die Gläubigen dort waren darüber sehr glücklich und führen die Tradition in unserer Pfarrkirche.

Sie hatten sowieso schon immer am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt eine Marienandacht abgehalten, bei der die Gläubigen nach der Heiligen Messe mit Lichtern gemeinsam als Prozession in den Pfarrgarten zogen, um der Jungfrau Maria für die Ret-

hausturm. Um 10.00 Uhr begann ein Platzkonzert, um 11.00 Uhr war die „Gedenk- und Huldigungsfeier“ auf dem Stadtplatz. Unter Vorantritt von 1848er Gardisten bestiegen der Bürgermeister, die Stadtvertreter und mehrere Ehrengäste die Festtribüne, unter ihnen Parlamentarier, Vertreter vieler Städte und Gemeinden Mährens, Schlesiens und Ostböhmens sowie Abgeordnete von Vereinen, die Festrede hielt Professor Otto Kühnert.

Der große „Historische Festzug“ wurde um 14.00 Uhr durch einen gewappneten Ritter hoch zu Roß mit zwei Knappen eröffnet. Es folgten ein Jagdzug des mährischen Markgrafen aus dem 13. Jahrhundert, dann der Stadtvogt Theoderich mit seinen Helfern, fahrende Kauf- und Bergleute. Die Hussitenzeit war durch wehrhafte Bürger vertreten, das 16. Jahrhundert durch Neustäd-
ter Zünfte, Weber, Wagner, Schmiede, Zimmerleute, Fleischer und Bäcker, einen Bürgermeister in damaliger Tracht, Ratsverwandte und Schöppen. Ihre Machtfülle zeigten uns der „ungenannte Mann“ im roten Talare und das Richtbeil. Die Schwedenzeit mit ihrem Soldatenvolk zog vorüber. Das Lustlager von 1770 war durch Rokokoherren und -damen, Grenadiere, Husaren, Garde, Dragoner und Fußvolk vertreten, aber die zwei Hauptpersonen Kaiser Josef II. und Preußenkönig Friedrich II. durften infolge der tschechischen Zensur nicht dargestellt werden. Freiheitskämpfer des Jahres 1813 zogen vorüber. Die Biedermeierzeit wurde durch Gruppen „Im Familienkreise“, „Bei einem Ausflug“, „Als Student“, „Auf Reisen“, „Bei der Enkeljause“ vorgeführt. Die Bürgergarde von 1848 beschloß die Vergangenheit.
Přemysl Ottokar I., König von Böhmen, kon rmiert den Bürgern von Mährisch Neustadt (Uničov) jene Rechte, die sie bereits von Vladislav Heinrich, Markgraf von Mähren, erhalten haben. Verwiesen wird in der Pergamenturkunde u. a. auf Freudenthal (Bruntál) mit Magdeburger Recht.
Bild: Herder-Institut (Hrsg.): Dokumente und Materialien zur ostmitteleuropäischen Geschichte. Themenmodul „Stadtentwicklung in Böhmen und Mähren im Mittelalter“. URL: https://www.herder-institut.de//digitale-angebote/dokumenteund-materialien/themenmodule/quelle/2443/details.html
Gegenwart und Zukunft wurden durch Hochschulstudenten, Turner, den Wandervogel und Vereine der Stadt, der Ortsgemeinden des Neustädter Ländchens und der Nachbarstädte dargestellt. Im Zuge waren die Neustädter Stadtkapelle und die Sternberger Musikkapelle eingeteilt. Die Gruppe Bergleute und die Teßtaler Gruppe hatten eigene Spielleute. Etwa 15 000 mit den Zuschauern waren auf dem Stadtplatz. Auf der Tribüne hatten die Ehrengäste Platz genommen, auch der Erbprinz von und zu Liechtenstein mit Familie.
Anschließend waren das Volksfest und Gausingen der Gesangsvereine im Stadtpark. Dabei gab es Volksbelustigungen aller Art. Ein Feuerwerk am Abend beschloß den Hauptfesttag. In der Stadt wurden der Rathausturm,
die Marienstatue und das Gnadenbild an der Pfarrkirche beleuchtet. Während des Festzuges kreiste ein Flugzeug der N.A.F. Mährisch Schönberg über der Stadt und warf einen Blumenstrauß mit Glückwunsch ab. Zum Abschluß der Festwoche am Sonntag, 19. August wurde in altehrwürdiger Weise um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche und mit dem traditionellen Umgang vor der Mariensäule das Wachsstockfest gefeiert, das auf das Jahr 1424 anläßlich der Befreiung der Stadt von der Belagerung durch die Hussiten zurückgeht. Ein Schaufliegen der N.A.F. Mährisch Schönberg, ein Konzert im Schießstattgarten und ein Nachtfest des Musik- und Gesangvereins im Stadtpark bildeten den Abschluß aller Festlichkeiten.

Facebook-Eintrag der Stadt Limburg an der Lahn vom Oktober 2020 1956 entschied die Stadtverordnetenversammlung einstimmig, die Patenschaft über die Stadt Mährisch Neustadt zu übernehmen. Beim Wachsstockfest 1963 wurde darüber eine prachtvolle Urkunde ausgestellt, die heute im Stadtarchiv aufbewahrt wird
(Signatur: StALM II/2876). Darin heißt es: „Die Patenschaft dient der Erhaltung der vielfältigen ideellen Werte, die den Heimatvertriebenen nicht genommen werden konnten … Möge ein echtes und tiefes Freundschaftsverhältnis zwischen den Bürgern beider Städte erwachsen. In dem Bewußtsein, daß das Recht auf Heimat unveräußerlich ist, soll diese Patenschaft Ausdruck der Liebe, Treue und Verbundenheit zur angestammten Heimat sein.“
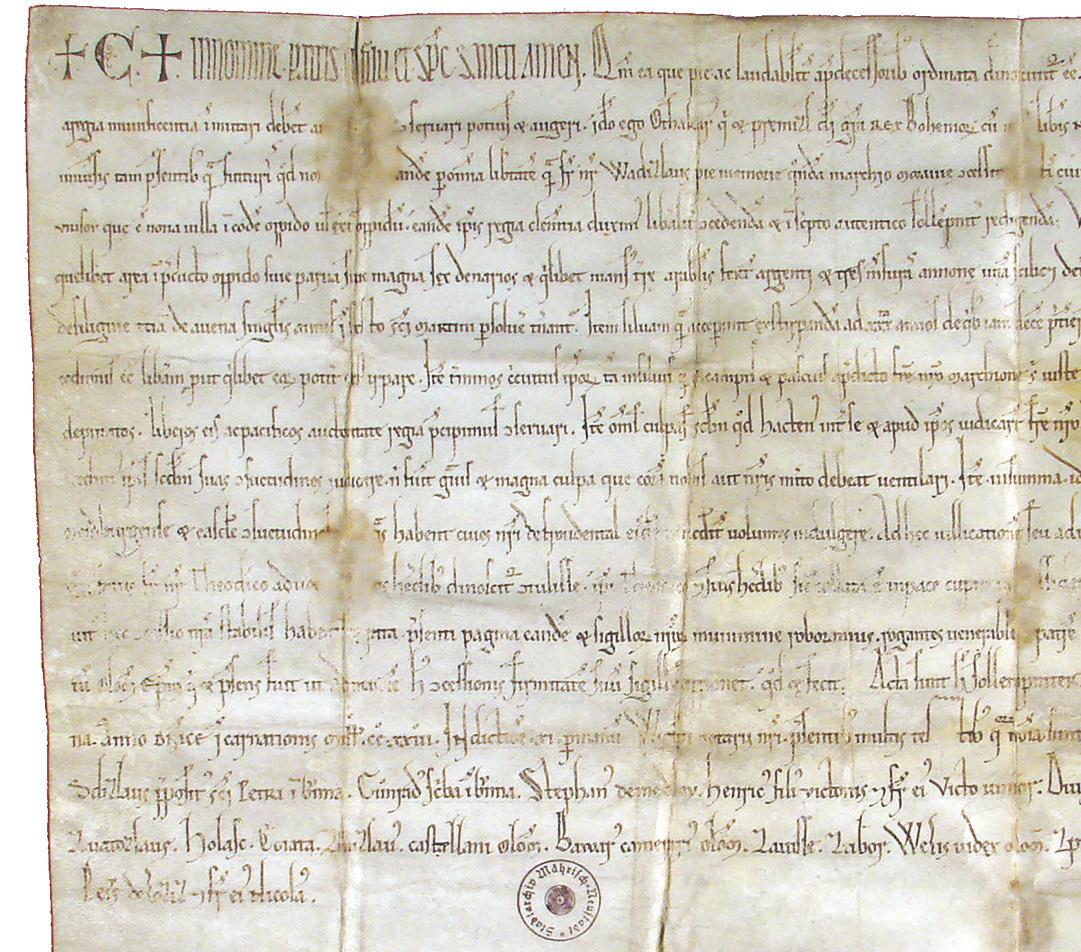
tung der Stadt zu danken. Dieses Jahr feierten sie am 20. August neben dem Marienfest auch das Wachsstockfest und schlossen uns Vertriebene in ihre
Gebete ein. Und weil an diesem Tag immer eine Kerze geweiht wurde, die die Länge der damaligen Stadtmauer von MährischNeustadt hat, wollte auch der jetzige Pfarrer Trzaskalik mit dieser Tradition fortfahren. Weil aber eine derartige Kerze in Tschechien nicht zu kaufen war und der Kauf in Deutschland zu teuer gewesen wäre, suchte er nach einer Maschine, mit der eine derartige Kerze gefertigt werden kann. Er fand eine, baute sie mit viel Liebe und Hingabe nach – und sie funktionierte! Die Maschine stand sogar voriges Jahr im Barockmuseum. Die letzte fast 80 Jahre alte Wachsstockkerze, die wir bei der Vertreibung in der Mährisch Neustädter Kirche zurücklassen mußten, steht, würdevoll geschmückt, in einer Glasvitrine rechts neben dem Hauptaltar unter dem Mariener-
Bis in die Gegenwart feiern die ehemaligen Bewohner Mährisch Neustadts ihr Wachsstockfest in der Limburger Pallottinerkirche. In Uničov hat man sich inzwischen ebenfalls auf die Tradition der Stadt besonnen und feiert das Fest auch dort. Die Heimatstube im Schloß wurde 2010 aufgelöst, die Archivalien und Objekte werden seitdem im Stadtarchiv aufbewahrt.
scheinungsbild (Bild). Im Pfarrgarten wurde auch dieses Jahr die neu hergestellte lange Kerze geweiht und angezündet.
Ebenfalls am 20. August wurde auch im nordhessischen Naumburg das Mährisch Neustädter Wachsstockfest gefeiert. Das schon zur Naumburger Tradition gewordene Wachsstockfest wurde von zahlreichen Gläubigen und den Mährisch Neustädtern, die in dieser Region leben, bei herrlichstem Sommerwetter besucht.
Nach der Heiligen Messe bestand die Möglichkeit in einer „Diashow“ 75 Jahre Naumburger Wachsstockfest in Bildern und Videos zu betrachten. Matthias Raschendorfer, dem dieses Fest sehr am Herzen liegt, blickte in einem Vortrag auf die Entstehung und Historie des Naumburger Wachsstockfestes zurück. Die Naumburger Stadtkapelle lud mit einem Platzkonzert an der Weingartenkapelle noch zum Verweilen ein.
Sigrid Lichtenthäler
23 STERNBERGER HEIMAT-POST Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023
O Maria, hilf! ❯ 800 Jahre Mährisch Neustadt
Während des Gottesdienstes in der Naumburger Weingartenkapelle weihte Stadtpfarrer i. R. Geistlicher Rat Ulrich Trzeciok unter Mitwirkung von Diakon Alexander von Rüden den diesjährigen Wachsstock. Danach ging es in einer Prozession einmal um die Weingartenkapelle, am Kreuz vor der Kapelle wurde das Mariengebet gesprochen. Die Heilige Messe wurde von dem Projektchor unter Leitung von Jonas Raschendorfer musikalisch begleitet. Bilder: Karl-Franz Thiede (3), Sigrid Lichtenthäler (1)
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail zuckmantel@sudeten.de
Sie ging nicht unter
Michael Stifel (auch Stiefel) wurde um 1487 in Esslingen am Neckar geboren und starb am 19. April 1567 in Jena. Er war ein deutscher Theologe und in erster Linie Mathematiker. Nach der Brockhaus-Enzyklopädie trug er „wesentlich zur Weiterentwicklung der Mathematik, insbesondere der Algebra, bei“.


❯ Sprache und die Kritik daran
Wolf Schneider
Wolf Schneider, geboren am 7. Mai 1925 in Erfurt, starb am 11. November 2022 in Starnberg. Er war ein hervorragender Journalist, Sachbuchautor und Sprachkritiker.
Für den deutschen Journalismus ist es ein riesiger Verlust, er hinterläßt eine schmerzliche Lücke. Daß die meisten Medien in ihren Nachrufen seine letzte Sprachkritik verschwiegen, also seinen heftigen Widerspruch gegen das Gendern, zeigte schon, wie sehr er fehlen würde. Klare und schnörkellose Aussagen und Ansagen waren sein Markenzeichen. Im August dieses Jahres stellte er in der BILDZeitung klar: „Die ganze Gender-Debatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben.
… Wenn man heute von Führungskraft spricht, so ist es heute überwiegend ein Mann – und niemand hat sich darüber beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben.“
Mehr muß man zum Irrweg des Genderns nicht sagen. Die Süddeutsche Zeitung, für die Schneider einst als Korrespondent gearbeitet hatte, erwähnte in ihrem Nachruf immerhin indirekt


Schneiders Kritik am Denglisch: „Im Jahr 2005 gehörte er zu den Gründern des Vereins Deutsche Sprache (VDS).“
Doch ist an dieser



Meldung so gut wie alles falsch: Der Verein wurde nämlich 1997 ins Leben gerufen, und Wolf Schneider war bei der Gründung gar nicht dabei.
Richtig ist, daß er zusammen mit VDSGründer Walter Krämer und Josef Kraus, dem damaligen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, zwischen 2006


und 2010 die „Aktion Lebendiges Deutsch“ verantwortete. Das öffentliche Echo damals war groß. Die Aktion schlug so schöne Entsprechungen vor wie „Essen nach Ermessen“ für „all you can eat“ oder „Prallsack“ für den „Airbag“. Vielen Menschen ist damals klar geworden, daß man eben nicht jeden englischen Ausdruck gedankenlos nachplappern muß. Diese wichtigen Tätigkeiten herauszufinden, war aber schon zu viel für manche Medien. Das zeigt, wie sehr der Journalismus in Deutschland in den etablierten Medien auf den Hund gekommen ist. Wenn die richtige Gesinnung mehr zählt als der Anspruch, so zu berichten, wie es gewesen ist, dann leidet zwangsläufig die Qualität. Schneider hat gegen diesen Niedergang bis zuletzt gekämpft. Im hohen Alter von 97 Jahren trat er noch in kurzen Lehrfilmen für die „Reporterfabrik“ auf der Netz-Plattform „Tik-Tok“ auf. Mit der Reihe „Schreiben lernen vom Profi“ erreichte er binnen drei Wochen drei Millionen Leute. Der Titel der Serie spielt auf das erfolgreichste Buch Schneiders an:
„Deutsch für Profis“ von 1982, das unzählige Male aufgelegt wurde. Von 1995 bis 2012 hielt Schneider Sprachseminare für Presse und Wirtschaft und war Ausbilder an Journalistenschulen. Er schrieb 28 Sachbücher, darunter Standardwerke wie „Deutsch fürs Leben. Was die Schule zu lehren vergaß“ (1994), „Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde“ (1987), „Wege zu gutem Stil“ (1982) und „Das neue Handbuch des Journalismus“. Schneider gehörte zu den Kritikern der Rechtschreibreform. Er war nicht nur Kritiker, sondern vor allem Lehrer. Die Zahl seiner Schüler läßt sich aber nicht ermitteln – sie ist gewaltig. Das ist eine Saat, die sicher auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Rudolf Heider
eingeflossen ist, nimmt man ihm dieses „Mißgeschick“ nicht lange übel. Nachdem er das Versprechen abgegeben hatte, zukünftig keine Wortrechnungen mehr anzustellen, übernimmt er bereits ein Jahr später wieder eine Stelle als Pfarrer, allerdings in einer Nachbargemeinde.
Kehrwert des zweiten multipliziert, stammt aus diesem Buch.
Stifel stammt aus begüterten Verhältnissen und kann die Lateinschule in Esslingen besuchen, tritt später in das Augustinerkloster in Esslingen ein, wo er 1511 die Priesterweihe erhält. Schon bald kommt er in Konflikt mit den damaligen Zeitströmungen der spätmittelalterlichen Kirche und ihrer Priesterschaft, insbesondere im Umgang mit der Ablaßthematik. Im Kloster kommt es zu Spannungen, als er 1522 mit seiner Schrift über Martin Luther hervortritt. Nach diesen Kontroversen kann er nicht mehr im Kloster bleiben und flüchtet nach Frankfurt.

Luther vermittelt ihm zunächst eine Anstellung als Prediger beim Grafen von Mansfeld, dann 1524 in Oberösterreich, die Stifel aber bald aufgeben muß, als ihm wegen seines reformatorischen Eifers der Scheiterhaufen droht. Zurück in Wittenberg erhält er in der Nähe eine Stelle als Landpfarrer. Hier findet er auch Zeit für autodidaktische Studien; vor allem beschäftigt er sich mit Euklids „Elementen“, den Schriften von Adam Ries und Albrecht Dürer sowie mit dem AlgebraBuch von Christoph Rudolff.
In vielen Kulturen werden Buchstaben auch als Zahlzeichen benutzt; so haben zum Beispiel die römischen Buchstaben I, V, X, L, C, D und M auch eine numerische Bedeutung. Mithilfe einer Wortrechnung, indem er den Buchstaben des Alphabets jeweils Zahlen zuordnet, bestimmt er schließlich den Tag des Jüngsten Gerichts: Sonntag, 19. Oktober 1533. Seine Berechnungen und seine Überlegungen hat er in einem „Rechen-Büchlein vom EndeChrist“ veröffentlicht. In der „Offenbarung des Johannes“, besser bekannt als Apokalypse, findet er einen rätselhaften Satz, und durch Umordnen der darin enthaltenen römischen Zahlzeichen errechnet er das Jahr des Weltuntergangs, nämlich MDXXXIII = 1533. Das mathematische Genie hat sich so in diese fixe Idee verrannt, daß selbst Luther es nicht vermag, ihn davon abzubringen.
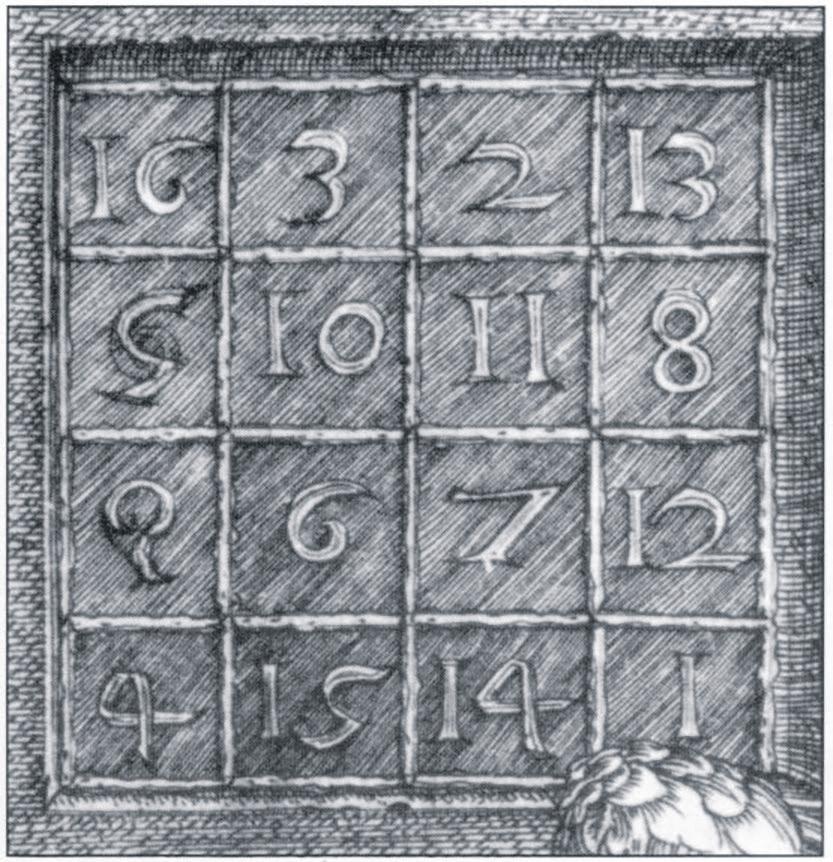

Am berechneten Tag versammeln sich die Gläubigen seiner Gemeinde und auch viele Fremde um den Prediger zum Gebet. Selbst aus Schlesien und der Lausitz waren die Menschen angereist. Viele hatten ihren Besitz verkauft und verpraßten das Geld. Anderen wurde angst und bange, sie taten Buße und flehten um Gnade. Die Tiere sollte es zuerst treffen, dann die Menschen, so hatte er es gepredigt. Als die Welt dann doch nicht unterging, wurde er durch Gesandte des Kurfürsten von Sachsen in Schutzhaft genommen.
Auch wenn die Redewendung „Einen Stiefel rechnen“ in der Bedeutung von „sich irren“ in den deutschen Sprachschatz
Von nun an beschäftigt er sich – neben der Theologie –nur noch mit „ernsthafter“ Mathematik. 1544 erscheint seine „Arithmetica integra“ bei Petreius in Nürnberg, der im Jahr zuvor die „De Revolutionibus Orbium Coelestium“ des Nikolaus Kopernikus gedruckt hatte und ein Jahr später die „Ars magna“ des Girolamo Cardano herausgibt. Die „Arithmetica integra“ faßt die damals bekannten Kenntnisse aus Arithmetik und Algebra zusammen, geht aber an einigen Stellen deutlich darüber hinaus. Mit Recht wird dieses aus drei Büchern bestehende Werk zu den wichtigsten der Mathematikgeschichte gezählt.
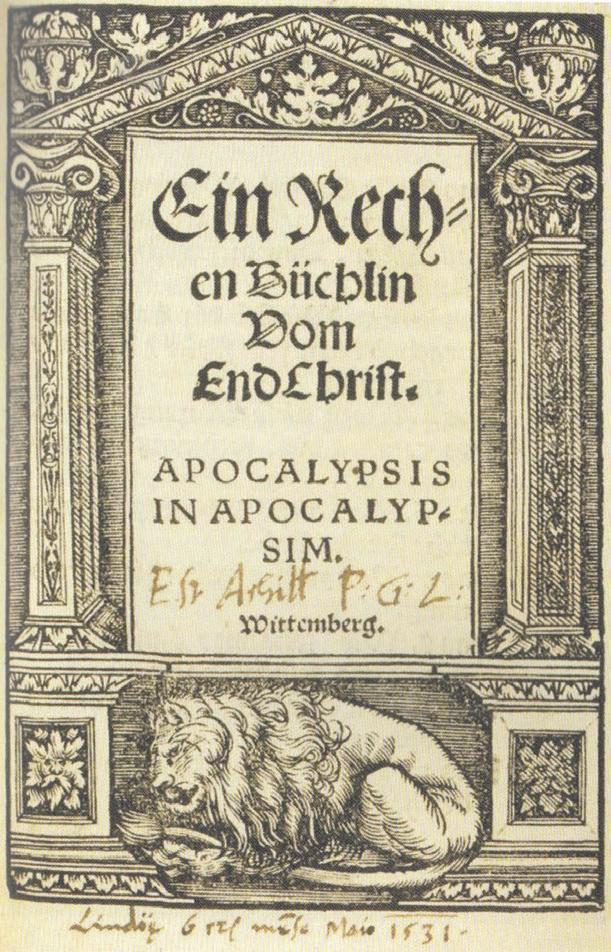


Im ersten Buch werden Regeln des elementaren Rechnens sowie einfache Probleme der Zahlentheorie behandelt; dabei verwendet er die Zeichen „+“ und „–“ sowie das Wurzelzeichen „√“ (anstelle von „r“ = radix).
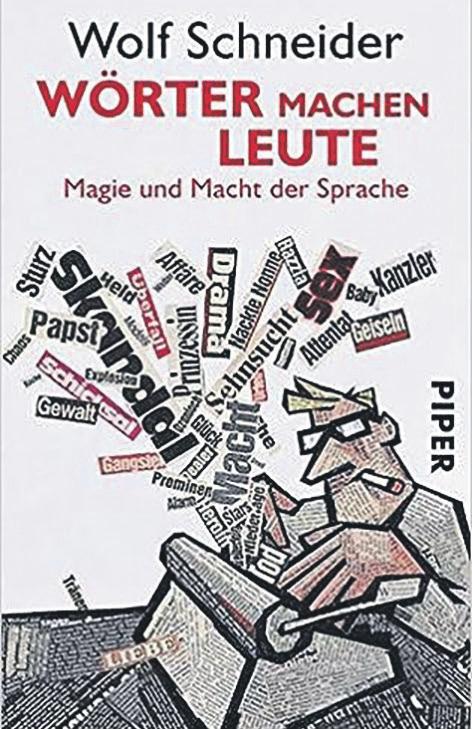
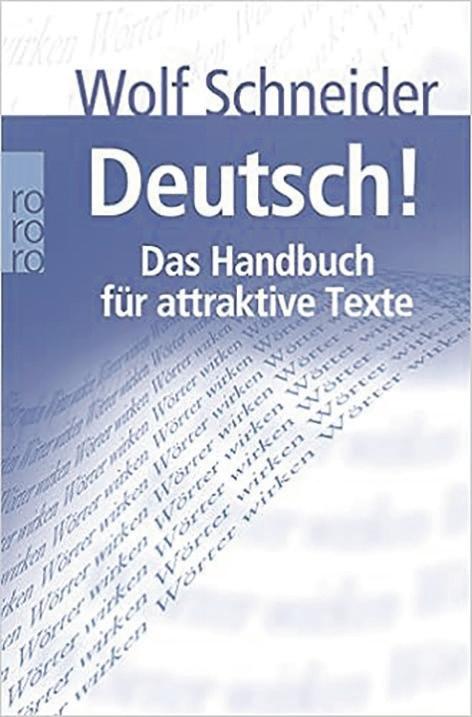
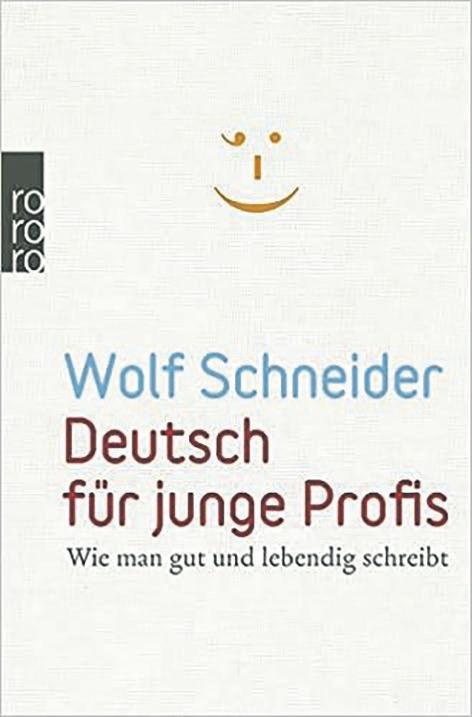
Die Regel, daß man bei der Division eines Bruchs durch einen Bruch den ersten Bruch mit dem
Auch geht er der Frage nach, inwieweit Brüche als Zahlen angesehen werden können (also zum Zählen geeignet) – er bezeichnet sie als abstrakte Zahlen. Als Gleichheitszeichen verwendet Stifel das lateinische Wort facit oder faciunt, was man mit „ergibt“ übersetzen kann.
In diesem Buch zeigt Michael Stifel eine Methode zur Herstellung von magischen Quadraten beliebiger Größe. In einem magischen Quadrat kommt jede Zahl nur einmal vor. Dieses Quadrat weist in jeder Zeile, Spalte und in den beiden Hauptdiagonalen die gleiche Summe auf. Diese magischen Quadrate wurden auch als Zauberquadrate bezeichnet, weil kaum jemand in der Lage war, solche Quadrate herzustellen.
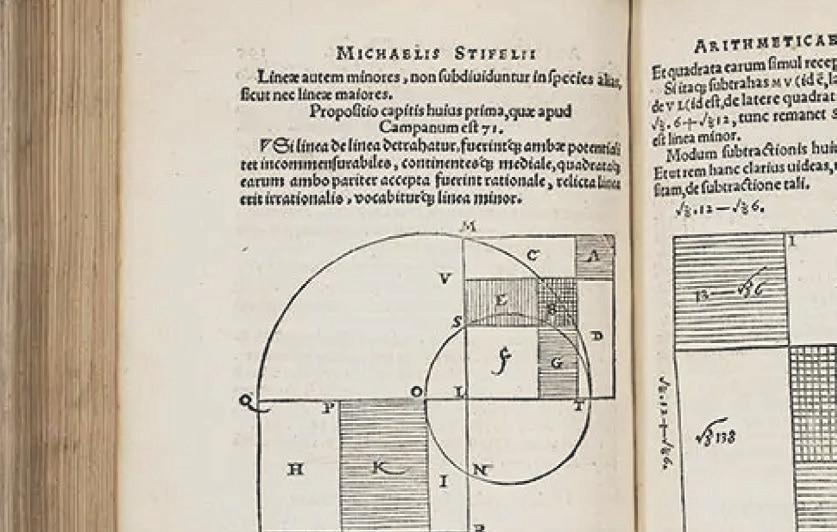
Das zweite Buch beschäftigt sich mit irrationalen Zahlen –ausgehend vom zehnten Buch der „Elemente des Euklid“. Im Stile eines Disputs stellt er fest, daß diese Zahlen in geometrischen Figuren auftreten, insofern „real“ sind.
Das dritte Buch der „Arithmetica integra“ geht über die Schrift des Christoph Rudolff aus dem Jahr 1525 „Behend und hübsch Rechnung durch die kunstreichen regeln Algebre, so gemeinicklich die Coß genennt wer-
den“ deutlich hinaus. (Coß leitet sich von dem italienischen Wort „cosa“ ab, wörtlich Ding, gemeint sind damit die Variablen; Algebraiker dieser Zeit, wie beispielsweise Adam Ries, werden auch als „Cossisten“ bezeichnet.) Während Rudolff bei der Behandlung quadratischer Gleichungen bezüglich der Vorzeichen der Koeffizienten noch acht Typen unterscheidet, reduziert Stifel diese auf nur noch einen Typ, da er als Erster negative Zahlen als Koeffizienten zuläßt, allerdings auch noch nicht als Lösungen von Gleichungen. Das Lösen einer quadratischen Gleichung der Form ist für ihn eine Rechenoperation, nämlich Wurzelziehen aus einem Term, oder, wie er sagt, „aus einer cossischen Zahl“. Stifel geht auch bezüglich der Potenzen über Rudolff hinaus; dieser hatte Potenzen mit null als Exponent zugelassen; Stifel untersucht beliebige ganzzahlige Exponenten (der Begriff „Exponent“ stammt von ihm). Weiter erkennt er: „Addition in der arithmetischen Reihe entspricht der Multiplikation in der geometrischen, ebenso Subtraktion in jener der Division in dieser. Die einfache Multiplikation bei den arithmetischen Reihen wird zur Multiplikation in sich bei der geometrischen Reihe. Die Division in der arithmetischen Reihe ist dem Wurzelausziehen in der geometrischen Reihe zugeordnet, wie die Halbierung dem Quadratwurzelausziehen.“ Diese Einsicht gibt John Napier die Anregung für die Entdeckung der Logarithmen.
Als 1547 katholische Truppen das Gebiet des protestantischen Fürsten erobern (Schmalkaldischer Krieg), muß Stifel fliehen. Als Pfarrer in Ostpreußen hält er an der Universität zu Königsberg Vorlesungen über Theologie und Mathematik, außerdem widmet er sich der erweiterten Neuauflage der „Rudolffschen Coß“. 1560 kehrt er nach Sachsen zurück und übernimmt dort Mathematik-Vorlesungen an der neu gegründeten Universität zu Jena; dort stirbt er auch im Jahr 1567.
Auf dem Marktplatz in Annaburg im Kreis Wittenberg hat man ihm ein Denkmal gesetzt. Er steht auf einer tief gespaltenen Weltkugel mit der Bibel in der Hand. Zur Erklärung liest man: „1533 verkündete Pfarrer Michael Stifel für Sonntag, 19. Oktober, 8 Uhr den Weltuntergang.“ Rudolf Heider
Literatur: Karin Reich: „Stifel, Michael“. In: „Neue Deutsche Biographie (NDB)“. Band 25, Duncker & Humblot, Berlin 2013, S. 337 (Digitalisat). Julius Giesing: „Stifels Arithmetica integra. Ein Beitrag zur Geschichte der Arithmetik des 16. Jahrhunderts“. Döbeln 1879. „Michael Stifel, Pfarrer in Brück. Freund Luthers, ein großer Mathematiker, Prophet des Weltunterganges“, in: Zauche- und FlämingHeimat 2, 1935, Nr. 6–12. Joseph Ehrenfried Hofmann: „Michael Stifel (1487–1567). Leben, Wirken und Bedeutung für die Mathematik seiner Zeit“ (Sudhoffs Archiv. Beiheft 9). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1968.


Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 24
Bild: Sven Teschke
❯ Michael Stifel, Mathematiker und Prediger
Michael Stifel auf einem Stich von Albrecht Dürer. Daneben eines seine magischen Quadrate und unten rechts der zu seinem Andenken errichtete Brunnen in Annaburg. Bilder: wikipedia.de
Heimatblatt für die Kreise Hohenelbe und Trautenau
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. – 1. Vorsitzende: Verena Schindler, Telefon 0391 5565987, eMail: info@hohenelbe.de, www.hohenelbe.de – Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. – 1. Vorsitzender Wigbert Baumann, Telefon 0931 32090657 – Geschäftsstelle Riesengebirgsstube (Museum-Bibliothek-Archiv), Neubaustr. 12, 97070 Würzburg, Telefon 0931 12141, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de – www.trautenau.de – Redaktion: Karin WendeFuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Telefon 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: Riesengebirgsheimat@t-online.de – Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Erscheinungsmonats.
� Heimatkreis Hohenelbe
Dieses Jahr verbrachte ich wieder einige Tage im Riesengebirge, in der Heimat meines verstorbenen Mannes. Ich verband das Kottwitzer Treffen mit dem Brünnl-Fest in Ketzelsdorf und schaute auch noch im Elternaus meines Mannes vorbei.
Erste Station Kottwitz. Das Elternhaus meines Mannes wird jetzt von einer jungen tschechischen Familie bewohnt, die mich sehr freundlich aufgenommen hat. Wir konnten uns gut auf Englisch unterhalten und es war ein nettes Kennenlernen. Zu den Vorbesitzern, die vor Jahren weggezogen sind, habe ich seit 1988 sehr engen Kontakt.
Weiter ging es zum Ehepaar Bašek, mit dem ich seit 1988 in Kontakt stehe. Beide waren ehemalige Bürgermeister von Kottwitz und sprechen gut Deutsch.
Am 1. Juli fand das BrünnlFest in Ketzelsdorf statt, an dem auch wir Kottwitzer traditionell teilnehmen. Kirsten Langenwalder, Pressereferentin des Heimatkreises Hohenelbe, die zu der Zeit im Riesengebirge unterwegs war, stieß ebenfalls zu uns und besuchte mit uns den Gottesdienst. Nach der Messe, die Pfarrer Richter und ein tschechischer Priester hielten sowie einem „Freiluft-Konzert“ eines Prager Chors folgten wir am Nachmittag der Einladung von Tomáš Anděl, dem Leiter des Museums in Arnau. Er lud uns zum Kaffee ins

� 32 Jahre Heimatgruppe Berlin
Wir haben die Feste gefeiert...
Kottwitzer Treffen: 1. Reihe von links: Jitka Bašek, Gudrun Bönisch. 2. Reihe von links: Anton Schoft, Vendula Reck, Štépánka Šichová,

sucht. Neben meinen Bekannten aus Arnau und Kottwitz kamen auch Besucher aus Ketzelsdorf und Trautenau zur hl. Messe, die ebenfalls von Pfarrer Richter zelebriert wurde. Ein Künstler gibt regelmäßig Konzerte in der Kirche und hat dort mehrere Bilder angebracht.

Es sind nur noch drei Wochen bis zum 61. Bundestreffen und 29. Wiedersehensfest der Riesengebirgler aus Arnau und Umgebung. Wir treffen uns dazu am Wochenende 16./17. September 2023 in Bensheim. Bringt Eure Kinder mit, bringt Verwandte, Freunde und Bekannte mit! „Kummt ock olle!“ Der Rübezahl im Bensheimer Stadtpark hält Ausschau nach uns.
Museum ein, wo wir die renovierte Pieta und eine Christusstatue bewunderten, die sich jetzt im Museum befinden. Die Statuen stammen noch aus der Katharina-Kirche, die es seit 1966 nicht mehr gibt. Wir sind Herrn Andel sehr dankbar für seinen Einsatz.
Die Heimatfreunde aus dem Riesengebirge treffen sich in Berlin am 8.9.2023
Man will es gar nicht recht glauben: Die Riesengebirgsheimatgruppe in Berlin besteht heuer bereits seit 32 Jahren. Bei dem ersten Treffen in Bensheim nach der Wiedervereinigung wurde sie auf Vorschlag des Vorstandes des Heimatkreises Hohenelbe hin gegründet.
Die ersten aktiven Mitglieder waren Dr. Erika Stankov, Günter Kasper, Gottfried Lath und Dr. Otto Weiss. Sie bildeten den Vorstand der Heimatgruppe. Leider sind die Heimatfreunde Günter Kasper und Gottfried Lath bereits verstorben. Erika Stankov hat uns jedes Jahr ein interessantes Programm vorgeschlagen, mit vielseitigen Themen aus der Heimat, sozialen, historischen, kulturellen und aktuellen Inhalten. In der Regel trafen wir uns sechsmal im Jahr zu verschiedenen Veranstaltungen, die immer gut besucht waren, sowie zu Wanderungen und anderen Unternehmungen. Leider hat die Corona-Krise
in den letzten Jahren unsere Zusammenkünfte verhindert. Wir wollten die Treffen 2023 wieder aufleben lassen, aber die Teilnehmerzahl war sehr gering. Leider waren in der Zeit auch eine ganze Anzahl von Heimatfreundinnen und -freunden verstorben. Im September 2023 wollen wir eine Aktivierung unserer schönen Zusammenkünfte in Berlin versuchen und starten diesen Aufruf: Wir treffen uns wie üblich am 2. Freitag des Monats, dem
Es war wirklich ein sehr schöner Nachmittag im Museum.
Am 2. Juli feierten wir den Gottesdienst in Kottwitz. Leider waren nur wenige Kottwitzer aus Deutschland gekommen. Trotzdem war die Kirche ganz gut be-
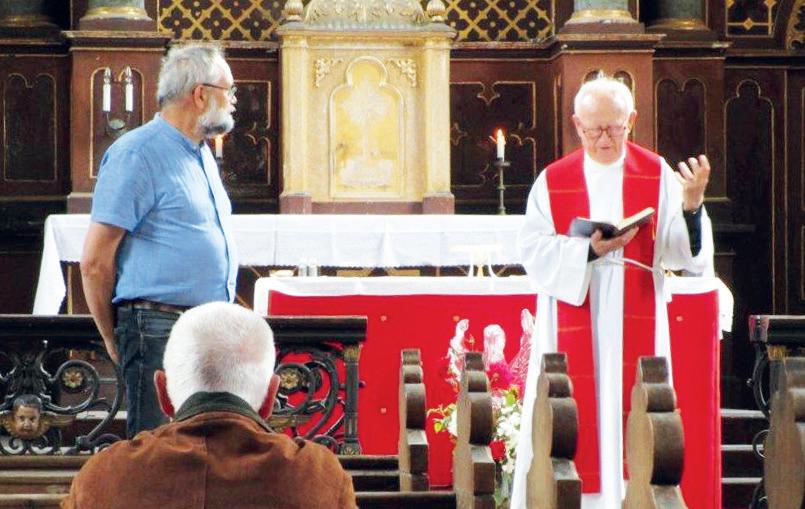
8.9.2023 um 14.00 Uhr in der Freizeit- und Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Torstraße 190, Ecke Tucholskystraße in 10115 Berlin. Weitere Termine sind der 13. Oktober und der 8. Dezember 2023, ebenfalls in der Begegnungsstätte.
Nach dem Kirchenbesuch gingen wir ins ehemalige Gasthaus „Fiedler“ zum Mittagessen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein. Ich habe mich sehr gefreut, daß meine tschechischen Bekannten Walter und Franz Kuhn-Gaber, Tomáš Anděl mit Gattin, die ehemaligen Bürgermeister Jitka und Jiří Bašek sowie der amtierende Bürgermeister Lukeš sowohl beim Gottesdienst als auch beim anschließenden Essen dabei waren. Neu begrüßen durften wir in der Runde Frau Reck (Dolmetscherin) aus Trautenau mit ihrem Ehemann und Frau Šichová, die Leiterin des deutsch-tschechischen Begegnungszentrums in Trautenau. Es waren auch einige neue Gesichter dabei, die zum ersten Mal nach Kottwitz gekommen waren. Abschließend möchte ich den tschechischen Freunden für ihre Hilfe bei meinen Vorbereitungen zum Treffen sehr herzlich danken. Es wäre schön, wenn wir uns nächstes Jahr alle wieder im Riesengebirge treffen könnten!


Gudrun Bönisch HOB von Kottwitz
leben mußten. Wir wollen an diesem Tag den vielen ehrenamtlich arbeitenden fleißigen Helfern bei den 47 Tafeln in Berlin danken, die 70.000 Essen im Monat an Bedürftige verteilen. Für die Tafel bitten wir um Geldspenden.
Wenn Sie Genaueres zu den
� Niederlangenau
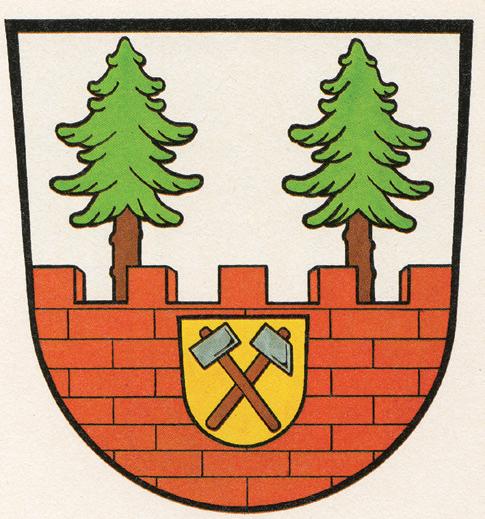
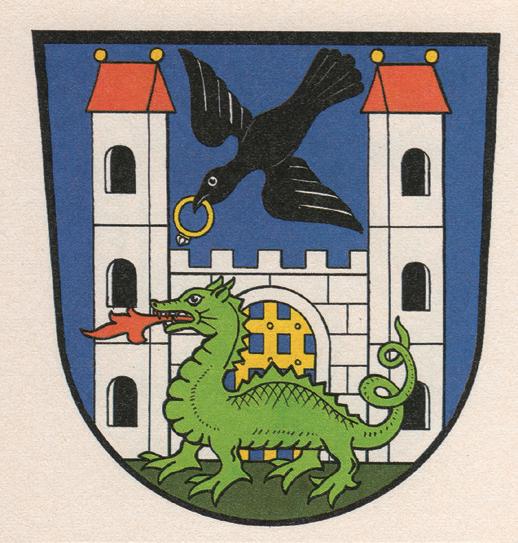
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, auf unsere Mitglieder und auf unsere Heimatortsbetreuerinnen und -betreuer.
Für den Vorstand:
Verena Schindler 1. Vorsitzende
Das Rübezahl-Denkmal in Bensheim feiert heuer seinen 60. Geburtstag.

Foto: Ingrid Mainert
Wallfahrtsmesse zum Hl. Jakobus
Die Torstraße in Berlin-Mitte ist mit Bus und Straßenbahn erreichbar. Wir wollen uns zunächst über die Lage und Gesundheit der Mitglieder der Heimatgruppe unterhalten und darüber, wie wir weitere Heimatfreunde und deren Kinder und Enkel für unsere Treffen gewinnen können.
Die Liste der Feier- und Weltaktionstage weist den 8. September als „Tag der Wohnungslosen“ aus. Ein Leid, das viele von uns nach der Vertreibung persönlich wochen- und monatelang er-
Treffen wissen wollen, rufen oder schreiben Sie mich an oder schauen Sie in die Seiten der „Riesengebirgsheimat“ in der „Sudetendeutschen Zeitung“.
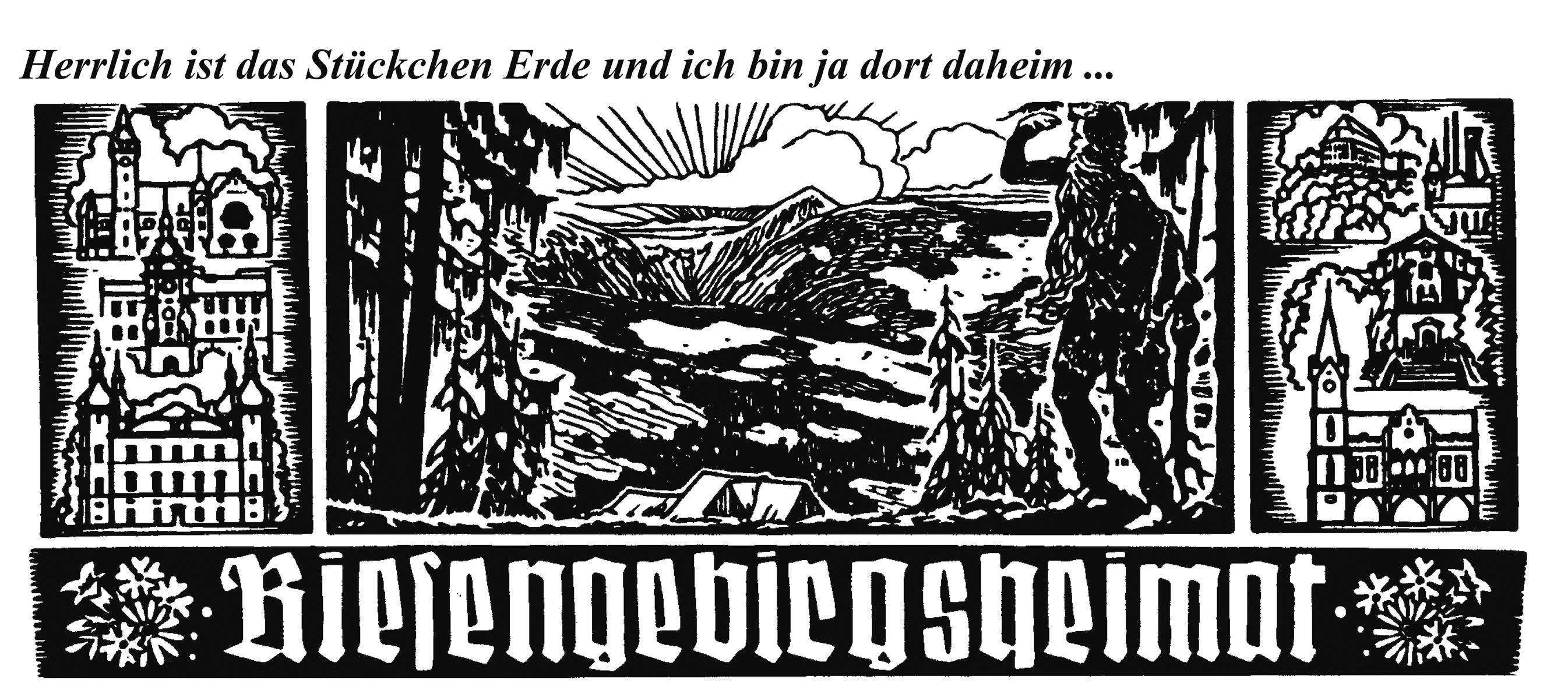
Liebe Heimatfreunde! Kommen Sie zu unseren Heimattreffen im September oder später und bringen Sie Angehörige und bekannte Heimatfreunde mit!
Prof. Dr. med. Otto Weiss 12685 Berlin, Amanlisweg 18, Tel. 30543 78843, eMail: Prof.Otto.Weiss@t-online.de
Blick auf die Kirche in Niederlangenau.
In der Niederlangenauer Kirche fand am Samstag, 22. Juli 2023, um 16 Uhr die Wallfahrtsmesse zum Hl. Jakobus mit anschließendem Konzert statt. Das Kirchweihfest ist den Langenauern als „Long‘sche Fohrt“ in Erinnerung geblieben. Nach der Messe freuten sich vor allem die Kinder auf den Jahrmarkt, wo sie Naschwerk kaufen und auf der „Reitschule“ Karussell fahren konnten.
HOB Verena Schindler
Foto: Archiv V. Schindler
� Hermannseifen
Grußwort von Theodor Müller
Liebe Heimatfreunde!
Fast 25 Jahre Tätigkeit als HOB für euren Heimatort Hermannseifen und 275 Beiträge für die „Riesengebirgsheimat“ sind genug, denke ich.
Nun hat sich glücklicherweise mit Christina Auerswald eine Nachfolgerin gefunden, der ich sehr gerne den HOB-Staffelstab übergebe, den ich nach dem Tode meines Vaters übernommen hatte. Damals war ich der jüngste HOB im Heimatkreis, jetzt bin ich wohl der dienstälteste, gesundheitlich beeinträchtigt und nicht mehr so reisefähig. Leider.
Bitte schenkt Christina Auerswald das gleiche Vertrauen, wel-
ches Ihr mir seit 1999 entgegengebracht habt. Sie ist nach Prof. Klug, dem Wehnerlois, dem Lorenz Franzi, Thedl Müller, meinem Vater und mir nun fünfter HOB von Hermannseifen.
Ich wünsche ihr viel Erfolg! Die Teilnehmer am diesjährigen Treffen in Rudnik haben sie bereits kennengelernt. Dieser Abschied ist sehr wohl mit einer Träne im Knopfloch, aber auch mit der Erleichterung verbunden, daß die Kontinuität gewahrt bleibt.
Euer Theodor Müller Emeritierter HOB von Hermannseifen
� Suchanfrage Rochlitz (bzw. Wildschütz)
Wer kann Auskunft geben über folgende Personen (auch vermeintlich unwichtige Informationen können wichtig sein):
•Prof. Rudolf Pohl: Seine Vorfahren aus NR sind 1877 nach Australien/Neuseeland ausgewandert. Er selbst nicht, hatte aber in den 1950er Jahren noch einen Briefwechsel mit Verwandten in Neuseeland. Prof. Pohl verstarb vermutlich 1972 in Wasserburg am Inn.
•Josef Donth geb. 1925, OR 100, gefallen 21.10.1944, Niederlande.
•Walter Donth geb. 1926, OR
226, gefallen 27.10.1944, Niederlande.
•Karl Butzke geb. 1906 in Wildschütz, lt. Rochlitzer Ortsbuch ab 1939/40 Volksschullehrer in NR; im Buch ist vermerkt „vermißt seit 11.01.1945“. (Mittlerweile ist bekannt, daß er gefallen ist in der Zeit vom 12.1. bis 31.5.1945 in Polen.)
•Marie Zeiner, geb. ca. 1927; sie besuchte im Jahr 1933 die
3. Klasse in Hohenelbe
Bitte Informationen an Kirsten Langenwalder, Telefon: 089 12018348, presseriesengebirge@aol.com
Sudetendeutsche Zeitung Folge 33/34 | 25.8.2023 25
Gottesdienst in der Brünnl-Kirche in Ketzelsdorf. Foto: Walter Kuhn-Gaber
Ji í Bašek, Bürgermeister Lukeš, Norbert Reck. Foto: Gudrun Bönisch
� Kottwitzer Treffen, Brünnl-Fest
Messe mit Pfarrer Richter in der Kottwitzer Kirche. Foto: Tomáš And l
Der erste Vorstand der Heimatgruppe 1991. Dampferfahrt auf der Spree. Fotos: Otto Weiss
78. Heimatkreistreffen am 15. und 16. Juli 2023
Am 24. Juni, dem Johannesfest, war die leider sehr renovierungsbedürftige Kirche in Soor nicht wiederzuerkennen, so schön war sie mit Blumen und Kränzen geschmückt.

gab im Anschluß an die Hl. Messe ein Konzert und danach spielte das Duo „Elias“ Lieder aus verschiedenen Ländern, gesungen und gespielt auf landestypischen Saiteninstrumenten.
Für das Jahrestreffen des Heimatkreises in Würzburg hatten wir uns das heißeste Wochenende und den heißesten Treffpunkt des Jahres ausgesucht: die „Riesengebirgsstube“, die in den Würzburger Barockhäusern der Neubaustraße 12 ihr Domizil hat. Dort befinden sich das Archiv, die Bibliothek, ein kleines Museum und der sogenannte Herrgottswinkel als Ort der Begegnung.
� Erinnerungen an Raatsch
Hier fand an diesem Tag die Hauptversammlung statt. Diese traf zukunftsweisende Entscheidungen: Wigbert Baumann als Vorsitzender bekommt eine zweite Vorsitzende an seine Seite: Claudia Rabenstein aus Berlin. Außerdem ist Markus Decker aus Kelstenbach in den Beirat des Vorstandes und Lothar Streck aus Hanau als Kassenprüfer einstimmig gewählt worden. Eine Hauptaufgabe des Vorstan-
des wird bleiben, die „Riesengebirgsstube“ als Ort für Erinnerungen, Begegnungen und Informationen zu erhalten. Schließlich begehen wir 2024 unser 75-jähriges Gründungsjubiläum. Und das soll mit „RiesengebirglerSchwung“ gefeiert werden.
Am Sonntag gab es dann im Würzburger Gasthaus Schusters „Zur Zeller Au“ ein schönes Treffen mit vielen anregenden Begegnungen von Riesengebirglern aus
Bayern, Franken,
dem
Für alle an der Trautenauer Region Interessierten ist die Würzburger „Riesengebirgsstube“ Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.trautenau.de Andreas Hoffmann
Unser Heimatort im Weltkrieg 1914 bis 1918
Am 1. August erfolgte die allgemeine Mobilisierung.
Jetzt sah man erst, wie ernst die Lage war. Am 26.08.1914 mußten die im Frühjahr assentierten Rekruten schon einrücken. So wurden unserer Wirtschaft die wichtigsten Kräfte entzogen. Bereits im ersten Kriegsjahr mußte die Ernte mit unzulänglichen Kräften eingebracht werden. Um genügend Nachschub für die Feldarbeit zu haben, erfolgten in jedem Kriegsjahr mehrere Musterungen. Selbst Jünglinge, die erst das 18. Lebensjahr erreichten, wurden schon eingezogen; jeder nur halbwegs geeignete Mann mußte einrücken. Die noch zurückgebliebenen Gemeinderäte mit dem Vorsteher hatten eine eigene Musterung in Jitschin. Freiwillig rückte Rudolf Bradatsch, Nr. 77 ein.
Anfang August war in Traute-


� Ketzelsdorf
nau eine große Pferde-Musterung. Dort mußten alle Pferdebesitzer, deren Tiere noch ein Auge hatten, bei der militärischen Musterung erscheinen. Unsere gemusterten Pferde wurden sofort vom Staat angekauft. Nach dem Kriegsleistungsgesetz mußten zum Abtransport auch Koppelknechte gestellt werden. Dazu geschickt wurden: Peter Zelfel, Nr. 98, Franz Weisser, Nr. 80 und Rudolf Seidel, Nr. 111. Fuhrwerke stellten die Besitzer der Häuser Nr. 58, 52, 41 und 115.
Durch die Kriegsanleihe unterstützte das Hinterland den Staat tatkräftig. Die Gemeinde Raatsch zeichnete 60.500 Kronen Kriegsanleihe. Die Ortsbewohner selbst gaben viele Tausende.
Schon im Jahr 1914 begannen schwere Kämpfe an der Front. Als die ersten Verlustlisten in
Das Brünnl-Fest verbindet uns
Am 1. Juli fand dieses Jahr das Brünnl-Fest in Ketzelsdorf statt. Ich habe mich gefreut, daß ich wieder mit einigen Kottwitzern beim Gottesdienst dabei sein konnte. Herr Pfarrer Richter und ein tschechischer Priester feierten mit uns. Nach der Messe gab ein Chor aus Prag ein Konzert im Freien. Ich möchte mich herzlich bei




den Ketzelsdorfern bedanken, die am Sonntag, den 2. Juli mit uns in Kottwitz den Gottesdienst feierten. Herzlichen Dank auch für die Übersetzung der Predigt ins Tschechische. Hoffentlich können wir uns im nächsten Jahr gesund wieder treffen.
Gudrun Bönisch HOB von Kottwitz
der Gemeinde eintrafen, kamen die Bewohner bald zu anderen Einsichten. Der erste Verwundete war Vinzenz Lochmann, Nr. 175. Als er heimkam, umringten ihn bald viele Neugierige und er mußte erzählen, wie es ihm ergangen war an der russischen Front. Erster Raatscher, der den Heldentod starb, war Josef Hetfleisch, Nr. 5. Er starb bei den Kämpfen bei Schabat in Serbien. Das Rote Kreuz setzte sich ein, die Leiden des Krieges zu mildern. Überall veranstaltete man Sammlungen für diesen guten Zweck. In Raatsch wurden Geld, Lebensmittel und warme Kleidung gespendet. Auch die Schulen unterstützten tatkräftig dieses Liebeswerk. Als die Not das höchste Maß erreicht hatte, kam der Zusammenbruch. Der neue Staat – die
� Großaupa und Petzer
Tschechoslowakische Republik – entstand. Tschechisches Militär besetzte die Sprachgrenze und sperrte die Straßen gegen Eipel unterhalb der Raatscher Ziegelei. Erst nach Verhandlungen durch den Gemeindevorsteher wurde diese Maßnahme wieder fallen gelassen. Die Teuerung wurde nach dem Umsturz noch größer, die Lebensmittel blieben noch weiter rationiert. Das Vieh, besonders die Pferde, hatten enorme Preise. Der Wert des Geldes ging ständig zurück … Anmerkung: Ich möchte für alle jüngeren Leser den Ort regional einordnen: Raatsch heißt heute tschechisch: „Radeč“, und ist nach der Stadt Eipel, heute tschechisch, „Úpice“, im Bezirk Trautenau (Trutnov) eingemeindet. Aus der Chronik des Ortes Raatsch, eingesandt von HOB Andreas Hoffmann
Auflösung unseres Heimatmuseums
Bei den jährlichen AupatalTreffen – heuer geplant vom 9. bis 10. September 2023 –konnte man im Hotel am Schloßpark in Wernigerode das mit Liebe zusammengestellte Riesengebirgs-Heimatmuseum bewundern. Da das Hotel verkauft wird und wir keine weitere Lösung gefunden haben, müssen wir den Lagerraum räumen. Wir bitten die ehemaligen Spender oder deren Verwandte, die uns
die Stücke für die Ausstellung überlassen hatten, um Abholung.
Bitte melden Sie sich bei Christa Lang, Handy 0170 6523260 oder Helmut Bönsch, Tel.Nr. 03931 712479 wegen eines baldigen gemeinsamen Termins für die Abholung. Herzlichen Dank für die jahrelangen Leihgaben!
HOB Christa Lang
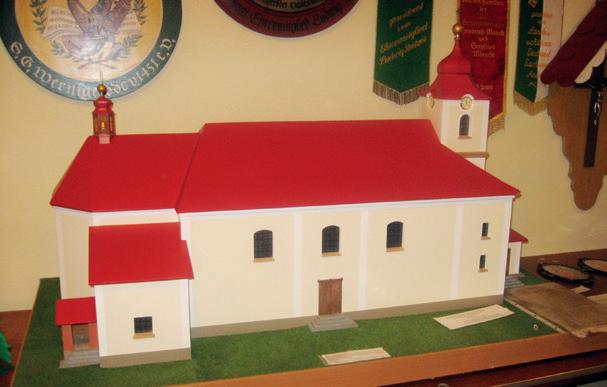
Handy: 0170 6523260
Pfarrer Pawel Rousek hielt die Hl. Messe, bei der auch die Taufe der kleinen Charlotte Ann gefeiert wurde. Ihre Mutter hat eine starke Verbindung zu Soor, denn sie lebte bis zu ihrem 4. Lebensjahr in Niedersoor, und auch später, bis sie 14 Jahre alt war, verbrachte sie jedes Jahr ihre Ferien dort bei den Großeltern.
Feierlich gestaltet wurde der Gottesdienst durch den Chor „Jaromir“ aus Jaroměř
Der örtliche Chor „Na Zdar“
Links:
Fotos:
Für Einwohner und Gäste ging es weiter zum Dorfplatz. Neben dem neuen Klubraum des Vereins Jaroměř wurde zur Freude aller spontan Musik gemacht. Die Stimmung war so gut, daß bis in die Nacht hinein musiziert und gefeiert wurde.
Alle diese Informationen und die Bilder erhielt ich, dankenswerter Weise, von Frau Zuzana Kazmirowská, die maßgeblich an der organisatorischen Vorbereitung der Hl. Messe und der Taufe beteiligt war.
HOB Edith Niepel
- 17. 9.2023
Zwischen Freiheit (heute Svoboda n. Upou) und Auerbach/v.Reumtengrün besteht seit einigen Jahren eine Städtepartnerschaft, die trotz Corona-Hemmnissen sehr aktiv ist. Es fanden bereits zahlreiche gegenseitige Besuche statt, die auch vom Sächsischen Innenministerium gefördert werden*
Im September findet das nächste Partnerschaftstreffen in Freiheit statt. Zeitplan und Busfahrt sind organisiert.
Die Besonderheit diesmal ist das Rudolffest, das wir gemeinsam in Freiheit/Svoboda feiern wollen. Es geht auf Kaiser Rudolf II. zurück.
Er war Kaiser des Römischen Reiches, König von Böhmen und Ungarn mit Sitz in Prag. Im 16. Jahrhundert hat er „Freiheit am güldenen Rehorn“ das Stadtrecht verliehen. Jung und Alt sind herzlich zu dem Fest eingeladen!
Nähere Information bei HOB Dr.-Ing. Herbert Gall Tel. 03744 2413660
eMail: gallhr@online.de
*Themen dieser Partnerschaft sind gemäß einer Deutsch-Tschechischen Erklärung unter anderem: Die Kooperation auf den Gebieten Kultur, Bildung, Kunst, Sport, Touristik, Wirtschaft, Kontakte zu fördern zwischen Schülern, Studenten, Interessensgemeinschaften, Vereinen und Bürgern, um die Kultur, Geschichte und Tradition beider Kommunen kennenzulernen und zu bereichern. Bei gemeinsamen Treffen sollen gegenseitig Informationen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Bei der Erforschung der Geschichte, insbesondere des Zweiten Weltkrieges und dessen Folgen, sollen persönliche Erfahrungen ehemaliger deutscher und tschechischer Bewohner des Riesengebirges genutzt werden.
RIESENGEBIRGSHEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 33/34 | 25.8.2023 28
� Heimatkreis Trautenau
� Freiheit Partnerschaftstreffen und Rudolffest vom 15.
Hessen,
Rheinland und Thüringen.
Die Teilnehmer des 78. Heimatkreistreffens . Foto: A. Hoffmann
Die
Ketzelsdorf.
Die Soorer Kirche im Festtagskleid Johannesfest in Soor
Brünnl-Kirche in
Foto: Gudrun Bönisch �
Pfarrer Rousek tauft die kleine Charlotte Ann.
Die festlich geschmückte Kirche zum Soorer Fest.
Ein Bild
in Freiheit/Svoboda
Eindrücke
Christian Kazmirowski
vom Treffen
im August 2021. Foto: H. Gall
vom Riesengebirgs-Heimatmuseum im Hotel am Schloßpark in Wernigerode: Modell der Kirche Großaupa von Josef Dix. Foto: Christa Lang
Die
Foto:
Teil 2
hl. Messe mit einem deutschen und einem tschechischen Pfarrer.
Tomáš And l


















 Torsten Fricke
Torsten Fricke

















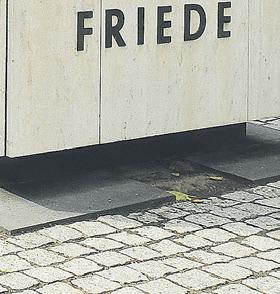





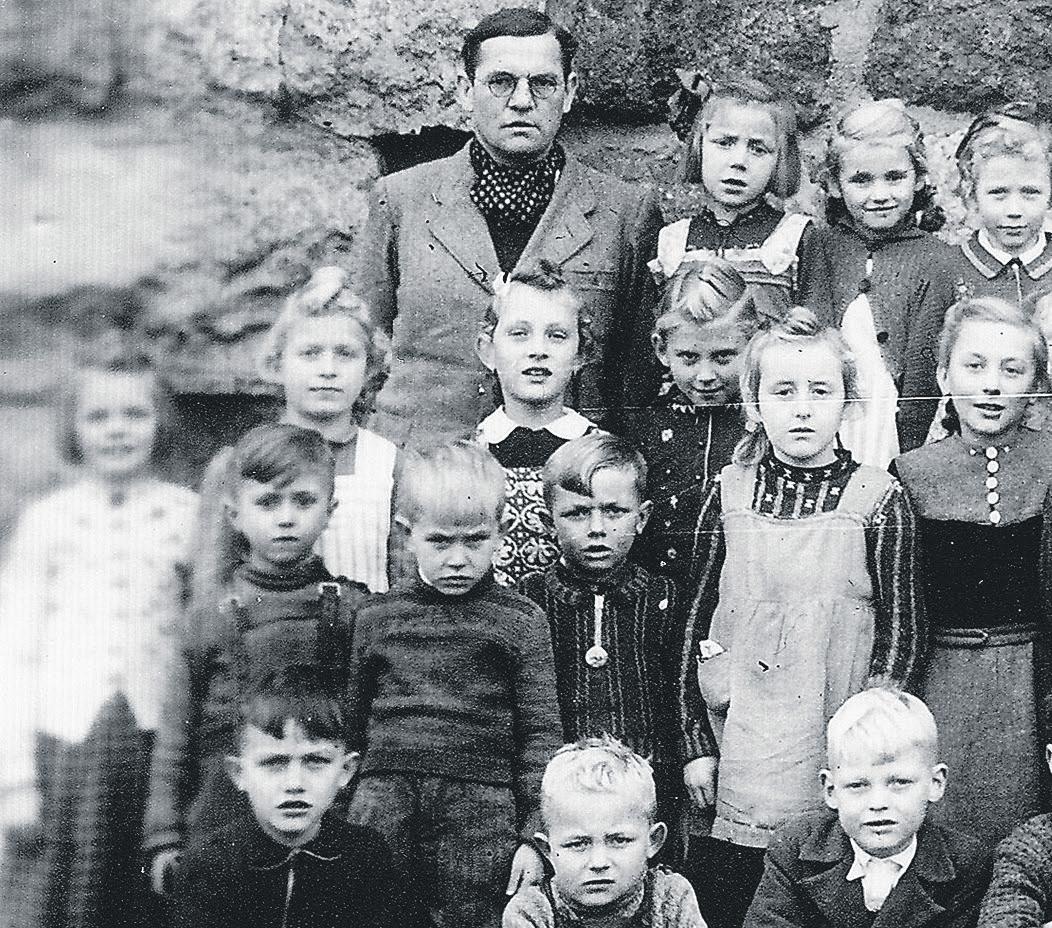


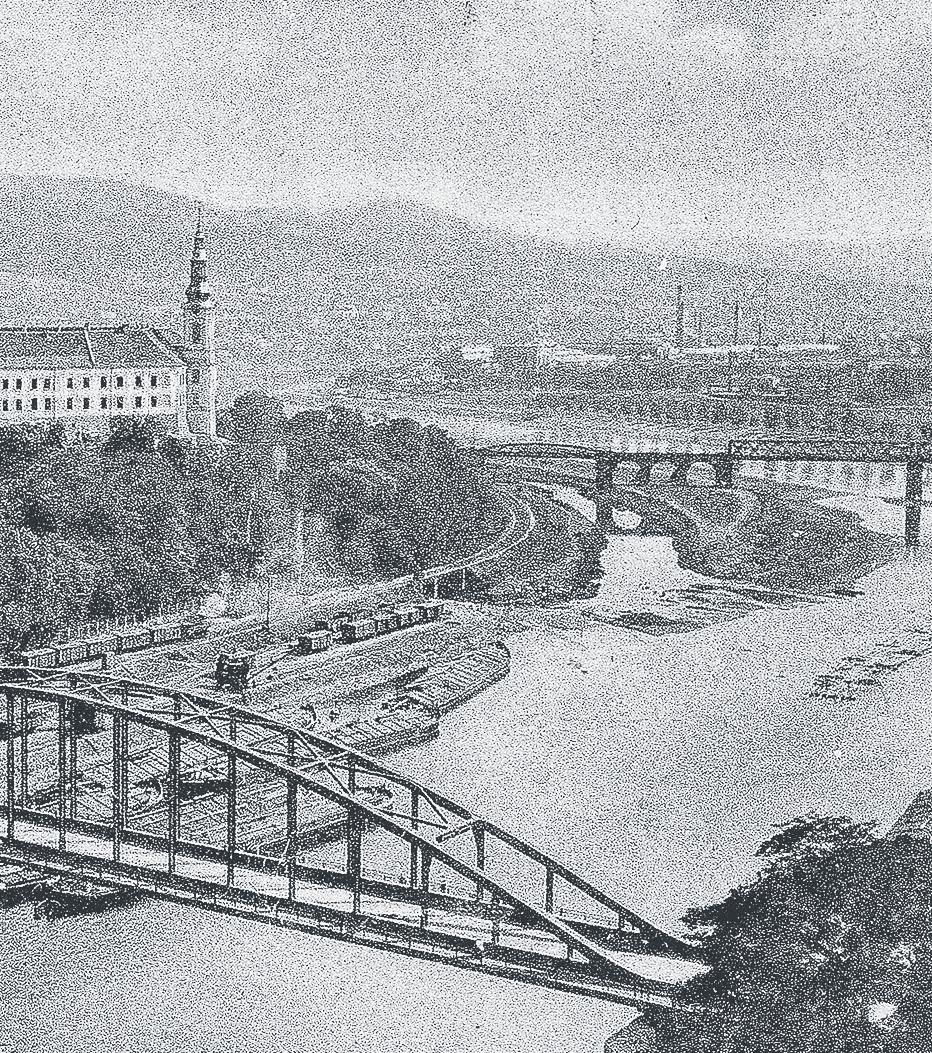
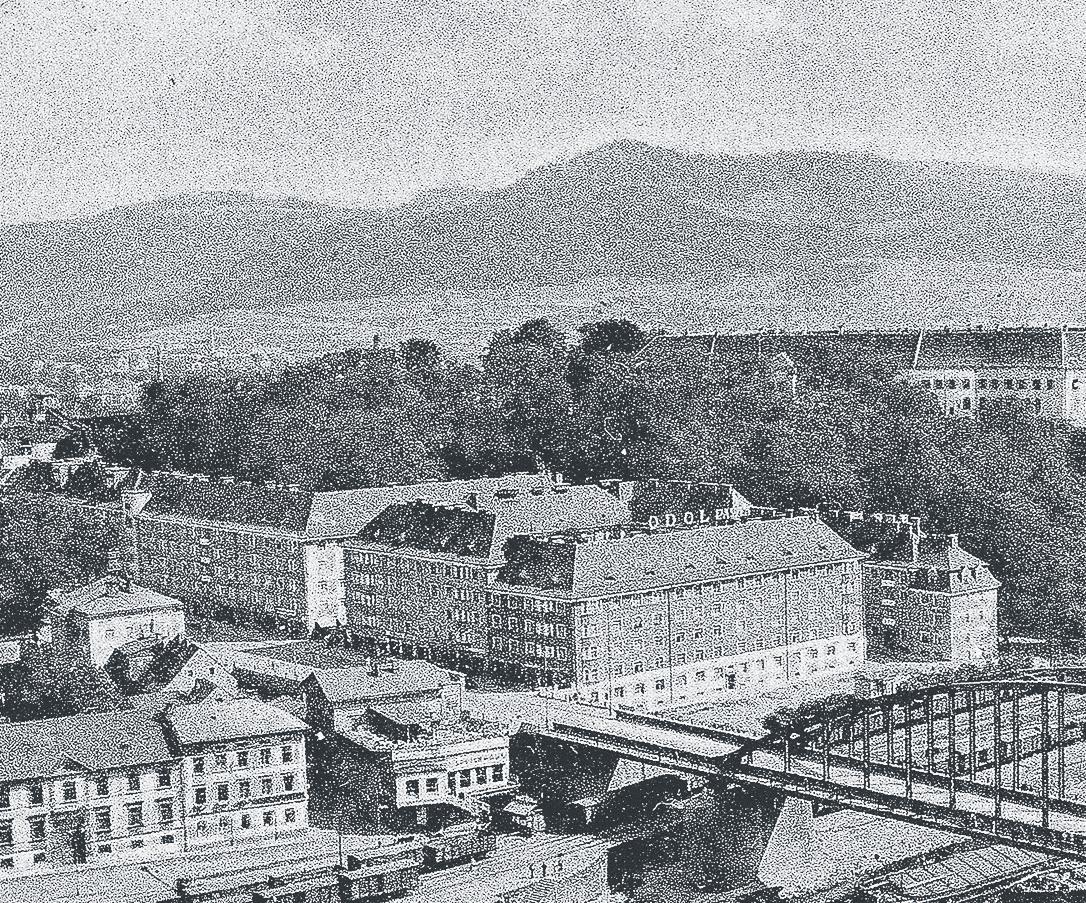


















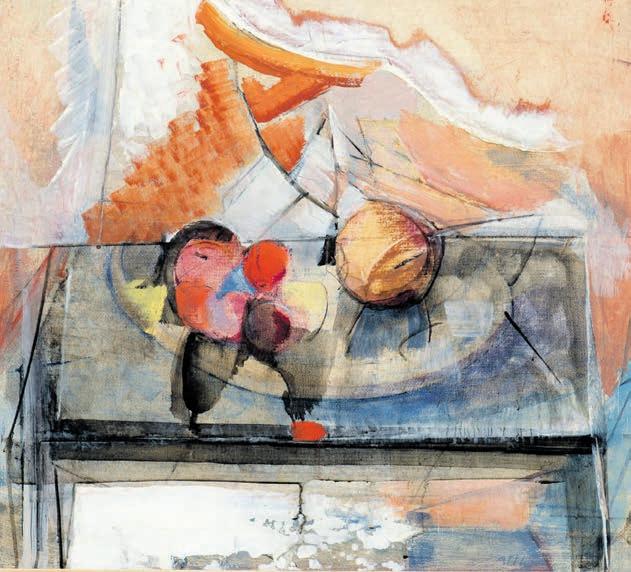


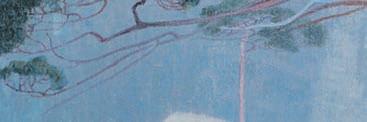



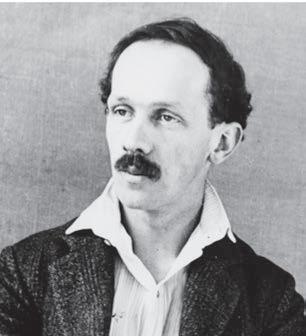

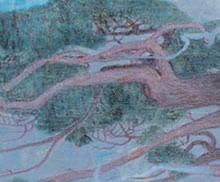
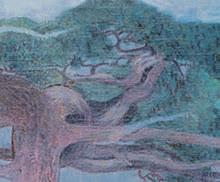

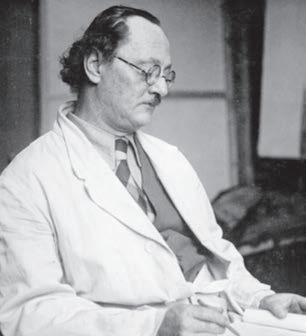























































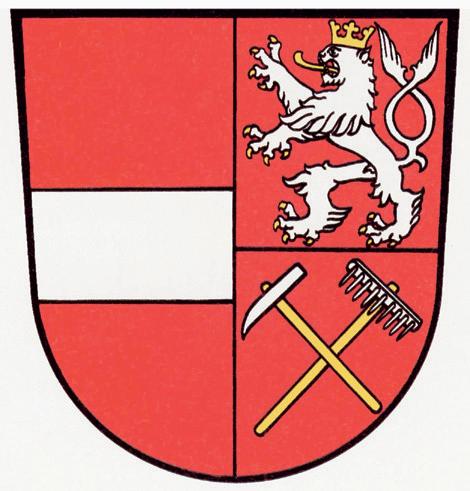
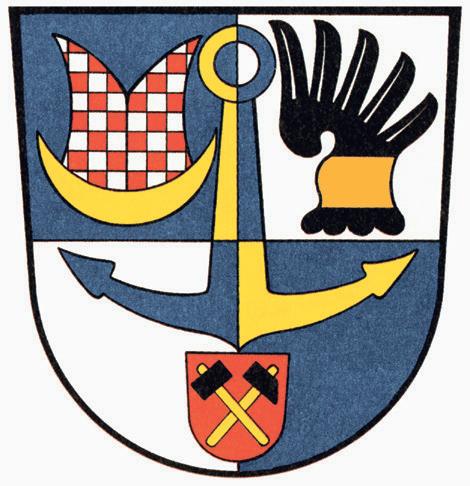
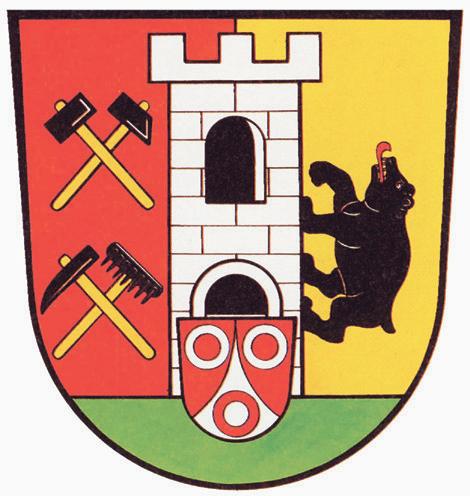




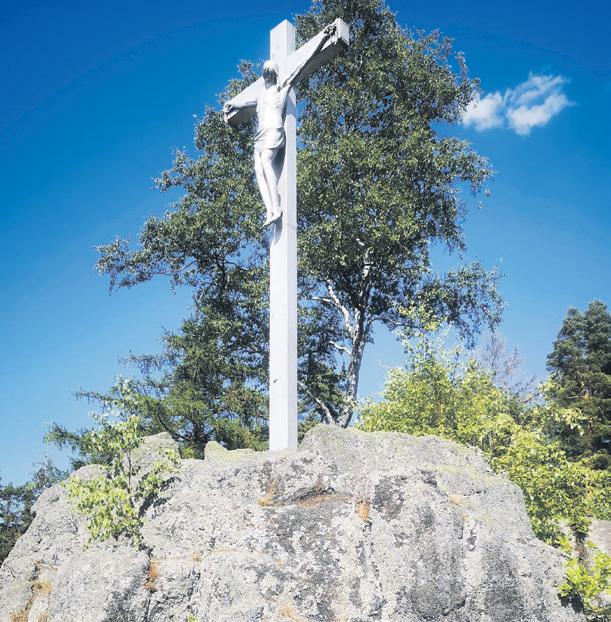







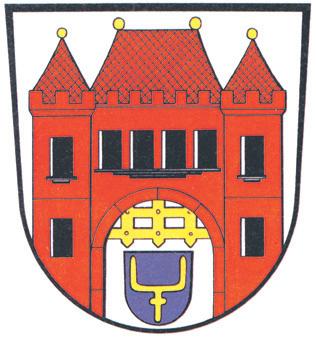
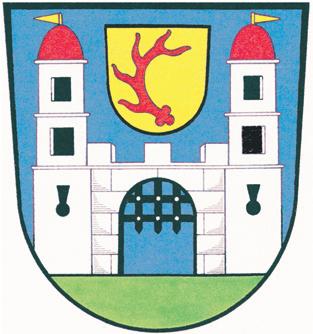
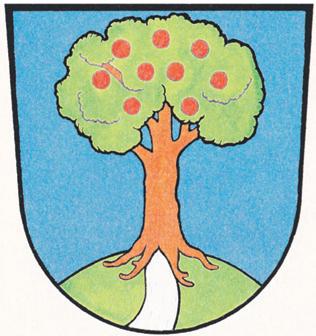
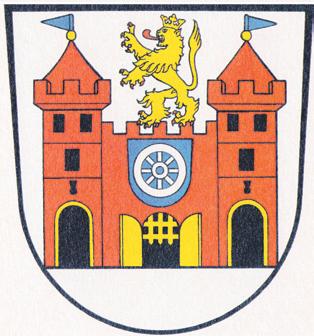













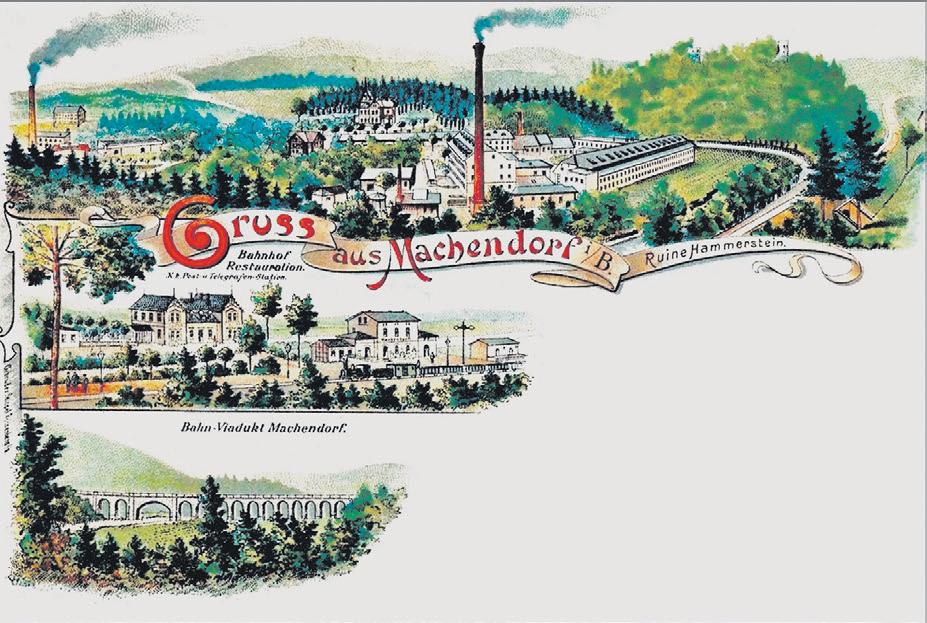

 Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel
Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel




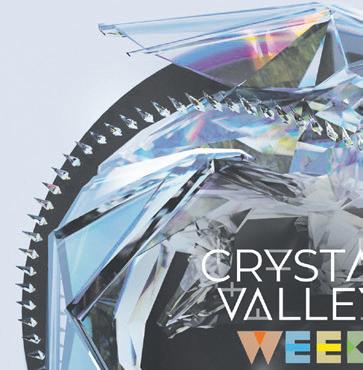




 Der Chor „Ü60“ aus Kaufbeuren.
❯ Gablonz und Kaufbeuren
Der Chor „Ü60“ aus Kaufbeuren.
❯ Gablonz und Kaufbeuren


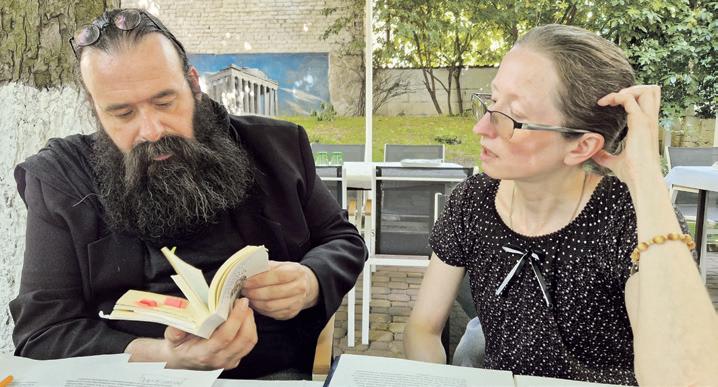

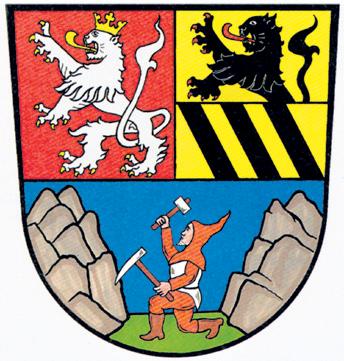
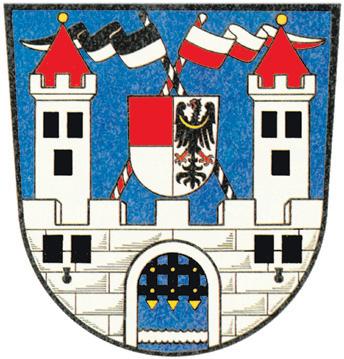

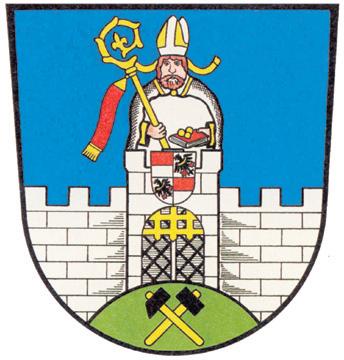
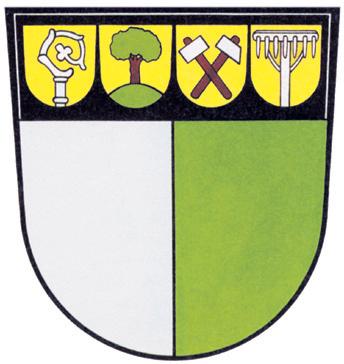











 Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg