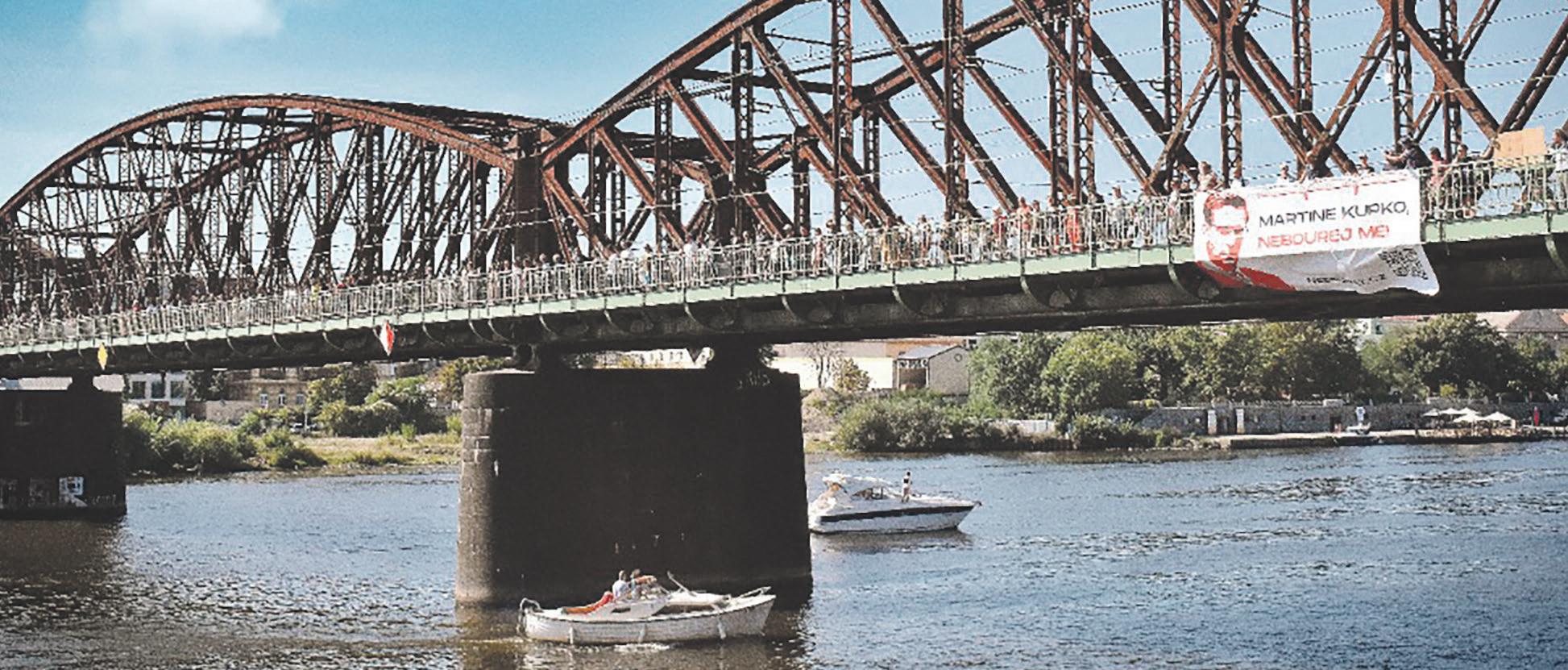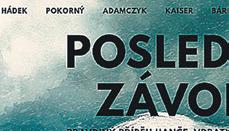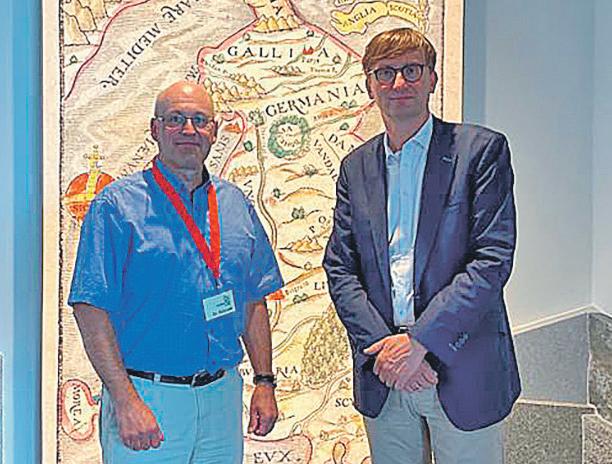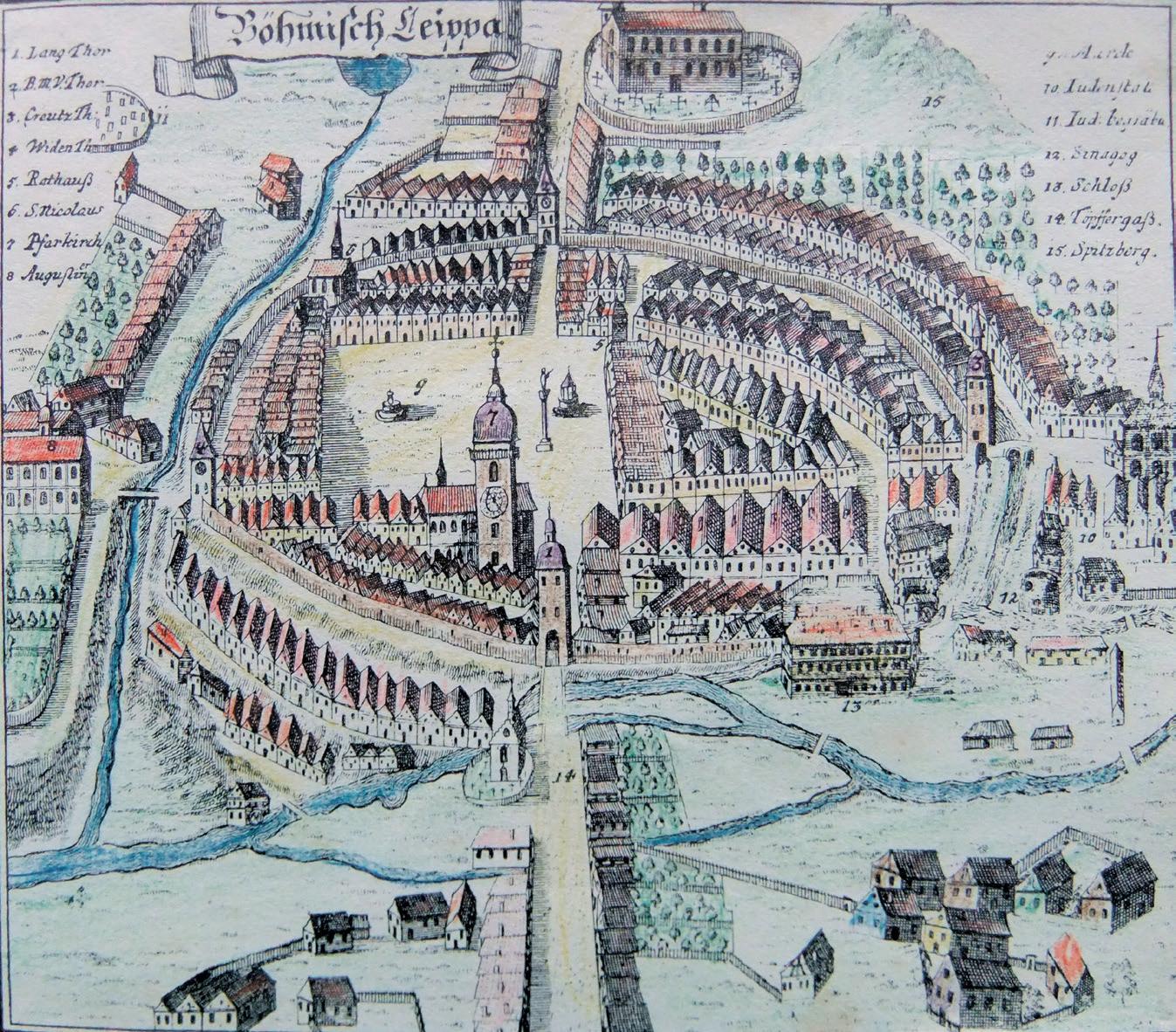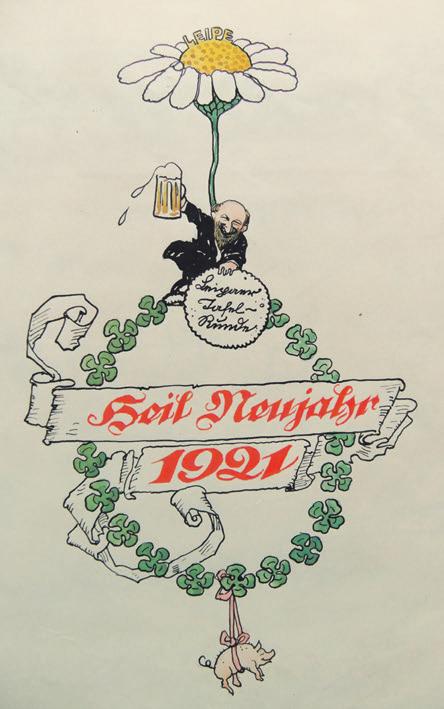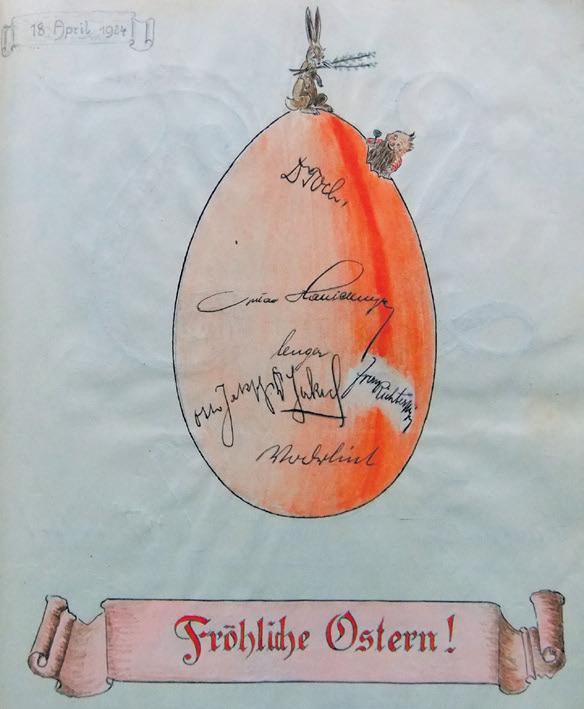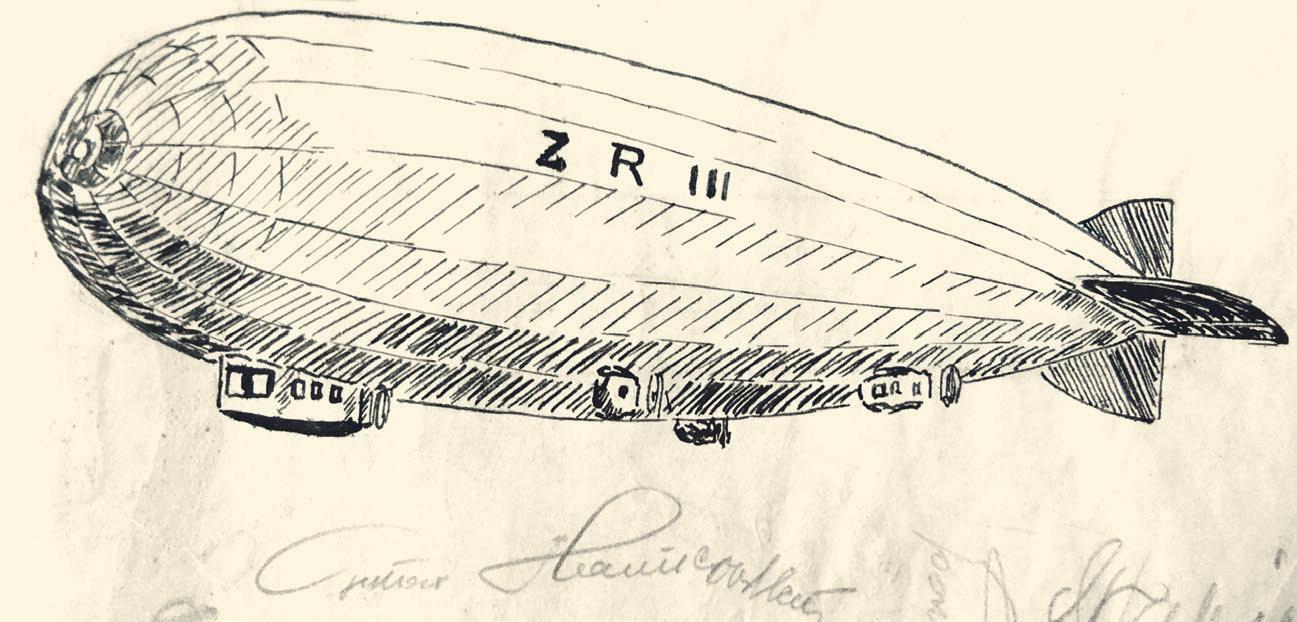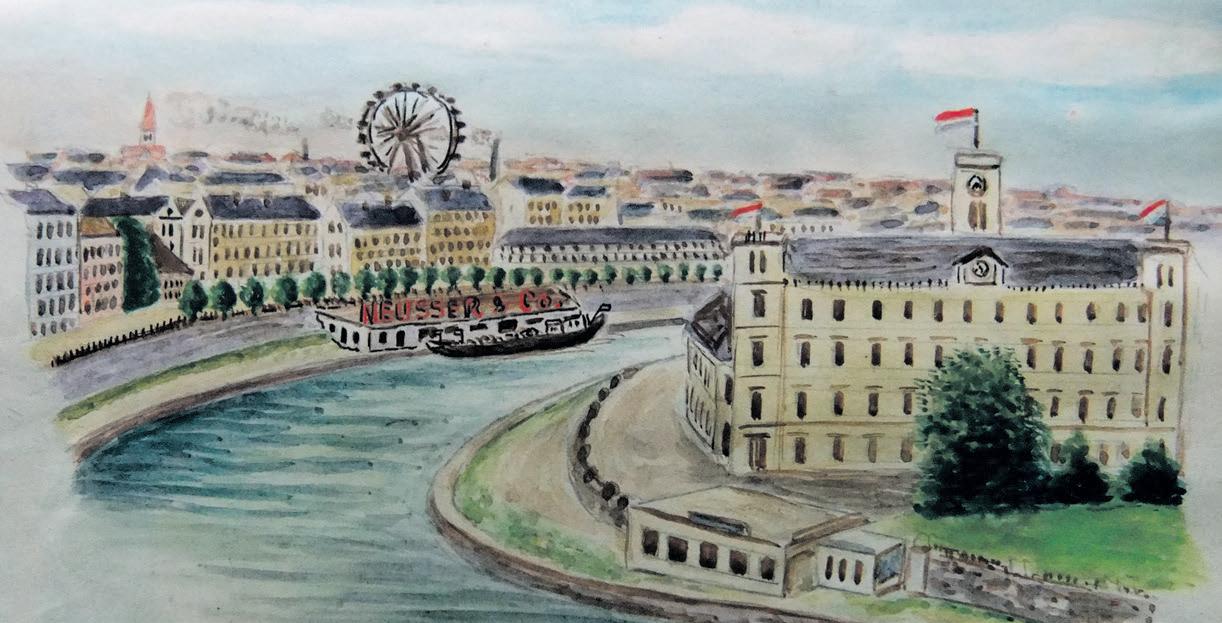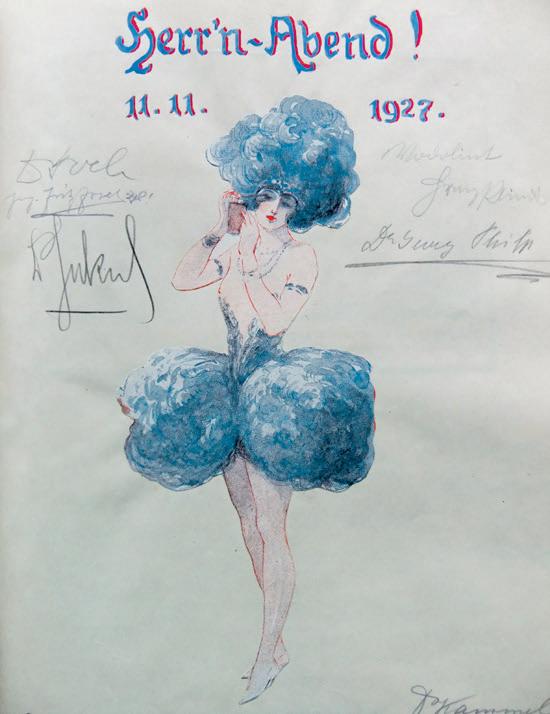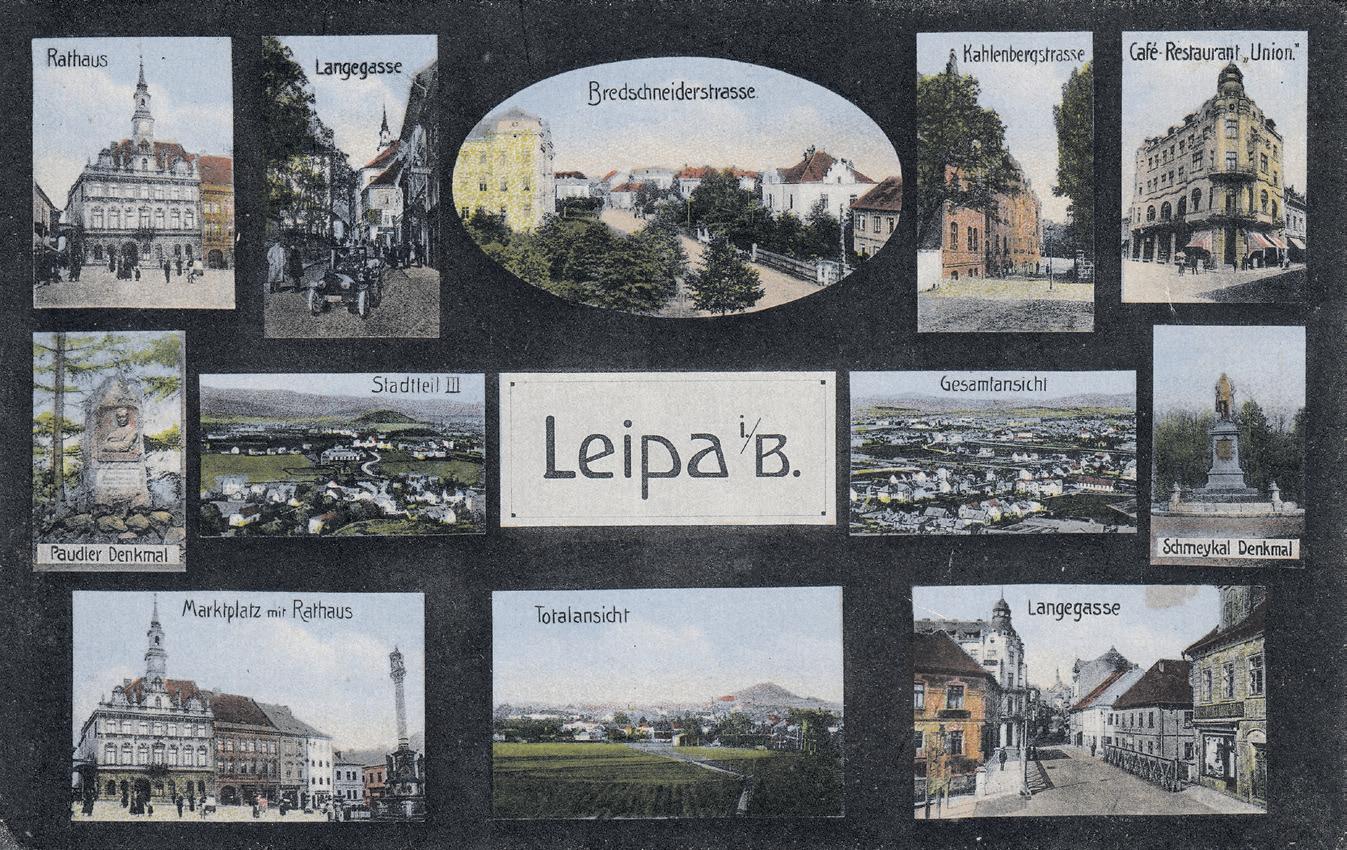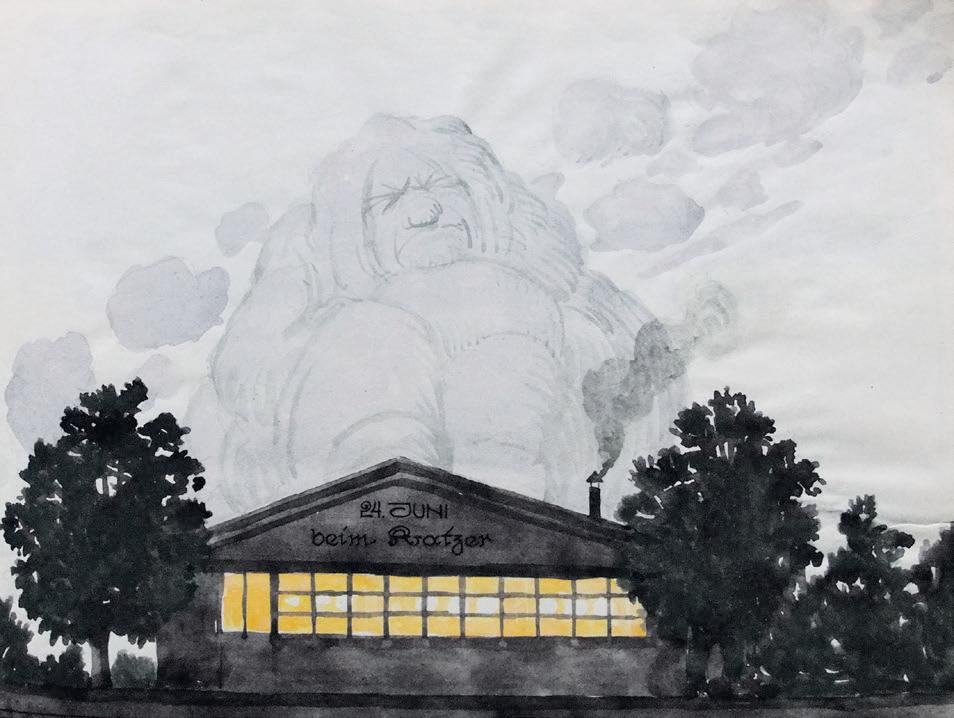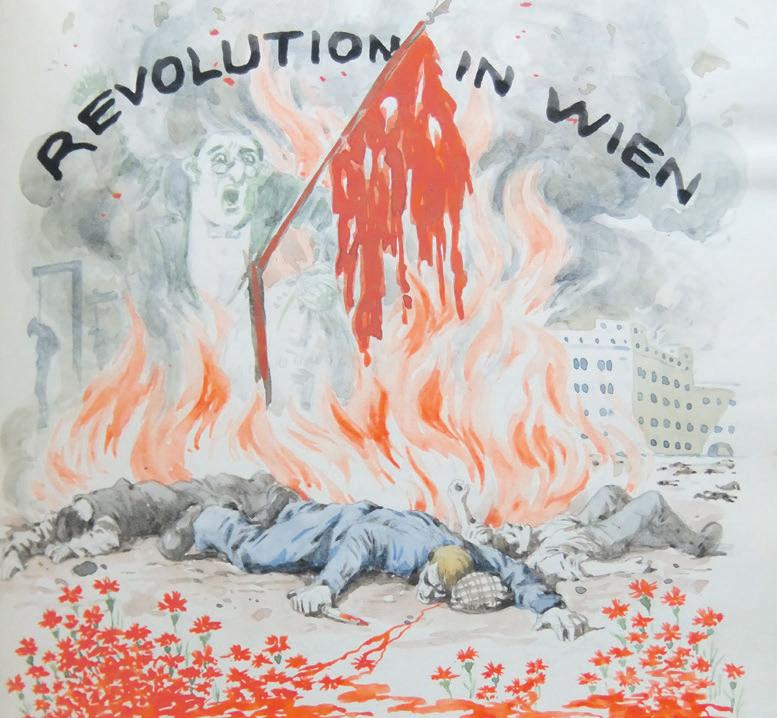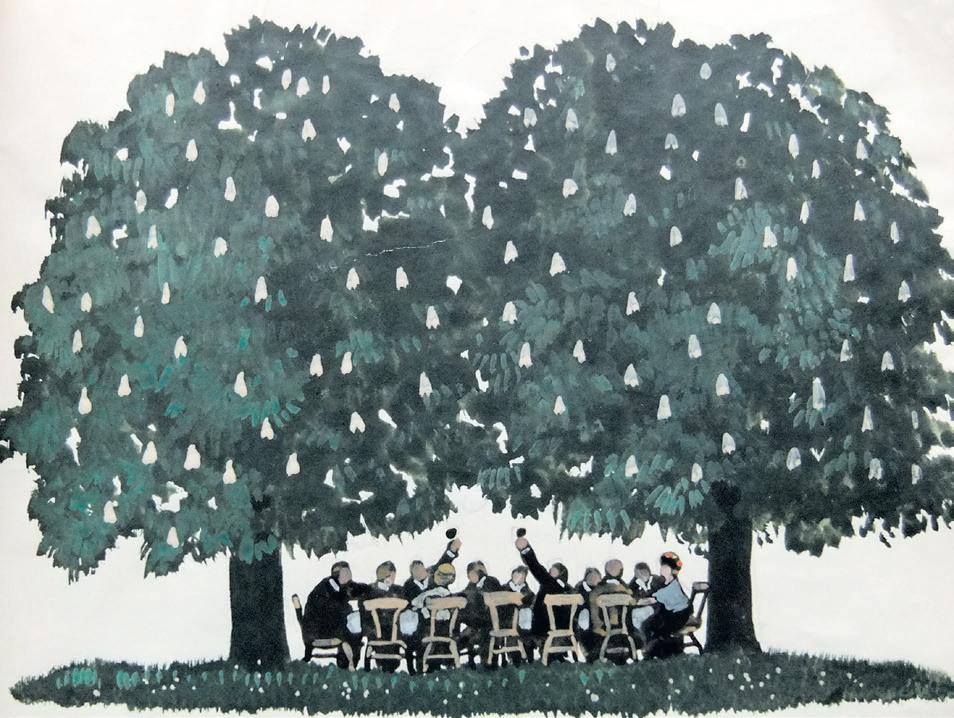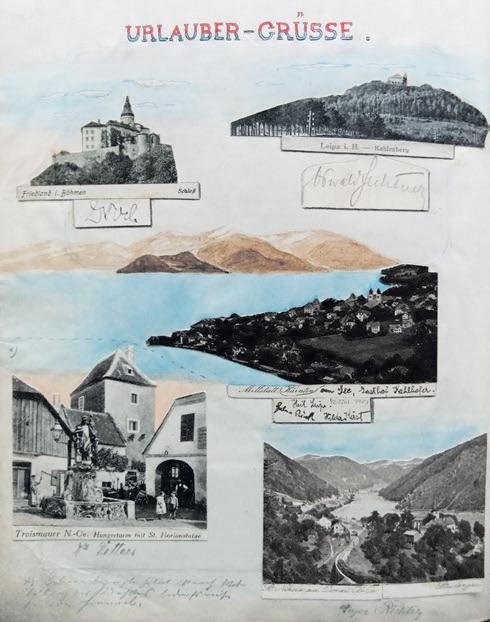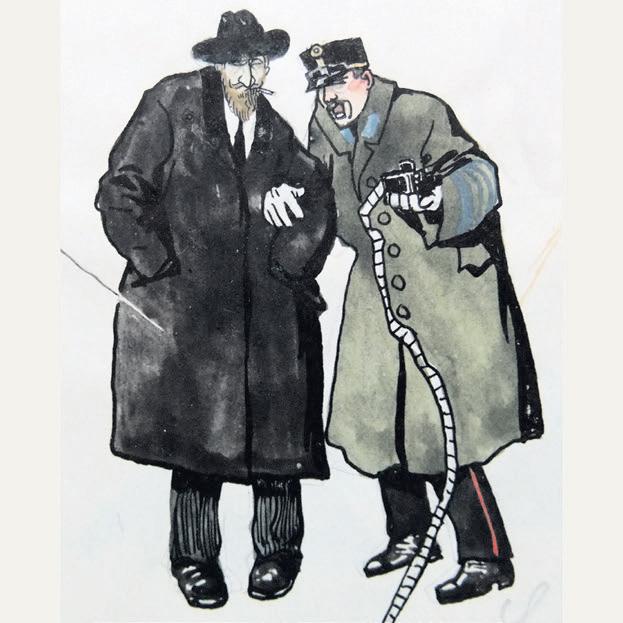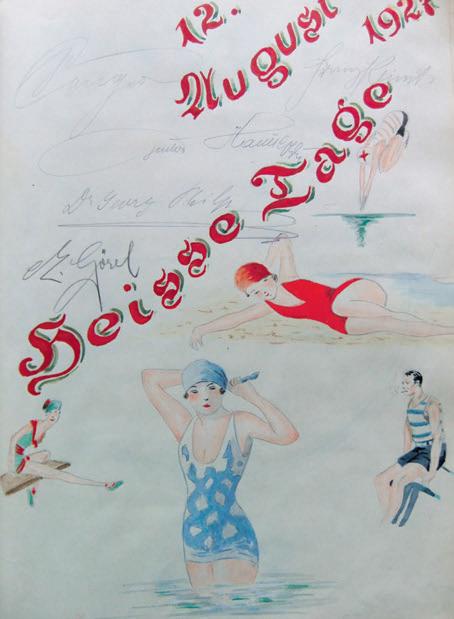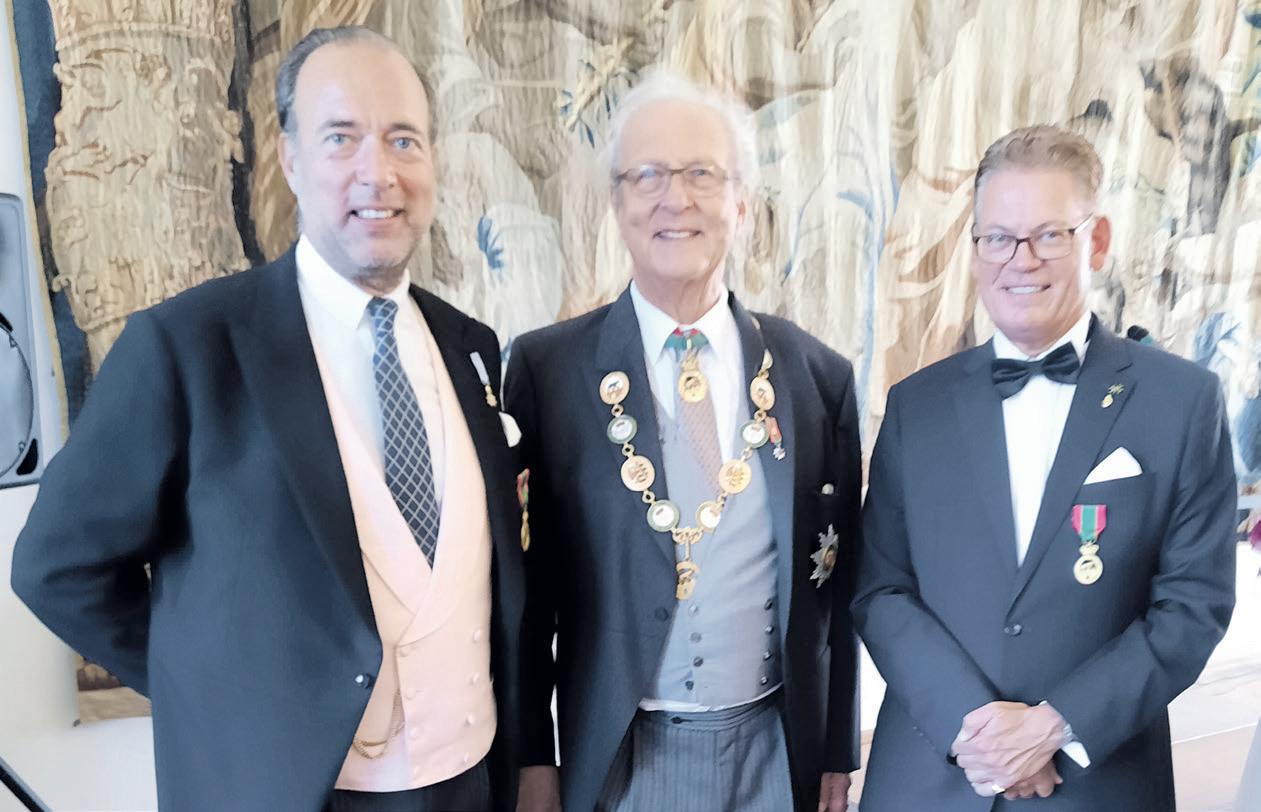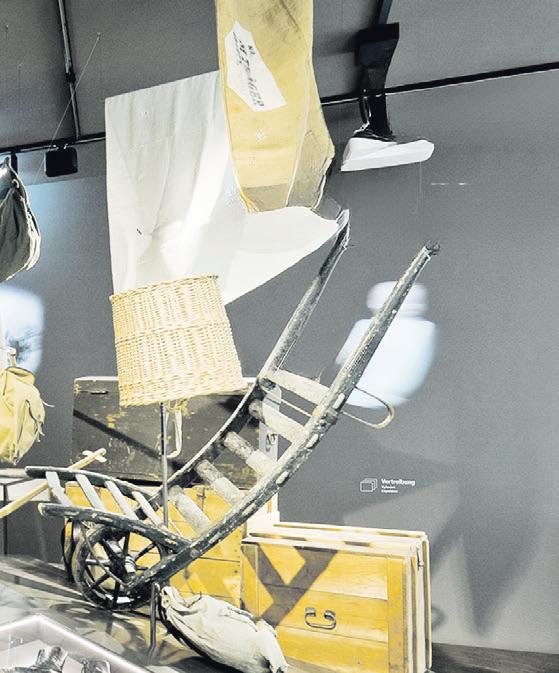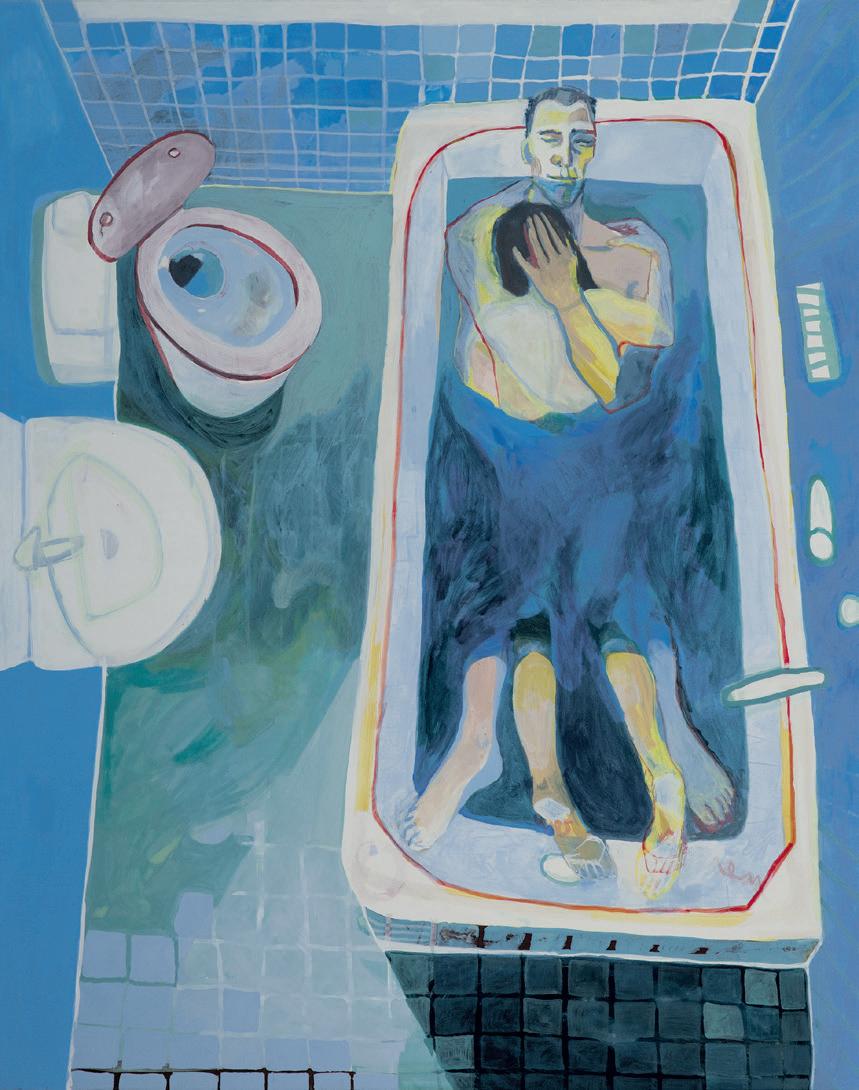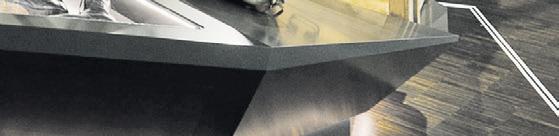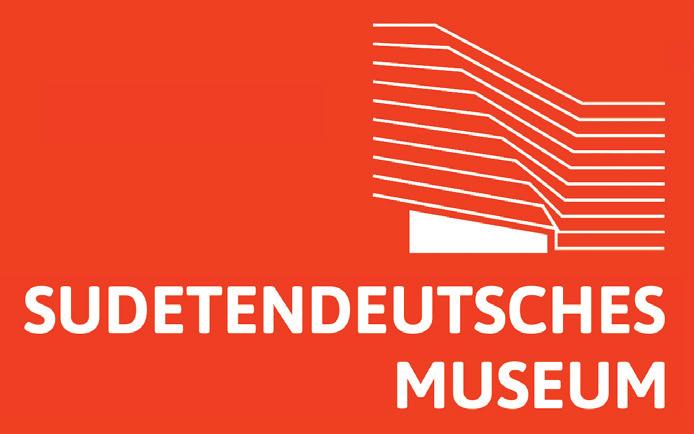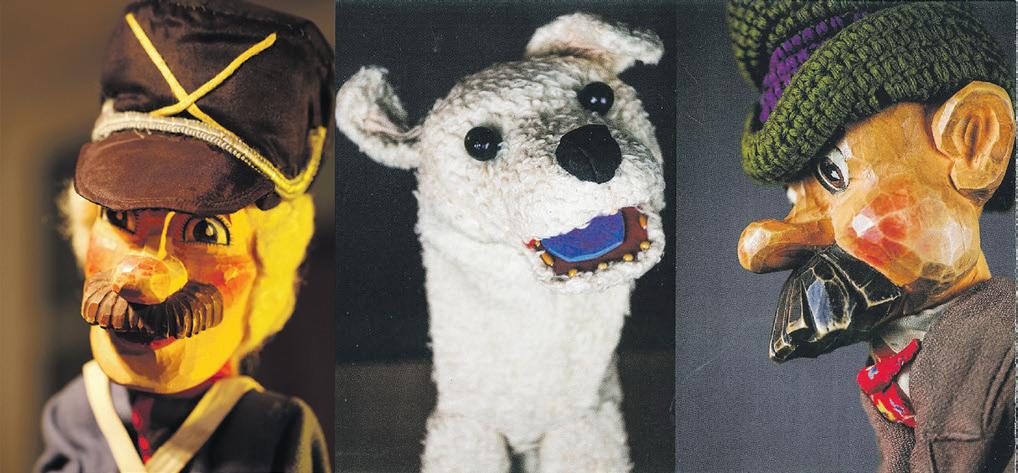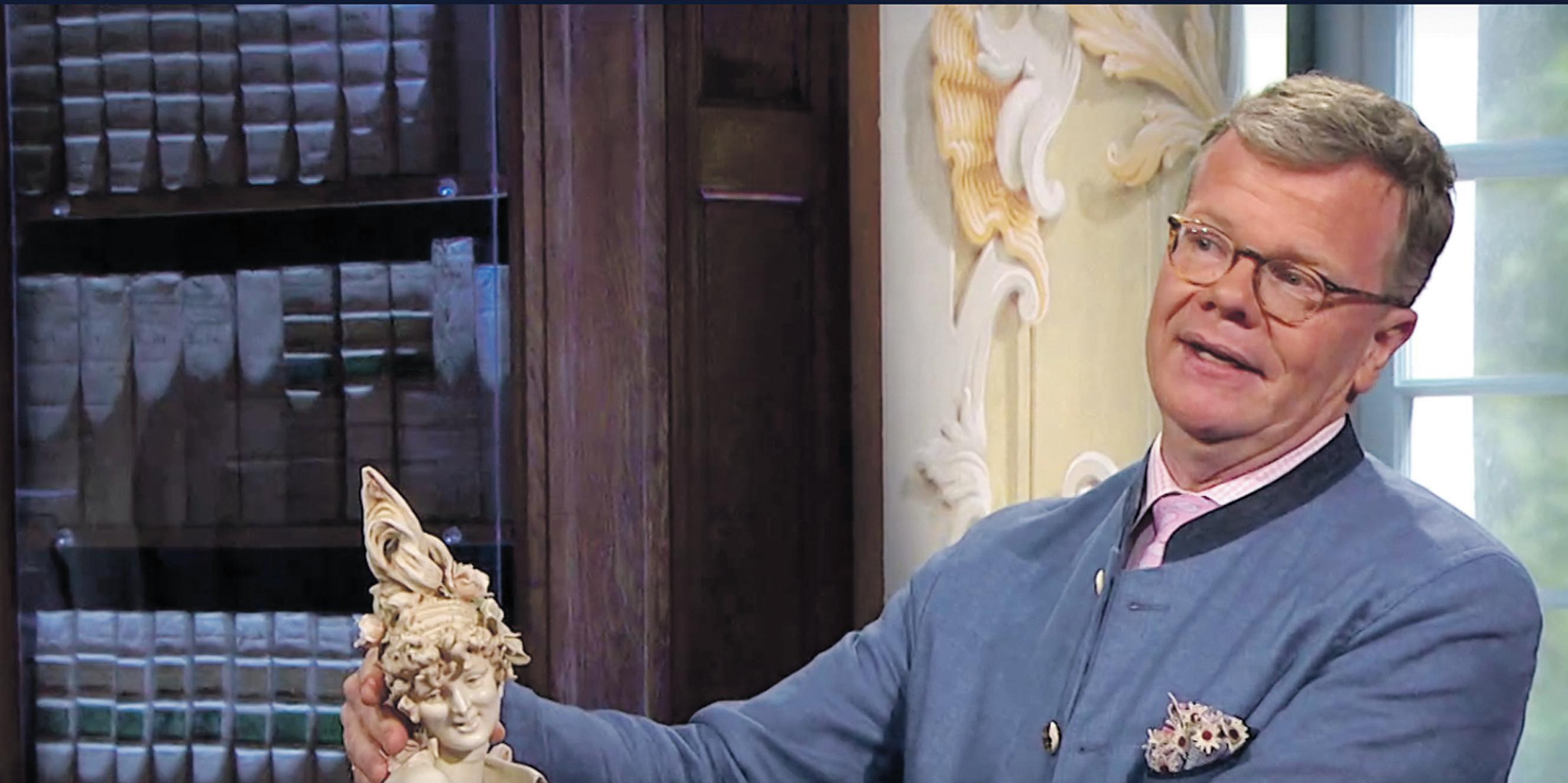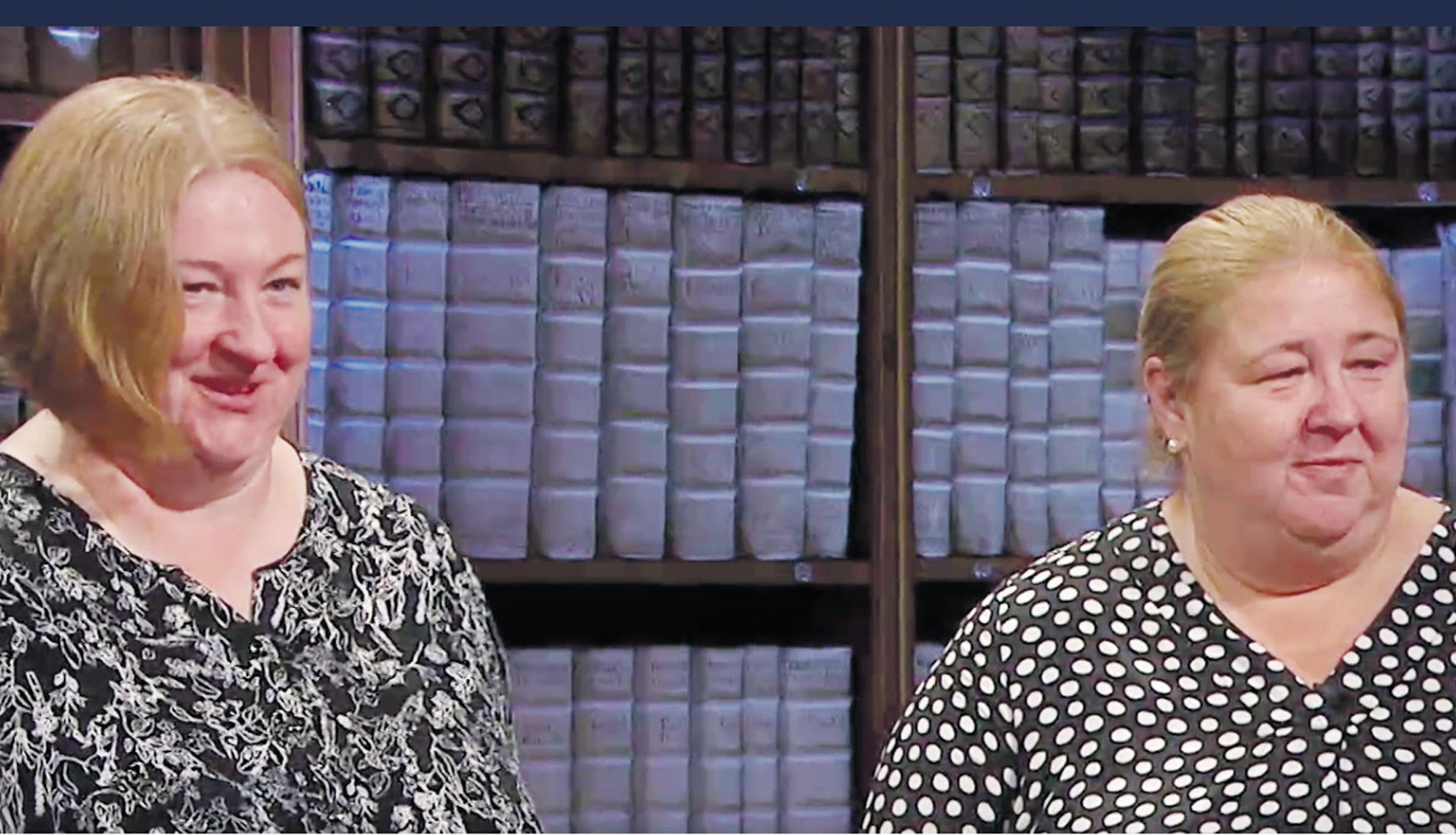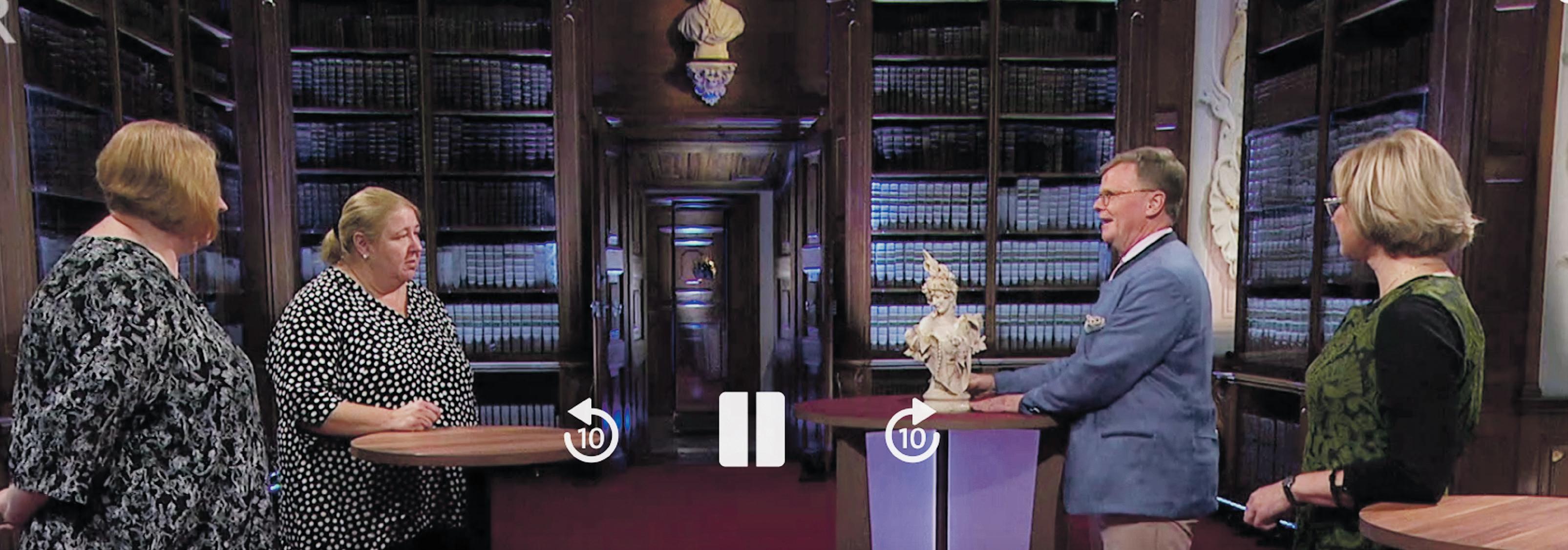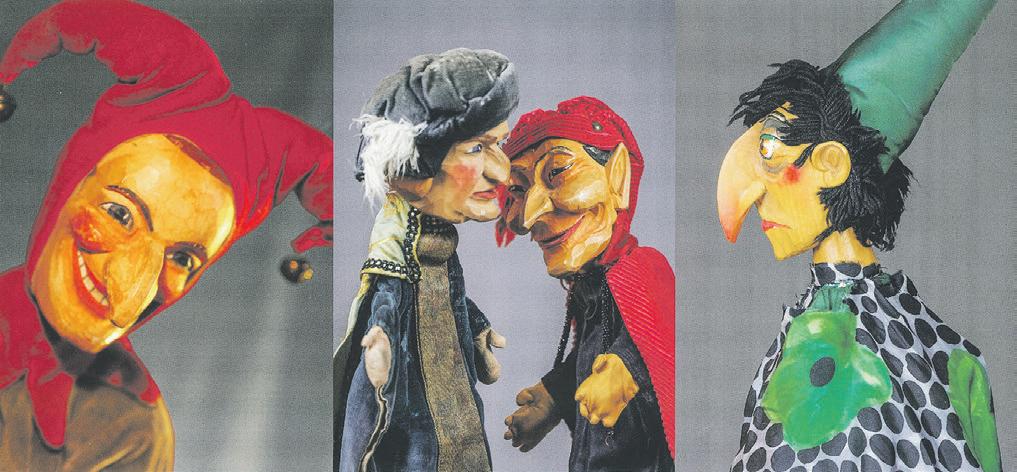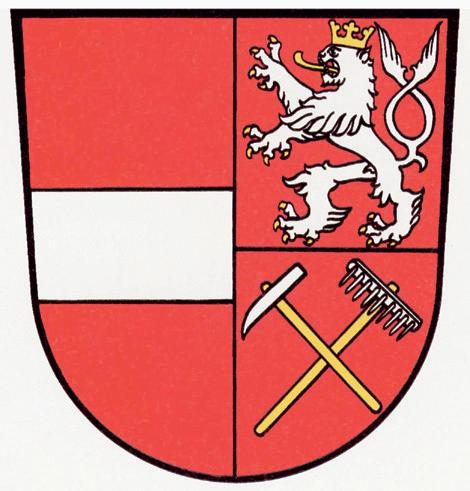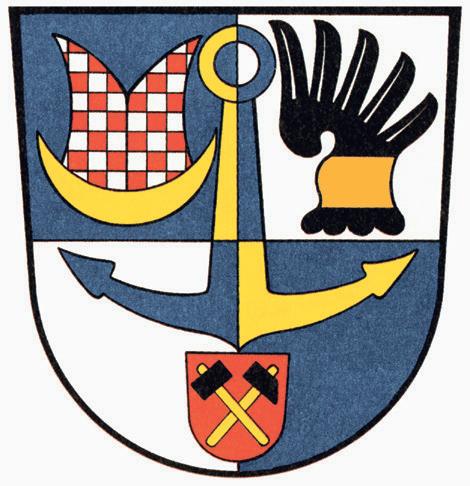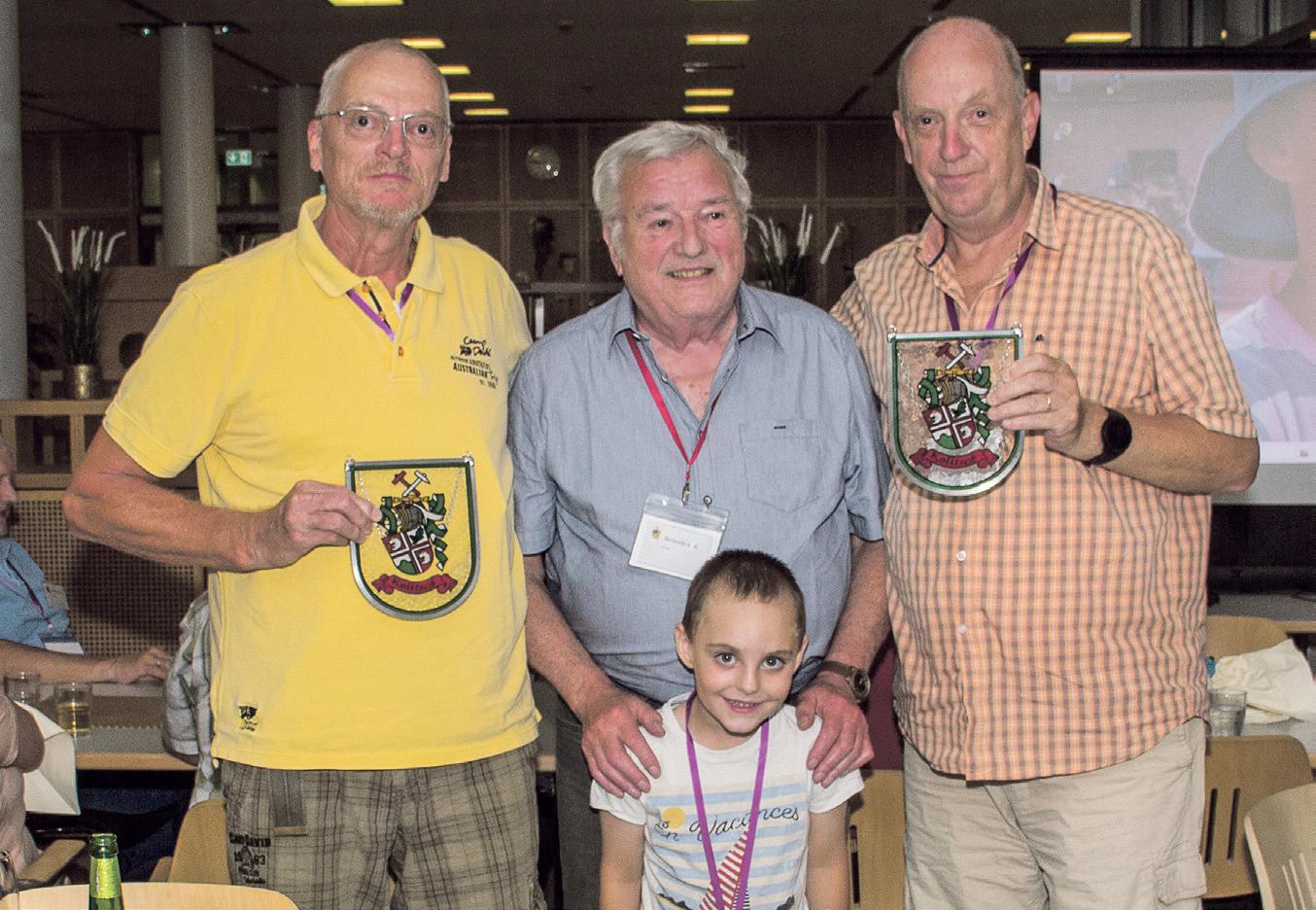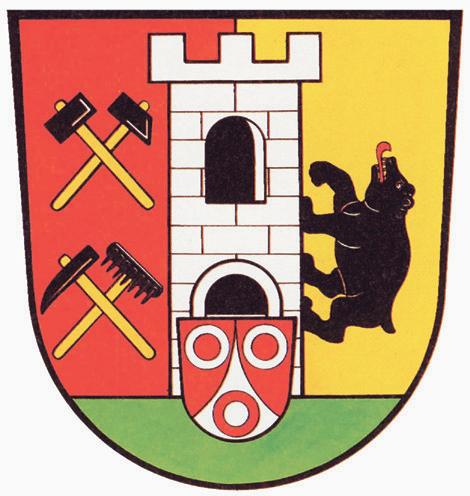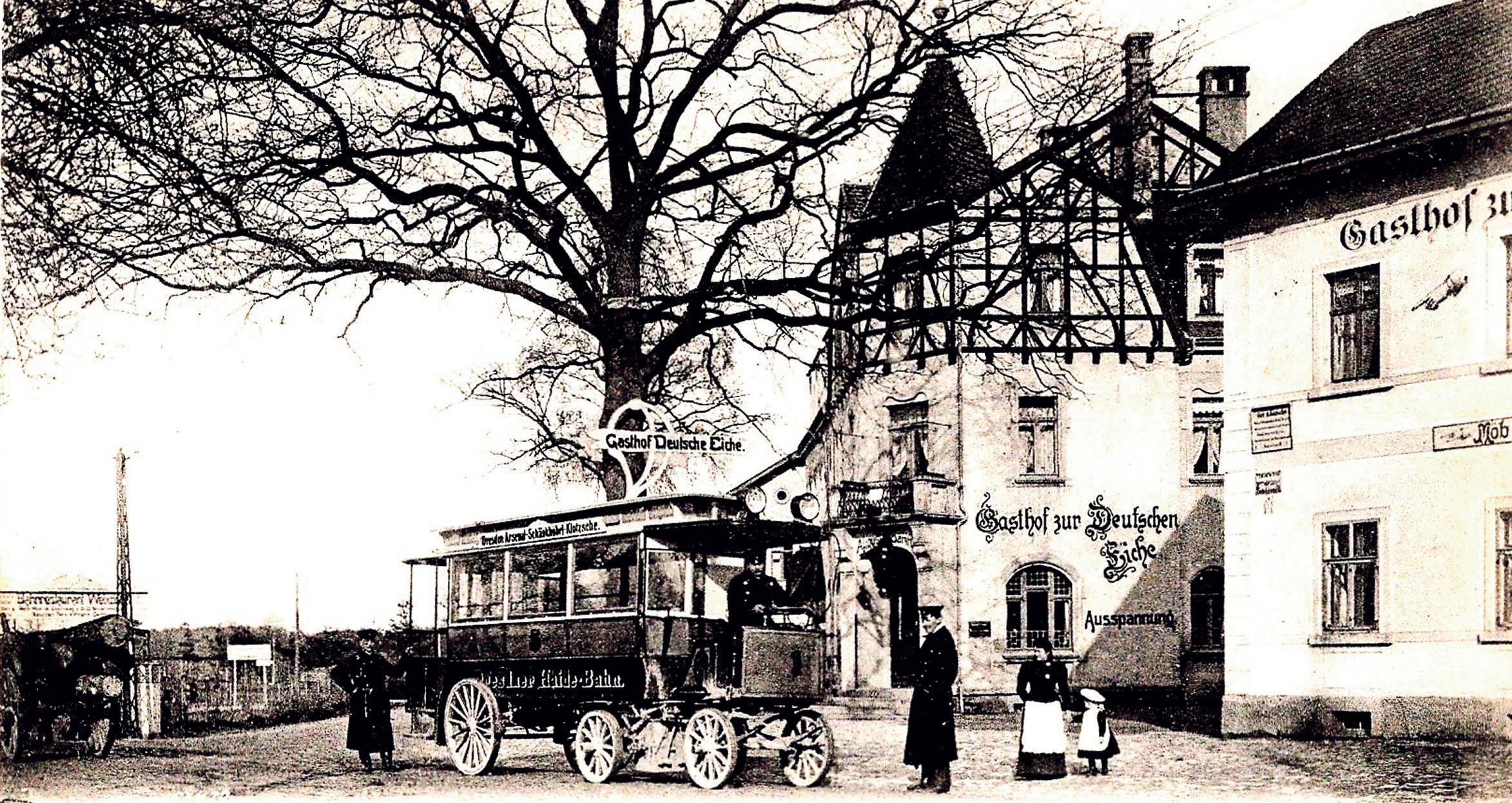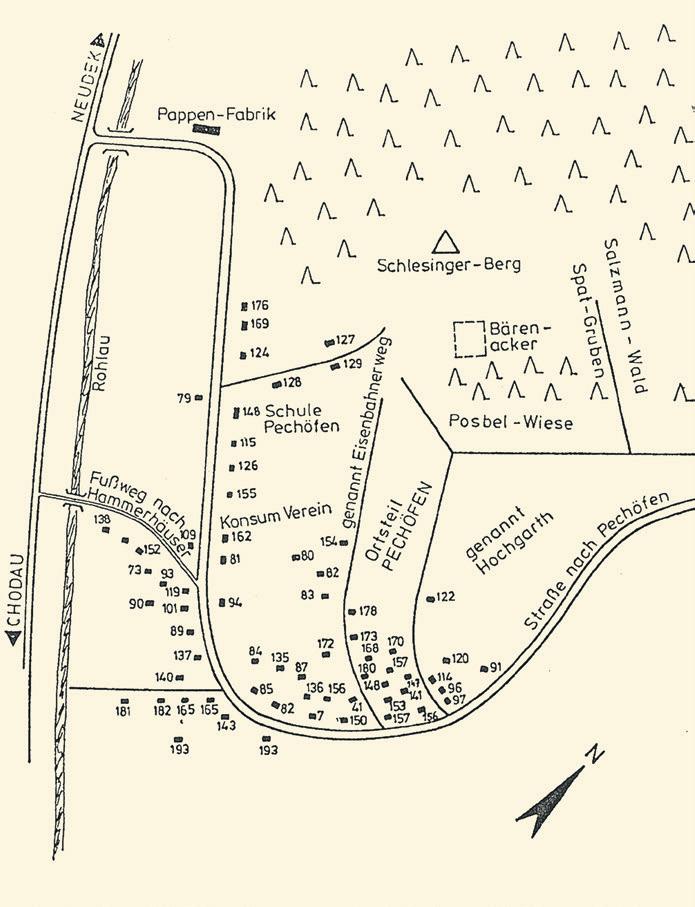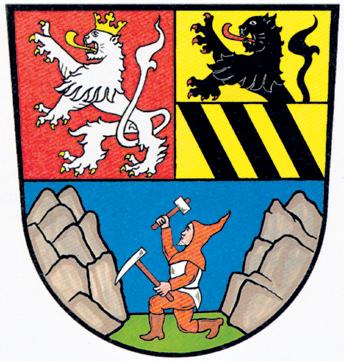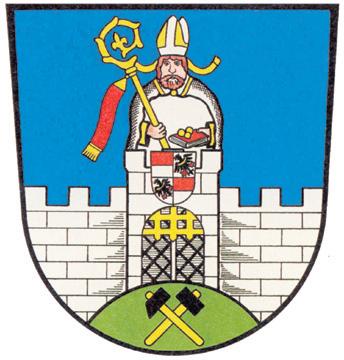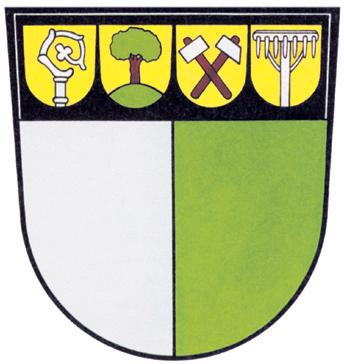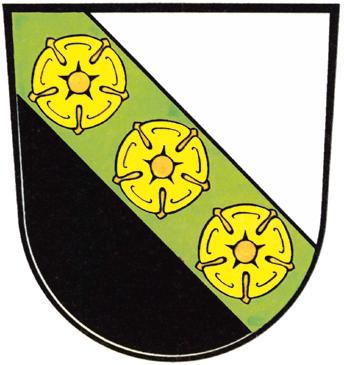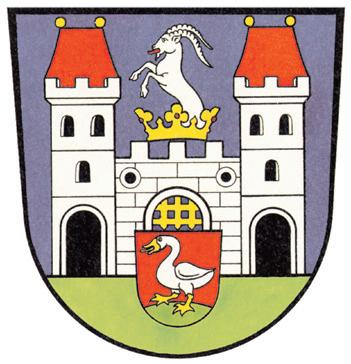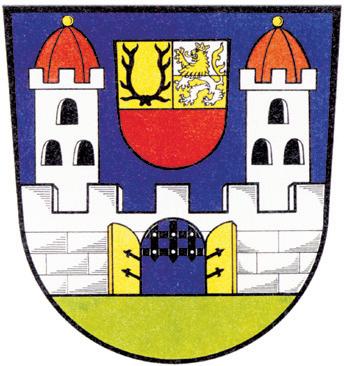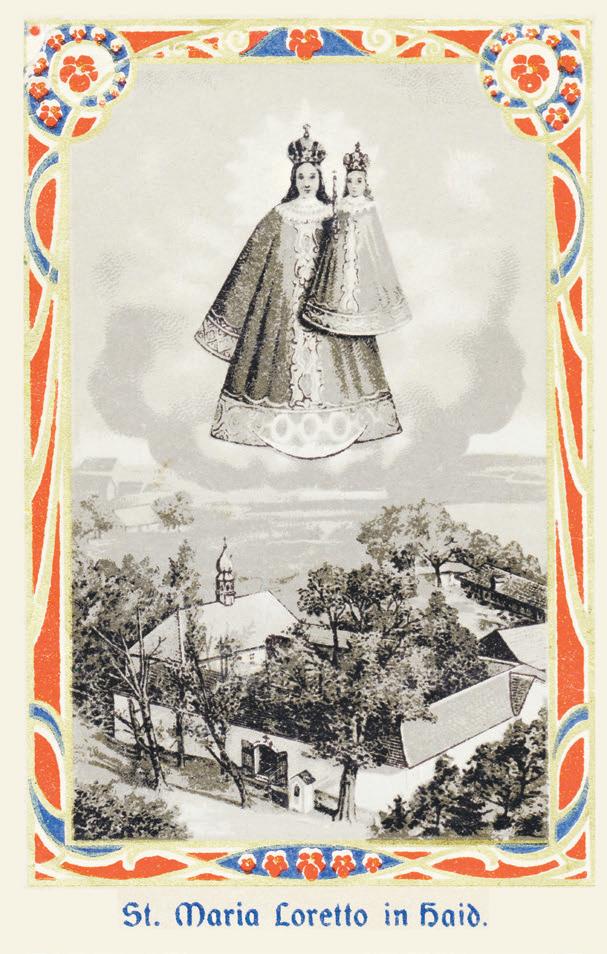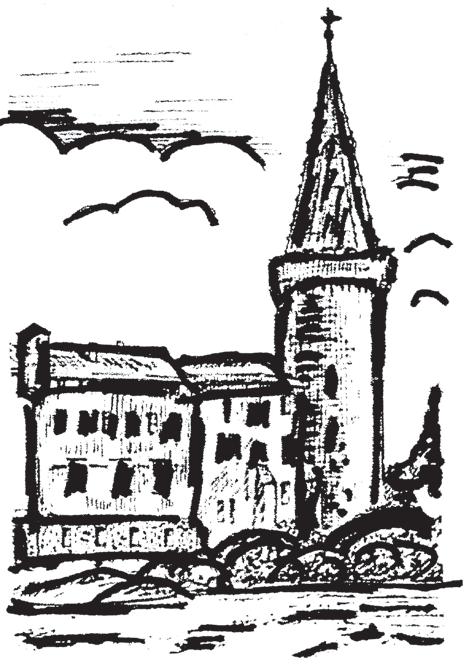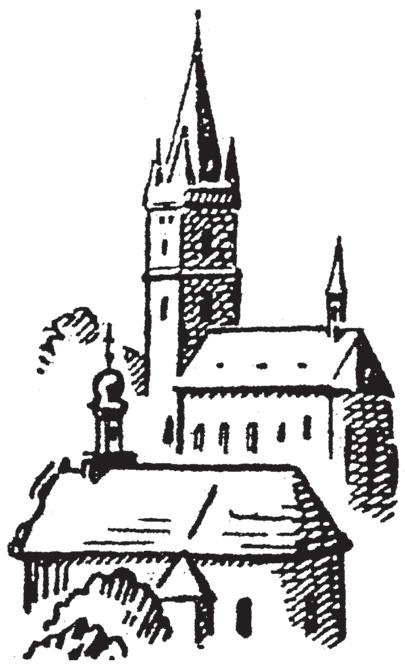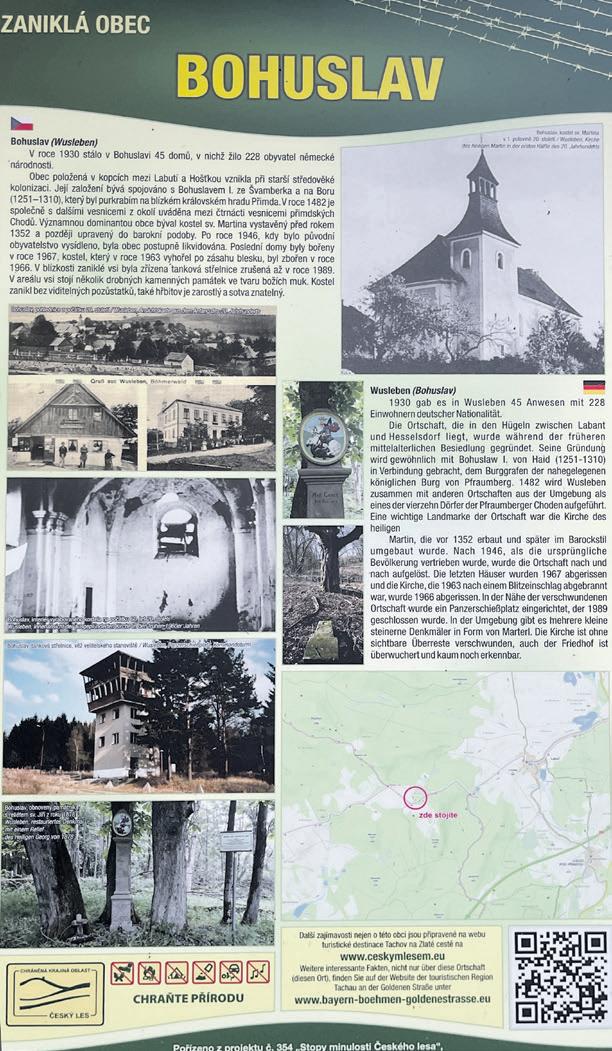Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger

VOLKSBOTE
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
Neudeker
Sudetendeutschen Landsmannschaft
Sudetendeutsche Zeitung
Zeitung
Zeitung




HEIMATBOTE


Neudeker Heimatbrief

Heimatbrief

VOLKSBOTE
� Auto-Abgasregelung
Tschechien
setzt sich bei Euro 7 durch
Der Vorstoß der Bundesregierung und der Europäischen Kommission, ab Jahresmitte 2025 EU-weit für Kraftfahrzeuge die strenge Abgasnorm Euro 7 einzuführen, ist gescheitert. Durchgesetzt hat sich im Ministerrat Tschechien, das mit seiner Gegeninitiative die eigene Automobilindustrie und die damit verbundenen Arbeitsplätze schützen will.
Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka (ODS) bezeichnete den ausgehandelten Kompromiß als einen großen Erfolg für Tschechien. Nach Kupkas Aussage wurden Emissionsgrenzwerte für Autos gelokkert und die Fristen für die Einführung der Norm gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag verlängert. Tschechien hatte nach Bekanntwerden der EUPläne massiv protesiert und weitere sieben EU-Staaten als Unterstützer gewonnen. Am Ende stimmte auch Deutschland dem ursprünglichen Entwurf nicht zu, da sich die Koalitionspartner FDP und Grüne nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten.
Ob die Euro-7-Norm nun tatsächlich so kommt, wird sich final erst entscheiden, wenn die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und der EU-Kommission dazu abgeschlossen sind. Das kann noch Monate dauern.
VOLKSBOTE

� Weltweite Studie des Reiseveranstalters Planet Cruise
Mit einer Menschenkette über die Moldau haben Bürger gegen den geplanten Abriß der historischen Eisenbahnbrücke unterhalb des Prager Wyschehrad demonstriert und eine Sanierung des über 120 Jahre alten Bauwerkes gefordert.
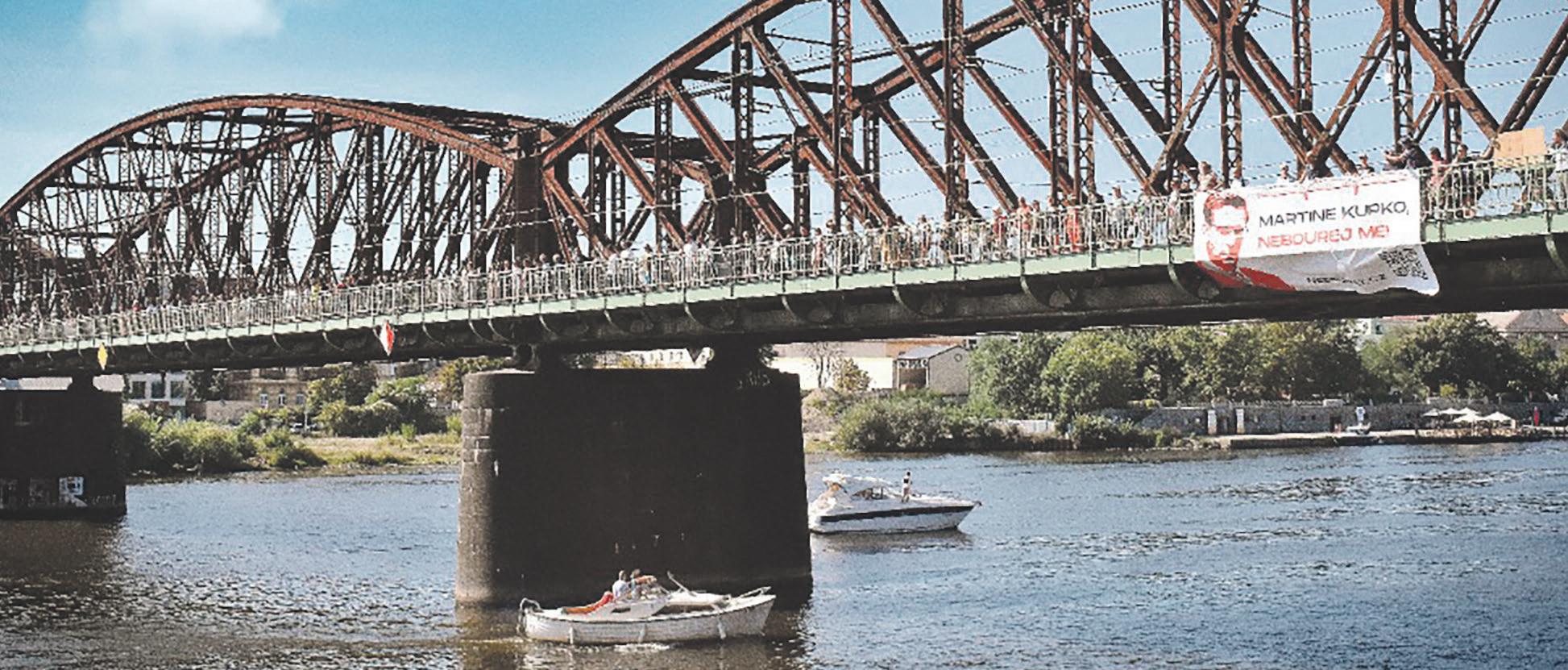
Der Verein Nebourat, der zu dem Protest aufgerufen hatte, sammelt außerdem Unterschriften für den Erhalt. Die On-
line-Petition wurde bereits von 17 500 Bürgern gezeichnet. Täglich fahren bis zu 288 Züge über die 261 Meter lange Moldau-Brücke, die seit 2004 unter Denkmalschutz steht. In einer Studie hatten Experten 2018 geraten, die Brücke durch einen Neubau zu ersetzen. Verkehrsminister Martin Kupka (ODS) erklärte, er wolle über das weitere Vorgehen bis zum Jahresende entscheiden.
Sicher, freundlich, günstig: Prag ist das beste Reiseziel in Europa
Bestes Reiseziel in Europa, zweitbestes Reiseziel auf der Welt: Prag ist laut einer Studie des Reiseveranstalters Planet Cruise vor allem für Alleinreisende die perfekte Wahl.

Während Familien den Urlaub am Meer, am See oder in den Bergen verbringen, entscheiden sich viele Alleinreisende für einen Städtetripp. Für diese Zielgruppe haben Experten im Auftrag des Reiseveranstalters
Planet Cruise die 56 interessantesten Metropolen der Welt untersucht. Die sechs Kriterien, die dabei die Grundlage bildeten, waren Sicherheit, Freundlichkeit, durchschnittliche Hotelkosten, Angebot an Gruppenaktivitäten, Anzahl der Attraktionen sowie die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr.
Mit 4,6 von fünf Punkten erreichte Prag knapp hinter Tokio (4,7) weltweit den zweiten Platz. Weltweit unter den attraktivsten zwanzig Städten sind zehn europäische Städte, und zwar Budapest (7), Wien (8), Rom (9), Bukarest (10), Madrid (13), Lissabon (14), Florenz (15), München (17) und Paris (19).
In Punkto Freundlichkeit ist Prag mit 62 Prozent knapp hinter Wien (64 Prozent) die zweitfreundlichste Stadt der Welt. Auch bei der Sicherheit kann die tschechische Hauptstadt mit 75,3 Punkten, dem fünftbesten Wert weltweit, überzeugen. In ihrer Studie schreiben die Autoren: „Der zweite Ort auf unserer Hotspot-Liste für Alleinreisende ist die märchenhafte Stadt Prag.
Mit ihrer imposanten gotischen Architektur, dem köstlich wär-
� 90.
Mit einem Rekordergebnis von 96,56 Prozent ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf dem Parteitag am Samstag in München als CSU-Vorsitzender klar im Amt bestätigt worden. Außerdem sind im neuen Parteivorstand wieder zahlreiche Landsleute mit sudetendeutschen Wurzeln vertreten.

menden Essen und den schönen Kopfsteinpflasterstraßen ist Prag der perfekte Ort, für alle, die auf der Suche nach einem Ort sind, den sie ein paar Tage lang erkunden können.“
Die Stadt mit der höchsten Sicherheit ist übrigens mit 79,2
Preis sind die wichtigsten Pluspunkte des Prager Nahverkehrssystems seine Vernetzung und Effizienz“, schreiben die Autoren in ihrer Studie und verweisen auf die Zeitschrift TimeOut, die Anfang des Jahres das öffentliche Nahverkehrssystem von Prag
Punkten München. Der einzige deutsche Vertreter in der Top 20 fällt dagegen in einer anderen Kategorie mit 0 Punkten komplett durch – bei den Kosten für den Öffentlichen Nahverkehr.
Kein Wunder, da in München allein die Hin- und Rückfahrt zum Flughafen mit 26 Euro zu Buche schlägt.
Anders Prag, das im europäischen Vergleich mit Budapest und Bukarest zu den preisgünstigsten Destinationen gehört.

„Neben dem relativ niedrigen
als das zweitbeste der Welt gekürt hatte. Auch in den Jahren davor wurde Prag immer wieder ausgezeichnet – 2022 als kinderfreundlichste Urlaubsstadt in Europa und 2021 als einer der besten Städte weltweit für alleinreisende Frauen.
Und 2015 hatten die Leser der amerikanischen Zeitung US Today die tschechische Hauptstadt wegen ihrer schönen Weihnachtsmärkte als weltweit bestes Reiseziel für die Adventszeit gewählt. Torsten Fricke
A

ls Landesvorsitzender der Union der Vertriebenen (UdV) ist Bernd Posselt, Spre-
cher der Sudetendeutschen Volksgruppe, kraft Amtes weiter Mitglied des Parteivorstands, ebenso wie Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf als Vorsitzende der Frauen-Union und Gesundheitsminister Klaus Holetschek als Vorsitzender des Bezirks Schwaben. In das höchste Parteigremium gewählt wurden außerdem die ehemalige Schirmherrschaftsministerin Carolina Trautner und MdL Josef Zellmeier, Vorsitzender der Arbeitsgrup-
pe Vertriebene, Aussiedler und Partnerschaftsbeziehungen der CSU-Fraktion.
Als stellvertretende Parteivorsitzende wurden MdEP Manfred Weber (94,95 Prozent), MdEP Prof. Dr. Angelika Niebler (95,30 Prozent), Katrin Albsteiger (91,52 Prozent), Staatsministerin Melanie Huml (87,58 Prozent) sowie MdB Dorothee Bär (75,24 Prozent) gewählt. Schatzmeister sind MdB Sebastian Brehm (96,60 Prozent) und Dr.
Hans Reichhart (96,26 Prozent), Schriftführer Dr. Astrid Freudenstein, die mit 97,26 Prozent das beste Einzelergebnis aller Kandidaten erzielte, und Markus Pannermayr (96,40 Prozent).
In seiner Rede schwörte Söder die CSU-Delegierten auf die Landtagswahl am 8. Oktober ein: „Diese Wahl ist eine wichtige Weichenstellung für Bayern und ein starkes Signal für Berlin. Nur wir als CSU sind die Stimme Bayerns in Deutschland.“
HEIMATBOTE
Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Jahrgang 75 | Folge 39 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 29. September 2023 HEIMATAUSGABEN IN DIESER ZEITUNG
Zeitung Sudetendeutsch-Tschechischer Zukunftskongreß in Budweis (Seite 3)
HEIMATBOTE
VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Historische Eisenbahnbrücke in Prag
Heimatbrief �
Protest gegen den Abriß
Bayerns Vierter Stamm im CSU-Vorstand
Parteitag der Christlich-Sozialen Union am Samstag in München
Als Ziel für Städtereisen landet Prag bei Rankings immer wieder auf den vorderen Plätzen. Fotos: Czech Tourism
Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka.
Bis zu 288 Züge fahren pro Tag über die Moldau-Brücke unterhalb des Prager Wyschehrad. Foto: Monika Skopalová
Ministerpräsident Markus Söder wurde mit dem Rekordergebnis von 96,56 Prozent als CSU-Parteivorsitzender im Amt klar bestätigt. Foto: CSU
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der Bürgermeister des Stadtviertels Prag 7 (Holeschowitz), Jan Čižinský, gehört zu den treuesten Freunden der Sudetendeutschen und ganz besonders des Prager SL-Büros. Bereits als Chef des außenpolitischen Büros der tschechischen Christdemokraten (KDU-ČSL) erwies er unseren Landsleuten große Dienste. Heute wirkt er in seiner zweiten Amtsperiode als Bürgermeister eines mächtigen und wirtschaftlich starken Stadtteils mit mehr als 45 000 Einwohnern. Prag-Holeschowitz war lange vor dem Zweiten Weltkrieg das Zentrum der Prager Deut-
schen und deutschsprachigen Juden. Čižinský ist sich dieses historischen Erbes bewußt und tut alles dafür, daß die Verdienste der Prager Deutschen nicht in Vergessenheit geraten. Kein Wunder, daß SL-Büroleiter Peter Barton Čižinský für seine (sudeten-)deutsch-tschechische Verständigung schätzt und die beiden bei Bartons Besuch eine weitere Zusammenarbeit besprachen. Die Freundschaft und der Einsatz für diese gewaltige Aufgabe, verbunden mit Zuverlässigkeit, überzeugen Barton davon, daß Čižinskýs Arbeit uns auch in den nächsten Jahren erhalten bleibt.
Tschechische Abgeordnete in Bayern, Berlin und Sachsen
Unter der Leitung des KDUČSL-Abgeordneten David Šimek hat der Ausschuß für Wissenschaft und Bildung des Tschechischen Abgeordnetenhauses Bayern, Berlin und Sachsen besucht. Nach einem Austausch mit Vertretern des Ausschusses für Bildung und Kultus im Bayerischen Landtag erklärte Münchens Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková: „Das Treffen hat bestätigt, daß die Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft zu den wichtigsten Prioritäten zwischen Tschechien und Bayern gehört.“
MdL Tobias Gotthardt, der als stellvertretender Vorsitzender den Landtagsausschuß leitet, bestätigte diese Wertung: „Dieses Treffen hat gezeigt, daß sowohl Tschechien als auch Bayern als Bildungs- und Innovationsstandorte einen hohen Anspruch haben. Mein Wunsch ist es, daß wir die grenzüberschreitenden Bemühungen noch weiter verstärken.“
Ein wichtigstes Gesprächsthema sei, so Gotthardt, der Lehrermangel gewesen, „der uns auf beiden Seiten der Grenze betrifft“. Ebenfalls behandelt wurde der Spracherwerb in Bayern sowie in Tschechien. „Der Wunsch ist groß, sich als gute Nachbarn zu verstehen. Da wollen wir noch einmal neu anpakken“, sagte Gotthardt.
In München besuchte die tschechische Delegation außerdem das Bayerische Ministerium

für Unterricht und Kultus. Zwei weitere Termine standen in Regensburg auf dem Programm. Zum einen trafen sich die Vertreter aus Prag mit dem Präsidenten der Universität Regensburg (siehe auch Bericht unten), Prof. Dr. Udo Hebel, und informierten sich zudem auf dem Campus über die an der Uni angesiedelte Tschechisch-Bayerische Hochschulagentur. Die 2016 ins Leben gerufene Einrichtung fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Belange in der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien im Hochschulund Wissenschaftsbereich. Zum
anderen gab es ein Arbeitstreffen in der Fachhochschule Regensburg, um mehr über die duale Ausbildung und dafür notwendige Zusammenarbeit mit Unternehmen zu erfahren.
In Berlin trafen sich die tschechischen Politiker mit Vertretern des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technologie. Außerdem diskutierten sie mit Dr. Henry Marx, dem Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin, informierten sich über ein gemeinsames Projekt von tschechischen Universitäten und der Humboldt-Universität und sprachen mit Botschafter Tomáš Kaf-
❯ Weitere Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Informatik und Data Science angestrebt
ka über den aktuellen Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen.
Außerdem noch auf dem Programm stand ein Besuch des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im sächsischen Pirna, wo tschechische und deutsche Schüler gemeinsam zweisprachig das Abitur absolvieren.
Šimek kommentierte dann via Twitter proaktiv, die mehrtägige Tour durch Deutschland sei kein Parlamentsausflug gewesen, sondern eine Reise „mit zahlreichen bilateralen Verhandlungen“.
Pavel Novotny/Torsten Fricke
Universitäten in Regensburg und Brünn besiegeln Strategische Partnerschaft


„Es freut mich sehr, daß wir den Ausbau und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Masaryk-Universität nun in Gestalt einer Strategischen Partnerschaft gemeinsam besonders unterstützen und begleiten werden“, hat Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, bei der Vertragsunterzeichnung erklärt.
Damit wird die seit 1989 existierende Partnerschaft zwischen der Universität Regensburg und Tschechiens zweitgrößter Universität intensiviert. Die Unterzeichnung des Abkommens fand im Rahmen eines Delegationsbesuchs von Rektor Prof. Dr. Martin Bareš und weiterer Professoren der Brünner Universität statt.
Dabei wurden neben den bereits bestehenden engen Forschungskooperationen in den Fächern Slavistik, Chemie, Germanistik und Amerikanistik wei-
Gemeinsam gegen Schlepper
Wegen der dramatisch steigenden Anzahl von illegalen Migranten über die Balkanroute werden die tschechische und die deutsche Polizei gemeinsam intensiv gegen Schlepper vorgehen, hat der tschechische Innenminister Vít Rakušan (Stan) angekündigt. Dabei schloß Rakušan auch „stationäre Kontrollen an ausgewählten Grenzübergängen“ nicht aus. Darauf hätten sich er und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verständigt. Noch im Mai hatte Faeser gesagt, daß „offene Grenzen für die Bürger im täglichen Leben wichtig“ seien, und sie dies nicht ändern wolle.
Präsident Pavel besucht Colt-Fabrik
Der tschechische Präsident Petr Pavel hat zum Abschluß seiner USA-Reise die Waffenfabrik Colt in Hartford (Connecticut) besucht. Das amerikanische Traditionsunternehmen ist im April vergangenen Jahres von einer Gruppe tschechischer Rüstungsfirmen gekauft worden. Pavel sagte, er sehe hierin ein hervorragendes Beispiel, daß tschechisches Kapital selbst Kultmarken übernehmen könne und Tschechien damit auf den Weltmarkt bringe. Petr Pavel war für fast eine Woche in den Vereinigten Staaten. Wichtigster Programmpunkt war die Teilnahme an der Uno-Vollversammlung in New York.
Daniel Křetínský hat Le Monde verkauft
Der tschechische Milliardär
Daniel Křetínský hat seine Anteile an der französischen Tageszeitung Le Monde für 50 Millionen Euro an das Medienhaus NJJ Presse des Telekommunikationsmagnaten Xavier Niel verkauft. Der neue Eigentümer hat sich verpflichtet, die Beteiligung auf einen Fonds zur Sicherung der Pressefreiheit zu übertragen. Křetínský, der in Frankreich studiert hat und fließend Französisch spricht, war 2019 beim Traditionsblatt eingestiegen, was zu heftigen Protesten unter den Mitarbeitern geführt hatte. In Frankreich ist der tschechische
Milliardär weiterhin vor allem in der Energiebranche investiert, besitzt aber auch Anteile an der Supermarktkette Casino und am TV-Konzern TF1.
Restaurants mit Hygiene-Mängeln
Fast jedes zehnte Restaurant war mangelhaft. Von den über 1300 Gastbetrieben und Kantinen, die die staatliche Veterinärverwaltung in der ersten Jahreshälfte kontrolliert hat, wurden bei 113 Betrieben Verstöße registriert. Die häufigsten Verstöße waren Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, Lebensmittel unbekannter Herkunft in den Lagerbeständen sowie mangelnde Hygiene.
Schlacht am Weißen Berg nachgestellt
Rund tausend bewaffnete Kämpfer in historischen Kostümen haben am Wochenende in Prag die Schlacht am Weißen Berg nachgestellt. Die Schlacht vom 8. November 1620 gilt mit über 50 000 Soldaten als die erste große militärische Auseinandersetzung im Dreißigjährigen Krieg. Dabei unterlagen die Truppen der böhmischen Stände dem kaiserlichen und bayerischen Heer der Katholischen Liga. Die Zahl der Gefallenen wird auf 5 700 Soldaten geschätzt.
Drohungen gegen Putin-Kritiker
Zwei in Prag lebende oppositionelle Journalistinnen aus Rußland werden von Unbekannten bedroht. Das amerikanische Komitee zum Schutz von Journalisten hat deshalb die tschechischen Behörden aufgefordert, tätig zu werden. Die Drohnachrichten gingen bei der Redaktion des Investigativportals Važnyje istorii ein und waren direkt an die Journalistinnen Alesja Marochowskaja und Irina Dolinina gerichtet. Die Prager Polizei erklärte, man habe bereits Ermittlungen aufgenommen, könne sich aber zur Zeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Die Redaktion des Investigativportals war nach Beginn des russischen Angriffskrieges nach Prag umgezogen, um der Kreml-Zensur zu entgehen.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
auch in der Mobilität: So zählt Brünn nicht nur zu den wichtigsten Heimatuniversitäten der internationalen Austauschstudenten in Regensburg, „beide Universitäten sind jeweils auch besonders stark nachgefragte wechselseitige Ziele für Forschungs- und Lehraufenthalte“.
Rektor Prof. Bareš betonte die fundamentale Bedeutung der Wissenschaft für den Umgang mit den großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit Blick auf das vertrauensvolle Verhältnis und die mit der Strategischen Partnerschaft verbundenen gemeinsamen Werte und Vision sieht er die beiden Universitäten gerade auch für diese Mission besonders gestärkt und gerüstet.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
tere Kooperationen besprochen, wie insbesondere im Bereich Informatik und Data Science.
Die lebendige Verbindung beider Universitäten zeige sich, so die Universität Regensburg,
Die Universität Regensburg versteht sich als „transnationale und transkulturelle Drehscheibe“ und pflegt deshalb ein vielfältiges Netzwerk an internationalen Kontakten zu über 300 Universitäten weltweit.
AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29.9.2023 2
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
PRAGER SPITZEN
❯ Ausschuß für Wissenschaft und Bildung
MdL Tobias Gotthardt (1. Reihe, 3. von links), stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultus, und Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková (1. Reihe, 4. von links) mit den Mitgliedern der tschechischen Delegation und den Ausschußmitgliedern im Bayerischen Landtag. Foto: Mediaservice Novotny
Prof. Dr. Martin Bareš, Rektor der Brünner Masaryk-Universität, trägt sich in das Gästebuch der Universität Regensburg ein. Im Hintergrund (von links): Präsident Prof. Dr. Udo Hebel, Vizepräsidentin Prof. Dr. Ursula Regener und Vizerektor Prof. Dr. Petr Suchý. Foto: Julia Dragan/Universität Regensburg
Podium 1
„Kultur und Bildung – Wegweiser für die Zukunft“ unter Leitung von Dr. Gernot Peter (Leiter des Böhmerwaldmuseums Wien) mit Terezie Radoměřská (Bürgermeisterin in Prag 1), Dr. Veronika Hofinger (Leiterin des Centrums Bavaria Bohemia), Johannes Dill (Oberstudienrat, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Referat VII.2 – Erinnerungskultur, internationale Bildungszusammenarbeit, Extremismusprävention), Prof. Dr. Ulf Broßmann (Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft), Milan Muzikář (Gründer des Festivals Lebendes Grenzland, Orchesterdirektor a. D. und Musiker), Jana Dejmková (Direktorin des Gymnasiums Prachatitz) und Dr. Matthias Schickel (Oberstudiendirektor, Schulleiter am Katharinen-Gymnasium Ingolstadt).
„Gerade in Zeiten wie diesen sind wir, Sudetendeutsche und Tschechen, gefordert, unsere Anliegen zu vertreten und zusammenzuhalten. Dinge zum Besseren verändern kann man nicht durch große Worte, sondern nur, wenn man sich vernetzt, qualifiziert und geduldig Überzeugungsarbeit leistet“, erklärt Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, warum die Sudetendeutsche Landsmannschaft zum ersten Mal zu einem SudetendeutschTschechischen Zukunftskongreß in Budweis einlädt.
Ziel sei es, so Posselt, „mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen und Vertretern aus beiden Regierungen die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zu stellen. Dabei werden von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Oktober im Clarion Congress Hotel bei vier hochrangig besetzten Podiumsdiskussionen einzelne Aspekte intensiv beleuchtet. Die Themen sind „Kultur und Bildung – Wegweiser für die Zukunft“, „Heimat heißt Schöpfung bewahren“, „Geschichte und Zukunft – zwei Seiten derselben Medaille“ und „Europa der Regionen –eine Heimat der Heimaten“.


Posselt: „Unser Kongreß mit allen in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit Aktiven soll ein weiteres Signal setzen für den grenzüberschreitenden Austausch sowie ein sichtbares Zeichen unseres Einsatzes für ein friedliches und demokratisches Europa der guten Nachbarschaft sein. Unser Motiv dabei sind Heimatliebe und der Wille zu konkreter Verständigung.“
Budweis als Tagungsort ist bewußt gewählt. Nach Prag (2000) und Pilsen (2015) wird die südmährische Stadt als dritter Vertreter Tschechiens 2028 ein Jahr lang zur Kulturhauptstadt Europas. In dem 102seitigen Bewerbungskonzept, mit dem sich Budweis im Juli im Finale gegen Braunau durchgesetzt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), haben die Initiatoren bereits angekündigt, auch die Nachbarn in Bayern und Österreich miteinzubinden.

So soll das Kunstprojekt „28 Places/28 Works“ des Kurators

Ondrej Horák auch in den Regionen Oberösterreich und Niederbayern stattfinden. Geplant ist außerdem das BrückenbauerProjekt „Tripoint Capital“ der In-

Podium 2
„Heimat heißt Schöpfung bewahren“ unter Leitung von Klaus Hoffmann (Bürgermeister von Bad Herrenalb, stellvertretender Bundesvorsitzender der SL) mit Marcel Ladka (Direktor im Kabinett des tschechischen Umweltministers), Šimon Heller (Mitglied im tschechischen Abgeordnetenhaus, Vertreter der Stadt Budweis und Regionalvertreter in der Region Südböhmen), Kaspar Sammer (Geschäftsführer und Leiter von Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V., Europaregion Donau-Moldau Trägerverein Niederbayern e. V., Europe Direct Niederbayern, Europahaus), Pavel Hubený (Leiter des Nationalparks – Šumava), Alfred Miller (Hobermillerhof in Reichenau bei Gablonz, Landwirt) und Elisabeth Januschko (Bundesvorsitzende der Böhmerwaldjugend).
Podium 3
„Geschichte und Zukunft – zwei Seiten derselben Medaille“ unter Leitung von Steffen Hörtler (Stiftungsdirektor am Heiligenhof, stellvertretender Bundesvorsitzender der SL) mit Prof. Dr. Jörg Skriebeleit (Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg), David Vondráček (Regisseur und Journalist), Niklas Perzi (Historiker, Zentrum für historische Migrationsforschung), Kateřina Tučková (Autorin und Kuratorin), Reinfried Vogler (Ehrenpräsident der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Zeitzeuge), Peter Polierer (Studienrat, stellvertretender Vorsitzender der Sudetendeutschen Jugend), Martin Dzingel (Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik), Radek Novák (Vorsitzender des Kulturverbandes der Bürger deutscher Nationalität der Tschechischen Republik).
❯ Brückenbauer, Politiker und Experten aus beiden Ländern tre en sich von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Oktober







Sudetendeutsch-Tschechischer Zukunftskongreß in Budweis
itiative Post Bellum, das auch die Vertreibung thematisiert. Hierzu heißt es im Konzept: „Vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebten in Budweis sowohl tschechische als auch deutschsprachige Bürger. Das Projekt Tripoint Capital zielt darauf ab, Budweis als Zentrum der tschechischen und deutschsprachigen Kultur zu etablieren“.

In dem Projekt „Finding Storyland“ geht es ebenfalls um die Zeit während des Zweiten Weltkriegs und die anschließende Vertreibung der deutschsprachigen Landsleute. Und beim Projekt „Accessible Heritage“ soll modernste digitale Technologie eingesetzt werden, um, so die Initiatoren „verschwundene Kulturstätten, wie die von den Nazis zerstörte jüdische Synagoge oder Dörfer, die nach der Deportation der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sind, wiederzubeleben.“


Am Rande der Tagung werden die Teilnehmer auch Körper und Geist stärken. Letzteres am Sonntagvormittag beim gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Wenzel-Kirche mit Monsignore Adolf Pintíř. Am Abend zuvor steht dann das auf dem Programm, wofür Budweis überall auf der Welt bekannt ist: das Bier. Im Rahmen der BrauereiBesichtigung wird auch daran erinnert, daß Budweiser Budvar 1895 von tschechischen Brauberechtigten als Aktienbrauerei Český akciový pivovar initiiert wurde – und zwar in Konkurrenz zum Budweiser Bürgerbräu aus dem Bürgerlichen Brauhaus Budweis, welches 1795 gegründet worden war und vorwiegend deutschsprachigen Bürgern gehörte. Torsten Fricke

❯ SL-Bundesverband

Anmeldung zum Kongreß
Podium 4
„Europa der Regionen – eine Heimat der Heimaten“ (von links) unter Leitung von Dr. h. c. Bernd Posselt MdEP a. D. (Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland) mit Andreas Künne (Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag), Stephan Mayer MdB (Parlamentarischer Staatssekretär a. D., Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, BdV), Thomas Rudner MdEP (bis 2021 Leiter des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem, bis Juli 2023 Geschäftsführer der Stiftung „Jugendaustausch Bayern“), Mgr. František Talíř (Vertreter der Region Südböhmen, 1. Stellvertretender Regionalhauptmann), Filip Smola (Bürgermeister von Markt Eisenstein/Železná Ruda), Jan Kuchař (Mitglied im tschechischen Abgeordnetenhaus, Beiratsmitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums), Christa Naaß MdL a. D. (Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten, Dritte Vizepräsidentin des Bayerischen Bezirketages).
Der Kongreß wird gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Alle Podien werden in deutscher und tschechischer Sprache simultan übersetzt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessenten, die an dem Kongreß teilnehmen möchten, wenden sich an: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 54, eMail: anmeldung@sudeten.de
❯ Deutsche Schüler führen in der KZ-Gedenkstätte Theresienstadt die vergessene Kinderoper Brundibár auf
Singen im Angesicht des Holocausts

80 Jahre nach der Uraufführung am 23. September 1943 im Ghetto Theresienstadt haben Schüler des nordrhein-westfälischen Gymnasiums Wülfrath die von Hans Krásas komponierte Kinderoper „Brundibár“ auf dem Dachboden der Magdeburg-Kaserne in der Gedenkstätte neu aufgeführt.

Damals, so erklärt Historikerin Radana Rutová von der Gedenkstätte Theresienstadt, sei es für die ausgemergelten Kinder „ein Ausbruch aus der grauen Realität des Ghettos“ gewesen.

Acht Jahrzehnte später, so erzählt Lehrer und Pfarrer Klaus-
Ausgemergelt stehen die Kinder auf der Bühne des Lagers Theresienstadt.
Peter Rex, hätten seine Schüler zunächst reserviert auf die Stückauswahl reagiert, weil die Kinderoper „von der Musik her nicht so einfach“ sei. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust sei für seine Schüler außerdem „sehr intensiv“ gewesen. Die Geschichte von „Brundibár“ handelt von zwei Kindern, Pepicek und Aninka, deren Mutter schwer krank ist. Der Arzt empfiehlt ihnen, der Mutter Milch zu besorgen. Auf dem Markt wollen die Kinder wie der Leierkastenmann Brundibar mit ihrem Gesang Geld verdienen, um die Milch zu kaufen, doch sie werden als Störenfriede verjagt.
Aber es gelingt ihnen, alle Kinder der Stadt zusammenzutrommeln und sich gegen Brundibár durchzusetzen. „Brundibár ist besiegt“, ertönt es am Ende der Kinderoper triumphierend.
Viele erkennen in Brundibár Hitler wieder – nicht zuletzt, weil er in der Theresienstädter Aufführung einen falschen Bart trug. Allerdings hatte Adolf Hoffmeister das Libretto für die Oper bereits 1938 geschrieben.
In der Urfassung wurde das Stück zur Jahreswende 1942/43 erstmals im Jüdischen Waisenhaus in Prag aufgeführt. Nach seiner Deportation ins Ghetto Theresienstadt kreierte Krása ei-
ne neue Fassung mit teils geändertem Text. Die Nazis mißbrauchten deportierte Künstler regelmäßig, um die Weltöffentlichkeit zu täuschen. So wurde einer Delegation des Roten Kreuzes als angeblicher Beleg für „Normalität“ die Oper vorgespielt, als sie im Juni 1944 in Theresienstadt war. Die Realität war dagegen grausam. Die Nazis brachten Krása und die Mehrzahl der „Brundibár“-Darsteller nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager, wo sie ermordet wurden. Erst 1991 wurde die Kinderoper „Brundibár“ wiederentdeckt und neu aufgeführt.
3
Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29.9.2023
AKTUELL
Als dritte Stadt Tschechiens wird Budweis 2028 für ein Jahr lang Kulturhauptstadt Europas.
Foto: Czech Tourism
❯ Der preisgekrönte tschechische Film über den Prager Deutschen Emmerich Rath wurde jetzt in Berlin gezeigt
„Das letzte Rennen“ erinnert an den Konflikt zwischen den Volksgruppen
Der tschechische Film „Das letzte Rennen“ aus dem Jahre 2022, der in Tschechien ein großer Erfolg war, lief bereits im November letzten Jahres auf dem Festival des osteuropäischen Films in Cottbus, wo er den Publikumspreis des Festivals gewann. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam, dem Tschechischen Zentrum in Berlin und den zwei eingebundenen Kinos Krokodil und Bundesplatz-Kino wurde der Film in Berlin präsentiert und mit einem Gespräch einiger Beteiligter verbunden.
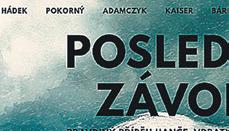
Der Film erzählt die Geschichte eines sudetendeutsch-tschechischen Konkurrenzrennens auf Skiern im Jahre 1913, das die Konfliktlage zwischen den Nationen in Böhmen vor allem aber im Riesengebirge noch im Kaiserreich spiegelt.
Die beiden getrennten Skiverbände, der Tschechische und der Deutsche, treffen nach Jahren am 24. März 1913 erstmals wieder bei einem 50-Kilometer-Skilanglauf-Rennen aufeinander. Es geht um viel Prestige. Wer dominiert im Riesengebirge? Die Tschechen mit ihrem Ausnahmetalent Bohumil Hanč oder die Deutschen mit Oswald Bartel? Das Rennen wird zu einem Desaster. Während beim Start noch frühlingshafte
Temperaturen herrschen, löst ein Wetterumschwung einen Schneesturm aus.
Die Kälte forderte ihren Tribut. Die beiden tschechischen Sportler Bohumil Hanč und Václav Vrbata waren leicht bekleidet gestartet, um möglichst schnell unterwegs zu sein, und bezahlten dies mit ihrem Leben.

Auf der Goldhöhe, wo beide wohl erfroren, erinnert noch heute ein Denkmal an das Drama. Auch hat man in der sozialistischen Tschechoslowakei 1956 einen Film zu diesem Rennen gedreht:
„Synové hor“ (Söhne der Berge). Wer jedoch als Sportler in der tschechischen Heldenerzählung vergessen ging, war der deutsche Prager Emmerich Rath, der mit den Tschechen im Riesengebirge trainierte und bei dem Rennen versuchte Hanč zu retten. Er, der nach dem Einmarsch Hitlers in Prag die deutsche Staatsbürgerschaft ablehnte und Tschechoslowake blieb, der einen jüdischen Freund versteckte und nach 1945 bleiben konnte, dann aber als Sportartikelhändler als Verbreiter amerikanischer Lebensart und als Deutscher in der stalinistischen CSSR denunziert und eingesperrt wurde, verstarb mittellos und vergessen 1962 in Braunau, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte und ein Cousin lebte.
Emmerich Rath, der Alleskönner im Sport, in der Leichtathletik, der Nordischen Kombination, im Bobsport, im Kanusport, im Rudern, im Fußball, im Skilanglauf, im Bergsteigen, beim Rugby, beim Boxen, im Hockey und Eishokkey, der bei zwei Olympischen Spielen startete und zwei Olympische Spiele als Sportjournalist erlebte, wurde in Tschechien in den letzten Jahren wieder bekannt und hat auch als einer von fünf Sudetendeutschen Eingang in den Eröffnungsfilm der Ausstellung „Unsere Deutschen“ in Aussig gefunden.
„Das letzte Rennen“, der neue Film zum nationalen Prestigeduell im Riesengebirge von 1913 rückt nun die noch immer in Tschechien sehr bekannte Geschichte in ein anderes Licht. Ist nicht das Schicksal Emmerich Raths zu würdigen und zu bedenken im Kontrast zu diesem später verfaßten nationalistischen Märchen vom Skilangläufer Hanč, der lieber starb als einem Deutschen den Sieg im Rennen zu gönnen?





Der Regisseur und Drehbuchautor Tomáš Hodan gibt am ersten Abend der Filmvorführung in Berlin im Gespräch mit Christina Frankenberg vom Tschechischen Zentrum darüber Auskunft. Emmerich Rath sei als Prager Deutscher und Sportbegeisterter immer an der Freundschaft zwischen den Menschen interessiert gewesen, nicht an der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Hodan kannte die Geschichte von Rath schon etwas, aber ein Zeitzeuge, ein alter Mann, berichtete ihm von seinem Zusammentreffen mit Rath als Kind auf der Elbfallbaude im Riesengebirge, wo Rath als Heizer arbeiten mußte und wo er sich immer etwas Italienisches auf Platten anhörte. Hodan wußte außerdem von einer Einladung Emmerich Raths nach Rom zu den Olympischen Spielen von 1960, wohin er dann allerdings nicht reisen durfte.

Diese Geschichte über den älteren Emmerich Rath verwob Hodan mit der wahrheitsgemäßen Erzählung der Geschehnisse um das Konkurrenzrennen von 1913.
Die Produzentin Martina Konoblochová berichtete über die Drehorte. Es seien alles Originalschauplätze gewesen, wo sie gedreht hätten, bis hin zum Haus des Bohumil Hanč, das wohl noch in Rochlitz existiert. Besonders sei jedoch gewesen, daß zur Drehzeit 2021 durch die Corona-Pandemie und den Lockdown die Gegend, wo sich gerade im Winter die Touristen tummeln, völlig menschenleer gewesen sei, was der Authentizität der Zeit vor über 100 Jahren im Film sehr zuträglich war. Und alle Theater im Lande hatten Pause, sodaß auch alle Schauspieler, die sie sich wünschten, an den drei Wochen im Riesengebirge zur Verfügung standen. Zu 90 oder gar 95 Prozent aller Szenen, die ja stark von Wetterphänomenen geprägt sind, da ja ein Wetterumschwung die Tragik des Rennens erzeugt, hätten sie original gedreht und kaum nachträglich im Studio nachbearbeitet. Die Kosten dafür wären einfach zu hoch gewesen und sie hätten Glück gehabt mit dem Wetter. Die eigentliche Idee bei einem deutsch-tschechischen Thema auch einen deutschen Produzenten mit ins Boot zu nehmen, hätte sich nicht realisieren lassen. Das Thema war wohl doch zu regional, niemand sei interessiert gewesen.
Neben dem tschechischen Schauspieler Jan Nedbal für die Figur des Josef Feistauer, der im Film von Bohumil Hanč auf das Rennen vorbereitet wird, standen an diesem Abend noch die im Film präsenten zwei deutschen Schau-
spieler Bastian Beyer und Simon Kürschner zum Gespräch bereit. Sie spielen den deutschen Konkurrenten Oswald Bartel und einen norwegischen Skilangläufer, der sich mit den Tschechen mißt. Beide wurden in der Coronazeit per Video gecastet und hatten ihre eigenen Erlebnisse, wie sie aus Deutschland ins Riesengebirge kamen. Bis Dresden mit dem Zug, dann per Taxi bis zur Grenze. Und obwohl sie alle möglichen Papiere und Ausnahmegenehmigungen bei sich hatten, wollten die deutschen Grenzbeamten sie nicht zu Fuß ausreisen lassen. Als Kürschner dann doch durfte, riefen sie ihm nach, „aber Sie kommen dann nicht mehr rein“. Daß es so nicht gekommen ist, bewies der Auftritt der beiden Deutschen im Kino Krokodil im Prenzlauer Berg, wo regelmäßig Filme aus Ost- und Mitteleuropa gezeigt werden. Kürschner, der um die Ecke wohnt, berichtete am Schluß noch von seiner Familie. Beide Großeltern waren vertriebene Sudetendeutsche, ein Großelternpaar kam aus der Slowakei um Kaschau herum, also Karpatendeutsche, das andere kam aus Böhmen. Es gab wohl auch Vorfahren aus dem Riesengebirge und darum sei er sehr froh bei dieser Produktion habe mitmachen dürfen, an den Orten zu drehen, wo Deutsche und Tschechen ihre Konflikte austrugen. Die Thematik der nationalen Spannungen war in dieser dreiwöchigen Zusammenarbeit in einer Crew ein heilsamer Prozeß, nicht nur im Film sondern auch in der Arbeit am Film. Ulrich Miksch
❯ Militärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel diskutierte mit Bernd Posselt und der Union der Vertriebenen im Sudetendeutschen Haus Wie Putin die Geschichte als Waffe mißbraucht
Unter dem Motto „Geschichte als Waffe – Putins Mißbrauch des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg für die Legitimierung des Ukrainekriegs: Folgen für die deutsche Erinnerungskultur?“ hat die Union der Vertriebenen und Aussiedler der CSU (UdV) unter dem Vorsitz von Bernd Posselt im Sudetendeutschen Haus mit dem bekannten Militärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam diskutiert.
Geschichte diene immer dazu, eine positive Identität zu erzeugen, erklärte Prof. Neitzel. Im Falle Rußlands sei dies die Erinnerung an die einstige Rolle als Großmacht und die Überhöhung des Heldentums. Putins baue bewußt ein Feindbild auf, um die eige-
ne Bevölkerung hinter sich zu bringen. Eine ambivalente Betrachtung der geschichtlichen Ereignisse fehlt aber nicht nur in Rußland. So gibt es in Deutsch-
land kaum eine Wissensvermittlung, wenn es um die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg geht. „Man könnte mit Abstand und einer ambivalenten
Meine niederösterreichische Heimatpfarrei feiert in diesem Jahr ihr 800-Jahr-Jubiläum. Wenn ich mir diese lange Zeit vor Augen führe, dann komme ich ins Staunen. Vor allem denke ich daran, daß es in all den Jahrhunderten Menschen waren, die an diesem konkreten Ort ihren Glauben gelebt haben, die mit ihren Nöten und Sorgen, aber auch mit ihrer Freude und ihrer Dankbarkeit über die Schwelle der Kirche traten und im persönlichen wie im gemeinschaftlichen Gebet Gott nahe sein wollten.
Diese Gemeinde ist alt und dennoch jung geblieben. Das durfte ich auch kürzlich beim Jubiläumsgottesdienst erfahren. Ich staune über die lange Kontinuität des Glaubens von 1223 bis zum heutigen Tag. Sicher gab es auch Krisen und Abbrüche in der Geschichte, aber ganz aufgehört hat es in meiner Heimatpfarrei mit dem kirchlichen Leben nie. Nach Krisen folgten Phasen einer neuen Konsolidierung, nach Abbrüchen kam es wieder zu neuen Aufbrüchen. Das gibt mir Hoffnung für die Gegenwart und Zukunft.
Wenn ich über die lange Geschichte dieses kirchlichen Ortes nachdenke und dabei auch meine eigenen Erfahrungen ins Spiel bringe, dann staune ich aber auch darüber, wieviel sich gerade im letzten halben Jahrhundert verändert hat. Als ich geboren wurde, hatte diese Pfarrei noch ihren eigenen Pfarrer. Von diesem wurde die Gemeinde geistlich und organisatorisch versorgt. Er spendete die Sakramente und bereitete auf den Empfang der Sakramente vor. Er machte die Büroarbeit im Pfarramt. Er hielt den Religionsunterricht in der Schule. Alles, was im Leben der Leute mit der Kirche zu tun hatte, lief über den Pfarrer. So war das über Jahrhunderte.
Heute ist das ganz anders. Die Pfarrei gehört zu einem Pfarrverband. Aus einer versorgten Gemeinde wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte eine mitsorgende Gemeinde. Um viele Aufgaben kümmern sich ehrenamtliche Gemeindemitglieder. Sie feiern Andachten und Wortgottesdienste, sie kümmern sich um bürokratische Angelegenheiten, und sie sind an Entscheidungen beteiligt, bei denen vor 50 Jahren noch niemand zu denken gewagt hätte, daß sie von jemand anderem als dem Pfarrer getroffen würden.
Wie gesagt, ich staune, daß es bei aller Kontinuität in den letzten Jahrzehnten auch so viel Veränderung gab. Verändert hat sich natürlich auch die Kirchenbindung der Menschen. Über Jahrhunderte war es eine selbstverständliche Gewohnheit, der Pfarrgemeinde anzugehören und sich am gottesdienstlichen Leben zu beteiligen. So war es auch noch in meiner Kindheit, damals allerdings bereits mit Abstrichen.
Sichtweise aufgeklärter darüber sprechen“, betonte Neitzel.
Der Landesvorsitzende der UdV, Bernd Posselt, war sehr angetan ob der differenzierten und klaren Betrachtungsweise des Militärhistorikers. Posselt erklärte, die UdV sei „das europapolitische und historische Gewissen der CSU“, und er habe es sich zur Aufgabe gemacht, immer wieder an den richtigen Stellen an die geschichtsträchtigen Ereignisse zu erinnern und sie als Grundlagen für heutige europapolitische Entscheidungen zu setzen.
Neitzel nutzte die Gelegenheit seines München-Besuchs, um neben der UdVSitzung unter der Führung von Dr. Raimund Paleczek das Sudetendeutsche Museum zu besuchen.
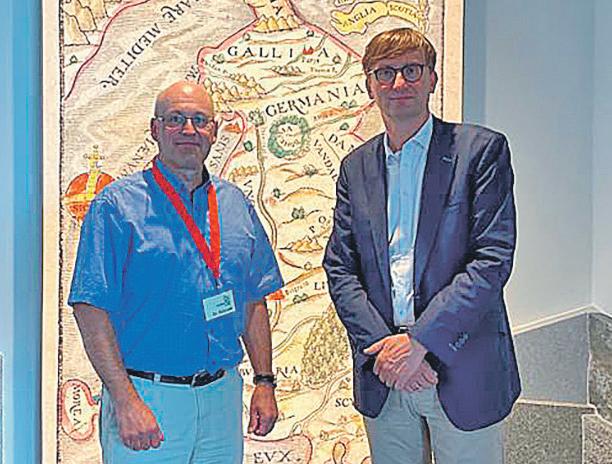

Heute hat sich das Gewohnheitschristentum zu einem Entscheidungschristentum verändert. Die Menschen entscheiden selbst, ob sie der Kirche angehören wollen, ob sie die Gottesdienste besuchen und ob sie sich am kirchlichen Leben beteiligen – oder eben nicht. Die Zahlen der engagierten Christen in allen Pfarreien werden dadurch geringer. Das kann man auf der einen Seite bedauern. Andererseits sehe ich darin aber auch einen Gewinn: Christsein bedeutet heute mehr denn je eine Herzenssache.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München


❯ Mut tut gut Christsein
Herzenssache
als
AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29.9.2023 5
Bernd Posselt und Prof. Dr. Sönke Neitzel. Foto: Hildegard Schuster
Filmszene aus „Das letzte Rennen“: Ein Wetterumschwung verwandelt das Skirennen im Riesengebirge zur tödlichen Falle.
Das Filmplaklat „Das letzte Rennen“. Der Prager Deutsche Emmerich Rath. Stellten sich den Fragen des Berliner Kinopublikums (von links): Simon Kürschner, Bastian Beyer, Jan Nedbal, Martina Knoblochová und Tomáš Hodan. Foto: Ulrich Miksch
Dr. Raimund Paleczek führt Prof. Neitzel durch das Sudetendeutsche Museum.
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
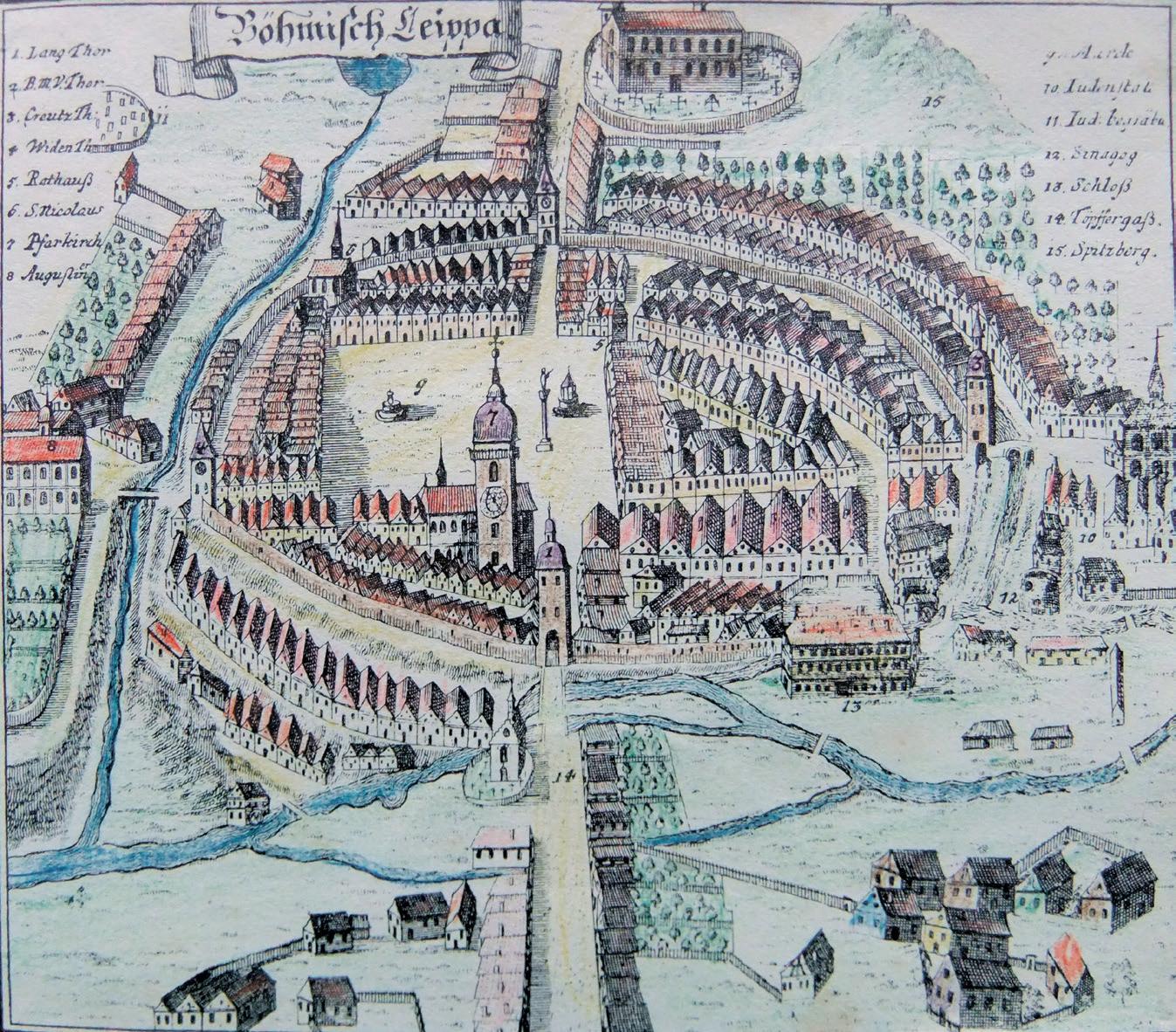
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
eMail
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
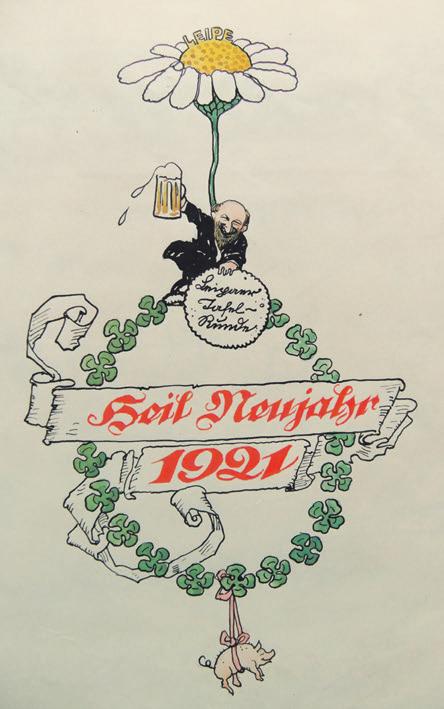
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH




Hochstraße 8
81669 München eMail
Seit 1985 beherbergt das Archiv der oberbayerischen Vertriebenenstadt Waldkraiburg im Haus der Kultur in der Braunauer Straße das Archiv des Heimatkreises Böhmisch Leipa. In absehbarer Zeit wird es in die Heimat zurückgeführt werden. Zu den Archivalien gehören die Gedenkbücher der Leipaer Tafelrunde, der sich Rafael Raaber hier widmet.
Eine Welt, in der man Bilder und Skulpturen verbieten würde, wäre ein schrecklicher Ort. Solch ein Szenario gibt es zum Glück nur in Filmen wie „Equilibrium“. Würden keine Bilder aus der Vergangenheit existieren, hätten wir keine Ahnung, wie unsere Vorfahren die Welt sahen. Die einzigen Quellen dafür wären, wenn überhaupt, nur Texte.
Diese müßten dann bildlich interpretiert werden, aber es wäre nicht vergleichbar. Diese nachgemachten Bilder könnten qualitativ nie den Originalen wie der Lascaux-Höhle in Frankreich, den römischen Mosaiken in Pompeji, den Skizzen und Gemälden von Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Friedensreich Hundertwasser, Franz Marc oder Gabriele Münter das Wasser reichen.
Nicht zu vergessen wären die Illustrationen der Totenbücher im alten Ägypten, die Bücher aus Antike und Mittelalter. Der Beruf des Buchillustrators wurde im Laufe der Zeit von vie-
Gedenkbücher der
len Menschen ergriffen wie von dem Schriftsteller Walter Moers oder der Kinderbuchautorin Cornelia Funke.
Auch Ernst Kutzer übte erfolgreich den Beruf des Buchillustrators aus. „Unter den Illustrato-
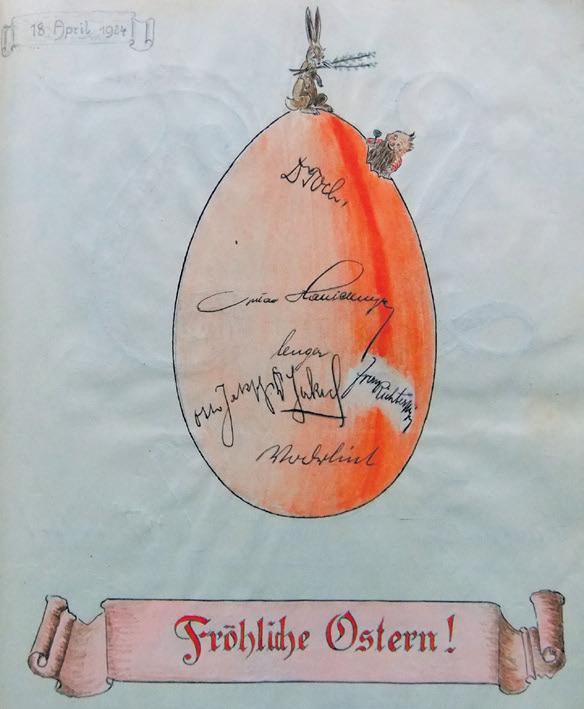
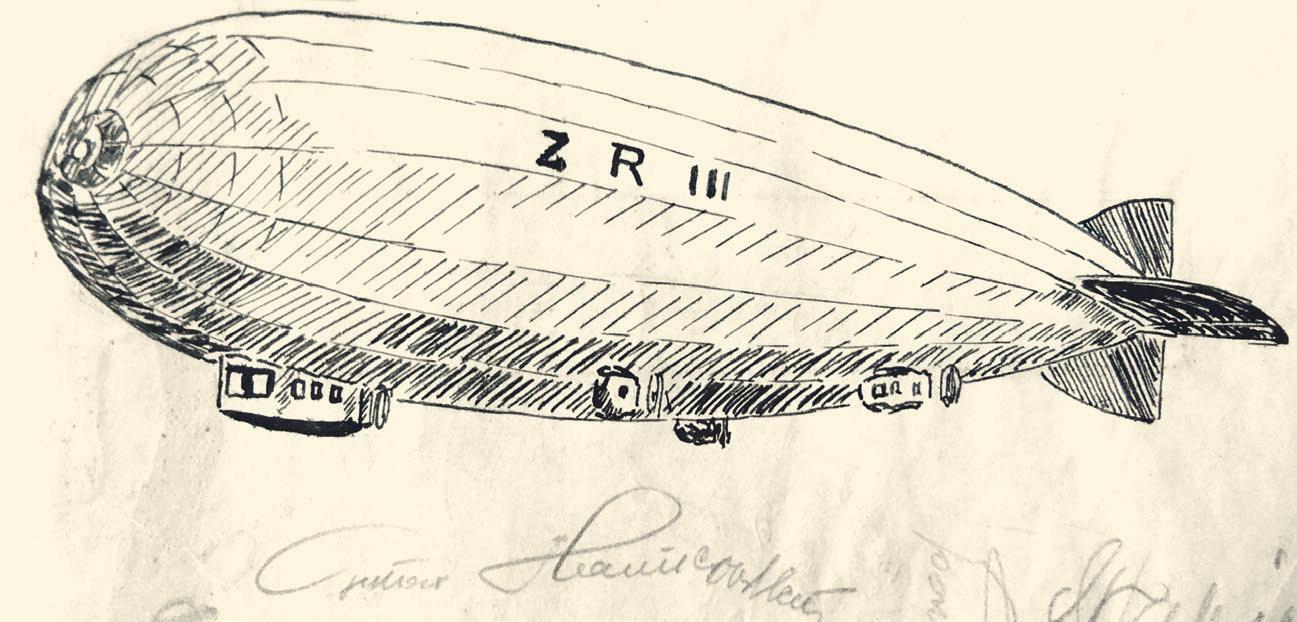
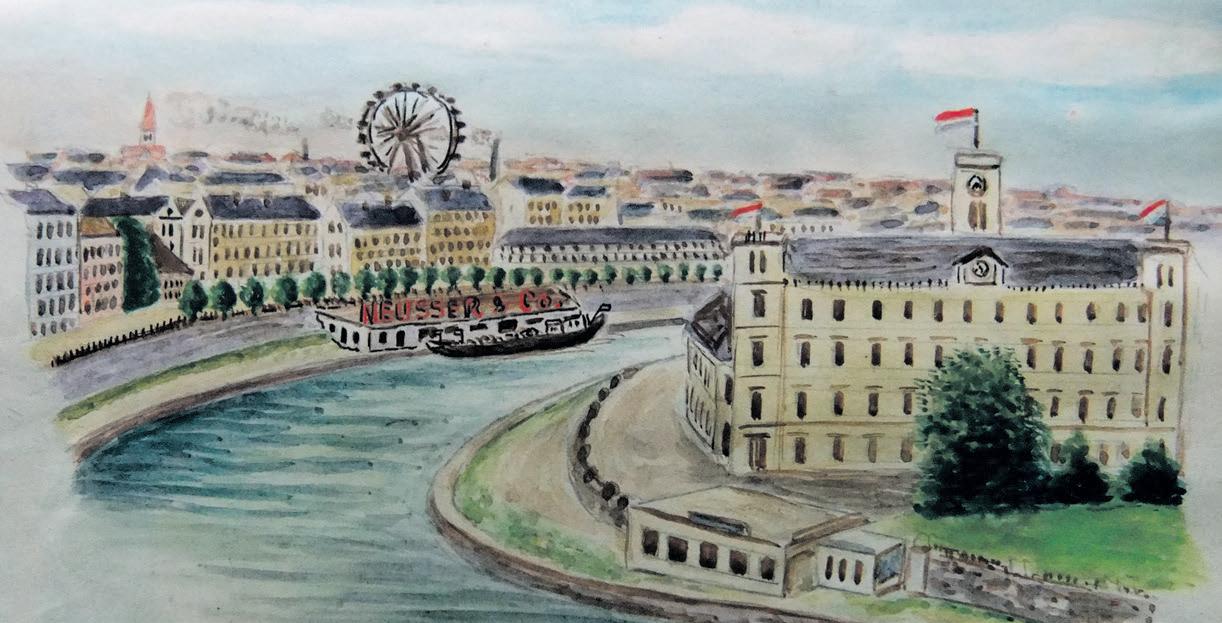

Jahre lang fast ausschließlich der Aufgabe widmete, den Kindern das geschriebene Wort durch anregende Bilder noch anschaulicher und verständlicher zu machen.“, sagte Noriko Shindo, die aus Japan stammende Germani-
Leipa zur Welt. Sein Vater, Josef Kutzer, war Gerber und Lederhändler. Seine Mutter Pauline war eine geborene Rapp. Nach dem Gymnasium besuchte Ernst Kutzer 1899 die Kaiserlich-Königliche Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Danach setzte er seine Ausbildung an der Malschule Streblow und an der kaiserlichen Akademie für bildende Künste in Wien fort.
Er illustrierte allein mehr als 800 Bücher, dazu gehören Kinderbücher, Fibeln, Schulund Jugendbücher, Märchen- sowie Sagenbücher. Auch gestaltete er Postkarten, Einladungen, Plakate, Werbe-Sammelbilder und Reklame- und Spendenmarken. Sogar Texte für seine heiteren Geschichten verfaßte er. Der Künstler starb am 16. März 1965 in Wien. Über Ernst Kutzer und sein Werk schrieb Noriko Shindo „Das Ernst-Kutzer-Buch“ , an dem sie mehr als neun Jahre lang gearbeitet hatte.
ren von Kinderbüchern gibt es im deutschen Sprachraum vermutlich neben Ernst Kutzer keinen zweiten, der sich nahezu 50
stin, die viele Jahre in Österreich studierte.
Ernst Josef Rudolf Kutzer kam am 10. Juni 1880 in Böhmisch
Anläßlich seines 100. Geburtstags 1980 fand in der Internationalen Jugendbibliothek in München eine Gedächtnis-Ausstellung statt. Auch in Waldkraiburg organisierte Stadtarchivar Konrad Kern von 2015 eine kleine Ausstellung
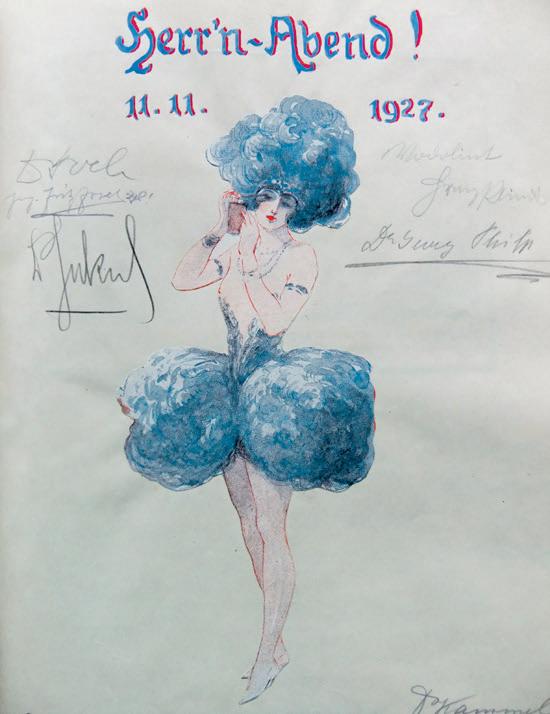
FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 6
� Nordböhmen
Treffen der Tafelrunde mit geschlossenen Augen im Dezember 1920.
Hauptversammlung 1937.
6. Dezember
Einfahrt des ersten Motorschiffes Boehm in den Donaukanal 1924. Luftschiff ZR III 1924.
Die Stadt im 17. Jahrhundert.
Julfeier am
1920.
Silvester 1921. Ostern 1924. Herrenabend 1927.
Im Casino Baumgarten 1924.
Treffen der Tafelrunde im März 1921.
svg@sudeten.de 39/2023
� Nordböhmen
Leipaer Tafelrunde
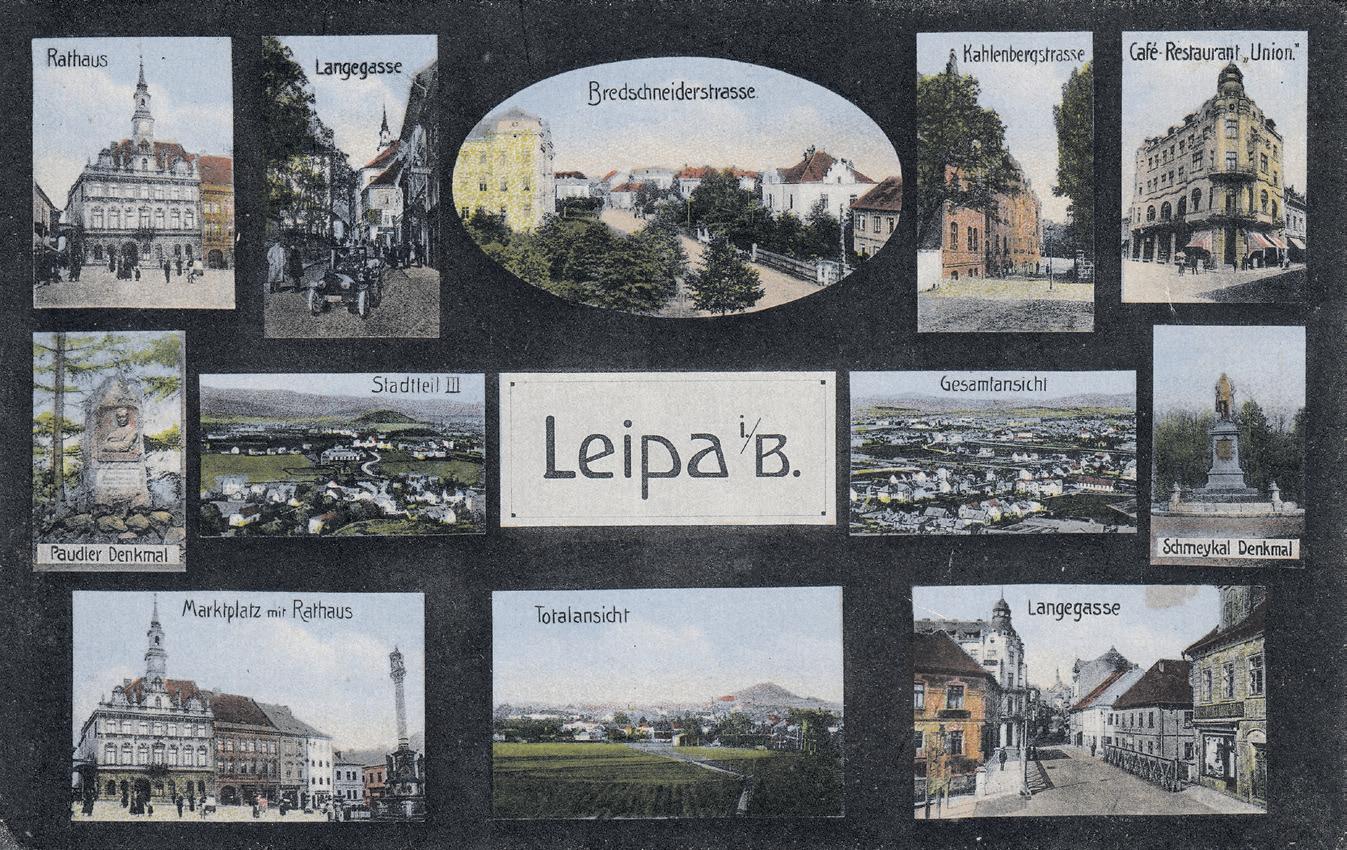
zum 50. Todestag von Ernst Kutzer im Foyer des Waldkraiburger Rathauses. Die Nachfahren von Kutzer leben immer noch in Wien, einige von ihnen sind auch in künstlerischen Berufen tätig.


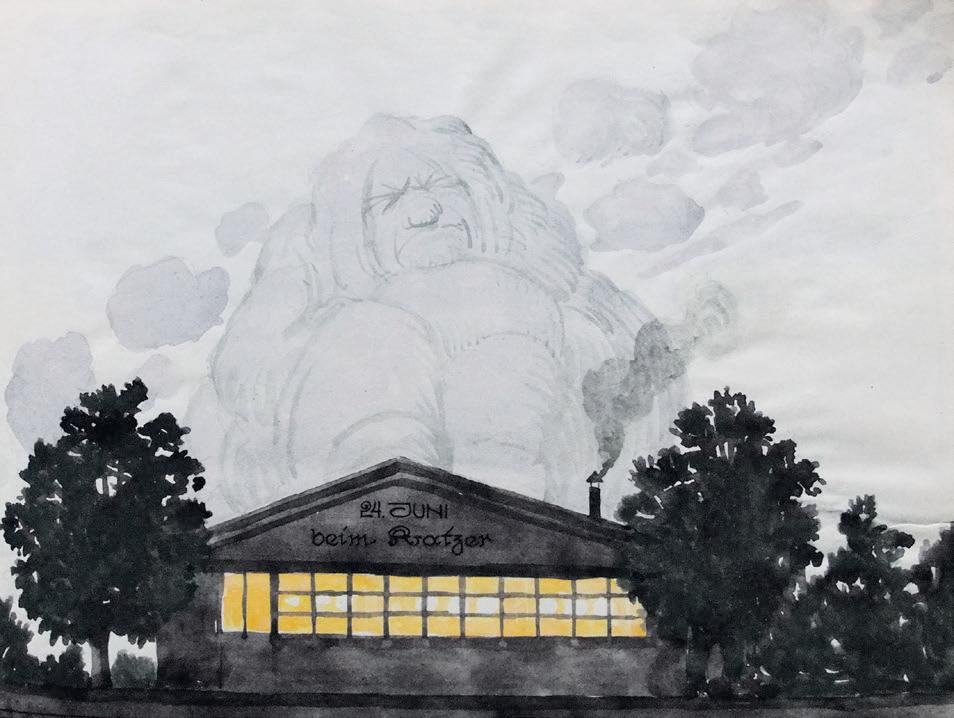

Seit seiner Studienzeit war Kutzer Mitglied der in Böhmisch Leipa gegründeten Ferialverbindung Hilaria sowie in der deutsch-akademischen Verbindung Cheruscia. Die Treffen der Hilaria in Wien wurden in späteren Zeiten in Leipaer Abende umbenannt.
Ministerialrat Willibald Liebisch war einer der sieben Studenten in Wien, der schon 1904/1905 das gemeinsame Treffen der Leipaer organisiert hatte, aus dem später die Leipaer Tafelrunde entstand. Der Verein löste sich zusammen mit dem übergeordneten Sudetendeutschen Heimatbund im Jahr 1939 aufgrund des Drucks der neuen NS-Behörden in Österreich auf.
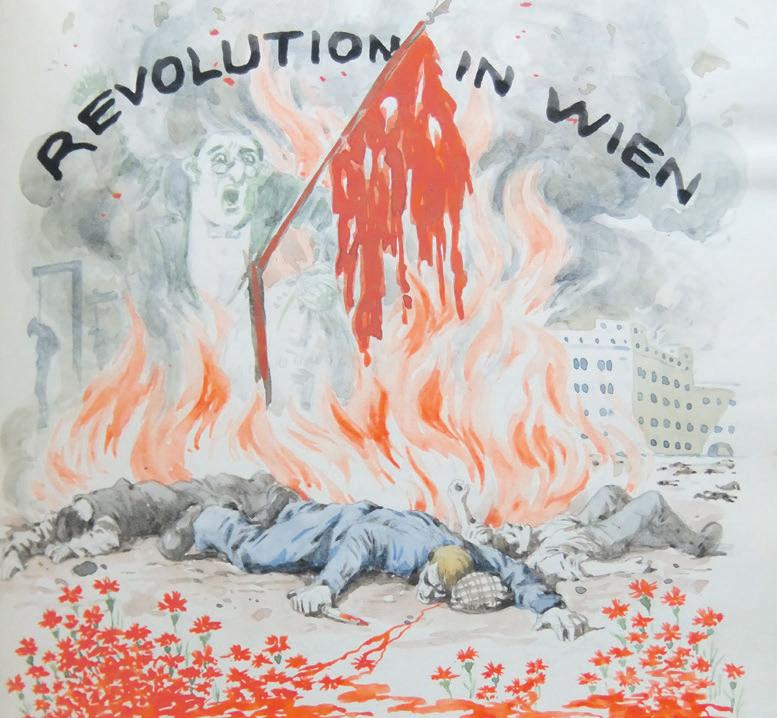

Mitglieder waren beispielsweise Ernst Kutzer, Hanni Senger, Gustav Hanisch, Viktor Schiffner, Richard Placht, Hermann Vetters, Gustav Senger und Josef Jaksch. Ihre Treffen hielten sie schriftlich in drei Gedenkbüchern fest. Diese wurden von Noriko Shindo 2004 im Haus der Kultur für das Heimatarchiv Böhmisch Leipa, Haida,
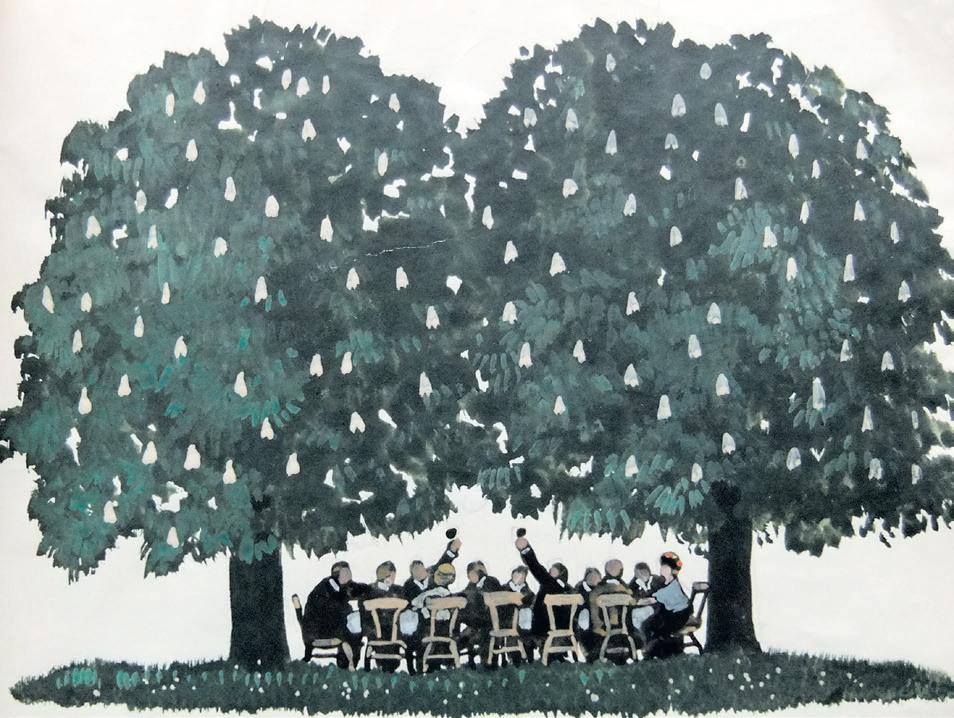
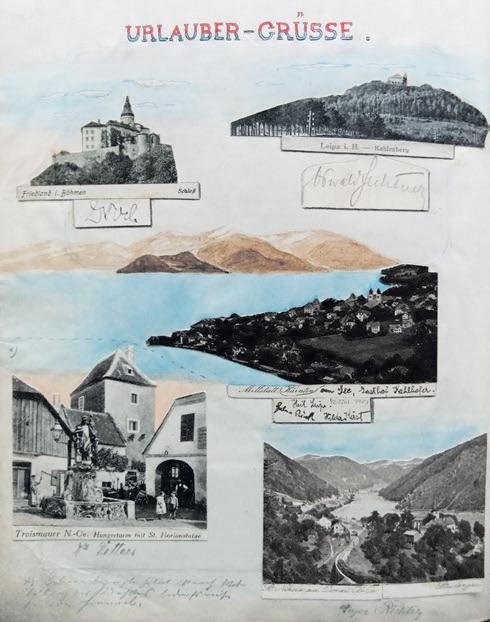
Dauba an Archivbetreuerin Erika Rahnsch und Stadtarchivar Konrad Kern übergeben. Die Mitglieder der Leipaer Tafelrunde trafen sich nie regelmäßig. Die Anzahl der anwesenden Mitglieder variierte. Es kam vor, daß nur vier Personen bei einem Treffen anwesend waren. Jedes anwesende Mitglied unterschrieb im aktuellen Gedenkbuch.
Schriften beschäftigen und so die Eigenschaften dieser Personen entschlüsseln.
Insgesamt gibt es drei Gedenkbücher. Band I beinhaltet die Eintragungen vom 20. Dezember 1919 bis 19. Dezember 1924 mit 324 Seiten. Im Band II finden sich die Notierungen vom 6. März 1925 bis 28. Dezember 1928 mit 404 Seiten, und im III. Band sind alle Versammlungen
ben anderen Mitgliedern wie Hanisch angefertigt.
Als Ergänzung zu den handschriftlichen Notizen wurden Postkarten, Bilder, Zeitungsausschnitte, Gedichte, Lieder, Briefmarken, Münzen, Vogelfedern, Menükarten von Gasthöfen, Wahlergebnisse, Einladungen und so weiter eingeklebt.
Aus den Gedenkbüchern erfahren wir von einigen Mitgliedern ihre Berufe wie Univ. Prof. Dr. Schiffner, ak. Medaillor Placht, Prof. Direktor Senger, Dr. Jaksch, Mag. pharm. Jaksch, akad. Maler Kutzer, Bergrat Petters, Bankbeamter Zimmermann, Oberrevident Bönisch, Oberinspektor der Staatsbahnen Klepsch oder Beamter Posselt.
Stimmung waren die einzelnen Mitglieder bei ihren Treffen? Welche Gefühle kamen hoch bei diesen Treffen? Die Antworten auf diese und andere Fragen ver-
nen Lamm, Gasthaus Zum blauen Freihaus, Gastwirtschaft Zum Walfisch im Prater. So manche Gasthäuser waren damals in Wien sehr bekannt. Wenn man seine Nase noch tiefer in die Gedenkbücher steckt, so kann man neben dem Buchgeruch auch eine feine Spur von Rauch, Essen, Bier und Wein vernehmen.

Manchmal hatten einige Mitglieder aus Versehen zwei Mal unterschrieben. Schon auf Grund der unterschiedlichen Handschriften könnte sich jemand mit der Analyse der einzigartigen
vom 4. Januar 1929 bis April 1939 mit 468 Seiten enthalten.
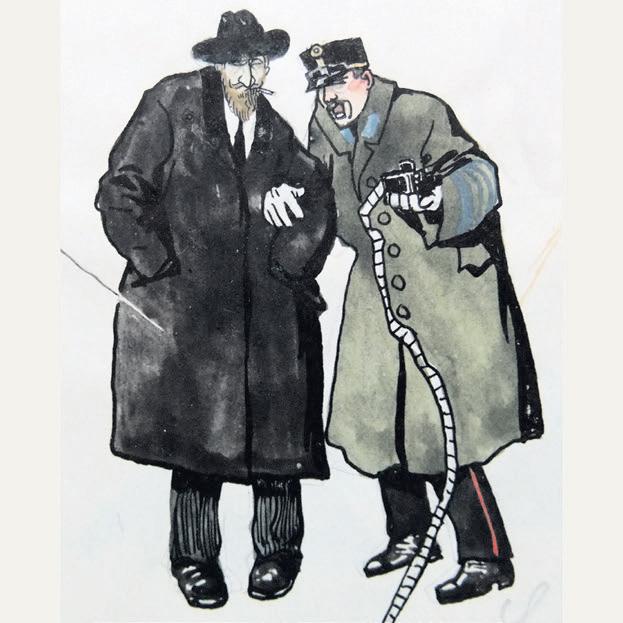
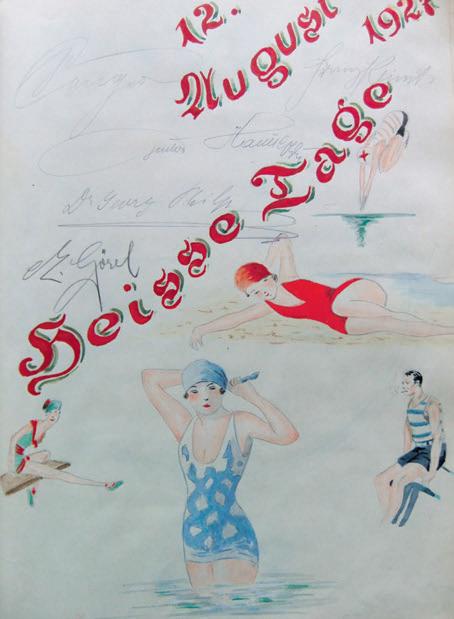

Fast zu jedem Treffen wurden humorvolle Zeichnungen und Bilder entworfen. Die Zeichnungen wurden von Ernst Kutzer ne-
Außerdem wurden Krankheiten, Trauungen, Gedenkfeiern und Sterbefälle in den Gedenkbüchern bekannt gegeben. Auch Ausflüge, Bälle, Treffen mit anderen Vereinen und Familienabende. Vorträge, Promotionen, Gratulationen, Geburtstage und Jubiläen wurden schriftlich festgehalten. Urlaube, Wetter, Jahreszeiten, Feiertage wie Weihnachten, Silvester, Fasching, Ostern, Abschiede und Rückkehr von Familienmitgliedern und Herrenabende wurden auch handschriftlich erwähnt.
Aber was ist mit den Diskussionen und Themen, die nicht eingetragen wurden? In welcher
mögen wir nicht zu beantworten. Sehr wichtig ist auch, wo sich die Mitglieder der Leipaer Tafelrunde, die jedes Mal schick gekleidet waren, getroffen haben. Das waren besondere und repräsentative Gasthöfe, Cafés und Restaurants in Wien wie Restaurant Mitzko, Café Gersthof, Burger Wiedner, Café Kugel, Restaurant Johann Schönauer Zum goldenen Hechten, Johann Kratzers Gastwirtschaft Zum golde-
Ereignisse aus Wien wie Hitzewellen, Frost und Kälte, Glatteis, politische, historische und kulturelle Ereignisse, aktuelle Geschehnisse, die aktuelle Teuerungsrate, Straßenbahnverkehr, das erste Motorschiff mit dem Namen „Boehm“ im Donaukanal, wurden in den Gedenkbüchern auch sorgfältig eingetragen. Aus der Heimat finden sich Einträge über Persönlichkeiten, Landsleute, Bürgermeister, Wahlen, zweisprachige Gasthofschilder und Straßennamen in Böhmisch Leipa. Aber auch Nachrichten aus dem Ausland wie politische Nachrichten oder der Flug des Luftschiffs Z.R. III nach New York fehlen nicht. Für mich war das Lesen der Gedenkbücher aufregend. Das war, als hätte ich historische Romane mit Illustrationen, die ich nicht aus der Hand legen konnte, vor meinen Augen. Gebannt erwartete ich die nächsten Seiten. Was sich anbieten würde, wäre die Analyse jedes Eintrages aus den Leipaer Gedenkbüchern. Aber so eine umfangreiche und zeitraubende Arbeit würde den Rahmen sprengen.
FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 7
Beim Presshaus 1923.
Postkarte von Böhmisch Leipa.
Mit diesem Bild vom Marktplatz präsentiert sich die Ortsgruppe Böhmisch Leipa des Bundes der Deutschen in Böhmen.
Im Hechten-Garten 1924.
Urgemütlicher Abend beim Kratzer 1920.
Zur Walfisch 1930.
Urlaubergrüße 1924. Heiße Tage 1927. Kutzer und Hanisch im ersten Buch. Leipaer Abend in Burgers Restauration 1921.
Beim Kratzer 1921.
Justizpalast gestürmt und in Brand gesteckt 1927. Revolution in Wien 1937.
Ein Professor, zwei Auszeichnungen
Stefan Samerski, Vizepräsident der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, Priester, Kirchenhistoriker und Hochschulprofessor, erhielt Mitte September auf Schloß Ballenstedt das Erinnerungszeichen 950 Jahre Ballenstedt, die Wiege Anhalts, und wurde zum Ritter des askanischen Hausordens Albrechts des Bären.
Die drei Herzöge Heinrich von Anhalt-Köthen, Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau und Alexander Carl von AnhaltBernburg stifteten am 18. November 1836, dem Todestag Albrechts des Bären, den Herzoglich Anhaltischen Hausorden Albrechts des Bären als gemeinsamen Hausorden. Namensgeber des Ordens war der Askanier Albrecht der Bär.
Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Veränderungen. So wurde im Juni 1839 die Collane eingeführt. Am 18. März 1848 wurde die Kommandeur-Klasse durch Schaffung der Kommandeure
I. Klasse mit Stern erweitert. Erster ausgezeichneter Kommandeur war Leopold von Morgenstern. 1850 folgte die Verleihung der nächsten Kommandeure der
I. Klasse an Albert von Goßler, Heinrich von Krosigk und Albert Friedrich von Plötz.
Am 8. Februar 1854 folgten die Aufteilung der Ritter-Klasse mit der Schaffung der II. Klasse in Silber sowie die Stiftung der Schwerter zu allen Klassen am 18. Juli 1864. Weitere Verände-
rung war die Stiftung der Krone zu den Ordenszeichen am 29. April 1901 und am 19. August 1904 zu den Verdienstmedaillen. Die Klasse der Kommandeure wurde 1904 in Komture umbenannt. Das Ordenszeichen ist ein goldenes Oval, das mit der Ordensdevise und dem Wahlspruch des Hauses Askanien „Fürchte Gott und befolge seine Pläne“ umschrieben ist. Die Inschrift wird oben von dem Herzschild des anhaltischen Wappens unterbrochen. Das Oval umschließt einen Bären mit Krone und Halsband, der auf einer Mauer mit drei Zinnen und Torbogen nach rechts aufwärts steigt. Rückseitig ist umlaufend die Inschrift „Albrecht der Bär reg. 1123 bis 1170“. Auf der Vorder- wie Rückseite wird oben der Schriftzug durch das askanische Wappen
geteilt. Die ersten bekannten Verleihungen von Orden in den askanischen Häusern gehen zurück bis ins Jahr 1382.
Albrecht der Bär, Sohn von Otto dem Reichen, ist der Ur-Urenkel des Stammvaters der Askanier, Graf Esiko von Ballenstedt († 1059). Albrecht war eine der berühmtesten historischen Persönlichkeiten des deutschen Mittelalters. Neben seinen Eroberungen östlich von Saale und Elbe war er Vertrauter und Diplomat für mehrere deutsche Könige und Kaiser wie Kaiser Barbarossa. Durch seine Eroberungen und angeheirateten Rechte brachten es seine Söhne zu den mächtigsten Fürsten und Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sein Sohn Otto wurde Markgraf von Brandenburg, dessen Söhne gründeten Berlin und verliehen

der Stadt im Wappen den Bären ihres Großvaters. Der jüngere Sohn Bernhard wurde Herzog von Sachsen und erbte die Grafschaft Anhalt. Von Bernhards Söhnen wurde Heinrich I. Fürst von Anhalt und Stammvater aller heute lebenden direkten Nachfahren des Hauses Anhalt.
Der heutige Großmeister des Ordens, Prinz Eduard von Anhalt Herzog zu Sachsen, wurde genau wie sein Urahn in Ballenstedt geboren. Aus den bekannten geschichtlichen Gründen wurden der Prinz und seine Familie lange Zeit von ihrer Heimat ferngehalten und genießen es nun um so mehr, das Land ihrer Vorväter kennenzulernen und neu zu erfahren. Auch der Orden wird nun wieder mit Leben gefüllt. In diesem Sinne verleiht das Haus Anhalt-Askanien den Orden Albrecht der Bär wieder an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um das Land und um das Haus Anhalt-Askanien verdient gemachen haben. Die Aufgabe des Ordens besteht in der Bewahrung und Vermittlung der Werte des christlichen Abendlandes, in der Treue und Unterstützung des Herzoglichen Hauses, in karitativer Arbeit und in der kulturellen und gesellschaftlichen Aufbauarbeit unseres Landes. Chef des Hauses Anhalt, aus dem als prominenteste Vertreterin Katharina die Große hervorging, ist heute Prinz Eduard von Anhalt Herzog zu Sachsen, der auch als Großmeister jedes Jahr die Investituren vornimmt.
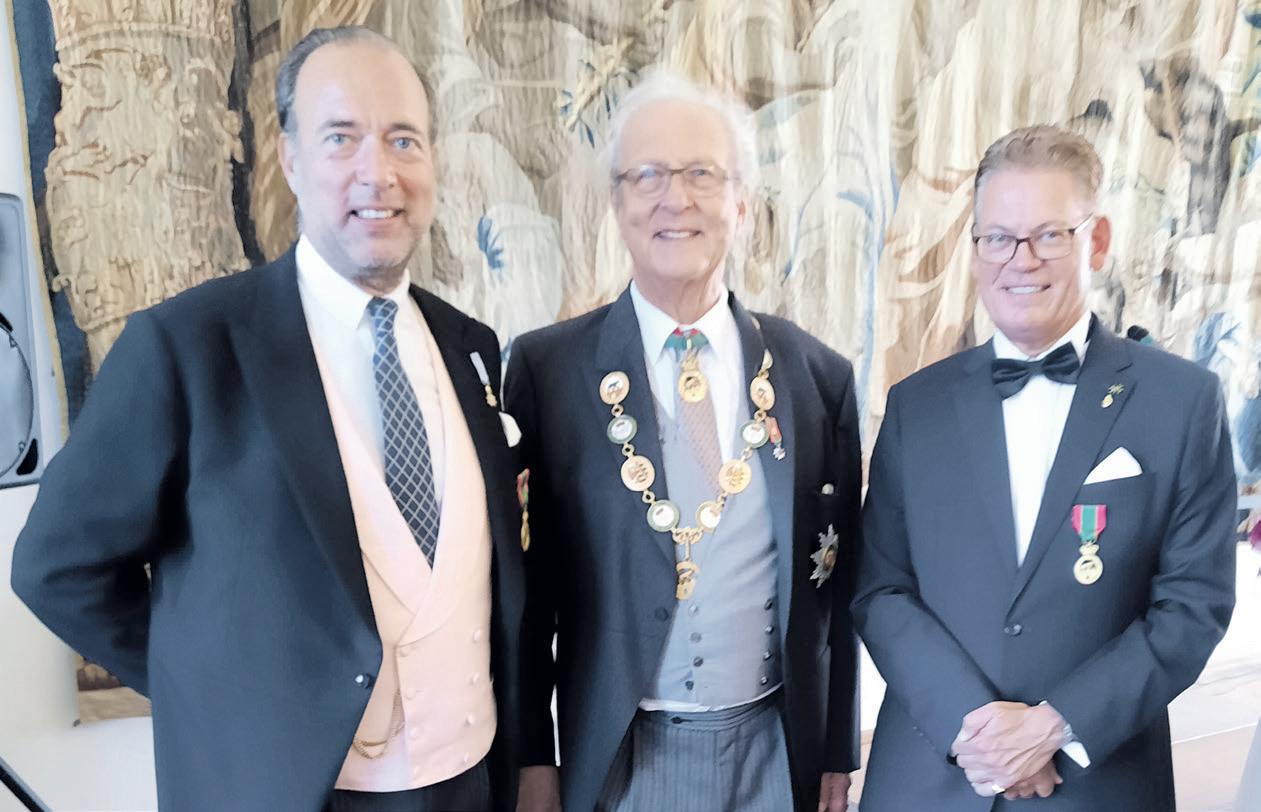
Elena Zipsers Wasserzeichen
Gestern eröffneten HDO-Direktor Andreas Otto Weber und Heinke Fabritius, Kuratorin und Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum im baden-württembergischen
Gundelsheim, die Ausstellung „Wasserzeichen“ der Malerin und Zeichnerin Elena Zipser im Münchener Haus des Deutschen Ostens (HDO).
Wasser ist für Elena Zipser ein zentrales Bildmotiv, Badezimmer und Thermen sind bevorzugte Szenerien. Doch es gibt auch Bilder von Landschaften und Stadträumen, die den Eindruck von frischem Regen vermitteln. Die Welt, die sich darin entfaltet, erscheint in besonderer Klarheit, wie gereinigt. „Das ist ein gutes Gefühl“, sagt die Künstlerin. Eine repräsentative Auswahl aus Elena Zipsers bildnerischem Œuvre ist jetzt im HDO zu sehen.
Die Ausstellung „Wasserzeichen“ führt Werke der Künstlerin zusammen, die in den letzten zehn Jahren nach dem Abschluß der Kunstakademie entstanden. Sie zeigen den Weg zur Entwicklung einer unabhängigen Bildsprache. Dem Motiv des Wassers sowie dem großzügigen Gebrauch der Farbe Blau fällt dabei eine besondere Rolle zu: Es ist, als wolle Elena Zipser sich von zu vielen Schichten des Erlernten, Mitgebrachten und Gewußten befreien. Sie häutet die gesehene Außenwelt und entrümpelt
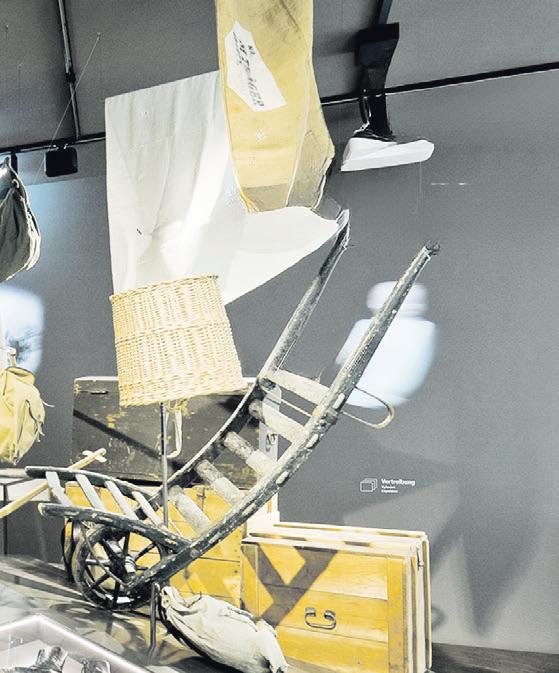
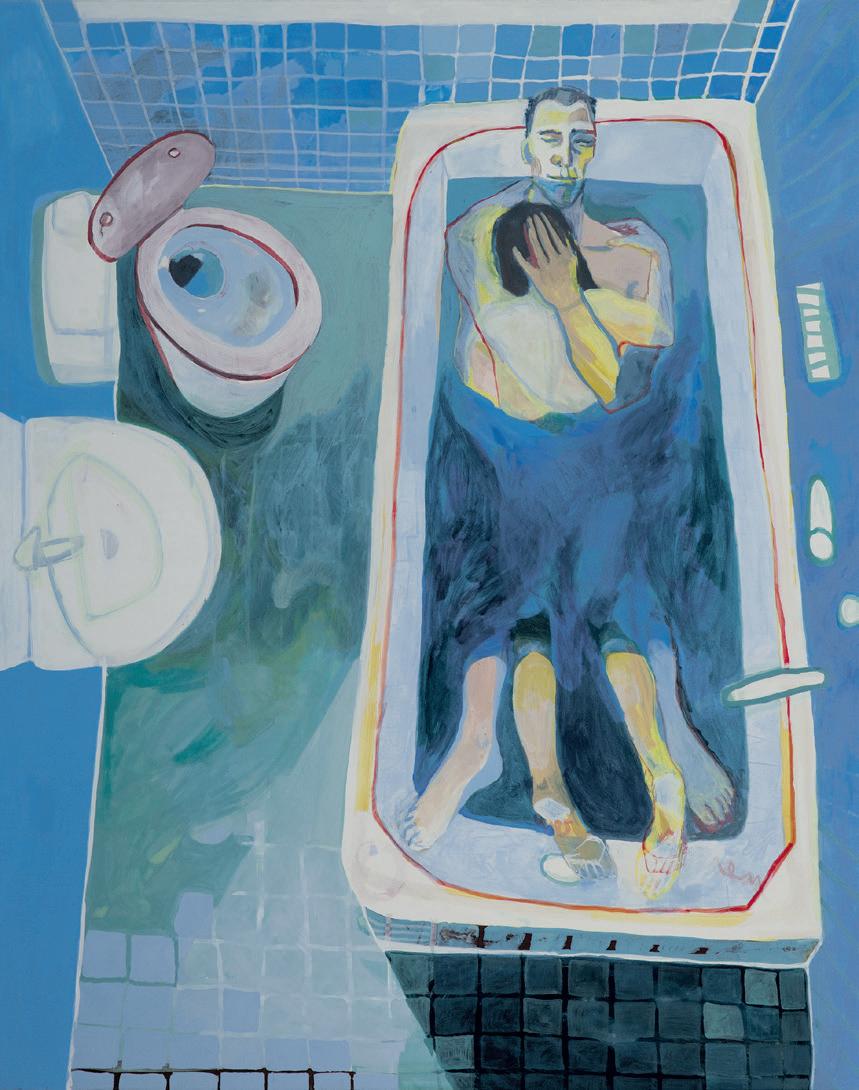
damit ihre Bildräume, seien es eine Dorfstraße bei Kronstadt, der staubige Bukarester Nordbahnhof oder auch private Innenräume und Interieurs. Auf der großformatigen Leinwand ebenso wie in der kleingefaßten Pinselzeichnung – immer ist das Ziel, Raum
Malerin. Die Mutter, Pomona Zipser, ist vor allem Bildhauerin und Zeichnerin. Von beiden Künstlerinnen ist in der Ausstellung je eine Arbeit zu sehen. Von Elena Zipser ausgesucht und in den Kontext des eigenen Werkes gesetzt, rufen sie Schlüsselerlebnisse auf, die für die Definition der eigenen Position wesentlich waren. Das „Wasserzeichen“ steht in diesem Fall für die verbindende Prägung der drei Generationen.


Elena Zipser wurde 1988 in Berlin geboren, erhielt ihre Ausbildung in Bildender Kunst, Tanzpädagogik und Choreographie in Ma-

❯ Sudetendeutsches Museum in München
Lange Nacht bietet Kurzweil
In der Langen Nacht der Museen am 14. Oktober erwacht das Sudetendeutsche Museum zum Leben.


drid, Berlin und Stuttgart und lebt heute am Bodensee. Sie arbeitet als Malerin und Performerin in Deutschland, Europa und den USA. In ihrem Werk nutzt sie unterschiedliche Medien. Interdisziplinäre Projekte, in denen professionelle Künstlerinnen und Laien zusammenwirken, besitzen für sie einen besonderen Stellenwert.
Die Ausstellung findet in Kooperation mit Heinke Fabritius statt. Am 14. Oktober, in der Langen Nacht der Museen, führt Fabritius um 19.00, 21.00 und 23.00 Uhr sowie am 27. Oktober und 7. November jeweils um 17.00 Uhr durch die Ausstellung.
Bis 10. November Montag bis Freitag 10.00–20.00 Uhr, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, Telefon (0 89) 4 49 99 30, eMail poststelle @hdo.bayern.de
freizugegeben, Platz zu schaffen und Perspektiven zu öffnen.
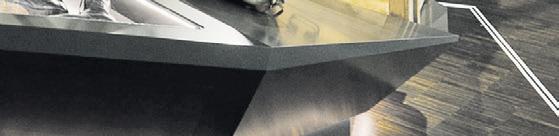

Untergründig setzt sich Elena Zipser auch mit ihrer Herkunft und der Kunst ihrer aus Siebenbürgen stammenden Großmutter und Mutter auseinander. Die Großmutter, Katharina „KATH.“ Zipser, war
Eine kurzweilige Live-Erzählung illustriert abwechslungsreich die Geschichte der Sudetendeutschen zwischen erster Besiedlung, Konflikten und Krieg, Vertreibung und Neuanfang in Europa. In der Langen Nacht wird das Museum im wahrsten Sinne des Wortes menschlich, was die neuartige Kunstform des Body Paintings zum Ausdruck bringt. Das Gebäude atmet, einige Objekte werden im Kontext der sudetendeutschen Geschichte erzählt und neu erlebt. Der siebenminütige Ausflug in diese spannungsgeladene Historie beinhaltet ein innovatives Storytelling mit Elementen der Body Art und farbenreichen, fesselnden Illustrationen. Das Sudetendeutsche Museum lädt dazu zu Beginn jeder Stunde in den Adalbert-StifterSaal ein. Die Show um 18.00 Uhr ist in tschechischer Sprache, um 23.00 Uhr in englischer Sprache und die restlichen Shows sind auf Deutsch.
Um 19.00 Uhr entführen Sie die Kuratorinnen in die Erlebniswelten Otfried Preußlers „Ein bißchen Magier bin ich schon…“. Der beliebte Kinderbuchautor war ein Magier der Worte und seine Geschichten verzaubern bis heute Kinder wie Erwachsene.
„Der kleine Wassermann“ und „Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ und „Krabat“ gelten als Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, und ihr Autor gilt als einer der bedeutendsten Vertreter dieses Genres. Seine Figuren und Erzählstoffe fand Preußler in seiner nordböhmischen Heimat. Die Sonderausstellung im Sudetendeutschen Museum in Kooperation mit dem AdalbertStifter-Verein und dem Isergebirgs-Museum in KaufbeurenNeugablonz können Sie bis spät in die Nacht besichtigen. Nicht nur Nachteulen kommen bei der Langen Nacht auf ihre Kosten. Um 14.00 und um 16.00 Uhr lädt Sand-Art-Künstlerin Nadia Ischia zu einer zauberhaften Performance, in der Bilder aus Sand Otfried Preußlers Geschichte „Das kleine Gespenst“ erzählen. Wie diese Kunstform zustande kommt und wie man selbst Sandkunst kreieren kann, erklärt und zeigt sie jeweils um 15.00 und 17.00 Uhr in einem Workshop. Für Kinder ab vier Jahren ist eine Anmeldung erforderlich, Telefon (08 9) 48 00 03 37, eMail info@sudetendeutschesmuseum.de
Das Ticket für die „Lange Nacht der Münchener Museen“ erhält man über www. muenchner.de/museumsnacht für 23,50 Euro. Es berechtigt zum Eintritt in alle beteiligten Häuser für eine Person.
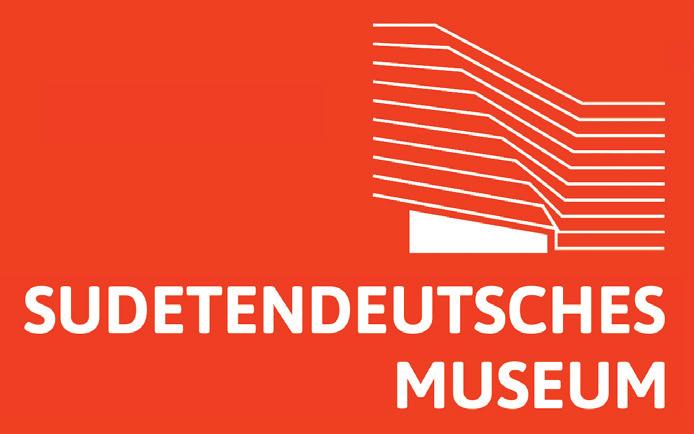
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 8 ❯ Ballenstedt/Sachsen-Anhalt
❯ Haus des Deutschen Ostens in München
Maximilian Graf von Deym zu Stritetz, Prinz Eduard von Anhalt Herzog zu Sachsen und Professor Dr. Stefan Samerski.
Albrecht der Bär (1100–1170)
Katharina die Große (1729–1796)
Gemälde des Ausstellungsraumes.
Bild: Robin Dorfler
Ausstellungsraum „Nationalismus und Nationalstaat“. Bild: Daniel Mielcarek
Ausstellungsraum „Verlust und Vertreibung“.
Elena Zipser: „Badende II“, Pigmente und Binder auf Leinwand.
Elena Zipser. Bilder: Chelsea Southard, Elena Zipser
In der BR-Sendereihe „Kunst und Krempel“ wurde einmal wieder ein Erbstück aus Böhmen gezeigt und eingeordnet.
Ein Schwesternpaar aus Österreich fand sich im Stift Herzogenburg in der Nähe von Sankt Pölten zur Begutachtung bei der Sendung des Bayerischen Rundfunks „Kunst & Krempel“ ein. Die Schwestern präsentierten eine schwere Porzellanbüste, die sie von ihrer Mutter geerbt hatten und die sie seit ihrer Kindheit begleitet hatte. Sie nannten die Frauenfigur immer nur Püppi und verwahren das Erbstück auf einer Holzsäule in der Wohnung einer der Schwestern, die sie immer erben wollte und schließlich auch bekam.

Herkunft
aus
Teplitz-Turn
Der Experte Samuel Wittwer von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam begeisterte sich sofort für die besondere Form der Frauenbüste, die aus glänzend weißem Porzellan modelliert, aber danach vollständig bemalt wurde, so daß man sogar den Eindruck haben könnte, es handele sich
Püppi, ein Familienschatz aus Porzellan
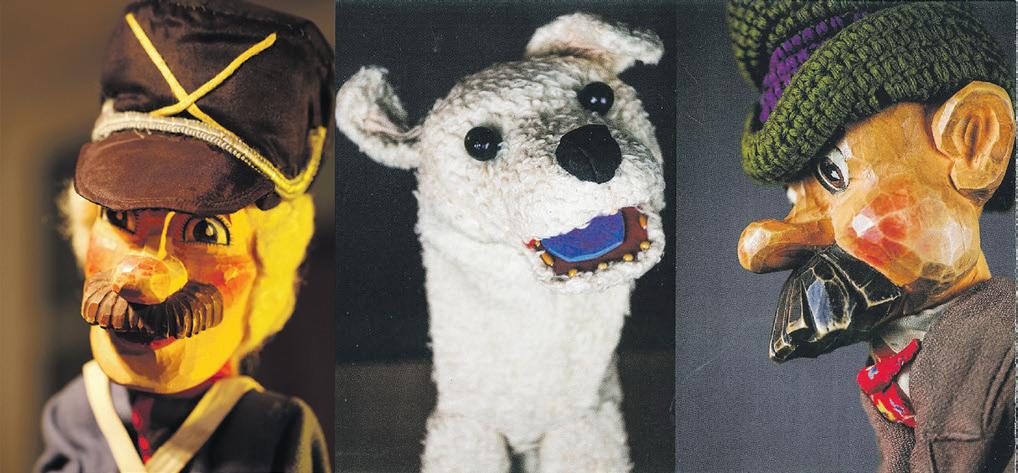
schen Turn bei Teplitz gegründete Porzellanmanufaktur firmierte unter der Leitung des Sohnes von Alfred, Eduard Stellmacher, und den Schwiegersöhnen von Alfred, Karl und Hans Riessner, sowie Rudolf Kessel ab 1892 unter der Bezeichnung Amphora. Bis 1904 war diese Stempelung üblich und zierte das reichhaltige Sortiment von Vasen, Ziergefäßen und eben auch Figuren wie Püppi.
Stück von Amphora
pham-Porzellan, das man bei der Frauenbüste finden könne. Sie konstatierte trotz kleinerer Defekte beim Porzellan keine Minderung des Schauwertes und bescheinigte der Figur eine „tolle Ausstrahlung“. Einen Entwerfer könne man nicht identifizieren. Sicher sei allerdings, daß bekannte Künstler für Amphora gearbeitet hätten. Der Wert der Büste liege zwischen 500 und 1000 Euro. Ähnliches werde noch immer gern gekauft, obwohl diese Figuren massenhaft hergestellt worden seien.
um Elfenbein. Die Expertin Anke Wendl, Auktionatorin in Rudolstadt, analysierte sogleich die gedruckte Marke am Boden der Büste. Die noch lesbaren Buchsta-

ben R, St und K würden auf die Besitzer Riessner, Stellmacher und Keller verweisen, ebenso wie die nicht mehr lesbare Herkunft Teplitz-Turn und der Name
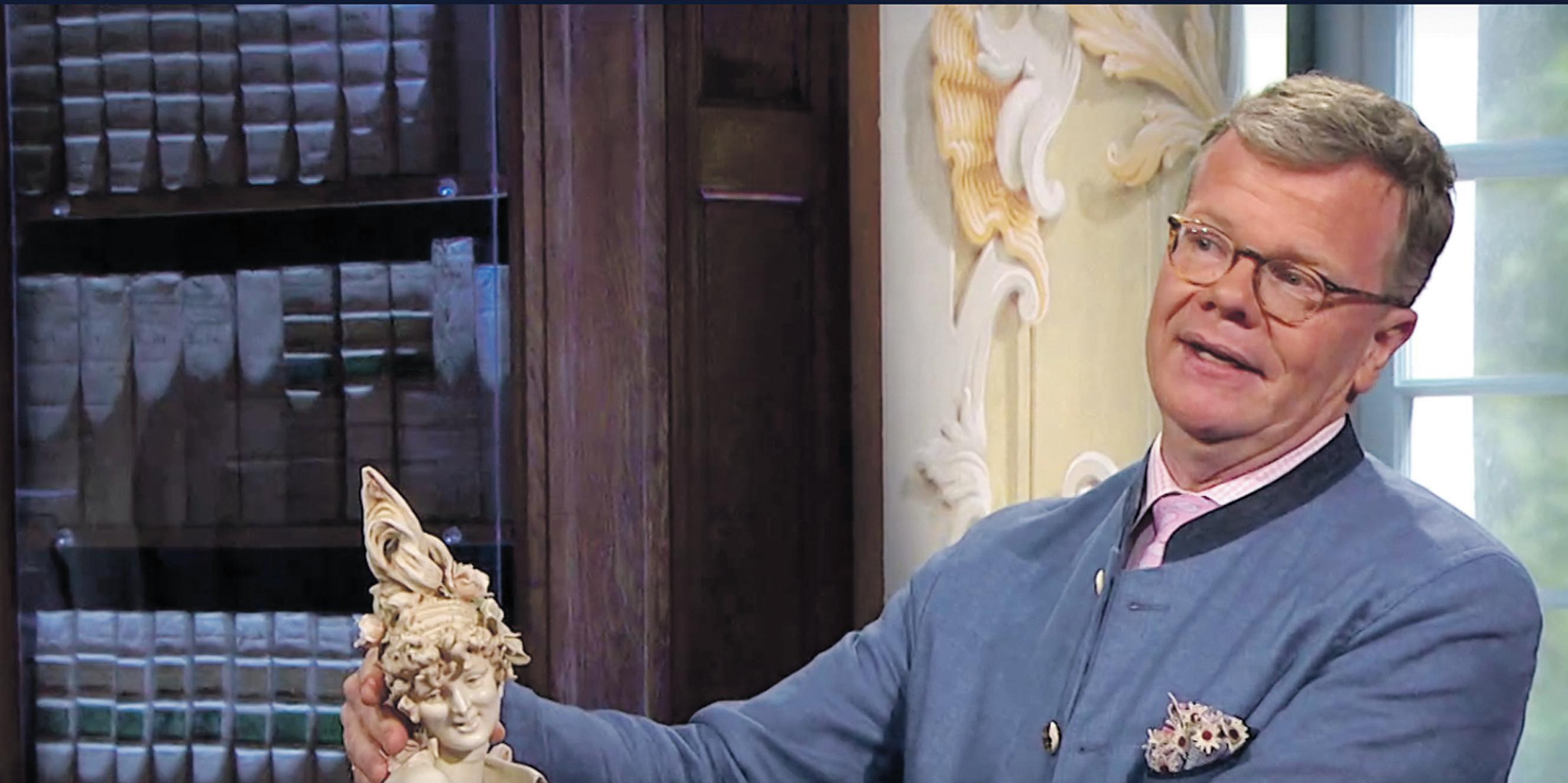
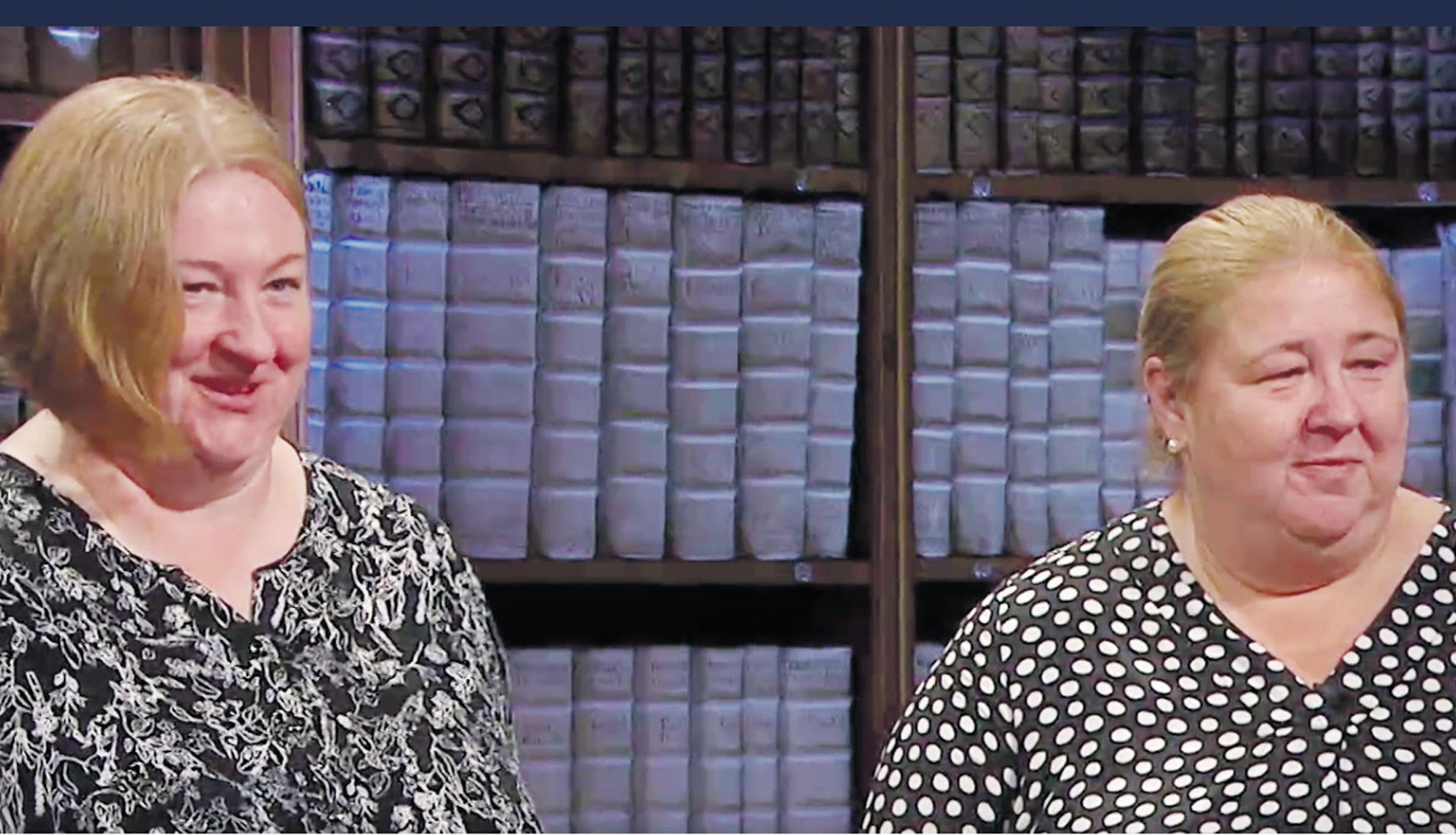
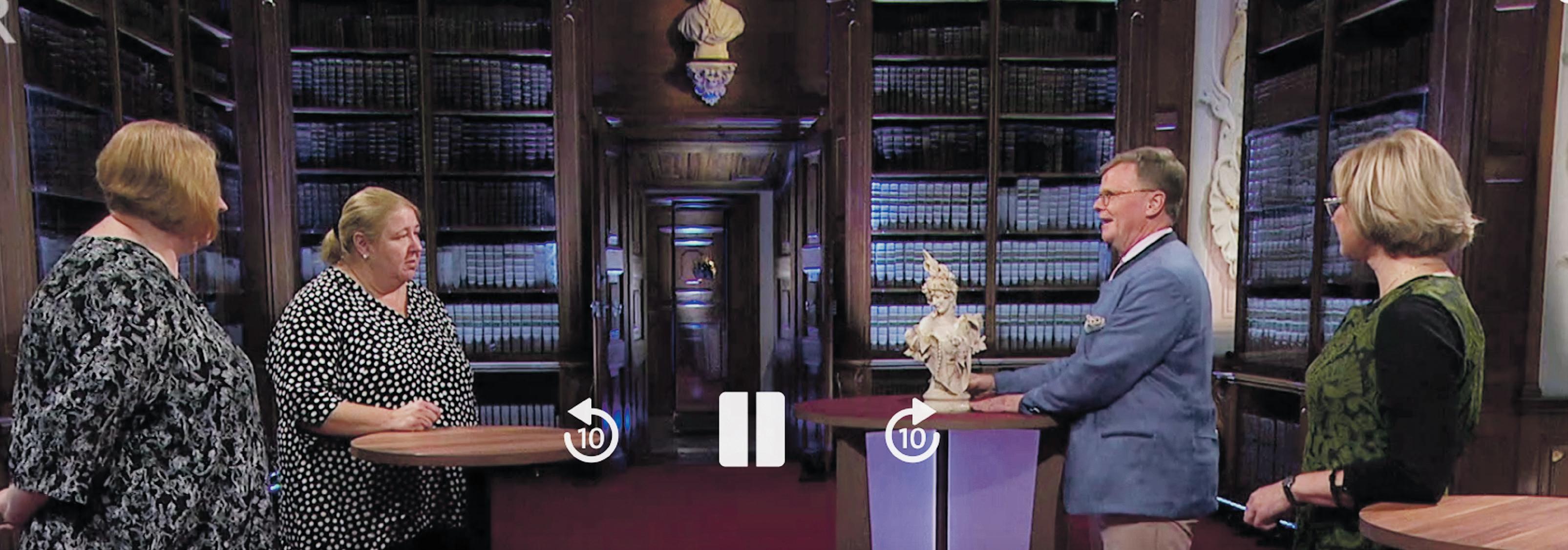
Amphora. Und die zeitliche Einordnung erscheine dadurch sehr klar. Die von Alfred Stellmacher aus Thüringen um 1876 im böhmi-
Der Porzellanexperte Wittwer ordnete die Büste in die Zeit des Fin de Siècle ein und in ein bürgerliches Gefallen am Dekorativen und an einer gewissen Koketterie. Die Frauenfigur deute ein aufgeknöpftes Mieder an, man inszeniere erotische Anspielungen. Wittwer entdeckte Ähnlichkeiten in der Form mit Zeichnungen von Henri Toulouse-Lautrec und sprach von einer Harlekine, wobei der dafür gebräuchliche spitze Hut hier zu einer spitzen
Frisur gemacht worden sei. Die Auktionatorin Wendl schilderte die Besonderheiten der Amphora-Werke, die schon damals weltweit verkauft hätten, mit dem elfenbeinfarbenen Porzellan und dem durchschimmernden Dia-
Für die beiden Schwestern, in deren Familie die Figur schon sehr lange gewesen zu sein scheint, blieb trotz aller Enthüllungen über die kokette Ausstrahlung der Frauenbüste kein Zweifel an ihrem Namen: „Püppi bleibt Püppi.“ Und nordböhmische Porzellankunst der Jahrhundertwende um 1900 erfreut noch immer die Herzen in Niederösterreich, wohin die Büste wohl schon früher hingelangt war. Ulrich Miksch
Im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf wird Anfang Dezember die Ausstellung „Der Hohnsteiner Kasper – Der Puppenspieler Harald Schwarz“ (7. Dezember bis 31. Januar) eröffnet mit einer Einführung durch Markus Dorner, den Leiter des Museums für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach und live gespielten Hohnsteiner Handpuppenszenen.
Der Hohnsteiner Kasper ist berühmt. Seit 1928 war sein Schöpfer Max Jacob mit seiner Puppenbühne in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz ansässig. Von hier aus zogen die charakteristischen Figuren mit den geschnitzten Köpfen in die Welt. Bald schon entwickelte sich das Kasperle-Theater von volkstümlicher Unterhaltung, die auch der Information, dem Klatsch
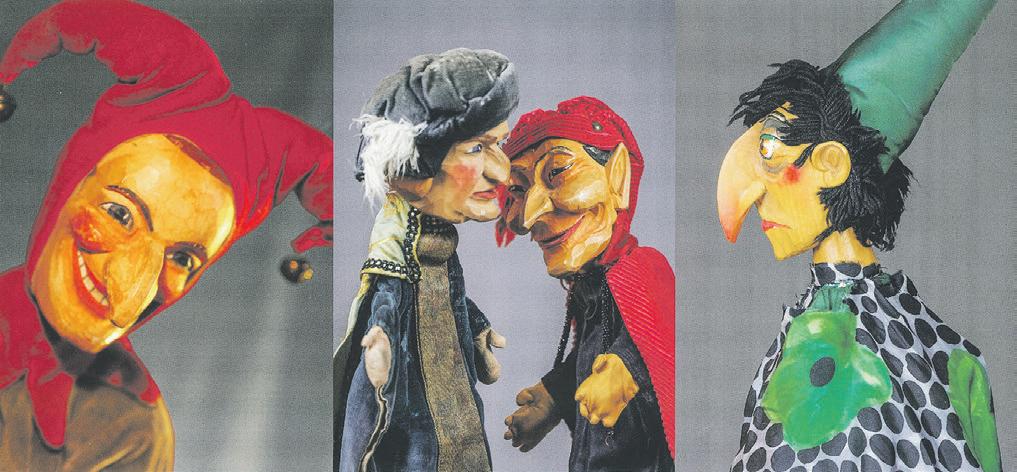
und dem Tratsch diente, zu einer anspruchsvollen Theatergattung.
� Ausstellung im Gerhart-Hauptmann-Haus
2021 nahm die Deutsche UNESCO-Kommission das traditionelle Spielprinzip des Kasper-Theaters schließlich als schützenswertes Kulturgut in das Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe auf. Der Puppenspieler Harald Schwarz kam 1921 in TeplitzSchönau/ Teplice an der deutschtschechischen Grenze zur Welt und begann nach seinem Abitur ei-
Hohnsteiner Kasper
ne Ausbildung an der Bühne von Max Jacob. Er war äußerst musikalisch, ein sehr erfahrener Komponist und versierter Interpret. Auch war er der letzte Hohnstei-
ner Bühnenleiter, der die Hohnsteiner Tradition am längsten, und zwar bis 1995, fortführte. Von 1939 bis Ende der 1960er Jahre spielte er das beim breiten Publi-
kum beliebte traditionelle oder leicht abgewandelte Hohnsteiner Kasperspiel Jacobscher Prägung. Ab 1970 ließ er sich für einen geänderten und stark musical-musikalischen Spielstil in Prag völlig andere Hand- und Stabfiguren herstellen. Diese fertigte Václav Havlik exklusiv für Schwarz. Sie zeichneten sich durch ihre Größe und Fernwirkung aus. Zu seinen erfolgreichsten Erwachseneninszenierungen dieser neuen Ära zählte die Puppentheateradaption „Der bra-
ve Soldat Schwejk“ (1971). Aber auch der „Räuber Hotzenplotz“ seines Reichenberger Landsmannes Ortfried Preußler gehörte zu seinem Repertoire. Seine Stücke für Kinder und Erwachsene zeigte Schwarz im gesamten Bundesgebiet, in Böhmen, Italien, Südamerika und den USA und fungierte dabei als Bühnenleiter, Puppenspieler, Texter und Musiker. Innerhalb der Puppenspielszene war er ein gefragter Ratgeber besonders für den puppenspielerischen Nachwuchs. Er starb 1995 im mährischen Zwittau.
Harald Schwarz war jahrzehntelang mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus verbunden, gastierte dort viel und gab mehrere Puppenspiellehrgänge. Sogar das 50jährige Jubiläum der Hohnsteiner Bühne wurde seinerzeit in Düsseldorf gefeiert.
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 9
� Büste aus Böhmen
Zwei Schwestern stellen ihren Familienschatz vor.
Püppis Kopf in einer Nahaufnahme.
Beratungsstunde im Stift Herzogenburg in Niederösterreich mit einer Frauenfigur im Mittelpunkt.
Dr. Samuel Wittwer und Anke Wendl stellen einzelne Aspekte der Büste dar.
Einige Figuren aus dem beliebten Ensemble.
Bilder: Jens Welsch
Die Sehnsucht nach Heimat läßt niemanden los
Mitte September beging der BdV-Landesverband Hessen unter dem Leitwort „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ die zentrale Gedenkveranstaltung des landesweiten Tages der Heimat mit dem 10. Hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation im Schloß Biebrich in Wiesbaden.
Neben Ministerpräsident Boris Rhein und Festrednerin Ilze Garda, Vorsitzende des Verbandes der Deutschen in Lettland, Innenminister Peter Beuth, Justizminister Roman Poseck, dem Staatssekretär und Sprecher der Landesregierung, Tobias Rösmann, sowie der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, begrüßte BdV-Landesvorsitzender Siegbert Ortmann weitere Ehrengäste wie die Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik MdB, BdV-Präsidiumsmitglied



Milan Horáček, Ingmar Jung MdB sowie die Landtagsabgeordneten
Ines Claus, Andreas Hofmeister, Kathrin Anders, Katrin Schleenbecker, Gisela Stang, Robert Lambrou und Dimitri Schulz.
Ein weiterer Willkommensgruß galt dem ehemaligen Landtagspräsidenten Karl Starzacher und dem Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermayer, der in einem Grußwort die Gäste in der Landeshauptstadt willkommen hieß. Ebenso herzlich begrüßte Ortmann auch die Wiesbadener Stadtverordneten Eleftherios Tsiridis, Nicole Röck-Knüttel und Daniel Butschan, die Vertreter von Sozialverbänden, von BdV-Nachbarverbänden sowie Angehörige landsmannschaftlicher Gruppierungen.

In seiner Begrüßungsrede erinnerte Ortmann an die Einführung des Hessischen Gedenktages vor zehn Jahren, um an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation zu erinnern und gleichzeitig zu Verantwortung und Versöhnung zu mahnen. Diesem Ziel fühle sich der hessische BdV zutiefst verpflichtet. Ortmann: „Was wir als Heimatvertriebene der Erlebnisgeneration an Grausamkeit erleben muß-
ten, wiederholt sich heute bei den Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Regionen auf dieser Erde und fordert uns alle zu Bestrebungen zu einem friedlichen Miteinander auf.“ Bereits der Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren und die dortigen Kriegsverbrechen hätten deutlich gemacht, daß Krieg und Vertreibung Geißeln der Menschheit seien und geächtet werden müßten. „Kriegsverbrechen wie im ehemaligen Jugoslawien und jetzt in der Ukraine sind eine Schade für Europa.“
„Knapp ein Drittel aller in Hessen lebenden Menschen erlebte Flucht oder Vertreibung am eigenen Leib, ist durch das Schicksal der nächsten Angehörigen betroffen oder lebt als Spätaussiedler hier. Daher bin ich stolz darauf, daß wir in Hessen seit zehn Jahren einen eigenen Gedenktag haben, der die Schicksale derjenigen Vertriebenen in den Mittelpunkt stellt, die bei uns in Hessen eine neue Heimat gefunden haben“, so Boris Rhein. „Der Gedenktag erinnert uns daran, daß Heimat nicht immer ein fester Ort ist, sondern oft in unseren Herzen und Erinne-
rungen lebt. Gerade der Ukrainekrieg führt uns eindringlich vor Augen, wie grauenvoll und traumatisch Flucht und Vertreibung sein können.“
In seiner Rede würdigte Rhein die Arbeit des hessischen BdV-Landesverbandes, dem er zum 70. Geburtstag gratulierte. „Mit seinen Landsmannschaften und Kreisverbänden ist der BdV Hessen seit Jahrzehnten eine feste Säule in der Erinnerungskultur der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in unserem Land und bewahrt das historische Erbe durch persönliches, meist ehrenamtliches Engagement – und das seit 70 Jahren. Im Namen der Hessischen Landesregierung danke ich dem BdV Hessen und allen im Verband Engagierten von Herzen für das besondere gesellschaftlich-integrative Engagement“, schloß Rhein.
„Die Heimat verlassen zu müssen, ist ein uraltes Trauma der Menschheit“, begann Ilze Garda ihre Festrede. Daß die Schicksale und die Gründe des Weggangs aus der Heimat unterschiedlich seien, zeigten schon Bezeichnungen wie Heimatvertriebene, Migranten oder Flüchtlinge. Gemeinsam sei diesen Menschen jedoch die Erfahrung des Exils, der Heimatlosigkeit und des Lebens in der Fremde.
„Doch unabhängig davon hat die Sehnsucht nach der Heimat wohl
niemanden von ihnen losgelassen.“
In ihrer bewegenden Ansprache berichtete sie über das Schicksal der Deutschbalten, über das heute in Deutschland viel zu wenig bekannt sei.
So hätten infolge des Hitler-Stalin-Pakts von 1939, der die baltischen Staaten an die Sowjetunion ausgeliefert habe, bereits vor Kriegsbeginn Zehntausende Baltendeutsche ihre Heimat verlassen müssen. Gegen Ende des Krieges seien sie zu Flüchtlingen geworden, da sie aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands hätten fliehen müssen, wo sie zuvor angesiedelt worden seien.
In Bezug auf ihre Heimat Lettland sprach Ilze Garda auch über die verbliebenen Deutschen, die nach 1945 das Schicksal der Letten teilen mußten: sowjetische Besatzung, Deportationen nach Sibirien und Russifizierung. „Deutschsein war in der Sowjetunion nichts, worauf man stolz sein konnte und durfte. Das kriegsbedingte Feindbild wurde zur Stigmatisierung – es gab eine kollektive Schuldzuschreibung. Die Pflege der deutschen Sprache und deutscher Traditionen war lange untersagt.“
Aus dieser Erfahrung heraus gebe es heute in Lettland eine große Solidarität mit der Ukraine und den von dort Geflüchteten. Zehntausende Ukrainerinnen
und Ukrainer seien seit Kriegsbeginn nach Lettland gekommen, gerade den vielen Kindern wolle man ein Gefühl der Sicherheit und ein Stück Alltag und Normalität zurückgeben. Die Schrekken der Sowjetzeit seien in Lettland in der kollektiven Erinnerung präsent. Gerade deshalb sei das Mitgefühl für die Ukraine so groß. „Lettland und Deutschland sind nicht im Krieg, aber dieser Krieg geht uns alle an.“

Abschließend appelierte Garda, aus der Vergangenheit zu lernen, die Erinnerung an das Vertreibungsschicksal zu bewahren und die deutschen Minderheiten im Ausland im Sinne der Völkerverständigung zu unterstützen. Margarete Ziegler-Raschdorf unterstrich in ihrem Schlußwort die Bedeutung des Gedenktages, um die Erinnerung an die unzähligen Vertreibungsschicksale wachzuhalten. Die Unterstützung der Heimatvertriebenen, die Bewahrung und Pflege der Kultur der Vertreibungsgebiete sei ein wesentliches Anliegen der Landesregierung. „Das Land Hessen übernimmt in vielerlei Hinsicht Verantwortung für die Heimatvertriebenen und unterstützt die Arbeit der Vertriebenenverbände seit vielen Jahren.“ Sie erinnerte an die Übernahme der Patenschaft des Landes Hessen über die Deutsch-Baltische Gesellschaft, die ihren Sitz in Darmstadt habe. Auch die Eröffnung des Schwerpunktbereichs Historische Erinnerung und kulturelles Erbe „Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen nach 1945“ an der Justus-LiebigUniversität Gießen und die Freischaltung des Digitalportals „Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext“ mit Unterstützung des Landes seien Meilensteine in der Erinnerungsarbeit. Hierfür danke sie Boris Rhein und Peter Beuth. Auch allen Ehrenamtlichen danke sie für ihre jahrzehntelange Arbeit und unermüdliche Treue zu ihren Verbänden. „Der BdV in Hessen gehört zu den bestaufgestellten Vertriebenenorganisationen in Deutschland“, schloß sie. Der „Musikverein Landenhausen“ und das Streichquartett „Junge Musik Hessen“ begleiteten den Festakt musikalisch.
� BdV-Landesverband Baden-Württemberg
Ein Fest der Kulturen und Traditionen
Mitte September fand im Hegelsaal der Liederhalle in Stutgart der Tag der Heimat des BdV-Landesverbandes BadenWürttemberg statt. Unter dem Motto „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ bot der BdV ein Programm, das die Herzen der Besucher eroberte.
Der BdV-Landesvorsitzende Hartmut Liebscher eröffnete die Veranstaltung und hieß die zahlreichen Gäste willkommen. Thorsten
Frei MdB, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Festredner, betonte die Bedeutung der Erinnerung an die tragischen Ereignisse von Krieg und Vertreibung und rief zu einem starken Zusammenhalt und einer offenen Gesellschaft auf.

Hans Vastag und Norman Thalheimer führten charmant
und stellenweise auch mit überlieferten Texten durch das Programm und sorgten für eine gelöste Atmosphäre. Die Darbietungen der Mitwirkenden begeisterten das Publikum und brachten die kulturelle Vielfalt eindrucksvoll zur Geltung. Tänzer, Musiker und Sänger trugen
zur ausgelassenen und fröhlichen Stimmung bei.
Auf der Bühne waren die Lettische Volkstanzgruppe Trejdeksnitis, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus Heilbronn, die Donauschwäbische Tanzgruppe Reutlingen, der Chor „Freundschaft“ der Ortsgruppe
Stuttgart der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, der Siebenbürgische Trachtenchor Stuttgart und die Donauschwäbische Blaskapelle aus Pforzheim. Deren beeindruckende Darbietungen verdeutlichten die reiche kulturelle Vielfalt der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler.
Insgesamt war der Tag der Heimat im Hegelsaal der Liederhalle ein bewegender und gelungener Nachmittag, der die Bedeutung der Heimat und der kulturellen Vielfalt gebührend feierte. Die Organisatoren und Mitwirkenden können stolz auf diesen Erfolg sein, der die tiefe Verbundenheit der Gemeinschaft unterstreicht. Wir freuen uns schon auf den Tag der Heimat im kommenden Jahr.
Bereits am Vormittag hatte am Mahnmal für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Stuttgart-Bad Cannstatt eine Kranzniederlegung stattgefunden. Hier hatten Richard Jäger, BdV-Landesgeschäftsführer, und Frank Nopper, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Grußworte gesprochen. Auch diese Veranstaltung war bei bestem Wetter sehr gut besucht.
Mitte September fand im Passauer Gasthaus Aschenbrenner das Monatstreffen der niederbayerischen SL-Ortsgruppe Passau statt.

Eigentlich hatte Helga Heller, Obfrau der SL-Ortsgruppe Passau, Peter Seiler als einstigen langjährigen Mitarbeiter der Diözese gebeten, einen Vortrag über den gegenwärtig so heiß diskutierten Synodalen Weg zu halten. Dieser legte seinen Schwerpunkt aber auf die Historie der Laienbewegung. Der Synodale Weg sei, sagte Seiler, nichts Neues, so sei die Mitsprache Nichtgeweihter schon im Konzil von Trient 1545 bis 1563 Thema gewesen, auch als Reaktion auf den sich ausbreitenden Protestantismus. Demokratisierungsbestrebungen habe es in den Synoden 1919 und 1931 gegeben, bei der Katholischen Aktion in Passau 1930, nach dem Krieg in der Diözesankonferenz von 1946 und dem Katholikentag 1950. Das Zweite Vatikanische Konzil dann habe die Laien zur Mitwirkung eingeladen. Pfarrer seien eben nicht alleine die Kirche, so der Referent. Den Zuhörern gab er ein PaulusWort mit auf den Weg, das als Inschrift am Passauer Dom zu lesen sei: „Die aus dem Glauben leben, werden gesegnet sein“.
Die Zahl der SL-Mitglieder schwinde, viele seien verstorben, hätten altersbedingt Probleme mit der Mobilität. Das sagte Obfrau Helga Heller, die wenige Tage zuvor, am 2. September, 96 Jahre alt geworden war. Nichtsdestotrotz hatte sie heuer bereits zum 60. Mal am traditionellen Sudetendeutschen Tag in Regensburg teilgenommen. Sie stammt aus Böhmisch Leipa im Norden Böhmens.
Der junge Historiker Tomáš Cidlina, angestellt im dortigen Museum, hat sie unlängst wieder in Passau besucht und sich mit ihr über das von ihm geschriebene und herausgegebene Buch „Leipsche“ ausgetauscht, das bereits ins Deutsche übersetzt wurde und hierzulande 300 Mal, in tschechischer Sprache 500 Mal gekauft wurde. „Nun wächst eine andere Generation heran“, sagte Heller. „Tomáš Cidlina ist mit Gold nicht zu bezahlen.“
Peter Pontz, Obmann der SLKreisgruppe Passau, überreichte Heller im Namen aller Anwesenden Blumen und dankte ihr für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Aussöhnung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. „Die Glocken von Böhmen“ stimmten die Frauen aus Ruhstorf an. Marita Pletter
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 10 � BdV-Landesverband
Hessen
Christliche Laien
� SL-OG Passau
Siegbert Ortmann
Ilze Garda
Boris Rhein
2012 zeichnet Kreisobmann Peter Pontz Helga Heller mit der Verdienstmedaille der SL-Landesgruppe Bayern aus.
2021 Helga Heller und Tomáš Cidlina in Passau.
Gedenken am Vertriebenenmahnmal in Stuttgart-Bad Cannstatt.
Innenminister Peter Beuth MdL, Wiesbadens Stadtverordnetenvorsteher Dr. Gerhard Obermayer, Landesbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf, Vorsitzende des Verbandes der Deutschen in Lettland, Ilze Garda, Ministerpräsident Boris Rhein, BdV-Landesvorsitzender Siegbert Ortmann, BdV-Präsidiumsmitglied Milan Horáček MdB a. D. und MdEP a. D. Bilder: Hessische Staatskanzlei/Paul Müller
Tschechischer Besuch
Anfang September fand das Bundestreffen des Heimatkreises Tepl-Petschau im hessischen Bad Vilbel statt.

Das diesjährige Treffen hatte nach der langen Coronazeit einen besonderen Stellenwert, und alle Teilnehmer hatten viel Freude. Satzungsgemäß fanden am Vormittag die Ortsbetreuertagung und Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Gewählt wurde wieder Hildrun Barthlme als Vorsitzende, als Stellvertretende Vorsitzende wurden erneut Herbert Mayerl und Günther Schmidt gewählt, Schatzmeisterin wurde wieder Gudrun Barthlme und zur Schriftführerin wurde erneut Gabriele Opl gewählt. Kassenprüferinnen wurden wieder Angelika Püschel und Brigitta Vancura. Alte und neue Kreisbetreuerin ist Hildrun Barthlme. Anschließend berichtete Erster Stadtrat Bastian Zander von den Entwicklungen in der Patenstadt Bad Vilbel seit dem letzten Treffen, Hildrun Barthlme berichtete von ihrer Tätigkeit als Kreisbetreuerin und von der Arbeit und den Plänen des Vorstandes.
Die Totenehrung fand am Denkmal im Kurpark statt. Thomas Stöhr, Ehrenbürgermeister von Bad Vilbel und Ehrenpatenbürgermeister des Heimatkreises Tepl-Petschau, brachte in einer kurzen Ansprache seine Gedan-
ken zum Ausdruck. Ein Trompeter der Stadtkapelle spielte zu Beginn das „Feierabendlied“ und zum Schluß „Ich hatte einen Kameraden“. Vertreter der Stadt und des Heimatkreises legten Kränze nieder, unsere tschechischen Freunde aus Tepl hatten ebenfalls einen Gedenkkranz mitgebracht, und die Kreisbetreuerin entzündete eine Kerze. Im Stadtteil Dortelweil trafen sich die Landsleute zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Heuer beglei-
Seit 33 Jahren ist Bad Vilbel Pate des Heimatkreises Tepl-Petschau, dafür gilt der Stadt unser ausdrücklicher Dank. Unser Ehrenpatenbürgermeister würdigte den Verdienst der Sudetendeutschen, mit der Charta der Heimatvertriebenen so kurz nach der grausamen Vertreibung auf Rache und Vergeltung verzichtet zu haben. Sein Dank galt zum Schluß Hildrun Barthlme für die langjährige vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, die keineswegs selbstverständ-
schen Bundesversammlung. Neben den jüngsten Zeichen der tschechischen Politik, die durchaus Anlaß zu Optimismus geben, zeigte der Besuch des Zweiten Bürgermeisters von Tepl, Martin Klepal, und des Stadtrats und Hobbyhistorikers Ludvik Poláček das positive Verhältnis zu tschechischen Landsleuten im privaten Bereich.
Die beiden hielten einen bewegenden Vortrag über ihre ehrenamtliche Tätigkeit zur Restaurierung, Wiederherstellung und Aufstellung einer Vielzahl deutscher Grabsteine, Denkmale, Gedenksteine, Marterln und Kreuze. Für diesen Einsatz und dieses Engagement bedanken wir uns herzlich, dienen sie doch der Erhaltung des deutschen Kulturgutes.
teten die „8 Franken“ aus Eisenbach den Festabend musikalisch und sorgten für gute Stimmung. Die Kreisbetreuerin begrüßte Thomas Stöhr als Vertreter der Stadt, die Ehrengäste, die Gäste aus Tepl und alle anderen, die den Fest- und Eröffnungsabend mitfeierten.


lich sei, und man müsse für dieses Engagement dankbar sein. Grußworte sprachen unser Patenbürgermeister der Stadt Butzbach, Michael Merle, und Bernd Klippel, Vorsitzender der SLKreisgruppe Gelnhausen, Mitglied des Sudetendeutschen Heimatrates und der Sudetendeut-

Die Redebeiträge wechselten sich ab mit Auftritten der Tanzgruppe der Egerländer Gmoi z‘ Offenbach, die herzerfrischend unser Brauchtum präsentierte und uns schon oft mit ihren Darbietungen erfreute. Besonders die drei jüngsten Mitglieder entzückten das Publikum. Den Abschluß des Festabends bildete nach einer kurzen Verabschiedung der Kreisbetreuerin die deutsche Nationalhymne. Es war ein sehr schönes Treffen. Beim nächsten Treffen im nächsten September feiern wir mit dem Jubiläumsbundestreffen 70 Jahre Patenschaft der Stadt Butzbach für die Stadt Tepl. ne
Heldentafel für Hans Folk
Anfang September fand im südmährischen Millowitz im ehemaligen Kreis Nikolsburg die feierliche Enthüllung einer Tafel zum Gedenken an Fliegerpilot Oberleutnant Hans Folk statt.

❯
Barthlme-Fest in der Heimat
Ende August versammelten sich etwas mehr als 30 Personen in der Dorfkirche von Oschelin im ehemaligen Kreis Mies, um mit dem Theologen Pater Pavel Frývaldský von der Karls-Universität Prag und Pfarrer Miroslav Martiš aus Mies die Festmesse anläßlich des Patroziniums zu feiern.


Pater Frývaldský befaßte sich in der auf Tschechisch und Deutsch gehaltenen Festpredigt mit dem Kirchenpatron Bartholomäus beziehungsweise dessen biblischer Entsprechung Nathanael als einem der ersten Jünger Jesu. Eine einheimische Organistin begleitete den Volks-
gesang in beiden Sprachen. Die deutschsprachigen Gottesdienstbesucher gestalteten einen musikalischen Teil mit. Das fränkische Bläsertrio aus Oswald Gebert, Karl Gebert und Frank Rügamer stimmte das „Heilig, heilig, heilig“ der Deutschen Messe von Franz Schubert an. Reinhold Langstein trug die Lesung auf Deutsch vor. Josef Paul begrüß-
te namens der ehemaligen Pfarrangehörigen die Gottesdienstbesucher, unter ihnen auch Oschelins Bürgermeister Jiří Šefčík, und dankte allen Mitwirkenden. Besonders gedachte er des am 19. August verstorbenen Ernst Gebert, der sich um die Rettung der Oscheliner Kirche seit vielen Jahren verdient gemacht habe.
Nach dem feierlichen Gottesdienst beteten Pfarrer Martiš und Pater Frývaldský mit den Gottesdienstbesuchern auf dem Friedhof und gedachten der Verstorbenen aus dem Kirchsprengel Oschelin. Währenddessen begleitete das Bläsertrio diese bewegende Geste mit einfühlsamer Trauermusik.
Das anschließende Dorffest rund um das ehemalige Gasthaus Spirk bot einiges an Gaumenfreuden und im Innenhof ausgezeichnete böhmische Blasmusik. Die beiden Egerländer Altstars aus Leiter, Alwin Wagner und Reinhold Langstein, sind bekannt von der Melsunger „Vogelwiese“. Hier konnten sie ihr Gesangstalent – wie schon beim Sologesang in der Kirche – in rasch geknüpfter musikalischer Kooperation mit der tschechischen Blaskapelle entfalten.
Wer hätte gedacht, daß in Oschelin ein Lied von Ernst Mosch – „In deinen Armen“ –so meisterhaft von einer tschechischen Kapelle gespielt und von zwei Sudetendeutschen so wunderbar gesungen würde? fl
Mitte September fand in Brünn Den za Moravu, der Mährische Tag, statt. „Nach getaner Arbeit ist gut ruh‘n!“ war eines der sieben deutschmährischen Lieder, die die „Mährische Singgruppe Brünn“ beim Mährischen Tag zu Gehör brachte. Diesmal bot sie auch ein Weinlied aus Südmähren/Niederösterreich. Bemerkenswert ist, daß durch das Singen an die auch deutsche Vergangenheit Mährens erinnert wird. Schon im siebten Jahr in Folge. Leider ist unsere älteste Mitsängerin – sie ist 86 Jahre alt – nicht auf dem Bild. Sie ist die einzige verbliebene Deutsche in unserer südmährischen Gruppe.
Text: Barbara Edith Breindl Bild: František Vřeský


Die von Marco Toffol mit dem Historischen Verein von Primörtal im Trentino organisierte Veranstaltung wurde von der mährischen Gemeinde unterstützt, die am Gefallenendenkmal im Stadtzentrum eine Gedenktafel für den Piloten anbringen wollte. Bereits im Juni 2022 fand eine ähnliche Zeremonie auf dem Feltre-Friedhof statt, der ersten Grabstätte von Oberleutnant Folk, nachdem er 1918 am Himmel über dem Monte Grappa abgeschossen worden war.


Die Zeremonie in Millowitz hat für Toffol eine doppelte Bedeutung. Sie soll nach mehr als 100 Jahren an einen Helden der österreichisch-ungarischen Luftwaffe erinnern, der mit nur 27 Jahren starb und auch im NachkriegsÖsterreich in Vergessenheit geriet. Und da der Held ein Sudetendeutscher war, soll die Erinnerung an ihn eine Brücke des Friedens und der Toleranz zwischen den verschiedenen Volksgruppen bauen, die das mitteleuropäische Schachbrett, insbesondere in diesen Grenzgebieten, bilden.
In diesem Sinne war die Haltung einiger Körperschaften aus unserem Land, Welschtirol, das ebenfalls an der Grenze liegt und in der Vergangenheit auch durch ethnische Konflikte verwüstet wurde, zu dieser Veranstaltung günstig und nicht zufällig, vor allem in der Region Trentino-Südtirol, der Gemeinschaft des Primör-
tals, der örtlichen Tourismusagentur und der Gemeinde Primiero San Martino di Castrozza. Ein Zeichen des Friedens und der Brüderlichkeit zwischen Völkern, die es trotz der gleichen politischen und historischen Ereignisse geschafft haben, Spaltungen und Mißverständnisse zu überwinden und eine Zukunft des Zusammenlebens zu schaffen. Symbol dieser Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft war die Anwesenheit einer wichtigen Delegation des Schützenbundes Welschtirols unter der Leitung des Kommandanten Major Enzo Cestari und der Landesgruppen Kaiserschützen und Standschützen. Primör war durch seine Musikkappelle vertreten. Die Gastfreundschaft der Gemeinde Millowitz übertraf aufgrund der Herzlichkeit und Freundlichkeit, mit der die Teilnehmer empfangen wurden, alle Erwartungen. Unter ihnen war auch eine Delegation des Kulturverbandes der Südmährer in Österreich mit Obmann Hans Günter Grech, die den Wunsch, in Millowitz ihres Landsmanns zu gedenken, besonders schätzte. Eine Erinnerung, die auch durch die Anwesenheit der oberösterreichischen Delegation des Österreichischen Schwarzen Kreuzes besiegelt wurde.
Bürgermeisterin Veronika Blanářová äußerte den Wunsch, daß die zufällige Begegnung zwischen unseren beiden geographischen Realitäten im Namen eines Soldaten, der sie ideal vereine, nicht auf die Gedenkfeier beschränkt bleibe, sondern mit anderen Gelegenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen fortgesetzt werden könne.
VERBANDSNACHRICHTEN HEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 11
❯
Heimatkreis Tepl-Petschau/Egerland
Heimatort Oschelin/Egerland
Pater Pavel Frývaldský und Pfarrer Miroslav Martiš zelebrieren die Patroziniumsmesse und das Gedenken auf dem Friedhof der Toten.
Musikkapelle aus Primör.
Welschtiroler Schützenbund, Kaiser- und Standschützen.
Ludvik Poláček, Stadtrat in Tepl, Dr. Thomas Stöhr, Ehrenbürgermeister von Bad Vilbel und Ehrenpatenbürgermeister, Kreisbetreuerin Hildrun Barthlme, Michael Merle, Erster Bürgermeister von Butzbach und Patenbürgermeister, und Martin Klepal, Zweiter Bürgermeister von Tepl. Bild: Günther Schmidt
Böhmische Bläser, Alwin Wagner und Reinhold Langstein. Bilder (2): Josef Paul
Hans Folk (1891–1918)
Veronika Blanářová mit einem Buch über Primör und Marco Toffol mit einem Folk-Portrait.
❯ Millowitz/Kreis Nikolsburg
Neudek Abertham
Neudeker Heimatbrief
für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Folge 649 · 9/2023
Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft, Stadtsparkasse München – IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 650 (10/2023): Mittwoch, 18. Oktober.
Kolitsch aus Hengstererben
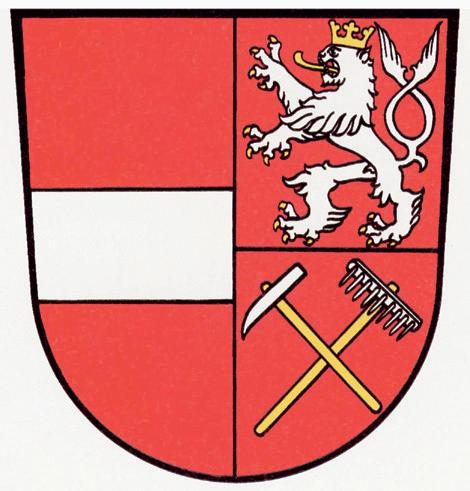
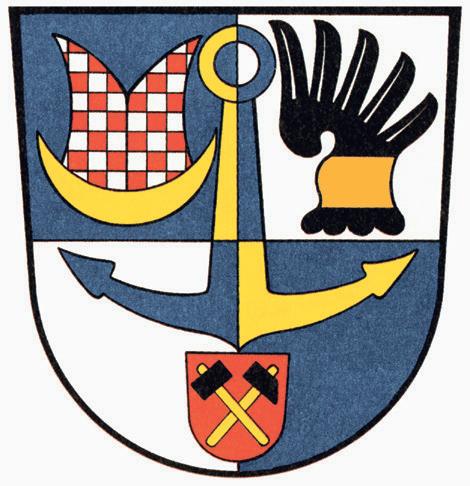


60 Verwandte treffen sich in Dresden

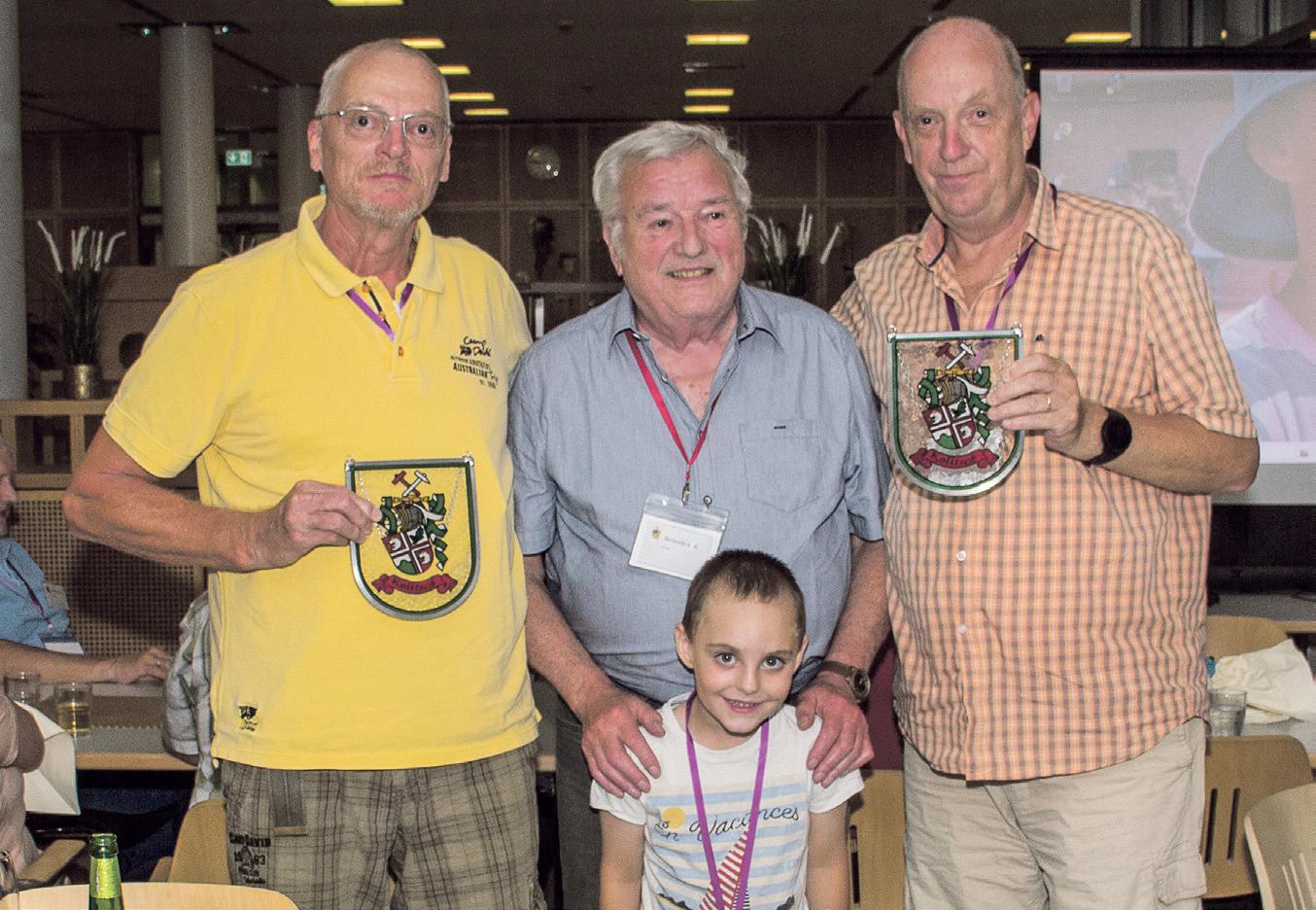

Anfang September trafen sich mehr als 60 Mitglieder der Familie Kolitsch im Dresdner Akademiehotel. Aus nah und fern war die Verwandtschaft für ein Wochenende voller Austausch, Freundschaft und Unterhaltung angereist.
Nach dem ersten Familientreffen der Kolitschs im Sommer 2018 in Gottesgab/Boží Dar hatten nun die Brüder Wolfgang und Matthias Kolitsch aus Dresden die Organisation des zweiten Familientreffens übernommen und in das Dresdener Akademiehotel der Berufsgenossenschaften eingeladen. Die Gäste von außerhalb konnten hier ein Zimmer beziehen, und gemeinsam mit den Tagesgästen, welche in Dresden und der näheren Region wohnen, traf man sich im Restaurant des Hotels zum Essen, zu Gesprächen und Vorträgen. Der Einladung ins schöne Elbflorenz waren mehr als 60 Mitglieder der Familie aus ganz Deutschland und der Tschechischen Republik gefolgt. Nach ih-
rer Ankunft am Freitagabend und einem gemeinsamen Abendessen gab es eine organisatorische Ansprache für die folgenden Tage und die ersten Vorträge sowie ein Wissensquiz. Am späten Freitagabend und nach vielen interessanten Gesprächen ging es voller Vorfreude auf den kommenden Sonnabend für alle Teilnehmer ins Bett.
Am Sonnabendmorgen traf sich die Gesellschaft für eine gemeinsame Stadtrundfahrt durch Dresden mit vielen Sehenswürdigkeiten. So ging es zunächst zum Grundstück des ehemaligen Gasthofes zur Deutschen Eiche im Dresdener Stadtteil Klotzsche-Königswald, der mehr als 50 Jahre lang im Familienbesitz war und in dem Kamill Kolitsch und seine Familie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg den aus dem Sudetenland vertriebenen Familienmitgliedern Zuflucht gewährten.
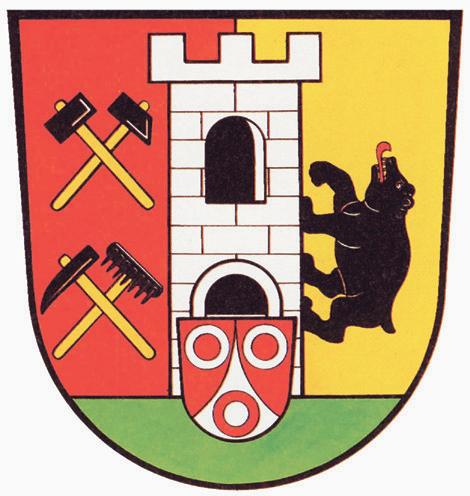
Nach weiteren Sehenswürdigkeiten der sächsischen Landeshauptstadt ging es auf dem
Rückweg vorbei am Hotel Rothenburger Hof. Im Rothenburger Hof hatte Kamill Kolitsch seine erste Dresdener Gaststätte eröffnet, die Erzgebirgsschänke in der damaligen Markgrafenstraße 17.
Nach individueller Freizeitgestaltung am Samstagnachmittag
traf sich die Großfamilie abends wieder im Restaurant des Akademiehotels zum Abendbrot, und zu weiteren Vorträgen, Erfahrungsberichten, Einblicken in die Familiengeschichte und in die Historie von Hengstererben. So gab Helmuth A. Kolitsch einen Abriß der Familiengeschich-
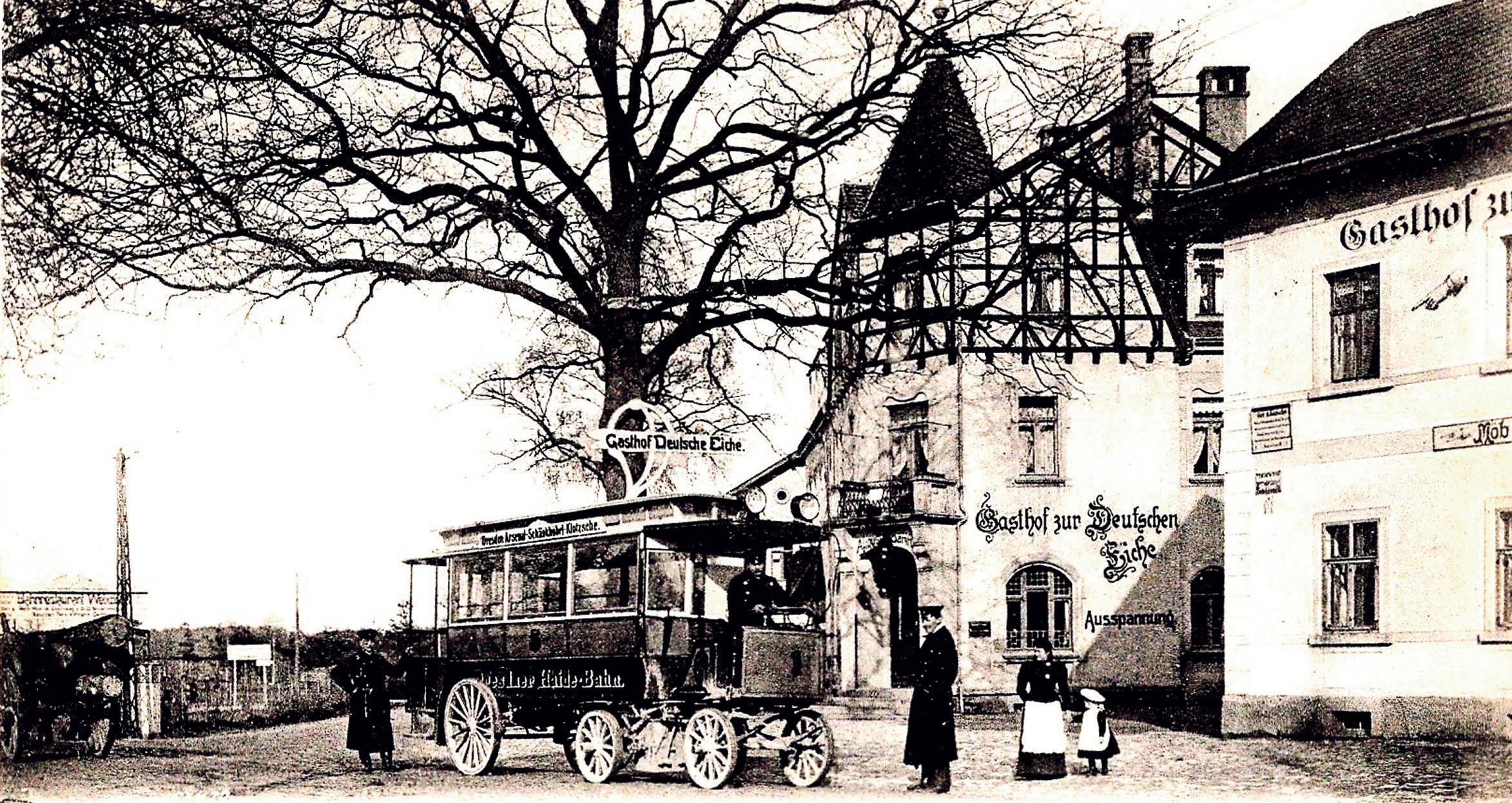
te und vermittelte lebhaft und anschaulich sein großes Wissen aus der Aufarbeitung der Historie der Familie Kolitsch und angrenzenden Familien.

Elke Buskies berichtete sehr emotional von ihren Erfahrungen und Erlebnissen bei der Wanderung auf den Spuren der Vertreibung ihres Vaters von Karlsbad bis zum Gasthof zur Deutschen Eiche nach Dresden. Professor Andreas Kolitsch sprach lebhaft über die Ergebnisse seiner Familienforschung.
Barbora Modes, die Zweite Bürgermeisterin von Abertham/Abertamy und ebenfalls Mitglied der Familie, meldete sich zu Wort und teilte ihr Anliegen bezüglich des Erhalts und der Pflege der Gräber von Familienangehörigen auf dem Friedhof in Abertamy mit.
Hier sind viele Mitglieder der Familie Kolitsch sowie deren unmittelbare Verwandte begraben.
Nun werden Kontakte zu Angehörigen und weiteren Bekannten gesucht. Eine Liste der Gräber,

welche gepflegt werden könnten, ist bestimmt bei der Kommunalverwaltung zu finden, und Barbora Modes sicherte ihre Unterstützung zu.
Am Sonntagmorgen ging es bei herrlichem Sommerwetter gemeinsam auf einem Schaufelraddampfer der sächsischen Dampferflotte zu einer Schlösserfahrt die Elbe stromaufwärts bis zum Schloß Pillnitz und wieder zurück in die Dresdner Innenstadt. Im Anschluß begaben sich alle Teilnehmer auf ihre Heimreise, im Gepäck eine Menge neuer Eindrücke, Anregungen, Kontakte und die Idee für ein weiteres Familientreffen in nicht allzu ferner Zukunft.
Unser Dank gilt allen Teilnehmern, die den Weg nach Dresden auf sich nahmen und mit ihren Beiträgen, Anregungen und dem Wissen über Vergangenes das Treffen bereicherten. Ganz besonderer Dank gilt den Brüdern Wolfgang und Matthias Kolitsch für ihren Einsatz und die gelungene Organisation des Familientreffens.
Martin Kolitsch
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer:
Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 12
Matthias, Professor Dr. Helmuth A., Konstantin und Wolfgang Kolitsch mit Familienwappen.
Unser Schaufelraddampfer „Dresden“. Bilder (3): Peter Sende Historische Aufnahme des Gasthofs zur Deutschen Eiche mit der ersten elektrischen gleislosen Straßenbahn.
❯ Familie
� Neudeker Heimatgruppe „Glück auf“
Klöppeln beim Stadtteilfest
Nach der Corona-Pause fand heuer wieder das AugsburgGögginger Stadtteilfest am Tag des offenen Denkmals statt. Dazu bietet sich wohl nichts besser an als der Park rund um das Gögginger Kurhaus, noch dazu an einem herrlichen Sommertag. So ließen die zahlreichen Besucher nicht lange auf sich warten, boten doch die Veranstalter ein umfangreiches Programm für jung und alt.

Ehemalige rote Hochburg
Pechöfen liegt etwa vier Kilometer südlich von Neudek an der Bahnlinie Karlsbad–Neudek–
Breitenbach auf einer Höhe von 518 Metern über dem Meeresspiegel und wurde 1872 als Teil des Dorfes Voigtsgrün gegründet. Die Gesamtfläche des Dorfes beträgt 645 Hektar.
Wie der Name des Dorfes andeutet, war der Vorgänger der Siedlung wahrscheinlich eine Pechsiederei, die vor allem von Böttchern, Schustern und anderen Handwerkern genutzt wurde. Eine wichtige Voraussetzung für die Errichtung von Pechfabriken war der Reichtum an harzreichen Fichten und anderen Nadelbäumen. Das Rohpech entstand als Nebenprodukt bei der Herstellung von Holzkohle in den Köhlereien und auch durch Raffinierung in speziellen Öfen.

Ein Teil der Bevölkerung war in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt, andere fanden Arbeit in den Neudeker Fabriken, in der Porzellanfabrik in Neu Rohlau und im Bergbau im Gebiet von Elbogen. 1882 wurde in der Nähe der Brücke über die Rohlau an der Abzweigung nach Pechöfen ein Mahlwerk für Holzmehl errichtet. Das Mahlwerk befand sich parallel zur Straße von Chodau nach Neudek.
Das Werk war von der Firma Schlesinger und Co. gegründet worden, die Halbfertigprodukte für die Papierindustrie her-
WER KANN HELFEN?
Wir suchen Nachfahren von Endlich oder Nachtigal aus Frühbuß.
Radek Hamouz ist Tscheche und kam 1970 in Frübuß zur Welt. Er möchte gerne Kontakt mit den früheren deutschen Besitzern seines Hauses oder deren Nachfahren aufnehmen. Das Haus hatte früher die HausNr. 130, später wurde sie in 134 geändert. Die frühere deutsche Besitzerin könnte Leopoldine Endlich gewesen sein, die nach der Heirat mit Nachnamen Nachtigal hieß. Wer Radek Hamouz helfen kann, wende sich bitte an mich, Kontaktdaten Ý Impressum des Neudeker Heimatbriefes Josef Grimm
stellte. Unter den beengten Verhältnissen des Tals war das Anschlußgleis 100 Meter lang. Es wurde direkt von der Straße aus ent- und beladen. In der Ersten Republik ist eine Firma Hernych als Eigentümer aufgeführt. Während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Werk und Gleisanschluß stillgelegt.
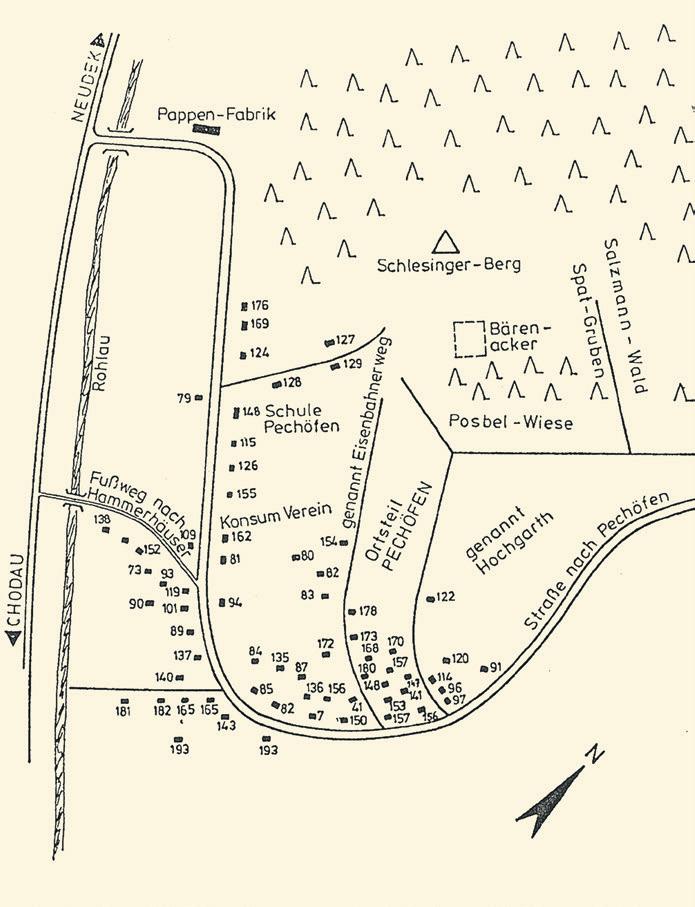
Für die Errichtung einer Gemeindeschule (Haus-Nr. 141) als Zweigstelle der Schule von
lands vertrieben wurde, fand ein großer Bevölkerungsaustausch statt. Voigtsgrün und damit auch Pechöfen wurden von Tschechen aus dem Landesinneren, dann von Slowaken und Rückwanderern besiedelt. Von der ursprünglichen Bevölkerung blieb nur ein Bruchteil übrig. Kommunisten aus Pechöfen, die in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, in der späteren DDR, eine neue Heimat fanden, fanden Be-
nalwahlen im November 1990, als Pechöfen die Unabhängigkeit von Neudek erlangte, war es mit nur 59 Einwohnern im Dezember 1990 eine der kleinsten Gemeinden in der Westböhmischen Region. Nach der Erlangung der Selbstständigkeit stieg die Einwohnerzahl der Gemeinde allmählich wieder, was vor allem auf die Zuwanderung aus Städten wie Neudek und Karlsbad zurückzuführen ist.
Begrüßt wurden die Besucher gleich am Eingang von der Gögginger Feuerwehr, die Einblick in ihr Feuerwehrauto gewährte und gerne alle Fragen beantwortete. Der Kurhauspark war die geeignete Kulisse für all die bunten Stände der Vereine und Firmen sowie zahlreicher Parteien. Großes Interesse fanden dabei einige Glücksräder, die Gewinne unterschiedlicher Art versprachen.
Die Neudeker Heimatgruppe „Glück auf“ war ebenfalls mit einem Tisch und zwei Klöpplerinnen präsent. Eine Klöpplerin hatte einen herkömmlichen Klöppelsack, auf dem sie an Teilen für ein Decke arbeitete, und die zweite Klöpplerin zeigte ihr Können auf einem Klöppelbrett, auf dem sie schon für Weihnachten
an einem Stern klöppelte. Gerne gaben sie den Interessierten Auskunft, die ihnen erstaunt über die Schultern schauten. Wohl vielen wurde erst nach einiger Zeit des Zuschauens bewußt, wieviel Zeitaufwand in den Klöppelarbeiten steckt, und sie verabschiedeten sich mit Worten großer Bewunderung. Großes Interesse und Bewunderung fanden auch die verschiedenen Aufführungen, so die der Showgruppe der Universität mit ihrer Akrobatik oder die Vorführungen des Tanz-SportZentrums und das bunte Programm des TVA 1847. Für Unterhaltung sorgte natürlich das Kolping-Blasorchester. Es gab jedoch nicht nur etwas zum Schauen, sondern auch etwas zur Beschäftigung. So konnte man am Stand des ukrainischen Vereins kleine Puppen basteln oder die Kinder sich auf der Hüpfburg austoben. Wem das alles auch noch nicht reichte, der konnte an einer Führung durch das wunderschöne Kurhaus teilnehmen und sich am Schluß noch am Imbiß-Stand mit einer Pizza oder Wurstsemmel stärken. Alles in allem war das ein gelungener Nachmittag im Kurhauspark.
Anita Donderer
Voigtsgrün wurde im September 1905 ein Gebäude gekauft und zu einer eigenen Schule ausgebaut. Da Pechöfen überwiegend von kommunistischen Familien bewohnt wurde, die nach dem 26. September 1938 aus dem Dorf ins Landesinnere flohen, hatte die Schule mit Schülermangel zu kämpfen. Die Schule mit Deutsch als Unterrichtssprache blieb bis 1945 bestehen.





In der einklassigen Gemeindeschule wurde im September 1947 der Unterricht in tschechischer Sprache aufgenommen. Zuvor war das Gebäude verwüstet worden, und es fehlte an Möbeln und anderer Ausstattung. Dank der Einwohner und der lokalen Verwaltungskommission von Voigtsgrün wurden die Fenster verglast, Lampen installiert und die Innenausstattung bereitgestellt. Im ersten Schuljahr 1947/1948 besuchten 36 Schüler –19 Jungen und 17 Mädchen – die Schule. Die Zahl der Schüler, die die Schule besuchten, ging allmählich zurück, und im Schuljahr 1966/1967 wurden nur noch sechs Kinder gezählt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die deutsche Bevölkerung in die alliierten Besatzungszonen Deutsch-
schäftigung in den Parteistrukturen der SED, bei den Sicherheitskräften und im diplomatischen Dienst. Beispiele sind der NVA-Offizier Otto Schwab (* 1903 Voigtsgrün, † 1972 Ostberlin) und der Stasibeamte Alfred Kraus (* 1910 Neu Rohlau, † 2001 Berlin).
Nach 1945 gehörte Pechöfen zur Gemeinde Voigtsgrün, die im Januar 1976 nach Neudek ein-

Während die Gemeinde ab den 1920er Jahren ausschließlich kommunistisch war und deswegen in Westböhmen rote Hochburg genannt wurde, verbreitete sich dort Ende der 1920er Jahre auch die Deutsche Sozialdemokratische Partei, welche sich auch im politischen Kampf betätigte. Damals kam es zu einer Reihe von Zusammenstößen zwischen Mitgliedern politischer Parteien, sei es zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten auf der einen Seite und zwischen national Gesinnten auf der anderen Seite. Aber auch zwischen den beiden linken Parteien – den deutschen Sozialdemokraten und der Kommunistischen Partei – kam es zu Auseinandersetzungen, und man kann sagen, daß sie heftig waren, wie der Fall vom September 1930 zeigt.
Am Sonntag, den 28. September 1930 planten die örtlichen Sozialdemokraten eine öffentliche Versammlung im Gasthaus von Daniel Stutzig – Haus-Nr. 143, heute Gemeindeamt –, zu der sie alle Bürger aus der näheren Umgebung einluden. Als die Kommunisten von den Vorbereitungen für die Versammlung der Sozialdemokraten erfuhren, begannen sie in der ganzen Gegend unter ihren Anhängern zu agitieren, sie sollten nach Pechöfen kommen und die Versammlung stören.
� Voigtsgrün
Vergelt‘s Gott
Kürzlich baten wir um eine Spende zugunsten der Voigtsgrüner Kapelle (Þ NHB 646).
gegliedert wurde, und verlor an Einwohnern, was sich vor allem in den 1960er und 1970er Jahren zeigte, als die Menschen in die nächstgelegenen Städte Neudek und Neu Rohlau abwanderten. Dieser Abwärtstrend wurde in den frühen 1990er Jahren gestoppt. Nach den ersten Kommu-
Als die Sozialdemokraten mit etwa 500 Mann aus Neudek eintrafen, mischten sich etwa 60 Kommunisten aus den Kreisen Neudek und Elbogen unter der Leitung des kommunistischen Abgeordneten Karl Haiblick unter die sozialdemokratische Menge, begannen die Internationale zu singen und riefen Parolen gegen den politischen Rivalen. Fortsetzung folgt
Das Geld soll für Akkugeräte zur Pflege des KapellenGeländes verwendet werden, da dort kein Stromanschluß ist. Zwei heimatverbliebene Voigtsgrüner kümmern sich dankenswerterweise um die Pflege rund um Kapelle und Gefallenendenkmal. Zu unserer großen Freude blieb der Aufruf nicht ungehört. Es ging zwar nur eine – dafür aber eine sehr großzügige – Spende auf dem Konto der Heimatgruppe „Glück auf“ ein, die an Voigtsgrün weiter gegeben
werden konnte. Der großherzige Spender bekam natürlich, wie im Aufruf erwähnt, von uns eine Spendenbescheinigung, die bei einer eventuellen Einkommensteuer-Erklärung geltend gemacht werden kann.
Hier unser persönlicher Dank, speziell im Namen der Voigtsgrüner, die sich schon seit Jahren um die Kapelle und das Denkmal kümmern. Anita Donderer
Gefallenendenkmal und Kapelle in Voigtsgrün. Bild: Anita Donderer
Folgender treuer Abonnentin des Neudeker Heimatbriefs, die im September Geburtstag feiert, wünschen wir von Herzen alles Gute und viele schöne Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit. n Neuhammer. Annl Schippl/Faßmann Rosenstraße 2, 86465 Welden, 13. September 1926.

NEUDEKER HEIMATBRIEF Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 13
� Pechöfen
Anita Donderer mit den Klöpplerinnen Regina Mayer und Hildegard Schorer im Gögginger Kurpark. Bild: Dieter Kleber
von
Jahren 1930 … … 1970 … 1925
Auf dem Klöppelbrett entsteht ein goldener Weihnachtsstern.
Teilansichten
Pechöfen aus den
Das Schulgebäude im Jahr 1925
und 1970.
Ortsplan von Pechöfen. und im Jahr 1930.
WIR GRATULIEREN
Auch heuer trafen wir uns Ende August bis Anfang September im heimatlichen Teplitz-Schönau. Jutta Benešová berichtet über den zweiten Teil des großen Treffens.
Am 1. September fuhren wir bei wunderschönem Wetter nach Kaaden. Es würde zu weit führen, das Kloster und die Kirche in Kaaden im Einzelnen zu beschreiben. Die ursprünglich gotische Klosterkirche, die Ende des 15. Jahrhunderts geweiht und 1749 erweitert wurde, erfreute sich seit ihrer Entstehung einer großen Verehrung der Gläubigen.
Dieser Wallfahrtsort ist mit einer Legende verbunden, die besagt, daß anstelle des heutigen Altars, der den Vierzehn Nothelfern gewidmet ist, einst ein Hinrichtungsplatz war. Ein Adliger, der gegen die Obrigkeit rebelliert hatte, sollte gehängt werden, tat aber auf dem Weg zum Richtplatz Abbitte und bat die Vierzehn Nothelfer um Erbarmen. Er überlebte die Hinrichtung und wurde wegen dieses Wunders begnadigt, der Hinrichtungsplatz außerhalb der Stadt verlegt und an der Stelle, wo das Wunder geschah, eine Kapelle zu Ehren der Vierzehn Nothelfer errichtet.
Abgesehen von der Legende war der wirkliche Gründer von Kloster und Kirche der bekannte böhmische Pilger zum Heiligen Grab in Jerusalem, Johann Hassenstein von Lobkowitz (1450–1517). Dieser sehr gelehrte und gottesgläubige Ritter hatte 1492/93 das Heilige Land besucht und nach seiner Rückkehr das Franziskanerkloster gegründet, und in wenigen Jahren wurde die geräumige Klosterkirche mit einem Hauptaltar und vier Seitenaltären errichtet. Die Entfernung vom Rathaus in Kaaden bis zum Kloster und der Kirche der Vierzehn Nothelfer soll genau der Entfernung entsprechen, die vom Haus des Pontius Pilatus nach Golgatha in Jerusalem führt. Die Verehrung der Vierzehn Nothelfer erreichte in Kaaden im 17. und 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Die nachfolgenden Josephinischen Reformen führten zu einem starken Nachlassen der Bedeutung dieses Wallfahrtsortes, aber noch zu Beginn
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau

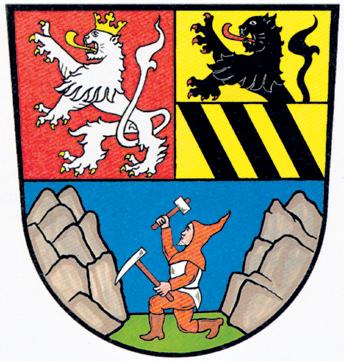


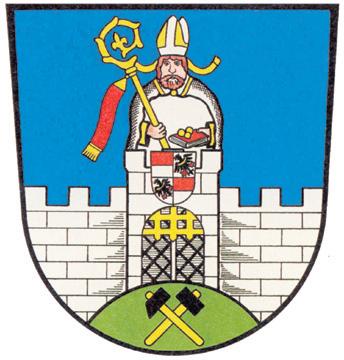
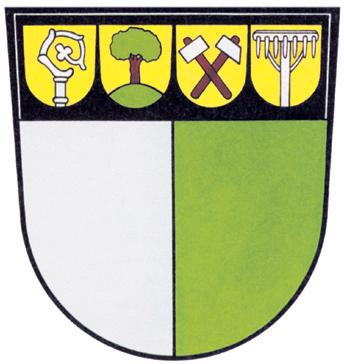

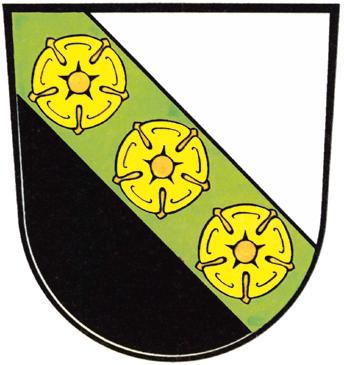

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt
Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –
Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Links: Blick in die VierzehnNothelfer-Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters in Kaaden und auf die dortigen Deckenfresken von Lucas Cranach dem Älteren. Unten: Tumba von Johann Hassenstein von Lobkowitz. Rechts: Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek am März-Mahnmal auf dem Kaadener Friedhof.

Das neunte Treffen in der Heimat
des 20. Jahrhunderts besuchten die Kirche weit über tausend Pilger. Seit 1995 ist das Franziskanerkloster mit der Kirche Nationales Kulturdenkmal. Die Vorbereitungen zur Erneuerung des Klosters begannen am Millenium und die Rekonstruktion der Kirche erfolgte in den Jahren 2016 bis 2021. Im August 2021 wurde die erneuerte Kirche vom Leitmeritzer Bischof Jan Baxant gesegnet. Allein die Lage des Klosters mit der Kirche an einem Berghang mit anliegendem Garten, der bis hinunter zum Fluß Eger reicht, erweckt Bewunderung. In Kloster und Kirche finden wir Gewölbe, Zellen- oder Diamantgewölbe genannt, die vermutlich die ersten dieser Art in Böhmen waren, und Wandmalereien, die Lucas Cranach dem Älteren zugeschrieben werden. In der Kirche fand auch Johann Hassenstein von Lobkowitz seine letzte Ruhestätte, und zwar mit einer Tumba ungewöhnlicher Art.

Fast war die Zeit zu kurz, um alle Kostbarkeiten vor allem der Kirche zu erfassen. Doch nach dem Mittagessen im Weißen Lamm erwartete uns noch die Kranzniederlegung an der Gedenkstätte auf dem Kaadener Friedhof. Hier erinnerte der Teplitz-Schönauer Freundeskreis mit seinem Vorsitzenden Erhard



Spacek, gleichzeitig Heimatkreisbetreuer, an die traurigen Ereignisse des 4. März 1919. Bei einem Konflikt zwischen tschechoslowakischen Soldaten und
deutschen Demonstranten seien 54 Tote zu beklagen gewesen. Spacek betonte, daß die Familie Clary und Aldringen zu Unrecht von dem kommunistischen
Regime als Nazis abgestempelt worden sei. Ohne sie, denen Teplitz unter anderem das Gartenhaus, die Kirche in Eichwald und die Edmundsklamm zu verdanken habe, wäre sicher manch‘ berühmte Persönlichkeit nicht in die Teplitzer Kurbäder gereist.
Spacek: „Wir als nachfolgende Generation stehen fassungslos vor den traurigen Folgen, die der Zerfall der Habsburger Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg und nationalistischer Fanatismus mit sich gebracht haben. Es liegt nun an der jungen Generation, sich mit der historischen Wahrheit zu beschäftigen.“
Die Rückfahrt nach Teplitz in den frühen Nachmittagsstunden glättete wieder etwas die gedrückte Stimmung, denn am Abend erwartete uns ein Konzert in der Sankt-Elisabeth-Kirche in Schönau. Den Bau der Kirche hatte auch Fürst Edmund von Clary und Aldringen unterstützt, damit Bad Schönau, damals noch eine selbständige Gemeinde, zur Stadt erhoben werden konnte. Der berühmte Wiener Architekt Heinrich von Ferstel hatte diese Kirche entworfen, die 1877 feierlich eingeweiht worden war.

In den vorangegangenen Jahren war es zur lieben Tradition geworden, unser Treffen mit einem Konzert in der von uns finanziell unterstützten Beuroner

Kapelle zu beschließen. In diesem Jahr kam es jedoch zu einer Änderung.
Auf Initiative des tschechischen Teplitzer Vereins hatte unser Teplitz-Schönauer Freundeskreis eine enge Zusammenarbeit mit dem römisch-katholischen Pfarrhaus in Teplitz begonnen, wobei das gemeinsame Projekt „Die Teplitzer Sankt-Elisabeth-Kirche – ein Gotteshaus mit offenen Türen für alle“ entstand. Dessen Ziel ist, mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zum einen die Beziehungen durch gemeinsame Zusammenkünfte zu festigen und zum anderen einen weiteren Verfall der Elisabethkirche zu verhindern. Das neue Dach der Kirche ist ein erster Beweis dafür.
Und so hatte nun unser Verein durch öffentliche Aushänge auf das Konzert aufmerksam gemacht, und die zahlreiche Beteiligung war für uns der Beweis, daß der Gedanke eines „Gotteshauses mit offenen Türen für alle“ von den Teplitzern gern angenommen wurde. Außer Senator Hynek Hanza waren auch der Direktor des Teplitzer Gymnasiums, Zdeněk Bergman, die Historikerin des Schloßmuseums in Teplitz, Bohuslava Chleboradová, sowie der Vorstandsvorsitzende des Fußballklubs FK Teplice, Pavel Šedlbauer, gekommen.
Die Küsterin der SanktElisabeth-Kirche, Kateřina Šafránková, mit ihrem Sohn Vojtek – beide Mitglieder des Teplitzer Vereins und Mitarbeiter der Redaktion der „Erzgebirgs-Zeitung“ – hatte die Kirche für den Konzertabend vorbereitet. Ein Streichquartett der Nordböhmischen Philharmonie Teplitz spielte bekannte Werke unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und Antonín Dvořák. Erhard Spacek hatte einleitend Begrüßungsworte für die Anwesenden gefunden, und das Konzert war für alle ein angenehmer Abschluß der kulturellen Erlebnisse unseres Treffens. Mit einem deftigen Abendessen in der Gaststätte U veselýho mandlu/Zur lustigen Mandel, wobei wir auf der Terrasse recht eng zusammengerückt waren, fanden diese Teplitzer Tage ihren freudigen Ausklang.
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
14 Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023
� Teplitz-Schönau
Der Teplitz-Schönauer Heimat- und Freundeskreis.
Bilder (6): Heidelinde Obermann
Ein Streichquartett der Nordböhmischen Philharmonie Teplitz konzertiert in der Schönauer Sankt-Elisabeth-Kirche.
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ
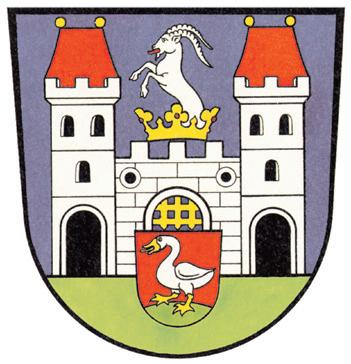
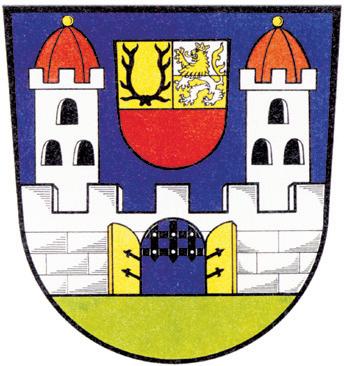

Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

❯
31. Equipe-Wanderung


Bei Kaiserwetter auf den Spuren der Krals
Rund 150 Leute waren Mitte September bei Kaiserwetter zur 31. Equipe-Wanderung des Freundeskreises deutsch-tschechischer Verständigung gekommen. Karl Reitmeier berichtet.
Die Wanderer wollten auf den Spuren des Ehepaars Kral wandeln, das in der Further Kreuzkirche Zum Heiland auf der Rast um einen Stammhalter gebetet hatte. Diesen Bittgang beschreibt der chodische Schriftsteller Jindřich Šimon Baar sehr detailliert in seinem Roman „Lůsy“. Unter dem Motto „Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft“ waren die Wanderer in Klentsch gestartet und absolvierten dann 18 Kilometer durch eine traumhafte Landschaft. Auf dem Oskar-Kögler-Rastplatz auf etwa halber Strecke war einmal mehr für beste Bewirtung der Wanderer gesorgt, und dort spielte auch die Kapelle „Chodovanka“ beschwingt auf. Dort wurde auch eine Gedenkminute für Franz Turner eingelegt, der die Equipe-Wanderung jahrelang begleitet und auch immer unterstützt hatte.

Organisator Jürgen Kögler strahlte über das ganze Gesicht,
als er den vollbesetzten Bus sah, der sich vom Further Stadtplatz auf den Weg zum Friedhof in Klentsch machte. Schon im Bus verwies er ausführlich auf die Geschichte der Equipe-Wanderung, die sein Vater mit tschechischen Freunden ins Leben gerufen hatte. Nicht unerwähnt ließ er die zahlreichen Unterstützer in all den Jahren.


„Ich bin happy, ich bin glücklich“, sagte Jürgen Kögler angesichts der großen Teilnehmerschar bei der Begrüßung vor dem Friedhof in Klentsch. Sein besonderer Dank richtete sich an den Further Waldverein, die Natur-Freunde, den Touristikclub Taus, die Abordnung des Lionsclubs Pilsen und die starke Delegation des JindřichŠimon-Baar-Gymnasiums in Taus, die sogar eine junge Chodengruppe mitgebracht hatte, die ebenso für Musik und Gesang sorgte wie der Männergesangsverein „Haltravan“. Der Dank Köglers richtete sich insbesondere an den ehemaligen Leiter der Städtischen Wälder Taus, Jan Benda, für die jahrelange Unterstützung.

Bürgermeister Jan Bozděch hieß die Teilnehmer herzlich willkommen und wies darauf hin, daß er als Fünfjähriger mit seiner Mutter bei der ersten Veranstaltung am Friedhof in Klentsch

Baars (1869–1925), des größten Schriftstellers jener Zeit, trage. Erfreut war sie darüber, daß das Jindřich-Šimon-Baar-Museum einer Renovierung unterzogen werde.
Waldvereins, Marianne Linsmeier, zeigte sich sehr erfreut über die gute Beteiligung. Ihr Dank richtete sich an den Schriftsteller Jindřich Šimon Baar, der die Geschichte über den Bittgang des Ehepaars Kral geschrieben habe. Ihr Wunsch war es, daß die guten Verbindungen zwischen Tschechen und Bayern auch in der Zukunft so blieben. Anschließend legten Bürgermeister Jan Bozděch, Direktorin Jana Štenglová, KČTVorsitzender Petr Matějka und Marianne Linsmeier Blumengebinde am Grab von Jindřich Šimon Baar nieder.
Danach brachen die Wanderer auf und zeigten sich begeistert von der herrlichen Landschaft. Die 18 Kilometer lange Strecke führte über Chodau und Hochofen zunächst zum Oskar-Kögler-Rastplatz, wo Ingrid Heiduk zusammen mit ihrer Tochter Stefanie die Wanderer mit leckeren Aufstrichbroten versorgte.
„Žádnej neví, co jsou Domažlice“ (Niemand weiß, was Taus ist) gesungen, was eine Premiere bedeutete. Kögler versäumte es nicht, dort auch eine Gedenkminute für Franz Thurner einzulegen, um damit zu signalisieren, daß er unvergessen bleibe.

Über den Grenzübergang Hochstraße kamen die Wanderer wieder auf die bayerische Seite, wobei einige dankbar die Gelegenheit zur Einkehr bei Xaver und Maria Baumann direkt an der Grenze annahmen. Anschließend wurde Furth im Wald erreicht, wo in der Pfarrkirche noch ein Gottesdienst mit dem neuen Pfarrvikar Thomas K. Samuel gefeiert wurde.
gestanden sei. Die Direktorin des Gymnasiums in Taus, Jana Štenglová, bemerkte, daß das Gymnasium stolz und bewußt den Namen Jindřich Šimon
Der Vorsitzende des Touristikclubs Taus, Petr Matějka, hieß die Teilnehmer ebenfalls willkommen und wünschte eine schöne Wanderung. Die Vorsitzende des
Die Familie Anderle zeichnete für den Getränkeverkauf verantwortlich. Dort spielte auch die Kapelle „Chodovanka“ wie immer beschwingt auf, und es wurde sogar gemeinsam das Lied
Zum Abschluß war noch ein geselliges Beisammensein im Hotel Zur Post am Further Stadtplatz angesagt, wo alle bestens bewirtet wurden. Dort hielt Bohumil Řeřicha vom Freundeskreis deutsch-tschechischer Verständigung noch eine bemerkenswerte Rede, die letztlich darin gipfelte, daß er sich für die Ungerechtigkeit der Vertreibung entschuldigte. Řeřicha: „Ich habe die Mitschuld als Bürger der Nation, die in der Vergangenheit versagte.“
Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 15
HEIMATBOTE
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Am Grab von Jindřich Šimon Baar auf dem Friedhof in Klentsch.
Stefanie und Ingrid Heiduk versorgen die Wanderer mit belegten Broten. Rast auf den Bänken am Oskar-Kögler-Platz.
Bei der Begrüßung am Klentscher Friedhof.
Bilder: Karl Reitmeier
Bohumil Řeřicha und Pfarrvikar Thomas K. Samuel.
Der Männergesangsverein „Haltravan“.
Die Chodengruppe „Chodovanka“ mit Jürgen Kögler. Junge Chodenmusiker und eine Büste von Jindřich Šimon Baar.
Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon

@online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09
kreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Schossenreith Schweigh, Schnatterl
Folgendes Ereignis trug sich zu deutscher Zeit in der Sankt-Anna-Kirche in Schossenreith zu.


� 33. Heimatkreistreffen – Teil II
Messe in Sankt-Wenzels-Kirche
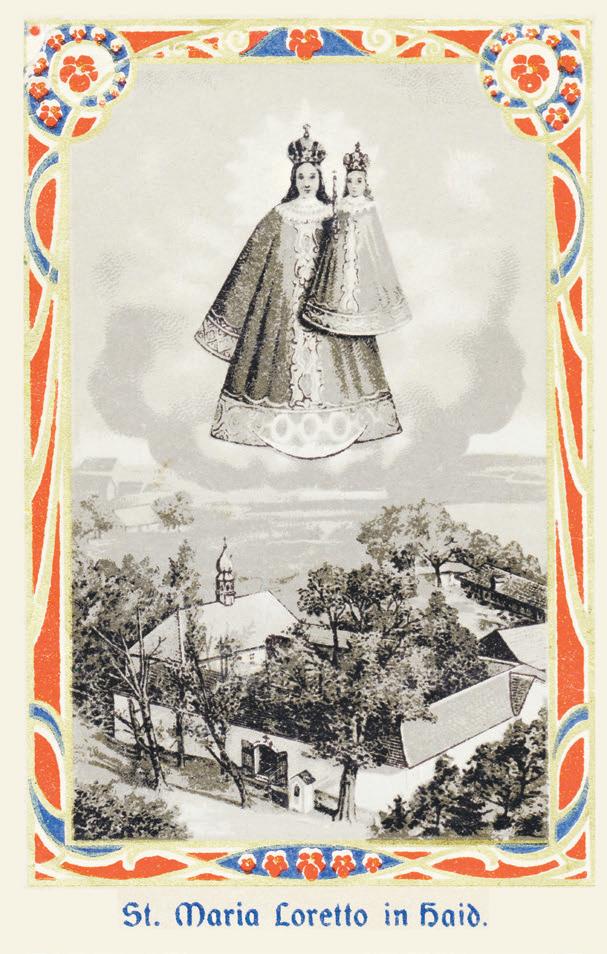
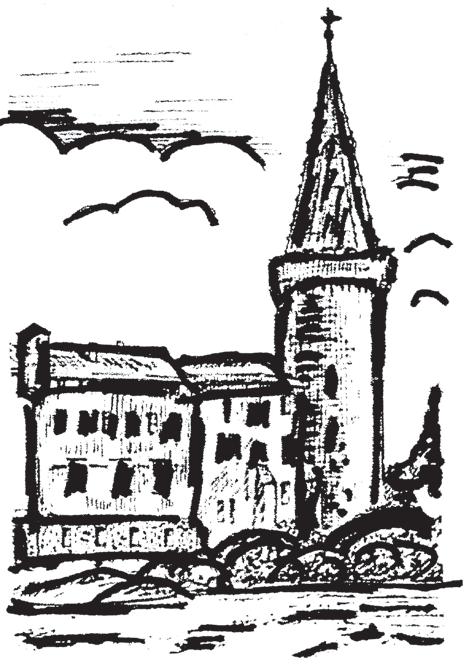
Anfang September fand das zweitägige 33. Heimatkreistreffen der Tachauer statt. Am ersten Tag stand eine Busfahrt in den ehemaligen Kreis Tachau auf dem Programm. Ziele waren die Orte Haid, Kladrau, Tachau und Roßhaupt, in denen Zeichen einer neuen Entwicklung in der tschechisch-sudetendeutschen Annäherung spürbar waren. Heimatkreisbetreuer WolfDieter Hamperl berichtet in mehreren Teilen. Hier der zweite Teil.
Auf der Fahrt von Tachau nach Roßhaupt wählen wir den Weg über Labant zu dem verschwundenen Dorf Wusleben. An der schmalen Straße nach Hesselsdorf finden wir die Reste des Ortes in einem Wald aus alten Kastanienbäumen und hohen Sträuchern. Auf den ehemaligen Ort weist ein grünes Ortsschild hin mit der Aufschrift „Zaniklá Ves – Untergegangenes Dorf. Bohuslav. Wusleben“. Endlich finden wir auf einem Schild den deutschen und den tschechischen Namen des Ortes. Darum bitten wir Sudetendeutsche seit Jahrzehnten. Ein tschechischer Verein in Tachau stelle diese Schilder auf, so die Auskunft des Tachauer Bezirksarchivs.

Wir halten an einer Bucht, steigen aus, gehen auf einer Brücke über einen Bach und erreichen einen Platz, an dem Wanderer rasten können. Das von František Sokoup aus Tachau vor Jahren
wieder aufgestellte Marterl des heiligen Georg sehen wir zum ersten Mal. Weiter hinten blikken wir in einen alten Keller eines verschwundenen Hauses. Hier stand wohl die Pfarrkirche. Der Ort Wusleben erscheint 1352 erstmals als Bohuslaus in einer Urkunde. Fast 600 Jahre lang bestand der Ort, bis ihn Panzergeschosse zerstörten. Wir fahren weiter auf die freie Höhe mit den zerzausten Bäumen am Straßenrand, 640 Meter hoch liegen die Felder. Der Lehrer und Heilpraktiker Georg Magerl aus Waidhaus stellte die Marterln am Straßenrand wieder auf. Er war es auch, der in der Hesselsdorfer Kirche zu Weihnachten die Orgel spielte und deutsche Weihnachtslieder sang. An dieses Unikum, das auf dem Waidhauser Friedhof beerdigt ist, erinnern wir uns gerne.

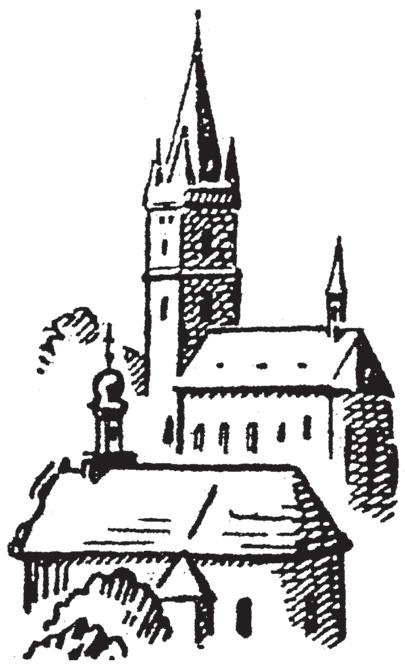
Schließlich führt uns die neue Reichsstraße nach Roßhaupt. Dort empfangen uns viele Waidhauser vor und in der ehemaligen Pfarrkirche Sankt Wenzel. Auch
Bürgermeister Markus Bauriedl ist da. Und viele Gläubig besuchen den Gottesdienst, weil der über lange Jahre in Waidhaus tä-
tige Pfarrer Georg Hartl die Messe hätte feiern sollen. Doch leider verhindert dies eine vorübergehende Kreislaufschwäche. Würdig vertritt ihn Gerhard Schmidt, Pfarrer in Roggenstein.
sieht, organisierte gemeinsam mit Pfarrer Georg Hartl und der Waidhauser Mesnerin Anna Hartung den Gottesdienst. Denn der ehemalige Kirchenraum verfügt über keinen Altar. Die Waidhauser Josef Kleber, Wilhelm Kirchberger und Siegfried Zeug brachten deshalb den Altartisch und den Ambo hierher und schmückten alles festlich. Die Kirche ist nun mit mehr als 70 Gläubigen, Waidhausern und Tachauern, gut gefüllt.




der Messe singen alle mit lauter Stimme das Böhmerwald-Lied.
Besonders freut mich, daß auch einige tschechische Bürger gekommen sind. Das wollen wir bei den nächsten Heimattreffen intensivieren, da ja Waidhaus und Rozvadov/Roßhaupt eine europäische Partnerschaft verbindet. Besonders aufgefallen ist das sehr schön renovierte Hochaltarbild der ehemaligen Roßhaupter Pfarrkirche, das über Jahrzehnte an der Rückwand der Kirche in Sankt Katharina lehnte.
An einem Vormittag betrat eine Frau die menschenleere Dorfkirche und steuerte auf das Gnadenbild der heiligen Anna mit ihrem Kind Maria zu. Der zufällig in der Kirche anwesende Mesner sah die Frau, die für ihre scharfe Zunge berüchtigt war, kommen und trat hinter den Altar. Mit lauter Stimme – es war ja niemand da – klagte sie Mutter Anna ihr Leid und bat um gnädigen Beistand. Das Getue ärgerte den Mesner, und er erteilte mit verstellter Stimme eine Mahnung. Erbost über diese Einmischung – sie suchte hinter der hohen Stimme die Stimme des Kindes Maria –, sagte sie: „Schweigh, Schnatterl, mit dia howe necks gredt, låo da Mutta riadn.“
TERMINE
Der Ehemann der Ortsbetreuerin von Roßhaupt, Heribert Kett, der Kirchenmusiker war und noch mit fast 80 Jahren den Chor- und Musikdienst in der Pfarrkirche in Roggenstein ver-
Der Pfarrer Gerhard Schmidt begrüßt die Gemeinde, Heribert Kett und sein Trompeter Wilhelm Kirchberger sorgen für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung, so daß wir mit lauter Stimme die Lieder der vertrauten Deutschen Messe von Franz Schubert singen können. Pfarrer Gerhard Schmidt bindet immer wieder die Kinder der Vertriebenen in seine Gebete ein und erinnerte auch an die verstorbenen Eltern. Am Schluß
Die Gemeinde Roßhaupt ließ es in Prag restaurieren und im Chorraum aufstellen. Es stellt den heiligen Wenzel dar, einen der Nationalheiligen Böhmens, der am 28. September sein Fest hat. Auf dem Ölbild von Karel Škréta ist die Kirche von Roßhaupt auf der linken unteren Bildseite dargestellt. Der dargestellte Kirchturm wurde aber nicht realisiert.
Den Abend beschließen wir im Gasthof Römmererhäusl in Oberströbl. Der Ströbl liegt unmittelbar am Grenzbach, dem Rehlingbach, und diente 1946 vielen als Fluchtort in die Freiheit.
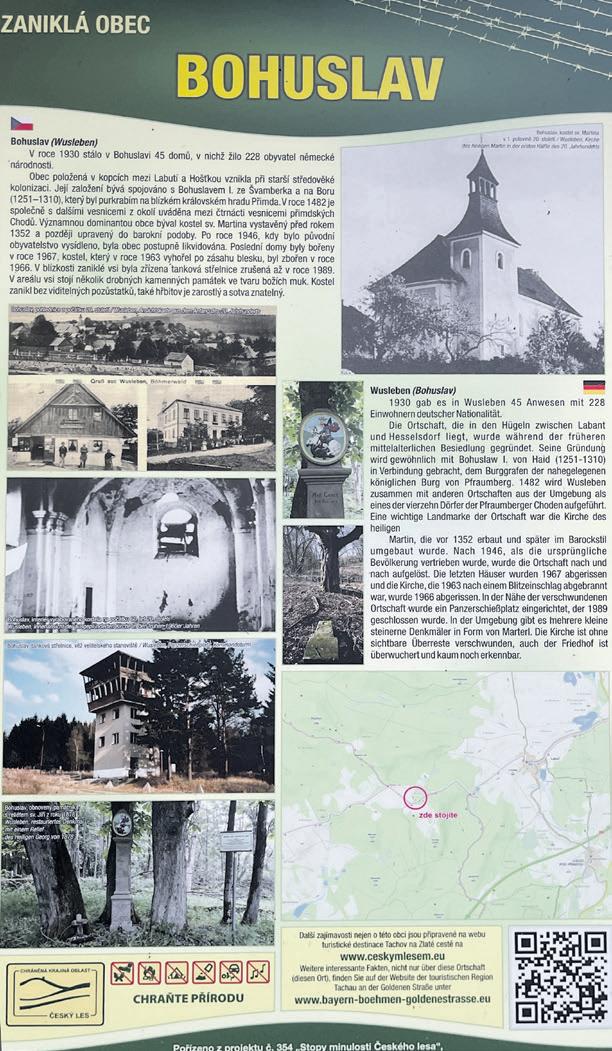
Fortsetzung folgt
n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
Ortsbetreuerecke
H
erzlich gratulieren wir im September Stefan Riederle, Ortsbetreuer von Altsattel, am 8. zum 61. und Ernst Adler, Ortsbetreuer von Drißgloben, am 17. zum 91. Geburtstag Wir wünschen weiterhin alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, und danken für die geleistete Arbeit für unsere Heimat. Sieglinde Wolf

Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 16
(0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl
41
Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de.
61) 81
02,
Spendenkonto: Heimat-
Josef Kleber, Sprecher des Pfarrgemeinderates in Waidhaus, Monika Krug, Haushälterin von Pfarrer Schmidt, Gerhard Schmidt, Pfarrer von Roggenstein, Markus Bauriedl, Bürgermeister von Waidhaus, Trompeter Wilhelm Kirchberger, Organist Heribert Kett, Hans Seidel, Stellvertretender Ortsbetreuer von Labant, Heimatkreisbetreuer Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Pfarrer Klaus Oehrlein und Margit Reichenberger.
Bilder: Karin Wilck (3), Siegfried Zeug (5)
Pfarrer Gerhard Schmidt zelebriert vor dem restaurierten Altarbild.
Die Spitze des wieder aufgestellten Sankt-GeorgsMarterls.
Ludmilla Himmel, Ortsbetreuerin von Schönbrunn, und Heimatkreisbetreuer Dr. Wolf-Dieter Hamperl vor dem zweisprachigen Ortsschild.
Zweisprachige Informationstafel
über Wusleben.
Die Roßhaupter Sankt-Wenzel-Kirche strahlt – ohne Turm – im Sonnenschein. Oben die im Altarbild gemalte Kirche mit Turm.