Prof. Carsten Gansel über Otfried Preußler und dessen Trauma (S. 8)
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung
HEIMATBOTE
Jahrgang 75 | Folge 40 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 6. Oktober 2023
VOLKSBOTE
HEIMATAUSGABEN IN DIESER ZEITUNG
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
VOLKSBOTE
Zeitung
Zeitung



HEIMATBOTE
HEIMATBOTE




Neudeker Heimatbrief
Heimatbrief

VOLKSBOTE
❯ Tschechien erstmals dabei
Gastland der Frankfurter
Buchmesse
Tschechien wird Gastland der 78. Frankfurter Buchmesse, die vom 7. bis 11. Oktober 2026 stattfindet. Bei einem Festakt in Prag haben am Montag Buchmesse-Direktor Juergen Boos und Tschechiens Kulturminister
Martin Baxa den offiziellen Ehrengast-Vertrag unterzeichnet.
Er freue sich, so der Direktor der Frankfurter Buchmesse, vor allem über das humorvolle Motto „Czechia – a country on the coast“. „Das ist eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage. Das fällt auf, das regt unsere Fantasie an – weit über das literarische Motiv von Böhmen am Meer hinaus“, sagte Boos auf der Pressekonferenz.
Kulturminister Martin Baxa sagte: „Die Präsentation der Tschechischen Republik auf dieser Messe ist eine großartige Chance für die tschechische Buchbranche und den gesamten Kultursektor. Es handelt sich nicht nur um eine Chance, der Welt die hohe Qualität der tschechischen Literatur zu präsentieren, sondern auch um eine Investition in die Zukunft.
Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die vom 18. bis 22. Oktober stattfindet, wird Tschechien mit 23 Verlagen und einem eigenen Programm vertreten sein.
VOLKSBOTE
VOLKSBOTE


❯ Der staatliche Energiekonzern ČEZ will noch in diesem Jahr das Genehmigungsverfahren einleiten
Größtes Vorkommen in Europa –Region Aussig im Lithium-Rausch
Es ist der Rohstoff der Energiewende. In Böhmisch Zinnwald in der Region Aussig, unmittelbar an der Grenze zu Sachsen, lagern große Mengen an Lithium im Erdreich. Geologen gehen davon aus, daß sich hier im Erzgebirge drei bis fünf Prozent des weltweiten Lithiumaufkommens befinden. Dies wäre gleichzeitig das größte Vorkommen in Europa.


Lithium ist ein Schlüsselrohstoff für die Elektromobilität, insbesondere für Batteriespeicher. Deshalb arbeiten wir daran, sobald wie möglich mit dem Abbau zu beginnen, idealerweise bereits im Jahr 2026“, erklärte Premierminister Petr Fiala, der jetzt die Region bei Aussig besuchte, um das Projekt voranzubringen. In seiner Vision für die Entwicklung der Tschechischen Republik in den kommenden dreißig Jahren, die der Regierungschef Anfang September vorgestellt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), ist Lithium eine der sechs strategischen Säulen.
Die Zahlen sind in der Tat gigantisch und wecken große Hoffnungen für einen massiven Wirtschaftsaufschwung in der seit der Vertreibung strukturschwachen Region. Das seit den 1990er Jahren sich abzeichnende Ende des Braunkohle-Abbaus, der Tausenden von Menschen vor Ort Arbeit gab, hat ebenfalls dazu geführt, daß die Region Aussig mittlerweile zu den ärmsten Gegenden in der Tschechischen Republik gehört. Hinzu kommt, daß der Tagebau tiefe Wunden
in die Landschaften geschlagen und mehr als 100 Siedlungen verschlungen hat.
Laut einer Machbarkeitsstudie halten die Experten eine jährliche Fördermenge von 2,25 Millionen Tonnen Erz für realistisch.
Daraus könnten knapp 30 000
Tonnen Lithiumhydroxid gewonnen werden, was ausreicht, um jährlich fast eine Million Lithium-Batterien für Autos herzustellen.
In Böhmisch Zinnwald wird bereits seit dem 13. Jahrhundert Erz abgebaut, insbesondere, wie der Name vermuten läßt, Zinn sowie Wolfram. Ab den 2010er
Jahren wurde bei Bohrungen auch Lithium auf beiden Seiten der Grenze entdeckt, dessen Abbau auf Grund des zunehmenden Bedarfs und der steigenden Preise wirtschaftlich immer interessanter wird. Mit dem Nachbarn Sachsen hat Tschechien deshalb bereits einen Vertrag zum gemeinsamen Abbau geschlossen.

Mit dem Abbau könnten nicht nur Tausende neue Arbeitsplätze im Bergbau entstehen, sondern viele weitere in der geplanten Gigafactory. „Wir können die gesamte Kette vom Abbau, der Verarbeitung, der Batterieproduktion, der Chip-Produktion bis zur
Endproduktion von Autos abdekken“, sagte Fiala. Der LithiumAbbau, so die Prognose, könnte sich somit zum wirtschaftlichen Motor nicht nur für die gesamte Region, sondern für das ganze Land entwickeln.
In der Region Aussig traf sich Fiala deshalb mit Lokalpolitikern, um für das Projekt zu werben. Die Unterstützung ist allerdings kein Automatismus. So äußerte sich Landrat Jan Schiller von der oppositionellen Ano-Partei nach dem Treffen verhalten:
„Ich sehe den Lithium-Abbau als Chance, aber vieles hängt von den Rahmenbedingungen ab.
Wir haben die Folgen des Kohle-Abbaus in der Region noch in lebhafter Erinnerung. Jegliche Beeinträchtigung und Verschlechterung der Lebensbedingungen muß auch den Gemeinden gegenüber angemessen entschädigt werden.“
Bei ersten öffentlichen Informationsveranstaltungen wurde bereits deutlich, daß die Bürger vor allem Angst vor einer zunehmenden Luftverschmutzung und einem Absinken des Grundwasserspiegels haben und dabei auf die Erfahrungen in Südamerika verweisen. Dort, im sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Chile und Argentinien, wo etwa 70 Prozent der weltweiten Lithium-Reserven liegen, sank der Grundwasserspiegel durch das Abpumpen der lithiumhaltigen Sole teils stark. Durch den vielfach unverantwortlichen Umgang der Abbauunternehmen wurden zudem Luft, Wasser und Boden kontaminiert. Im Erzgebirge würde Lithium aus Festgestein gewonnen werden. Auch diese Fördermethode gilt als wasserintensiv – und ist deutlich energieaufwendiger und teurer als der Abbau aus Sole. Dennoch soll nach Angaben des Energiekonzerns ČEZ das Genehmigungsverfahren für den Lithium-Abbau noch in diesem Jahr eingeleitet werden. Das Unternehmen scheint dabei wenig Zweifel an dem Ausgang des Verfahrens zu haben: Es hat bereits ein Grundstück für eine Lithium-Aufbereitungsanlage gekauft, für eine Milliarde Tschechische Kronen – rund 40,8 Millionen Euro.
Torsten Fricke❯ Offizieller Besuch der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Prag


Unterstützung für Tschechiens Atomkurs
„Wir wissen, daß die Kernenergie im tschechischen Energiesystem eine zentrale Rolle spielt und daß weitere Investitionen in diesen Sektor notwendig sein werden, damit er seinen Beitrag zur Energiewende in Tschechien leisten kann“, hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bei ihrem Besuch in Prag erklärt.
Von der Leyen verwies dabei auf die Netto-Null-Industrie-
Verordnung, die eine Förderung der Spitzentechnologie im Kernenergiebereich vorsieht. „Wir wollen die Investitionstätigkeit ankurbeln und die grenzübergreifende Zusammenarbeit ausbauen.“
Bei ihrem Treffen in Prag sagte sie Premierminister Petr Fiala außerdem zu, daß Tschechien für seine Energiestrategie im Rahmen des Programms REPowerEU, mit dem die Europäische Union unabhängig von rus-
sischen Öl- und Gaslieferungen werden will, 2,2 Milliarden Euro an zusätzlichen Finanzmitteln erhält. Dabei betonte die Präsidentin der Europäischen Kommission, es bleibe das Vorrecht der Mitgliedstaaten, den nationalen Energiemix selbst festzulegen.
Fiala hatte bei dem Treffen erneut deutlich gemacht, daß Tschechien weiterhin auf die Kernkraft als CO2-neutrale Energiequelle setze, und von der Leyen über den geplanten Bau wei-
terer Reaktorblöcke informiert. Ein weiterer Gesprächspunkt war die illegale Migration. „Ein besserer Schutz der EUAußengrenzen und eine Verringerung der Zahl der ankommenden Wirtschaftsflüchtlinge ist für die Tschechische Republik absolut entscheidend“, sagte Fiala nach dem Treffen und betonte, daß Tschechien „jede Form der Zwangsumverteilung illegaler Migranten innerhalb der EU“ ablehne.
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Am 20. September fand in der Bayerischen Repräsentanz eine Lesung aus dem letzten Roman von Peter Becher mit dem Titel „Unter dem steinernen Meer“ statt. In diesem Werk versucht Becher, sich mit der schwierigen Geschichte des (sudeten) deutsch-tschechischen Zusammenlebens auseinander zu setzten.
Da es darin inhaltlich meistens um die südböhmische Metropole Budweis geht, trat als Gast der ehemalige tschechische Kulturminister Daniel Herman (KDU-ČSL) auf. SL-Büro-
leiter Peter Barton erinnerte in seinem Grußwort an die beru iche Laufbahn Bechers, die thematisch immer die Problematik der böhmischen Länder beinhaltet. Seit seiner Tätigkeit im Sudetendeutschen Haus, ab Mitte der achtziger Jahre, fand Barton in Becher immer einen aufmerksamen Mitstreiter für die Verständigung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. Nach der Begrüßung von Florian Winzen, dem Leiter der Bayerischen Repräsentanz, folgte die Lesung, die vom Übersetzer, Germanisten und Literaturhistoriker Václav Maidl kommentiert wurde. Der volle Saal die-
ses Hauses bestätigte den Erfolg der Veranstaltung, und Becher beendete an diesem würdigen Ort seine
Prag-Reise, die wie immer von der Liebe zur Heimat seiner Vorfahren geprägt ist.
❯ Regierung Fiala hat den Kauf von 24 Überschall-Mehrzweckkamp ugzeugen des Typs F-35 beschlossen
Tschechien rüstet massiv auf
Als Antwort auf die russische Bedrohung verstärkt Tschechien massiv die Landes- und Bündnisverteidigung. Die Regierung von Premierminister Petr Fiala hat jetzt beschlossen, 24 Überschall- und Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeuge der fünften Generation des Typs F-35 vom amerikanischen Rüstungsunternehmen Lockheed Martin für fünf Milliarden US-Dollar zu kaufen. Mit weiteren Kosten, wie dem Ausbau des Militärflughafens bei Tschaslau, investiert Tschechien bis 2034 rund sechseinhalb Milliarden Dollar in die Luftverteidigung – knapp 2,5 Prozent des Jahresbruttoinlandsproduktes.
Nach der Entscheidung der Regierung informierte Premierminister Petr Fiala die Öffentlichkeit über die weiteren Schritte: „Die ersten F-35 werden 2029 für die Ausbildung unserer Piloten in den USA zur Verfügung stehen. Ab 2031 werden dann die ersten Maschinen in Tschechien bereitstehen. Bis 2035 werden wir über alle 24 Flugzeuge verfügen.“ Die F-35 werde mehr und mehr zum Standard innerhalb der Nato, begründete Fiala, warum sich Tschechien für das USSystem entschieden hat. Auch die deutsche Luftwaffe hatte bereits verkündet, die alten Tornados durch 35 hochmoderne F-35 zu ersetzen. Dabei beginnt die Bundeswehr bereits 2026 mit der Pilotenausbildung. Und ab 2027 sollen die Maschinen auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert werden, um, so die Bundeswehr, „die nukleare Teilhabe zu ermöglichen“, also im Verteidigungsfall mit Atombomben antworten zu können.

Tschechiens Verteidigungsministerin Jana Černochová erklärte, daß die Einführung der F-35 weniger als siebeneinhalb
Prozent der geplanten Verteidigungsausgaben ausmachen werde. „Dadurch kann ich garantieren, daß die anderen Modernisierungsprojekte der tschechischen
Armee, insbesondere die Moder-
nisierung der schweren mechanisierten Brigade, durch dieses Projekt nicht gefährdet werden.“ Auf der Pressekonferenz
daten getroffen habe. „Die Maschinen der fünften Generation sind die einzigen, die auf den Schlachtfeldern der Zukunft be-
Regierung verringert Defizit im Haushalt
Die tschechische Regierung hat ihren Entwurf für den Staatshaushalt 2024 dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Demnach werden Einnahmen von 1,94 Billionen Kronen (79 Milliarden Euro) erwartet, denen Ausgaben von 2,19 Billionen Kronen (90 Milliarden Euro) gegenüberstehen. Das geplante Defizit beträgt 252 Milliarden Kronen (10,3 Milliarden Euro) und liegt 43 Milliarden Kronen (1,8 Milliarden Euro) unter dem genehmigten Defizit für das Jahr 2023. Dadurch würde sich das Defizit von 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 2023 auf 2,2 Prozent verringern. Die Abgeordneten beraten ab Ende Oktober über den Etatentwurf, der noch bis Jahresende verabschiedet werden muß.
Wirtschaft: Noch
keine Erholung
Die Konjunktur in Tschechien stagniert, hat das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) gemeldet. Im Vergleich vom ersten zum zweiten Quartal gab es demnach kein Wachstum. Im Jahresvergleich verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sogar ein Minus von 0,6 Prozent. Die Wirtschaftsdaten liegen damit unter den Erwartungen der Wirtschaftsexperten, die noch Ende August von einer Erholung ausgegangen waren. Eine leichte Belebung wird jetzt für das zweite Halbjahr 2023 erwartet, berichtet die Presseagentur ČTK.
Anschlag: Spur führt zu Putins Bodyguard
stes GRU an dem Anschlag hatte der damalige tschechische Premierminister Andrej Babiš (Ano) bereits im April 2021 die Öffentlichkeit informiert. Die Beraterin des Chefs des ukrainischen Ermittlungsamtes SBI, Tetjana Sapjanowa, erläuterte jetzt auf Ukrinform, daß mehrere Angehörige russischer Geheimdienste im Visier stünden. Darunter sei auch der ehemalige Bodyguard des russischen Präsidenten Putin, Alexej Djumin, der 2013 bis 2015 als GRU-Agent Spezialoperationen geleitet hatte. Besucherrekord beim Klassikfestival
Mit einem Konzert der Prager Rundfunksymphoniker ist das 16. Klassikfestival Dvořákova Praha (Dvořáks Prag) zu Ende gegangen. Nach Veranstalterangaben wurde mit 17 000 Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt. Im nächsten Jahr findet das Festival vom 6. bis 24. September statt.
Auch Prag feiert Maria Callas
Die Welttournee mit einem Konzertprojekt zum 100. Geburtstag von Maria Callas (2. Dezember 1923–16. September 1977) wird auch in Prag Station machen. Am 1. November wird „Callas 100“ im SmetanaSaal des Gemeindehauses aufgeführt. Bei der Mischung aus Theateraufführung und Konzert wird die Prager Kammerphilharmonie von dem Italiener Oleg Caetani dirigiert. Zudem treten der tschechische Sänger Vojtěch Dyk, die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak, der italienische Tenor Marco Berti und die ungarische Mezzosopranistin Andrea Edina Ulbrich auf.
Auf einer Pressekonferenz erläuterten Verteidigungsministerin Jana Černochová, Premierminister Petr Fiala und Generalstabschef Generalleutnant Karel Rehka, die Entscheidung für den Kauf von 24 Kamp ets vom Typ F-35.

sprach auch der Generalstabschef der tschechischen Armee, Generalleutnant Karel Rehka, der der Regierung dafür dankte, daß sie ihre Entscheidung auf Empfehlung der Sol-
stehen können und die auch garantieren werden, daß wir uns gemeinsam mit unseren Verbündeten wirksam gegen äußere Aggressionen verteidigen können, wenn es nötig ist.“ An-
schließend erläuterte Tschechiens höchster General die Einzigartigkeit des überschallfliegenden Mehrzweckkampfjets. „Die Hauptmerkmale der F-35 sind eine Kombination aus minimaler Sichtbarkeit für Radare und der Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu sammeln, zu verarbeiten und weiterzugeben.“
Mit Blick auf die Nato-Partner sagte der Generalstabschef: „Wir sprechen insgesamt von mehr als sechshundert Flugzeugen, und das ist bereits eine Streitkraft mit erheblichem Abschreckungspotenzial, die einen potentiellen Gegner von einem Angriff auf uns abhalten kann. Wenn unser Heimatland angegriffen wird, werden wir nicht in der Lage sein, uns auf unserem eigenen Territorium zu verteidigen. Um Tschechien und das gesamte Bündnis wirksam zu verteidigen, müssen wir in der Lage sein, auf dem Territorium des Gegners zu operieren. Und das geht am besten mit den Flugzeugen der fünften Generation.“
Torsten Fricke❯ Ano-Partei von Ex-Premierminister Andrej Babiš wäre laut einer aktuellen Umfrage mit 30,8 Prozent klarer Wahlsieger
Regierung ohne eigene Mehrheit
Laut einer aktuellen Umfrage liegt die Ano-Partei von Ex-Premierminister Andrej Babiš mit deutlichem Vorsprung vor den anderen Parteien. Die Regierung von Premierminister Petr Fiala hätte demnach keine eigene Mehrheit mehr. Allerdings:
Die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus finden erst im Herbst 2025 statt.
Mit 30,8 Prozent der Stimmen wäre Ano der klare Wahlsieger. Fialas ODS käme mit 13,1 Prozent auf Platz zwei, dicht gefolgt von der rechtsradikalen SPD mit 10,9 Prozent. Die Piraten kämen auf 9,6 Prozent,
Führt in den Umfragen: ExPremierminister und Ano-Chef Andrej Babiš.

Top 09 auf 5,4 Prozent, Stan auf 5,3 Prozent und KDU-ČSL auf 5 Prozent.
„Die tschechische Politik wird von Ano dominiert. Die Partei bleibt unangefochten an der Spitze der Oppositionsstimmen und verfügt
über eine sozial breit gefächerte Wählerschaft“, hat das Prager Meinungsforschungsinstitut
Stem seine Umfrage kommentiert. Sollten alle fünf Koalitionsparteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, wäre das Bündnis von Premierminister Petr Fiala aus ODS, Piraten, Top 09, Stan und KDUČSL mit insgesamt 38,4 Prozent zwar der stärkste Block im Abgeordnetenhaus, aber ohne eigene Mehrheit.
Bei den Wahlen im Herbst 2021 war das Bündnis Spolu aus ODS, KDU-ČSL und Top 09 mit 27,8 Prozent noch als Sieger hervorgegangen. Ano kam mit 27,1 Prozent knapp dahinter nur auf Platz zwei.
Die Fünferkoalition aus Spo-


lu sowie Piraten und Stan, die gemeinsam 15,6 Prozent erzielten, erreichte mit 108 von 200 Sitzen eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus.
In der Kritik steht die aktuelle Regierung insbesondere wegen ihres Sparpakets. So wurde die Mehrwertsteuer für einige Produkte erhöht, und die Renten steigen weniger stark als geplant.
In einer Fernsehdiskussion verteidigte Verkehrsminister Martin Kupka von der ODS den Regierungskurs und sagte: „Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Schritte überzeugender zu erklären.“ Torsten Fricke
Ukrainische Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben Beweise, daß hinter dem Bombenanschlag auf ein Munitionslager in Mähren russische Geheimdienste stecken. In einem Bericht der Agentur Ukrinform, die sich auf ukrainische Ermittler sowie den dortigen Sicherheitsdienst SBU beruft, heißt es, die verdächtigen russischen Agenten seien auch für die Explosion eines Waffenlagers in der ukrainischen Stadt Swatowe im Oktober 2015 verantwortlich. Über die vermutliche Beteiligung des russischen Militärgeheimdien-
Winzer erwarten
guten Jahrgang
Zehn bis zwanzig Prozent weniger Ernte, aber eine bessere Qualität der Trauben, so lautet das vorläufige Fazit der südmährischen Winzer. Demnach kommen die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen vor allem den roten Trauben zugute. Die weißen Sorten hingegen müßten nun schnell abgeerntet werden, damit die nötige Säure erhalten bleibe.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Prag sucht einen neuen Draht nach Preßburg

„Mit der Slowakei verbinden uns nicht nur tiefe historische Bindungen und Nähe, sondern auch freundschaftliche Beziehungen auf allen Ebenen. Ich habe die Ergebnisse der slowakischen Wahlen verfolgt und wünsche den Slowaken, daß die Verhandlungen nach den Wahlen zur Bildung einer guten Regierung führen. Ich glaube, daß wir zum Wohle unserer beiden Länder weiterhin eng auf Regierungsebene zusammenarbeiten werden“, hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala auf Twitter das Wahlergebnis kommentiert – und mit keinem Wort den Wahlsieger Robert Fico erwähnt.


Anders Ex-Premiermister und Ano-Chef Andrej Babiš. Der gebürtige Slowake twitterte am Sonntag: „Guten Morgen, Slowakei. Herzlichen Glückwunsch an Robert Fico zum Wahlsieg! Ich gratuliere auch Peter Pellegrini zu dem hervorragenden Ergebnis und wünsche der gesamten Slowakei eine Regierung, die sich für ein besseres Leben der Menschen zu Hause einsetzt und die Interessen aller slowakischen Bürger in Europa energisch vertritt.“
Robert Fico hatte mit seiner neuen Partei Smer (Richtung) die Wahl knapp mit 22,94 Prozent gewonnen und ist mittlerweile von Präsidentin Zuzana Caputova beauftragt worden, eine Regierung zu bilden. Der Sozialdemokrat war bereits von 2006 bis 2010, von 2012 bis 2016 und von 2016 bis 2018 Premierminister und stürzte anschließend über eine Korruptionsaffäre. Wie die deutsche SPD so gehört auch die slowakische Smer im Europäischen Parlament zur Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten.
Eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung kommt nun der mit 11,64 Prozent drittplatzierten Partei „Stimme – Sozialdemokratie“ (Hlas-SD) unter Führung des ehemaligen Fico-Stellvertreters Peter Pellegrini zu.
Die liberale Partei „Progres-













sive Slowakei“ (PS) unter der Führung des EU-Abgeordneten Michal Simecka war lange als Favorit gehandelt worden, kam aber mit 18 Prozent nur auf den zweiten Platz. Fico hatte im Wahlkampf davon profitiert, daß die Vorgängerregierung am internen Dauerstreit zerbrochen ist, und er auf einen strammen Anti-Westkurs gesetzt hat. Er werde, so Fico, „keine Patrone mehr in die Ukraine liefern“. Dagegen gilt der mögliche Koalitionspartner Hlas-SD bislang als Unterstützer der Nato und der Waffenlieferungen an die Ukraine.
Beim Thema Migration könnte sich Fico mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán verbünden, um den Druck
auf die EU wegen der dramatisch steigenden Zahlen an illegalen Einwanderern zu erhöhen. Gerade für Tschechien als einen der vier Visegrád-Staaten wird das eine Herausforderung, nachdem nach Polen und Ungarn jetzt auch in der Slowakei nationalistische Populisten das Ruder übernehmen und im nächsten Sommer die Wahlen zum Europäischen Parlament anstehen.
Bereits vor dem Machtwechsel in Preßburg ist die Stimmung innerhalb der Visegrád-Staaten auf dem Tiefpunkt. Das inoffizielle Bündnis hatten 1991 die Präsidenten Lech Wałęsa (Polen), Václav Havel (Tschechoslowakei) und József Antall (Ungarn) gegründet, um innerhalb der EU als gemeinsame Stimme Mitteleu-
ropas aufzutreten. Insbesondere bei der Migrationspolitik der EU zieht sich mittlerweile aber ein so tiefer Riß durch das Bündnis, daß politische Beobachter sogar mit dem Zerfall der Gruppe rechnen. So sollen sich Diplomaten der eigentlich befreundeten Staaten in internen Sitzungen gegenseitig angeschrien haben. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán attackierte seinen Prager Amtskollegen Petr Fiala sogar öffentlich und warf ihm in einer Rede vor, in der EU die Seiten gewechselt zu haben. Fiala reagierte prompt und sprach von einer „absurden Stigmatisierung“ durch Orbán. Sein Land entscheide souverän, welchen Kurs es in der EU unterstützt und welchen nicht. Unlängst hielt Fia-
❯ Das tschechische Staatsoberhaupt sprach am College of Europe in Brügge und im Europäischen Parlament in Straßburg

la eine außenpolitischen Rede auf dem alljährlichen Treffen der tschechischen Botschafter im Außenministerium (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) und ging dort bereits auf Distanz zum Visegrád-Bündnis. Es sei, so schrieb Fiala seinen Diplomaten ins Stammbuch, „in unserem Interesse, daß die Visegrád-Gruppe nicht das einzige funktionierende Format für die Zusammenarbeit in Mitteleuropa ist“. Tschechien sei „an einem breiteren mitteleuropäischen Dialog interessiert“, und das spiegele sich auch in der Außenpolitik wider. Fiala: „Die strategische Zusammenarbeit mit Deutschland spielt in diesem breiteren mitteleuropäischen Dialog eine wichtige Rolle, ebenso wie die Stär-
kung der nachbarschaftlichen Beziehungen zu Österreich.“ Unterdessen versucht Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel, die Türen nach Preßburg nicht zuzuschlagen, und erklärte nach der Wahl ganz Staatsmann: „Der Wille der Bürger muß respektiert werden.“ Erst die Koalitionsverhandlungen würden zeigen, welchen Weg die Slowakei einschlägt. „Es liegt auch im Interesse der Tschechischen Republik, die Beziehungen zu den Slowaken langfristig auf einem hohen Niveau zu halten“, so Pavel, der damit seine Fico-kritischen Äußerungen relativierte. Vor der Wahl hatte Pavel noch öffentlich gesagt, daß Fico „eine Reihe von Ansichten geäußert hat, die eher der russischen Propaganda als unserer Weltsicht entsprechen“, und erklärt, daß, „wenn er gewählt werden würde und das Vertrauen bekäme, dies sicherlich die Beziehungen zwischen uns in gewissem Maße stören würde, weil wir einige grundlegende Dinge anders sehen“. Fico konterte postwendend und warf Pavel vor, „eine inakzeptable Einmischung in den slowakischen Wahlkampf“ vor.
Unterdessen hat das slowakische Außenministerium am Montag den russischen Botschafter einbestellt. Der Vorwurf: Der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Narischkin, hatte kurz vor der Wahl behauptet, die USA hätten ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Slowakei verstärkt. Das slowakische Außenministerium wies dies in einer Protestnote als „unzulässige Einmischung der Russischen Föderation in den Wahlprozeß“ zurück und forderte Moskau zudem auf, „die gegen die Slowakei gerichteten Desinformationsaktivitäten einzustellen“.
Wenn Prag und Preßburg an ihrer Tradition festhalten, dann wird Robert Ficos erste Auslandsreise als neuer Premierminister nach Tschechien zu seinem Amtskollegen Petr Fiala führen. Dieses Aufeinandertreffen dürfte spannend werden. Torsten Fricke
Präsident Pavel wirbt für verantwortungsbewußtes Europa
„Die Zukunft wird hart. Europa und der Rest der Welt stehen vor einer Reihe komplexer Herausforderungen“, hat Tschechiens Präsident Petr Pavel am Dienstag am renommierten College of Europe in Brügge gewarnt.
Das Staatsoberhaupt hielt die Festrede zur Eröffnung des neuen akademischen Jahres, das der langjährigen US-Außenministerin Madeleine Albright gewidmet ist, die am 15. Mai 1937 in Prag geboren wurde und am 23. März 2022 in Washington verstorben ist.
„Madeleine Albright und ihr enger Freund, der erste tschechoslowakische Präsident Václav Havel, wußten ob der Bedeutung unserer gemeinsamen Verantwortung. Beiden war klar, wie groß der Vertrauensverlust ist, wenn wir mit Gleichgültigkeit darauf reagieren, daß Menschen unter inländischen Konflikten oder ausländischer Aggression leiden.“
Europa stehe vor großen und vielfältigen Herausforderungen, so Pavel: „Keine Sicherheitsbedrohung ist dringlicher als die russische Aggression, keine geopolitische Herausforderung ist schwieriger als ein selbstbewußtes China und seine Annäherung an viele Länder.“ Euro-
pas Antwort könne nur eine Ausweitung der Europäischen Union sein. Ziel müsse es sein, die westlichen Balkanländer, die Ukraine, Moldawien und auch Georgien zu integrieren. „Der neue geopolitische Imperativ erfor-
dert eine neue Dynamik der Erweiterung. Zu lange haben wir einige europäische Länder den geopolitischen Manipulationen ausgeliefert“, erklärte das Staatsoberhaupt. Der Tschechischen Republik und damit ganz Mit-
teleuropa komme bei der EU-Erweiterung eine wichtige Rolle zu: „Wir müssen sicherstellen, daß wir niemanden zurücklassen.“
Die Erweiterung werde die europäische Sicherheit stärken –und nicht untergraben, so Pa-
vel. Die Ausweitung der Europäsichen Union diene zudem der Stabilität der Demokratien. Die EU müsse deshalb „transparente und erreichbare“ Beitrittskriterien für die Kandidatenländer und einen klaren Zeitplan für den Beitrittsprozeß aufstellen.
Gleichzeitig müsse die EU aber auch selbst zu Reformen bereit sein und Vorschläge prüfen, in einigen Bereichen zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen überzugehen, um ihre Effizienz zu erhöhen.
Weil sie als Flüchtling nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag die „Zerbrechlichkeit der Demokratie“ selbst erlebt hat,
habe Madeleine Albright später als Schirmherrin des Europarats die Bedeutung der Natound EU-Osterweiterung erkannt und sich innerhalb der US-Regierung erfolgreich dafür eingesetzt. Dies sei visionär gewesen, würdigte Pavel Albrights Lebensleistung.

„Ich möchte die Widerstandsfähigkeit der Demokratie zu einem der zentralen Themen meiner Präsidentschaft machen und plane, in Prag eine Konferenz zu diesem Thema abzuhalten“, sagte das Staatsoberhaupt.
An der akademischen Feier nahmen neben Pavel auch der ehemalige Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, sowie die US-Botschafterin bei der Nato, Julianne Smith, teil. Smith erinnerte daran, daß Albright maßgeblich an der Aufnahme der Tschechischen Republik und anderer ehemaliger Warschauer-Pakt-Staaten in die Nato beteiligt war und ihre ganzes Leben für die Demokratie eingetreten sei.
Einen Tag später sprach Pavel vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (nach Redaktionsschluß der Sudetendeutschen Zeitung) und warb dort ebenfalls für ein starkes und verantwortungsbewußtes Europa.
Torsten Fricke
Der sozialdemokratische Populist Robert Fico gewinnt die slowakischen Parlamentswahlen und kündigt an, „keine Patrone mehr in die Ukraine zu liefern“
❯ Erste Lesung im Bundestag zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes: Benachteiligung von Spätaussiedlern soll beendet werden
BdV-Präsident Bernd Fabritius

„Unser Drängen hatte Erfolg“
In erster Lesung hat der Bundestag am vergangenen Donnerstag die lange angekündigte Änderung des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) im Bereich der Spätaussiedleraufnahme debattiert und an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, zog ein positives Zwischenfazit: „Unser Drängen hatte Erfolg. Die BVFG-Änderung kommt endlich voran.“



Wie vom BdV und von der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland gefordert, sei in dem Gesetzesentwurf eine wichtige Klarstellung eingeflossen, so Fabritius: „Wenn jemand, der die Aufnahme als Spätaussiedler beantragt, ein aktuelles Bekenntnis zum deutschen Volkstum nachweisen kann, dann führen frühere, anderslautende Bekenntnisse nicht mehr zur Ablehnung des Antrages. Wenn diese Überzeugung sich auch in den weiteren Lesungen durchsetzt, hat die bisherige rechtliche Gleichbehandlung von Eintragungen des sowjetischen Unrechtsstaates mit freiheitlich erfolgten Bekenntnissen zur eigenen deutschen Abstammung und Kultur endlich ein Ende.“
Überdies sei es gut, daß Forderungen des BdV aus der Verbändebeteiligung in die Formulierungen eingegangen seien. Wo nämlich noch keine Bekenntniskor-
rektur erfolgt oder diese nicht mehr möglich sei, können laut Gesetzestext jetzt auch „ernsthafte Bemühungen um eine Änderung“ ausdrücklich ausreichen.
Dies ist insbesondere in denjenigen Ländern des Aussiedlungsgebietes wichtig, wo heute schon formalrechtlich keine Nationalitäten mehr in Personenstands- und Personaldokumente eingetragen werden – und daher auch nicht einfach korrigiert werden können“, betonte der BdV-Präsident und sagte: „Sämtlichen Abgeordneten und Fraktionen, die diese Gesetzesänderung angestoßen und vorangebracht
haben und sie jetzt mittragen, spreche ich den Dank unseres Verbandes, aber ganz besonders der Betroffenen aus. Es muß nun darum gehen, daß die Verabschiedung zügig gelingt und daß die aus dem geänderten Grund abgelehnten Antragsteller dann über die neue Rechtslage in Kenntnis gesetzt werden, so daß sie eine Wiederaufnahme ihrer Verfahren beantragen können.“ „Bedauerlich“ sei es jedoch, daß angesichts des Krieges in der Ukraine noch immer keine Regelung des Wertungswiderspruches zwischen vorübergehen-
❯ MdB Natalie Pawlik, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten:

Zum Auftakt der Debatte im Bundestag hat die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik (SPD), die historischen Zusammenhänge, die Regierungssicht auf die aktuelle Rechtslage und die Gründe für die Änderungswünsche am BVFG dargestellt.

Mit kurzen Worten machte Pawlik, die als Sechsjährige mit ihrer Familie von Rußland nach Deutschland ausgewandert ist, deutlich, warum die pauschale Vermutung des Kriegsfolgeschicksals auch heute noch für diejenigen Deutschen gilt, die in den außereuropäischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion leben. „Unsere Solidarität mit den Betroffenen darf nicht an Bürokratie scheitern“, betonte sie und appellierte an alle Fraktionen: „Lassen Sie uns gemeinsam und konstruktiv schnelle Lösungen für die Betroffenen auf den Weg bringen.“
Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christoph de Vries, erklärte, daß man in der Sache mit der Ampelkoalition einig sei, man sich jedoch ein schnelleres Agieren gewünscht habe.


Die CDU/CSU-Fraktion habe hier immer wieder zur Eile gemahnt und das Thema vorangebracht. „Vom Deutschlandtem-
Durch höchstrichterliche Rechtsprechung sind die Anforderungen für den Nach-weis des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum, das für die Spätaussiedlerauf-nahme erforderlich ist, angehoben worden (BVerwG, Urteil vom 26.01.2021, Az.: 1 C 5.20). Dies gilt für diejenigen Spätaussiedler, die ein sogenanntes Gegenbekenntnis abgegeben haben, also in amtlichen Dokumenten eine nichtdeutsche Volkszugehörigkeit haben eintragen lassen.
Dieses Gegenbekenntnis steht einem Bekenntnis zum deutschen Volkstum so lange entgegen, bis davon wirksam abgerückt wurde. Für ein solches Abrücken reicht aber nach der Rechtsprechung allein die formelle Änderung der Eintragung in amtlichen Dokumenten auf eine deutsche Volkszugehörigkeit (sog. Nationalitätenerklärung gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG)) gerade nicht aus. Viel-
gut Mit Maria leben und glauben
Wieder ist der Oktober gekommen, der in der katholischen Kirche als Rosenkranzmonat begangen wird. Neben dem Marienmonat Mai bietet dieser Monat ausreichend Gelegenheit, an der Hand der Mutter Jesu unser Leben und unseren Glauben zu betrachten. Entlang der einzelnen Perlen des Rosenkranzes meditieren wir grundlegende Szenen der biblischen Heilsgeschichte und bringen sie mit unseren persönlichen Erfahrungen, mit unseren Notlagen und unseren Glücksmomenten in Verbindung.
der Fluchtrettung gemäß dem Aufenthaltsgesetz beziehungsweise entsprechenden europäischen Regelungen und einem endgültigen Verlassen des Aussiedlungsgebietes im Sinne des BVFG gefunden wurde. Fabritius: „Es ist zynisch, den heutigen Krieg Rußlands gegen die Ukraine und dessen Folgen, als Unterbrechung des Aussiedlungszusammenhangs für deutsche Aussiedlerbewerber zu werten. Wer seine Heimat für die Zeit einer humanitären Krise verläßt, darf nicht seinen Anspruch auf Aufnahme als Spätaussiedler verlieren.“
po haben wir ein anderes Verständnis. Zwei Sätze in einem Gesetz zu ändern, das kann auch schneller als in anderthalb Jahren gehen“, so de Vries. Dieser Kritik schlossen sich später seine Fraktionskollegen Nina Warken und Alexander Hoffmann an. Ausdrücklich begrüßte de Vries, der sudetendeutsche Wurzeln hat, die Rückkehr zur alten Aufnahmepra-

❯ BVFG-Änderung Problem und Ziel
mehr müssen die Antragsteller äußere Tatsachen nachweisen, die einen inneren Bewußtseinswandel und den Willen erkennen lassen, nur dem deutschen und keinem anderen Volk anzugehören.
Diese erhöhten Anforderungen der Rechtsprechung an den Nachweis des Abrückens von einem früheren Bekenntnis zu einem nichtdeutschen Volkstum sind naturgemäß einzelfallbezogen und entziehen sich stereotypen Darlegungen, so daß die Betroffenen (zumeist juristische Laien mit eingeschränkten Deutschkenntnissen)
xis vor der letzten bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung. Außerdem sei es gut, daß der Anspruch auf Wiederaufnahme von Aufnahmeverfahren bestehe, die aufgrund der jetzt zu ändernden Regelung abgelehnt wurden. Kritik gab es abschließend für die für 2024 gekürzten Haushaltsansätze in der Spätaussiedleraufnahme und -integration, insbeson-
sie nur schwer nachvollziehen können. Die dem Urteil angepaßte Verwaltungspraxis hat demzufolge zu deutlich mehr Ablehnungen geführt und wird mittelfristig den Spätaussiedlerzuzug stark begrenzen.
Die Änderung des § 6 BVFG soll daher die Rückkehr zu der früheren Verwaltungspraxis ermöglichen. Diese erlaubte eine Änderung des Bekenntnisses durch bloße Änderung der Volkszugehörigkeit in allen amtlichen Dokumenten (Nationalitätenerklärungen) bis zum Verlassen der Aussiedlungsgebiete (ernsthafte, aber erfolglose Bemühungen um eine Änderung der eingetragenen Volkszugehörigkeit konnten ausreichen). Das frühere Gegenbekenntnis stand einem neuen Bekenntnis zum deutschen Volkstum dann nicht im Wege. Aus dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP
dere vor dem Hintergrund der verhandelten BVFG-Korrektur. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), bezeichnete das BVFG als ein „Zeichen unserer gemeinsamen historischen Verantwortung und der Wiedergutmachung“. Thematisch ergänzte sie die Debatte um die auch vom BdV vertretene Forderung einer großzügigen Regelung für eine vorübergehende Flucht: „Es ist für mich zentral, daß es eben auch nicht sein kann, daß ein fluchtbedingter vorübergehender Aufenthalt außerhalb des Aussiedlungsgebietes zum Verlust des Aufnahmeanspruchs führt. Das wollen wir noch ändern. Es kann nicht sein, daß wir deutschen Minderheiten auf der Flucht eine Schlechterstellung zumuten gegenüber denjenigen, die sich noch im Aussiedlungsgebiet befinden.“
Für die FDP sprach die Abgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht und bezeichnete „die Geschichte der Deutschen aus Rußland und der Bundesrepublik Deutschland als eine Geschichte der Solidarität und Unterstützung; denn diese Menschen werden hier in Deutschland stets ein Zuhause haben“.
Petra Pau (Die Linke), ebenfalls Bundestagsvizepräsidentin, begrüßte die anstehende Änderung des BVFG als „überfällig“ und forderte, daß die Regelungen zum Thema „Gegenbekenntnis“ als nicht mehr zeitgemäß grundsätzlich zu überarbeiten seien.
Nina Warken (CDU/CSU) machte deutlich, daß die Unionsfraktion stets abgestimmt mit den Verbänden vorgegangen sei. Es gelte, mit der Gesetzesänderung „einen erneuten Schicksalsschlag“ zu vermeiden.
Simona Koß (SPD) wiederum lobte Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Aussiedlerbeauftragte, Natalie Pawlik, für deren schnelles Handeln.
Alexander Hoffmann (CDU/CSU) charakterisierte die BVFG-Änderung als nötig, weil sich die durch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil entstandene Vorgabe nicht mit der Lebenssituation der Betroffenen übereinbringen lasse.
Die AfD hatte einen eigenen Antrag vorgelegt, den das Fraktionsmitglied Eugen Schmidt vorstellte, der aber keine Chance auf eine Mehrheit hat. Schmidt kassierte einen Ordnungsruf, weil er entgegen der Regeln des Bundestages während seiner Rede mit einer Deutschlandflagge provozierte.
Von Maria sind im Neuen Testament nur wenige Szenen überliefert. Noch seltener kommen Worte aus ihrem Mund vor. Die wenigen Worte aber, die wir von ihr kennen, haben es in sich. Mit zweien dieser Worte ist ein Bogen über unser Leben gespannt. Mit ihnen sind Grundhaltungen angesprochen, ohne die es kaum gelingen kann, sinnvoll zu existieren. Im Rosenkranzgebet klingen diese beiden Worte in den ersten beiden freudenreichen Geheimnissen an. Es lohnt, sich ihnen nachzuspüren. Auf Lateinisch sind sie besonders prägnant, so sehr, daß sie fast zu einer Art Kulturgut geworden sind. Das erste Wort heißt „Fiat“. Als der Erzengel Gabriel die Jungfrau fragt, ob sie in den Plan einstimme, die Mutter des verheißenen Messias zu werden, antwortet sie: „Es geschehe mir, wie du es gesagt hast. – Fiat mihi secundum verbum tuum“. Mit dieser Antwort ergibt sich Maria in den Willen Gottes. Sie akzeptiert das Neue und Unerwartete in ihrem Leben und stellt eigene Träume und Pläne hintan. Sie läßt sich damit auch auf Schwierigkeiten ein, aber im Vertrauen, daß am Ende alles gut wird. Von dieser Haltung Mariens können wir lernen. Ein in jeder Hinsicht selbstbestimmtes Leben kann nämlich recht einsam und unglücklich sein. Manchmal ist auch von uns ein „Fiat“ erforderlich: die Bereitschaft, etwas geschehen zu lassen, was wir uns nicht selbst ausgesucht oder zugetraut haben.
Das andere Wort aus dem Munde Mariens heißt in lateinischer Sprache „Magnificat“: Es entstammt der Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth und ist ein Wort der Freude: „Hochpreise meine Seele den Herrn. – Magnificat anima mea Dominum.“ Maria drückt mit diesem Ausruf, der sich zu einem Freudenhymnus entfaltet, ihre Dankbarkeit darüber aus, daß ihr Leben trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten glücklich ist. Dieses Glück ist nicht selbstgemacht. Es ist ihr geschenkt. Sie darf die Erfahrung machen, daß gerade die Kleinen und Benachteiligten dieser Welt bei Gott groß angeschrieben sind. Auch mit dieser Haltung ist sie uns ein Vorbild. Vergessen wir die Freude und die Dankbarkeit nicht über all das, was unserem Leben Auftrieb gibt!
„Fiat“ und „Magnificat“: Situationen und Aufgaben in unserem Leben annehmen und hingebungsvoll leben auf der einen Seite, andererseits das Glück nicht übersehen, all das, was uns innerlich reich macht. Wie gesagt, zwei Worte, die einen Bogen bilden, der uns hilft, mit Maria unser Leben und unseren Glauben besser zu verstehen. Und vielleicht gelingt es ja sogar, etwas von diesen Haltungen anderen Menschen weiterzuvermitteln.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
„Lassen Sie uns gemeinsam und konstruktiv schnelle Lösungen für die Betroffenen auf den Weg bringen“Die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik (SPD), bei der Vorstellung des Gesetzesantrages. Fotos: Bundestag
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
Rudolf Hemmerle
Der Schriftsteller, Redakteur und Bibliothekar Rudolf Hemmerle, der nicht zuletzt für sein „Sudetenland-Lexikon“ bekannt ist, starb am 8. Mai 2013 mit 93 Jahren.
40/2023
udolf Hemmerle kam am 3. Oktober 1919 in Sebastiansberg im Kreis Komotau im Erzgebirge als zweiter Sohn von Josef Hemmerle, Betriebsleiter des Torfwerkes, welches dessen Vater aufgebaut hatte, zur Welt. Als Internatsschüler besuchte er das von Jesuiten geleitete humanistische Gymnasium in Mariaschein und legte 1938 dort die Matura ab, anschließend wurde er zur Wehrmacht eingezogen.
R
1946 wurde er schwer versehrt aus französischer Kriegsgefangenschaft nach Bayern entlassen. Er begann Germanistik und Philosophie in Dillingen und München zu studieren. Für seinen Lebensunterhalt arbeitete er gleichzeitig im Münchener Verlag Christ unterwegs. Dort lernte er Marie Zermann kennen, die in Iglau geboren und in Olmütz aufgewachsen war. Die beiden heirateten 1950. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.
1950 trat er in den Bibliotheksdienst der Ludwig-MaximiliansUniversität in München ein, wo er 15 Jahre lang die Dissertationsabteilung leitete. Damals begannen seine Kontakte zum Sudetendeutschen Archiv in München. Davon zeugen die als maschinenschriftliche Vervielfältigung erschienenen „Dissertationen zur Problematik des böhmischmährischen Raumes“ 1955, 1956 und 1957. Sie wurden zur Orientierungshilfe für die Wissenschaft in jenen Jahren, ihre Verfielfältigung war ein Ansatz, die Doktorarbeiten der Nachkriegsgeneration über den Heimatraum systematisch zu erfassen. 1955 veröffentlichte er eine Bibliographie über Peter Dörfler, 1958 eine über Franz Kafka. Sein Sammeleifer und sein Wissen fanden in biographischen und bibliographischen Arbeiten und Aufsätzen in der „Neuen Deutschen Biographie“, im „Österreichischen Biographischen Lexikon“, im „Lexikon der Marienkunde“ und in „Kindlers Literaturlexikon“ Niederschlag. Kaum überschaubar sind seine Beiträge in Zeitschriften und Zeitungen, in Jahrbüchern, Heimat-
❯ Kuhländchen
briefen oder Sammelbänden wie über Johannes Urzidil oder über Sigmund Freud. Für Sammelwerke schrieb er historische Beiträge über Gregor Mendel (1957), die deutsche Technische Hochschule in Prag (1959) oder die Benediktiner in den Sudetenländern (1971). Viele seiner Beiträge bereicherten auch die Sudetendeutsche Zeitung Als 1955 das Sudetendeutsche Archiv gegründet wurde, war er von Anfang an dort nebenher freier Mitarbeiter. In den „Mitteilungen des Sudetendeutschen Archivs“ war er von der ersten bis zur letzten Folge 30 Jahre lang Mitarbeiter, ab 1981 verantwortlicher Redakteur. Die Mitteilungen dokumentierten für die Heimatpresse wichtige Ereignisse, neues Schriftgut und kulturelle Nachrichten. Er prägte dieses Presseorgan, das in jeder Folge an die 70 Biographien herausbrachte und in Bibliotheken und Dokumentationsstellen gesammelt wurde. Mit seiner Frau gab er ab 1963 die Zeitschrift „Prager Nachrichten“ mit der ständigen Beilage „Alma Mater Pragensis“ über das Prager utraquistische Kulturleben und ab 1990 die Zeitschrift „Olmützer Blätter“ heraus.
Ein neuer Lebensabschnitt begann 1970 als Leiter der Bibliothek des Hauses des Deutschen Ostens in München. Für die Sudetendeutschen schuf er ein bleibendes Dokumentationswerk von einmaligem Charakter. Mit seinem „Sudetenland-Lexikon“ setzte er ebenso wie mit seinem „Sudetenlandwegweiser“ seiner Heimat ein Denkmal.
Die Fortsetzung seiner Bibliographie „Heimat im Buch“ erschien 1996 in zweiter Auflage. Seine „Biographischen Skizzen aus Böhmen, Mähren und Schlesien“ wurden 1989 als Festausgabe zu seinem 70. Geburtstag veröffentlicht. Mit dem Bildband „Heimat Nordböhmen“ (1980) und dem Komotauer Heimatbuch „Deiner Heimat Antlitz“ (1959 mit Sepp Seifert) bescherte er seiner engeren Heimat ein Erinnerungswerk. Mit seinen Beiträgen in dem rund 250 Stadtgeschichten umfassenden Band „Städte im Sudetenland“ leistete er einen wichtigen Teil der historischen Städtebeschreibung.
Er war Mitglied in vielen sudetendeutschen Vereinigungen wie
der Künstlergilde und dem Adalbert-Stifter-Verein, mit dem ihn ein langes Zusammenwirken verband. Er war korrespondierendes Mitglied der Historischen Kommission der Sudetenländer, bei der er das Forschungsvorhaben über das deutsche Buch in Böhmen koordinierte. Seine bibliothekarischen Erfahrungen stellte er weiteren Institutionen zur Verfügung wie dem Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde. Dem Collegium Carolinum und der Ackermann-Gemeinde half er beim Aufbau ihrer Bibliotheken.
Trotz seines immensen Arbeitspensums stand er immer allen Ratsuchenden zur Verfügung. Sein profundes Wissen nutzten auch Wissenschaftler und Publizisten. Sein zuverlässiges Gedächtnis befähigte ihn, die Fülle der Namen von Menschen, Orten und Fakten jederzeit parat zu haben, so daß er als „lebendes Lexikon“ bezeichnet wurde.
1985 erhielt er den Dr.-EgonSchwarz-Gedächtnispreis für Publizistik und von der SL die Adalbert-Stifter-Medaille, 1994 die Dr.-Richard-Zimprich-Medaille, 1998 von der Arbeitsgemeinschaft für kulturelle Heimatsammlungen beim Sudetendeutschen Archiv die August-Sauer-Plakette.
Gleich nach dem Krieg hatte er begonnen, eine Sammlung von unzähligen Unterlagen über das Sudetendeutschtum anzulegen und setzte dieses mühevolle Unterfangen bis kurz vor seinem Lebensende fort. Er hatte sich gänzlich der Kulturgeschichte und dem kulturellen Leben seiner Heimat verschrieben. Sein permanentes Streben nach Objektivität und Wahrheitsfindung stand in fruchtbarer Verbindung mit seiner Liebe zur Literatur, zur Belletristik, zur Sachliteratur, zur klassischen Musik, zur Theologie und Philosophie. Dank seiner Tatkraft und seines Weitblicks leistete er still und bescheiden Beachtliches für die Sudetendeutschen.
Die immense Arbeit fraß seine gesamte Freizeit und forderte großes Verständnis von seiner Familie. Seine Frau, die auch Zeit ihres Lebens für die Sudetendeutschen tätig war, und seine Familie trugen alle Belastungen mit ihm und unterstützten ihn. Am 8. Mai 2013 starb Rudolf Hemmerle im Alter von 93 Jahren im Kreise seiner Familie im oberbayerischen Vaterstetten.
Andreas Schmalcz von der SL-Landes-Geschäftsstelle in München, der Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten und die Landesbeauftragte Sylvia Stierstorfer MdL.

❯ Heimatdenkmale
Für die Zukunft erhalten
Wenige Tage vor dem Ende der Legislaturperiode traf sich im Auftrag von Steffen Hörtler, Obmann der SL-Landesgruppe Bayern, sein Geschäftsstellenmitarbeiter Andreas Schmalcz mit der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Flüchtlinge, Sylvia Stierstorfer, in ihrem Amtssitz im Sozialministerium.
Inhaltlich ging es um den Erhalt der Vertriebenendenkmale im Freistaat. Hierzu hatte die SL-Landesgruppe Bayern unter maßgeblicher Federführung von Dieter Heller, Obmann der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach und Mitglied des SL-Landesvorstandes, eine Übersicht erarbeitet. Diese Übersicht informiert über die Anzahl, die Standorte, den baulichen Zustand und so weiter der Denkmale. Ziel ist nun, diese Denkmale auch in Zukunft zu erhalten.
Dabei hatte Sylvia Stierstorfer maßgeblich dafür gesorgt, diese Frage sowohl im Innenministerium als auch im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege zu thematisieren, um tragfähige Zukunftskonzepte zu erarbeiten. Bei dem aktuellen Gespräch ging es um die bisher erfolgten Schritte und das weitere Vorgehen in der neuen Legislaturperiode. Bei dieser Gelegenheit überreichte Stierstorfer Andreas Schmalcz für die Landesgeschäftsstelle ihren Tätigkeitsbericht. Schmalcz dankte im Namen der SL-Landesgruppe für Stierstorfers langjährige Unterstützung, gerade auch in dem besagten Themenbereich. sz
Übersetztes Vertreibungsbüchlein
2021 erschien Horst H. Jüngers 80seitiges Büchlein „Aus der Heimat vertrieben, weil wir Deutsche waren. Organisation der Vertreibung mit Viehwaggons 1946 aus einem Land, das 800 Jahre Heimat war“ über die Vertreibung aus dem Kuhländchen. Heuer erschien die tschechische Übersetzung.

Zdeněk Mateiucik, ein Odrauer Freund der Kuhländler, ließ das Büchlein ins Tschechische übersetzen und schrieb ein Vorwort. Hier Auszüge.
„… Was war der Grund für die Vertreibung unserer deutschen Landsleute? Sie haben angeblich dazu beigetragen, unsere gemeinsame Tschechoslowakische Republik zu zerschlagen. Wie haben sie zur Auflösung beigetragen? Indem sie in freien Wahlen für politische Parteien stimmten, die mit dem faschistischen Deutschland sympathisierten. Aber sie hatten das Recht, so zu wählen. Sie haben nicht alle
gleich gewählt. Und später haben die vertriebenen Kinder gar nicht mehr gewählt.
Außerdem hatten sie Gründe für ihre Entscheidung: die vielen Versprechungen der tschechischen Politiker über eine gerechte gemeinsame Heimat nach 1918, die große Armut in den Grenzgebieten in den 1930er Jahren, eine Folge der Weltwirtschaftskrise. Es waren die Grenzgebiete, das Sudetenland, die am meisten unter den Folgen dieser Krise litten.
Nein, es waren nicht sie, die diese Republik zerbrachen! Es war die Unfähigkeit oder der böse Wille vieler tschechischer, deutscher, englischer, französischer und britischer Politiker, die … auf der Weltbühne der Geschichte spielten … Der verbrecherische Zweite Weltkrieg, den die nationalistische deutsche Politik unter dem
Fanatiker Adolf Hitler entfesselte, war sicher schrecklich. Zehn Millionen Tote und Verbrechen, die man sich kaum vorstellen kann. Aber das war kein Grund, sich an den Schwächsten, an den einfachen Menschen zu rächen und sie … zu vertreiben.
Horst H. Jüngers deutsches Buch.

Wir haben fast alle vertrieben, Männer, Frauen, Kinder, die ganz jungen und die ganz alten. Sogar die Antifaschisten. Wer von ihnen war wirklich für den Krieg verantwortlich? Niemand wußte es je, und niemand weiß es heute … Die Vertreibung war ein Verbrechen, und ein Verbrechen, das leider bis heute ungesühnt bleibt, wie ich vor vielen Jahren in dem Dokumentarfilm ,Man Against Hysteria‘ darlegte.
Horst H. Jünger, gebürtig aus … Wolfsdorf bei Fulnek, hat für uns einen hohen dokumentari-

schen Wert. Vor allem der zweite Teil des Buches, in dem er seine eigenen Erfahrungen beschreibt, als er als siebenjähriger Junge in einem Viehwaggon ins Ungewisse fuhr. Er beschreibt auch seine spätere Suche nach einer neuen Heimat und seiner Ausbildung … bis zur Universität. Das … Trauma der Vertreibung seiner Familie aus ihrer Heimat veranlaßte ihn, sich … mit der Geschichte der gemeinsamen Heimat von Tschechen und Deutschen zu beschäftigen. Dabei suchte er die Ursachen für die Vertreibung in dem, was sich in der Vergangenheit zwischen unseren Völkern ereignet hatte …
Heute ist Europa unsere gemeinsame Heimat, und wir haben die besten Voraussetzungen, um als gute Nachbarn, als Freunde zusammenzuleben.
Aber wir sollten diejenigen nicht vergessen, die nicht so viel Glück hatten. Dieses Buch ist auch ein Andenken an sie.“
Der Brünner Schamane: Die Figur besteht aus Einzelteilen, die vermutlich wie eine Marionette zusammengefügt waren.
Der 13. Juli 1925 ist ein Montag, als Karel Absolon in dem kleinen südmährischen Dorf Unterwisternitz bei Nikolsburg in der Asche einer prähistorischen Feuerstelle einen sensationellen Fund macht. Er entdeckt eine nur 11,1 Zentimeter hohe Keramikfigur, die in zwei Teile zerbrochen ist und eine Frau mit ausladenden Brüsten und Hüften darstellt. Später ergeben die genauen Untersuchungen, daß die Figur in der Zeit zwischen 29 000 und 25 000 vor Christus erschaffen wurde und damit die älteste bekannte Keramikstatue der Welt ist. In Anlehnung an den tschechischen Ortsnamen von Unterwisternitz geht die Statue als „Venus von Dolní Věstonice“ oder „Venus von Věstonice“ in die Geschichte ein.

Da die Statue von unschätzbarem Wert ist, wird im Mährischen Landesmuseum in Brünn in der Regel nur eine Kopie gezeigt und das Original sicher im Tresor verwahrt. Für die Ausstellung „Älteste Schmuckstük-


In der Ausstellung „Älteste Schmuckstücke und Körperschmuck“ wird auch ein Grab gezeigt.
Dieser Frauenkopf mit tropfenförmiger, länglicher Form ist ein einzigartiges Artefakt, das aus der Zeit um 26 000 vor Christus stammt.
Die Venus von Věstonice


Gelegenheit haben, den Besuchern des Nationalmuseums die originale Venus von Věstonice wieder zu zeigen“, freut sich Michal Lukeš, Generaldirektor des Nationalmuseums, und erklärt die Bedeutung: „Fast jeder kennt die Venus von Věstonice aus Geschichtsbüchern, aber es ist selten möglich, das Original persönlich zu sehen, weil es nur selten den Tresor des Mährischen Museums in Brünn verläßt. Jetzt ist sie der Höhepunkt der Ausstellung ,Der älteste Schmuck und Körperschmuck‘, zusammen mit anderen weltweit einzigartigen Objekten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums und des Archäologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Brünn, darunter auch solche, die noch nie zuvor ausgestellt wurden, so daß die

❯ Nationalmuseum in Prag

Infos zur Ausstellung
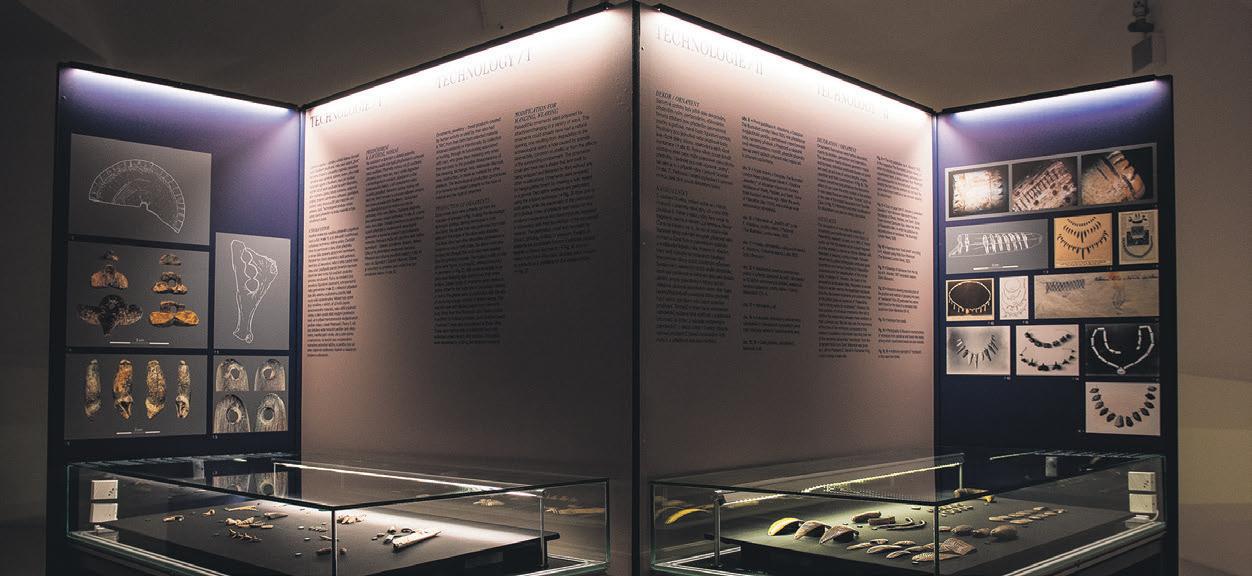
Die Ausstellung „Älteste Schmuckstücke und Körperschmuck“ wird bis zum 29. Februar 2024 im Hauptgebäude des Nationalmuseums am Wenzelsplatz gezeigt und ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Oktober ist das Haus wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 280 Kronen (ermäßigt 180 Kronen). Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei. Mehr Informationen in Tschechisch und Englisch unter www.nm.cz
ke und Körperschmuck“ wurde das Symbol der prähistorischen Kunst jetzt an das Nationalmuseum ausgeliehen und ist zum ersten Mal seit neun Jahren in Prag zu sehen. In der tschechischen
Hauptstadt können die Besucher noch bis Ende Februar unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen die Venus von Věstonice sowie weitere weltweit einzigartige Objekte in den Tresorräumen im Hauptgebäude des Nationalmuseums bestaunen.
„Es ist wunderbar, daß wir die
Öffentlichkeit sie in Prag zum ersten Mal sehen kann.“ Neben der Venus sind bis zu 30 000 Jahre alte Artefakte zu sehen. Ausgestellt werden die Originale aller in der Tschechischen Republik gefundenen paläolithischen Venusen, also Frauenfiguren. Weitere Exponate sind Halsketten, Stirnbänder, Armbänder und Ringe sowie viele andere Gegenstände aus typischen Materialien der Epoche, darunter das sogenannte weiße Gold der Vorgeschichte – Knochen

und Zähne von Mammuts, Bernstein und andere Edelsteine sowie Muscheln.
Archäologische Forschungen können mittlerweile belegen, daß die damaligen Bewohner von Mähren in der Lage waren, bestimmte Materi-
alien wie Muscheln quer durch Europa zu transportieren und sie von weit her mitzubringen. Sie schmückten dann ihren Körper mit diesen kostbaren Gegenständen oder verwendeten sie als Tauschobjekt, Almosen, rituelles Werkzeug, Opfergabe oder sogar als Heilmit-
tel. Gleichzeitig konnten Schmuck und Kleidungsschmuck die ethnische Zugehörigkeit oder den sozialen Status ihres Besitzers repräsentieren. „Diese Exponate sind damit Zeugnisse des künstlerischen Niveaus, des Könnens und der technologischen Fähigkeiten der Menschen jener Zeit“, erklärt Martina Galetová, die Kuratorin der Ausstellung. Ein weiteres einzigartiges
sich hierbei nicht um eine Statue aus einem Stück handelt, sondern um ein aus Einzelteilen zusammengesetztes Werk, die möglicherweise lose miteinander verbunden waren und wie eine Marionette funktionierten.
Die Forscher gehen davon aus, daß ein Schamane in der Steinzeit zwischen 25 000 und 20 000 vor Christus die Statue aus Mammutton hergestellt hat.




Neben der Venus von Věstonice und der Schamanenpuppe ist ein weiteres einzigartiges Artefakt aus der Zeit um 26 000 vor Christus ein realistischer Frauenkopf mit tropfenförmiger, länglicher Form, der fein aus Mammutton gemeißelt wur-
Ausstellungsstück, das mit der Venus von Věstonice vergleichbar ist, ist der Brünner Schamane. Die wahrscheinlich älteste Marionette der Welt ist bislang die einzige Statue dieser Art, die in einem Grab gefunden wurde.
Im Jahr 1891 hatten Arbeiter beim Bau einer Kanalisation in der Francouzská-Straße in Brünn in viereinhalb Metern Tiefe das Grab des sogenannten „Brünner Schamanen“ freigelegt. Von der Statue, die sich neben seinen Überresten befand, sind nur der Kopf, der Körper und der linke Arm erhalten. Das Besondere daran ist, daß es
de. Er ist außergewöhnlich in der Darstellung des Gesichts und einiger Details. Auf dem Kopf der Frau befindet sich eine Frisur oder eine Art Kopfschmuck. Sie wurde 1936 ebenfalls in Unterwisternitz von Karel Absolon und seinem Team gefunden. Aufgrund der Einzigartigkeit aller 191 im Nationalmuseum ausgestellten Artefakte und ihres unschätzbaren historischen Wertes wird die Ausstellung von außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Der Versicherungswert beläuft sich auf mehr als 100 Millionen Kronen. Nicola Fricke
als Kopie ausgestellt. In Prag ist jetzt das Original zu sehen. Die 11,1 Zentimeter hohe Statue ist älteste Keramikstatue der Welt. Fotos: Nationalmuseum

❯ Mährisches Landesmuseum würdigt den Entdecker der Venus von Věstonice

Brünn erinnert an Prof. Karel Absolon

Die Entdeckung der Venus von Věstonice hat Karel Absolon weltberühmt gemacht. Der Prähistoriker, Geologe und Speläologe wurde am 16. Juni 1877 in Boskowitz geboren und verstarb am 6. Oktober 1960 in Brünn, wo im Mährischen Landesmuseum eine Ausstellung an den langjährigen Mitarbeiter und Professor der Karlsuniversität Prag erinnert.
m Verlauf seines Berufslebens hat der Wissenschaftler über
2000 Höhlen erforscht, und sein Gesamtwerk beinhaltet Hunderte von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften und Monographien. Als Professor Absolon wurde er von dem Schriftsteller Václav Erben in einem seiner Romane verewigt.
Auch wenn Absolon als tschechischer Forscher gilt, hat er auch sudetendeutsche Wurzeln. Absolons Großvater war Heinrich Wankel, der „Vater der mährischen Archäologie“. Wankel wurde am 15. Juli 1821
in Prag in eine deutsch-tschechische Familie hineingeboren. Sein Vater war Damian Wankel, ein deutscher Beamter in Prag. Seine Mutter Magdalena, geborene Schwarz, stammte aus einem tschechischen Elternhaus. Heinrich besuchte deutsche Schulen und studierte in Prag Medizin.
Neben seiner Berufstätigkeit als Arzt erforschte Wankel die Höhlen im Mährischen Karst. Als Wankel 1883 pensioniert wurde, verlor er den Anspruch auf seine Dienstwohnung, wo sich
seine Sammlung mit über 8000 Stücken befand, darunter die menschlichen Skelette aus der Höhle Stierfelsen (Býčí skála). Das Mährische Landesmuseum in Brünn und das Nationalmuseum in Prag lehnten einen Ankauf ab.

Schließlich verkaufte Wankel die Sammlung für 12 000 Gulden der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, die sie dem Wiener Naturhistorischen Museum schenkte. Dort befindet sie sich bis heute. NF

Von Prof. Dr. Carsten Gansel
Lassen Sie mich mit einer Erinnerung beginnen, die sich in Otfried Preußlers zweitem autobiographischen Projekt findet, an dem er Mitte der 1990er Jahre arbeitet und dem er den Titel „Verlorene Jahre?“ gibt. „Vor ein paar Jahren meldete sich Fritz Kleine-Möllendorf, der in der Schlosserei des Silikatwerks als Eisendreher beschäftigt gewesen war“, schreibt Otfried Preußler. „Ihm hatten wir eine der Krippen geschenkt, und nun schrieb er mir aus dem Ruhrgebiet: ‚Noch heute steht eure Krippe alljährlich bei uns unterm Weihnachtsbaum, ich lege ein Foto bei.‘“
Leicht erkennbar ist, daß der Brief in Verbindung mit dem steht, was man Kripplkunst nennt. Und sie führt zurück in die Zeit der Kriegsgefangenschaft 1944 bis 1949: Otfried Preußler und ein Mitgefangener, der aus Freital in Sachsen stammt, machen sich zum Weihnachtsfest 1947 im Kriegsgefangenenlager in Kasan an die Herstellung von dreiteiligen Weihnachtskrippen nach der Art kleiner Flügelaltäre. Dabei gehört das Mittelfeld der „heiligen Familie unter dem Dach des Stalles, mit Ochs und Esel im Hintergrund, den linken Flügel nahmen die Hirten mit ihren Lämmern und Schafen ein, den rechten die heiligen Dreikönige aus dem Morgenland. Schräg nach hinten geklappt, verliehen die Seitenflügen dem Ganzen sicheren Stand.“
Letztlich stellen Otfried Preußler und Martin Grafe im Gefangenenlager etwa zwei Dutzend von diesen „Transparentkrippen“, wie beide sie nennen, her, und mindestens eine hat die Zeit des Lagers überlebt, nämlich jene, von der Fritz Kleine-Möllendorf das Foto schickt. Der Brief des früheren Mitgefangenen setzt einmal mehr einen Erinnerungsprozeß in Gang, den Otfried Preußler Mitte der 1990er Jahre in den „Verlorenen Jahren?“ so kommentiert: „Welch unverhofftes Wiedersehen nach einem halben Jahrhundert! Und welche Fülle an Erinnerungen, die das bunte Foto bei mir hervorgerufen hat!“
Das umfangreiche Manuskript, aus dem ich in der Biographie „Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre“ vielfach zitiert habe, wurde von Otfried Preußler trotz der euphorischen Rückmeldung von Frank Schirrmacher und einem ins Auge gefaßten Vorabdruck in der FAZ letztlich nicht abgeschlossen. Der Autor war sich nicht sicher, ob die vorliegenden Kapitel wie die Qualität des Geschriebenen ausreichen. Unabhängig davon ergeben sich Einblicke in jene traumatischen Erfahrungen, denen Otfried Preußler sich zu stellen hatte und die sein Werk beeinflußt haben. ...


Otfried Preußler kam mit 19 Jahren zur Wehrmacht und geriet mit 21 in Kriegsgefangenschaft. Man kann erahnen, mit welchen Traumata der junge Mann umzugehen hatte. Freilich
� Internationale Tagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Humbold-Universität in Berlin
Otfried Preußler und das Trauma
„Ich bin ein Geschichtenerzähler“ lautete der Titel der Internationalen Tagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum 100. Geburtstag von Otfried Preußler, die von Mittwoch bis Freitag an der Humboldt-Universität in Berlin stattgefunden hat. Veranstalter waren Prof. Dr. Julia Benner von der Humboldt-Universität und Prof. Dr. Carsten Gansel von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Prof. Gansel, Autor des Sachbuches „Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre“, hielt die Keynote und sprach zum Thema „Traumaerfahrung und -verarbeitung im Werk von Otfried Preußler“. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert diese spannende Analyse, wie der weltberühmte Kinderbuchautor seine schrecklichen Erlebnisse in Krieg und in der Kriegsgefangenschaft verarbeitet hat, in Auszügen.
war er damit nicht allein. … Es steht die Frage im Raum, ob Otfried Preußler sich erst in den 1990er Jahren den bis dahin nicht formulierten traumatischen Erfahrungen zuwendet. Mitnichten. Bereits vor der unveröffentlichten Autobiografie „Verlorene Jahre?“ hat der Autor in einem zweiten autobiografisch angelegten Projekt versucht, den Stoff von Krieg und Gefangenschaft zu verarbeiten. Der Titel des Textes verweist auf den Ort und die Zeit der Handlung, also auf den bearbeiteten „Stoff Wirklichkeit“: Der Arbeitstitel für den Text aus den 1980er Jahren lautet „Bessarabischer Sommer“. Und im Untertitel ist markiert, um welche Textsorte es sich handelt, nämlich um „Fragmente zu einem Roman“. Es geht also um den Versuch, die Kriegszeit an der rumänischen Front im Jahre 1944 und den Weg in die Gefangenschaft in romanhafter Form zu fassen. Dazu nutzt Otfried Preußler das fiktionale Moment, er erfindet als Erzähler ein ‚Alter ego‘ namens „Trenkler“, der wie er selbst 20 Jahre und Leutnant ist. In einer Vorbemerkung zu dem großen Projekt, das ihn über viele Jahre beschäftigt, schreibt Otfried
Preußler: „Bessarabien, Sommer 1944: Trenkler, damals noch keine einundzwanzig, ist Leutnant und Kompanieführer im Feld-Ersatzbataillon der 264. Infanteriedivision, das zur Zeit in der von der Zivilbevölkerung evakuierten Ortschaft Chimiseni liegt, etwa fünf Kilometer hinter der Front.“ Es existiert also eine Art autobiografischer Pakt zwischen dem Autor Otfried Preußler und dem vorgestellten Leser. Die Hauptfigur und der Autor sind eng an-

� Sudetendeutsches Museum in München
Preußler-Ausstellung

Noch bis Sonntag, 12. November, läuft im Sudetendeutschen Museum die Sonderausstellung: „Ein bißchen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“. Mehr siehe Seite 4.

einandergerückt, allerdings nicht identisch. Der Einsatz der Figur des Leutnant Trenkler ermöglicht Otfried Preußler das, was man ein Schreiben in der „dritten Person“ nennen kann. Dies ist beim autobiografischen Schreiben kein Einzelfall. Heinrich Gerlach wendet in „Durchbruch bei Stalingrad“ dasselbe Verfahren an. Und Erich Loest hat in seinem autobiografischen Bericht „Prozeßkosten“ Vergleichbares getan. „Ein Bericht also aus einem Abstand von fünfzig Jahren – diese Spanne scheint nötig, um zu werten durch Vergessen“, so Erich Loest. Wenngleich die Gegenstände des Erinnerns sich unterscheiden, eines ist ihnen gemein: Das Abarbeiten eines Traumas! ...
Als Otfried Preußler seine Erinnerungstexte schreibt, ist er Mitte 60. Erst jetzt beginnt er, sich dem Trauma von Krieg und Gefangenschaft über eine realistische Darstellung zu nähern.
Ein Brief des Schwagers Hans Herbig belegt, daß diese Texte ab Mitte der 1980er Jahre entstanden sind, also lange vor der Wehrmachtsausstellung Mitte der 1990er Jahre. Hans Herbig beginnt seine Sendung mit einer beigelegten Notiz. „Lieber Otfried“, notiert er am 16. Februar 1998, „vor circa zehn Jahren hattest Du mir ‚Die stillen Teilhaber‘ geschickt. Deine Zwiesprache mit toten Freunden. Ich hatte damals bereits ähnliche Gedanken und etwas konzipiert, was ich aber erst jetzt zu Papier gebracht habe: Erinnerungen an Weggefährten von einst, die im Krieg geblieben waren.“ Bei dem Text „Die stillen Teilhaber“ handelt es sich um den erst 2003 zum 80. Geburtstag unter dem Titel „Haltet mir einen Platz frei in eurer Nähe drüben“ publizierten Text über die toten Freunde. Die hätten sich jahrzehntelang im Schatten gehalten, schemenhaft, als stumme Masse im Nebel ferner Erinnerung“, schreibt Otfried Preußler und fragt, was aus ihnen geworden wäre, „wären sie
damals nicht im Krieg gefallen?“
Es stellt sich die Frage, an welchem Punkt und mit welchem Ergebnis Otfried Preußler die „Zellen im Gedächtnis“ öffnet. Eingesetzt hat der Versuch bereits Ende der 1950er Jahre, als er mit dem „Krabat-Projekt“ beginnt. Bereits damals sind vor seinen Augen Krieg und Gefangenschaft aufgetaucht. Aber sich schreibend den Schicksalen von Freunden zu nähern und literarisch zu erfassen, auf wie grausame Weise sie im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, das ist etwas anderes. Das wird Otfried Preußler erst im höheren Alter, also Mitte der 1980er Jahre, versuchen.
Nunmehr wird das „kleine kreisrunde rote Loch in der Stirn, der aufgerissene Leib, die klaffende Wunde am Hals“ des Freundes in der Erinnerung aufscheinen. Otfried Preußler fragt sich selbst, ab wann die toten Freunde wieder aufgetaucht sind. „Ich weiß es nicht“, lautet die Antwort, „nicht mit Bestimmtheit“, um dann zu präzisieren: „Vor ein paar Jahren muß das geschehen sein, als ich so um die Sechzig war. Und es ist nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Allmählich hat
sich der Nebel gelichtet, allmählich nahmen sie wieder Gestalt an, allmählich ließen sich ihre Gesichter wiedererkennen, von Tag zu Tag deutlicher und bestimmter. Und nun sind sie also wieder da, sind mir gegenwärtig, als stille Teilhaber meines Lebens. Und, höchst merkwürdig: unversehrt sind sie nun alle wieder, jung geblieben, nicht mehr entstellt vom Todeskampf, ohne Wundmale, ganz und gar unbeschädigt an Leib und Gliedern.“ …
Es liegt nahe, daß Preußlers Schweigen über seine verstörenden Kriegserfahrungen damals auf die Abwehr der schmerzhaften Erinnerung gerichtet ist und es sich dabei um einen mehr oder weniger bewußten Thematisierungsverzicht handelt. Im Umgang mit Schuld, Scham, Schmerz und Trauma schafft das „strategische Schweigen“ mithin eine „Distanz und ist eine wichtige Ressource für die Konstruktion und den Schutz von persönlicher Identität.“ …
Als sich – wie Otfried Preußler schreibt – „der Nebel“ allmählich lichtet und die Freunde zunehmend Gestalt annehmen, sich schließlich auch „ihre Gesichter wiedererkennen“ lassen, die „von Tag zu Tag deutlicher“ werden, da sucht er nicht, sie von sich fern zu halten, sondern er wählt einen Weg, sich den Traumata zu stellen, er nutzt seine Möglichkeiten als Autor, und er beginnt den „Bessarabischen Sommer“ zu schreiben. …
Es ist inzwischen bekannt, daß es sich bei derartigen Schrecknissen um traumatische Ereignisse handelt , die zu einer Störung des Selbst führen und mit ihren grausamen Details nur schwer narrativ zu fassen sind. Allerdings hat es bis ins neue Jahrtausend keine hinreichende Beschäftigung mit
� Über den Autor Carsten Gansel
Carsten Gansel, Jahrgang 1955, ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik am Institut für Germanistik der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Im Galiani-Verlag erschien 2022 Gansels Biographie über die frühen Jahre von Otfried Preußler.
Traumafolgestörungen durch Krieg und Kriegsgefangenschaft wie auch nach den Erfahrungen von Flucht und Vertreibung gegeben. Für die Familie von Otfried Preußler – das sei an dieser Stelle nur angemerkt – gerieten die Ereignisse um die Vertreibung aus dem Sudetenland in den Status von Traumata, die zeitlebens eine Rolle spielten. … Dem „Krabat“-Stoff nähert Otfried Preußler sich schon ausgesprochen früh. Wie der Vater Josef archiviert er ab Anfang der 1950er Jahre Texte, die Auskunft über Traditionen und Bräuche aus dem Iser- und Riesengebirge geben. … Erstaunlich in dieser Hinsicht ist der Umstand, daß Otfried Preußler eine weitere Variante für den „Krabat“-Stoff bereits in einem Brief vom 22. Dezember 1950 an Robert Hohlbaum bewegt. … Aber es wird bis 1971 dauern, erst dann erscheint der Roman, dem er den Titel „Krabat“ gibt.… Offensichtlich stecken hinter der Blockade psychosomatische Reaktionen. Es gibt also weit über das Literarische hinausgehende Gründe, die dafür verantwortlich sind, daß Otfried Preußler über Jahre nicht vorankommt. … Otfried Preußler geht mit der „Krabat-Sage“ in die Zeit des 30jährigen Krieges zurück, und er aktualisiert damit genau das, was er eigentlich über die Jahre verdrängen will und muß: … Die „Schreibaktivitäten“ am „Krabat“ führen Otfried Preußler unwillkürlich in den Krieg und die Gefangenschaft. Aber inzwischen ist bekannt, daß Personen darauf aus sind beziehungsweise darauf aus sein müssen, vergangene Erfahrungen in ein sinnstiftendes Verhältnis zur jeweiligen Gegenwart zu setzen, weil es nur dann möglich wird, das Ich zu stärken. Wenn es dem erinnernden Ich nicht gelingt, seine Erinnerungen sinnstiftend an gegenwärtige persönliche und gesellschaftliche Bedingungen und Bedürfnisse, Werte und Normen anzukoppeln, kann die eigene Identität in Frage stehen, ihre Stabilität und Kohärenz werden untergraben. Genau das wird man im Fall von Otfried Preußler sagen können. Er hat ein neues Selbstbewußtsein aufgebaut, und nun ist er gewissermaßen zurückgeworfen. Ohne es zu wissen, gerät er mit dem „Krabat“Stoff in eine Situation, die zu einem verstärkten Ausstoß von Streßhormonen führt. Dies wiederum führt zu Blockaden in bestimmten Regionen des Gehirns, was weitere „Schreibaktivitäten“ erschwert, ja im vorliegenden Fall sogar verhindert. Für Otfried Preußler hat dies gesundheitliche Folgen! … Als der „Krabat“ dann 1971 endlich erscheint, hat Otfried Preußler es geschafft, die traumatischen Erlebnisse an der Front und im Lager in eine romanhafte Form zu überführen, mithin narrativ zu konfigurieren. Anders gesagt: Otfried Preußler verarbeitet die Ereignisse, die durch die Beschäftigung mit dem „Krabat“-Stoff reaktiviert werden, und er bringt sie in eine für sich „erträgliche“ Form. Der Akt des Auf-Schreibens macht ihn freier. Insofern hat der sich über Jahre hinziehende Schreibprozeß eine heilende Wirkung. …
� Pro-Meritis-Plakette
Christian Knauer geehrt

Bei der BdV-Bundesversammlung Ende August in Berlin wurde Christian Knauer, scheidender Vizepräsident des BdV-Bundesverbandes, Vorsitzender des BdV-Landesverbandes Bayern und ehemaliger Landtagsabgeordneter sowie einstiger Landrat des bayerisch-schwäbischen Landkreises Aichach-Friedberg, für seine Verdienste mit der ProMeritis-Plakette ausgezeichnet.
Die Plakette Pro Meritis gilt als höchste Auszeichnung für BdV-Funktionsträger und wurde bislang erst zweimal verliehen. Knauer hatte nach 17jähriger Zugehörigkeit zum BdVPräsidium, davon 15 Jahre als Vizepräsident, auf eine erneute Kandidatur verzichtet. „Alles hat seine Zeit, und ich will das Zepter weiterreichen, solange ich das Gefühl habe, daß dieser Schritt allgemein bedauert wird“, meinte er augenzwinkernd. Als seinen Nachfolger schlug er erfolgreich

� BdV-Landesverband Bayern
Neue Satzung und neue Geschäftsordnung
Mitte September fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des BdV-Landesverbandes Bayern im Kulturzentrum Deutsche Fastnachtakademie im unterfränkischen Kitzingen statt.
Gesundes Selbstbewußtsein, wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Verbandsarbeit und Geschlossenheit kennzeichneten die Tagung. Gleich zu Beginn stellte Landesvorsitzender Christian Knauer fest, daß ohne die Aktivitäten des Dachverbandes die Heimatvertriebenen und ihre Verbände im Freistaat nicht den Stellenwert hätten, auf den sie heute stolz sein könnten. „In keinem anderen Bundesland gibt es so viele fruchtbare Kontakte zur Politik und zu den gesellschaftlichen Verbänden wie in Bayern – dies zahlt sich aus“, so der frühere Aichach-Friedberger Landrat. In zweieinhalb Stunden bewältigten die rund 75 Delegierten ein Mammutprogramm mit 21 Tagesordnungspunkten. Zurückzuführen war die hohe Zahl auf eine erfolglose Klage eines früheren Delegierten im Zusammenhang mit der Landesversammlung des vergangenen Jahres. Weil damals die Tagesordnung nicht vier, sondern wegen der zögerlichen Delegiertenmeldungen erst drei Wochen vor der Tagung den Delegierten zugestellt worden war, hatte dieser mit einer Reihe weiterer Forderungen sowohl das Registergericht als auch das Amtsgericht München angerufen. Nachdem er von dort auf die geringen Chancen seiner Klage und die möglicherweise auf ihn zukommenden Prozeßkosten hingewiesen worden war,
zog er die Klage zurück. Da die Verjährungsfrist für solche Formfehler aber drei Jahre beträgt, stimmte der BdV-Landesverband über alle Tagesordnungspunkte des Vorjahres erneut ab.
Die Entlastung des Landesvorstandes für 2021 und der Nachtragshaushalt 2022 wurden einstimmig befürwortet. Ein damals vom Kläger gestellter Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung wurde noch entschiedener als vor einem Jahr abgelehnt.
In seinem Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr ließ Landesvorsitzender Knauer die vielfältigen Aktivitäten Revue passieren. Stolz
Ehrenabend des BdV für Söders Vorgänger Horst Seehofer im Münchener Haus des Deutschen Ostens zum Dank für dessen immerwährende Unterstützung (Ý SdZ 12/2023).
Der BdV-Landesverband, so Knauer, habe nicht nur zur bayerischen Landespolitik, sondern auch zu den Vertretungen der Nachbarländer hervorragende Kontakte. So treffe man sich regelmäßig mit den konsularischen Vertretern der Tschechischen Republik, Rumäniens, Ungarns und Serbien. Schon fest im Jahresprogramm stünden die Einladungen an BdV und Landsmannschaften zum Staatsfeier-
Sehr zufrieden zeigte sich Knauer mit dem Abschneiden seines Landesverbandes bei den Neuwahlen zum BdV-Präsidium Ende August in Berlin. Mit BdVPräsident Bernd Fabritius und dessen Stellvertretern Stephan Mayer MdB und Steffen Hörtler stellten die Bayern fast die Hälfte des engsten Führungszirkels. Bei den Wahlen der weiteren sechs Präsidiumsmitglieder seien Rita Hagl-Kehl MdB und die Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Brunhilde Reitmeier-Zwick, erfolgreich gewesen. Die Früchte kontinuierlicher Arbeit ließen sich im Freistaat auch an der gu-
ses der Heimat in Nürnberg ablesen. Derzeit bereite man die Verlegung des Sitzes der Karpatendeutschen Landsmannschaft von Stuttgart nach München vor.
Gut seien auch die Neuwahlen in Oberfranken und in Schwaben verlaufen. Turnusgemäß werde man in den nächsten Wochen die Neuwahlen in Niederbayern in Angriff nehmen und anschließend den seit über einem Jahrzehnt inaktiven Bezirksverband Oberpfalz wiederbeleben. Großen Applaus gab es nicht nur für Knauers Rechenschaftsbericht, sondern auch für die gute Arbeit der Landesgeschäftsstelle. Besonders würdigte Knauer den engagierten und konstruktiven Einsatz von Landesgeschäftsführerin Stefanie Sander-Sawatzki.
Volles Haus und konstruktive Diskussionen bei der BdV-Landesversammlung in Kitzingen.

zeigte er sich dabei über die politischen Gespräche mit den Landtagsfraktionen von CSU, SPD, Freien Wählern und Bündnis 90/Die Grünen und die gro-ßen Vertriebenenempfänge von CSU und SPD. Als besondere Höhepunkte würdigte er das Festessen im Antiquarium in der Münchener Residenz, zu dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Funktionsträger eingeladen hatte (Ý SdZ 25/2023), und einen
� BdV-Landesverband Bayern
tag der Tschechischen Republik, zum Rumänischen Nationalfeiertag und zur Gedenkfeier für die vertriebenen Ungarndeutschen.
Sehr erfreulich sei im April eine Begegnungsreise nach Serbien verlaufen, wo man sich auf die Suche nach den Wurzeln der Donauschwaben begeben habe. Dabei habe man sich erfolgreich mit der deutschen Minderheit und der dortigen Landes- und Kommunalpolitik ausgetauscht.
ten Entwicklung der vier Kulturstiftungen, der neuen Forschungsstelle „Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern 1945 bis 2020“ am Leibnitz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg, an der Wiederaufnahme der Institutionellen Förderung des Schlesischen Museums in Straubing, der Kulturstiftung Schlesien in Würzburg und der Erweiterung des Hau-
Reine Formsache waren die Berichte des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer zum Rechnungsjahr 2022, die Entlastung des Landesvorstandes und die Genehmigung des Nachtragshaushalts für 2023. Längere Zeit beanspruchte die Verabschiedung der neuen Satzung und Geschäftsordnung, da vor der jeweils einstimmig erfolgten Zustimmung zum Gesamtwerk über jeden einzelnen Paragraphen abgestimmt wurde. Im Wesentlichen ging es bei den Neuregelungen um die Verkürzung der Amtszeit der Vorstände von vier auf zwei Jahre, um klare Einberufungskriterien für die Versammlungen auf den einzelnen Ebenen und um Fragen zur Niederschrift. Im Falle der Auflösung des Verbandes wird künftig ein eventuelles Vermögen der gemeinnützigen Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zufallen. Susanne Marb
Kulturpreis für Banater Brauchtumsmuseum
Auch heuer wurden beim Zentralen Tag der Heimat des BdVLandesverbandes Bayern Mitte Juli in Ingolstadt der BdV-Kulturpreis und die zugehörigen Ehrengaben überreicht.
desvorsitzendem gehalten wurden.
Nachfolger Steffen Hörtler.
Steffen Hörtler vor, den Obmann der SL-Landesgruppe Bayern. BdV-Präsident Bernd Fabritius würdigte seinen langjährigen Stellvertreter in sehr persönlichen Worten. Über 30 Jahre lang habe er dem Bund der Vertriebenen treu gedient und dabei stets zum Wohle des Verbands sein fundiertes Wissen, sein diplomatisches Geschick und viel Herzblut eingebracht. Seine Wortbeiträge und Ideen, Anregungen und Initiativen seien im Präsidium und im Verband geschätzt worden.
Knauer habe immer den Mut gehabt, auch unbequeme Fragen zu stellen. Und wenn er selbst gefragt worden sei, habe er auch unbequeme Antworten gegeben. Ausgezeichnet habe Christian Knauer jederzeit seine zutiefst demokratische Einstellung, sein Vermögen verbandsintern nach Mehrheiten zu suchen, diese zu organisieren, dabei Konsens zu finden, Abstimmungen zu akzeptieren und neue Handlungsmöglichkeiten darzulegen, lobte Fabritius.
Mit stehendem Applaus quittierten die BdV-Delegierten die Feststellung des BdV-Präsidenten, daß sein scheidender Vize die zahlreichen Ehrenämter im Vertriebenenbereich mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit die längste Zeit neben seinem politischen Mandat im Bayerischen Landtag und dem sich daran anschließenden Amt des Landrats ausgeübt habe. Dies sei sowohl Ausdruck seiner nicht verhandelbaren Verbundenheit mit dem BdV als auch der Nachweis seiner Energie und Belastbarkeit gewesen.
Stefanie Sander-Sawatzki
Zum elften Mal würdigte der BdV damit herausragende künstlerische, literarische oder wissenschaftliche Beiträge über Themen der Vertriebenen und Spätaussiedler, der deutschen Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa oder Brauchtumspflege. Der Kulturpreis besteht aus dem mit 2000 Euro dotierten Hauptpreis sowie bis zu zwei Ehrengaben mit je 500 Euro. Die Preise werden von einer fünfköpfigen Jury vergeben, von denen zwei Mitglieder vom für die Heimatvertriebenen zuständigen Staatsministerium und drei Mitglieder vom BdV-Landesvorstand berufen werden.
Den Kulturpreis 2023 verliehen die Landesbeauftragte für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer MdL, Landrätin Tamara Bischof und BdVLandesvorsitzender Christian Knauer an das Brauchtumsund Trachtenpuppenmuseum im Heimathaus der Banater Schwaben in Würzburg. Bei der Überreichung der Ehrengabe an Jakob Fischer assistierte der Vertriebenenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Helmut Kaltenhauser, bei der Ausreichung an Ernst Schroeder Barbara Becker MdL.

Nachstehend veröffentlichen wir Auszüge aus den Laudationes auf die Preisträger, die von Landesschatzmeister Paul Hansel, Landesgeschäftsführerin Stefanie Sander-Sawatzki und Lan-
Laudator Paul Hansel, Schatzmeister des BdV-Landesverbandes, über das Museum der Banater Schwaben in Würzburg: „ Der diesjährige BdV-Kulturpreisträger zeichnet sich durch eine generationenübergreifende Pflege der ostdeutschen Kultur aus. Seine Einrichtung begeistert ihre Besucher nicht nur aus den Reihen der eigenen Landsleute, sondern auch aus ganz Franken und darüber hinaus. Sie ermöglicht einen umfassenden Blick auf die Volkskultur sowie auf die Geschichte und die wirtschaftliche Leistung der Banater Schwaben.
Teil aus originalen Stoffen, mit den Trachten der einzelnen Ortschaften nachempfunden. Das tägliche Leben im Banat vor der Vertreibung oder der weitgehenden Übersiedlung seiner deutschen Bevölkerung nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Gewaltherrschaft im Jahr 1989 wird durch Inszenierungen mit echten Möbeln und Gegenständen sowie Schaufensterpuppen nachgestellt. So sind beispielsweise eine Bauernküche mit Vorratskammer und eine ,gute Stube‘ mit originalen Möbeln, Hausrat und Textilien zu sehen. Geehrt wurde nicht nur das Museum, sondern vor allem die Mit-
lung ,Deutsche aus Rußland. Geschichte und Gegenwart‘ oder Entertainer und Hüter des rußlanddeutschen Liedgutes, stets leistete Jakob Fischer einen erfolgreichen Beitrag, die bundesdeutsche Öffentlichkeit über die Geschichte und Kultur der Deutschen in und aus der ehemaligen Sowjetunion zu informieren. Dabei ging es ihm stets darum, die Akzeptanz der Spätaussiedler in der deutschen Gesellschaft zu verbessern und Vorurteile abzubauen.
In mehr als 130 Stationen in allen 16 Bundesländern erreichte die von ihm konzipierte Wanderausstellung bereits mehr
er national und international das traditionelle Kulturerbe seiner Landsleute.“
Laudator und BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer über Ernst Schroeder: „Mit bewundernswertem Eifer und großem Engagement trug Ernst Schroeder Kulturschätze seiner Heimatregion Pommern und einschlägige Literatur zusammen und sorgte für deren sinnvolle Nachnutzung. Zudem gelang ihm, durch sein in die Zukunft gerichtes Brückenbauen in seine Heimatstadt Kolberg deutsches Kulturgut vor Ort zu sichern und wertvolle Exponate aus Deutschland im Foyer des Hotels New Skanpol zu präsentieren.
Dem Kulturzentrum zur Geschichte pommerscher Auswanderer im brasilianischen Jaraguá do Sul spendete er fast 10 000 Bücher, darunter Fachliteratur und kulturhistorische Bücher über deutsche Auswanderungsgeschichte sowie Schönliteratur in deutscher Sprache.
Strahlende Gesichter bei der Verleihung des Kulturpreises 2023 des BdV Bayern.
Seit 1987 zeigt das Museum in einem um 1900 erbauten Gebäude mehr als 100 Trachtenpuppen und Originaltrachten, aber auch weitere Gegenstände aus Brauchtum und Volkskultur. Es waren in erster Linie beherzte Landsleute, welche die Festund Arbeitstrachten ihrer Heimatdörfer im Kleinformat nachgestellt, das Haus instandgesetzt und ausgestattet haben. Die Trachtenpuppen wurden zum
arbeiterinnen und Mitarbeiter um Betreuerin Katharina Haidt, ohne deren ehrenamtlichen Einsatz Errichtung und Betrieb des Museums nicht möglich wären.“
Stefanie Sander-Sawatzki, Geschäftsführerin des BdV-Landesverbandes Bayern,dem über Jakob Fischer: „Ob als Stellvertretender Theaterdirektor des Deutschen Schauspieltheaters Temirtau/Alma-Ata, als Projektleiter der Wanderausstel-
Bild: Susanne Marb
als 60 000 Menschen, darunter 30 000 Jugendliche und Kinder im Rahmen des Unterrichtsprojekts. Als Entertainer und Hüter des rußlanddeutschen Liedgutes war er gern gesehener und vielseitiger Moderator und Sänger. Unterstützt von Chören, Gesangs-, Tanz- und Musikgruppen sowie Solisten aus den Reihen der Deutschen aus Rußland und nicht selten auch einheimischen Interpreten, präsentierte
In vielfältiger Weise brachte sich der langjährige Landesvorsitzende der Pommerschen Landsmannschaft auch ins Kulturleben Bayerns ein. So beriet er den BR bei der Produktion zweier Filme über Pommern und das ZDF bei einem Film über Kolberg. Ferner wirkte er an der Konzeption von Ausstellungen mit und war Herausgeber mehrerer Bücher über seine Heimatregion und Familienforschung. Hervorzuheben sind ferner seine Leistungen als BdV-Vertreter im Vertriebenenbeirat des Freistaates, im Beirat des HDO und im Wertebündnis Bayern.“ Susanne Marb
� SL-Landesgruppe Hessen
Vom Weweiser
zum Zeitzeugenprojekt
Mehr als nur ein Schulprojekt war die Aufarbeitung des Themas Flucht und Vertreibung in Alsfeld im hessischen Vogelsbergkreis.
Zu einer großartigen Projektreihe hat sich eine kleine Idee im hessischen Alsfeld entwickelt. Der Geschichtslehrer und ehrenamtliche Stadtarchivar Michael Rudolf hatte vor einigen Jahren moniert, daß der auf dem Ludwigsplatz in Alsfeld befindliche „Wegweiser“ als Denkmal für Flucht und Vertreibung schadhaft und sanierungsbedürftig sei. Vor allem habe der Wegweiser nach Eger gefehlt. Rudolf hat übrigens väterlicherseits Vorfahren aus dem Egerland.

Sozialpolitiker
aus dem Altvaterland
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) erinnerte am 28. September an den 100. Todestag des österreichischen Sozialpolitikers Ferdinand Hanusch, der in Oberdorf bei Wigstadtl im sudeten-schlesischen Kreis Troppau zur Welt gekommen war.

Ferdinand Hanusch wurde am 11. November 1866 als vierter Sohn eines schlesischen Hauswebers in Oberdorf geboren. Sein Vater starb kurz nach seiner Geburt, und er wuchs unter dürftigsten Verhältnissen mit Mutter und drei Brüdern auf. Mit 13 Jahren wurde er Bauhilfsarbeiter und etwas später Hilfsarbeiter an den mechanischen Webstühlen einer Bandfabrik. Er schloß sich einem Fachverband an, um seine Schulbildung zu erweitern und ging auf Wanderschaft quer durch Europa und in der Türkei. 1891 kehrte er in seine Heimatstadt zurück und trat dem Arbeiterverein


Eintracht bei, 1897 wurde er Gewerkschafts- und Parteisekretär in Sternberg und 1900 wurde er zum Sekretär der neu gegründeten Union der Textilarbeiter mit Sitz in Wien gewählt, wo er sich für Verbesserungen bei der Arbeitszeit und den Arbeitsverträgen einsetzte. 1903 wurde er Vorsitzender der Gewerkschaftskommission, dem Leitungsorgan der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung, wo er sich immer stärker in der Sozialpolitik engagierte.
Seit 1907 gehörte er als sozialdemokratischer Abgeordneter dem Reichsrat an, wo er sich unter anderem für den Acht-Stunden-Arbeitstag einsetzte. In der ersten provisorischen Regierung nach dem Zusammenbruch der Monarchie wurde er Staatssekretär
für soziale Fürsorge – heute Sozialminister – und blieb es bis zum Ausscheiden der Sozialdemokraten aus der Bundesregierung im Oktober 1920.
Während dieser Tätigkeit baute Hanusch eine Sozialgesetzgebung auf, die als Vorbild für andere Staaten diente: ein zeitgemäßes Krankenkassenwesen, die Sozialversicherung, den Urlaubsanspruch, den durch Kollektivvertrag garantierten Mindestlohn, die 48-Stunden-Arbeitswoche, die Arbeitslosenversicherung, die sechswöchige Karenzzeit für werdende Mütter und die Errichtung der Kammern für Arbeiter und Angestellte. Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung blieb er Abgeordneter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und wurde 1921 Präsident der Wiener Arbeiterkammer, wo er auch Mitarbeiter aus anderen politischen Lagern für seine Ideen heranzog. Seiner schlesischen Heimat blieb er als Autobiograph und Schriftsteller verbunden, unter anderem mit Werken wie „Auf der Walze“ und „Aus der Heimat. Geschichten in schlesischer Mundart“. Hanusch starb am 28. September 1923 in Wien im 57. Lebensjahr. Seine Ruhestätte befindet sich im Urnenhain der Feuerhalle Simmering, Abteilung MR, Gruppe 45, Grab
Nr. 1G.
Seine Büste ziert als einer von drei Politikern das Republikdenkmal neben dem Parlament. Zahlreiche Plätze, Straßen und Gassen in Österreich sind nach Ferdinand Hanusch benannt, so auch der Hanuschhof am Kößlerplatz in Wien. 1945 wurde das ehemalige Erzherzog-Rainer-Spital als Krankenhaus der Wiener Gebietskrankenkasse in Hanusch-Krankenhaus umbenannt. HR

dabei auch Monika Hölscher begrüßen konnte. Die Schülerinnen und Schüler eines sogenannten KOP-Kurses an der Albert-Schweitzer-Schule, einer Art Arbeitsgemeinschaft, hatten die Veranstaltung auch mit Unterstützung von Rudolfs Kolleginnen Leandra Arlene Pohlai und Verena Wickles bis ins Detail geplant. Der Stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Thomas Weidemann, hob die Leistung der Gymnasiasten hervor, und Bürgermeister Stephan Paule betonte die Bedeutung des Themas gerade für Alsfeld.

�
mannschaften und Möglichkeiten des Engagements dar.
Im Laufe des Abends berichteten acht Personen, darunter der ehemalige Landrat des Vogelsbergkreises Rudolf Marx, aus unterschiedlichen Verhältnissen über die Thematik und verloren dabei den Bezug zur Region um Alsfeld nie aus den Augen. Spannend war zum Beispiel, als Helmut Gläser von seinem kilometerweiten Schulweg erzählte, den er jeden Morgen zum Gymnasium zurücklegen mußte.
Am 23. September feierte der Egerländer Rudolf Pelleter mit Tochter Claudia und deren Familie, Verwandten und Bekannten im südhessischen Egelsbach 100. Geburtstag.
Sein Anliegen wurde von Bürgermeister Stephan Paule dahingehend bearbeitet, daß dieser sich an die Geschäftsstelle der SL-Landesgruppe Hessen in Wiesbaden wandte, von wo selbstverständlich Hilfe kam, so daß im Sommer die feierliche Einweihung des sanierten Wegweisers erfolgen konnte.
Damit war der Anfang für eine Projektreihe gelegt, die sogar einen Kooperationsvertrag mit Monika Hölscher vom Referat für den ländlichen Raum der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und unlängst einen neuen Höhepunkt hervorbrachte: eine öffentliche Zeitzeugenbefragung.
Das Marktcafé in Alsfeld war vollbesetzt, als Michael Rudolf die Veranstaltung eröffnete und
Für ein Impulsreferat hatten die Veranstalter Markus Harzer, Mitglied der Kreisgruppe Schlüchtern und vormaliger SLLandesobmann, gewinnen können. Er stellte Flucht und Vertreibung aus einer hessischen Sicht dar und erwähnte am Ende, daß die Sudetendeutschen quasi die Erfinder des Hessentags gewesen seien, der bekanntlich zum allerersten Mal 1961 in Alsfeld stattgefunden habe.
Harzer stellte im Gespräch mit Nisa Solmaz und Sema Erik die aktuelle Situation der Lands-

� SL-Kreisgruppe Frankfurt am Main/Hessen
Daß bereits viel Zeit verstrichen war, bemerkten die Zuhörer erst, als das Ende der Veranstaltung verkündet werden mußte. Das Projekt wird im gerade beginnenden Schuljahr zu einem vorläufigen Abschluß gebracht werden mit einer Broschüre über die Zeitzeugenbefragung. Diese Verschriftlichung soll für Anschlußprojekte sorgen. Danach sollen Unterrichtsmaterialien über Flucht, Vertreibung und Neuanfang erstellt werden. Gerade das Lokalkolorit macht dieses Material für Alsfelder und Vogelsberger Schulen interessant. Die lokalen Medien zeigten sich sehr interessiert an der Aufarbeitung eines in Alsfeld lange vernachlässigten Themas. Michael Rudolf, mittlerweile Mitglied der SL-Kreisgruppe Kassel, stellte fest: „Dieser weiße Flecken hat nun schon ein wenig Farbe erhalten.“ Und so macht das Schulprojekt hoffentlich auch wieder Lust auf noch mehr. sr
Glanzvolle Filmpremiere
Die hessische SL-Kreisgruppe Frankfurt am Main hatte mit der Stadt Hanau und der dortigen Karl-Rehbein-Schule zu einer Filmvorführung in das Hanauer Kulturforum eingeladen
Nach fast zwei Jahren war der Film soweit. Nach der Premiere der tschechischen Version in Brünn im Rahmen von „Meeting Brno“ konnte auch die deutsche Fassung als „Directors Cut“ in die Erstaufführung gehen. Filmemacher Rainer Brumme und Wolfgang Spielvogel stellten das erste Ergebnis eines Ausnahmeprojekts vor. Obwohl Spielvogel SL-Kreisobmann in Frankfurt am Main ist, war das Hanauer Kulturforum ausgesucht worden, um die 93 Minuten Dokumentarfilm zu präsentieren und zu besprechen.
Martin Hoppe und Yvonne Blüml hatten die Vorbereitungen für die Premiere professionell in die Hand genommen. Direktor Stephan Rollmann von der Karl-Rehbein-Schule ließ Grüße ausrichten, Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck (SPD) lobte das Projekt und dessen Bedeutung und Achim Güssgen-Ackva von der Landeszentrale für politische Bildung konnte über Lobesworte hinaus verkünden, daß eine dem Unterricht angepaßte Version von seiner Stelle in Lizenz erworben werde. Auch die Schülerseite kam noch zu Wort, bevor der Film startete: Für die
tschechische Seite sprach Jakub Treska, für die deutsche Oliver Jahn.
Bei dem Filmprojekt bildet die Zusammenarbeit zweier Schülergruppen die Grundidee. Die eine Gruppe kam von der American School in Brünn. Schulleiter Pavel Nowak hatte daselbst eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.
Und das deutsche Pendant bildete der Leistungskurs Geschichte an der Karl-Rehbein-Schule mit Tutor Markus Harzer. Gerade erst die Abiturzeugnisse in die
dene Epochen der Nachkriegszeit abbilden: „Erste Schritte“, „Wagen nach Wien“ und „Gerta – das deutsche Mädchen“. Der vorliegende Dokumentarfilm, der Nastup zum Schwerpunkt hat, zeigt, wie sich die Schülerinnen und Schüler beider Nationen über „Erste Schritte“ einer Thematik annähern, die den wenigsten von ihnen vorher bewußt war, vor allem den Deutschen. „Erste Schritte“, im tschechischen Original „Nastup“ war ein von kommunistischer Ideologie geprägter Kolonialroman Anfang der fünfziger Jahre – schon bald sogar Pflichtlektüre an tschechischen Schulen.
Rudolf Pelleter kam am 23. September in Sandau als Sohn der Eheleute Josef und Margareta Pelleter im Strumpfwirkerhaus zur Welt. Der tägliche Fußweg zur Bürgerschule nach Bad Königswart und zurück betrug zehn Kilometer, auch bei schlechtem Wetter. Nur an den Wintertagen wurde die Bahn benutzt. Bereits an dieser Schule fiel sein zeichnerisches Talent auf. Bei der Eisenhandelsfirma Hermann Ernst in Eger wurde er Industriekaufmann. In Sangerberg im Kaiserwald lernte er Segelfliegen, daher kam er zur Luftwaffe. Die Grundausbildung erhielt er in Crailsheim und in Südfrankreich. Die Insel Kreta im Mittelmeer war die nächste Station. Von deren Landschaft und uralter Kultur schwärmte er noch später. Schrecklich muß der Rückzug der deutschen Truppen auf den Balkan gewesen sein. Nur ein Teil der Verbände erreichte das Ziel Niederösterreich, wo eine neue Front aufgebaut werden sollte. Das Vorhaben schlug fehl. Trotz mehrfacher Gefangennahme schlug er sich nach Sandau durch.
Nach dem Kriegsende mußte er im verstaatlichten Tankholzwerk in Sandau am Bahnhof arbeiten. Im Juni 1946 wurde er vertrieben. Erste Station war das Aufnahmelager in Bad Königswart. Groß war die Enttäuschung, als der Vertriebenentransportzug in die SBZ fuhr. Pelleter gelang, eine Zuzugsgenehmigung nach Hessen zu bekommen, wo die Familie bereits im Sommer 1946 eintraf. Zunächst arbeitete er im Wald und auf Baustellen. Dann diente er sich von bescheidenen Anstellungen bis zum Verkaufskorrespondent des Frankfurter Verkaufskontors der BASF hoch, wo er bis zur Pensionierung blieb.
1959 heiratete er Christa Schneider aus Patschkau in Schlesien. Im September 1960 wurde Tochter Claudia geboren. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei jungen Männern, die der Stolz der Großeltern sind. Rudolfs geliebte Frau starb leider schon 2022. Bei seiner Arbeit für die „Stimmen von Sandau“ hatte sie ihn stets unterstützt. Ohne ihre Hilfe hätte er die Arbeit nicht bewältigt.
Hand bekommen, war klar, daß natürlich Hanau der Ort für die deutsche Premiere sein würde. Als Einladende fungierten die Kreisgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft Frankfurt am Main, die Stadt Hanau sowie die Karl-Rehbein-Schule.
Basis dieses Projekts, das nicht nur in eine Tiefe ging, die selten unter normalen Verhältnissen erreicht wird, waren drei tschechische Romane, die drei verschie-
Die filmische Annäherung wird ergänzt durch Gespräche mit Zeitzeugen. Wichtig ist, daß der Film nicht belehrt und das auch nicht will. Er stellt allerdings Fragen, deren Antworten letztlich so individuell wie nur möglich sein können und müssen. Entsprechend war auch die anschließende Diskussion mit den Filmemachern eine sehr offene Angelegenheit. Das Projekt als Ganzes ist, wiewohl das Filmmaterial für die beiden anderen Romane ja schon vorhanden ist, noch nicht vollständig abgeschlossen, die Freundschaft bleibt. Und so wandert eine Flasche Karlsbader Becherbitter wie eine Wandertrophäe erst einmal wieder nach Brünn. Wann und wo sie geleert wird, das weiß zur Stunde allerdings niemand. sr
Herausgeber der „Stimmen von Sandau“ war Pelleter wie sein Vorgänger Edi Feiler aus Pflichtbewußtsein und Liebe zur Heimat. Private Interessen stellte er oft hintan. Auf dem Gebiet der Quellenforschung leistete er Vorbildliches. Er besuchte die Heimat zu einer Zeit, als dies noch riskant war, und berichtete darüber. Oft unterlegte er seine Berichte mit Bildern.
Über viele Jahre hielt er die Erinnerung an die Heimat wach und trug dazu bei, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu festigen. Ohne die „Stimmen von Sandau“ wären die regelmäßigen Heimattreffen kaum vorstellbar.
Wir schulden Dir Dank und Anerkennung für Deine Tätigkeit als Herausgeber und Schriftleiter der „Stimmen von Sandau“. Für Deinen unermüdlichen Einsatz spreche ich Dir als Nachfolger ein herzliches Vergelt‘s Gott aus. Unser Herrgott schenke Dir noch viele Jahre. Josef Plahl
Vor einiger Zeit schickte Alois Schubert der SdZ folgenden Bericht über „Zwei Raritäten aus Böhmen und Mähren“. Schubert kam am 14. Dezember 1929 in Mährisch Schönberg im Altvaterland zur Welt. Er floh auf abenteuerlichen Wegen nach Wien, verlor den Kontakt zu seinen Eltern, machte in Wien Abitur und fand seine Eltern nach der Vertreibung wieder im baden-württembergischen Plüderhausen im Remstal. Er wurde Lehrer und war von 1968 bis zu seiner Pensionierung 1994 Rektor der Grund- und Hauptschule in Aalen-Fachsenfeld. Dort lebt er heute noch.
Kürzlich fiel mir ein altes Kochbuch über die Österreichische Küche in die Hände. Der wohlerhaltene Band aus dem Jahre 1913 ist in dunkelblaues Leinen gebunden und sehr voluminös. Sein Inhalt sind unzählige, nach vielerlei Kategorien geordnete Rezepte. Dieses Kochbuch ist gleichzeitig ein Lehrbuch, denn es enthält auch „Anleitungen zur Erlernung der Kochkunst“.Das Deckblatt nennt eine achte Auflage von 31 000 bis 35 000 Exemplaren, spricht von „vielfach vermehrt und verbessert“ mit „Textilillustrationen und Tafeln“. Als Erscheinungsorte sind Wien, München und Leipzig aufgeführt. Die deutlich hervorgehobene Namensnennung gilt der Autorin Marie von Rokitansky.
Ich bin kein aktiver Koch und will auch keiner mehr werden. Ich meine mit dem „Österreichischen Kochbuch“ nun allerdings einen wertvollen Schatz, eine wahre Rarität zu besitzen. Natürlich habe ich mich mit dem interessanten Objekt noch weiter beschäftigt.
Beim Blättern stieß ich auf ein Lesezeichen, das nach meiner Meinung hier absolut unpassend war. Es war ein hellgraues Kärtlein, kleiner als eine Postkarte, mit der markanten Aufschrift „Teilnehmer-Karte“. Es sollte zu einer überregionalen Veranstaltung, „zum Deutschen Katholikentage für das Sudetenland“ in meiner Heimatstadt Mährisch Schönberg für den 3., 4. und 5. Juli 1920 einladen. Nun hatte ich also eine weitere Rarität, mehr als 100 Jahre alt, gefunden. Die Jahreszahl 1920 machte mich neugierig, mehr über diese Epoche sowie über den Anlaß und die Hintergründe der Veranstaltung zu erfahren.
Ich kann an diesem Deutschen Katholikentag nicht teilgenommen haben, weil ich erst im Jahr 1929, also neun Jahre später, zur Welt kam. Allerdings sind mir die Namen von drei der Einladenden aus meiner Kinderzeit bekannt: Bartel, Schinzel und Blaschke. Vor allem der Name Hans Bartel ist mir wichtig, weil ich immer noch enge freundschaftliche Verbindungen zu seinen Nachfahren pflege. Von Josef Schinzel (1869–1944) weiß ich, daß er der letzte deutsche Weihbischof der Erzdiözese Olmütz war. Alois Blaschke leitete bis Frühjahr 1938 in sehr schwierigen Zeiten die Geschicke der Stadt als Bürgermeister.
Aus dem Text der Karte ist zu
Ein Kochbuch und eine Teilnehmer-Karte
entnehmen, daß keine zwei Jahre nach dem Großen Krieg schon eine Organisation für die deutsche Bevölkerung, die gegen ihren Willen der neuen Tschechoslowakischen Republik einverleibt worden war, aufgebaut wurde. Die Jahreszahl 1920 fordert dazu heraus, sich intensiv mit den Zeitläuften jener Monate zu befassen. Seit Ende des Ersten Weltkrieges waren noch keine zwei Jahre vergangen. Er hatte mit dem Sieg der Alliierten sein Ende gefunden. Damit brach die Doppelmonarchie ÖsterreichUngarn zusammen beziehungsweise auseinander. Die Bürger hatten damit ihre jahrhundertealte Zugehörigkeit zum Habsburgerreich verloren. Fast alle Menschen, die 1920 in Mährisch Schönberg lebten, hatten den Krieg selbst erlebt und erlitten und waren verurteilt, seine Folgen zu tragen.
Um den Wert der TeilnehmerKarte aus dem Jahre 1920 und ihre Bedeutung verstehen zu können, umreiße ich die einschlägigen historischen Ereignisse.
Damit will ich den Wert des mehr als 100 Jahre alten Dokuments versuchen zu deuten.

Für die siegreichen Alliierten hatte USA-Präsident Woodrow Wilson schon im Januar 1918 in seinem „14-Punkt-Programm“
die Neugestaltung des mitteleuropäischen Raumes umrissen.
Punkt 10 betont: „Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz unter den Nationen wir gefestigt und gesichert zu sehen wünschen, soll die freieste Möglichkeit autonomer Entwicklung gewährt werden.“
Wilsons Programm legten die einzelnen Volksgruppen natürlich im jeweiligen eigenen Sinne aus. Der ergänzende Zusatz Wilsons „keine Annexionen gegen den Willen der beteiligten Völker“ bestärkte die Sudetendeutschen in ihrem Streben gegen ihre Integration in einen tschechisch dominierten Staat.
Am 28. Oktober 1918 riefen tschechische Politiker in Prag die Tschechoslowakische Republik (ČSR) als souveränen Staat aus. Sie nahmen dabei die historischen Grenzen der Länder Böhmen, Mähren und ÖsterreichischSchlesien als Staatsgrenzen in Anspruch. Bei der Grenzziehung wurde das Nationalitätenprinzip nicht berücksichtigt. Die ČSR verstand sich als Nachfolgestaat der Monarchie Österreich-Ungarn. Die Bevölkerung wurde ohne Abstimmung übernommen. Der neue Staat, der 1938 endete, hatte eine Bevölkerung von etwas mehr als 14 Millionen Menschen, die zu acht verschiedenen Nationen gehörten, darunter etwa 3,3 Millionen Deutsche. Die Tschechen selbst zählten 6,7 Millionen. Somit war wieder ein Vielvölkerstaat entstanden wie es die alte Monarchie gewesen war. Diesen neuen Staat bestätigte die Pariser Friedenskonferenz am 10. September 1919 im Staatsvertrag von Saint Germain.

Im Sinne von Woodrow Wilson war am 30. Oktober 1918 für das gesamte geschlossene deutsche Siedlungsgebiet im Alpen- und Donauraum die erste demokratische Repu-




blik Deutsch-Österreich entstanden. Eine konstituierende Nationalversammlung bestätigte die
Staatsbildung mit der Tendenz zum Anschluß an das Deutsche Reich. Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien entschieden sich am 29. Oktober 1918 mit überwältigender Mehrheit für einen Anschluß zu Deutsch-Österreich und erklärten die sudetendeutschen Gebiete zu einer Provinz Deutsch-Österreichs. Am 12. November 1918 verabschiedete die Provisorische Österreichische Nationalversammlung das Gesetz „Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik“. Die Verfassungsgebende Nationalversammlung in Weimar bestätigte am 21. Februar 1919 mit Zustimmung sämtlicher Fraktionen diesen Rechtsakt.



Die Alliierten Siegermächte ignorierten diese Bekundung der Zusammengehörigkeit der Deutschen. In einer Note an die deutsche Reichsregierung erklärten sie, daß die Angliederung Deutsch-Österreichs an das Deutsche Reich nicht zugelassen werde.

Nach der Ausrufung der Tschechoslowakischen Repu-
blik folgten rasch weitere Maßnahmen. Den Weg in die Zukunft bestimmte zunächst ein nicht gewähltes Parlament. Eine Provisorische Verfassung vom 13. November 1918 ermächtigte sich selbst, Gesetze zu erlassen. Sie wählte am 14. November 1918 Tomáš G. Masaryk zum ersten Staatspräsidenten. Zu diesem Zeitpunkt weilte Masyryk noch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sanktionierte die illegale Besetzung der Slowakei und der Sudetengebiete. Am 1. Juni trat das erste gewählte Parlament zusammen. Die selbsternannte Nationalversammlung setzte für 15. Juni 1919 Neuwahlen für die Gemeinderäte an. Am 15. Juni schlossen die Siegerstaaten mit der Tschechoslowakei einen Staatsvertrag. Zu den ersten Gesetzen, die dem tschechischen Volk Vorteile brachten, gehörte das Schulgesetz vom 3. April 1919. Es ermöglichte den Bau von tschechischen Minderheitenschulen in den Gebieten der Deutschen und Ungarn. Das Enteignungsgesetz vom 16. April 1919 ermöglichte, in nichttschechischen Gebieten Tschechen anzusiedeln, schrittweise erfolgte dies auch in Mährisch Schönberg. Tschechisches Militär hatte die Stadt schon am 15. Dezember 1918 besetzt.

Bei der Teilnehmer-Karte faszinierten mich sofort die Wörter Mährisch Schönberg und Bartel. Bartels wohnten in nächster Nachbarschaft von Schuberts. Wir pflegten engste freundschaftliche Kontakte. Eine glücklich Fügung war, daß beide Familien nach der Vertreibung neue Wohnorte in einer überbrückbaren Distanz voneinander zugewiesen bekamen. So wurde die Freundschaft selbstverständlich fortgesetzt und auf die folgenden Generationen übertragen. Und wir pflegen sie noch heute. Von den Großeltern Bartel bis zu deren Nachfahren lernte ich sieben Generationen dieser Familie kennen. Wohl auch eine Rarität. Über den auf der TeilnehmerKarte für den Ortsausschuß siginierenden Hans Bartel kann ich berichten, daß er neben seinem Engagement in der Deutschen Christlich-Sozialen-Volkspartei für diese Stellvertretender Bürgermeister in Mährisch Schönberg war und für diese Partei auch vier Jahre lang als Abgeordneter im Prager Parlament saß. Er war Vorsitzender des deutschen katholischen Turnvereins in der ČSR. Nach der Vertreibung faßte die Familie Bartel im mittelfränkischen Dinkelsbühl Fuß. Sein Engagement in der CSU setzte er zugunsten der Vertriebenen ein. An seiner Beerdigung 1957 konnte ich teilnehmen. Nach der Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft wurde sein Schwiegersohn Hans Geißler in Dinkelsbühl Stadtbaumeister. Ihm verdankt Dinkelsbühl den Erhalt seiner historischen Atmosphäre. Sein Verdienst ist, daß der USA-Nachrichtensender CNN lauf „Fokus“ kürzlich Dinkelsbühl als eine der schönsten Städte Europas bezeichnete: „Im Ranking vertritt es ganz Deutschland.“ Bereits vorher war Dinkelsbühl als schönste Altstadt Deutschlands gekürt worden. Dieter Geißler, der Sohn des Stadtbaumeisters, wirkte in Dinkelsbühl als Stellvertretender Direktor des Gymnasiums. Dessen Sohn praktiziert als Oberarzt am Klinikum in Ingolstadt und freut sich über aktiven Nachwuchs.
Obwohl ich mich sehr für die Geschichte Mährisch Schönbergs interessiere, hatte ich bis zu meinem Fund noch nie etwas von dieser Veranstaltung gehört. Wahrscheinlich ist meine Teilnehmer-Karte das einzige Exemplar seiner Art in der Bundesrepublik. Schließlich erhielt ich vom Heimatkreisverein Mährisch Schönberg im hessischen Bad Hersfeld eine Kopie der Broschüre „Erinnerung an den Katholikentag. Mährisch Schönberg Juli 1920“.
Die Schrift belegt, daß mehr als 7000 Besucher an zahlreichen Veranstaltungen über unterschiedliche Themen mit hochkarätigen Fachleuten teilnahmen. Sie ist reichlich illustriert und zeigt Bilder von geistlicher Prominenz wie Leo Kardinal Skrbenský von Hříště oder Brünns Bischof Pater Johann Norbert Klein, von weltlicher Prominenz, von hochkarätigen Referenten, von aktiven Geistlichen und Laien, vom Festzug, von Gottesdiensten und Vortragsveranstaltungen, und nicht zuletzt vom ansehnlichen Mährisch Schönberg. Was man nicht alles in einem alten Kochbuch findet.
Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Die Geschichte der nordböhmischen Stadt Deutsch Gabel – Teil X
Soldaten aller Herren Länder in der Stadt
Dem Aufmarsch der Franzosen im August folgte im September der Durchmarsch der Russen. Vom 21. bis 29. September zogen 80 000 Mann durch die Gegend. Die erste Gruppe aus etwa 4000 Mann wurde in Brins einquartiert. Am 22. September kam die zweite Mannschaft. Sie wurde aufgeteilt und nach Wartenberg, Hennersdorf und Neuland geschickt. Die Zuweisungen hatte Stadtrat Franz Turek als kaiserlicher Kommissar vorzunehmen. Am 26. September kam ein neuer Heerhaufen und dann eine Abteilung Kosaken. Die einen hatten große Bärte, die anderen waren rasiert. Ihnen folgte ein Bataillon Landwehrmänner.
Diese trugen keine Hemden, sondern ein ärmelloses Untergewand aus Hanffaden auf dem bloßen Oberkörper. Über dieses hatten sie einen gefütterten Bauernrock gezogen. Die Hosen waren auch aus Hanffäden angefertigt und von roter oder blauer Farbe, die Stiefel ganz zerfetzt. Trotz der elenden Kleidung und der großen Verletzungen an den Füßen zeigten sie keine Ungeduld. Ganz für Gott eingenommen, erhoben sie Hände und Augen zum Himmel und machten große Kreuze. Sie neigten sich bis zur Erde und küßten sie. Die gleiche Ehre erwiesen sie den Heiligenbildern, die sie mit entblößtem Haupte andächtig anschauten.
Ihre Sitten beim Essen waren sonderbar. Die Teller schoben sie beiseite. Das Fleisch wurde auf dem Tisch zerteilt. Alle griffen mit den Händen zu. Dann schlürften sie die Brühe nach und aßen Brot dazu. Die Kartoffeln zerquetschten sie zu einem Teig, in den sie soviel Butter mengten, als Kartoffelteig war. Vor dem Essen trank jeder zwei Gläser Branntwein, ebenso nach dem Essen. Dann goß jeder noch eine halbe Maß Bier hinunter.
Vom 27. bis 29. September sollten wieder Russen in und bei Gabel lagern. Die Lebensmittelzufuhr hatte sich verzögert, und so zogen sie weiter bis nach Neuland bei Niemes. Um die Verpflegung einigermaßen zu sichern, führte jedes Regiment eine Herde Kühe und Schafe mit sich. Diese Herden wurden nicht auf der Straße, sondern über die Wiesen und Felder getrieben. Das Vieh, nicht gepflegt, verendete massenhaft. Die Tierleichen verpesteten die Luft. Viehkrankheiten leerten die Ställe der einheimischen Bauern. Die russischen Durchzüge waren schrecklich, die Einquartierungen noch schrecklicher. Oft wurden die Bewohner mißhandelt. Aber auch dieser Schrecken hatte ein Ende.
Die Preußen 1866 in unserer Stadt Der kurze Deutsch-Dänische Krieg im Jahre 1864 verlief unter preußischem Oberbefehl glücklich. Im Wiener Frieden mußte Dänemark Schleswig-Holstein und das Herzogtum Lauenburg an Preußen und Österreich abtreten. Diese Provinzen kamen unter die gemeinsame Verwaltung von Preußen und Österreich. Otto von Bismarck aber wollte die Herzogtümer Preußen einverleiben. Dem widersetzte sich Österreich. Auf österreichischen Antrag beschloß der Bundestag am 14. Juni 1866 die Mobilmachung des Bundesheeres gegen Preußen. Der Deutsche Krieg begann. In der Schlacht bei Königgrätz siegte am 3. Juli 1866 Preußen. Im Frieden zu Prag wurde Österreich geschont, damit ei-

ne spätere Wiederannäherung möglich bleiben sollte. Das war ein Schachzug der schlauen Politik Bismarcks. Dagegen annektierte Preußen die Herzogtümer Schleswig-Holstein, Lauenburg, Kurhessen, Nassau, Hannover und Frankfurt am Main. Der Deutsche Bund wurde aufgelöst und Österreich ganz aus Deutschland verdrängt. Vorboten dieses Krieges waren für unsere Heimat 17 Radetzky-Husaren, die am 25. Mai 1866 durch die Stadt ritten. Dann kamen zwei Abteilungen Husaren. Die eine blieb in Gabel mit dem Auftrag, einen Einfall der Preußen bei Petersdorf, Krombach, Paß und Freudenhöhe zu verhindern.
Mitte Juni tauchte das Gerücht auf, die Preußen seien in Zittau eingerückt und hätten dort große Forderungen gestellt. Große Furcht ergriff alle. Die Bauern aus Lückendorf, Petersdorf und Herrndorf trieben das Vieh tiefer ins Land. Die jungen Männer flüchteten, als sie von den sächsischen Flüchtlingen vernommen hatten, daß die Preußen alle tauglichen Männer ins Heer steckten.

Am 23. Mai rückten die Preußen gegen Gabel vor, ohne den geringsten Widerstand zu finden. Nachmittag um fünf Uhr kam ein anderer Zug. Die Stadt mußte dem Kommandanten sechs Zentner Heu, zehn Zentner Stroh, zehn Strich Hafer, 2000 Hufnägel, 200 Pfund Brot, 80 Pfund Rindfleisch, 30 Pfund Speck, zehn Pfund Zucker, einen Eimer Bier und drei Flaschen Rum liefern.
Am 25. Mai brachen die Preußen von drei Seiten in den Gabler Kessel ein: von Rumburg,


Waltersdorf und Zittau. Von den Truppen blieben etwa 18 000 Mann in der Stadt. Alle Häuser waren mit Soldaten überfüllt; in manchen Häusern waren 100 bis 160 Mann zusammengepfercht. Über ihr Verhalten gegen die Bürger konnte man sich nicht beklagen. Was die Religiosität der katholischen Rheinländer und Westfalen anbelangte, gaben sie der Bevölkerung ein gutes Beispiel. Die Priester waren bis tief in die Nacht hinein in den Beichtstühlen. Um halb drei Uhr in der Nacht spendete Pfarrer Josef Kaspar an 1000 Mann die Heilige Kommunion. Man sah viele Soldaten, darunter hohe Offiziere, auf den Knien vor dem Altar in stillem Gebet versunken.
Am 26. Mai marschierten diese Truppen wieder weiter. Nach diesen kamen 12 000 Mann, 1200 wohnten im Schloß, die übrigen in der Stadt. Auch diese Mannschaft unterschied sich sehr vorteilhaft von den übrigen Truppen. Ganz anders verfuhr der kommandierende General mit der Gemeinde. Er forderte mehrere Vorspannpferde, die man beim besten Willen nicht auftreiben konnte.
Bürgermeister Wilhelm Ergert, schon ganz erschöpft von seinen Vermittlungsbemühungen, suchte Hilfe im Pfarramt. Stadtpfarrer Josef Kaspar begab sich mit einigen angesehenen Bürgern zum General und bat um Schonung für die ganz verarmte Stadt. Alles Bitten blieb vergeblich. Der General ordnete eine strenge Hausdurchsuchung an. Im Bräuhaus fand man in einer Kiste eine Husarenuniform, zwei Säbel und Pferdedecken. Dar-
über entstand unter den Preußen eine furchtbare Aufregung. Der General und die Offiziere behaupteten, daß Grüfte und geheime Gänge vorhanden sein müßten, worin sich die Österreicher versteckt hielten. Im Schulgarten wurden tiefe Löcher gegraben und die Erde mit Stangen durchwühlt. Ein Bräuer, der durch seine fesche Erscheinung einem Husaren glich, wurde festgenommen. Der General war wütend vor Zorn und sagte, er werde das ganze Nest ausbrennen, wenn noch etwas Verdächtiges gefunden werde.
Von da an waren Plünderungen an der Tagesordnung. Die Soldaten drangen in das Bräuhaus und in die Branntweinläden ein. Was sie nicht austrinken konnten, nahmen sie mit. Bürgermeister Ergert machte wegen dieses Treibens Vorstellungen beim Kommandanten, dann schaffte dieser Ordnung. Am 20. August zogen Soldaten des Regiments König Friedrich IV. in Gabel ein.
Ihr Kommandant Major Stantig, ein roher Kriegsmann, dem alle Wohnungen in Gabel zu schlecht waren, schikanierte die Bürger auf alle mögliche Weise. Um sein inhumanes Vorgehen etwas zu bemänteln, ließ er im Schloßgarten zu Gunsten der Armen die Militärmusik spielen. Am 3. September 1866 verließen die Truppen unsere Stadt.
Die Jahre 1823 bis 1914



Mit einem Ereignis besonderer Art beginnt der Bericht über die Geschehnisse bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Im Ortsteil Markersdorf wurde 1823 in der Fabrik des Josef Kittel die
erste englische Dampfmaschine Böhmens in Betrieb genommen. Die Aufstellung dieser Maschine war ein großes Ereignis, zu dem aus der weiten Umgebung Industrielle, Kaufleute und Gelehrte kamen, um dieses Wunderwerk der Technik zu bestaunen. Sogar die k. k. private „Prager Zeitung“ vom 23. Dezember 1823 berichtete über dieses Ereignis ausführlich.
Das Freiheitsjahr 1848 verlief in unserer Heimatstadt ohne sonderliche Ereignisse, die Konstitutionsverkündigung wurde von der gesamten Bevölkerung mit großem Jubel aufgenommen, der Bauer war endlich frei, der Geist Metternichs erledigt. Die Herrschaftsgüter von Gabel wechselten in diesem Jahr wiederum ihren Besitzer, sie kamen an Franz Josef Berka.
Am 1. Februar 1850 trat die k. k. Bezirkshauptmannschaft Gabel, in deren Verwaltungsbereich der Gerichtsbezirk Zwickau einbezogen wurde, in Wirksamkeit, einige Monate später übernahmen in beiden Städten die neugeschaffenen Bezirks-Gendarmeriekommandos ihren Dienst.
Von der nach 1866 im nordböhmischen Raum allgemein einsetzenden Industrialisierung wurde Gabel nicht erfaßt. In diesem Jahrzehnt wurden die meisten Vereine gegründet, nämlich 1860 der Veteranenverein, 1862 der Deutsche Turnverein, 1863 der Männer- und Damengesangsverein „Eintracht“ und 1865 die Freiwillige Feuerwehr. 1867 erfolgte der Verkauf der Herrschaftsgüter an den sächsischen Baron Palme, der sie 1878 an Franz Mattausch veräußerte.
Das heute noch stehende und wohl den meisten bekannte Bürgerschulgebäude wurde in den Jahren 1870 und 1871 erbaut und unter großer Beteiligung der Bevölkerung im Herbst 1871 feierlich eingeweiht. Fortsetzung folgt
LESERBRIEF
DDR marschierte nicht ein
Zum Artikel „Sowjetinvasion vor 55 Jahren“ von Stanislav Beran über die Feier Ende August in Gablonz, die des Einmarsches der Warschauer-PaktTruppen 1968 gedachte (➝ RZ 36/2023).

❯ Zwickau und Erinnerungen an das Kriegsende – Teil II und Schluß
Odyssee nach Baden-Württemberg

Die aus Zwickau stammende Waltraud Joist/Hanisch berichtet in dieser Serie über die Erlebnisse ihrer Familie nach dem Kriegsende 1945. Hier der zweite Teil.
Am 31. Juli 1946 um 17.30 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Die meisten Leute standen um die Zugtür herum, um bis zuletzt die geliebte Heimatstadt im Blick zu haben, viele weinten.
Der Zug fuhr zunächst nach Deutsch Gabel. Dort kamen noch mehr Waggons mit Einwohnern von dort dazu, bis der Zug 40 Waggons zählte. Am 31. Juli begann die Fahrt über Leipa und Tetschen durch das schöne Elbetal und bei Bad Schandau über die Grenze bis Pirna. Hier wurden das Gepäck und die Menschen in einen anderen Zug umgeladen. Bald erreichten wir Dresden. Unvergeßlich ist mir die Fahrt durch diese zerstörte Stadt geblieben, stundenlang fuhren wir nur durch Ruinen. Unser Zug zuckelte dann mit vielen Aufenthalten tagelang durch die Sowjetzone. Die Verpflegung war äußerst dürftig, das mitgenommene getrocknete Brot bald aufgebraucht.

Am 9. August erreichten wir endlich Treuenbrietzen (➝ Bericht unten) und kamen in ein Quarantänelager. Dort bekamen
wir mit einer anderen Familie, die auch aus vier Personen bestand, einen Raum. Wir wurden entlaust und geimpft und nach 14 Tagen nach der vorherigen Erwerbstätigkeit eingeteilt in neue Transporte. Mit zwei Eisenbahnwaggons voll Menschen kam unsere Familie am 17. August in Senftenberg in der Niederlausitz an. Es war Sonntag, und man wußte nichts von unserer Ankunft. So dauerte es eine Weile, bis man jemanden vom Rathaus aufgetrieben hatte, der weiteres veranlassen konnte. Schließlich fand man ein paar leerstehende Baracken, in denen man uns unterbrachte, wieder zwei Familien in einem Raum. Bei den Behörden lief alles sehr zügig. Am 19. August meldete uns mein Vater bei der Meldebehörde, beim Wohnungs- und Arbeitsamt und bei der Kartenstelle an. Wir bekamen ein paar Lebensmittelmarken und konnten darauf unseren ersten Einkauf tätigen: Kartoffeln und Gurken. Kochen mußten wir nämlich in einer Gemeinschaftsküche selber. Bereits am 3. September trat mein Vater eine Arbeitsstelle an. Auch eine Wohnung wurde uns bald zugewiesen, das heißt, wir wurden bei einer fünfköpfigen

Familie einquartiert, die uns zwei Zimmer abtreten mußte. So war das Verhältnis zu unseren Vermietern etwas angespannt.
Wir waren daher froh, im Jahr darauf eine zwar auch beengte Wohnung – ein sehr großes Zimmer – aber mit etwas mehr Freiraum, nämlich einem eigenen Zugang, separatem Freiluft-
WC, einem Stück Garten und vor allem einer netten Vermieterin zu finden. Geprägt war diese Zeit vor allem für die Eltern von ständigem Hunger und der Suche nach zusätzlichen Nahrungsmitteln. Hamsterfahrten in Bauerndörfer, Ährenlesen und Kartoffelstoppeln, Schwarzhandel mit aus dem Westen geschickten Waren, überhaupt Pakete von Verwandten aus dem Westen, einmal auch zwei Carepakete aus den USA milderten die schlechte Versorgungslage manchmal.
Mein Vater machte 1947 eine Erkundungsfahrt in den Westen, besuchte unsere Verwandten und seinen früheren Arbeitgeber. Er wollte erkunden, ob es für uns nicht auch eine Möglichkeit gäbe, nach Westdeutschland zu kommen. Arbeit hätte er schon finden können, aber keine Wohnung, und ohne die gab es keine Zuzugsgenehmigung. 1948 beschlossen meine Eltern, daß mein Vater zunächst allein einen neuen Start versuchen sollte, und so verließ er im August illegal die Ostzone. Besonders für meine Mutter begann eine schwere Zeit. Sie mußte bei den Behörden so tun als hätte mein Vater die Familie im Stich gelassen. Auf einigen Umwegen konnte mein Vater uns Geld zukommen lassen. Auch schickte er so viele Päckchen wie erlaubt waren, die unter anderem auch Süßstoff enthielten, den wir gut verkaufen konnten. Im Sommer 1949 kam mein Vater zurück und holte seine Familie. Alles war illegal: seine Einreise, sein Aufenthalt bei uns, unser gemeinsamer Grenzübertritt bei Duderstadt. Wir mußten alles streng geheimhalten, und nur wenige Bekannte wußten davon und bangten mit
uns um ein gutes Gelingen unseres Vorhabens. Alles klappte wie geplant, und so begann das Leben im Westen für uns im August 1949 im Ruhrgebiet. Endlich waren die Hungerjahre vorbei. Leider gab es wohnungsmäßig einen Rückschritt. Wir mußten über ein Jahr in einem Keller hausen, bis wir endlich eine Kleinwohnung bekamen. Wir hatten 30 Quadratmeter für vier Personen ohne Bad, aber welch ein Fortschritt bedeutete das für uns. So nach und nach ersparten sich die Eltern wieder einige eigene Möbelstükke und ersetzten damit die improvisierte Möbelierung.
Da unsere Verwandten alle in Süddeutschland gelandet waren, hatten wir schon länger den Wunsch, durch einen Umzug ihnen näher zu kommen. 1961 fanden Vater und Bruder Arbeit in Baden-Württemberg, und endlich, 15 Jahre nach der Vertreibung, auch eine ausreichend große Wohnung für die Familie. Meine Mutter konnte diese leider nur noch sechs Jahre genießen, dann starb sie. Ich selbst wohne mit meiner Familie nun schon lange ebenfalls in Baden und fühle mich hier wohl. Eine besondere Freude ist es für mich immer wieder, wenn ich meiner Heimat Zwickau in Böhmen einen Besuch abstatte.
Im Kampf gegen Wölfe und Schweinepest
In diesem Jahr brachten Wölfe, die in der Region Friedland und an der polnischen Grenze leben, sieben Welpen zur Welt. Und der Kreis Reichenberg will sich am Kauf von Kühlgeräten für die Lagerung wegen Schweinepest erlegter Wildschweine beteiligen. Stanislav Beran berichtet.
Die Vergrößerung des Wolfsrudels um Friedland bestätigten Beobachtungen von Freiwilligen und zufälligen Zeugen. Das hier lebende Rudel besteht nun aus vier erwachsenen Wölfen und sieben Jungtieren.

Beweise für Wolfsbewegungen in diesem Gebiet werden seit 2018 von Freiwilligen der sogenannten Wolfspatrouillen registriert, aber auch die gemeldeten Sichtungen aus der Bevölkerung lassen darauf schließen, daß Wölfe hier schon seit mehreren Jahren regelmäßig auftauchen.
Ihre Wege und ihr Kot, die in der Gegend entdeckt wurden, sind ein Beweis dafür, daß Wölfe in diesem Gebiet leben. Auch die Aufnahmen von Fotofallen bestätigen dies regelmäßig. Das nächstgelegene Rudel befindet sich im Isergebirge. Beide Wolfsgebiete sind grenzüberschreitend und erstrecken sich sowohl auf die Tschechische Republik als auch auf das benachbarte Polen, wo der Wolf ebenso wie in der Tschechischen Republik ganzjährig unter strengem Naturschutz steht.
Die Tatsache, daß es gelungen ist, die Vermehrung des Wolfsrudels in der Region Fried-
land zu bestätigen, ist ein weiterer Beweis dafür, daß Wölfe anpassungsfähige Lebewesen sind und auch in den vom Menschen veränderten Landschaften leben können.
Jetzt liegt es an den Menschen, sich an die ständige Anwesenheit von Wölfen in ihrem Lebensraum zu gewöhnen und nicht nur ihre Schafe, sondern auch Nahrungsreste beziehungsweise Mülltonnen zu sichern. Nur so kann das Zusammenleben mit den in diesen Landschaften heimischen Raubtieren funktionieren. Um Schäden an Haus-
Die Landwirte haben im Falle eines Wolfsangriffs Anspruch auf Schadenersatz.
Auch in der Sache Schweinepest gibt es Neuigkeiten. Im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest bereitet der Kreis Reichenberg ein neues Subventionsprogramm vor.
Er will den Kauf von Kühlanlagen unterstützen, in denen Jäger erlegte Wildschweine lagern können, bis sie die Ergebnisse der Laboruntersuchungen von der Veterinärverwaltung erhalten. Das Programm wird voraussichtlich zwei Millionen Kro-
von bis zu 126 Kühlgeräten gefördert werden kann, falls die Jäger daran interessiert sind. Die Zuschüsse werden rückwirkend für Kühlgeräte gewährt, die bis zum Ende dieses Jahres angeschafft werden. Der Antragsteller kann maximal die Hälfte des ausgegebenen Geldes erhalten.
Die Afrikanische Schweinepest ist eine akute Krankheit, die der klassischen Schweinepest ähnelt, aber ihre Symptome sind schwerer und ihr Verlauf schneller. In fast allen Fällen sterben die infizierten Tiere. Es gibt keine Heilung für die Krankheit,
„Es ist kaum zu glauben, aber es ist 55 Jahre her, daß die Armeen der fünf kommunistischen Länder des Warschauer Paktes im Rahmen der Operation Donau die Tschechoslowakei besetzt haben“, zitiert Stanislav Beran den Gablonzer Bürgermeister Miloš Vele. Die Warschauer-Pakt-Staaten waren seit dem 14. Mai 1955 die UdSSR, die ČSSR, die Sozialistische Volksrepublik Albanien, die Volksrepublik Polen, die Volksrepublik Bulgarien, die Sozialistische Volksrepublik Rumänien, die Volksrepublik Ungarn und die DDR. Die Sowjetunion, Polen, Ungarn und Bulgarien beteiligten sich mit Soldaten am Einmarsch. Die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR marschierte nicht in den Nachbarstaat ein.
Die NVA war zwar in die Vorbereitungen für den Einmarsch einbezogen worden. Der Beschluß ihrer Nichtteilnahme fiel jedoch erst wenige Stunden vor dem Beginn der Militäraktion und wurde auch dann erst der NVA-Führung mitgeteilt. Die Truppeneinheiten der NVA standen zwar praktisch mit laufenden Motoren direkt an der Grenze, um notfalls die anderen Truppen unterstützen zu können. Sie selbst betraten das Territorium der ČSSR jedoch nicht.
Das hatte vor allem ideologische Gründe. Die Bürger der ČSSR sollten vermutlich 30 Jahre nach dem Münchener Abkommen von 1938 nicht wieder dem Anblick deutscher Truppen ausgesetzt werden. Nichtsdestotrotz berichtete die Presse in der DDR fälschlicherweise offiziell von einer aktiven Teilnahme am Einmarsch.
jagt wurden, sowie bei einem in der Region Bömisch Leipa.
In der Region Reichenberg wurden zwei Sperrzonen eingerichtet, in denen sich die Fundorte der infizierten Tiere befinden – eine in der Region Friedland und die andere in der Region Böhmisch Leipa. Die Zonen erstrecken sich über insgesamt 44 Gemeinden. Sie sind von einer Pufferzone namens Sperrzone I umgeben, die 166 Katastergebiete umfaßt und sich von der tschechisch-polnischen Grenze über den Hirschberger Großteich/Máchovo jezero hinaus bis nach Weißwasser/Bělá pod Bezdězem und Backofen an der Iser/Bakov nad Jizerou in der mittelböhmischen Region erstreckt. Im gesamten Gebiet dürfen nur geschulte Jäger Wildschweine jagen. Jedes erlegte Tier muß auf die Schweinepest untersucht werden.
Von den acht WarschauerPakt-Staaten – oder Warschauer Vertragsorganisation, wie sich die Teilnehmerstaaten selbst offiziell nannten – marschierten nicht fünf, wie der Gablonzer Bürgermeister Miloš Vele sagte, sondern nur vier ein. Nicht einmarschiert waren neben den Soldaten der DDR Soldaten aus Albanien, Rumänien und der Tschechoslowakei. Peter Barth 18356 Barth
KREIS DEUTSCH GABEL
tieren zu vermeiden, sollten die Landwirte ihre Herden mit hochwertigen Elektrozäunen versehen, ihr Vieh nachts in einen Stall sperren oder die Anschaffung von Herdenschutzhunden einer geeigneten Rasse erwägen. Für die verletzten, vermißten und von Wölfen getöteten Nutztiere – das sind vorwiegend Schafe – kann jetzt eine Entschädigung gefordert werden.
nen kosten und muß noch vom Regionalrat genehmigt werden.
Dank des Zuschusses könnte die Kapazität für die Lagerung der abgeschossenen Tiere erhöht werden, bis klar ist, ob das Tier in Ordnung ist und verzehrt werden kann oder ob es nicht in Ordnung ist und zur Beseitigung in eine Tierkörperbeseitigungsanstalt gebracht werden muß. Vorgesehen ist, daß die Anschaffung
und infizierte Schweine müssen geschlachtet werden. Die Krankheit ist für Menschen und Hunde nicht gefährlich, aber sie können Überträger der Krankheit sein. Der erste Fall von Schweinepest wurde Anfang Dezember letzten Jahres von Tierärzten in der Region Reichenberg bestätigt. Seither wurde die Krankheit bei mehr als 50 Wildschweinen diagnostiziert, die in der Region Reichenberg gefunden oder ge-
Seit Jahresbeginn haben die Jäger 1042 Wildschweine in der Sperrzone I und weitere 299 in der Zone II erlegt. Mehr als eine Million Kronen an Abschußgebühren und weitere 242 000 Kronen Finderlohn wurden für fast 120 Tiere gezahlt, die Jäger in den beiden Zonen tot oder von Autos angefahren aufgefunden hatten. Um den Anreiz zur Jagd zu erhöhen, wurde im September die Belohnung für ein erlegtes oder gefundenes Wildschwein in der Zone II auf 2000 Kronen vereinheitlicht, während der Staat ursprünglich 1000 Kronen als Abschußgebühr und 3000 Kronen als Finderlohn gezahlt hatte.

Heimatkreis und Gemeindebetreuer gratulieren den treuen Abonnenten aus dem Kreis Deutsch Gabel, die im Oktober ihren Geburtstag feiern, und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes überreichen Segen.
■ Deutsch Gabel – Geburtstag: Am 26. Burgl Krippner/ Kretschmer (Niemeser Straße 195), Eisenmannstraße 13, 87730 Bad Grönenbach, 88 Jahre.

Othmar Zinner
Helga Hecht
■ Hennersdorf – Geburtstag: Am 13. Christa Trappmann/Glathe (Haus-Nr. 20), Feldstraße 82, 47918 Tönisvorst, 87 Jahre. Rosl Machtolf

 Einstiger Bahnhof in Zwickau. Bahnhof in Deutsch Gabel. Bahnhof in Böhmisch Leipa. Bahnhof in Tetschen. Bahnhof in Bad Schandau.
Bahnhof in Senftenberg.
Einstiger Bahnhof in Zwickau. Bahnhof in Deutsch Gabel. Bahnhof in Böhmisch Leipa. Bahnhof in Tetschen. Bahnhof in Bad Schandau.
Bahnhof in Senftenberg.
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau


Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt
Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –
Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegär ten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Bahnhof in Teplitz-Schönau
Rekonstruktion geht zügig voran
� Teplitz-Schönau







August der Starke ist wieder da
Mitte September wurde in Teplitz eine Büste von August dem Starken enthüllt. Der Freundeskreis Teplitz-Schönau war dabei. Jutta Benešová berichtet.
In den Informationen über die Geschichte der Teplitzer Kurbäder wird vor allem auf den Besuch von Johann Wolfgang von Goethe und Ludwig van Beethoven hingewiesen, vor allem auf ihr einmaliges Treffen im Schloßpark 1812. Doch die Teplitzer Bäder können auf eine viel frühere Geschichte hinweisen. Dazu gehört das 1158 von der böhmischen Königin Judith aus Thüringen gegründete Benediktinerinnenkloster. Bereits diese Nonnen nutzten bei der Pflege von Kranken und Siechen das Thermalwasser der Urquelle.
Mitte September wurde nun in der Badegasse nahe der Büste unserer Klostergründerin Judith das Denkmal Augusts des Starken (1670–1733), des Kurfürsten von Sachsen und polnischen Königs, enthüllt. Auch diese Büste hatte, ebenso wie die der Judith, der akademische Bildhauer Libor Pisklák gestaltet. Zur feierlichen Einweihung waren viele Gäste gekommen.

Radek Popovič, Vorstandsvorsitzender der Teplitzer BäderAG, begrüßte Hideo Suzuki, Japanischer Botschafter in Prag, Marius Winzeler, Direktor der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, Markéta Meissnerová, Tschechische Generalkonsulin in Dresden, die Senatoren Martin Krsek und Hynek Hanza, natürlich auch den Teplitzer Oberbürgermeister Jiří Štábl, Jiří Řehák, den Kulturbeauftragten des Bezirks Aussig, und zu guter Letzt Erhard Spacek, Vorsitzender des Teplitz-Schönauer Freundes-




kreises. Alle Ehrengäste waren nach der Einweihung des Denkmals zur einem Essen im Restaurant Beethoven eingeladen. Am Nachmittag fanden kleine Thea-
auf. Bereits Augusts Großmutter väterlicherseits, Magdalena Sibylla, fuhr seit 1657 alljährlich im Frühjahr für einige Wochen hierher, wobei sie von einer Gefolg-
tution und gehörte zu den größten Männern seiner Zeit. Es wird berichtet, daß er beim Bau des Zwingers eigenhändig einen schweren Stein aus Elbsandstein getragen habe, was ihm wohl die Bezeichnung Sächsischer Herkules eintrug. Auch in der Zahl seiner Nachkommen ist er wohl kaum zu übertreffen; Quellen sprechen von 382 unehelichen Kindern, wobei wohl über 80 nachgewiesen sind. Die übrigen 300 unterlagen sicher einer damaligen Übertreibung, die wir heute als „Me too“ bezeichnen würden. Sei es wie es sei.
Im Spätsommer vergangenen Jahres begann die schon lange versprochene Rekonstruktion des Teplitzer Bahnhofes. Bereits im zeitigen Frühjahr war heuer das Dach erneuert. Seither tummeln sich auf den Gerüsten viele Bauarbeiter, die emsig auch an den Wochenenden arbeiten. Schließlich nähert sich der vereinbarte Termin der Fertigstellung des Außenmantels des Bahnhofs unerbittlich.
Über den Teplitzer Bahnhof sagt man, daß er der längste in Tschechien sei. Wer ihn umläuft, hat mindestens einen Kilometer in den Beinen. Viel zu tun haben nun Maurer und Restauratoren, die eine Reihe völlig zerstörter dekorativer Elemente neu herstellen müssen. Die gute Nachricht für die Reisenden ist, daß alle Arbeiten bei vollem Betrieb stattfinden.

teraufführungen in der Badegasse statt, wobei August der Starke persönlich mit seiner Entourage begrüßt werden konnte.
Gerade August dem Starken und seiner Familie verdankt Teplitz den Ruhm seiner Kurbäder, denn der Dresdener Hof hielt sich seit 1550 mit einer einzigen Unterbrechung während des Dreißigjährigen Krieges jedes Jahr in den Frühjahrs- oder Sommermonaten in den Teplitzer Bädern
schaft von 165 Personen und 118 Pferden begleitet wurde. Selbst Augusts Sohn, der spätere Kurfürst und König August III., sparte nicht an seinem Gefolge und reiste sogar mit seiner Hofkapelle an.
Doch niemand konnte August den Starken übertreffen. Er besuchte in den Jahren 1683 bis 1721 ein Dutzend Mal die Teplitzer Bäder, wobei er zum Beispiel 1699 in Begleitung von 1500 Gästen und fast 1000 Pferden anreiste. Das bedeutete für die Stadt nicht nur willkommene Einnahmen, sondern das sächsische Vorbild zeigte auch Wirkung nach außen. Teplitz als beliebtes Kurbad des Dresdener Hofes kam ins Gespräch und in die Korrespondenz der damaligen Aristokratie, und die Nachricht von den wohltuenden Bädern in Teplitz verbreitete sich in Europa. In keinem anderen böhmischen Kurbad hielten sich so viele Kaiser, Könige, Erzherzöge, Fürsten und Prinzen auf.
August der Starke trug seinen Namen nicht umsonst. Er verfügte über eine außergewöhnliche körperliche Konsti-
Außer seiner offensichtlich sehr toleranten Gemahlin Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth leistete ihm in Teplitz beispielsweise 1692 auch die sehr gebildete Gräfin Aurora von Königsmarck Gesellschaft. Voltaire hatte sie als berühmteste Frau zweier Jahrhunderte bezeichnet; sie lebte an der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert. In ihren Briefen beschrieb sie ausführlich die Teplitzer Lustbarkeiten in Gesellschaft des Kurfürsten. Der Sohn, den sie August gebar, war später General in Frankreich. Auch Ursula Katharina von Altenbockum, Reichsfürstin von Teschen und Württembergische Herzogin, war eine Mätresse von August und begleitete ihn regelmäßig nach Teplitz.
Augusts ausgeprägter Sinn für Schönheit mündete in der Verwandlung Dresdens in eine der schönsten Städte Europas. Elbflorenz, wie sich die sächsische Hauptstadt nennt, dankt August dem Starken die Perle des Barocks – den Zwinger. Dessen Errichtung hatte August seinem Hofarchitekten Matthäus Daniel Pöppelmann anvertraut, und die figurale Ausstattung übernahm Balthasar Permoser, dem Teplitz das Relief der Quellfindung zu verdanken hat. Beide Meister waren ebenfalls Gäste der Teplitzer Bäder.
Sehr zu begrüßen ist, daß die Stadt Teplitz sich seiner berühmten Gäste früherer Jahrhunderte entsinnt. Gerade die Badegasse war stets ein beliebter Treffpunkt der Kurgäste. Die Namen der ehemaligen Logier-Häuser wie Goldene Sonne, Pelikan oder Goldene Harfe sind bis heute erhalten und weisen mit ihren Gedenktafeln auf die einst berühmten Besucher hin. Alle diese Häuser gehören nun zum Sanatorium Beethoven und bieten auch heute noch mit ihren Thermalquellen allen Heilungsuchenden Linderung und Genesung.
Die hier tätige Baufirma Chládek & Tintěra aus Leitmeritz muß bis Ende des Jahres 750 000 Quadratmeter Fassade und 5000 Quadratmeter Dach reparieren. Bis Ende 2023 werden die Dächer, der erste Bahnsteig, Fenster, Türen, Regenrinnen und Elektroinstallation erneuert. Gegenwärtig sind etwa 85 Prozent der Dachkonstruktionen, über 100 Fenster und der Abriß der Überdachung des ersten Bahnsteigs vollendet. Das Innere des Bahnhofs kommt dann erst im nächsten Jahr an die Reihe.
Am 28. September, am SanktWenzels-Tag, der hier Staatsfeiertag ist, fand ein Tag der offenen Tür im Bahnhof statt. Einer der Projektanten erklärte interessierten Bürgern den Fortgang der Arbeiten, vor allem an der Rückseite des Objekts. Dort wurde die Überdachung des Bahnsteigs 1 entfernt, um diesen für einen barrierefreien Zugang zum Zug anzuheben. Um die originalen Säulen der Überdachung wiederverwenden zu können, müssen diese nun dem erhöhten Niveau angepasst werden – eine Arbeit für Denkmalschützer und Handwerker gleichzeitig. Auch die Fenster, die in Originalgestalt erhalten bleiben müssen, ergaben manche Probleme, denn dem heutigen Standard entsprechend müssen es nun Doppelfenster sein, für die die Fensterrahmen zu schmal sind. Für Laien ist die Problematik dieser verschiedenen baulichen Anpassungen kaum zu sehen, diese können aber zu unerwünschten Zeitverzögerungen führen. Dagegen erwies sich die Holzkonstruktion während der Dachdeckerarbeiten als ausgesprochen gut erhalten, so daß hier finanzielle Reserven entstanden. Die Frage nach dem jetzigen Stand des Finanzetats für die Rekonstruktion zeitigte die Antwort: „Bisher wurde alles eingehalten, keine Mehrkosten.“ Wollen wir hoffen, daß es so bleibt. Jutta Benešová
Frontseite des in Renovierung begriffenen Bahnhofs. Bild: Jutta Benešová
WIR GRATULIEREN

Unseren Heimatruf-Abonnenten herzliche Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag im Oktober:
n Tischau/Kreis TeplitzSchönau. Gretl Hofmann/Andörfer, Philipp-Müller-Straße 57, 15344 Strausberg, 31. Oktober 1932.
n Bilin. Wolfgang Hilgers, Schreiberweg 5, A-1090 Wien, 26. Oktober 1931.
n Klostergrab, Grundmühlen, Janegg-Krinsdorf, JaneggWernsdorf/Kreis Dux. Christa Dedek/Löwe, Zschernitzer Weg 6a, 04509 Wiedemar, 11. Oktober 1941.
TERMINE
n Freitag, 6. bis Sonntag
8. Oktober, 16. Herbsttreffen des Heimatkreisvereins Bilin in Bilin: Freitag 11.00 Uhr Begrüßung
durch Bürgermeisterin Zuzana Schwarz im Rathaus; 12.00 Uhr Mittagessen im Restaurant U Kádi; 14.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung am Schloß Mireschowitz, anschließend Informationen über Geschichte und Wiederaufbau des Schlosses und Imbiß. Samstag 15.00 Uhr Gedenken am Kreuz der deutschen und
tschechischen Opfer der Weltkriege auf dem Friedhof in Merschlitz, anschließend Programm in der Sankt-Jakobi-Kirche und Besichtigung der Ausstellung „Meine Heimat im Wandel der Zeit“; 18.00 Uhr Abendessen und gemütliches Beisammensein in Kotzauer im Böhmischen Mittelgebirge. Sonntag 10.00 Uhr Gottesdienst in der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche in Bilin, anschließend Beendigung des Heimattreffens.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergHEIMATBOTE

FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ
Heimatkreis


Internet
Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯
Sie waren fleißig, aber arm
Seine Erinnerungen an Nimvorgut zeichnete der ehemalige dortige Lehrer Franz Stich 1971 in Würzburg auf. Und er stellte sie unter den folgenden Leitspruch des Historikers Anton Ernstberger aus dem Nachbarkreis Tachau: „Zu dem vielen, was Heimat heißt, zu dem greifbaren und ungreifbaren, dem körperlichen und seelischen Besitz, der jedem Menschen mit der Heimat gegeben ist, gehört auch ihre Geschichte, ihre Vergangenheit.“

Wenn jemand meinen Bericht über Nimvorgut liest, wird mancher Leser sagen, die Nimvorguter müssen aber alle Engel gewesen sein. Es gab eine einzige asoziale Familie. Wegen dieser kann man doch nicht über die ganze Ortsbevölkerung den Stab brechen.
Daß Ungeziefer in den Häusern hauste, kann nicht verschwiegen werden. Die alten Holzhütten waren ideale Brutstätten für diese Schmarotzer, die nicht mehr auszurotten waren. Wie ich schrieb, war der Haupterwerbszweig das Spitzenklöppeln. Die Frauen wollten viel verdienen – im Winter waren sie die einzigen Verdiener –, also wurde die Körperpflege vernachlässigt.
Läuse, Wanzen und Küchenschaben
Auf einer Schülerin krochen während des Unterrichtes Läuse. Ich gab ihr drei Tage unterrichtsfrei mit dem Auftrag, ihre Mutter – obige asoziale Familie – solle sie reinigen. Diese fühlte sich darüber beleidigt, ging im Dorfe umher und schimpfte über mich. Da gerade Faschingszeit war, so nannte sie mich einen „Zacherl“, soviel wie Hanswurst. Ich meldete diesen Vorfall dem Schulamt in Bischofteinitz.
Dieses gab meinen Bericht an das Bezirksgericht in Taus weiter, Mitte Feber war die Verhandlung. An diesem Tage herrschte sehr starkes Schneegestöber, deshalb schickte die Angeklagte ihren Mann zum Gericht. Der Richter scherte den unschuldigen Mann zusammen. Er gab ihm den Rat, seine Frau möge mich bitten, daß ich mit einer öffentlichen Ehrenerkärung in der Gemeinde einverstanden sei, sonst müsse sie einige Tage ab-
sitzen. Daheim habe ich mir die Sache überdacht und kam zu der Einsicht, daß ich nichts davon hätte, wenn die Frau eingesperrt würde, die Familie aber darunter leide. Am anderen Tage bestellte ich die Frau zum Gemeinderat. Dort bat sie weinend um Verzeihung und erklärte, sie habe aus Unvernunft so gehandelt. Von da an hatte ich keine Klage mehr.
ich eine Wanze darin. Hätte ich nicht gleich nachgesehen, so wäre wohl auch meine Wohnung verwanzt worden.
Vor dem Ersten Weltkrieg wurde über Nimvorgut und seine Bewohner in der Umgebung mehr oder weniger verächtlich gesprochen. Vielleicht hatte auch der Name Einfluß: Niefürgut, Wimmfürgut, Nimvorgut,
er das schöne Schwarzachtal mit vielen kleineren und größeren Orten sowie unzähligen einzeln gelegenen bayerischen Gehöften. Nach Süden erblickte man die Berge des südlichen Böhmerwaldes: Schwarzkoppe (1039 Meter), Hoher Bogen (1079 Meter), Seewand (1343 Meter), Arber (1456 Meter), Osser (1293 Meter) und Rachel (1453 Meter).

1. Dezember bis 7. Januar findet auf Schloß Bischofteinitz eine Krippenausstellung statt. Die Krippenfreunde des Oberen Bayerischen Waldes werden unter ihrem Vorsitzenden Johann Dendorfer aus Furth im Wald wieder mitmachen. Dendorfer berichtet.
Einmal war der Nimvorguter Kaufmann zu mir gekommen. Auf seinem Rocke kroch ein Ruß, eine Küchenschabe. Meine Mutter sah diesen Ruß, getraute sich aber nicht, den Mann darauf aufmerksam zu machen; denn sie befürchtete, er könne beleidigt sein. Der Ruß blieb zurück. Es stellte sich heraus, daß dieser Ruß eine Russin und gesegneten Leibes war, denn nach einigen Wochen war mein Heim mit diesen Biestern überschwemmt. Ein Maurerpolier hat mich von dieser Invasion befreit, indem er meinen Küchenofen an allen offenen Stellen mit Kalk verschmierte und die Fugen zwischen den Fußbodenbrettern mit Zement ausgoß. Ein anderes Mal kam ein Mädchen mit einem Scheck zum Ausfüllen. Als ich ihn entfaltete, sah
Nimmergut und so weiter. Ein Teil der Schuld konnte auch an der mangelhaften Schulbildung liegen. Durch die Errichtung der Volksschule erlebte Nimvorgut seine Wiedergeburt. Es wurde den anderen Dörfern gegenüber gleichberechtigt.

Nimvorgut/Nuzarov
In einer größeren Waldlichtung am Nordhang des Schauerberges mit 886 Metern Höhe befand sich das kleine Dörfchen Nimvorgut auf 700 bis 730 Metern Höhe. Von hier hatte man einen herrlichen Blick über den Bischofteinitzer Kreis hinweg bis in Orte des Tachauer- beziehungsweise Mieser Kreises. Begab man sich aber auf den 848 Meter hohen Gebirgskamm zum Großen Fels, so lag vor dem Beschau-
Nimvorgut hatte 25 Häuser und 125 deutsche katholische Einwohner. Es gehörte zur tschechischen Gemeinde Alt-Possigkau, politischer Bezirk Taus. Fast alle Häuser waren kleine, alte Holzhütten und sehr primitiv. Die Familien hatten wenig Bewegungsraum. Auch sonst waren die Wohnräume hygienisch nicht einwandfrei. In einigen Häusern gab es auch Ungeziefer wie Küchenschaben, Wanzen oder Läuse. Trotz der guten, staubfreien Waldluft starben immer wieder Ortsbewohner an Lungentuberkulose, meist im Alter von 17 bis 26 Jahren.
Die Bevölkerung von Nimvorgut lebte in sehr ärmlichen Verhältnissen. Ein Handwerk übte niemand aus. In damaliger Zeit war es sehr schwer, ein solches zu erlernen. Die Lehrzeit dauer-
te drei Jahre, und der Lehrling mußte Lehrgeld zahlen. Konnte er dies nicht, so wurde die Lehrzeit um ein halbes Jahr verlängert. In Nimvorgut war das Geld rar, also mußten die Männer weiterhin Waldarbeiter, Handlanger beim Häuserbau und Gelegenheitsarbeiter bleiben.
Sachsengänger
Arbeitsscheu waren die Nimvorguter nicht. Man griff zu, wo es etwas zu verdienen gab. Eine gute Verdienstmöglichkeit bot alljährlich das Sachsengehen. In Deutschland nahm die Industrie ab 1870 einen ungeahnten Aufschwung, die Städte wuchsen und der Handel dehnte sich schwunghaft aus. Das Baugewerbe blühte, doch es fehlte an Bauarbeitern. Da zogen nun nach Ostern viele Männer aus allen Orten des Grenzgebietes nach Sachsen, um als Maurer oder Handlanger den Lebensunterhalt für ihre Familie zu verdienen. Auch Nimvorguter Männer waren unter den Sachsengängern. Im Oktober kamen sie wieder heim. Das ersparte Geld war eine gute Beihilfe für den Winter.

Hopfenp ücker
Eine andere Saisonarbeit war für die Nimvorguter das Hopfenpflücken im August. Daran beteiligten sich oft ganze Familien. Der Partieführer, ein Einheimischer, der mit dem Hopfenbauer in Verbindung stand, stellte die einzelnen Arbeitstrupps zusammen. Eines Morgens zeitig früh gingen die Pflücker nach Waldmünchen. Dort vereinigten sie sich mit den anderen Arbeitsgenossen aus den anderen Dörfern. Gemeinsam fuhren sie mit der Bahn in die Hallertau zwischen Nürnberg und München. Dort wurden sie in leeren Ställen und Schuppen untergebracht und schliefen auf Stroh und Decken. Verpflegt wurden sie vom Hopfenbauer. Das Essen war reichlich, aber eintöniger Eintopf. Zeitig früh ging es auf die einzelnen Hopfenäcker. Die Männer legten die Hopfenstangen, die der größeren Standfestigkeit wegen gegenseitig mit Draht verbunden waren, nieder und schnitten die Ranken auf einzelne Stücke. Fortsetzung folgt
Der von mir seit 40 Jahren geführte Krippenverein pflegt seit mehr als 20 Jahren eine intensive Freundschaft mit unseren böhmischen Nachbarn. Regelmäßig werden wir eingeladen, deren Krippenausstellungen mit unseren Exponaten zu ergänzen im Zeichen der ausgezeichneten böhmisch-bayerischen Krippennachbarschaft. So waren es bereits elf gemeinsame Ausstellungen. Heuer findet die gemeinsame Ausstellung in Bischofteinitz statt. Der Ausstellungsraum übersteigt an Größe und Erhabenheit alles, was wir bisher schon bestückten. Die dortigen Vitrinen reichen gerade einmal für die Objekte unserer tschechischen Freunde. Darum müssen wir heuer unsere eigenen Vitrinen mitbringen. Unser Verein wird mit etwa zwölf Exponaten aus der Region des Landkreises Cham, aber hauptsächlich aus Furth im Wald, vertreten sein.
Für die Ausstellung werde ich ein kleines Geheft mit Beschreibungen unserer Krippen verfassen. Der deutsche Text soll natürlich auch ins Tschechische übersetzt werden. Bei der Raiffeisenbank in Furth im Wald gibt es zwei tschechische Mitarbeiterinnen, die übersetzen werden. Ich freue mich schon jetzt auf zahlreiche Krippenfreunde, die aus Bayern und Böhmen nach Bischofteinitz kommen werden.
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Oktober Josef Johann Mayer, Ortsbetreuer von Haschowa und Zwingau, am 1. zum 90. Geburtstag; Karl Weidner, ehemaliger Ortsbetreuer von Tannawa, am 19. zum 92. Geburtstag sowie Gita Reiter, Ortsbetreuerin von Amplatz, am 30. zum 96. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit sowie Gottes reichen Segen und danken für den tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik


Heimatkreisbetreuer

Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de,
www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank ChamerBischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatbote

für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0


@online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
n Zummern. Am 12. September starb Anna Flegel/Rötsch mit 92 Jahren an einer zweiwöchigen akuten Erkrankung, nachdem sie zur Kurzzeitpflege für gerade eine Woche in einem Pflegeheim gewesen war. Sie war am 18. Januar 1931 als jüngstes von fünf Kindern der Eheleute Franz Rötsch und Margareta, geborene Kreiner, an einem besonders schneereichen Tag in Zummern zur Welt gekommen. Der Vater war Maurermeister und kaufte als Häusler noch in den 1930er Jahren vereinzelte Feldparzellen, um eine Landwirtschaft im Nebenerwerb zu betreiben.


Petra Vorsatz und Dr. Sebastian Schott, Heimatkreisbetreuer Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Bürgermeister Lothar Höher, Emma Weber, Ortsbetreuerin von Neuhäusl, und die Tanzende Tachauerin.
� 33. Heimatkreistreffen – Teil III und Schluß
Die Welt hinter meinen Augen
Anfang September fand das zweitägige 33. Heimatkreistreffen der Tachauer statt. Heimatkreisbetreuer Wolf-Dieter Hamperl berichtet in mehreren Teilen. Hier der dritte und letzte Teil.
Der zweite Tag des 33. Heimatkreistreffens begann am Sonntagmorgen traditionell beim Gedenkstein. An die 30 Personen waren gekommen, den Oberbürgermeister vertrat Bürgermeister Lothar Höher, das Kulturamt Petra Vorsatz und Sebastian Schott. Das Totengedenken sprach diesmal ich als Vorsitzender des Heimatkreisvereins. Ich erinnerte an die jüdischen Mitbürger, die schon Ende September 1938 aus Tachau hatten fliehen müssen. Nur wenige hatten im Frühjahr 1939 aus der besetzten Tschechoslowakei fliehen und ihr Leben retten können. Namentlich erinnerte ich an Karl Lanzendörfer, der wegen seiner Europaideen in das KZ Buchenwald eingeliefert worden war und dort am Januar 1946 an einer Sepsis starb. Schließlich erinnerte ich an die verstorbenen alten Frauen und Männer, die die Vertreibungstransporte nicht überlebten und beispielsweise im Lagerfriedhof in Wiesau oder neben der Cadolzburg begraben wurden. Auch an die sollte gedacht werden, die sich aus Verzweiflung vor der Vertreibung das Leben nahmen. Das Gedenken endete mit einem gemeinsamen Vaterunser.

Anschließend wandte sich Bürgermeister Lothar Höher an die Landsleute. Er habe selbst sudetendeutsche Wurzeln.
Sein Vater habe aus Prag gestammt, seine Mutter aus Neulosimthal. Höher lobte die Arbeit des Heimatkreises und sagte, die Stadt stehe weiter zur 1956 eingegangenen Patenschaft, was der schön geschmückte Platz um den Gedenk-
stein und die Tanzende Tachauerin sowie die aufgezogenen Fahnen zeigten. Er wies auch auf die guten grenzüberschreitenden Beziehung zur Partnerstadt Marienbad hin. Viele tschechische Bürger arbeiteten in Weiden und Umgebung, allein im Klinikum Weiden an die 30 Ärzte. 33 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs habe sich die

Welt verändert, besonders in der Oberpfalz und im angrenzenden Westböhmen.
Anschließend erinnerte ich den Bürgermeister an die neue Gedenkstätte in Haid, an der wir am Vortag ein Blumenbouquet niedergelegt hatten. Emma Weber, Ortsbetreuerin von Neuhäusl, trug ein Heimatlied vor. Das Gedenken schloß mit unserer Hymne „Tief drin im Böhmerwald“, die alle aus voller Brust mitsangen.
Nach kurzen Gesprächen wanderten viele zum Hans-Bauer-Kulturhaus neben der Sankt-Michaels-Kirche. Dort trafen sich die Mitglieder des Kreisrates und einige Ortsbetreuer. Als Vorsitzender des Heimatkreisvereins begrüßte ich die Anwesenden. Nach der Totenehrung trug ich den ausführlichen Tätigkeitsbericht vor. Kassenwartin Paula Marterer berichtete über die finanzielle Lage. Da sich der Verein nur von den Überschüssen des Heimatkalenders und seltenen Spenden finanziere, sei der Betrag auf dem Konto rückläufig. Das werde auch in Zukunft so sein. Aber der Verein verfüge über ein gutes Geldpolster. Dann informierte ich die Runde noch über meine Tätigkeit für den Egerer Landtag wie Inventarisierung der Bücherei, Ordnung, Inventarisierung und Digitalisierung des Vereinsund heimatkundlichen Archivs und schließlich die Ordnung und Digitalisierung des Fotobestandes. Diese Arbeiten für den Egerer Landtag seien nach einer intensiven Arbeitszeit von zwei Jahren und zwei Monaten Ende des Jahres beendet. Ich bot meine Erfahrung und meine Kenntnisse auch dem Tachauer Heimatkreisverein an. Ohne Archivierung und Digitalisierung der seit 1952 gesammelten Urkunden, Dokumente, Vereinsprotokolle, Fotos und so weiter wäre die Sammeltätigkeit sinnlos gewesen. Die Ergebnisse sollten in der schon bestehenden Homepage öffentlich zugänglich werden. Ohne personelle Hilfe sei das nicht zu leisten. Da wir in unseren Reihen keinen ehrenamtlichen Archivar hätten, müßten wir jemanden anstellen. Das werde einen erheblichen Teil unseres Vereinsvermögens aufbrauchen.
Aber es werde schwierig genug sein, eine qualifizierte Kraft zu finden. Ich bat
die Landsleute, sich für oder gegen dieses Zukunftsprojekt zu entscheiden. Alle stimmten zu.
Mittags wurde die Ausstellung „Das Lebenswerk des Tachauer Künstlers Bernd Fleißner“ in der Städtischen Galerie des Hauses eröffnet. Ich skizzierte das Leben des Künstlers, Bürgermeister Lothar Höher dankte, daß der Verein immer schon einen Teil des kulturellen Lebens der Stadt mitgestalte.



Der 2020 verstorbene Künstler war 1944 in Marienbad zur Welt gekommen und nach der Vertreibung bei der Firma Lorenz als Holzingenieur tätig. In dieser Funktion entwickelte er die Holzspielzeuge, die in Geretsried erfolgreich produziert wurden. Man denke nur an den hölzernen Wackeldackel aus den 1960er Jahren. Bernd Fleißner schuf auch Kinderbücher und sogenannte Kinderspielbücher und war damit sehr erfolgreich.
Daneben war er Aquarellist der Voralpenlandschaft, aber er schuf auch fast surrealistisch anmutende Werke wie den Turm zu Babel. In malerischer Manier gestaltete er auch seine Biographie.
Bernd Fleißner war ein eigenwilliger und fleißiger Künstler und ein guter Zeichner. Viele ließen sich von ihm porträtieren. Für die von seinem oberbayerischen Holzhaus nur 100 Meter entfernte Dorfkirche in Antdorf schuf er ein Heiliges Grab, das auch die Auferstehung darstellt.

Die Ausstellung gibt mit Zeichnungen seiner Frau und der Kinder, seinen Landschaftsaquarellen, dem großen Bild „Die Welt hinter meinen Augen“ und mit zahlreichen Beispielen seiner Holzspielzeuge einen guten Überblick über sein Lebenswerk. Die Ausstellung lief bis Ende September.
Ein Mittagessen, zu dem die Stadt Weiden eingeladen hatte, beschloß das 33. Tachauer Heimatkreistreffen.
Der 250 Seelen zählende Ort wurde erst 1941 elektrifiziert. Ihre wirkliche Schulbildung endete wegen kriegsbedingten Lehrermangels in Neustadtl bereits kurze Zeit später. An eine weitere Schul- oder berufliche Ausbildung war nach der Vertreibung über das Sammellager in Tachau und mit den üblichen Viehwaggons nach Büdesheim, heute ein Ortsteil von Schöneck in Hessen, nicht zu denken.
Die beiden ältesten Brüder Josef und Franz lebten in Gernsheim am Rhein und Büdesheim. Ihr Lieblingsbruder Karl konnte sich der Einberufung 1944 nicht mehr entziehen und kam schnell in Kriegsgefangenschaft nach Louisiana in den USA, wo er noch vor Kriegsende verunglückte. Anna konnte sein – auch heute gut gepflegtes – Grab auf dem Fort Sam Houston National Cemetery in San Antonio in Texas besuchen, worüber sie in ihrem Ruhestand gerne als ganz besonderes Erlebnis erzählte.
Ihre Schwester Maria heiratete nach Dieburg im Südhessischen, wo Anna Willy Ernst Flegel auf der Fastnacht kennenlernte und 1959 heiratete, um für den Rest ihres Lebens ebenfalls dort zu wohnen. Willy Ernst gründete 1965 einen Betrieb als Maschinenbauingenieur. Er führte ihn bis zu seinem Tod am 9. Juli 2013 mit 86 Jahren. Er stammte aus Wolfersdorf bei Böhmisch Leipa in Nordböhmen. Noch in Aussig begann er eine Ingenieurschule, abgebrochen wegen kurzzeitigen Kriegsdienstes und gefolgt von Jahren der Kriegsgefangenschaft mit Zwangsarbeit im Bergwerk. Unterbrochen von der Notwendigkeit zur ungelernten Erwerbsarbeit, konnte er schließlich erst 15 Jahre später die Staatliche Ingenieurschule in Darmstadt absolvieren.
Ihre drei Kinder kamen in Dieburg zur Welt. Professor Willy Albrecht Flegel ist forschender Arzt im Krankenhaus der National Institutes of Health bei Washington DC, Gemeindereferentin Rita Regina Maria Flegel ist Lehrerin an Schulen in Mainz und Rainer Paul Schwarz, verheiratet mit Ursula Schwarz, ist Telekommunikationsingenieur beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz. Die beiden Enkel Benedikt und Veronika Maria hatten als kleine Kinder noch beiden Großeltern viel Freude bereiten können und beginnen bald zu studieren.
Das Requiem fand in Dieburg statt. Im dortigen gemeinsamen Grab des Ehepaars wurde Anna nach einem wechselvollen, manchmal entbehrungsreichen und schließlich lange Zeit erfüllten Leben zur letzten Ruhe gebettet.
n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de


Mundart und heutige Sprache II
Dr. Eduard Hlawitschka berichtet erneut über in der nordböhmischen Heimat geläufige mundartliche Ausdrükke und ihre heute gängigen Entsprechungen.
Man brauchte häufig auch den Ausdruck „e Hejtl Solot“ (einen Kopf Salat). Als eine Besonderheit galten damals „Pomeranzen“, die jetzt durchweg Apfelsinen heißen.
Wie es früher war/Straschnitz
Wie‘s daheim war –in Straschnitz
Straschnitz, ein kleines hundertSeelen-Dörfchen mit 21 Häusern und Laden mit 14 Häusern (eingemeindet) waren die Orte, wo Margarethe Semsch ihre schönsten Jugendjahre verbracht hat.
Es war das Zentrum des Kirchsprengels, zu dem die Orte Tetschendorf, Roche, Wedlitz, Julienau-Tschiemsch, Drahobus und Brzehor gehörten. Unsere schöne große Kirche, dem Heiligen Wenzel geweiht, sah man schon von weitem, sie war sozusagen unser Wahrzeichen. Die fünfklassige Volksschule, später nur noch mit drei Klassen, nahm alle schulpflichtigen Kinder aus den umliegenden Orten auf. Brzehor kam später zu Drahobus. Tetschendorf hatte eine eigene, einklassige Schule.
Kuchen – Kolatsch‘n – wurden gebacken. Quark, Mohn, Apfelmus (Äpplflosl) und Streusel waren die „Drauftue“. Dieser Tag wurde von uns jungen Mädchen mit Herzklopfen herbeigesehnt, denn da bekamen wir meist ein neues Kleid, das von den Freundinnen mit kritischen Blicken gemustert wurde.
es seinerzeit noch nicht. Mädchen und Jungen befestigten die Strümpfe an (den Hosenträgern vergleichbaren) „Strumpfhaltern“.
Spielten wir Kinder Handball (nicht Fußball), so versuchten wir, ein „Gôôl“ zu schießen, während es heute um das ToreSchießen geht (und zwar jetzt zumeist in riesigen Fußball-Stadien bzw. -Arenen, die übrigens erst seit den Dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts groß in Mode kamen).

Gab es früher bei den Festivitäten die „Vouglwiese“ mit „Ringlspieln“ und weiteren Attraktionen, so besucht man jetzt einen Pfi ngstmarkt oder eine ähnlich benannte Veranstaltung, wo unter anderem „Kettenkarussells“ die Jugendlichen erfreuen.
Für unsere Bauern war die Spar- und Darlehenskasse sehr wichtig. Sie konnten sich einen Weg nach Auscha ersparen, um ihr Geld zinsgünstig anzulegen.
Natürlich auch borgen, wenn der Ertrag einmal nicht so günstig ausfiel, oder man mit dem Verkauf des Hopfens zu lange gewartet hatte als „Huppehalder“ (Hopfenbauer), denn es sah für das kommende Jahr böse aus. Ob es eine Taufe, Hochzeit oder Beerdigung gab, alle mußten aus den beträchtlich größeren Dörfern auf den Berg hinauf in das kleine Kirchdörfchen. Pfarrer Otto Vogel war bis zur Vertreibung unser Seelsorger. Ein Wirtshaus gab es natürlich auch. Es war nicht riesig groß, hatte aber eine Kegelbahn und, was besonders wichtig war, es hatte einen Tanzsaal. Einen Gesangverein hatten wir auch, der konnte sich sehen und hören lassen. Die sonntäglichen Singstunden wurden gut und gern besucht. Unser “Herr Pepi“ und mein Vater, Oberlehrer Jahnel, studierten mit uns nicht nur die Schubertmesse (die wir sehr gerne sangen), sondern zudem auch
lateinische Messen mit Orchesterbegleitung ein.
Wenzeslei, unser Kirchfest am 28. September und auch die Straschnitzer Paut genannt, könnte man fast als Höhepunkt bezeichnen. Da zeigten die Sängerinnen und Sänger, was sie in den Übungsstunden gelernt hatten.
Gefeiert hat an diesem Tag eigentlich der ganze Kirchsprengel. Der kleine Dorfplatz war vollgestopft mit Schiffsschaukel, Ringelspiel und manchmal sogar mit einem kleinen Zirkus, der auf dem Schulhof aufgestellt wurde. Wo die Buden mit Süßigkeiten und Spielsachen noch Platz fanden, konnte ich mir nicht vorstellen, als wir 1992 wieder einmal daheim waren.
Der Besuch des Hochamtes war Ehrensache und wurde von unserem Herrn Pfarrer Vogel meist mit zwei Gastpriestern zelebriert. Nach dem Ende des Hochamtes strömte alles auf den Dorfplatz. Irgendetwas musste man ja auch den Daheimgebliebenen mitbringen, vielleicht eine Tüte Fejerstenln (wörtlich: Feuersteine, aber es waren Bonbons), Türkischen Honig, Papierblumen vom Schießstand oder eine aufblasbare Papprolle, mit der man die Mädchen nekken konnte. Nach einem guten Mittagessen besuchte man um 15 Uhr den Segen, erst danach erscholl die von der Kapelle Proboscht gespielte Platzmusik.

Ein „Reindl“ heißt heute meistens Pfanne, in der „Kuchl“ (Küche) gab‘s dazu auch noch diesen und jenen anderen „Toup“ (Topf) und viele „Kaffej-Tüppln“ (Tassen). Von der Milch wurde der „Schmejtn“ (Rahm) abgeschöpft. Aus gekochten „Arpln“ wurde die „Arplgasche“ (Kartoffelpüree) gestampft. Die „Karvenatln“ unserer Jugendzeit heißen jetzt „Frikadellen“ oder „(Königsberger) Klopse“.
„Liwanzen“, aus Gerstenmehl gefertigte Pfannkuchen, sind auf den heutigen Speiseplänen gar nicht mehr zu fi nden, ebenso wie die „Dolken“ und die „Buchten“ (aus Hefeteig), die entweder mit „Powidl“ (Zwetschgenmus) gefüllt sein konnten oder auch gern ungefüllt gegessen wurden. Nicht vergessen darf man hier natürlich auch die „Golâtschn“, die kleinen runden Küchlein, die mit allerlei Auflagen (meist Mohn, Powidl und gesüßtem Quark) sowie „Streusl“ bestückt waren. „Ribis“ war der gängige Name für die Johannisbeere.
In die nächste Stadt – nach Lobositz, Leitmeritz oder Teplitz – fuhren wir seinerzeit mit dem „Tschockl“, dem von einer Dampflokomotive gezogenen Personenzug, und in diesem kontrollierte der „Kondukteur“, nicht ein Schaffner, die Fahrkarten (jetzt auch häufig Tickets ge-
Gâken (Saatkrähe). Foto:Wikipedia
Ein bis zwei Tage vor dem großen Fest herrschte schon ein lebhaftes Treiben. Die Hausfrauen setzten ihren Stolz darein, daß alles vorbereitet war, denn Verwandte und Bekannte wurden eingeladen. Unmengen von
Mal schnell geschaut, ob auch fremde Burschen sich schon eingefunden hatten, denn die eigenen kannte man ja zur Genüge und dann auf zu Jahnels Tanzsaal! Margarethe Semsch Einsenderin: Margarethe Ulber, Fortsetzung folgt
Waren die „Knickerbocker“ in unserer Jugendzeit für junge Männer die große Mode, so sind es jetzt die „Jeans“-Hosen, und das auch für Frauen, die früher doch zumeist Röcke trugen. Lange Unterhosen von Männern hießen damals zumeist „Gattichhousn“. „Strumpfhosen“ gab
„Gâken“ hießen bei uns ehedem die heute vorzugsweise als Krähen oder Raben bezeichneten Raubvögel, als „Eichkatzen“, „Sißliche“ und „Hûtschn“ benannte man die Eichhörnchen, Ziesel bzw. die Frösche. Prof. Dr. Eduard Hlawitschka Fortsetzung folgt ❯ Geschichte/Pohorschan
Meldung Verstorbener und Einsendung von Beiträgen
Kirchsprengel Schüttenitz – Pohorschan
Im März 2017 wurde das Pfarrdorf Schüttenitz im Leitmeritzer Heimatboten vorgestellt. Hier nun sind es Pohorschan, Skalitz, Trnowan, Podiwin und Welbine.
Bemerkenswert ist, daß bei der Volkszählung 1833 in den Dörfern in Stadtnähe kaum tschechische Einwohner zu verzeichnen waren. Wir wissen, daß nach der Gründung der Tschechoslowakei die meisten deutschsprachigen Beamten und Angestellten aus dem Staatsdienst entlassen wurden. Amtssprache war ab sofort Tschechisch. Ich glaube, daß die meisten Deutschen nicht die Sprache der neuen Regierung beherrschten. Meine Großmutter und auch meine Mutter konnten nicht Tschechisch sprechen. Wir stellen fest, daß bei der Zäh-
lung 1930 plötzlich in allen Dörfern tschechische Einwohner auftauchen, in Trnowan sind es fast 50 Prozent der Einwohner. In

und auch ein tschechischer Lehrer eingesetzt. Man versuchte auch deutsche Kinder anzuwer-
Kinder aus Pohorschan und Skalitz eingeschult. Trnowan hatte mit Podiwin eine Schule und auch Welbine hatte ein Schulgebäude. Pfarrer Kumpf hat in allen drei Schulen Religionsunterricht gegeben. Auf dem Friedhof von Schüttenitz wurden die Verstorbenen aus allen Ortschaften des Kirchsprengels begraben. Die Daten stammen aus dem Heimatbuch Leitmeritz, herausgegeben vom Heimatkreis Leitmeritz in Fulda, 1970
Pohorschan (ma. Porschn) Haufendorf, am Südwesthang des Goldberges gelegen. Obst, etwas Hopfen, hat Tagelöhner im Baugewerbe (nach Leitmeritz).
1057 Zum Leitmeritzer Stiftskapitel gehörig.
1620 Wieder ans Kapitel zu St. Stephan in Leitmeritz. 18 Häuser zum Gut Schüttenitz (also zum VyŠehrader Kapitel) gehörig.

1736 Mit Meierhof und Schäferei zur Herrschaft Ploschkowitz.
1787 61 Häuser (16 davon noch zu Schüttenitz gehörig).
1796 Meierhof aufgelassen, Felder verpachtet bzw. mit Gärten an zehn Baustellenbesitzer verteilt.

1833 76 Häuser, 411 Deutsche, (katholisch), ein Wirtshaus an der Gebirgsstraße (nach Vertrag durfte die Herrschaft Ploschkowitz ein Wirtshaus errichten).


Liebe Leser und Leserinnen, Ich würde mich über Post und Beiträge von Ihnen sehr freuen. Diese können Sie mir postalisch unter der Adresse
Heike Thiele, Eulengasse 16, 50189 Elsdorf oder gerne per E-Mail zusenden, unter der E-Mail-Adresse Thiele.Heike@gmx.de
Bitte nennen Sie mir Verstorbene, damit ich aktuell bleiben kann.
Schüttenitz waren es zent, es wurde für eine Handvoll Kinder eine Schule gebaut
chischen Schule eine Schulspeisung. Schüttenitz hatte eine große Schule, dort wurden auch die
1421 Durch die Hussitenkriege an die Herren von Ruppau (Roupowa) gekommen.

1930 97 Häuser, 419 Einwohner (319 Deutsche, 20 Tschechen, sieben Ausländer, 341 katholisch, 73 evangelisch und fünf ohne Konfession).
1939 386 Einwohner.
Ich bin auf Ihre Benachrichtigungen angewiesen, insbesondere bei sehr betagten Heimatfreunden und (über) Hundertjährigen welche in den Geburtstagen verzeichnet sind.
Ich sende Ihnen ganz herzlichen Dank und liebe Grüße. Heike Thiele
Georg Pohlai� Geschichte/Skalitz
Skalitz bei Schüttenitz

Haufendörfchen auf meist Kalk grund und nördlich auch auf Sand gebaut, mit einem Teich.
Es gibt zwei übereinander ge baute Kapellen, nördlich des Waldes am Waldrand, und ein Forsthaus.
Seit etwa 1425 Mit Sicherheit besiedelt, wahrscheinlich aber schon früher. Skalitz bedeutet Felsendorf, nach den Sandsteinfelsen mit Steinbruch.
1657 Ansiedlung eines „Mansionarius“ (Einsiedlers) „in eremiterio monte de bello“ namens
Paulus Ferratius bellinus de Gröbel, dem sich ein Eremitenlaienbruder zugesellte. Sie richteten über einer in den Felsen gehauenen unteren Kapelle noch eine zweite ein und wohnten unweit davon in Klausen. De Gröbel versah seinen Kirchdienst in Schüttenitz. Im
18. Jahrhundert verkamen dann die Bauten.
1760 Vertrag des Schüttenitzer (Vyšehrader) Propstes mit der Stadt Leitmeritz zur Überlassung des Wassers aus dem Skalitzer Teich, für ein halbes Faß Bier jährlich.
1780 Die Einsiedelei wurde von Kaiser Joseph II. aufgehoben.
1787 Schaller erwähnte 25 Häuser des Ortes, es gab auch einen herrschaftlichen Meierhof. Die
Schäferei wurde aufgehoben, es wurden Gründe verkauft.
1792 Bischof Kindermann von Schulstein läßt die Einsiedelei mit der Doppelkapelle wiederherstellen und schöne Gartenanlangen dabei errichten.
1801 Die Wasserleitung wird auf Kindermanns Veranlassung gelegt. Sie bestand aus Zinkrohren und wurde zu einem Wasserfall in Bassins genutzt.
31.5.1806 Der Blitz schlägt in ebendiese Anlage ein.
1833 Es gibt 32 Häuser mit 188 Einwohnern, die alle Deutsche und katholisch sind.
1836 Die Revierförsterei des Gutes Schüttenitz wird in Skalitz eingerichtet.


Nach 1880 Es werden mehrere Villen in der Nähe erbaut, gedacht für eine Sommerfrische, die bald auch guten Zuspruch fanden.
Bissl woos vu Schittenz
Mir hottn ju fost olls zunn Assn salba. Uffn Feldan und ain Gortn hottn ma Arpln, Korn, Obst vu olln Sortn, Arbsn, Meehrn, Linsn, Bunn. Karviol, waisses und ruutes Kraut, Pettasilije.
Halt olles fa die Kichche. Milch hottma salba zunn Kwork, Butta und Kasln mochn. Ee grußes Schwain homma a in Winta vur Waihnochtn geschlocht, dou hottma doss ganze Johr unsa Flejsch und die Laaba- und Bluttwurscht, Schnitzln, Sauabrotn homma halt aigerext.
Doss Korn hout uns dar Minarsch gemohln und houts dan Rusnkranz hiegeschofft und mier kundn unsa Bruut datt hulln, hottn ock fars Bockn bezohln missn. Su homma halt ni vill vu dar Rotterin hulln brauchn.
Iech konn miech gutt droo
� Leserbriefe
Diese Worte hat Margarethe Ulber vor etwa zwanzig Jahren auf der Todesanzeige gelesen, die sie darüber informiert hat, daß Margarete Semsch am 24. September 2003 verstorben war.
Seitdem sind zwei Jahrzehnte ins Land gegangen, dennoch erinnere ich mich noch heute gern an sie. In meiner alten Heimat war sie im dörflichen Miteinander die „Oberlehrer Gretl“. In meiner kindlichen Erinnerung ist sie eine junge Frau, die immer gut gekleidet daherkam und freundlich auf die Menschen in den Dörfern zuging. Sie kannte mich als eine der vielen Schülerinnen, die von ihrem Vater, Oberlehrer Jahnel, in der Volksschule Straschnitz unterrichtet wurden. Bewusst begegneten wir uns erst in den Neunziger Jahren im Leipziger Zoo.
Der Leipziger Zoo war im „Osten“ der Ort, an dem sich am ersten Sonntag nach Pfingsten stets ein Häuflein der tapferen Unentwegten traf, die ihre Wurzeln im Sudetenland hatten. Im „Westen“ war es ganz offiziell längst zur Tradition geworden, daß an den Pfingstfesttagen das „Treffen der Sudetendeutschen“ stattfand. Die Treffen im Leipziger
arinnan, doss da enne gruuße Schrift ieban Loodn vu dar Rottarin woor. „Kolonialwaren“ hout ieba da Auslooge und dar
Tiere geschtandn. Iech hob ma kenne Gedankn gemocht, woss doss hejst. Vill homma darte nie keefn brauchn. Obba suu bissl woos homma datte hulln missn.
Viellaicht wisst ia ju nouch, wemma woss hulln wullde, ma ejne Korte uffn Pudl lejn musste und die Rottarin hout dann mit enna Schaare ee Schnipsl obgeschnietn. Doss woor halt faan Zucka, fa Salz und Mahl, woss mier obba salba hottn, oda aa fa Rechazaigs. Wail unsa Tate obba ain Kriege woor, hottma fa daan kenne Korte, obba aa die Waiba hettn sich Rechazaig keefn kenn, s woor ock ni suu vill wie bai daan Mennan.
Ejmou, iech denke s woor zu menn Nomstooge, wullte die Mamme woss Extras mochn. Dou woor iech mit dar Mamme bai dar Rottarin. Frohte die Mamme: „Rottarin, hotta ee
� Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
100 bis 102 Jahre
28.10.1923, Hildegard Kinne, geb. Pokorny, früher Lobositz
26.10.1921, Dr. Gottfried Kupsch früher Hlinay
23.10.1922, Gudrun Kleist, geb. Leitenberger, früher Auscha
95 Jahre
13.10.1928, Charlotte Rosenbusch, geb. Lausch, früher Watislaw
12.10.1928, Marie Eiselt, unbekannt
90 Jahre
11.10.1933, Traute Scholz, geb. Bobek, fr. Theresienstadt
85 Jahre
02.10.1924, Erna Schmall, geborene Rost
02.10.1930, Anton Mattausch
Lewin
02.10.1934, Johanna Riedel, geborene Riedl
Libochowan
26.10.1925, Elfriede Jörn, geborene Quasnitschka
Lobositz
16.10.1925, Helmut Meinel
03.10.1926, Rudolf Fuchs
Lukowitz
03.10.1925, Mariechen Müller, geborene Wolf
Medonost
13.10.1939, Heinz Eibicht
1930 Es gibt 63 Häuser mit 260 Einwohnern, davon sind 247 Deutsche und Katholiken, zehn Tschechen und drei stammen aus dem Ausland. Sechs Bürger sind evangelisch, drei anderer Konfession und vier sind ohne Angabe.
1939 Skalitz hat 237 Einwohner, eine Pfarrei und Post in Schüttenitz. Aus dem Heimatbuch des Heimatkreises Leitmeritz 1970, Einsender: Georg Pohlai
bissl Kakau?“ „Nu jo“, sohtse, „obba ia hott ju kenne Markn doufier. Ee bissl woos hobbiech undada Pudl.“ „Nu woss komma dou mochn, iech mechte doch daan Jung enn Frejde mochn.“ Hout die Rottarin hie und har iebalejt und dann sohtse: „Wesste, Annl, dar alde Paasche, dar rechat und froht mich imma, ebb iech extra Toubak hoo. Dou war iech mou daine Rechamarkn namm, und wenn dar Paasche wieda kimmt, dar kimmt olle zwej Tooge, dann schnaidn iech die Kakau oda Schokolademarkn ob!“ Die Mamme hout daan Kakau und mitn extra Fettn und Zucka uffn Blaach enn Schokolade gemocht. Wennde poor Schuh keefn wulltst, brauchste Markn. Wenn de Wulle zun Schtrickn gebraucht hosst, brauchste Markn. Suu woor doos, und aa nochn Kriege iss doss poor Johre waitagangn. Obba jetze dar Noom: Kolonialwaren. Hotte die Rottarin vill aus daan „Kolonien“? Mier woorn aigntlich „Selbstversorger“ und homma ain Kriege iebahaupt woss ausn Kolonien krigt? Ia wisst doss sicha bessa olls iech. Georg Pohlai
31.10.1938, Erna Pieschel, geborene Bopfinger, früher Deutsch-Welhotta
11.10.1938, Lydia Vorhagen, geb. Karras, früher Ober-Koblitz
80 Jahre
13.10.1943, Heidelore Blencke, geb. Hoschka, früher Polepp
75 Jahre
12.10.1948, Helga Burger, geb. Bittner, früher Schüttenitz
50 Jahre
12.10.1973, Mario Illmann, früher Taucherschin
Alt Ohlisch, Kreis Tetschen
19.10.1931, Erika Pejscha, geborene Picl
Bleiswedel
16.10.1929, Anni Domanski, geborene Tieze
13.10.1936, Erhard Kral
Eicht
09.10.1941, Erika Mühlhause, geborene Neumann
Enzowan
19.10.1964, Kerstin Wacke
Gastorf
11.10.1941, Irene Takacs, geborene Heger
Graber
07.10.1945, Gerda Jäger, geborene Kunte (Franz)
09.10.1926, Anneliese Kowalczyk, geborene Krolopp
25.10.1939, Johanna Günzel, geborene Irrgang-Wehle
Groß-Tschernosek
26.10.1934, Dorothea Castillo
geborene Kaschka
Haber
18.10.1930, Erika Steiner, geborene Hellmich
Kninitz
01.10.1927, Helmut Langer
Kottomirsch
18.10.1931, Josef Richter
Krscheschitz
27.10.1927, Anna Maria Jirsik, geborene Ducke
27.10.1936, Konrad Heidorn
Leitmeritz
Molschen
19.10.1939, Walter Kobolla
Nieder-Sebirsche
18.10.1949, Manfred Redlich
Ober-Koblitz
15.10.1939, Gerhard Karras
Pistian
01.10.1929, Gertrud Korthals, geborene Joch
12.10.1935, Hubert Ehrlich
Podiwin
30.10.1930, Marie Danicke, geborene Fiedler
Polepp
31.10.1935, Josef Anders
Radaun
25.10.1929, Gerhilde Ludwig, geborene Mader
Raschowitz
01.10.1951, Reinhard Ducke
Rübendörfel
14.10.1934, Elfriede Teichmann
Schnedowitz
23.10.1934, Annemarie Gaul, geborene Maßel
Schüttenitz
24.10.1927, Alfred Teich
Stratschen
07.10.1927, Erhard Köcher
Tlutzen
17.10.1955, Helga Krause, geborene Strubich
20.10.1939, Kurt Leipelt
Trebnitz
10.10.1925, Anni Reuter, geborene Wolf
Trschebautitz
21.10.1930, Edith Raetz, geborene Reinisch
Tschersing
10.10.1931, Ingeborg Weidinger, geborene Nebas
Wegstädtl
20.10.1924, Marcel Graillot
Weisskirchen
12.10.1939, Annelies Sandau, geborene Werner
Wellemin
30.10.1939, Josef Knobloch
Zebus
Zoo waren zur Zeit der DDR von den staatlichen Organen nicht gern gesehen. Es gab deshalb dazu keine Einladungen, keine Informationen in Presse, Rundfunk oder Fernsehen. Dennoch, jeder Insider kannte den Termin und den Ort. Wer kam, teilte mit dem anderen eine gemeinsame Vergangenheit, fühlte sich zugehörig und verstanden.
Als ich Frau Semsch im Leipziger Zoo kennenlernte, war ich bereits Rentnerin. Sie war für mich eine ältere würdevolle Dame. Unsere Biographien waren zwangsläufig durch unsere Leben, einerseits in Ost und andererseits in West, mit einem Altersunterschied von 15 Jahren, unterschiedlich geprägt. Die Brücke zueinander war die „alte Heimat“. Frau Semsch kam unkompliziert auf mich zu und gab mir das Gefühl, daß es ihr angenehm war, mich kennenzulernen.
Nach der Begegnung in Leipzig meldete sie sich hin und wieder telefonisch bei mir. Die Gespräche waren stets interessant und von beachtlicher Länge. Meist war sie die Anrufende. Ich schrieb eher von Zeit zu Zeit einen langen Brief, für den sie sich telefonisch dann ausgesprochen warmherzig bedankte. Das tat
mir gut, zumal sie immer betonte, daß meine Briefe auch von ihrem Mann, einem überaus erfolgreichen Arzt im Ruhestand, gern gelesen würden. Das letzte Telefonat, das wir 2003 miteinander führten, existiert in meinem Gedächtnis noch heute. Das Telefon klingelte, als ich auf der Malerleiter stand. Ich war dabei, mein Schlafzimmer frisch zu tapezieren und meine Wohnung befand sich in der Arbeitsunordnung, die solche Aktivitäten bekanntlich mit sich bringen. Trotzdem fand ich einen geeigneten Platz, als ich wußte, wer da vermutlich ein längeres Gespräch mit mir führen wollte und so kam es auch. Frau Semsch interessierte sich unter anderem dafür, was ich denn mal wieder aufgeschrieben hätte und ich versprach, ihr ein Manuskript von meiner Aufzeichnung „Tante und Onkel“ zu schicken. Dazu kam es aber nicht. Noch bevor ich das Chaos in meiner Wohnung beseitigt hatte, erreichte mich die Nachricht von ihrem Tod.
In Gedanken habe ich ihr schon mehrmals gesagt, daß es mir leid tut, daß ich mein Versprechen nicht einhalten konnte. Als Wiedergutmachung
erinnere ich heute nach zwanzig Jahren achtungsvoll an ihren Todestag, den 24.09.2003. Mit ihrer Niederschrift „Wie‘s daheim war“ erzählt sie authentisch von Straschnitz, dem Ort ihrer Jugendzeit. Ich habe diese Niederschrift – von ihr auf einer zeitgemäßen Schreibmaschine getippt – in meinem Computer festgehalten. Außerdem habe ich mir erlaubt, einige aus unserem Dialekt stammende Begriffe mit einem allgemein verständlichen Wort zu ergänzen, denn es gibt sicher nur wenige Leser, die sich zum Beispiel etwas unter dem Adjektiv „labarwarschtlgrou“ vorstellen können. Wörtlich könnte man es als leberwurstgrau ins Hochdeutsche übersetzen oder es schlicht als dämmrig bezeichnen. Aber was ist schon dämmrig, gemessen an der wunderbaren Lautmalerei von labarwarschtlgrou?
Auf jeden Fall halte ich das, was sie uns erzählt, für bemerkenswert und lesenswert. Selbst zwischen den Zeilen spüren wir einen Hauch dessen, was ich als heimatliche Mentalität bezeichnen möchte. Die eventuelle Frage, ob Frau Semsch einer Veröffentlichung ihrer Arbeit zustimmen würde, könnte ich nicht wirklich beantworten und fragen können wir sie nicht mehr. Also gehen wir einfach davon aus, ihr gutes Herz gönnt den heutigen Lesern das Vergnügen, in die dörfliche Welt des Sudetenlandes einzutauchen. Margarethe Ulber
25.10.1952, Gernot Bergmann
� Poesie
12.10.1930, Margarete Seitter, geborene Langer
Gedicht vom Sudetengau
Wir lebten dort in Ruh‘ und Frieden, doch lange war dieses Glück mir nicht beschieden.
Eines Tages kam der Befehl, es ist wahr, was ich hier jetzt erzähl‘: Gestellt sein am Gemeindehaus in Sonneberg, früh um vier Uhr. Mitnehmen dürft ihr nur, was ihr am Leib und in der Hand tragen kund, es geht jetzt ab in‘s Lager rund.
Die Schwarzen waren ja beritten und wir sind daneben hergeschritten. Wer nicht mehr laufen konnt‘ zu dieser Stund‘, wurde geprügelt wie ein Hund.
Im Lager angekommen, wurden alle in Empfang genommen. Durchsucht wurden wir bis auf die Haut, so daß einem heut‘
noch davor graut. Schmuck und Ohrringe wurden rausgerissen, wenn man daran denkt, geht es einem heute noch beschissen. Man steckte uns in Bara kken rein, das waren Zeiten, es ist heute noch zum Weinen.
Sechzig Mann in einem Zimmer, mit Essen war es auch noch schlimmer. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, so war unser‘s Lagers Ziel.
Eines Tages kam die Parole: Es geht bald nach Haus, aber leider wurde nichts daraus –wir kamen in ein anderes Haus. Ein Jahr später mußten wir nach Mecklenburg heraus. Maria Hackel, geb. Marschner, früher Kreis Böhmisch Leipa, Einsender: Kurt Hammer
� Unseren Toten zum ehrenden Gedenken
April 2023
Wenzel de Bernardo, Meerane, im Alter von 93 Jahren, früher Libochowan
04.01.2021
Erna Pech geb. Illmann, Lohmen/Pirna, im Alter von 90 Jahren, früher Taucherschin Nr. 4
28.07.2023
Edeltraud Hanzsch geb. Illmann, Memmingen, im Alter von 84 Jahren, früher Taucherschin Nr. 4
05.04.2023
Hilde Krebs geb. Hahnel, im Alter von 91 Jahren, früher Taucherschin Nr.
„Wenn Ihr mich sucht, sucht mich in Euren Herzen“
Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

Betreuer der Heimatkreise – Aussig: Brigitta Gottmann, Hebbelweg 8, 58513 Lüdenscheid, Tel. 02351 51153, eMail: brigitta.gottmann@t-online.de – Kulm: Rosemarie Kraus, Alte Schulstr. 14, 96272 Hochstadt, Tel. 09574 2929805, eMail: krausrosemarie65@gmail.com – Peterswald, Königswald: Renate von Babka, 71522 Backnang, Hessigheimerstr. 15, Tel. 0171 1418060, eMail: renatevonbabka@web.de – Heimatgruppe Graupen, Mariaschein, Rosenthal und Umgebung: Sibylle Schulze, Müggelschlößchenweg 36, 12559 Berlin, Tel. 030 64326636, eMail: sibyllemc@web.de – Redaktion: Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: aussiger-bote@t-online.de – Redaktionsschluß: jeweils der 15. des Vormonats.
Erinnern Sie sich noch an das 5-bändige Werk „Schicht’s Kochbuch“? Frauen und Mädchen kochten nach dem Ersten Weltkrieg und Jahre später nach den Rezepten und mit den Produkten der Firma Schicht: Ceres-Speisefett und Visan-Milchmargarine. So profilierte sich der Seifen- und Waschmittelhersteller Schicht mit seinen Produkten auch in der Küche.
Bereits 1903 wurde Ceres, aus Kokosöl und hundertprozentigem Pflanzenöl, zum Konkurrenten für das traditionelle Schweineschmalz. Berühmtheit erlangte Ceres auch bei der Olympiade 1936 als „gesundes“

Fett. Selbst in jüdischen Haushalten, in denen kein Schweinefleisch gegessen wird, hielt es Einzug und wurde in der Aussiger Fabrik gemäß Ritualvorschriften unter Aufsicht eines Rabbi hergestellt. Der Geschäftserfolg mit Ceres-Fett führte zum Aufschwung der Firma Schicht, so daß 1911 die erste Fetthärtungsanlage Europas und die vierte weltweit in Aussig erbaut werden konnte. Dazu kamen die Öle Vegetol und Ceresol und der Ceres-Apfelsaft, der bis 1952 produziert wurde.
Nach der Vertreibung übernahm das tschechische Unternehmen Setuza die Speiseöl- und -fettproduktion am alten Firmensitz in Schreckenstein. Noch heute ist Setuza der größte Verarbeiter von Ölpflanzen und führender Lieferant von Speisefetten, Ölen und Margarine in Tschechien. Allerdings sucht man die Namen Ceres und Ceresol heute vergebens, die Produkte sind unter den Namen „Lukana“ und „Käkä“ im Handel.
Zurück zum Kochbuch. Interessant ist das Vorwort im 1. Band, das die damalige Zeit und die
� Persönlichkeiten
� Aussig
Schicht´s Kochbuch
schaft und Volksgesundheit haben Visan-Milchmargarine und Ceres-Speisefett eine außerordentliche Bedeutung. Wenn man die vielseitigen Verwendungsarten der beiden Produkte in Erwägung zieht, wird uns erst klar, wie unökonomisch die Kochbücher der Vergangenheit gewesen sind. … Der Gesamtinhalt unseres Werkes besteht nur aus praktisch erprobten Rezepten, die Abbildungen wurden anhand der fertiggestellten Speisen gezeichnet und koloriert, sind daher nicht als bloße Ausschmückung anzusehen, sondern als eine wichtige Ergänzung. Wort und Bild ermöglichen selbst der ungeübten Anfängerin eine praktische Handhabung der Rezepte.
Möge damit Schicht’s Kochbuch als zuverlässiger Ratgeber im Reiche der Küche willkommen sein und in allen Frauenkreisen freudige Aufnahme finden.“
Frau Kippberger aus Bensheim übergab vor Jahren dem Aussiger Archiv den blauen Sammelband „Schicht‘s Kochbuch“ mit den noch erhaltenen Bänden:
1. Band „Mehlspeisen“
3. Band „Suppen - Soßen - Gemüse - Eierspeisen“ mit dem Untertitel: Der Tisch als Mittelpunkt der Familie und Gesellschaft.
Stellung der Frau widerspiegelt: „Geehrte Hausfrau! Täglich tritt an Sie die Pflicht heran, ihre Ausgaben für Küchenzwecke mit der allgemein fühlbaren Geldknappheit in Einklang zu bringen. …Geordnete Wirtschaftsverhältnisse der einzelnen Haushaltungen bilden die Grundlage eines gefestigten Staatswesens. Es gehört deshalb wohl zu den dankbarsten Aufgaben der Gegenwart, mit den Frauen neue Wege zur Erhaltung un-
serer Volkswirtschaft zu suchen. Die aufreibenden Jahre der staatlichen Zwangswirtschaft, die schwere Zeit der großen Fettund Eiernot sind zwar längst vorüber, den breiten Volksschichten ist es aber bei der herrschenden Lebensmittelteuerung trotzdem unmöglich, sich dem Massenverbrauch an Butter und Eiern wieder zuzuwenden, den die Kochbücher der Vorkriegszeit veranlaßt hatte. Heute sind wir ja über den Nährwert des Eies und anderer
Der Heimatmaler Walter Zimmanyi
Zu den Persönlichkeiten unserer Heimat gehört auch der Maler, Grafiker und Kunsterzieher Walter Zimmanyi, der im Jahr 2000 für sein Aquarell „Blick in das Elbetal bei Aussig – Sudetenland“ den Kunstpreis des Bundes der Vertriebenen/Landesverband Thüringen erhielt.

Walter Zimmanyi wurde am 15.5.1928 in Brüx geboren und zog mit seiner Familie1936 nach Aussig. Dort mußte er als 17-Jähriger das Massaker vom 31. Juli 1945 auf der Brücke miterleben. Selbst kam er nur knapp mit dem Leben davon. Nach seiner Inhaftierung wurde er in das berüchtigte Lager Lerchenfeld gebracht. Seiner Mutter gelang es, die Entlassung zu erwirken. 1946 wurde die Familie aus Aussig vertrieben. 1953 erhielt
Zimmanyi in der DDR eine Anstellung als Lehrer und begann ein Studium zum Kunsterzieher. 1958 wurde er Schuldirektor der Polytechnischen Oberschule in Guthmannshausen/Kreis Sömmerda und bekleidete dieses Amt bis zu seiner Pensionierung. Trotz seiner schlimmen Erfahrungen in der Jugend malte
Walter Zimmanyi an der Staffelei.
Walter Zimmanyi seine Heimat in den schönsten Farben und
Nahrungsmittel auch nicht mehr derselben Meinung wie vor dem Kriege. Jede umsichtige Hausfrau verzichtet z. B. jetzt aus Sparsamkeit auf den Verbrauch tierischer Fettstoffe in der Küche, denn sie weiß, daß Pflanzenfette nahrhaft, billiger und leicht verdaulich sind und daß die ernste Mahnung „Sparen und Zusammenhalten“, die als unsichtbarer Haussegen über jeder Küche schwebt, durch den steten Gebrauch von Visan und Ceres in die Tat umgesetzt wird.
Die Möglichkeit der Verwendung von Visan und Ceres gibt uns für die Kochbücher der Jetztzeit eine ganz neue Richtung. Beide Erzeugnisse werden in immer gleichmäßiger, einwandfreier Qualität hergestellt. Sie sind billig und gut und daher nicht nur im privaten Haushalt unentbehrlich, sondern auch in allen Küchen, wo man auf die sparsame Zubereitung nahrhafter, wohlschmeckender Speisen Wert legt. Vom Standpunkt der Volkswirt-
5. Band „Getränke - Süße Sulzen - Gefrorenes - Einsieden und Einlagern von Obst und Gemüse - Kompotte - pikante und sauere Früchte - Nationalspeisen - Krankenkost“.
Möglicherweise befinden sich an anderer Stelle die fehlenden Bände 2 und 4.
kw
Quelle: „Schicht’s Kochbuch“, „Berühmte lokale Marken aus Aussig“, Stadtmuseum Aussig.
Foto: „Schicht‘s Kochbuch“
Der „Kino-Architekt“ Richard Brosche
präsentierte seine Werke in verschiedenen Ausstellungen in der DDR. Am 1. Dezember 2015 starb Walter Zimmanyi 87-jährig in Guthmannshausen. Leider konnten wir sein prämiertes Bild „Blick in das Elbetal“ im Archiv nicht finden. Aber das Aquarell der Burgruine Schreckenstein gibt einen Eindruck seines großen Könnens.

kw
Quelle: Helmut Hoffmann.
Fotos: Archiv
R
ichard Brosche wurde am 2. Februar 1884 in Johannesthal bei Reichenberg geboren. Sein Architekturstudium absolvierte er an der technischen Hochschule in Karlsruhe (Baden-Württemberg). 1911 machte er sich in Duisburg-Hamborn als Architekt selbständig. Den Ersten Weltkrieg erlebte er an der italienischen und russischen Front. Nach Kriegsende kehrte er in seine Geburtsheimat zurück, wo er zunächst in Böhmisch-Leipa und später in Schreckenstein ein Architekturbüro besaß.

Brosche entwarf hauptsächlich öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, Kirchen, Theatergebäude und vor allem Kinos. Man kann sagen, daß er in Nordböhmen fast das Monopol auf Lichtspielhäuser hatte. Unter seiner Regie entstanden zunächst Kinos in Asch, Eger, Falkenau, Karlsbad, Kaaden und Dux. In Aussig schuf er die Kammerlichtspiele und die Olympia-Lichtspiele sowie die Alhambra-Lichtspiele in Schreckenstein-Krammel. Auch die Lichtspieltheater in Königswald, Teplitz und in 10 weiteren Orten bis hinein ins Riesengebirge trugen die Handschrift Brosches. Aber er
schuf nicht nur Kinos. 1926-1928 wurde in Böhmisch-Leipa nach seinen Plänen die Jan-Hus-Kirche erbaut, die 2021 nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wiedereröffnet wurde. Dank ihrer besonderen Akustik und der berühmten Orgel beheimatet sie einen der wichtigsten Konzertsäle im heutigen Česká Lípa.
Richard Brosches politisches Engagement in der Sudetendeutschen Partei gipfelte 1938 in seinem Amt als Bürgermeister der Stadt Schreckenstein. 1939,
Evangelische Kirche in BöhmischLeipa, 2021. Foto: MartinVeselka

bei der Eingemeindung von Schreckenstein in den Stadtkreis Aussig, verzichtete er jedoch auf ein Mandat als Stadtrat – inzwischen für die NSDAP –und wurde stattdessen Leiter der Planungsabteilung beim Stadtbauamt Aussig.

Nach Kriegsende aus Aussig vertrieben, siedelte er sich in Duisburg an. Hier erneuerte er 1956 die im Krieg beschädigte Kirche in Obermarxloh.
Richard Brosche starb am 22. Oktober 1965 in Aalen in BadenWürttemberg. kw
Quelle: Helmut Hoffmann
� Riesengebirglers Heimatlied
Othmar Fiebiger –vom Riesengebirge nach Aussig
Othmar Fiebiger stammte aus dem Riesengebirge und wir alle kennen seine größte Hinterlassenschaft, das Riesengebirgler Heimatlied. Aber auch wir Aussiger haben eine enge Beziehung zu ihm. Nicht nur, weil uns das Riesengebirgslied genauso zu Herzen geht und unser Erzgebirge ebenfalls „Blaue Berge, grüne Täler“ aufzuweisen hat – Othmar Fiebiger war dreißig Jahre lang Oberlehrer und Erzieher an der Volksschule in Schreckenstein-Obersedlitz! Er war ein äußerst beliebter Lehrer, der für sein Leben gern sang und mit Einfühlungsvermögen und Humor unterrichtete.
HUMOR
Menschenkind, da hilft kein Klagen, nimm, was kommt, nur fest beim Kragen. Und wenn’s beißt, so beiße wieder. Denk – im Mai nur blüht der Flieder und im Sommer blühn die Rosen, und aus Höschen werden Hosen. Und wenn’s schneit… Freund, schließ das Tor, nur vergiß nicht den Humor.
Denn wo der dann fehlt im Haus, löscht die letzte Lampe aus.
Othmar Fiebiger

So kannte man „unseren“ Heimatdichter, den wir kurzer-
� Meldungen
Saaz ist
Unesco-Weltkulturerbe
Im AB Folge 31/32 vom 4. August 2023 hatten wir über die Bewerbung von Saaz (Zatec) zur Aufnahme in die Liste des UnescoWeltkulturerbes berichtet. Es hat geklappt! Am 18.9.2023 wurde im saudi-arabischen Riad von der Jury entschieden, Saaz aufzunehmen. Es handelt sich um die erste Gegend, die wegen ihrer Biertradition auf der Unesco-Liste steht, denn es betrifft die gesamte Region der Saazer Hopfenlandschaft. Die Aufnahme kann ein wichtiges Argument werden bei der Beantragung von Fördergeldern, so Stanislav Štech, Vorsitzender der tschechischen Unesco-Kommission. kw
hand für diesen Beitrag aus dem Riesengebirge entliehen haben.
Othmar Fiebiger wurde am 21. April 1886 in Altenbuch bei Trautenau im Riesengebirge geboren. Seine ersten Berufsjahre verbrachte er als Dorfschullehrer an der Waldschule in Anseith, von 1915 bis 1945 war er Oberlehrer in Aussig-Schreckenstein. Nach der Vertreibung wurde er in die „Russische Zone“ bei Erfurt abgeschoben. Mit seiner Familie lebte er anschließend in Höchst im Odenwald und später in der Stadt Bensheim, wo er bis zur Pensionierung als Pädagoge tätig war. In den 1950er Jahren widmete sich Fiebiger vermehrt seiner schriftstellerischen Tätigkeit und arbeitete 15 Jahre lang als Mitarbeiter bei der Heimatzeitschrift „Riesengebirgsheimat“. Die letzten Jahre verbrachte er mit seiner Gattin bei ihrer Tocher in Baden-Baden, wo er fast 86-jährig am 23.2.1972 verstarb.

Budweis wird europäische Kulturhauptstadt 2028
Budweis wird 2028 die Tschechische Republik als Kulturhauptstadt Europas vertreten, nachdem es sich im Finale der nationalen Auswahl gegen Braunau durchgesetzt hat. Brünn und Reichenberg waren bereits in der Vorrunde ausgeschieden.
Die Stadt wird in den nächsten Jahren über 21 Millionen Euro in kulturelle Veranstaltungen sowie Renovierungen der Innenstadt und Neubauten, wie die Südböhmische Aleš-Galerie investieren.
Bisher haben zwei tschechische Städte den Titel „Kulturhauptstadt“ getragen: Prag im Jahr 2000 und Pilsen 2015. Die Bierkultur hat in diesem Jahr – wie bei der Entscheidung für Saaz – offensichtlich auch hier gesiegt. kw
Ein neuer Spieler für den FK Usti nad Labem
Die Medien bezeichnen es als den „verrücktesten Transfer des Jahres“, denn Martin Podhajyski (22) hat noch nie Fußball gespielt. Der Präsident des Drittligisten FK Ústi nad Labem Přemysl
Kuban hat dem Spieler dennoch einen Platz zugesagt, denn sein Vater spendete dem Verein 21.000 Euro, mit der Auflage, daß sein Sohn in der 1. Mannschaft spielt. Präsident Kuban: „So weit
Das Riesengebirgler Heimatlied
Bei einer Wanderung zur Peterbaude im Jahr 1911 trug sich Fiebiger ins Wanderbuch mit diesem Vers ein: „Bloe Barche, griene Täla, mitta dren a Hesla klen, herrlich is dos Steckla Erde, on ich bin ju dart doheem. O mei liewes Riesageberche.“ 1914 erweiterte Fiebiger den Text zu einer vierstrophige Fassung. Der Komponist Vinzenz Hampel (18801955) vertonte 1915 die Verse für seinen Gesangsverein „Liedertafel“ in Hohenelbe – das „Riesengebirgler Heimatlied“ war geboren. Liedpostkarten verbreiteten die volkstümliche Weise.
Aufgrund des Erfolges schuf Fiebiger eine hochdeutsche Textfassung, die 1920 in das „Liederbuch des Deutschen Sängerbundes“ aufgenommen wurde.
Der Refrain mit dem Ausdruck „deutsches Gebirge“ erregte bereits 1920 in der Tschechoslowakei Anstoß. Auch in der DDR, dem Bruderstaat der CSR, war es bis 1989 verboten. Ganz anders im Westen. Das Lied wurde nach der Vertreibung zur „Hymne der Sudetendeutschen“.
Bis heute gibt es kein Treffen der Riesengebirgler, bei dem nicht das „Riesengebirgler Heimatlied“ gesungen wird. Es beschert heimattreuen Menschen immer einen Gänsehautmoment und rührt die Seelen der Heimatvertriebenen weit übers Riesengebirge hinaus. kw Quelle: Heimatkreis Hohenelbe, AB 12/2013
ich weiß, hat sein Sohn bis jetzt nur das Spiel FIFA auf der Konsole gezockt. Aber für so viel Geld lasse ich jeden mitspielen.“ kw Quelle: Internet
Brandkatastrophe im „Haus der Heimat“ in Wien Der Brand vom 15. auf den 16. August hat den Festsaal und das gesamte dazugehörige Stockwerk komplett zerstört. Die Etage darunter ist durch das Löschwasser ebenfalls stark beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der materielle Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro. Hinzu kommt, daß wichtige Erinnerungsstücke verbrannt sind, wie ein großes historisches Gemälde von Aussig viele Dokumente aus dem Archiv und zahlreiche Trachten, berichtet SLÖ-Bundesobmann DDr. Stix.
Quelle: Sudetendeutsche Zeitung
Nr. 36
Riesengebirglers Heimatlied
1. Blaue Berge, grüne Täler, Mittendrin ein Häuschen klein, Herrlich ist dies Stückchen Erde, Und ich bin ja dort daheim. Als ich einst ins Land gezogen, Ham‘ die Berg‘ mir nachgeseh‘n. Mit der Kindheit, mit der Jugend, Wußt selbst nicht wie mir gescheh‘n.

Refrain:
Oh, mein liebes Riesengebirge, Wo die Elbe so heimlich rinnt, Wo der Rübezahl mit seinen Zwergen Heut‘ noch Sagen und Märchen spinnt. Riesengebirge, deutsches Gebirge, Meine liebe Heimat du!
2. Ist mir gut und schlecht gegangen, Hab‘ gesungen und gelacht, Doch in manchen bangen Stunden Hat mein Herz ganz still gepocht. Und mich zog‘s nach Jahr und Stunden Wieder heim ins Elternhaus. Hielt‘s nicht mehr vor lauter Sehnsucht Bei den fremden Menschen aus.
3. Heil‘ge Heimat, Vater, Mutter; Und ich lieg an ihrer Brust, Wie dereinst in Kindheitstagen, Da von Leid ich nichts gewußt. Wieder läuten hell die Glocken, Wieder streichelt ihre Hand, Und die Uhr im alten Stübchen Tickt wie grüßend von der Wand.
4. Und kommt‘s einstens zum Begraben, Mögt ihr euren Willen tun, Nur das eine, ja das eine, Laßt mich in der Heimat ruh’n! Wird der Herrgott mich dann fragen Droben nach dem Heimatschein, Will ich deutsch und stolz und deutlich Vor dem Himmelstore schrei’n:
Bin aus dem lieben Riesengebirge, Wo die Elbe so heimlich rinnt, Wo der Rübezahl mit seinen Zwergen Heut’ noch Sagen und Märchen spinnt. Riesengebirge, deutsches Gebirge, Meine liebe Heimat du!
Text: O. Fiebiger, Melodie: V. Hampel
krankte Personen (DuchenneMuskeldystrophie) gesammelt.
Drei Teams zu je 4 Personen sind am Start. Eine Person läuft und drei begleiten sie auf dem Fahrrad. Dabei wird natürlich immer durchgewechselt, denn der jeweilige Läufer bestimmt die Geschwindigkeit.
Die siebte Etappe von Dobri-
n 100. Geburtstag: Am 15.10. Edith TREML geb. Hörtler aus Aussig-Kleische, Flurenstr. 32 in CH-8952 Schlieren, Alter Zürichweg 24.
n 98. Geburtstag: Am 26.10. Edeltraud MOHNERT aus Nestomitz, Lindenstr. 110.
n 97. Geburtstag: Am 15.10. Erwin SOUTSCHEK aus Schöbritz Nr. 61.
n 95. Geburtstag: Am 28.10. Walter ZECHEL (Böhm-Wona W.) aus Schönwald/Streckenwald.
63179 Obertshausen, Bieberer Str. 21.
n 85. Geburtstag: Am 21. 10. Horst PÖPPERL aus Aussig, Kunststr. 36.
n 84. Geburtstag: Am 4. 11. Willi WOLF aus Peterswald Nr. 257 (Zöllnerbauer), Tel. 07146 9396766.
n 81. Geburtstag: Am 18. 10. Brigitte RICHTER geb. Giebel aus Schreckenstein in 06792 Sandersdorf, Pfingstanger 20.
n 80. Geburtstag: Am 21. 10. Roland BRAND aus Ziebernik Nr. 3.
Lauf-Kultour 2023 mit Aussig-Etappe

Die Lauf-Kultour wurde 2007 in Chemnitz als studentische Initiative gegründet und seitdem jedes Jahr als Staffellauf durchgeführt. Dabei werden in Tagesetappen von 80 bis 140 Kilometern Spendengelder zur Unterstützung hilfsbedürftiger Vereine für genetisch muskeler-
chowitz (Dobřichovice) endete in Aussig. Ein Teilnehmer schreibt in seinem Tagebuch: „Etwa 200 Meter vor dem Empfang in Ústi der erste größere Defekt der diesjährigen Tour – gerissene Kette. Vom Radladen in Ústi bekamen wir dann noch drei gelbe Fahrräder übergeben (die sollen mit nach Chemnitz) und endlich ging‘s zur Unterkunft. Hier wartete ein weiterer herzlicher Empfang mit umfangreichem und sehr leckerem Buffet auf uns.“

Eine tolle Idee der jungen Leute – finden Sie nicht auch? kw Quelle: www.lauf-kultour.de
n 94. Geburtstag: Am 29. 10. Gertraud BUHSE geb. Kühnel (Bauer Traudl) aus Streckenwald in 23974 Blowatz, Wodorf 9.
n 92. Geburtstag: Am 28. 10. Herta MEISNER geb. Thuma aus Aussig in 07629 Hermsdorf, Rudolf-Breitscheid-Str. 20.
n 91. Geburtstag: Am 23. 10. Margit APPEL geb. Tscherpel aus Peterswald/Hungertuch in
n 78. Geburtstag: Am 4. 11.
Peter HICKISCH aus Karbitz.
n 77. Geburtstag: Am 21. 10. Dr. Siegfried STARK (Sohn von Lieselotte Stark).
n 50. Geburtstag: Am 12. 10. Mario ILLMANN, Ortsbetreuer u.a. für Taucherschin, wohnhaft in Pirna.
