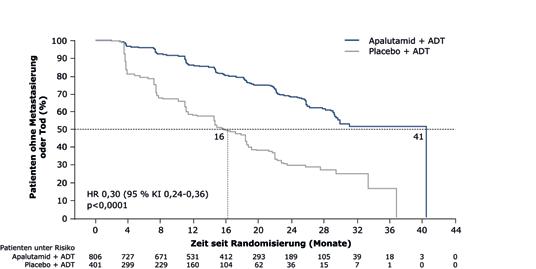5 minute read
Multiple Sklerose: Real-World-Daten können bei der Therapieentscheidung unterstützen
Die Auswahl der passenden Therapieoption bei schubförmig remittierender Multi
pler Sklerose (RRMS) erfolgt auf Basis einer Reihe praxisrelevanter Kriterien. So spielen neben dem zu erwartenden Therapieerfolg, den
Advertisement
Nebenwirkungen und Abbruchraten der individuelle Krankheitsverlauf sowie die Lebensplanung des Patienten in der Therapieentschei
dung eine wichtige Rolle. Ergänzend zu den Ergebnissen klinischer Studien liefert heute eine steigende Zahl von Daten direkt aus der Ver
sorgungspraxis, sogenannte RealWorld-Daten, belastbare Informationen. Eine aktuelle Auswertung von Behandlungsdaten aus dem
dänischen MS-Register zeigt einen
Vergleich von Therapieergebnissen und Abbruchraten zwischen Dimethylfumarat (Tecfidera ® ,
DMF) und Teriflunomid. Demnach blieb die jährliche Schubrate unter DMF um 42% signifikant niedriger als unter Teriflunomid [1].
Vor der Therapie die zu erwartenden Ergebnisse abschätzen
Bei fehlender oder unzureichender Therapie führt die RRMS langfristig fast immer zu einer Zunahme der Behinderung. Ziel der Behandlung ist es daher, die Langzeitprognose bezogen auf die Behinderung maßgeblich zu verbessern [2]. Im Rahmen der Auswahl der individuell passenden Therapieoption gilt es daher, mehrere praktische Fragen zu bedenken. Besonders wichtig für Arzt und Patient ist dabei eine Einschätzung der kurz-, mittel- und langfristig zu erwartenden Therapieergebnisse. Auch unerwünschte Ereignisse spielen in Bezug auf die Patientensicherheit und -adhärenz eine wichtige Rolle.
Hier gilt es, mögliche Nebenwirkungen und deren Schweregrad in der Therapieentscheidung zu berücksichtigen. Da die MS-Behandlung immer eine langfristige sein sollte, ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Therapieabbruchs wegen unzureichender Wirkung bzw. nicht tolerierter Nebenwirkungen ein wichtiges Kriterium. Nicht zuletzt sollte gemeinsam mit dem Patienten entschieden werden, welches Präparat bei seinem individuellen Krankheitsverlauf, seinen persönlichen Bedürfnissen und seiner Lebensplanung am besten geeignet ist.
Dänisches Register ermöglicht Vergleich zwischen DMF und Teriflunomid
Neben den Ergebnissen klinischer randomisierter Studien kann der Arzt bei der Therapieplanung heute auf eine Reihe von Daten direkt aus der ärztlichen Praxis – RealWorld-Daten – zurückgreifen. Die gemeinsame Betrachtung der verfügbaren Daten ermöglicht es, zahlreiche praxisrelevante Fragen zu beantworten. So lassen die Ergebnisse einer aktuellen Auswertung des dänischen MS-Registers wertvolle Rückschlüsse auf die Therapieergebnisse im Behandlungsalltag unter DMF im Vergleich zu Teriflunomid zu [1]. Anders als in Deutschland werden alle dänischen Patienten mit MS (inkl. klinisch isoliertem Syndrom, KIS) landesweit in insgesamt 14 spezialisierten MS-Kliniken behandelt. Die Patientendaten werden dabei vom jeweiligen behandelnden Neurologen zu Therapiebeginn sowie nach 3 bzw. 6 Monaten und danach alle 6 Monate in ein großes Register eingepflegt. Analysen dieses Registers spiegeln daher die gesamte dänische MS-Population wider [1]. In die aktuelle Auswertung flossen Daten von 2.236 erwachsenen Patienten ein, die zwischen Oktober 2013 und Mai 2018 DMF oder Teriflunomid erhalten hatten. Ausgeschlossen waren u.a. Patienten mit vorheriger Behandlung mit hochwirksamen krankheitsmodifizierenden Therapien (Disease Modifying Therapy, DMT), mehr als 2 unterschiedlichen DMTs in der Vorgeschichte oder einer Behandlungsdauer von über 8 Jahren. Als primäre Endpunkte wurden die jährliche Schubrate (ARR) sowie das Verhältnis der Schubraten unter DMF vs. Teriflunomid definiert. Sekundäre Endpunkte waren die Zeit bis zum ersten Schub, die Zeit bis zur Behinderungsprogression (bestätigt nach 6 Monaten), die kumulative Inzidenz ursachenspezifischer Therapieabbrüche bzw. Therapiewechsel aufgrund von Krankheitsaktivität oder uner
Dimethylfumarat (DMF)
Dimethylfumarat (Tecfidera ® 120 mg/240 mg magensaftresistente Hartkapseln) ist zugelassen zur oralen Behandlung von erwachsenen Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose. Auch wenn der exakte Wirkmechanismus derzeit nicht bekannt ist, ist Dimethylfumarat bisher der einzige in klinischen Studien untersuchte Wirkstoff für die Behandlung von MS, für den angenommen wird, dass er den Nrf2-Signalweg aktiviert. Der Nrf2-Signalweg ist ein körpereigener Abwehrmechanismus, der Zellen vor potenziell schädlichen Einflüssen wie Entzündungen und oxidativem Stress schützt, die unter anderem bei der MS-Pathophysiologie eine Rolle spielen [4].
wünschten Ereignissen. Die Auswertung erfolgte auf Basis einer Gewichtung der Therapieeffekte (Inverse Probability of Treatment Weights; IPTW) sowie der Propensity-Score-Methode [1]. Die Ergebnisse zeigen eine über 4 Jahre um 42% signifikant niedrigere jährliche Schubrate unter DMF verglichen mit Teriflunomid (0,09 vs. 0,16; p<0,001). Zudem blieben etwa 76% der Patienten unter DMF über 4 Jahre schubfrei, verglichen mit ca. 65% unter Teriflunomid. Die Abbruchraten aufgrund unerwünschter Ereignisse betrugen 18,0% unter DMF und 18,5% unter Teriflunomid – und waren damit nach 4 Jahren vergleichbar hoch. Dagegen brachen unter Teriflunomid verglichen mit DMF etwa doppelt so viele Patienten die Therapie aufgrund mangelnder Wirksamkeit ab (22,4% vs. 10,7%). Bei DMF führten vor allem folgende Nebenwirkungen zu Therapieabbrüchen: gastrointestinale Ereignisse, Flush-Symptomatik, Reduktion der Lymphozytenzahl. Bei Teriflunomid waren es ein Anstieg der Leberwerte, gastrointestinale Ereignisse und Haarausdünnung [1]. Als Limitation der Studie führten die Autoren an, dass aus den Daten keine Informationen zur Fa
milienplanung bei den dänischen MS-Patientinnen hervorgehen. In dänischen Leitlinien wird empfohlen, Frauen, die im nächsten Jahr eine Schwangerschaft planen, mit DMF anstelle von Teriflunomid zu behandeln. Dazu passe auch, dass Frauen häufiger mit DMF behandelt wurden als Männer. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass Frauen, die eine Schwangerschaft in Betracht ziehen eine geringere Krankheitsaktivität aufweisen. Dies könnte einen positiven Einfluss auf die Therapieergebnisse von DMF mit sich bringen. Die Autoren gehen allerdings davon aus, dass Frauen mit objektiven Anzeichen hoher Krankheitsaktivität ihre Therapie eher mit einem hocheffektiven DMT beginnen und nicht mit Teriflunomid. Eine weitere Limitation der Auswertung war der Ausschluss von Patienten, die zwischen Teriflunomid und DMF wechselten [1].
Moderne statistische Verfahren schaffen zusätzliche Evidenz
MS-Patienten im Wartezimmer des Neurologen unterscheiden sich von Studienpatienten [3]. So ist der durchschnittliche MS-Patient oft älter und weist eine längere Krankheitsdauer auf als Patienten aus Phase-III-Studien. Zudem sind körperliche Funktionsbeeinträchtigungen häufig deutlicher ausgeprägt als bei Patienten im Rahmen klinischer Studien. Real-WorldDaten bieten hier eine wertvolle Ergänzung mit Daten direkt aus dem Versorgungsalltag. Die so gewonnenen Ergebnisse erreichen zwar nicht den Evidenzgrad der RCTs, beschreiben aber den Nutzen eines Arzneimittels in der klinischen Routine. Um die Vergleichbarkeit der z.B. in Beobachtungsstudien und Behandlungsregistern beobachteten Therapieeffekte in diesen (meist größeren) gemischten Patientenkollektiven herzustellen, sind statistische Verfahren unverzichtbar. Mithilfe beispielsweise des Propensity Score Matching (PSM), einer Gewichtung der Therapieeffekte (Inverse Probability of Treatment Weights, IPTW) sowie rigoroser Sensitivitätsanalysen können die Therapieeffekte in den untersuchten Patientenkollektiven angeglichen und Therapieeffekte eingeschätzt werden.
Fabian Sandner, Nürnberg
Literatur
1 Buron M et al. Neurology 2019; 92:e1811-e1820 2 Gold R et al. Nervenheilkunde 2015;34: 915-922 3 Pellegrini F et al. ECTRIMS/ACTRIMS 2017; P352 4 Fachinformation Tecfidera ®
; Stand: Februar 2018