Organe spenden



Sind wir in Zukunft nur noch Ersatzteillager? 12

Leben mit dem Mond


Naturrhythmen für Naturmenschen 42



Grippe – ohne mich!


Die besten Tipps für den Winter 18

Keimlinge und Sprossen


Knackig Gesundes vom Fensterbrett 30


BAU MR IE SEN
Ein Vortrag über My thos, Kult und Forst
Europas mächtig ster Zeitzeugen

Michel Brunner Live Exklusiv aus dem Baumarchiv von proarbore.ch

VERANSTALTUNGEN 2013
Do. 10. Jan. KGH Frutigenstr. 22, Thun 19.30 Uhr
Fr. 11. Jan. Ref. Kirchgemeindehaus, Spiez 20 Uhr
Di. 15. Jan. Volkshaus, Zürich 20 Uhr
Mi. 16. Jan. Aula Campus BMS gibb, Bern 19.30 Uhr
Do. 17. Jan. Aula Campus BMS gibb, Bern 19.30 Uhr
Mi. 23. Jan. Aula Gsteighof, Burgdorf 20 Uhr
So. 27. Jan. Bärensaal, Worb 17 Uhr
Do. 31. Jan. Schützi, Olten 16.30 Uhr / 20 Uhr

Sa. 02. Feb. Botan. Garten der Uni, Freiburg 16 Uhr
So. 03. Feb. Volkshaus, Zürich 16.30 Uhr / 19.30 Uhr
Fr. 08. Feb. baz.cityforum, Basel 20 Uhr
Sa. 09. Feb. baz.cityforum, Basel 17 Uhr / 20 Uhr
So. 10. Feb. Hotel Engel, Liestal 17 Uhr
Mi. 27. Feb. Konzertsaal, Solothurn 20 Uhr
Mi. 06. März Bibliothek, Wiesendangen 20 Uhr
Saalkasse: 1 Stunde vor Beginn / Info: www.vivamos.ch
Reservation: www.olalei.ch Tel. 031 974 11 02

Wunderweltdes Winters
David Coulin
Das grosse Schneeschuhtourenbuch der Schweiz
192 Seiten, über 100 Fotos, gebunden
•50Schneeschuhtouren mit Varianten in der ganzen Schweiz
•Mit wunderschönen Fotos und praktischen Informationen für die Tour-Vorbereitung
•Für gemütliche Geniesser wie auch ambitionierte Sportler

Bestellcoupon
Ja, ich bestelle mit Rechnung zur portofreien Lieferung:

Portofreie Lieferung!
Expl. David Coulin: Das grosse Schneeschuhtourenbuch, Fr.49.90
/Vorname









































Kompet ent eJ ournaliste nu nd Journalistinnen schreiben für Sie in Schweizer Zeitungen und Zeitschrift en über Aktualität en und ihre Hint ergründe. Damit Sie besser informiert sind und sich eine eigene Meinung bilden kö nnen. Beste llen Sie jetzt per Mausklick ein Probeabo Ihrer gewünscht en Zeitung oder Zeitschrift und den Tierkalender auf www.presseabo.ch und mit etwas Glück gewinnen Sie CHF 10’000.– in bar oder Einkaufskart en vo nC oop City im Gesamtwert vo nC HF 40’000.–. IhreS chweizer Zeitungen und Zeitschriften.

Übernehmen Sie Verantwortung
Liebe Leserin, lieber Leser
Vielleicht gehören Sie wie ich zu jenen Menschen, die sagen: «Das Organspenden scheint mir eine vernünftige Sache zu sein.» Einen Spenderausweis haben Sie aber trotzdem bis heute nicht gemacht. Vielleicht weil der Schritt vom rationalen Kopfentscheid hin zur Tat eben doch zu gross ist für viele von uns, selbst wenn man sagt: «Was kümmerts mich, ob meine Niere bei mir bleibt, wenn ich tot bin.»
Nur: Wann genau bin ich tot? Was, wenn mein Herz eines Tages nicht einfach zu schlagen aufhört? Wenn ich einen Unfall hatte, im Koma liege und die Prognose «aussichtslos» heisst? Wenn mich nur noch Maschinen am Leben erhalten? Stellt man sie ab, dann bin ich tot – meine Organe aber noch frisch genug, um das Leben eines anderen Menschen zu verlängern oder gar zu retten.
Die gängige Praxis, die es – mit Einwilligung der betroffenen Person oder der Angehörigen – erlaubt, Organe zu entnehmen, setzt den sogenannten Hirntod voraus. Das ist dann der Fall, wenn die Gehirnfunktionen irreversibel ausgefallen sind. Inzwischen werden aber auch an Herz-Lungen-Maschinen angeschlossene Sterbende, deren Hirn noch arbeitet, deren Überlebeschancen aber gleich null sind, für eine Organspende präpariert
Sie bekommen beispielsweise Medikamente, um die Organe in bestmöglichem Zustand zu erhalten. Hier stellt sich unweigerlich die Frage der Ethik.
Darf ein Sterbender so behandelt werden, als wäre er schon tot? Verkommt der Mensch in seinen letzten Tagen zum Ersatzteillager? «Sind Sie ohnehin dem Tod geweiht, sollten Sie doch wenigstens anderen Menschen helfen, weiterzuleben», argumentieren Befürworter von Organspenden. Doch weil der Tod und das Sterben weit mehr als nur biologisch und medizinisch erklärbare Vorgänge und die technischen Möglichkeiten heute schier unbeschränkt sind, sind wohl viele – so wie ich – mit dem Thema überfordert
Darf ein Sterbender so behandelt werden, als wäre er schon tot? Redaktorin
Dennoch sollte man sich die Frage stellen, ob man seine Organe spenden will oder nicht, eine Entscheidung treffen und diese entsprechend festhalten. Tut man das nicht, müssen dies die Angehörigen übernehmen, was, wie das Beispiel im Artikel ab Seite 12 zeigt, nebst dem Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen, zu noch viel mehr zusätzlichem Leid führen kann.
Denken Sie darüber nach. Ich wünsche Ihnen einen guten Start im neuen Jahr

Klinik für Biokinematik
Herbert-Hellmann-Allee 29-31
D-79189 Bad Krozingen bei Freiburg
Tel. 0049-(0)7633/93321-0 Fax 0049-(0)7633/93321-99
Informieren Sie sich:

Praxis für Biokinematik
Basler Landstr 28b D-79111 Freiburg
Tel. 0049-(0)761-383037 Fax 0049-(0)761-383047
home: www.biokinematik.de mail: info@biokinematik.de
Natürliche Hautpflegelinie vom Toten Meer







Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss für Sie und Ihn aus den wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres mit Vitamin E, Aloe Vera, Jojoba und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei ISO 9001 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt
Für die schonende Pflege jeder Haut und jeden Alters; auch ideal bei Hautproblemen und Irritationen
Gesichts-, Körper-, Haar- & Sonnenpflege,Wellness-, Beauty- und Badeprodukte; Aloe Vera und Aloe Ferox als Gel und Saft; atmungsaktives Coverderm® 24 hAbdeck-Make-up (Camouflage) & Kompaktpuder

Bitte senden Sie mir Ihre fundierten, kostenlosen Unterlagen:


Unterwegs mit dem Nachtwächter 60
Inhalt



Gesundheit
10 Übergewicht ist schlecht fürs Gehirn
11 Wie Sie Ihren Hals gut durch den Winter bringen
12 Sterben versus weiterleben: Konfliktthema Organspenden
18 Propolis, ein kraftvoller Helfer aus der Natur
26 Heinz Knieriemen über das erstaunliche Element Wasser
Beratung
22 Sabine Hurni beantwortet Leserfragen
Haus & Garten
28 Gute Luft dank Pflanzen
29 Tun Herz und Gaumen gut: Baumnüsse
30 Zart und doch voller Kraft: Sprossen und Keimlinge
36 Remo Vetters Lob auf den Winter
Natur
40 Windräder sind für Vögel tödliche Fallen
41 Hausmäuse sind Überlebenskünstlerinnen
42 Wie uns die Mondphasen beeinflussen
46 Unterwegs auf Zürichs magischen Pfaden
Leben
54 Nobelpreisträger essen gerne Schokolade
55 Geduld ist lernbar
56 Was Smartphone und Co. mit unseren Köpfen anstellen
60 Wie einst: unterwegs mit dem Nachtwächter
63 FeldenkraisÜbungen für den Alltag
Plus
3 Editorial
7 Leserbriefe
50 Markt
52 Leserangebote
62 Agenda
64 Rätsel
65 Vorschau
66 Carte blanche



Spiel ohne Grenzen?




wir eltern weiss weiter und bringt jeden Monat die aktuellen Themen, die Sie beschäftigen. Jetzt 2 Monate kostenlos Probe lesen!












Tierische Freunde
«natürlich» 12-12
Tiere sind nun halt mal die besseren Menschen! Und haben eine entsprechende Behandlung verdient. Aus Ihrem Editorial lese ich genau jenes Unverständnis heraus, das heute viele den Haustieren und der Liebe, die sie uns geben, entgegenbringen. Unnötig.
Daniela Roll, Biel
Ich mag Hunde und auch Katzen. Aber die Art und Weise, wie diese Tiere heute vermenschlicht werden, übersteigt mein Verständnis. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die sogenannt besten Freunde als eine Art «Sozial- und Beziehungssklaven» gehalten werden. Statt dass sich die Menschen mit Menschen abgeben und ihnen helfen, schenkt man dem Grosi ein Büsi, damit es «jemanden hat». Oder die Tiere werden wie ein Kinderersatz gehegt, gep egt und verwöhnt, was dann darin gipfelt, dass einige Zeitgenossen Hunde oder Katzen echten Kindern vorziehen.
Immer wieder zu lesen in Zeitungsdiskussionen, wenn es beispielsweise darum geht, ob ein Hund im Zug auf dem Polster sitzen darf oder nicht. Eine Gesellschaft, die sich in dieser Frage bereits in gehässigen Kommentaren spaltet, hat vergessen, wer letztlich wirklich der beste Freund des Menschen ist: der Mensch.
Renate Duppenthaler, Winterthur
Einfach zauberhaft
«natürlich» 12-12
Passend, dass Sie das Thema Märchen ausgerechnet in der Dezember-Ausgabe aufgreifen. Schliesslich wird in diesem Monat das grösste aller Märchen ausgiebig gefeiert – die Weihnachtsgeschichte. Bestandteil jener Religion, die den Glauben unserer Vorfahren komplett ausgerottet hat, um heute als «unsere Kultur» gefeiert zu werden. Und Ursprung jener drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam), die seit ihrem Bestehen im Namen eines allmächtigen und in den Himmel entrückten Gottes bis heute für unzählige Greueltaten sorgen – und für sich erst noch in Anspruch nehmen, dass sich der Mensch im Namen und mit dem Segen seines Gottes die Erde untertan machen dürfe. Die Folgen davon sieht, wer wachen Auges durch die Welt geht. Und das alles aufgrund eines raf niert erzählten Märchens… Res Gloor, Thun
Der Umgang mit Umweltgiften «natürlich» 11-12
MitFreude lese ich immer wieder das «natürlich» und insbesondere die Beiträge von Heinz Knieriemen, die so herrlich (wenn auch nicht immer angenehm) das Bewusstsein schärfen. Beim Artikel über unseren Umgang mit Umweltgiften ist mir aufgefallen, dass er auf die Google-Suchmaschine verweist. Ich habe mal gehört, dass jede Suche mit einer Suchmaschine sehr viel Energie braucht.


Ich beginne erst, mein Bewusstsein diesbezüglich zu schärfen – und darum kenne ich neu die «grüne» Suchmaschine Ecosia.org, die 80 Prozent ihrer Einnahmen für den Regenwaldschutz spendet. Auch da kann man etwas tun.
Yvonne Schwienbacher, Luzern
Bittere Wahrheit
«natürlich» 11-12
Wir sollten die ausbeuterischen Produktionsmethoden in Assam und anderswo nicht unterstützen und keinen Schwarztee mehr im Supermarkt kaufen. Es gibt doch hervorragende Alternativen: zum Beispiel die Organisation «Teekampagne». Diese Firma liefert ihren Darjeeling mit einem alternativen Vertriebssystem zu unschlagbar günstigem Preis, da der Zwischenhandel, Lagerkosten und unnötige Wege ausgespart werden. Im Gegensatz zu manchem, was man im Supermarkt erhält, ist dieser Darjeeling wirklich echt und hocharomatisch. Jeder Lieferung sind Rückstandskontrollen beigelegt. Der Tee stammt von den Hängen des Himalaya. Die Teearbeiterinnen und Teearbeiter sind in Gewerkschaften organisiert, haben Krankenkassen, die Kinder Schulen – ein völlig anderes soziales Konzept als in Assam.
Silvia Sachs, per Mail
Mein letzter Tag «natürlich» 11-12
Ich bin enttäuscht von Thomas Widmers (egoistischem) Prinzip. Es müsste doch heissen: «Stell dir vor, morgen sei der letzte Tag ihres Lebens.» Erst wenn man einen lieben Menschen an seinem letzten Tag nicht mehr sehen oder begleiten durfte, weiss man, dass sich die Frage des Entscheides gar nicht stellt. Deshalb noch ein anderer Vorschlag: So früh wie möglich zu einer Feier gehen, einen Geburtstagskuss geben und sagen, dass man noch etwas vorhat, und nach einer halben Stunde verschwinden – im Berner Land gibt es
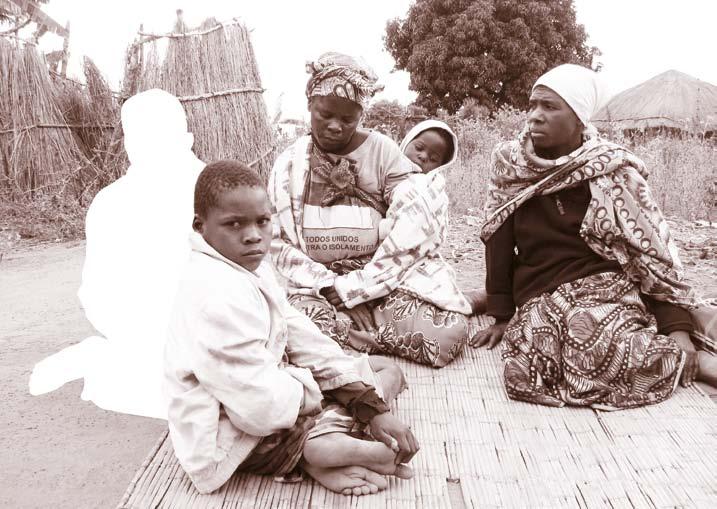

auch herrliche Wandermöglichkeiten. Der Freund oder die Freundin wird glücklich sein, dass man trotz des Vorhabens für ein paar Minuten vorbeigekommen ist. Uli Christoph, Crans/Céligny
Schulmedizin
contra Alternativmedizin
So wie es einst im Hochmittelalter die Nominalisten und die Realisten gab, so gibt es heute den grossen Gegensatz zwischen Schulmedizin und anthroposophischer Medizin. Die einstigen Nominalisten gingen davon aus, dass Allgemeinbegriffe wie Baum, Tisch oder Mensch eine ontologische Existenz hätten, das heisst die Begriffe seien nicht irgendeine Er ndung, sondern seien aus dem, was sie bezeichnen, selbst hervorgegangen. Wohingegen die Realisten der festen Überzeugung waren, dass die Begriffe aus reinen, verstandesmässigen Begriffsbildungen hervorgegangen seien, die mit dem Gegenstand, den sie bezeichnen, unmittelbar nichts zu tun hätten. So gesehen, meinen diese, könnte man

einen Stuhl geradeso gut mit Blumblum bezeichnen.
Diese einst philosophisch geführte Diskussion zeigt sich heute ganz woanders, ist aber auf diese grundlegende Divergenz in jener Auffassung begründet, ich spreche von Erkrankung und Genesung. Für den Schulmediziner machen Krankheiten grundsätzlich keinen Sinn, sie sind deshalb möglichst schnell zu beseitigen, denn sie stellen lediglich ein Ungemach dar. Für den anthroposophischen Arzt haben die Krankheiten einen tiefen Sinn für den Erkrankten, denn sie weisen darauf hin, dass ein Mensch aus dem Gesunden herausgefallen ist, der nun durch eine Krankheit zur Genesung kommen muss – die Krankheit also als Notwendigkeit, um zu einer Genesung zu kommen.
Eine Wortklauberei? Nein, denn wenn Patienten dieser beiden Auffassungsrichtungen gesunden, dann sprechen zwar beide Mediziner von der Genesung, meinen aber absolut nicht das Gleiche.
Chemie ignoriert ja nicht nur einen Gedanken – das könnte man noch hinnehmen –, sondern ist so gesehen Verdrängung der Entwicklung, ja Unterdrückung der Genesis des Menschen. Fataler geht es gar nicht. Es ist eine Spätfolge jenes Philosophenstreites, der mit Aristoteles begann, im Mittelalter seinen Höhepunkt erreichte und seine Ausläufer bis in unsere Tage hineinstreckt. Nun aber nicht mehr als nur philosophische Haltung, sondern als gelebte Entwicklungsverhinderung. Christoph Ammann, per Mail



Was heisst denn Genesung? Das Wort kommt vom griechischen Genesis und bedeutet so viel wie Entwicklung, Entstehung, wie beispielsweise die Genesis als 1. Buch Moses. Genesung ist also Entwicklung. So gesehen sprechen also beide eigentlich von einer Entwicklung des Menschen, die nach einer überwundenen Krankheit mit der Genesung verbunden ist, nur bleibt das dem Schulmediziner unbewusst, denn er glaubt nicht an die Worte, die er spricht. Denn Worte sind für ihn reine Begriffe, sind Abstraktionen, sind austauschbar, zufällig, sie haben mit dem, was sie aussagen, nicht wirklich etwas zu tun.

Was ist die Folge davon? Das Fatale dieser Geisteshaltung ist, dass, wenn Genesung nicht als Entwicklung angeschaut und ernstgenommen wird, Krankheit zu etwas nicht Notwendigem, zu einer Störung wird, die möglichst sofort zu beseitigen ist. Das Verdrängen der Krankheitssymptome durch den Einsatz von
Briefe an «natürlich»
Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik sind willkommen. Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51.


Mmmhhh ... «natürlich» 12-12 A


ls Pastaliebhaber habe ich Ihren Artikel «Pasta» mit Interesse gelesen. Sie empfehlen für 100 g Pasta 1 Liter Wasser, also für 500 g 5 Liter Wasser zu kochen. Mag sein, dass die Pasta ein wenig besser werden als mit «nur» 3 Litern, aber: Ihr Heft hat eine Au age von 52 000 Exemplaren. Wenn pro gedrucktes Heft je ein Leser seine Pasta künftig mit 2 Litern mehr Wasser kocht, und dies 2-mal pro Woche, so gäbe dies im Jahr 5 408 000 Liter kochendes Wasser! Die Energiewende steckt auch im Detail – und mit weniger geht’s auch.
Stefan Schäppi, Astano

Gesundheit
Lesen_ Wohltuende Wickel

Wickel sind ein altbewährtes Mittel, um Krankheiten auf sanfte, aber effektive Weise zu behandeln. Wickel können vorbeugend, schmerzlindernd und heilungsfördernd eingesetzt werden. Die Krankenschwester Maya Thüler hat zusammen mit Illustrator Hans-Peter Häderli ein Standard-Werk zum Thema geschaffen. Alle, die selbst etwas zur Gesunderhaltung oder Gesundwerdung beitragen möchten, finden in diesem Buch entsprechende theoretische Grundlagen und praktische Anleitungen.

Sportlerernährung_ Rosinen statt Powerriegel

















Maya Thüler, Hans-Peter Häderli: «Wohltuende Wickel», Fr. 37.90
Die Werbung will einen glauben machen, dass man selbst als Hobbysportler ohne Powerdrinks und Fitnessriegel kaum mehr über die Runden kommt. Tatsächlich unterstützen kohlenhydratreiche Extrakicks die körperliche Leistung. Forscher schickten in einem Versuch Läufer entweder nur mit Wasser, einem üblichen Energieriegel oder mit einer Handvoll Rosinen versorgt auf einen Langstreckenlauf. Alle 20 Minuten wurden Herzschlag, Atemluft, Blutzucker- und Elektrolytespiegel sowie andere Blutwerte gemessen. Das Ergebnis war eindeutig: Die Läufer, die mit Powerriegel oder Rosinen gestärkt waren, waren schneller unterwegs als ihre Kollegen, die nur Wasser bekamen.


Gehirn_ Dicke bauen schneller ab
Eine breit angelegte Studie französischer Forscher bestätigt, was schon früher vermutet wurde: Die Hirnleistung gibt bei fettleibigen Menschen schneller ab als bei normalgewichtigen. Dies zeigte sich bei kognitiven Tests mit Gedächtnisübungen, logischem Verständnis und Leseleistung bei rund 6400 erwachsenen Testpersonen. Kommen zusätzlich noch weitere Aspekte wie Bluthochdruck oder Diabetes hinzu, nimmt die Hirnleistung zusätzlich nochmals schneller ab, wie die aerztezeitung.de berichtet. tha

Interessant: Die Forscher erwarteten, dass sich der höhere Ballaststoffanteil der Rosinen negativ auf die Leistung auswirken könnte. Dies war aber nicht der Fall. tha






➜ Die App










Vegetarier und besonders Veganer müssen speziell darauf achten, dass sie mit genügend Mineralstoffen und Vitaminen versorgt sind. Eigens für diese Gruppe hat die Gesellschaft für optimierte Ernährung und der Vegetarierbund Deutschland eine App entwickelt. Der Benutzer erstellt zuerst ein persönliches Profil. Dann kann er aufgrund der tatsächlichen eingenommen und der empfohlenen Mengen feststellen, ob und wie seine Ernährung optimiert werden kann. Zudem gibt die App Hinweise zur Klimafreundlichkeit einzelner Lebensmittelgruppen. Im App-Store nur für iPhones, iPads und iPods


Die Stimme pflegen
Ob Reden, Murmeln, Schreien oder Lachen: Tagtäglich muss unsere Stimme Höchstleistungen vollbringen. Die meisten von uns schenken ihr jedoch kaum Beachtung. Doch die Stimme will gepflegt werden – insbesondere dann, wenn sie aufgrund eines Infekts angegriffen ist (siehe auch Artikel «Grippewelle: ohne mich», Seite 18). Der Berufsverband der Deutschen Hals-Nasen-Ohren-Ärzte empfiehlt Folgendes:
1. Vermeiden Sie es, zu schreien oder zu rufen. Das Gleiche gilt für längeres Sprechen in kalter oder lauter Umgebung sowie bei körperlicher Anstrengung (z. B. beim Joggen).
2. Flüstern oder Räuspern belastet die Stimmbänder ebenfalls. Tipp bei Räusperzwang: Einen Schluck Wasser trinken oder schlucken.
3. Schränken Sie den Alkohol- und Koffein-Konsum ein. Auch Rauchen oder das Einatmen von Rauch (Passivrauchen) reizt die Stimmbänder.
4. Kaffee, schwarzer und grüner Tee nur in Massen geniessen, da diese Getränke die Schleimhäute austrocknen.
5. Um die Stimmbänder feucht zu halten, am besten viel Wasser trinken. Wichtig: Es sollte nicht zu heiss oder zu kalt sein.
6. In Stress-Situationen bewusst langsam sprechen, dabei ruhig ein- und ausatmen. Nach dem Ausatmen eine kurze Pause machen.
7. Bei Entzündungen im Bereich von Hals, Nase und Ohren sowie bei Stimm-Beschwerden ist Sprechen vorübergehend tabu. MM

Wenn nur noch das
Wann ist ein Mensch tot? Von welchem Zeitpunkt an darf ein Sterbender für eine mögliche Organspende «präpariert» werden? Die Möglichkeiten der HightechMedizin zwingen uns, Ethik und Moral des Todes neu zu überdenken.
Text Eva Rosenfelder

Herz schlägt
Gesetzliche Bestimmungen

Erweiterte Zustimmungslösung
Diese in der Schweiz gängige Praxis zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen sieht in einer fehlenden Spende-Erklärung der verstorbenen Person lediglich eine Nichterklärung. In diesem Fall werden deshalb die nächsten Angehörigen für eine Organentnahme angefragt. Stimmen diese zu, ist die Explantation zulässig. Der Wille des Verstorbenen hat aber in jedem Fall Vorrang gegenüber dem der Angehörigen.
Widerspruchslösung
Die in vielen Nachbarländern gängige Praxis (gilt auch für Touristen) wertet ein Schweigen als Einverständnis und erfordert für die Nichtentnahme den expliziten Widerspruch. Auch hier gibt es eine erweiterte Lösung, bei der Angehörige den Willen des Verstorbenen vertreten können. Widersprechen diese nicht innert einer bestimmten Frist, dürfen Organe, Gewebe und Zellen entnommen werden.
Aktuell gibt es vier parlamentarische Vorstösse sowie Bestrebungen, (zum Beispiel von Swisstransplant) in der Schweiz die Widerspruchslösung einzuführen.

Für die Organentnahme sind Schmerz- und Beruhigungsmittel obligatorisch.
Gisela Meyer verbrachte 1991 die Skiferien mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in St. Luc, im Wallis. Bei einer Abfahrt stürzte der 15-jährige Sohn Lorenz schwer, notfallmässig wurde er nach Sion geflogen. Als die Eltern im Spital ankamen, wurde er beatmet, doch schien er ihnen zur grossen Erleichterung unversehrt. «Man klärte uns auf, er habe eine schwere Hirnverletzung, es liege alles daran, ob die Schwellung zurückgehe oder nicht», erinnert sich Gisela Meyer. «18 Stunden nach der Einlieferung teilten die Ärzte uns mit, Lorenz sei tot. Das Wort hirntot fiel nicht. Nach Schweizer Richtlinien würden am nächsten Morgen die Apparate abgestellt. Es folgte die Frage nach einer Organspende und die Aufzählung der infrage kommenden Organe.»
Wie in Trance standen sie vor ihrem Sohn. Eine Krankenpflegerin wechselte den Urinbeutel, eine Infusion lief, man sorgte für seine Mundhygiene, sein Bein zuckte, als der Vater darüber strich. «Es war eine Folter. Unser Kind sollte sterben? Sollte tot sein? Verweigerten wir die Organspende, trugen wir auch noch die Schuld am Tod anderer Menschen – so schien man uns subtil mitzuteilen.» Unter moralischem Druck und völlig am Ende gaben die Eltern die Nieren ihres Sohnes frei. Noch nie hatten sie sich bisher konkret Gedanken gemacht zur Organspende. Die Wehrlosigkeit des Patienten und seiner sich im Schock befindenden Angehörigen wird ihrer Meinung nach schamlos missbraucht: «Die Frage nach Organen darf in einem solchen Moment nicht gestellt werden. Sie ist eine unmenschliche Zumutung. Wir waren nicht in der Lage, Partei für unser hilfloses Kind zu ergreifen, es in seinem Sterben zu beschützen.»
Vom Patienten zum Restkörper
Trotz des Versprechens, ihren Sohn nach der Organentnahme zum Abschied in der Station aufzubahren, sahen sie ihn erst im Leichenkeller wieder. «Mein erster Impuls war: Das ist nicht mein Kind, das ist ein Irrtum!», sagt Gisela Meyer. Dann: «Er hat Schmerzen gehabt! Die Haare sind nass gewesen, seine vollen Lippen waren zusammengepresst, das Gesicht klein geworden. Die Augen waren grossflächig verklebt, obwohl wir sie ausdrücklich und mehrfach verneint, nicht freigegeben hatten.» Ohne Abschied, voller Entsetzen seien sie vor ihrem eigenen Kind geflohen. Wenn Hirnrinde und Hirnstamm tot sind, ist der Körper noch nicht am Ende. Das liegt daran, dass viele nervliche Funktionen nicht übers Gehirn, sondern beispielsweise übers Rückenmark laufen. Es zeigt, dass das Gehirn eben nur ein Teil des Körpers ist, dass es längst nicht die herausragende Funktion für die Organisation des ganzen Organismus besitzt, von der man gemeinhin ausgeht.
Bei Hirntoten gibt es klar feststellbare Schmerzreaktionen wie Schwitzen, Zucken, Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz und Rötung des Gesichts. Sie können zum Beispiel ausgelöst werden, wenn der Bauchraum zur Entnahme der Organe geöffnet wird. Darum sind bei Organentnahmen in der Schweiz heute Schmerz- und Beruhigungsmittel obligatorisch – meist werden die Spender auch narkotisiert, um Verunsicherung und psychische Belastung des Pflegepersonals zu verhindern, so sagt man.
Gisela Meyer lebt mit der Gewissheit, dass ihrem Kind in seinem Sterben Schreckliches widerfahren ist. Lange konnte sie nicht darüber sprechen, Suizid-
«Ich habe dem Druck der Ärzte nicht widerstanden.»

gedanken hatte sie über Jahre. Das Ehepaar rief mit anderen Betroffenen die Initiative «Kritische Aufklärung über Organtransplantation KAO» ins Leben und stürzte sich in diese Aktivitäten. Ehemann Jürgen sagte an einem seiner Vorträge: «Ich habe versagt, ich habe dem Druck der Ärzte nicht widerstanden, um meinem Kind beizustehen. Ich schäme mich.»
Anpassungen im Transplantationsgesetz
Ist ein Sterben in Würde möglich, angesichts der drängenden Tatsache, dass nur
einem durchbluteten Körper mit schlagendem Herzen auch lebende Organe entnommen werden können? Der moralische Status des Hirntodes sei sehr umstritten, sagt Ruth Baumann-Hölzle, Institutsleiterin von «Dialog Ethik Zürich». «Warum sollten Hirntod und Tod eins sein? Der Hirntod ist ein irreversibler Zustand, auf den der Tod unweigerlich folgen wird. Sind deshalb Hirntote Sterbende oder bereits Tote? Sterben ist letztlich ein Geheimnis, das von der Wissenschaft nicht ergründet werden kann. Ob man Hirntote als tot oder sterbend beurteilt, ist daher ein
Um den Verwesungsprozess zu stoppen, werden über Schläuche im Bauch Konservierungsmittel zugeführt.
moralischer Entscheid», erklärt die Theologin.
Galt bisher der Hirntod (siehe Box) als Todeskriterium, wird der potenzielle Spenderkreis durch neue «Präzisierungen» im Schweizer Transplantationsgesetz inzwischen auf eine vom Hirntod unabhängige Patientengruppe erweitert: Auf Patienten mit schweren Hirnschädigungen oder Koma, die aber noch nicht hirntot sind. Bei ihnen wird aufgrund ihrer «aussichtslosen» Prognose durch Therapieabbruch –durch das Ausschalten der Herz-LungenMaschine – ein «kontrollierter» und somit «planbarer» Herzstillstand ausgelöst. Die fehlende Blutzufuhr führt nach einigen Minuten zum Hirntod. So werden sie zu Non-heart-beating-donors, zu «Spendern mit nicht schlagendem Herzen».
Wenn der Tod einen Zweck bekommt
Nach zehn Minuten Wartezeit – so viel ist in der Schweiz vorgeschrieben – wird der Körper erneut an die Herz-LungenMaschine angeschlossen, damit die Organe durchblutet und gekühlt werden können. Organerhaltende Massnahmen sind bei dieser Patientengruppe deshalb schon vor dem Tod erlaubt, denn je länger man wartet, desto schlechter sind die Organe für eine allfällige Spende. Zu diesen Massnahmen gehören beispielsweise Medikamente, um die Gefässe zu erweitern und die Blutgerinnung zu verhindern, aber auch Operationen, bei denen in der Leistengegend dicke Schläuche angebracht werden, in die Nähr- und Konservierungslösungen zugeführt werden, die den Verwesungsprozess der Organe stoppen.
Laut Patientenschützerin Margrith Kessler handelt es sich dabei um «Körperver-


Was heisst hirntot?
Gemäss Schweizerischem Transplantationsgesetz (2007) gilt der Mensch als tot, wenn die Funktionen seines Gehirns einschliesslich des Stammhirns irreversibel ausgefallen sind.
In den USA läuft seit Längerem eine Kontroverse über das Hirntod-Konzept. Mit neuen technischen Verfahren liessen sich bei sogenannt Hirntoten Aktivitäten im Gehirn nachweisen. Die «Presidents Commission on Bioethics» war 2008 zum Schluss gekommen, die biologischen Gründe für die Definition des Hirntods hätten sich als irrtümlich erwiesen, da man dabei davon ausging, dass der Körper nach Ausfall der Hirnfunktion sofort aufhöre, als Ganzes zu funktionieren, was heute widerlegt wird.

letzung zugunsten Dritter». Aus ihrer Sicht können über ein solches Vorgehen nur Betroffene zu Lebzeiten entscheiden. Hier bekomme der Tod plötzlich einen Zweck: nämlich Organe entnehmen zu können. Ethisch äusserst heikel daran findet Ruth Baumann-Hölzle die organerhaltenden Massnahmen beim noch nicht hirntoten, lebenden Menschen mit aussichtsloser Prognose zugunsten eines Dritten – und dass dies unter Umständen ohne das Wissen geschieht, ob der Betroffene überhaupt seine Organe spenden möchte. Der Sterbeprozess dürfe nicht dem Spendeprozess unterstellt werden.
Den Zahlen der Stiftung Swisstransplant gemäss spenden die Schweizer viel zu wenig Organe. Die Diskrepanz zwischen benötigten Organen und erfolgten Transplantationen sei frappant. Auf der Warteliste für Organspenden stehen mit 1102 Personen so viele wie nie zuvor. Hinter diesen Zahlen versteckt sich viel Leid: Allfällige Spender stehen an der Schwelle zum Tod, für sie hoffen bis zuletzt ihre







Angehörigen. Auf der anderen Seite warten Schwerstkranke, bei denen alle anderen medizinischen Massnahmen versagt haben, und die nur mithilfe eines gespendeten Organs werden überleben können.
Auf dieser Schwelle kreuzen sich zwei Biografien, prallen Verzweiflung, Trauer, Hoffnung und Freude frontal aufeinander. Ebenso zwei sich widersprechende ethische Pflichten: Die Lebensrettung durch Organspende einerseits, die Frage des guten Sterbens andererseits. Und damit verbunden eine Tabuüberschreitung, bei der die «Körper-Geist-Seele-Einheit» auf der Strecke bleibt und das Sterben zu einem rein medizinisch und juristisch fassbaren Vorgang wird.
Leben mit neuem Herz
Auf der anderen Seite der Schwelle leben Menschen wie Nicola Heyser. Die Mutter einer achtjährigen Tochter litt jahrelang an schwerer Herzinsuffizienz unbekannter Ursache, auch eine Operation konnte nicht helfen. Ihren Beruf als Reitlehrerin und Dressurreiterin konnte die gesundheitsbewusste 41-jährige Frau nicht mehr ausüben. Am Nullpunkt angekommen, liess sie sich auf die Warteliste von Swisstransplant setzen.
Fünf Monate später wurde sie vom Inselspital Bern benachrichtigt, ein Herz sei bereit für sie. Man habe sie wunderbar vorbereitet, verständnisvoll begleitet und
Eine Spende ist ein Geschenk.
im Nachhinein hochprofessionell und menschlich betreut, erzählt Nicola Heyser. Zwei Jahre ist es nun her, seit sie mit diesem Herz lebt. «Die vielen Medikamente und Immunsuppressiva, welche die körpereigene Abstossung eines fremden Organs verhindern sollten, fordern eine enorme Umstellung des Körpers und haben viele Nebenwirkungen. Es hat gedauert, bis mein Körper mit allem fertig wurde. Doch heute geht es mir wirklich gut.»
Dass sie leben darf, ihr Kind grossziehen kann und heute sogar wieder arbeitet, ist für Nicola Heyser wie eine zweite Geburt. «Ich bin voller Zuversicht, dass dieses Herz ‹halten› wird. Und es ist mir bewusst, dass ich wahnsinniges Glück hatte, dieses Geschenk zu bekommen.» Ihre eigenen Organe möchte sie nach ihrem Tod spenden – auch die ihres Kindes würde sie freigeben.
In unserer Gesellschaft ist der Tod nach wie vor ein Tabuthema. Detailfragen zur Organspende werden meist Medizinern und Juristen überlassen – es sei denn, man ist persönlich betroffen. Wer Organe spenden möchte, sollte sich unbedingt informieren, wie eine Organentnahme genau vor sich geht und was es im Detail bedeu-
tet. Mit dem Ziel, die Zahl der Organspenden zu erhöhen, erfolgt der medizinische Zugriff auf die Spender immer früher, eben auch auf Menschen mit «aussichtsloser» Prognose. Neben dem altruistischen Argument, Leben zu retten, existiert auch die Tatsache, dass Pharmaindustrie und Spitzenmedizin an Transplantationen und Medikamenten sehr gut verdienen. Eine Spende aber ist ein Geschenk. Für Ruth Baumann-Hölzle ist die Voraussetzung für eine Organspende die absolute Freiwilligkeit. «Dieses ‹Opfer› kann unmöglich von der Gesellschaft ‹gefordert› werden, etwa durch eine Widerspruchslösung (siehe Seite 14).» Wer sich mit der Frage der Organspende kritisch auseinandersetzen will, soll Fragen stellen und Zweifel haben dürfen, ohne gleich eines Tabubruches oder des religiösen Fanatismus beschuldigt zu werden. u
Surftipps _ www.natuerlich-online.ch/surftipps

Au sgebrannt?





















































VIGOR – bevor Sie sich ausgebrannt fühlen.


VIGOR:


Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.








Appenzeller Heilmittel wirken mit besonderer Kraft.
• bei nachlassender Konzentrationsfähigkeit
• baut Stresssymptome ab



• bei Müdigkeits- und Schwächegefühl


• ist rein pflanzlich
Grippewelle:
Der Januar ist bekannt für seine hohe Virendichte, die viele Menschen mit einer Grippe oder einem grippalen Infekt ins Bett zwingt. Wer in diesen Zeiten gesund bleiben möchte, nimmt am besten das Bienenkittharz Propolis ein. Es wirkt nicht nur vorbeugend, sondern auch heilend.
Text Sabine Hurni

Was Bienen für uns herstellen
Neben Propolis (Bild) sind auch Honig und Gelee Royal zwei hochwertige Bienenerzeugnisse, die uns als Stärkungsmittel dienen. Das Gelee Royal wird von den Bienen für die Aufzucht der Bienenkönigin verwendet. Die Ammenbienen produzieren den nährstoffreichen Saft aus Blütenpollen. Frischer Gelee Royal enthält wertvolle Inhaltstoffe wie Aminosäuren, Hormone, Enzyme, Vitamine und Spurenelemente, die wie ein Jungbrunnen wirken sollen. Für die Gewinnung von Gelee Royal saugen die Imker diese Substanz aus den Waben der Königin Honig hingegen dient den Bienen als Nahrung für das Bienenvolk Gewonnen wird er aus dem Pflanzennektar (Siebröhrensaft), den die Bienen in den Blüten sammeln. Doch nicht nur Blüten scheiden Siebröhrensaft aus. Auch aus Nadelbäumen können die Bienen Pflanzensaft für die Honigproduktion gewinnen.
Im Januar ist Grippezeit: Ringsum wird gejammert und gekränkelt. Doch manch einer, der meint die Grippe hätte ihn erwischt, leidet in Wirklichkeit lediglich an einem grippalen Infekt oder einer heftigen Erkältung mit Fieber. Der Unterschied zwischen einer echten Grippe und anderen grippalen Erkrankungen ist wesentlich: So beginnt eine gewöhnliche grippale Erkältung langsam mit einem wässerigen Schnupfen, der nach und nach schlimmer wird. Man fühlt sich müde und abgeschlagen, hat leichtes Fieber, vielleicht einen schleimigen Husten, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen. Nach einer Woche klingen die Symptome langsam ab. Für eine solche Erkältung können bis zu 200 verschiedene Viren verantwortlich sein. Meistens sind es die Adeno- oder Rhinoviren, mit denen sich Kleinkinder im Durchschnitt vier bis acht Mal jährlich anstecken. Bei Erwachsenen sind es laut Statistik lediglich zwei bis vier Infektionen im Jahr.
Echte Grippe ist selten
Anders die echte Grippe, die im Vergleich zu grippalen Infekten wesentlich seltener vorkommt. Ganz typisch für die Grippe ist ihr plötzlicher Beginn. Wie aus dem Nichts macht der Körper hohes Fieber, das begleitet ist von Schüttelfrost und Kältegefühl. Die Erkrankten sind gezwungen, die Arbeit niederzulegen und gehen zu Hause sofort ins Bett. In der Regel wird das hohe Fieber einer echten Grippe von massiven Kopf- und Gliederschmerzen sowie von Atemwegsinfekten begleitet. Ursache für die echte Grippe sind die Influenzaviren A und B. Auch sie werden, wie alle anderen Virenarten, sehr schnell mittels Tröpfchen-
infektion von Mensch zu Mensch übertragen. Die Erreger befinden sich in der Atemluft und sind in feinsten ausgeniesten und ausgehusteten Tröpfchen enthalten.
Starkes Immunsystem
Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch sowohl einer Grippe als auch einer grippalen Erkältung beträgt zwei bis fünf Tage. Die Viren gelangen über die Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum in den Körper, von wo sie sich, je nachdem wie gut oder schlecht das Immunsystem des Betroffenen arbeitet, in den Bronchien oder in den Nasennebenhöhlen ausbreiten. An der Tatsache, dass die Viren zum Winter gehören wie die Kälte und der Schnee, können wir nichts ändern. Jeder Gesunde kann jedoch aktiv dazu beitragen, sein Immunsystem zu stärken. Dazu gehören eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung, der gesunde Umgang mit Stress, der präventive Gebrauch von befeuchtenden Nasentropfen, viel Bewegung im Freien und angemessene Kleidung für die nasskalte Witterung. Auch Heilpflanzen wie Sonnenhut (Echinacea) oder die Kapuzinerkresse (Tropaeolum) vermögen bei ersten Krankheitsanzeichen das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte auf Vordermann zu bringen. Dasselbe gilt für das Bienenkittharz oder Kittwachs Propolis. Propolis ist eine von Bienen hergestellte harzartige Masse mit antibiotischer, antiviraler und antimy kotischer Wirkung. Die Bienen brauchen das Harz hauptsächlich für ihren eigenen Schutz; in einem Bienenstock lebt bei etwa 35 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit ein ganzes Bienenvolk. Und wo es heiss und feucht ist, breiten sich
ohne mich!

Bewegung und frische Luft stärken das Immunsystem.

Auch das hilft bei der Grippe und grippalen Erkrankungen:
Bettruhe: Schlafen ist heilsam, weil das Immunsystem in dieser Zeit sehr aktiv arbeiten kann. Wer ein fiebersenkendes Medikament oder ein Aufputschmittel einnimmt, um die Grippesymptome zu unterdrücken, suggeriert dem Körper, dass alles in Ordnung ist. Mit der vermeintlichen Gesundheit findet der Körper jedoch nicht die Ruhe, die er eigentlich brauchen würde. Deshalb gilt Bettruhe noch immer als effizientestes und wirksamstes Heilmittel bei fiebrigen Erkrankungen.
Leichte Kost: Der Appetit ist bei den meisten Erkrankten eher schwach. Das ist gut so. Denn der Körper hat viel zu tun, um die Körpertemperatur auszugleichen und das Immunsystem zu stärken. Für die Verdauungsorgane bleibt nicht viel Energie übrig. Kommt trotzdem etwas Hunger auf, eignen sich Suppen, geriebene Äpfel, leichte Eintöpfe, Gemüsebrühe und warme Getreidebreie.


Viel Trinken: Schweiss wirkt kühlend. Deshalb ist es gut, wenn ein fiebriger Körper richtig ins Schwitzen kommt. Zum Beispiel mit Lindenblütentee. Generell ist es wichtig, dass dem Körper sehr viel Flüssigkeit zugefügt wird, um den Verlust beim Schwitzen wieder auszugleichen. Geeignet sind Wasser, ungesüsster Tee und Bouillon. Wärme und Kälte: In der Phase der Schüttelfröste braucht der Körper viel Wärme. Bettflasche, warme Getränke, Bettwärme und ein warmes Bad sind wohltuend. Zum Fiebersenken wiederum ist Kälte angezeigt.
Kühle Waschungen, Wadenwickel und kühle Getränke. Auch ein Einlauf kann fiebersenkend wirken.

Keine Antibiotika: Eine grippale Erkrankung oder eine Grippe wird durch Viren verursacht. Antibiotika zeigen hier keine Wirkung. Erst wenn ein Schnupfen oder ein Husten «produktiv» wird, das heisst mit zähem, gelblichem Exkret, ist dies ein Zeichen, dass Bakterien im Spiel sind. Verschreibt ein Arzt jedoch bei einer normalen, fiebrigen Grippe ein Antibiotikum, sollten Sie nicht zögern und kritisch nachfragen.
Zum Arzt gehen: Bei Fieber über 40 Grad Celsius muss ein Arzt konsultiert werden. Ebenso, wenn das Fieber länger als drei Tage hoch bleibt und sich der Krankheitsverlauf nicht verbessert.


auch Bakterien und Keime munter aus. Deshalb dient Propolis den Bienen zum Abdichten von Öffnungen, Spalten, Ritzen sowie zum Auskleiden der Wabenzellen, damit eingeschleppte Keime keine Chance haben, sich auszubreiten.
Für die Herstellung von Propolis benötigen Bienen harzige Substanzen, die an Knospen oder Baumwunden vorkommen.
Vermischt mit Pollenanteilen, ätherischen Ölen aus Blütenknospen, Wachs und Speichelsekreten entsteht die klebrige Bau-
Wadenwickel helfen bei Fieber.


verarbeitet. Vermischt mit Alkohol dient das rohe Propolisharz auch zur Herstellung von Propolistinkturen, Salben und Cremen.
Propolistinktur selber herstellen
Dort, wo das menschliche Immunsystem an seine Grenzen kommt, kann Propolis helfen. Sei es bei einer allgemeinen Abwehrschwäche, einer Erkältung, einer Grippe, Aphten, Fieberblasen, rheumatischen Erkrankungen, Zahnfleischproblemen und vielen anderen entzündlichen Erkrankungen. Für diese Zwecke nimmt man entweder die Tinktur in etwas Wasser mehrmals täglich ein oder man verzehrt täglich einen Löffel voll Propolisgranulat pur oder vermischt im Müesli. Bei Akne, schlecht heilenden Wunden oder Herpes kann eine Propolistinktur oder -salbe helfen.
substanz. Dieses Propolis ist reich an Flavonoiden, Gummi und ätherischen Ölen. Zudem enthält es viele Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.
Damit auch der Mensch diese heilsame Substanz der Bienen für sich nutzen kann, kratzt der Imker das Kitzharz aus den Ritzen. Einfacher und gezielter geht es, wenn ein feinmaschiges Gitter in den Bienenkasten hineingelegt wird. Die Bienen verkitten diesen Fremdkörper mit seinen störenden Zwischenräumen. Danach kommt das Kunststoffgitter in den Gefrierschrank, damit das Harz in gefrorenem Zustand durch leichtes Biegen des Gitters abbricht. Der so gewonnene Rohstoff wird zu einem Granulat oder einem Pulver weiter-
Zur Herstellung der Tinktur brauchen Sie auf 50 Gramm Probolisharz etwa 100 Milliliter 70- bis 96-prozentigen Trinkfeinsprit aus der Drogerie oder der Apotheke. Ein hochprozentiger Weingeist tut seinen Zweck aber auch. Das Harz frieren Sie zuerst ein und verreiben es dann im gefrorenen Zustand im Mörser zu einem Pulver. Dieses geben Sie in ein Glas mit Schraubverschluss. Übergiessen Sie das Pulver mit dem Alkohol, damit es ganz bedeckt ist. Schrauben Sie das Glas zu und lassen Sie es an einem hellen, zimmerwarmen Ort zwei bis sechs Wochen stehen. Nach dieser Zeit können Sie die Tinktur durch einen Kaffeefilter aus Papier giessen. Das braucht etwas Geduld und kann je nach Feinheit des Pulvers mehrere Stunden dauern. Jetzt füllen Sie die fertige Propolistinktur in eine braune Glasflasche, lagern sie an einem kühlen Ort und nehmen bei ersten Krankheitszeichen sofort davon ein. ◆




«Bilden Sie sich weiter am IKP: Für Ihre ganzheitliche Lebenskompetenz, berufliche Entwicklung und Qualifikation.» Dr med. Y. Maurer
Berufsbegleitende, anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP
Der IKP-Ansatz beinhaltet neben dem therapeutisch-beraterischen Gespräch auch das Erleben und Erfahren über den Körper sowie den Einbezug kreativer Medien. (2 Jahre, ASCA und SGfB anerkannt)
Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP
Humanistische Psychologie, Psychosoziale Beratung und Ernährungsfachwissen. (2 bzw 4 Jahre, ASCA anerkannt)
Ganzheitliche/r
Atemtherapeut/in IKP
Ausbildungsinstitut IKP in Zürich und Bern
Atemmassage Atemtherapie mit Option zum/ zur eidg dipl. Komplementärtherapeut/in. (2 Jahre, EMR und ASCA anerkannt) Seit 30 Jahren anerkannt



zur Ausbildung sowie die Daten der Infoabende finden Sie unter : SHI Homöopathie Schule
Steinhauserstrasse 51 • 6300 Zug



Shiatsu Infoabende
Jetzt kostenlos mehr erfahren über die anerkannten Ausbildungslehrgänge. 5.3., 17.4., 18.6. Zürich •1.2.2013 Winterthur www.ko-shiatsu.ch/infoabende
Shiatsu Einführungskurse
An einem Tag wirkungsvolle ShiatsuMassagen geben und Anti-Stress-Techniken lernen, am 16.2. und 14.9.2013 in Zürich, nur CHF 100.– /Tag. www.ko-shiatsu.ch/shiatsutag
Ko Schule für Shiatsu Zürich Die Schule macht den Unterschied Telefon +41 44 942 18 11
Komplementärtherapeut
Ein Beruf mit Zukunft. Eine Ausbildung mit Branchendiplom Akupunktmassage. Telefon 044 680 32 30 oder www.wba.ch oder E-Mail: info@wba.ch

«Chrüter»- und Botanik-Reisen 2013
Der fröhliche Dialog mit der Natur unter der Leitung von Heilpflanzenkundigen sowie Botanikern
Gerne senden wir Ihnen den neuen Katalog:

Postfach, 6301 Zug, Tel. 041 729 14 20 www.arcatour.ch

Mit Mut und Ihrer Unterstützung.
Danke, dass Sie per SMS 20 Franken spenden: Mut 20 an 488.



Beratung

Haben Sie Fragen?
Sabine Hurni, Drogistin HF und Naturheilpraktikerin mit Fachrichtung Ayurveda und Phytotherapie, und das kompetente «natürlich»-Berater-Team beantworten Ihre Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Ökologie, Garten oder Natur.
Senden Sie Ihre Fragen an: sabine.hurni@azmedien.ch oder «natürlich», Leserberatung Neumattstrasse 1, 5001 Aarau
Rat & Tat per Internet Fragen können Sie auch auf unserer Website www.natuerlich-online.ch stellen. Das «natürlich»-Berater-Team ist unter der Rubrik «Beratung» online für Sie da.
Folsäure vor der Schwangerschaft?
Meine Frauenärztin hat mir geraten, ein Jahr vor einer möglichen Schwangerschaft regelmässig ein Folsäurepräparat einzunehmen. Ich esse gesund und bin Vegetarierin. Ist dies aus Ihrer Sicht zu empfehlen, und falls ja, welche Dosierung?
D. W., Zürich
Wenn Sie bis anhin die Pille eingenommen haben, wäre die Einnahme von Folsäure sicher nicht schlecht. Die Pille behindert die Folsäureaufnahme. Grundsätzlich können Sie aber auch ein Aufbaumittel auf Hefebasis einnehmen. Hefepräparate enthalten neben vielen Nährstoffen auch reichlich Folsäure. Die Folsäure ist für die Zellteilung wichtig. Fehlt der Nährstoff, besteht die Gefahr, dass sich die Wirbelsäule des Kindes nicht richtig ausbildet. Ich bin auch nicht dafür, wegen allem und jedem immer gleich ein Heilmittel einzunehmen. In Ihrem Fall wäre es aber sicher ratsam, die Empfehlung der Frauenärztin zu befolgen. Wenn Sie über viele Jahre hinweg die Pille eingenommen haben, wäre ein Folsäurepräparat aus der Drogerie oder Apotheke die beste Lösung. Haben Sie bis anhin natürlich verhütet, so sollte auch eine Nahrungsergänzung auf Hefebasis ausreichen, die mitunter auch dabei hilft, die in den Lebensmitteln vorkommende Folsäure besser zu verwerten. Ein solches Präparat eignet sich auch als Schwangerschaftsbegleitung. Wie Sie bestimmt wissen, erhöht sich der Nährstoffbedarf drastisch, sobald Sie nicht nur sich selber, sondern zusätzlich ein heranwachsendes Kind zu versorgen haben.
Wenn Sie schwanger werden möchten, sollten Sie auch vermehrt gesunde Fette zu sich nehmen, die einen grossen Anteil an Omega-3-Fettsäuren enthalten. Sie sind in Walnüssen, im Leinöl oder im Fischöl reichlich enthalten. Die Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Zellteilung und den Aufbau von Zellmembranen.
Sabine Hurni

Nitrate im Trinkwasser
Bis jetzt habe ich nur Hahnenwasser getrunken. Nun habe ich gelesen, dass unser Wasser einen Nitratgehalt von 24 bis 29 mg/l hat. 40 mg/l ist die obere Grenze. Da ich viel trinke, überlege ich mir, nun doch Mineralwasser zu kaufen. Was meinen Sie?
D. P., Olten
Esgibt wohl kein anderes Lebensmittel, das so gut kontrolliert wird, wie unser Trinkwasser. Insofern können Sie davon ausgehen, dass die Wasserwerke Olten eine Lösung finden müssen, wenn die Werte noch höher werden. So wie die Werte im Moment sind, brauchen Sie sich hingegen keine Sorgen zu machen. Erst recht nicht, wenn Sie ein gesundes Leben führen und generell reichlich Nährstoffe zu sich nehmen.
Die Nitrate gelangen vor allem aus der Landwirtschaft in die Gewässer und können in hohen Dosen das Risiko einer Krebserkrankung erhöhen. Wenn Sie deswegen auf das Hahnenwasser verzichten möchten, ist das Ihre Entscheidung. Kaufen Sie aber konsequenterweise regionales Wasser in Glasflaschen, denn die Plas-
tikpartikel, die aus den PET-Flaschen ins Wasser übergehen, können das Risiko einer Krebserkrankung ebenfalls erhöhen. Wichtig ist, dass Sie beim Trinken ein gutes Gefühl haben.
Wenn es um Nitratbelastungen geht, so muss gesagt werden, dass der Nitratgehalt in konventionell angebauten Salaten wesentlich höher ist, als im Trinkwasser. Indem Sie konsequent biologische, saisonale Produkte auf dem Wochenmarkt kaufen, unterstützen Sie diejenigen Bauern, die aus Überzeugung einen anderen Weg gehen, essen gleichzeitig das gesündere Lebensmittel und belasten Ihren Körper nicht mit Pestiziden. Zwar sind auch die biologischen Salate nicht ganz frei von Nitraten, aber sie enthalten nur einen Bruchteil des Gehaltes von konventionell angebauten Salaten. Das ist für mich richtig verstandene Gesundheitsprävention.
Sabine Hurni
Induktionsherd und Gesundheit
Sollen wir einen Induktionsherd kaufen oder nicht? Was sind die gesundheitlichen Risiken? Welchen Einfluss hat der Induktionsherd auf die Qualität der gekochten Lebensmittel?
D. G., Lommiswil
Aufdie Qualität des Essens hat der Induktionsherd keinen nachweislichen Einfluss. Da aber für die Erwärmung der Platten und Pfannen ein Magnetfeld aufgebaut wird, ist die elektromagnetische Belastung neben dem Kochherd sehr hoch. Sie nimmt aber bereits in der Entfernung von einem Meter markant ab. Weil die Erwärmung magnetisch funktioniert, braucht die Pfanne einen entsprechenden Boden. Im schlimmsten Fall müssen Sie das ganze Pfannenmaterial auswechseln. Ein gesunder Mensch kommt mit der elektromagnetischen Belastung klar. Die Person, die bei Ihnen im Haushalt hauptsächlich kocht, steht vermutlich zusammengezählt durchschnittlich höchstens eine bis zwei Stunden pro Tag am eingeschalteten Herd. Der Körper hat also viel Zeit, sich wieder von der Belastung zu erholen, denn wie mit allem ist es eine Frage der Einwirkungsdauer, bis sich etwas nachhaltig schädlich auswirkt. Bei Schwangeren und Menschen mit Herzschrittmachern kann die Strahlung allerdings sehr schnell zu ungesunden Reaktionen führen.
Am besten halten Sie es so, dass wer am häufigsten am Herd steht, entscheiden darf, welche Art von Herd in der Küche stehen soll. Es ist nicht ideal, wenn beim Kochen ständig ein ungutes Gefühl mitschwingt.
Sabine Hurni


Die Frage an Sie: Schon wieder erkältet?

















Eine Antwor t der Natur:

Echinacea purpurea (Roter Sonnenhut).
Echinaforce® Protect
• Aus frischem Rotem Sonnenhut
• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Zweimal täglich eine Tablet te
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Biofo rce AG, Roggwil TG . Weitere Informationen auf www.echinaforce.ch


































































Ei nf üh run gs kur se in di e Med it at io nstec hn ik na ch de r Trad it io n vo n Ba baj i, Pa ra mah an sa Yoga na nda (Autor vo n «Autobi og ra fi e ei ne s Yogi») bi s Pa ra mapad ma Dh iran an da ji



















Zü ri ch: 26 / 27 Ja nuar 2013 rhei nfe ld en: 9. / 10 mä rZ 2013 in te rl ake n: 6. / 7. ap ri l 2013





















































































Institut für Klang-Massage-Therapie
Institut für Klang-Massage-Therapie
Elisabeth Dierlich Peter Hess Akademie Schweiz
Elisabeth Dierlich

ku rs le it un g: Ba rb ar a Gl au se r- Rh ei ng ol d, au to ri sie rt e Kr iy a Yo ga Le hr er in in fo rm atio n: Sa bi ne Sch ne id er T: 044 35 0 21 89 , E- Ma il: sa bi ne .s ch ne id er@kr iy a. ch www.k ri ya .c h


ganzheitliche
Winterwander n
Geniessen Sie eine aktive Woche verbunden mit tollen Wanderungen in der winterlichen Umgebung des Vierwaldstättersees. Nebst viel Bewegung und Entspannung gönnen Sie Ihrem Körper,Geist und Seele eine Trink-Fasten-Kur,eine Auszeit die es in sich hat!
Kur-&Ferienhaus St. Otmar ·Maya &Beat Bachmann-Krapf ·CH-6353 Weggis +41 (0)41 392 00 10 ·www.otmarsan.ch
Zertifizierte Ausbildung in Peter Hess-Klangmassage Zertifizierte Weiterbildung in Elisabeth Dierlich-Klangtherapie Vertrieb von Therapieklangschalen und Gongs
Ausbildung in Klangtherapie Vertrieb von China-Gongs
www.klang-massage-therapie.ch 0041(0)62 892 05 58 4600 OltenAmthausquai 31
www.klang-massage-therapie.ch kontakt@klang-massage-therapie.ch 4600 Olten • Amthausquai 31 • 0041(0)62 892 05 58
Lasertherapie für Blut und Gehirn
Erfolgreiche Methode u.a. bei
• Diabetes
• Tinnitus
• Burn-out
• Allergien
• Bluthochdruck
• Arthritis und Rheuma.
TimeWaver GesundheitsZentrum AG CH-9248 Bichwil • Tel. +41 (0)848 64 64 64 www.timewaver-gesundheitszentrum.ch


SPENDEN


Die Nase voll
Seit längerer Zeit leide ich an Nebenhöhlenentzündungen, zeitweise mit Husten und Stimmproblemen. Mit Antibiotika gingen die Entzündungen zwar weg, kamen aber immer wieder. Da ich in einem pädagogischen Beruf arbeite und viel sprechen muss, ist der Alltag mit der ständigen Entzündung sehr beschwerlich. Ist das eine Allergie? D. L., Münsingen
Allergien zeigen sich in der Regel mit Juckreiz und Fliessschnupfen. Es kann aber durchaus sein, dass Ihre Atmungsorgane auf einen äusseren Reiz reagieren. Das Spektrum ist breit und kann von einer stressigen Situation, schlechter Raumluft, Elektrosmog oder einem Ungleichgewicht im Darm herkommen. Das müssten Sie allenfalls austesten lassen durch einen Bluttest oder mittels Testmethoden wie Kinesiologie, Bioresonanz oder Dunkelfeldmikroskopie.
Im Grundsatz geht es jedoch darum, dass Sie Ihr Immunsystem stärken. Denn wenn dieses geschwächt ist, reagiert der Körper viel eher auf äussere Reize oder innere Konflikte. Gehen sie täglich im Wald spazieren, sorgen Sie für einen erholsamen Schlaf und verzichten Sie auf Zucker,
Süssstoffe und raffinierte, weisse Kohlenhydrate. Wenn Sie Käse mögen, dann wählen Sie Rohmilchkäse. Ansonsten sollten Sie auf Milch weitgehend verzichten. Achten Sie auch darauf, dass Sie mit gesunden Fetten kochen. Ideal sind Olivenöl und Rapsöl. Auch ein Löffel Leinöl im Salat versorgt sie mit Omega-3-Fettsäuren und unterstützt so den Körper bei entzündungshemmenden Heilungsprozessen.
Es gibt zudem eine wunderbare Heilpflanze bei chronisch entzündlichen Erkrankungen der Atmungsorgane, und zwar den Holunder (Sambucus nigra). In Drogerien und Apotheken erhalten Sie Sambucustropfen zum Einnehmen. Sie wirken auf den Körper wärmend und schleimlösend. Hilfreich sind ebenfalls schleimlösende Nasenduschen mit Meersalzlösungen.
Damit der Darm nach den AntibiotikaKuren wieder richtig funktioniert, empfehle ich Ihnen, mit Bakterienkulturen die Darmflora wiederherzustellen und den Darm mithilfe von Flohsamen zu sanieren. Denn der Ursprung für Schleimhauterkrankungen liegt häufig auch in der Darmflora.
Sabine Hurni
Allergisch auf den eigenen Schweiss
Ich schwitze relativ stark. Jetzt reagiere ich allergisch auf meinen Schweiss. Die Achselhöhlen und Augenwinkel sind entzündet und schmerzen. Was kann ich dagegen tun? Ich ernähre mich gesund, trinke viel Wasser, wenig Kaffee. Ich bin sehr anfällig auf Infektionen und oft verschleimt.
K. A., Retschwil
Wenn
der Schweiss plötzlich ätzend wird, deutet dies auf ein Mineralstoffungleichgewicht hin. Holen Sie sich in der Drogerie die Schüssler-Salze Nr. 1 (Calcium fluoratum) und Nr. 8. (Natrium chloratum). Beide Salze werden eingesetzt, wenn der Schweiss aggressiv und ätzend wird. Sie können je 10 Tabletten in Wasser lösen und so über den Tag verteilt trinken. Oder Sie lutschen viermal täglich zwei Tabletten aufs Mal. Äusserlich könnte es Ihnen gut tun, wenn Sie die entzündeten Stellen mit einer Meersalzlösung abwaschen.
Kann es sein, dass Sie im Sommer sehr viel Eis gegessen und Süssgetränke getrunken haben? Wenn meine Hypothese zutrifft, dann sollten Sie ab sofort nur noch einmal pro Woche Süssigkeiten essen und die Lust nach Süssem an den übrigen Tagen mit einem Apfel oder mit Mandeln befriedigen. Keine Süssgetränke und kein Glace. Zucker ist auch in Fruchtjoghurts, im Ketchup und in vielen Getreideflocken versteckt. Zucker ist deshalb problematisch, weil er ein richtiggehender Calcium fluoratumRäuber ist. Wenn dieser Mineralstoff im Körper fehlt, kann der Schweiss ätzend werden. Gleichzeitig schwächen eisgekühlte Nahrungsmittel die Nieren, was die Abwehrkräfte im Körper reduziert. Zudem wirkt viel Zucker schleimbildend. Sabine Hurni














Seit über 20 Jahren setzt sich Heinz Knieriemen für «natürlich» kritisch mit den Methoden und den Auswirkungen der Schulmedizin und der Laborwissenschaft auseinander. Im AT Verlag hat er mehrere Bücher herausgegeben, unter anderem über Vitamine, Mineralien und Spurenelemente oder Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Kosmetika.
Heinz Knieriemen über
das geniale Element Wasser
Wasser! Ein alltäglicheres Element gibt es kaum. Und es gibt kaum ein derart wichtiges Element, mit dem wir so selbstverständlich wie auch gedankenlos umgehen.
Was ist Wasser? Zunächst einmal ein Element, Materie, gekennzeichnet durch die chemische Formel H2O – eine Verbindung der Gase Wasserstoff (Hydrogenium) und Sauerstoff (Oxygenium). Es ist aber auch der Baustein der Lebensprozesse und unentbehrlicher Bestandteil aller Körpersubstanzen, die Pflanze, Tier und Mensch aufbauen.
Wasser ist aber auch Klang, Schwingung, rhythmische Bewegung. Im Lösen und Binden, Abtragen, Neuformen und fortwährenden Umwandeln ist Wasser der Organismus der Erde, das Sinnesorgan der Natur. Panta rhei, alles fliesst: Das nasse Element galt den Griechen als der ursprüngliche Stoff des Lebens, als elementarste Materie, aus der die Welt sich in ruhiger und bewegter Form entwickelte.
Wasser ist eine simple Verbindung, weit entfernt von der Komplexität etwa der Eiweissmoleküle oder synthetischer Kunststoffe. Die Vereinigung zweier Wasserstoffatome mit einem Sauerstoffatom weist jedoch viele von der Norm abweichende Eigenschaften auf. Betrachten wir die Struktur von H2O, so fällt als Erstes auf, dass Wasser bei einer Einordnung in die periodischen Gesetzmässigkeiten der Materie aus dem Rahmen fällt. Doch gerade diese ungewöhnlichen Eigenschaften der Wassermoleküle ermöglichen erst Leben auf unserem Planeten.
Weshalb schwimmt Eis?
Die auffälligste und wohl wichtigste Anomalie: Wasser dürfte gar nicht flüssig sein. Weil seine Ausgangselemente Gase sind,
müsste Wasser logischerweise auch gasförmig sein. Diesen Zustand erreicht es aber erst bei Temperaturen von über 100 Grad. Wasser gefriert bei null Grad und verdampft bei 100 Grad. Wir empfinden das als normal, doch sind Schmelz und Siedepunkt als wichtige Richtwerte der CelsiusTemperaturskala einfach am Verhalten des Wassers fixiert worden.
Ungewöhnlich verhält sich Wasser auch in seiner Dichteanomalie, indem es mit zunehmender Abkühlung nicht immer gleichmässig dichter wird, sondern die grösste Dichte bei vier Grad erreicht, um bei weiterer Abkühlung und beim Erstarren zu Eis wieder leichter, also weniger dicht zu werden – auch das wieder mit weitreichenden Konsequenzen für Leben auf der Erde. Da Wasser bei vier Grad das Dichtemaximum erreicht, ist Eis leichter und schwimmt somit auf der Oberfläche. Damit wird ein Gefrieren der Tiefenschichten von Seen und Meeren verhindert, was Leben im Wasser auch bei Temperaturen unter null Grad möglich macht.
Wasser nimmt Gestalt an
Auf diese Weise werden die Meeresströme aufrechterhalten und damit letztlich der globale Wasserkreislauf und das Leben an Land. Die gewaltigen Wassermengen der Weltmeere wirken wie eine gigantische Klimaanlage, die die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen unserer Erde durch Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe ausgleicht.
Die speziellen Eigenschaften des Wassers, die Leben erst ermöglichen, lassen sich beliebig fortsetzen. Die Gestaltbil

Wasser ist nicht nur Kreislauf des Lebens, sondern auch Organismus der Erde, das Sinnesorgan der Natur.
dungskräfte des Wassers kann jeder an ganz alltäglichen Phänomenen beobachten: an Regentropfen, an glitzernden Tautropfen auf Gräsern oder Spinnweben oder ganz einfach an einem tropfenden Wasserhahn. Die Beispiele verdeutlichen, dass Wasser immer versucht, die Form einer Kugel, eines Tropfens einzunehmen. Diese Eigenschaft kommt durch die Oberflächenspannung und die Kapillarkraft zustande. Diese Kapillarkräfte ermöglichen ein Ansteigen des Wassers von den Wur
zeln bis in die höchsten Baumkronen – ein für Pflanzen und letztlich auch für Menschen überlebenswichtiger Transportweg und Teil des grossen Wasserkreislaufs.
Schwerkraft gilt nicht
In Zellen und Blutadern überwindet das Wasser in sogenannten kolloidalen Lösungen die Gesetze der Schwerkraft. Kolloide, winzige unlösbare Mineral und Elektrolytpartikel, sinken nicht nach unten, wie das die Schwerkraft eigentlich verlangt, sondern halten sich in der Schwebe – ein für die Zellfunktionen lebenswichtiges Phänomen.
Aufgabe und Funktion des Wassers sind in allen lebenden Organismen sehr vielfältig. Wasser ist der wichtigste Vermittler des Stoffwechsels. Es übernimmt die Lösung und den Transport der Nahrungssubstanzen, die in Aufbaustoffe des Körpers verwandelt werden. Wasser wirkt mit beim Umbau, Abbau und der Ausscheidung dieser Substanzen. Ein Säugling besteht zu über 90 Prozent aus Wasser, ein Erwachsener noch aus gut 60 Prozent. Wasser kommt vielfältigen Aufgaben als Transportvermittler, Lösungsmittel oder Regulator der Körpertemperatur nach. Das gewaltige Filtervolumen der Nieren mit etwa 180 Litern am Tag wäre ohne das flüssige Element gar nicht denkbar. Es sind also die gegensätzlichsten Funktionen, die das Wasser wie selbstverständlich ausübt. Denken wir uns die gesamte Wassermenge der Welt als eine gefüllte Badewanne mit 200 Liter Inhalt. Allein das Meerwasser macht 195 Liter davon aus. Weitere 4,2 Liter entsprechen dem Wasser, das im ewigen Eis, im Permafrost und in den Gletschern gespeichert ist. Jetzt bleiben nur noch 0,8 Liter Wasser, das frei als Regen, in Bächen, Flüssen, Seen und als Grundwasser zirkuliert – ein Bruchteil der gewaltigen Wassermenge unseres Blauen Planeten also – und darum weit wertvoller, als unser täglicher Umgang mit dem wunderbaren Element vermuten lässt. u
Haus&Garten
Tut gut_ Wärmender Gewürztee
er Lust auf Süsses, aber schon alle Weihnachts-Guetsli verspeist hat, kann mit einem Chai-Tea seine Gelüste nach süsser Würze stillen.
Rezept für 2 bis 3 Tassen
Zirka 15 g frischer Ingwer in Scheiben geschnitten
1 Zimtstange
2 bis 3 Kardamonkapseln
1 Nelke
½ Vanillestange
Evtl. 3 bis 4 Koriandersamen
1 ½ EL Schwarztee
Etwa 1, 5 dl Milch
Zucker oder Honig
Raumklima_ Gute Luft dank Zimmerpflanze


DKardamon, Nelke und Koriander im Mörser zerstossen. Zimtstange zerbrechen. Die Gewürze zusammen mit der Nelke und dem Ingwer in 4 bis 5 Deziliter Wasser aufkochen. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauslösen und beigeben. Etwa 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

ie Grünlilie (Chlorophytum) ist wegen ihrer Anspruchslosigkeit eine beliebte Zimmerp anze. Zudem wird ihr eine besonders gute Fähigkeit, die FormaldehydBelastung in Innenräumen zu reduzieren, nachgesagt. Die giftige chemische Verbindung kommt in Farben, Lacken und Klebstoffen vor –und ist somit in vielen Wohnungen anzutreffen. Gemäss Wikipedia emp ehlt eine wissenschaftliche Studie, zur Luftverbesserung in Niedrigenergiehäusern Grünlilien einzusetzen.

Milch zugeben und nochmals aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, Tee zugeben und 3 bis 4 Minuten ziehen lassen.
Zuletzt mit Zucker oder Honig nach Bedarf süssen und durch ein Sieb abgiessen.
Tipp: Wer auf Schwarztee verzichten möchte, verdoppelt die Gewürzmenge.
➜ Der Tipp
Da nützt alles Lüften nichts: Hat man Fondue gegessen, liegt der schwere Käsegeruch auch am nächsten Morgen noch in der Luft. Linderung bringt das Universalmittel Essig. In einer Pfanne etwas Essig aufkochen und damit durch die Wohnung gehen. Der Dampf vertreibt nicht nur Käse-, sondern auch Fischgeruch.



Lesen_ Blaue Schweden, Grüne Zebra, Roter Feurio

Wirt Albi von Felten hat ein Herz für Minderheiten: Der Garten seines Gasthauses in Erlinsbach (Aargau) ist ein kleines Biotop mit aussergewöhnlichen Gemüsen, Kräutern und Früchten. Er hat es sich zu Aufgabe gemacht, seinen Gästen nicht nur regionale Spezialitäten aufzutischen, sondern ihnen auch (fast) vergessene Gemüse und Obstsorten näherzubringen. Zusammen mit Martin Weiss und ProSpecieRara hat er ein Buch über wiederentdeckte alte Kulturp anzen gemacht. Gegliedert nach Jahreszeiten zeigen 160 leicht nachkochbare Rezepte, welche kulinarischen Schätze in den alten Sorten stecken. Zudem bietet das Buch viele Hintergrundinformationen zu den Produkten und P anzen.
Martin Weiss, Albi von Felten: «Blaue Schweden, Grüne Zebra, Roter Feurio», AT Verlag, 2012, Fr. 69.–


Winterliche Knacknuss



ie gilt als Königin der Nüsse und sie hat jetzt Saison: die Baumnuss. Obwohl: Die Kerne sind ganzjährig erhältlich. In der Schale «verpackt» zum Selberknacken gibt es sie aber vor allem im Winter. Die ursprüngliche Heimat der Nuss, lateinisch Juglans regia, liegt wahrscheinlich in Südwestasien sowie in den Gebieten um das östliche Mittelmeer. Über die Griechen gelangten veredelte Sorten nach Italien. Die Gallier, die keltischen Vorfahren der heutigen Franzosen, wurden im Mittelalter oft als Baumchen oder Welsche bezeichnet, sodass die ursprüngliche lateinische Namensgebung im Lauf der Zeit als Welschnuss oder auch Walnuss ins Deutsche über ging. Wer meint, Baumnuss sei Baumnuss, irrt. Die Nussbaumschule in Hörhausen (Thurgau) baut 250 verschiedene Sorten an. Rund 100 Sorten sind schweizerischen Ursprungs und rund 100 stammen aus Europa und amerikanischen Gegenden. Freilich beschränkt sich die Auswahl im Supermarkt auf ein paar wenige
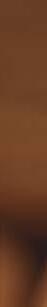


Sorten. Zu den Hauptanbaugebieten gehören Kalifornien, Chile und China. Beliebt ist auch die Grenobler-Nuss aus Frankreich, die sogar eine Appellation Controllee hat und am roten Siegel ihrer Verpackung erkennbar ist. In der Schale sind Nüsse nur ein paar Wochen haltbar. Aber keine Angst: Nüsse, deren Schale dunkel verfärbt ist, sind nicht etwa schlecht. Im Gegenteil, es zeigt, dass die Schale nicht gebleicht wurde. Dies wird oft getan, weil die Schale leicht oxidiert. Verdorbene Nüsse erkennt man sofort an ihrem ranzigen Geschmack. Baumnüsse sind nicht nur sehr gesund und enthalten




einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, sie gelten auch als wichtige Quelle für Antioxidantien, die vor Arteriosklerose oder Krebs schützen können. Ausserdem liefern Walnüsse jede Menge Nervennahrung: Magnesium, B-Vitamine und Lecithin. Walnüsse verfeinern das morgendliche Müesli, sie passen als Pesto oder vermischt mit einer Gorgonzolasauce perfekt zu Teigwaren, geben einer Pizza Margherita einen neuen Dreh oder lassen sich zusammen mit getrockneten Tomaten, Knoblauch und Zwiebeln zu einer Füllung für Fleischvögel verarbeiten. En Guete.






Kräftige Winzlinge
Keimlinge und Sprossen sehen zart und apart aus. Doch sie sind weit mehr als Dekoration: Die kleinen Kraftpakete liefern eine geballte Ladung Nährstoffe – und damit so ziemlich alles, was der Körper im Winter braucht.
Text Vera Sohmer
Auf dem leuchtend gelben KürbisKarotten-Salat sind die lilafarbenen Rotkohlsprossen ein toller Farbkontrast. Die Kressesprossen mit ihrem zarten Grün verpassen dem Kartoffelpüree den optischen Frischekick. Und wie hübsch ist die mit ein paar roten Linsenkeimlingen garnierte Tomatensuppe.

Das Keimen lässt den Gehalt an Nährstoffen in die Höhe schnellen.
Keimlinge (frisch gekeimte Samen) und Sprossen (weiterentwickelte Keimlinge mit grünen Blättchen) sind beliebt. Schliesslich lässt sich mit ihnen vieles ganz unkompliziert appetitlich anrichten: Dips und Suppen ebenso wie Sandwiches, Salate oder ein Risotto. Sie auf ihr gutes Aus-
sehen zu reduzieren, hält Michael Brönnimann von der Lebensmittel-Manufaktur «Naturkostbar» aber für verwerflich. «Gekeimte Saaten sind eines der wertvollsten Lebensmittel überhaupt. Etwas Besseres kann man kaum für sich tun.» Seit er jeden Tag selbst gezogene Keimlinge und Sprossen esse, fühle er sich frisch und fit und gehe energiegeladener durchs Leben.

Reich an Eiweiss
Brönnimanns Empfinden mag subjektiv sein, fest aber steht: Keimlinge und Sprossen werden allgemein als Powerpäckchen gepriesen. Durch den Keimvorgang schnellt der Gehalt an Nährstoffen in die Höhe. Alle essenziellen Bausteine werden dabei auf Hochtouren produziert, erklärt Brön-

Schmeckt herrlich und ist gesund: Butterbrot mit Kresse.
nimann. Hinzu kommt, dass die wertvollen Inhaltsstoffe aus der gekeimten Saat vom Körper besonders gut aufgenommen werden. Keimlinge und Sprossen sind reich an hochwertigem Eiweiss, Mineralstoffen, Enzymen und Vitaminen. Kurzum: Wer Wert auf gesunde Ernährung legt, sollte die Winzlinge auf den Speiseplan setzen. Sie seien eine willkommene Abwechslung und Ergänzung, erst recht in der kalten Jahreszeit mit dem eher kleinen Saisonangebot, heisst es bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Gesund ist schön und gut. Aber mundet Gekeimtes auch? Und ob, schwärmt Kochbuch-Autorin Valérie Cupillard. Keimlinge und Sprossen verwöhnten uns mit neuen Aromen, seien pure Gaumenfreude. Den Beweis liefert die Bioköchin mit überraschenden Rezepten: Da werden der Minestrone kurzerhand gekeimte grüne Linsen verpasst; in die Frühlingsrollen Sprossen von Sonnenblumenkernen eingewickelt. Und der Bratapfel bekommt eine Garnitur der Extra-Klasse: eine Mischung aus Honig, Zimt und gekeimtem Sesam.

Köstlich auf dem Butterbrot
Kenner kombinieren Keimlinge raffiniert und gekonnt. Sie mischen süsslich-milde aus Weizen oder Hafer ins Müesli oder den Fruchtsalat. Garnieren goldbraun gebratene Kartoffeln mit pikant schmeckenden Zwiebelsprossen. Oder streuen mildwürzige Alfalfa-Keime einfach aufs Butter- oder Frischkäsebrot.
Überhaupt Alfalfa: Wer zu Hause selbst Keimlinge ziehen will und es zum ersten Mal probiert, ist mit dieser Sorte gut beraten. Alfalfa, auch Luzerne genannt, keimt leicht und schnell – innerhalb von vier Tagen sieht man das Ergebnis. Für Anfänger

sicher motivationsfördernd und vielleicht Anlass, es nach und nach mit heikleren Sorten wie beispielsweise Randen zu probieren. Michael Brönnimann kann das Selbst-Kultivieren wärmstens empfehlen. So habe man alles frisch von der Fensterbank. «Und mit ein paar Grundkenntnissen funktioniert es wunderbar.»

Wichtig sei, auf Hygiene zu achten. Sprich: nur saubere Gläser oder Keimvorrichten zu verwenden, das Keimgut regelmässig zu wässern, aber aufzupassen, dass sich keine Staunässe bildet. Und: die richtige Sorte fürs richtige Gerät zu verwenden. Samen von Kresse oder Rucola


Keimlinge selber ziehen: So gelingt es
● Eine ganze Reihe von Pflanzen ist zum Ziehen von Keimen und Sprossen geeignet: Getreide wie Gerste, Hirse, Mais oder Roggen. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen, Mung- oder Sojabohnen. Darüber hinaus Samen von Dill, Fenchel, Knoblauch, Sellerie oder Spinat. Ungeeignet sind Tomaten oder Gartenbohnen.
● Kaufen Sie keimfähige Samen in Bioqualität. Man erhält sie in Reformhäusern, teilweise beim Grossverteiler oder bei spezialisierten Online-Shops.
● Zur Anzucht werden spezielle Schalen, stapelbare Keimboxen oder Sprossengläser mit Halterung angeboten. Für Bequeme gibt es Keimautomaten, in denen die Saaten automatisch mit gefiltertem Wasser besprenkelt werden. Man kann aber auch gewöhnliche Einmachgläser benutzen. Darauf achten, dass der Boden gebogen ist, damit sich allfälliges Wasser nur am Rand sammelt.
● Gekeimte Samen haben mehr Volumen, deshalb nicht mehr als drei gestrichene Esslöffel für ein Glas verwenden.
● Samen verlesen, waschen und in lauwarmem Wasser vorquellen. Die Dauer richtet sich nach Grösse und Sorte: Alfalfa oder Radieschen brauchen mindestens sechs Stunden; Kichererbsen, Mungoder Sojabohnen hingegen mehr als zehn Stunden.
● Ziehen im Einmachglas: Nach dem Einweichen die Samen in einem Sieb gründlich abspülen, nicht gequollene und leere Samenschalen aussortieren und ins gereinigte Einmachglas geben. Mit Gaze und Gummiband verschliessen
Das Glas kopfüber stürzen, damit das Wasser abtropfen kann. Dann kann das Glas richtig herum aufgestellt werden.
● Ideal ist ein warmer Standort, um die 20 Grad. Zu Beginn können die Keimlinge vor Licht geschützt werden. Um Chlorophyll zu bilden, brauchen sie dann aber Licht. Sobald die ersten Keime zu sehen sind, die Gläser an einen hellen Platz stellen. Direkte Sonneneinstrahlung jedoch meiden.




● Die Keime mindestens zweimal am Tag abspülen und gut abtropfen lassen.
● Bis die Samen keimen oder junge Sprossen wachsen, dauert es je nach Sorte zwischen zwei und sieben Tage Für jede Saat gibt es einen optimalen Zeitpunkt, wann sie verzehrt werden sollte: nämlich dann, wenn sie ein Maximum an Nährwerten bietet. Faustregel: Keimlinge aus Getreide oder Hülsenfrüchten sind mit fünf Millimeter Länge optimal. Gekeimtes aus Gemüsesamen oder Gewürzen verwendet man eher als junge Sprossen: etwa drei Zentimeter lang, mit Blättchen. Und dann gibt es Sorten, die in jeder Entwicklungsstufe gut sind: Sonnenblumenkerne zum Beispiel schmecken sowohl als Keim wie als junger Spross.
● Gekeimtes Saatgut rasch verzehren Weiteres Wachstum lässt sich verhindern, wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt. Nicht luftdicht und zu feucht verpacken. Alle zwei Tage abspülen. Unempfindliche Sorten lassen sich gut mit der Salatschleuder trocknen Je nach Sorte halten Keimlinge und Sprossen bis zu einer Woche oder auch länger.
● Wer Gekeimtes kauft, sollte darauf achten, dass die Farbe kräftig und leuchtend ist. War die Kühlkette unterbrochen oder gab es Nässestau, entwickelt sich schnell unangenehmer Geruch. Auch welke oder bräunlich verfärbte Ware ist nicht empfehlenswert



bilden viel Schleim. Im Glas können sich deshalb leicht Fäulnis und Schimmel breitmachen. Darum lieber auf einem flachen Teller keimen lassen oder diese Samen mit anderen Sorten wie Alfalfa mischen. Ebenfalls ein guter Trick: Fügt man keimenden Hülsenfrüchten einige Rettichoder Senfsamen bei, bleibt das Keimmilieu frei von Bakterien (weitere Tipps siehe Box).
Roh oder blanchiert?
Wer seine Keimlinge und Sprossen hegt und pflegt, muss also keine Angst haben, sich neben den wertvollen Nährstoffen auch Bakterien oder Schimmelpilze einzuverleiben und kann darauf verzichten, wie oft geraten, grundsätzlich alles Gekeimte erst einmal kurz zu erhitzen. Dies empfiehlt sich laut Valérie Cupillard nur bei grünen Linsen und Kichererbsen, um deren unverdauliche Stoffe herauszulösen. Auch Keimlinge von Sojabohnen sollten blanchiert werden. Ansonsten gilt: Wenn möglich – gut gewaschen – roh verzehren und so von der ganzen Ladung Energie spendender Nährstoffe profitieren. Denn erhitzt verlieren die Powerpäckchen schnell einen Teil der Vitamine. ◆
Surftipps
www.natuerlich-online.ch /surftipps

Mehr zum Thema gut Essen und Trinken unter www.wildeisen.ch




ist anders.

Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil!
Jetzt 2 Monate lang kostenlos Probe lesen!
SMS: NAT + Name + Ihre Adresse an 919 (20 Rp./SMS) Internet: www.natuerlich-online.ch/probeabo Post: Coupon ausfüllen und absenden


Ja gerne, senden Sie mir bitte 2 «natürlich»-Ausgaben, das bleibt für mich kostenlos und unverbindlich!
Vorname und Name
Strasse und Nummer
PLZ und Ort
Telefon und E-Mail
Coupon an: «natürlich», Leser-Service, Postfach, 5001 Aarau Angebot gilt nur in der Schweiz bis 31.12 2013

Bunte Sprossen
Rezepte für 4 Personen von Brigitte Aeberhard

Sprossen-Crêpes mit Gruyère AOC
Teig
100 g Mehl
½ TL Salz
1,5 dl Milch
2 Eier etwas Butter
Füllung
175 g Gruyère AOC
1 kleiner Apfel
200 g Quark
1 EL Senf Salz, Pfeffer
100 g gemischte Sprossen, z. B. roter Rettich, Alfalfa, Rucola
Zubereitung
Mehl, Salz und Milch in eine Schüssel geben, mit einem Schwingbesen zusammen verrühren. Eier verquirlen, unter den Teig rühren, 15 Minuten ruhen lassen. Etwas Butter in einer grossen Bratpfanne erwärmen und nacheinander 4 Crêpes backen. Gruyère AOC in feine Stifte schneiden. Apfel entkernen und klein würfeln. Quark mit Senf, Salz und Pfeffer verrühren. Käse, Apfelwürfelchen und Sprossen mit dem Quark vermischen.
Füllung auf den Crêpes verteilen, dabei 2 bis 3 cm Rand frei lassen. Crêpesränder links und rechts etwa 2 cm über die Füllung klappen, dann von unten her satt einrollen. Den oberen Crêpesrand mit wenig Quark (von der Füllung) bestreichen und gut andrücken. Crêpes diagonal halbieren.
Eignet sich ideal zum Mitnehmen.
Pfannengerührtes Sprossengemüse
200 g Shiitake-Pilze
300 g Chinakohl
150 g Rüebli
1 daumengrosses Stück Ingwerwurzel
2 Knoblauchzehen
3 EL Öl
100 g Mungbohnen-Sprossen
1 Limette
2 EL Sojasauce
Pfeffer
Zubereitung
Shiitake-Pilze je nach Grösse halbieren oder vierteln. Chinakohl in 2 cm breite Streifen schneiden. Rüebli in dünne Rädchen hobeln. Ingwer und Knoblauch fein hacken.
Die Hälfte des Öls in einer Wokpfanne oder einer grossen Bratpfanne erhitzen. Pilze 1 bis 2 Minuten darin anbraten. Restliches Öl zufügen, Ingwer, Knoblauch und Rüebli beigeben und kurz mitbraten. Chinakohl und Mungbohnen-Sprossen zufügen, unter Rühren braten, bis der Chinakohl leicht zusammenfällt. Limettensaft auspressen. Gemüse mit Limettensaft, Sojasauce und Pfeffer würzen.
Dazu passen Reisnudeln, Eiernudeln oder Reis.

Dinkelsprossen-Müesli
Für 2 Personen
½ reife Avocado
1 TL Zitronensaft
1 dl Apfelsaft
100 g Dinkel- oder Weizensprossen
3 EL Studentenfutter
2 kleine Äpfel
Zubereitung
Fruchtfleisch der Avocado mit einem Löffel aus der Schale lösen, in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Zitronensaft und Apfelsaft mit der Avocado gut verrühren. Dinkelsprossen und Studentenfutter zufügen. Äpfel auf einer groben Raffel direkt ins Müesli reiben. Alles gut vermischen und auf zwei Schälchen verteilen.
Auf zu neuen Taten
Nach den vielen Feiertagen mit gemütlichem Beisammensein und ausgiebigem Ausschlafen ist es an der Zeit, wieder nach draussen zu gehen – auf den Markt und in den Garten, um Topinambur und Kohl zu ernten.
Text Remo Vetter

Der Autor
Remo Vetter wurde 1956 in Basel geboren. 1982 stellte ihn der Heilpflanzenpionier Alfred Vogel ein. Seither ist Vetter im Gesundheitszentrum in Teufen (AR) tätig, wo er mithilfe seiner Familie den Schaukräutergarten von A. Vogel hegt.
Viele Menschen beginnen das neue Jahr mit Ausschlafen und gemütlichem Nichtstun. Persönlich habe ich den Neujahrstag lange Zeit nicht sehr geschätzt, weil ich da Geburtstag habe und meine Familie meist zu müde war, um am 1. Januar noch einmal zu feiern. So hat es sich eingebürgert, dass wir an Silvester kräftig festen und nach Mitternacht gleich meinen Geburtstag feiern. So geht es denn auch bei uns am 1. Januar und am Berchtoldstag ziemlich gemütlich zu und wir nutzen die freie Zeit, um zu «bächteln», um Freunde in der Beiz zu treffen.
Topinambur trotzt auch der grössten Kälte.

Doch nach all den Feiertagen in der warmen Stube freue ich mich auch auf den ersten Marktbummel im neuen Jahr. Wacker und unerschrocken trotzen die Gemüsebauern den garstigen Januartemperaturen. Mit Plastikblachen schützen sie sich und ihre Auslagen vor der grössten Kälte und dem eisigen Wind. Seit ich vor vielen Jahren selbst einmal einen Tag lang bei minus 10 Grad Gemüse auf dem Markt verkaufte, habe ich einen riesigen Respekt vor den Bauern und Marktfahrern. Jetzt im Januar liegt die letzte Ernte des Jahres auf dem Markttisch. Schön nach Länge und Dicke sortierte Schwarzwurzeln, rohe und gekochte Randen, Fenchelknollen, Sauerkraut und Sauerrüben, Kartoffeln, Nüsslisalat und Endivie, Palmkohl, Federkohl und Topinambur. Der Speisezettel ist in dieser Jahreszeit einfacher geworden, wenn wir uns mit einheimischen Produkten versorgen.
Geniale «Indianerkartoffel»
Topinambur, dieses alte Gemüse, das lange vor dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa verbreitet war und dann in Vergessenheit geriet, erlebt in den letzten Jahren

ein Revival, vor allem bei Produzenten, die biologische Landwirtschaft betreiben. Der Topinambur, auch «Indianerkartoffel» genannt, war ein Hauptnahrungsmittel der Indianer. Sein Name geht auf den Indianerstamm «Topinambas» zurück. Seefahrer brachten im 17. Jahrhundert dieses Gemüse zuerst nach Frankreich, wo es als besondere Delikatesse für reiche Leute zubereitet wurde.
Geerntet werden die Knollen gleich wie Kartoffeln, jedoch erst ab November bis April. Ein grosser Vorteil von Topinambur ist, dass er auch grösste Kälte erträgt und so den ganzen Winter hindurch frisch ausgegraben werden kann. Das ist vor allem gut, wenn zum Beispiel die Kartoffeln bereits aufgebraucht sind und sonst

Raus aus der warmen Stube.
Ab an die frische Luft.
noch nichts Frisches im Garten spriesst. Sollten wir überschüssige Exemplare haben, lassen wir sie einfach im Boden, wo sie sich Jahr für Jahr verbreiten. Wegen seiner dünnen Schale sollte Topinambur nicht lange gelagert werden; er verliert schnell seine Feuchtigkeit und wird runzlig. Botanisch ist die Knolle mit der Sonnenblume verwandt, nicht mit der Kartoffel. Die rohen Knollen, dünn geschält, besser nur geschabt, haben einen leicht nussigen Geschmack. Gekocht erinnern sie an Artischocken oder Schwarzwurzeln.

Gartenarbeit im Januar
Im Winter muss der Boden nicht umgegraben werden, denn der nasse, harte Boden wird dabei nur unnötig verdichtet. Doch es gibt auch andere Meinungen und Ansichten zum Thema: Einige raten zum Umgraben im Herbst, andere zur Brache und wieder andere –und ich auch – zum Nichtstun, sprich Belassen, wie es ist. Möglich ist alles. Ich persönlich halte mir das Bild des Meeres vor Augen. Ebenso wie im Meer, wo Fische und Lebewesen in ganz spezifischen Tiefen heimisch sind, leben in der Erde bestimmte Kleinlebewesen nur in bestimmten Schichten. Wenn ich diese Bodenschichten und Strukturen durch Umgraben oder mechanische Bearbeitung verändere, zwinge ich die Kleinlebewesen zu einem Leben in einer für sie ungünstigen Umgebung. Das ist meine subjektive Wahrnehmung und so setze ich in meinen Garten auf permanente Bepflanzung, Gründüngung und «Bodenkosmetik» mit Brennnesselund BeinwellAuszügen. Diese einfache Art der Bodenpflege hat sich bewährt. Zudem erlaubt es diese Arbeitsweise, den Januar gemächlich anzugehen. Es bleibt Zeit, um Saatgut zu bestellen, im Treibhaus oder im Wintergarten einige Pflanzen anzusäen und um sich Gedanken zu machen, was man im kommenden Frühjahr, wo pflanzen will.
Ernten
● Winterharte Kohlsorten liefern frische Vitamine und können im Boden bleiben, bis sie verwendet werden.
● Steckrüben sollten Sie ernten, bevor sie zu gross und holzig werden.
● Knollensellerie nach Bedarf ernten. Es bewährt sich, eine Schicht Stroh um die Wurzeln zu verteilen, um die Pflanzen länger im Boden belassen zu können.
● Pastinaken vertragen einige Minusgrade und schmecken sogar noch süsser, wenn sie Frost bekommen haben.
● Lauch wird auf dem Beet belassen und frisch geerntet.

● Winter-Endivien überstehen den Winter auf dem Beet, wenn sie mit Folien geschützt werden.
● Rosenkohl wird von unten nach oben geerntet, wenn er heranreift.
● Alle Grünkohlsorten sind frosthart und können den ganzen Winter über geerntet werden.
● Winterrettich ernten. Er schmeckt roh im Salat oder wie Rüben gekocht.
● Topinambure im Boden belassen und erst ausgraben, wenn sie gebraucht werden sollen.
● Brokkolis können in milderen Gegenden bis im Frühjahr geerntet werden.
● Im Januar ist der erste Winter-Blumenkohl erntereif. Die Köpfe überstehen Frost besser, wenn man die äusseren Blätter über ihnen zusammenbindet.


Fastenwandern
im WunderlandSchweiz mitMaya+Liselotte
…fröhlich-gesundeWochen unter kundiger Leitung …entspannen, entschlacken, Gewicht verlieren, Vitalität gewinnen!
Gratis-Infobei: Maya Hakios, CH-8269 Fruthwilen Tel. 071 664 25 29, www.fastenwandern.ch

Sich so richtig entspannen –Relaxen wie es sich gehört: Rachel Kuhn, 3007 Bern, Shiatsu Therapeutin HPS Telefon 031 371 37 56 www.shiatsu-kuhn.ch
Meditative Fastenferien
Ihr Hund ist Fleischfresser, kein Trockenfutter-Befeuchter. Richtig?


Bio Fleisch. Für Hunde die natürlichste Sache der Welt. www.canebio.ch Inserat57x49_V1.indd

30.3.–6.4., 6.–13.4.,13.–20.4., 20.4.–27.4. im Wellness-Hotel Höri direkt am Bodensee. Meditation, Energie-, Bewusstseinsarbeit, Qi Gong, Tanz, Matrix usw ab Fr 1170.– inkl. Kurs, Unterkunft. ✆ 052 741 46 00, www.fasten.ch
Ureinwohner in Indien erkämpfen von der Regierung das Recht, ihren Wald zu nutzen.
fasten-wander n-wellness.ch
Einmal Pause für Kopf und Bauch – Sie werden von der Wirkung begeistert sein. Ida Hofstetter, Telefon 044 921 18 09
Persönlicher Biorhythmus
Zeigt die Summe der Kräfte in Körper-Seele-Geist. Mehrfarbig, Kalenderform, Taschenformat, 12 Monate Fr. 36.–. Bitte Geburtsdaten an: Hermann Schönenberger, Churerstr. 92 B, 9470 Buchs SG Telefon 081 740 56 52, bioschoen@bluewin.ch

PC 30-303-5 www.swissaid.ch



Gegen Bronchitis, Husten und Katarrh
Kernosan Meerrettich Elixir basiert auf einer altbewährten Rezeptur mit 10 Heilpflanzen und frischem Saft aus der Meerrettich-Wurzel. Es lindert Erkältungsbeschwerden, löst den Schleim, erleichtert den Auswurf und lässt Sie nachts wieder ruhig schlafen. Kernosan Meerrettich Elixir – Heilkraft pur aus der Natur.

Gegen alle Arten von Verdauungsbeschwerden

Kernosan Heidelberger Kräuterpulver wird nach dem Rezept von Bertrand Heidelberger aus erlesenen, pulverisierten Kräutern ohne andere Beimischungen hergestellt. Es wird angewendet bei Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Aufstossen. Die sieben Kräuter sind alle bitter. Bitterstoffe sind wichtig für die Verdauung und den Abbau von Schleim und Schlacken und wirken daher blutreinigend. Leber und Nieren werden entlastet. Zudem stärken die natürlichen Bitterstoffe das Abwehrsystem und haben auch eine anti-oxydative Wirkung. Aggressive Sauerstoffmoleküle werden abgefangen und die Zellen vor einer Schädigung bewahrt.
Vertrieb: E. Kern AG, Telefon 055 610 27 27 CH-8867 Niederurnen, www.kernosan.ch
Dies sind Heilmittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Kleinbauern in der Dritten Welt setzen auf Bio-Landbau statt auf Chemie und Pestizide.

PC 30-303-5 www.swissaid.ch






Jugendliche und Liebeskummer ist nur eines von vielen Themen rund um Schule, Erziehung und Freizeit. Jetzt in Fritz und Fränzi, dem Magazin der Stiftung Elternsein. Abo oder Probeheft: 0800 814 813 oder fritzundfränzi.ch

Topinambur eignet sich ausgezeichnet als Spezialkost für Diabetiker. Die Knolle enthält Kalzium, Eisen, Phosphor, viel Vitamin B und C sowie Karotin zum Aufbau des Vitamin A. Die Verwendung ist vielseitig. Die Knollen können wie Kartoffeln gedämpft, gedünstet, gekocht, gebraten, gebacken oder püriert zubereitet werden. Sie können aber auch roh, als Salat oder zu einem Dessert verarbeitet werden.
Eine besondere Köstlichkeit zum Knabbern für Klein und Gross sind Topinambur-Chips. Dazu hobelt man die Knollen in feine Scheiben und backt sie danach sofort in heissem Öl hellbraun und knusprig. Anschliessend auf einem Küchenpapier abtropfen und leicht salzen.
Ein Lob auf das Sauerkraut
Etwas weniger Anklang bei den Kindern fi ndet erfahrungsgemäss Sauerkraut. Doch erwachsene Feinschmecker schätzen den eingemachten Kohl als Beilage zu deftigen Fleischgerichten, aber auch als Belag einer salzigen Wähe. Unbestritten ist auch die heilsame und entschlackende Wirkung des Sauerkrauts: Es wird bei Schlankheitskuren angewendet, denn es baut Fett im Körper ab (sofern wir nicht gerade Speck dazu essen) und es wirkt stoffwechselanregend. Sauerkraut ist ausserdem reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Das Angebot im Handel ist vielfältig und doch findet man vielleicht nicht immer das Sauerkraut, das dem eigenen Geschmack entspricht. Darum gibt es eigentlich nur eine Lösung: selber machen. Am besten eignet sich Winterkohl, weil er einen höheren Zuckergehalt hat als Kohl aus der Sommerernte. ◆


Weinsauerkraut
Für ein 15LiterGefäss (am besten ein SteingutTopf)
15 kg Weisskohl (netto)
225 g Salz
100 g Zucker
7,5 dl Weisswein
1 Gewürzsäcklein, bestehend aus Wachholder, Kümmel, Lorbeerblätter

Den Weisskohl von den welken Blättern befreien. Einige grosse, schöne Blätter beiseitelegen. Die Kohlköpfe vierteln und ohne Strunk und dicke Adern fein hobeln. Mit Salz und Zucker gleichmässig in ein grosses Gefäss einstreuen und mischen. Mit einem Stössel stampfen, bis das Kraut weich wird und Saft zieht. Dann die beiseitegelegten Kohlblätter auf den Boden des Einmachgefässes legen und das Kraut fest einschichten. Dabei jede Lage mithilfe eines Brettes gut zusammendrücken. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Topf ganz voll ist. Wenn der Topf zu zwei Dritteln gefüllt ist, das Gewürzsäcklein beigeben. Das Kraut mit einem gebrühten Tuch und einem Brett bedecken und mit einem grossen Stein beschweren. Bei etwa18 Grad Raumtemperatur zum Gären bringen, in den folgenden acht bis zehn Tagen öfters abschäumen und einmal mit dem Stiel eines Holzlöffels durchstossen, damit sich bildende Gase gut entweichen können. Nach dem Gären die Oberfläche gut reinigen, sodass das Kraut nur von seinem klaren Saft umgeben ist. Nun den Weisswein dazugiessen und das Kraut mehrmals durchbohren, damit das feine Aroma sich gleichmässig ausbreiten kann. Die Bedeckung gut gereinigt wieder auflegen und das Kraut von jetzt an im kältesten Raum des Hauses oder im Gemüsekühlschrank lagern. Nach etwa vier Wochen kann schon das erste Mal Sauerkraut entnommen werden.
lebendig Faszination schränke
Die Schrankfront als eine Einheit, verschmolzen zu einem Bild –dies verkörpert die neue Schrank-Kollektion PICTURA. Ihr persönlicher «Holzweg-Schrank» wird Sie bezüglich Platz und Form faszinieren!
Jud Vinzenz GmbH Massivholz-Möbelschreinerei
Grabackerstrasse 21 · 8722 Kaltbrunn
Tel. 055 283 27 23 www.holzweg.ch info@holzweg.ch

Ausstellung: offen nach telefonischer Vereinbarung



Natur

Sterngucker im Januar_ Grösste Sonnennähe
Die Erde umkreist die Sonne auf einer elliptischen Bahn, wobei die mittlere Entfernung Sonne-Erde 149,6 Millionen Kilometer beträgt. Am sonnennächsten Punkt sind es noch 147,1 Millionen Kilometer, während die Distanz zu unserem Mutterstern beim sonnenfernsten Punkt auf 152,1 Millionen Kilometer anwächst. Am 2. Januar um 6 Uhr erreichen wir den sonnennächsten Punkt. Da die Ellipse der Erdbahn fast kreisförmig ist, fallen diese Schwankungen kaum ins Gewicht. Klimatisch gesehen ist der Einfluss derart gering, dass trotz grösster Sonnennähe diese Konstellation bei uns praktisch zur kältesten Winterzeit stattfindet. Am 5. Juli um 17 Uhr dieses Jahres befindet sich die Erde dann im sonnenfernsten Punkt. Der Abstand Sonne – Erde ist übrigens nicht konstant. Mit jedem Jahr bewegt sich die Erde etwa 10 Zentimeter weiter von der Sonne weg. Andreas Walker

Vögel I_ Gelehrige Stadtvögel
Stadtvögel wie Spatzen und Amseln passen ihre Überlebensstrategien ihrer Umgebung an. Im Gegensatz zu ihren Artgenossen auf dem Land lernen sie mit neuen Bedrohungen wie beispielsweise Katzen umzugehen, berichtet eine Studie in der Fachzeitschrift «Animal Behaviour».
Lesen_ Blätter und ihre Bäume
Was ist ein Baum? Was ist Blatt? So heissen die ersten zwei Kapitel im neuen Buch des Botanikers Allen J. Coombes. So einfach die Fragen, so ausführlich seine Antworten. Auf über 600 Seiten stellt er eine Auswahl von 600 besonders attraktiven Laubblättern mit ihren Bäumen vor. Jedes Blatt ist in Originalgrösse abgebildet und detailliert beschrieben. Ein Buch zum Staunen, Verstehen und Lernen.


_ Allen J. Coombes: «Blätter und ihre Bäume», Haupt Verlag, 2012, Fr. 64.–
Vögel II_ Überforderte Greifvögel
Windräder sind eigentliche Todesfallen für grosse Vögel – beispielsweise Rotmilane –, wie die Vogelwarte Sempach mittels Computersimulationen festgestellt hat. Eine Studie zeigt, dass sich die Gefahr verkleinern lässt, wenn sich die Windräder gruppiert in einem Windpark befinden. Sind sie aber über eine grössere Fläche einzeln verteilt, würde die Population abnehmen, so Michael Schaub, Autor der Studie.

_ Infos: www.vogelwarte.ch
Schlaue Maus
Wo Menschen sind, sind auch Mäuse: Als Überlebenskünstlerinnen haben sie sich perfekt an ihre Lebensräume angepasst und trotzen jedem Vernichtungsversuch.
Rund ein Dutzend Mausarten leben in der Schweiz, obwohl einige Arten streng genommen gar keine Mäuse sind, sondern zu den Hörnchenartigen (Haselmaus) oder aber mit Igel oder Maulwurf verwandt sind (Spitzmaus).
Kein anderes Säugetier, ausser der Mensch, ist weltweit so verbreitet wie die Hausmaus. Lediglich in den Polarregionen ist sie nicht verbreitet. Vor etwa 6000 Jahren ist sie aus Indien mit den Menschen nach Europa gekommen. Lebt sie nicht in der Nähe des Menschen, gräbt sie ihre Gänge auch in Steppen oder Wüstengebieten. Als Kulturfolgerin hat sie sich aber so gut angepasst, dass sie das Anlegen von Wintervorräten vernachlässigt – findet sie in der Nähe des Menschen doch genügend Futter. Da die Hausmaus zu Versuchszwecken zur Labormaus gezüchtet wurde, gehört das Tier hinsichtlich seines Sozialverhaltens und seiner Erbmerkmale zu den am besten untersuchten Säugetieren. Hausmäuse kommunizieren einerseits mit Ultraschall-Lauten, anderseits über geruchliche Merkmale. Der leicht modrige Geruch, den auch die zur Haustierhaltung gezüchteten Tiere verströmen, hilft den Tieren, sich zu orientie-

ren. Mithilfe von Duftmarken legen sie Wege an, denen sie später stets folgen. Im Gras kann man solche manchmal als kleine Trampelpfade erkennen. Hausmäuse sind in der Regel nachtaktiv. Sie können –trotz ihrer kurzen Beine – sehr gut klettern, schnell laufen und auch schwimmen, wenn nötig. Weil sowohl der Mensch als auch zahlreiche natürliche Fressfeinde der Maus ständig nach dem Leben trachten, vermehrt sie sich – wie alle Mausarten – rasch und effizient. In der Regel bringt ein Weibchen 10 bis 20 Junge zur Welt; bereits nach 24 Stunden ist es wieder empfängnisbereit. Und nach drei Wochen sind die Jungtiere geschlechtsreif. Theoretisch wäre es also möglich, dass ein Mäusepaar innerhalb eines Jahres mindestens 100 Junge aufzieht, die ihrerseits auch mehrmals Junge haben. Im Gegensatz zur Feldmaus verfügt die Hausmaus aber über eine Art Geburtenkontrolle, wenn eine Überpopulation droht: Die weiblichen Mäuse können die Eireifung und die Brunst bei Bedarf verzögern.
Wer die Tierchen im Haus hat, sollte auf einen sorgsamen Umgang mit Nahrungsmitteln und Abfällen achten. Wo die Maus kein Futter findet, lässt sie sich auch nicht nieder. Auch Katzen helfen, ein Haus mausfrei zu halten. Gift ist keine Lösung, da die Tiere daran qualvoll verenden, weil es nicht unmittelbar wirkt. Andernfalls würden die Tiere merken, dass der tote Artgenosse etwas Schlechtes gefressen hat und die Köder in Zukunft meiden.
_ Quellen: Igel-Bulletin, Tierschutz.com
Leben mit dem Mond
Der Einfluss des Mondes auf unser Leben geht weit über die Wirkung des Vollmondes hinaus. Ein bewusstes Leben mit den Phasen des Mondes würde uns nicht nur näher zur Natur bringen, sondern auch sonst vieles erleichtern.
Text Fabrice Müller

Leben mit dem Mond

Der Mond in der Medizin
Die Altmeister der Medizin, Hippokrates und Paracelsus, haben beide den Zusammenhang zwischen Mond, Krankheit und Gesundheit erforscht und erkannt. Wie die englische Zeitung «The Independent» berichtete, konnten Forscher der «Leeds University» sogar nachweisen, dass der Mond einen Einfluss auf die menschliche Physis hat.
In der Astromedizin geht man laut Johannes Bollhalder zudem davon aus, dass jedes Tierkreiszeichen eine Beziehung zu einem menschlichen Organ hat. Basierend auf diesem Wissen hat der Astrologe und Naturheilpraktiker für medizinische und zahnärztliche Eingriffe die richtigen Mondphasen bestimmt:
Mond und Sternzeichen
l Jedem Organ ist ein Sternzeichen zugeordnet. Keine Operationen am entsprechenden Organ, wenn der Mond das organbezogene Tierkreiszeichen durchläuft.
l Weisheitszahn-Operationen in das Zeichen von Waage, Wassermann oder Zwilling legen.
l Zahnbehandlungen unbedingt meiden, wenn der Mond im Tierkreiszeichen Stier steht, da die Wundheilung negativ beeinflusst wird.
Vollmond
l Wenn immer möglich keine Operationen durchführen lassen.
Abnehmender Mond
l Muss ein Zahnersatz eingesetzt werden, empfiehlt sich die Behandlung bei abnehmendem Mond.
l Die Neubildung von Zahnstein und Zahnbelag hält sich in Grenzen, wenn diese bei abnehmendem Mond entfernt werden – am idealsten ist ein Termin bei abnehmendem Mond im Tierkreiszeichen des Steinbocks.
Neumond
l Grundsätzlich guter Termin für Operationen wie beispielsweise das Entfernen von Warzen und Wucherungen.
l Bester Zeitpunkt für den Beginn von Suchttherapien, da der Neumond unter anderem auch für positive Veränderungen und Neubeginn steht.

Seit Urzeiten spielt der Mond im Leben der Menschen eine wichtige Rolle; er beeinflusst die Gezeiten, ist Symbol für Wechsel und Wandel, aber auch für Göttinnen in verschiedenen Religionen und Kulturen. Und manch ein Gärtner oder Landwirt orientiert sich beim Pflanzen und Ernten nach dem Mond. So zum Beispiel Bauern, die nach der biologischdynamischen Anbauweise von Demeter arbeiten – der Name steht für eine griechische Mondgöttin. Christian Butscher, Leiter der Geschäftsstelle Demeter Schweiz in Liestal, erklärt: «Aus den Tierkreiszeichen werden über den Mond die Qualitäten für das Pflanzenwachstum vermittelt.»
Was heisst das für die Gartenarbeit? Je nach Sternbild, in dem der Mond gerade steht, werden für den Mondkalender Fruchttage, Wurzeltage, Blütentage oder Blatttage festgelegt. Hinweise für die landwirtschaftlichen und gärtnerischen Arbeiten in Bezug auf die Wirkung des Mondes und anderer Planeten findet man im Kalender «Aussaattage» von Maria Thun (1922 bis 2012), der deutschen Pionierin des Pflanzenbaus im Einklang mit kosmischen Kräften. Beachtet werden laut Christian Butscher auch die Mondphasen «aufsteigend» und «absteigend» – nicht zu
verwechseln mit «abnehmend» und «zunehmend». «Bei der aufsteigenden Phase werden Erntearbeiten durchgeführt; in dieser Zeit steigen die Kräfte eher aus der Erde. Bei der absteigenden Phase sind Pflanzarbeiten und Baumschnitt angebracht, da ziehen sich die Wirkungen der Mondkräfte eher in die Erde zurück», erklärt Christian Butscher.
Der Einfluss der Tierkreiszeichen
Genau wie das Jahr ist auch der Mondzyklus in zwölf Tierkreiszeichen wie etwa Löwe oder Skorpion aufgeteilt. Dabei durchwandert der Mond in gut zwei Tagen ein Tierkreiszeichen. Die Wirkung des Mondes hängt stark davon ab, welches Tierkreiszeichen er gerade besucht. «Das Mondzeichen, also jenes Sternbild, in dem sich der Mond aktuell befindet, symboli
Der Mond gilt allgemein als Himmelskörper der Gefühle und der Weiblichkeit.
Sonne, Mond und Sterne – kosmische Kräfte, die unsere Lebenszeit beeinflussen
siert die weibliche Seite des Lebens. Es erzählt uns etwas über unsere Bedürfnisse, Gefühle und Psyche», erläutert Eveline von Gunten, psychologische Astrologin aus Bern, mit Spezialgebiet Mond. Das Sonnen beziehungsweise das Sternzeichen dagegen stehe für die männliche Seite in uns, für das Ego. Durchläuft der Mond zum Beispiel das Sternenbild des Skorpions und ist man zudem nahe an einer Vollmondphase, steigt laut der Astrologin der Hang zur Aggressivität. Ein Vollmond im Sternzeichen Fische wirke sich vor allem auf die Psyche der Menschen aus. «In dieser Phase neigen die Leute zu mehr psychischen Problemen und Schlafstörungen. Die Wirkung von Medikamenten ist in dieser Mondstellung besonders stark», erklärt von Gunten.
Der Mond gilt allgemein als Himmelskörper der Gefühle und der Weiblichkeit. Darüber hinaus umfasst er die Intuition, das Psychische, die Sehnsucht und das Romantische. Deshalb fühlen sich manche Menschen besonders vom Mond angezogen und reagieren stark auf die verschiedenen Mondphasen. Dabei spielen gemäss Eveline von Gunten auch das persönliche Geburtsdatum sowie die Stellung des Mondes während der Geburt eine wichtige Rolle, um die eigene Persönlichkeit astrologisch zu beurteilen. «Menschen mit dem Mond im Stier beispielsweise zeichnen sich durch auffallende Besonnenheit aus. Im Gemütsleben herrscht meist Frieden, denn MondStiere haben einen starken Sinn für alles Schöne, die Musik und den Genuss», schildert die Astrologin. Steht der Geburtsmond eines Menschen etwa im Krebs, so hänge sein Wohlbefinden weitgehend von Heim und Herd ab. In der Familie finde er Ruhe und Ausgeglichenheit.
Bei Vollmond kuscheln
Mit seinen zunehmenden und abnehmenden Rhythmen wirkt der Mond auch auf den Wasserhaushalt im menschlichen Körper. Dass der Zyklus der weiblichen Menstruation mit dem Lauf des Mondes verbunden ist, zeigt der französische Aus
druck «moment de la lune» für die Regelblutung schön. Parallel zum weiblichen Zyklus durchläuft der Mond alle 12 Tierkreiszeichen. «Den meisten Menschen ist dieser Zusammenhang heute jedoch kaum mehr bewusst», erklärt Johannes Bollhalder, Astrologe und Naturheilpraktiker aus Luzern.
Das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Sexualität sei eng mit dem Mond verbunden – besonders bei Vollmond, sagt Johannes Bollhalder. Der Mond habe einen Einfluss auf Lust sowie die Bereitschaft, sich zu öffnen. Hebammen bestätigen ferner, dass in Vollmondphasen die Zahl der Geburten steigt. Die zunehmenden und abnehmenden Mondphasen sollen auch das Essverhalten der Menschen beeinflussen. Studien und Untersuchungen wie zum Beispiel jene von Hartmut Spiess vom Institut für BiologischDynamische Forschung in Bad Vilbel, Deutschland, oder der «Spiritual Science Research Foundation» (SSRF) kamen zum Schluss, dass Nahrungsmittel je nach Stand des Mondes eine bestimmte Wirkung auf den Körper haben.
Wer nach dem Mond isst, kann an manchen Tagen das Essen mehr geniessen, ohne sofort eine Gewichtszunahme fürchten zu müssen. Der abnehmende Mond hingegen soll die beste Zeit zum Abnehmen sein. In dieser Zeit sollte man viel trinken, um die Schlacken und Giftstoffe des Körpers abzutransportieren. Es empfiehlt sich, bei Vollmond mit dem ersten Entschlackungstag zu beginnen. Umgekehrt gilt es, während der Zeit des zunehmenden Mondes besonders gut auf sich, den Körper und die Lebensmittel zu achten. Denn in dieser Mondphase bleibt gerne etwas von den Dickmachern auf der Hüfte zurück.
Wer Wert auf schöne Haare legt, plant den Coiffeurtermin am besten ebenfalls nach dem Mondkalender. «Es gibt sowohl beim abnehmenden wie auch zunehmenden Mond Tage, an denen ein Haarschnitt nicht zu empfehlen ist. Dazu gehören zum Beispiel die Fischetage, an denen nach dem Waschen Schuppen entstehen kön
nen, sowie die Steinbocktage, die die Haare eher grau werden lassen», informiert Eveline von Gunten. Viele Erfahrungen rund um die Wirkung des Mondes sind allerdings nicht wissenschaftlich bestätigt, bewegen sie sich doch meist auf der feinstofflichen Ebene.
Neuer Zyklus, neue Energie
Kommt der Mond zwischen der Erde und der Sonne an, ist er für die Menschen auf der Erde unsichtbar. Bei Neumond befinden sich der Mond und die Sonne im gleichen Tierkreiszeichen. Die Energien sind auf einen Punkt konzentriert. «Deshalb gehen in dieser Phase besonders starke Impulse vom Mond aus», erklärt Eveline von Gunten. Dann beginnt für den Mond ein neuer Zyklus. Dieser steht auch für einen Neubeginn auf der mentalen Ebene. Jetzt ist die Zeit günstig für einen Neustart oder eine tief greifende Veränderung. Neue Ideen oder wichtige Geschäftstermine versprechen in der Phase des zunehmenden Mondes mehr Erfolg. Ist der Neubeginn gewagt, so unterstützt die Mondenergie das Vorhaben entsprechend. Der Mensch ist aufnahmebereit für die neuen Kräfte und Energien. u
Buchtipps
_ «Mondplaner 2013», Taschenkalender, Verlag Ludwig bei Heyne, 2012 _ Johanna Paungger, Thomas Poppe: «Vom richtigen Zeitpunkt», Anwendung des Mondkalenders, Südwest Verlag _ Claudia Graf-Khounani: «Das grosse Mondbuch», Gärtnern & Leben mit dem Mond, Bassermann Verlag _ Maria Thun, Matthias K. Thun: «Aussaattage 2013», Pflanz-, Hack- und Erntezeiten und günstige Arbeitstage für den Imker, Thun-Verlag
Surftipps _ www.natuerlich-online.ch/surftipps
An heiligen



Der erste Schritt beim Erkunden eines Kraftortes besteht darin, mit wachem Sinn wahrzunehmen, was da ist, welche Gebäude sich an dem Ort be nden, wo er lebendig wirkt, wie er in die Landschaft eingebettet ist. In Zürich sind es verschiedenste Kraftorte auf engstem Raum, die Stadt und See so einzigartig machen – sofern man gewillt ist, hinter die Kulisse der hektischsten aller Schweizer Städte zu schauen. Denn hier, wo unermüdlich gehandelt, spekuliert und konsumiert wird, gibt es Kleinode zu entdecken, wie kaum an einem anderen Ort. Krypten in kraftvollen Kirchen, Wunderbrunnen, heilige Steine, befestigte Hügel aus alter Zeit und – was kaum jemand weiss – geheimnisvolle untergegangene Inseln.
Wenn wir uns die Entstehung Zürichs vergegenwärtigen, wird klar, welche immense Bedeutung das Wasser – der See


und die Limmat – für die Siedler seit je hatte. Den Menschen, die hier lebten, war immer bewusst, dass der See und seine Lage in der Landschaft ihnen die entscheidende Lebensgrundlage bietet. Als stark von den natürlichen Gegebenheiten abhängige Menschen wussten sie sich mit der Natur verbunden. Gut nachvollziehbar ist daher, dass sie eine innige, religiöse Beziehung zum See und zum Fluss unterhielten, dem Wasser ihren Dank aussprachen und ihre Bitten an den See richteten. Wenn wir nun nach den Orten der Kraft Zürichs suchen, nden wir sie folgerichtig im oder ganz nahe beim Wasser.
Heilige Inseln im See
Im Arboretum, abseits des Verkehrs, können wir in Ruhe auf den See blicken und uns die Kultstätten vorstellen, die einst auf Inseln im See und an seinem Ufer lagen. Als vor 6000 Jahren hier Menschen siedel-


ten, lag der Wasserspiegel tiefer. Zwei Inseln ragten damals aus dem See: Die eine, von den Archäologen Kleiner Hafner genannt, lag unmittelbar vor dem Bellevue und war in der Jungsteinzeit in fünf verschiedenen Perioden bewohnt gewesen. Nur mehr die ältesten Fundschichten sind erhalten geblieben, alles Jüngere el der Ausbaggerung zum Opfer, mit der man im 19. Jahrhundert den Seeboden abtiefte.
300 Meter vom Ufer entfernt lag eine weitere Insel, Grosser Hafner genannt. Auch hier entdeckten die tauchenden Archäologen beeindruckende Funde.
Am Ufer des Sees und auf den Inseln lebten im 4. Jahrtausend vor Christus zuerst Menschen der Egolzwiler Gruppe, später solche, die der Cortaillod- und der Pfyner-Kultur angehörten. Sie bauten Brotgetreide, Äpfel, Birnen, P aumen, Kohl, Flachs und Mohn an und hielten Haustiere. Sie beherrschten die Webtech-



Wassern

Orte der Kraft gibt es in Zürich viele zu entdecken: heilige Wasser, Kultstätten und mythische Inseln, deren Geschichte bis in die Steinzeit zurückreicht. Eine Stadtwanderung der ganz besonderen Art.
Text Barbara Hutzl Ronge


nik und stellten spezialisierte Werkzeuge her. Wie gut sie damit umzugehen wussten, beweist der Fund eines Fragments eines menschlichen Schädels, der aufgebohrt worden war. Dem Patienten hatte diese Operation offenbar Linderung seiner Leiden verschafft, denn er hat sie um mehrere Jahre überlebt.
Die Archäologen gehen mittlerweile davon aus, dass die Cortaillod-Leute einer Kultur angehörten, in der eine Göttin als Spenderin allen Lebens verehrt wurde. Als Beleg für diese These dürfen wir in Zürich den Fund eines Gefässes ansehen, das eindeutig den Körper einer Frau nachbildet. Das feinwandige Brustgefäss wurde beim Kleinen Hafner gefunden.
Die weiblichen Brüste verbindet man noch heute mit der Fähigkeit der Frau, neues Leben zu nähren, mit Assoziationen von Glück, Fruchtbarkeit und gutem Gedeihen. Sehr gut vorstellbar ist daher, dass


das aufwendig gestaltete Gefäss im Rahmen eines Kultes zu Ehren einer Göttin verwendet wurde. Die Kraft des Nährens und des guten Gedeihens – welch schönes Motto für einen Kraftort im See.
Eine Gabe für die Götter
Nach der Jungsteinzeit nden sich für lange Zeit keine Belege mehr für Siedlungen am See. Eine neue Siedlungstätigkeit lässt sich erst wieder rund 2000 Jahre später, in der Bronzezeit, fassen. Zwischen 1050 und 850 vor Christus könnte eine Frau auf dem Grossen Hafner gelebt haben. Vielleicht kam sie aber auch nur auf die Insel, um dort eine Opfergabe niederzulegen. Archäologinnen fanden Reste einer fein verzierten Rindendose und hatten das besondere Glück, dass der Inhalt selbst nach 3000 Jahren noch an seinem Platz lag. Aus den vorgefundenen Glas-, Gagat-, Muschel- und Bernsteinperlen


und einem Zinnanhänger liess sich eine dreireihige Kette rekonstruieren. Ob die Insel ein heiliger Ort war, an dem sie ihren Schmuck bewusst als Opfergabe hingelegt hatte, wird ein Geheimnis bleiben. Möglich ist es sehr wohl.
Vor wenigen Jahren machte man auf der Insel einen Fund, der den Ort als rituell besuchten Kraftort ausweist. Archäologietaucher fanden Pfähle und Pfahllöcher in einer auffälligen Rundstellung, die auf das 2. Jahrhundert nach Christus datiert wurden. Auf dem Grossen Hafner stand damals also ein hölzerner Rundbau von 7,5 Meter Durchmesser. Man nimmt an, dass der Bau ein römischer Rundtempel war.

Die Menschen unterhielten eine innige Beziehung zum Wasser.


Funde aus dem Zürichsee des 4. Jahrtausends vor Christus.
Vom heiligen Wasser zum himmlischen Kraftort
Anreise
Vom HB Zürich mit Tram Nr. 11 bis Bürkliplatz, von dort knapp 10 Minuten zu Fuss bis zum Hafen Enge und dem Baumgarten Arboretum.
Alternative zwischen März und Oktober: mit dem Limmatschiff von der Haltestelle Landesmuseum bis zum Hafen Enge, Fahrplanauskunft unter Telefon 0848 988 988 oder unter www.zvv.ch. Im Sommer unbedingt Badezeug einpacken!
Wegbeschreibung
1. Etappe: Suchen Sie sich beim Hafen Enge einen schönen Platz, um sich auf den Kraftort am Zürichsee einzustimmen.
Vielleicht suchen Sie sich auch im Arboretum unter ehrwürdigen Bäumen eine Parkbank, um auf den See zu blicken, der selber ein uralter Kraftort ist, wie erstaunliche Funde der Kantonsarchäologen belegen.
2. Etappe: Dann gehen wir dem Ufer entlang zum Seeausfluss (von der Quaibrücke Überblick über die Topografie des Ortes, auf die «Kirchenfamilie» und den Lindenhof), anschliessend am rechten

Limmatufer bis zur nächsten Brücke, der Münsterbrücke. In der Vorhalle des Helmhauses befindet sich ein Brunnen, zu dem viele Jahrhunderte lang Menschen gepilgert sind, und der Eingang zur Wasserkirche. Hier birgt die Krypta einen alten Stein, einen Findling, der in der Legende der Zürcher Stadtheiligen eine wichtige Rolle spielt und bei dem der Sage nach auch Recht gesprochen wurde. Wahrscheinlich hatte der Stein auch schon bevor Felix und Regula in Zürich das Christentum verkündeten, eine kultische Bedeutung.
3. Etappe: Dann geht es die Treppe hinauf zum Grossmünster und in die Krypta, den zentralen Kraftort des Grossmünsters. Der Südturm bietet einen wunderbaren Blick über die Stadt und zeigt, wie das Münster architektonisch Erde und Himmel verbindet.
4. Etappe: Vom Grossmünster aus folgen wir dem mittelalterlichen Pilgerweg an der Wasserkirche vorbei und über die Münsterbrücke zum Fraumünster. Hier ist der Chorraum der Kraftort, den Marc Chagall mit seinen Fenstern auf ganz wundervolle Weise bereichert hat. Wir verlassen die Kirche durch das Ostportal, wenden uns nach rechts und betreten durch das schmiedeeiserne Portal den Fraumünsterhof mit seinem Kreuzgang.
5. Etappe: Wir spazieren flussabwärts der Wühre entlang bis zum Weinplatz, durch die Thermengasse (schmaler Eingang links vom Spielzeuggeschäft Pastorini) hinauf zur St.-Peter-Hofstatt, dem ältesten Kulthügel der Stadt. In Richtung Buchhandlung Beer gehen wir nach links die Strehlgasse hinunter und steigen dann durch die Pfalzgasse hinauf auf den Lindenhof, einen befestigten Hügel mit grossartiger Aussicht auf die Limmat und die an ihrem Ufer gelegenen Häuserzeilen sowie den Zürichberg. Hier beschliessen wir unsere Kraftortwanderung.

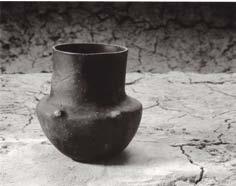
Inseln waren oft Kraft- und Kultorte.
Ausgehend von dieser Annahme fragt man sich, wer darin verehrt worden sein könnte. Rundtempel wurden im römischen Kult bevorzugt den Göttinnen Vesta und Diana, dem Gott Merkur und dem vergöttlichten Helden Herkules erbaut. Vesta, die Göttin des Feuers, ausgerechnet mitten im Wasser zu verehren ist eher unwahrscheinlich. Diana, der Göttin der Jagd, auf einer Insel zu huldigen, auf der es keine Jagd geben kann, erscheint ebenso wenig sinnvoll. Sehr passend für Zürich und für den Grossen Hafner wäre aber die Verehrung Merkurs, denn er ist der Gott des Handels und der Verkehrswege. Schiffer, die nach Zürich kamen, hätten ihm für geglückte Fahrt danken, diejenigen, die von hier aufbrachen, ihn um gute Fahrt bitten können. Auch die Fuhrleute, die Händler und Zöllner standen unter Merkurs Schutz. Sie hätten in der erfolgreichen Handelsniederlassung Zürich viele Gründe gehabt, ihrem Gott einen Rundtempel zu errichten.
Der Blick in die Vergangenheit mittlerweile verschwundener Inseln im Zürichsee zeigt, dass Menschen seit Jahrtausenden Inseln für ihre Kulthandlungen gewählt haben. Und er lässt vermuten, welche Kräfte in und um den See mehr oder weniger verborgen bei einer Stadtwanderung noch zu entdecken sind. ◆
Wettbewerb und Leserangebot
Gewinnen Sie
eines von drei Paaren wohlig warmen Winterschuhen im Wert von je Fr. 230.–; warme und trockene Füsse selbst bei klirrender Kälte garantiert der MAMMUT Blackfin TL
Dieser bequeme Winterschuh mit dem flauschigen Fleecefutter ist der perfekte Begleiter in der kalten Jahreszeit – er eignet sich für die Schneeschuhtour oder eine Winterwanderung ebenso gut wie für eine flotte Schlittelpartie. Sogar in der Stadt macht man mit dem MAMMUT Blackfin TL bei Schnee und Matsch eine gute Figur. Dank der speziellen Schnürung ist der Schuh blitzschnell geschnürt – selbst mit dicken Handschuhen. Dank integrierter Metallpartikel sorgt die Sohle für einen sicheren und griffigen Tritt auf Schnee und Eis.
Mehr Infos unter www.mammut.ch



Damen



Herren




Als Zusatzpreis gibt es dreimal zwei Paare Socken X-SOCKS Trekking Silver
Wettbewerbsfrage

A: Bäcker
B: Hafner
C: Wagner








Wie nennen die Archäologen die beiden mythischen Inseln im Zürichsee? Grosser und Kleiner

Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.











So nehmen Sie am Wettbewerb teil: Mit unten stehendem Bestellcoupon oder gratis im Internet unter www.natuerlich-online.ch/wettbewerb
• Claudia Achermann, 6006 Luzern black white-plum black-beige




Wir gratulieren!
Auflösung aus Heft 11-2012: B: 1911


Je eine Light & Motion Solite 100 Stirnlampe haben gewonnen:
• Bettina Gabathuler, 9477 Trübbach
• Claudia Ryf, 4051 Basel


Leserangebot

Das Buch «Magisches Zürich – Wanderungen zu Orten der Kraft» bietet 24 detailliert beschriebene Wanderungen in Stadt und Kanton. Entdecken Sie magische, heilige Quellen, erkunden Sie Chindlisteine, Menhire und verborgene Steinreihen und streifen Sie durch geheimnisvolle Wälder zu uralten, sagenumrankten Bäumen und Höhlen. Über den reichen Sagenschatz hinaus präsentiert die Autorin ein historisch gründlich recherchiertes Bild der spirituellen Geschichte der einzelnen Kraftorte und lässt längst versunkene Heiligtümer vor dem inneren Auge der Leser entstehen.
Bestellcoupon Leserangebot












Bestellen Sie das Buch aus dem AT-Verlag zum Vorzugspreis von Fr. 32.90 statt Fr. 39.90
Senden Sie mir: «Magisches Zürich» à Fr. 32.90, inkl. MwSt. und Versandkosten. Zudem nehme ich automatisch am Wettbewerb teil.
Wettbewerbslösung: A: Bäcker B: Hafner C: Wagner
Name Vorname
Strasse/Nr. PLZ/Ort
Datum Unterschrift
Wenn ich einen MAMMUT Blackfin TL-Schuh im Wert von CHF 230.– gewinne, brauche ich folgende Schuhgrösse und wünsche mir folgende Farbe:
Damen: 37 37½ 38 38½ 39 40 40½ 41 42 42½ white-plum black-beige
Herren: 37 37½ 38 38½ 39 40 40½ 41 42 42½ 43 43½ 44 45 45½ 46 47 48 black Falls ich X-SOCKS gewinne, brauche ich folgende Sockengrösse: 35–38 39–41 42–44 45–47
Das Leserangebot ist gültig bis 28. Februar 2013 und gilt nur für die Schweiz. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Januar 2013. Coupon einsenden an: AZ Fachverlage AG, Lesermarketing, «Magisches Zürich», Postfach, 5001 Aarau







Markt








Dürfen wir vorstellen : Das sind Froschkönig Fredi und Froschkönigin Fiona – kuschelige « Chriesisteikissen », hergestellt in einer geschützten Schweizer Werkstätte. Die beiden erfreuen nicht nur Kinderherzen und können je nach Gelegenheit kühl oder wohlig warm verwendet werden. Die farbenfrohen Frösche gibt es zusammen mit vielen weiteren Sachen bei Dreierlei, dem Online-Shop mit ausschliesslich in der Schweiz hergestellten Produkten aus den Bereichen Kinderspielwaren, Geschenkartikel und Lebensmittel.
Mehr Infos unter www.dreierleiladen.ch.
Hirse macht Haustiere happy
Rund die Hälfte aller Hunde und Katzen haben Probleme mit Haut und Fell und fühlen sich entsprechend unwohl. Hirseöl enthält einen besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, davon am meisten Omega 3 und 6. Das Öl nährt und pflegt Haut und Haar. Die Schweizerische Schälmühle E. Zwicky AG, die auf Hirseverarbeitung spezialisiert ist, lanciert die Linie AniBelle mit Produkten für das Haustier. Die aufbauende Wirkung des Hirseöls ist nach einer 3-monatigen Kur deutlich sichtbar. AniBelle gibt es als Kapseln oder Sticks. Sie sind die ideale Ergänzung zum bewährten Hunde- und Katzenfutter.
Weitere Infos unter www.anibelle.ch


Bierhefe für lückenlose Ernährung


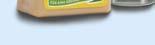
Alltagshektik im Beruf oder privat führt immer häufiger zu Stresssituationen und die Betroffenen an die Leistungsgrenzen. Die beste Gegenwehr ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung. Dazu gehört die cellulär-flüssige Bierhefe Panaktiv von Dr. Metz. Sie enthält wichtige bioaktive Wirkstoffe und ist besonders reich an der ganzen Vitamin B-Gruppe, B1, B2, B6 und B12. Panaktiv sorgt für geregelte Verhältnisse in der Darmflora und unterstützt das Immunsystem. Bierhefe Panaktiv ist erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Weitere Infos unter www.vitalprodukte.ch, Direktversand bei Rossi-Venzi AG, 7550 Scuol, Tel. 081 864 11 74


Eine Mitgliedschaft für Ihre Gesundheit!
Der Schweizerische Verband für Natürliches Heilen SVNH setzt sich für die Anliegen im Bereich natürliches Heilen bei Politik und Öffentlichkeit ein. Er fördert das natürliche Heilen als Ergänzung oder Alternative zu schulmedizinischen Methoden sowie zur Gesundheitsvorsorge. Im 2013 feiert der SVNH sein 30-Jahre-Jubiläum – ein neuer Auftritt, eine moderne Website und ein Newsletter sind nur einige der Instrumente, mit denen sich der SVNH den Herausforderungen der Gesundheitslandschaft stellt. Unterstützen auch Sie die Anliegen des SVNH, werden Sie Mitglied. Für Fragen und weitere Informationen sind wir gerne für Sie da. Weitere Infos unter www.svnh.ch, Telefon 031 302 44 40

Markt
TSL – die neue Generation Schneeschuhe
Die neuste Innovation von TSL Outdoor lässt glatt vergessen, dass man einen Schneeschuh trägt. Das patentierte Up-and-Down-System steht für einzigartigen Laufkomfort. Es gleicht die Hangneigung bei Auf- und Abstieg aus und entlastet so die Beinmuskulatur. Der TSL Access gibt sichere Haftung in steilem Gelände und bei Querungen. Die Bindungslänge wird mit einem Handgriff angepasst und die Fersenbindung mittels Ratsche bequem und präzise eingestellt. Erhältlich im Sportfachhandel.
Weitere Infos unter www.proimport.ch

Sie werden kochen vor Freude









Tim Bird – Nostalgiespielzeug aus den 70ern
Bei dem Spielzeugvogel Tim Bird von HCM Kinzel wirken dieselben physikalischen Gesetze von Vor- und Auftrieb wie bei einem echten Vogel. Tim Bird fliegt ohne Batterien : Einfach mit einer Kurbel den Gummi am Bauch des Vogels zwirbeln – so wird der Motor aktiviert. Jetzt noch einen Hebel drücken und den Vogel hoch in die Luft werfen. Tim Bird fliegt bis zu 50 Meter weit und ist mit einer Spannweite von 40 Zentimetern so gross wie ein Mauersegler. Mit dem verstellbaren Schwanz lässt sich die Flugrichtung steuern. Ein Riesenspass für Gross und Klein.
Mehr Infos unter www.hcm-kinzel.eu
Chriesi-Trüffe und Yakwurst, Bio-Nusstorte und ein Destillat aus Edelweiss sind vier der über 130 Produkte aus den Schweizer Bergen im E-Shop Vrenelis Gärtli. Produzenten aus den Schweizer Bergregionen verkaufen unter dem Motto
« Mit gutem Gewissen geniessen » direkt ab Hof Feines, Währschaftes und Authentisches. Sie geniessen hochwertige Lebensmittel und Sie unterstützen die Bergbevölkerung: Denn die Wertschöpfung bleibt in den Schweizer Berggebieten. Es braucht keine langen Wege zu den Köstlichkeiten. Die Post liefert bequem direkt nach Hause.
Weitere Infos unter www.vrenelis-gaertli.ch

Leserangebote




Ordnung muss sein


Filzkorb Zipp « weiss »
Vitamine pur
Fresh Juice
Starten Sie und Ihre Familie jeden Morgen mit frisch gepressten und vitaminreichen Fruchtsäften in den Tag. Der professionelle Entsafter von Trisa macht dies möglich. Das Fruchtfleisch und der Saft werden automatisch voneinander getrennt. Ausserdem ist der Fresh Juice kinderleicht zu reinigen.
● grosse Öffnung für ganze Früchte
● Saftbehälter 0.5 Liter
● Leistung: 500 Watt
● Masse: L 26 × B 17 × H 41 cm
Aktionspreis Fr. 79.– statt 129.–38%
Rabatt für Abonnenten
Dieser trendige Filzkorb eignet sich zum Aufbewahren von Kartoffeln sowie als Frühstückskorb oder als Ordnungshüter.
Das Ober- und Unterteil des Korbes ist mit einem raffinierten Reißverschluss-System verbunden, das formal wie funktional im Fokus steht. Das Oberteil aus Baumwolle lässt sich jederzeit wechseln. Ein trendy Korb zum Verschenken oder für Sie selber.
Aktionspreis Fr. 39.90 statt Fr. 49.90


20%



Gratis dazu!


Rabatt für Abonnenten über 26%
Rabatt für Abonnenten

Genussvoll frühstücken Wasserkocher von Graef
Begrüssen Sie den Tag mit einem perfekt aufgebrühten Tee oder Heissgetränk. Das ultimative an diesem Edelstahl Wasserkocher von Graef ist, Sie können verschiedene Temperaturen des Wassers einstellen von 70, 80 bis 90 Grad. Stellen Sie für jeden Tee die richtige Brühtemperatur ein. Sie erhalten gratis ein Twinings Selection Pack mit 5 × 5 Teesorten dazu.
● Herausnehmbarer Kalkfilter
● Automatische Abschaltung
● Trockengeh- und Überhitzungsschutz
● Füllmenge 1,5 Liter
Aktionspreis Fr. 109.– statt Fr. 149.–
Geniesen mit Freunden
Raclette Connect
Von jetzt an haben Sie kein Platzproblem mehr, wenn Sie eine Racletteparty veranstalten. Das Raclette Connect von Trisa ist variabel einsetzbar. Entweder nur als 2er
Raclette oder für vier Personen. Wenn Sie jedoch mehrere Gäste erwarten, lässt er sich bis auf 16 Personen erweitern.
● Inkl. Pfännchen und Spachtel antihaftbeschichtet
● Platten separat beheizbar
● Multifunktionalplatten für Grill- und Crêpeplausch
● Erhältlich in vier Ausführungen, individuell zusammen steckbar


« for 4 »
«natürlich»
Abonnentenpreis
Aktionspreis für
Raclette Connect « for 2 » Fr. 59.– statt Fr. 99.–
Raclette Connect « 2 plus 2 » Fr. 89.– statt Fr. 129.–
Raclette Connect « for 4 » Fr. 89.– statt Fr. 129.–
Raclette Connect « 4 plus 4 » Fr. 149.– statt Fr. 169. –







« for 2 »
Schnell bestellen und profitieren!


➜ Online: www.natürlich-online.ch/leserangebote Telefon 071 274 68 72 oder einfach Coupon einsenden!
Ja, ich möchte profitieren und bestelle folgende Angebote:
❍ Ich bin «natürlich»-Abonnent /-in und bestelle zum Vorzugspreis
❍ Ich möchte Abonnent /-in von «natürlich» werden und profitiere vom Preisvorteil! Ich bestelle ein Jahresabonnement zum Preis von Fr. 84.– 1301E01
❍ Ich bin Nichtabonnent /-in und bestelle zum Normalpreis
___ St. Entsafter Fresh Juice für nur Fr. 79.– anstatt Fr. 129.– * 30198
___ St. Filzkorb Zipp « weiss » für nur Fr. 39.90 statt Fr. 49.90 * 30199
___ St. Wasserkocher Graef für nur Fr. 109.– anstatt Fr. 149.– * 30197
___ St. Raclette Connect « for 2 » für nur Fr. 59.– anstatt Fr. 99.– * 10931
___ St. Raclette Connect « 2 plus 2 » für nur Fr. 89.– anstatt Fr. 129.– * 10932
___ St Raclette Connect « for 4 » für nur Fr. 89.– anstatt Fr. 129.– * 10933
St. Raclette Connect « 4 plus 4 » für nur Fr. 149.– anstatt Fr. 169.– * 10934
Angebot gültig bis 28. Februar 2013, solange Vorrat. Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt. und vRG, zuzüglich Fr. 8.- Verpackung und Porto. Bestellwert ab Fr. 150.– portofrei.
Vorname
Name
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Telefonnummer
Datum und Unterschrift
Coupon einsenden an: «natürlich», Leserangebote, Postfach, 9029 St. Gallen
Rückgaberecht: Für alle ungebrauchten Artikel garantieren wir ein 14-tägiges Rückgaberecht nach Erhalt der Ware. Sollte die Ware bei der Rücksendung ( in der Originalschachtel ) Spuren von Benutzung oder Beschädigung aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzanprüche geltend zu machen.
Lesen_ Milch – Vom Mythos zur Massenware
Leben
ilch ist so alltäglich, dass sich kaum jemand gross Gedanken zu diesem Lebensmittel macht. Die Autorin Andrea Fink-Keßler ging der Geschichte der Milch nach: ihrer Symbolik, ihrem Stellwert als elementarste und erste Nahrung des Menschen, ihrer kulturellen und religiösen Bedeutung und ihrem Dasein als industrialisiertes Naturprodukt. Eine lehrreiche, spannende und teilweise auch betrübliche Geschichte.



Kurioses aus der Wissenschaft_ Macht Schokolade schlau?





S Andrea Fink-Keßler: «Milch. Vom Mythos zur Massenware», Oekom bei Hanser, 2013, Fr. 27.90





Nobelpreise korrelieren, und kam – nachdem er die
chweizer verspeisen pro Kopf und Jahr fast 12 Kilogramm Schokolade und sind somit Weltmeister im Schoggiessen. So die Statistik. Die Statistik weiss zudem, dass die Schweiz überdurchschnittlich viele Nobelpreisträger stellt. Deshalb hat sich der in den USA lebende Schweizer Kardiologe Franz H. Messerli die Frage gestellt, wie Schokoladekonsum und eingeheimste Nobelpreise korrelieren, und kam – nachdem er die Daten verschiedener Länder miteinander verglichen hatte – zum Schluss, dass da ein Zusammenhang bestehen muss. Seinen Berechnungen nach braucht es vier Tafeln Schokolade pro Kopf und Jahr, um einen Nobelpreisträger auf 10 Millionen Einwohner zu generieren, schreibt «Ars Medici». Dass Schweden der einzige Ausreisser in der Statistik ist, bestätigt entweder die Ausnahme der Regel oder aber ist Indiz dafür, dass im Heimatland des Nobelpreises das Komitee nicht ganz unbefangen ist. Messerli will seine Hypothese jedenfalls mittels einer kontrollierten Studie überprüfen. Schokolade essen und dran bleiben, nden wir. tha
➜ Die App







Per Velo Städte zu erkunden, macht Spass. Ohne Ortskenntnisse kann das aber auch ganz schön nervenaufreibend sein. Statt mühsam im Stadtplan zu blättern, gibt es jetzt Apps fürs Smartphone. Die Idee stammt von österreichischen Velokurieren.










Fahrradkuriere kennen nicht nur die schnellsten, sondern auch die sichersten und schönsten Wege, um ans Ziel zu kommen. Mittlerweile sind im BikeCityGuide über 30 Städte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und anderen europäischen Ländern vertreten. Ein Navi fürs Velo, das einen ott ans Ziel bringt.
www.bikecityguide.org

Geduld hat mit Vertrauen zu tun
Selbstkontrolle und Geduld sind keine angeborene Fähigkeiten. Wesentlich sind die (positiven) Erfahrungen, die als Kind gemacht werden.

Geduld ist nicht jedermanns Sache. Bislang ging man davon aus, dass Geduld ein angeborener Charakterzug sei. Nun haben Psychologen den klassischen «Marshmallow-Test» aus den 1960er-Jahren überarbeitet und sind zum Schluss gekommen, dass Kinder geduldiger sind, wenn sie zuvor positive Erfahrungen gemacht haben. Oder anders: wenn es sich lohnt. Die Forscher sprechen von «zuverlässigen» und «unzuverlässigen» Situationen. «Auf Belohnung warten zu können, spiegelt nicht nur die Fähigkeit eines Kindes zur Selbstkontrolle, es zeigt auch seinen Glauben an den praktischen Sinn des Wartens», berichtet Celeste Kidd, Hauptautorin der Studie, wie wissenschaft-aktuell.de schreibt. «Das Aufschieben einer Belohnung ist nur dann eine vernünftige Entscheidung», so die Kognitionsforscherin, «wenn das Kind glaubt, dass es nach akzeptabler Wartezeit tatsächlich ein zweites Marshmallow bekommt.» Getestet wurden drei- bis fünfjährige Buben und Mädchen. In zwei Versuchen konnten die Kinder entscheiden, ob sie ein paar Minuten warten wollten, um mehr Buntstifte und später mehr Aufkleber zu bekommen, oder ob sie sich mit den bereits vorhanden Spielsachen begnügen wollten. Beide Male wurden nur die Kinder aus der Gruppe «zuverlässige Umgebung» mit den versprochenen Sachen belohnt. Der anderen Gruppe wurde gesagt, dass es die Belohnung nun doch nicht gäbe. Im dritten Versuch dann hatten die Kinder lediglich ein Marshmallow auf dem Tisch. Es wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass sie einen zweiten bekommen, der jedoch zuerst geholt werden müsse. Wie lange dies dauert, wurde nicht gesagt. Das Ergebnis war eindeutig: Die Kinder, die zuvor nicht belohnt wurden, warteten durchschnittlich drei Minuten. In der anderen Gruppe betrug die Wartezeit im Schnitt 12 Minuten. Einige spielten mit der Süssigkeit, andere verdeckten ihre Augen oder versuchten zu schlafen, um der Versuchung zu widerstehen. Für die Forscher ist klar: Schon kleine Kinder verlieren ihr Vertrauen, wenn das Umfeld nicht verlässlich ist und Versprechen nicht gehalten werden. Diese kindlichen Erfahrungen prägen das Erwachsenenleben, man ist eher ungeduldig. tha








Kommunikation
Smartphones und Tablet-PCs machen das Leben schneller, komplexer – einsamer. Und auch das Gehirn wandelt sich mit dem digitalen Druck, es wird unfrei und dumpf. Ein Plädoyer für einen besonnen Umgang mit neuen Medien.


Kommunikation total

Erinnern Sie sich noch an das sphärische, gurgelnde Geräusch beim Einwählen mit einem Modem? Man checkte E-Mails, loggte sich danach aus und machte dann wieder etwas anderes. Seit wir via Smartphone und TabletPC ständig mit dem Internet verbunden sind, haben wir uns weitgehend vom analogen Leben verabschiedet, und das rasend schnell. Viele von uns verbringen mehr Zeit vor Bildschirmen als mit der Familie und mit Freunden. Wir schenken dem Handy mehr Aufmerksamkeit als den Menschen, die uns umgeben. Wir reden auch nicht mehr miteinander. Wir nehmen die Umwelt und unser direktes Gegenüber kaum wahr. Stattdessen tippen, chatten, mailen und gamen wir. Facebook-Freunde, Chat-Partner, Avatare (selbst kreierte, künstliche Figuren) – wir haben ständig einen Grund, online zu sein. Gesimst wird selbst bei Beerdigungen. Und beim Autofahren, obwohl jeder weiss, dass das gefährlich ist.
Reden? Nein danke!
«Mit der ständigen Erreichbarkeit geht die Angst einher, einmal nicht erreichbar zu sein – eine Art Panik», schreibt die Kulturwissenschaftlerin Sherry Turkle in ihrem Buch «Verloren unter 100 Freunden. Wie wir in der digitalen Welt seelisch verkümmern». Turkle hat die Auswirkungen der Digitalkultur schon untersucht, als die meisten Menschen noch mit der Schreibmaschine getippt haben. Sie galt lange als grosse Freundin jeder neuen Technologie – mittlerweile kritisiert die Wissenschaftlerin die Vereinsamung, die permanentes Starren auf das Smartphone mit sich bringe.
Vereinsamung? Nicht nur Teenager versenden und empfangen mehrere Hundert Nachrichten – pro Tag. Genau das sei Teil des Problems, meint Turkle. «Die
Möglichkeit, nie allein sein zu müssen, verändert unsere Psyche. In dem Augenblick, in dem man allein ist, beginnt man sich zu ängstigen und greift nach dem Handy. Alleinsein ist zu einem Problem geworden, das behoben werden muss.» Wenn wir aber unser Leben weitgehend in Echtzeit übermitteln, so Turkle, kompromittieren wir unsere Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Sehnsucht nach Verbundenheit
Wohlgemerkt, Computer und das Internet sind fantastische Erfindungen. Man erledigt Korrespondenz müheloser, findet im Web zahllose Bildungsangebote und seriöse Informationen; man kann bequem einkaufen und spannende Spiele spielen. Und man bleibt dank sozialer Netzwerke und E-Mail leichter in Kontakt mit Freunden und Angehörigen, selbst wenn diese physisch weit weg sind. Facebook und Co. ermöglichen es, mit einer grossen Zahl von Menschen gleichzeitig in einer gefühlten Verbindung zu stehen. Und die Sehnsucht nach Verbundenheit – die hat wohl jeder Mensch. Online-Erfahrungen können beim Erwachsenwerden helfen, schreibt selbst Kritikerin Turkle. «In der Virtualität entwickeln manche Fähigkeiten, die sie in der Realität nutzen können.» Viele bauen sich einen Avatar, der sexy, elegant und selbstbewusst ist – die Verkörperung einer Art von Ideal-Ich, das mit einem selbst oft wenig gemein hat. Doch diese Fantasievorstellungen sind nicht der Kern des Problems. Vielmehr geht es um den Stellenwert, der der virtuellen Welt eingeräumt wird. Oder, um Paracelsus zu bemühen: «Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.» Denn wenn wir immer online und erreichbar sind, immer bei der Arbeit, immer am Kommunizieren, dann verpassen wir das eigentliche Leben.
Die Grundlagen unserer Gesellschaft sind in Gefahr. Wir klicken uns das Gehirn weg.
Manfred Spitzer, Neurologe und Autor von «Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.»
Tipps für mehr Lebenszeit
1. Üben Sie sich in Achtsamkeit («natürlich» 09 -11): Der erste Schritt zur Veränderung besteht im Entwickeln der Fähigkeit, nicht einfach draufloszureagieren, sondern innezuhalten und nachzudenken.
2. Lesen Sie Ihre E-Mails seltener, gezielter und bewusster, zum Beispiel um 10 Uhr und 17 Uhr.
3. Machen Sie sich zeitliche Vorgaben für das Leben im Internet – und halten Sie sich daran.
4. Auszeit nehmen: Machen Sie öfters eine mediale Fastenzeit, etwa an Wochenenden oder im Urlaub. Schalten Sie auch zwischendurch auf den Flugmodus.
5. Üben Sie sich in Monotasking. Widmen Sie sich mit voller Konzentration und allen Sinnen einer Sache.
6. Lesen Sie ein Buch oder die Zeitung analog. Das Lesen am Bildschirm verleitet einen immerfort, woanders hinzuschauen. Man wird abgelenkt durch Werbebanner, E-Mails, Facebook, MySpace, Twitter und so weiter.
7. Sport und frische Luft – das tut gut und führt uns wieder zurück in den Körper.
8. Führen Sie ein Tagebuch. Und schreiben Sie – von Hand – Briefe. Bewusst und von Herzen. Nehmen Sie sich Zeit dafür – so zeigen Sie Wertschätzung dem anderen gegenüber.
Auf immer und ewig
Die Wissenschaftlerin Turkle rät: «Wir sollten uns wieder an die Vorzüge des Alleinseins, der Langsamkeit und des Lebens im Augenblick erinnern. Um Alleinsein zu erfahren, muss man fähig sein, in eine Beziehung zu sich selbst zu treten; ansonsten ist man einfach nur einsam.» Kommt hinzu, dass gerade Kinder und Jugendliche oft sorglos mit privaten Informationen umgehen. Mit kostenlosen Kinderschutzprogrammen ist es zwar möglich, den Account eines Kindes so einzurichten, dass die Nutzungsdauer minutengenau festgelegt werden und jugendgefährdende Seiten nicht angeklickt werden können. Aber, und das ist vielen nicht bewusst: Das Internet vergisst nichts. Alles, was wir jemals auf Facebook geschrieben oder auf Google gesucht haben, hinterlässt unauslöschliche Datenspuren. Für Computer-Pionier Gordon Bell korrespondiert ein solches «Lebensarchiv» mit dem menschlichen Wunsch nach Unsterblichkeit, der uralten Sehnsucht, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Und Mark Zuckerberg, Erfinder und CEO von Facebook, sagt: «Privatsphäre ist irrelevant.» Das Ziel von Facebook ist offenbar, den Menschen völlig durchsichtig und berechenbar zu machen. Doch so wird er letztlich belanglos. Denn irgendwann werden wir von jedem alles wissen, aber niemanden mehr wirklich kennen, geschweige denn verstehen.
Implosion der Informationen
Es ist ein urmenschliches Bedürfnis, gehört zu werden, Anerkennung zu finden und Erlebnisse zu teilen. Klatsch und Tratsch gibt es seit Menschengedenken. «Aber das ist uns davongaloppiert, wir haben die Kontrolle verloren. Wenn man 500 Facebook-Freunde zu bedienen versucht, dann wird man verrückt», sagt Nina Pauer, Autorin von «Wie wir vor lauter Facebook das Leben verpassen». In der Flut, so Pauer, werde die einzelne Nachricht und der einzelne «Freund» nichtig. Unser Nervensystem aber reagiert auf jede Nach-
9. Ihnen fehlt die Disziplin? Dann tauschen Sie am besten Ihr Smartphone gegen ein «normales» Handy und verbannen so das Büro aus ihrer Hosentasche. «Wahre Herren verfügen über ihre Zeit, ständig erreichbar sind nur Sklaven.»
Anita Eggler, Autorin von «E-Mail macht dumm, krank und arm.»
Die ganze Welt im Handy – doch das Leben findet draussen statt.
richt, die wir bekommen, mit einem Dopaminstoss. Hirnforscher Manfred Spitzer schreibt in seinem Buch «Digitale Demenz»: «Tief im Gehirn sitzt eine Ansammlung von Nervenzellen, die für Glücksgefühle zuständig sind. Diese Zellen werden aktiviert, wenn etwas unerwartet Positives geschieht.» Der Botenstoff Dopamin spielt dabei eine wichtige Rolle. Schon lange ist bekannt, dass praktisch alle süchtig machenden Stoffe dieses Zentrum aktivieren. Seit mehr als einem Jahrzehnt wisse man, dass dieses Suchtzentrum auch durch digitale Medien aktiviert werde, so Spitzer. Forscher der Universität Chicago bestätigen das Suchtpotenzial: Bei einer Studie mit jungen Facebook-Nutzern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren fanden sie heraus, dass ein Mehr der Probanden bereit ist, Alltagsdinge zugunsten von Facebook zu vernachlässigen. Lediglich der Wunsch nach Schlaf und Sex sei grösser, als das Bedürfnis sich im Internet einzuloggen. Es sei für viele Menschen schwieriger, sich von Facebook fernzuhalten, als von Zigaretten oder Alkohol, erklärte der Studienleiter gegenüber dem «Guardian». Hinzu kommt: Eine ganze Reihe von weiteren Studien zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und der Internetnutzung. Die Krux: Der Mensch gewöhnt sich rasch an die positive Stimulation durch SMS-Botschaften und andere digitale News. Wir verlangen danach, selbst wenn es uns erschöpft; manche Menschen fühlen sich nach dem Versenden einer Nachricht, so lange unwohl, bis sie eine Antwort darauf erhalten. «Vor lauter Kommunizieren verpassen wir das Leben. Wir sind fahrig, hektisch und nervös geworden und merken es nicht einmal. Wir müssen wieder Verantwortung für unseren Geisteszustand übernehmen. Dazu müssen wir lernen, unsere Geräte zu beherrschen. Net-Balance – darum geht es heute», sagt Buchautorin Pauer.
Multitasking ist gefährlich Schüler, die Hausaufgaben machen, beschäftigen sich häufig gleichzeitig mit Facebook, Twitter, Musik, Online-Spielen,

Textnachrichten, Videos und Instant Messaging. Bis vor Kurzem galt Multitasking als die entscheidende Fähigkeit für erfolgreiches Arbeiten und Lernen im digitalen Zeitalter. Heute weiss man jedoch, dass Multitasker bei keiner der Aufgaben, die sie erledigen, richtig gut sind. Multitasking fühlt sich aber gut an. Der Körper schüttet dabei chemische Substanzen aus, die ein «Multitasking-Hoch» erzeugen. Dieses Hoch suggeriert den Multitaskern, sie seinen besonders produktiv. Dabei können Multitasker sich sogar schlechter auf mehrere Dinge zugleich konzentrieren als andere, sagen sowohl Kulturwissenschaft-
lerin Turkle als auch Hirnforscher Spitzer. Sie erledigen zwar vieles parallel, aber sie machen dabei auch mehr Fehler. Unser Gehirn ist schlicht nicht für Multitasking geschaffen, erklärt Hirnforscher Spitzer. Die permanente Informationsflut ruiniere unseren Stirnlappen. Dort sitzen Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbstkontrolle –die Grundlagen für das Arbeitsgedächtnis. Gerade für Kinder und Jugendliche kann das zum Problem werden. Bei ihnen ist der Stirnlappen noch nicht ausgereift. Sie lassen sich also schneller ablenken. «Die Gefahr, den ständigen Verlockungen zu erliegen und somit Aufmerksamkeitsstörungen
zu entwickeln und süchtig zu werden, ist umso grösser», sagt Spitzer.
Klicken wir uns das Hirn weg?
Spitzers Buch ist gewiss polemisch und effekthascherisch provokativ geschrieben. Aber was der Forscher uns da präsentiert – mit zig wissenschaftlichen Studien untermauert –, sollten wir schon ernst nehmen. Unser Gehirn degeneriert, wenn wir seine Aufgaben ständig delegieren, so Spitzer. «Was wir früher mit dem Kopf gemacht haben, wird heute von Computern, Smartphones, Organizern und Navis erledigt. Das Outsourcing von Hirntätigkeit führt zu einem schleichenden Gedächtnisverlust: Nervenzellen sterben ab, nachwachsende Zellen überleben nicht, weil sie nicht genutzt werden. Besonders dramatisch zeige sich dieser Prozess bei Kindern. Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen und Depressionen, Übergewicht und Gewaltbereitschaft seien die Folgen.
Neurologen und Pädagogen sind sich weitgehend einig, dass die beste Investition in die Kinder Zeit und Zuwendung sind und nicht die Überversorgung mit elektronischem Spielzeug. Damit sich der Mensch gesund entwickeln kann, muss er Dinge sehen, riechen, anfassen können und sich möglichst dabei bewegen. Das gilt übrigens auch für Erwachsene. Wir alle sollten öfters einmal die Geräte ausschalten und raus in die Natur – woher wir kommen, wohin wir gehören. u


«Hört Ihr Leut, unsre Glock hat
Einst sorgten Nachtwächter für Ruhe und Ordnung hinter den Stadtmauern. Was sie bei ihrer Arbeit erlebten und wie sie schliesslich durch Polizeidiener ersetzt wurden, erfährt man auf einem historischen Rundgang.
Text Rita Torcasso
rüher hätte er das Gesindel, das um diese Zeit noch unterwegs war, festnehmen müssen. Heute führt der Nachtwächter eine Gruppe von 30 Personen durch die nächtliche Zürcher Altstadt. Gekleidet ist er mit einem weiten schwarzen Umhang und Kniehosen mit weissen Strümpfen, auf dem Kopf trägt er einen Dreispitzhut. Hellebarde, Laterne und ein Horn runden das mittelalterliche Bild ab. Unterwegs in den engen Gassen der Altstadt erzählt Martin Harzenmoser anschaulich von Säufern, randalierenden Studenten und drakonischen Strafen; und vom schwierigen Leben der Nachtwächter damals.

Ein unehrenhafter Beruf Nachtwächter gibt es seit dem Entstehen der Städte in der Schweiz. In Zürich drehten 1336 die ersten ihre Sicherheitsrunden, als auch das Zunftwesen eingeführt wurde. Anfangs wurde die Wache Zunftmitgliedern anvertraut. Doch diese rekrutierten für wenig Geld arme Schlucker aus den umliegenden Dörfern. 1621 hält das Ratsprotokoll fest, dass «schier keyner der Burgeren syn Wacht selbst vertäte, sondern die Knecht und Hintersassen dahin schickt».

Ab 1667 wurden die Nachtwächter von der Stadt besoldet; um die 20 Nachtwächter sorgten damals für Ruhe und Sicherheit. Zu ihren Aufgaben gehörten, Feuer zu melden, Diebe und Feinde aufzuspüren, die «Überhöckler» aus den Wirtshäusern zu vertreiben und Ruhestörer nach Hause zu schicken. Um halb neun Uhr wurden die sieben Tore der Stadt geschlossen, um neun Uhr war Sperrstunde. Wer sich nicht an Ruhe und Ordnung hielt, landete im Turm. Dort ging es rau zu und her: Fluchenden wurde die Zunge angenagelt, Lügnern der Schwur nger abgeschlagen und Ehepaare, die sich stritten, wurden so lange in eine Zelle gesteckt, bis sie Frieden machten.


Das stehe in den «Frevelbüchern», in welchen Missetaten seit dem 14. Jahrhundert aufgezeichnet wurden, erklärt Martin Harzenmoser. Der 48-jährige Nachtwächter ist im Hauptberuf Lehrer an einer Sekundarschule. Schon während seines Geschichtsstudiums interessierte er sich für das Zunftwesen. Er gründete zusammen mit seinem Bruder die «Nachtwächterzunft», die Führungen in Schaffhausen und Zürich organisiert. Der Schaffhauser erzählt in breitem Dialekt und kommentiert: «Für ein so unbeliebtes Amt fand sich meist kein Hiesiger.»
Nachtwächter war ein unehrenhafter Beruf, denn nachts zu arbeiten galt im Mittelalter als «sündiges Tun». So stand er nur gerade eine Stufe über dem Totengräber und Henker. Zu ihrem schlechten Ruf trugen die Wächter auch selber bei. In der Zürcher Nachtwächter-Verordnung von 1630 hiess es, dass «Überweinen» – zu viel Wein trinken – ein schweres Vergehen sei und Nachtwächter weder uchen noch spielen dürfen.





Um halb neun Uhr wurden die sieben Tore der Stadt geschlossen.


zehn geschlagen!»
Nachtwächter Martin Harzenmoser.


Der Rundgang in Zürich führt durch versteckte und fast menschenleere Gassen. Licht gab es hier erst ab dem Jahr 1856: Mit Nachteinbruch sorgten 250 Gasanzünder dafür, dass die 3200 Laternen leuchteten. Ungefähr 30 Jahre später hingen vor dem «Haus zum Schwert», wo Mozart, Goethe und der spätere russische Kaiser Nikolaj abstiegen, die ersten elektrischen Lampen.



Polizei ersetzte Nachtwächter
Historische Nachtwächterführungen gibt es heute in verschiedenen Schweizer Städten (siehe Surftipp). Martin Harzenmoser schätzt, dass in der Schweiz an die 25 Nachtwächter tätig sind. Er möchte eine schweizerische Nachtwächter- und Türmerzunft nach europäischem Vorbild gründen. Bei der europäischen Zunft sind heute 115 Nachtwächter und 22 Türmer aus zehn Ländern dabei. (Türmer hielten im Mittelalter von Türmen aus Wache.) Um aufgenommen zu werden, macht der Zunftmeister vor Ort eine Kontrolle, ob die Führungen nach den Regeln der Zunft verlaufen – mit historisch fundierten Erzählungen und dem ordentlichen Nachtwächterruf mit Hornstoss.




In einer ansteigenden Gasse schildert der Nachtwächter, wie im Mittelalter die Notdurft entsorgt wurde. In der Mitte der Gassen verlief der sogenannte Ehrgraben, in welchen die Nachttöpfe entleert wurden. Weil die Bürger diese mit Schwung aus dem Fenster entsorgten, verordnete das Ratsprotokoll unter Strafe einen Warnruf. Spätestens bei den Geschichten über die Hübscherinnen, wie Prostituierte damals hiessen, versteht man, warum die Führung für Kinder nur bedingt empfohlen wird. Vorgeschrieben war, dass die Damen eine rote Kappe trugen. Später singt der Nachtwächter auf einem kleinen Platz den alten Stundenruf: «Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsre Glock hat zehn geschlagen!» Bekräftigt wird der Ausruf mit einem Hornstoss. Der Stundenruf wurde im Jahr 1673 eingeführt. Im 18. Jahrhundert gab es neben den Nachtwächtern auch spezielle Stundenrufer.
Immer mehr Sicherheit
In Zürich sorgten bis 1865 Nachtwächter für Sicherheit, in andern Städten bis zur Schwelle des 20. Jahrhunderts. Konkurrenziert wurden sie durch die Polizei. In Zürich gingen ab 1804 Polizeidiener gegen Rauchen auf offener Strasse, zu schnelles Fahren oder Reiten und das Beherbergen von «schlechten Dirnen» vor und kontrollierten die Wirtshäuser. Nachdem in Zürich die letzten fünf Nachtwächter ihre Arbeit verloren, war ausschliesslich die



Polizei für Ruhe und Ordnung zuständig. Freiwillige Feuerwehren führten Feuerwachen.
Das de nitive Ende der staatlich geregelten Nachtwache erfolgte im Jahr 1907, als in Bern die private Wachgesellschaft Securitas gegründet wurde – anfangs zum Schutz des Eigentums, heute auch zur Überwachung von Veranstaltungen und Asyl-Unterkünften. Waren die früheren Nachtwächter noch mit Hellebarde und Horn ausgestattet, tragen die heutigen auf ihren Rundgängen zwei Taschenlampen, ein Funkgerät, einen Pfefferspray und eine elektronische Kontrolluhr mit sich. Sicherheit ist zu einem Dauerthema geworden. Neben dem Ruf nach mehr Polizei werden wieder Bürgerwehren gefordert – wie im Mittelalter. Damals organisierten sie sich gegen Plünderer, im 19. Jahrhundert wurden sie gegen streikende Arbeiter eingesetzt.
Die Zürcher Nachtwächterführung endet hinter dem Ratshaus, von dem aus früher die Nachtwächter kontrolliert wurden. ◆
Surftipps

www.natuerlich-online.ch/surftipps Infos zu verschiedenen Führungen
Seminare
Vierteiliger Workshop
Mediale Begabung
Vertrauen in die eigenen Wahrnehmungen schöpfen
16. /17.2., Sa., 15 –18.30, So., 10.30 –16.30 Uhr, Sarg-Atelier Alice Hofer, Thun Weitere Daten: 25./ 26.5., 10./11.8., 9./10.11.
Anmeldung: Cristina Teot Tel. 079 506 28 08 www.sarg-atelier.ch www.cristinateot.ch
Schamanische Welten entdecken
12.1., 10.00 –16.00 Uhr, in Solothurn
Tel. 032 623 94 77 www.verena-buerki.ch
Schamanische Trommelgruppe Für Einsteiger/-innen
Beginn 22.1. Tel. 032 623 94 77
www.verena-buerki.ch
Meditative Fastenferien –ein Weg zum Neubeginn
30.3.– 6.4., 6.–13.4., 13.– 20.4., 20.– 27.4. am Bodensee
Wellness Hotel Höri Tel. 052 741 46 00 Essenz-Institut
www.fasten.ch
Diavortrag – Krafttiere und Verbündete der Schamanen
Dr. Christian Rätsch und Dr. Claudia Müller-Ebeling 6.2., 19.30 Uhr, L‘ESPRIT Laufenstrasse 44, Basel, Tram 16, Heiliggeistkirche
Anmeldung / Reservation: www.sphinxworkshops.ch Tel. 061 274 07 74

Agenda
Ayurveda – Ayurquell
26.1. Ayurveda-Einführungsund -Schnuppertag 23.2. Agni und Ama – oder wie Sie Allergien und Gewichtsschwankungen entgegenwirken
ayurQuell, Olten Tel. 076 398 86 86 www.ayurveda-kurse.ch
Kriya Yoga mit Kripanandamoyima 26./27.1. Zürich 9./10.3. Rheinfelden 6./ 7.4. Interlaken Info: Sabine Schneider Tel. 044 350 21 89 www.kriya.ch
Fastenwandern im Wunderland Schweiz 9.–16.3. Ascona TI 17.– 24.3. Ascona TI 4.–11.5. Andeer GR 11.–18.5. Andeer GR
Details und ganzes Programm 2013 unter www.fastenwandern.ch
Maya Hakios, Manzenweg 19, 8269 Fruthwilen, Tel. 071 664 25 29
Körperzentrierte
Psychologische Beratung/ Psychotherapie IKP
22.1., 18.30 – 20.30 Uhr
Ernährungs-Psychologische Beratung IKP
24.1., 18.30 – 20.30 Uhr
Ganzheitlich-Integrative Atemtherapie IKP
29.1., 18.30 – 20.30 Uhr
Partner-, Paar- und Familienberatung IKP
26.2., 18.30 – 20.30 Uhr
Psychologischer Patienten-Coach IKP
24.4., 18.30 – 20.30 Uhr
IKP, Kanzleistr. 17, 8004 Zürich Tel. 044 242 29 30 www.ikp-therapien.com
056 4442222 BEA-Verlag 5200 Brugg 056 444 22 22 bea-verlag.ch
BEA-Verlag, 5200 Brugg 056 444 22 22, bea-verlag.ch
Ausbildung
Tanztherapeutin
25.– 27.1. Einführungsseminar 8.–10.3. Einführungsseminar 3.– 5.5. Start der Ausbildung
Institut am See für Tanztherapie Uttwilerstrasse 26 8593 Kesswil www.tanztherapie-am-see.ch

Festivals
Thuner Fasnacht 2013 31.1.– 3.2., Innenstadt Fasnachtsfreunde Thun www.thuner-fasnacht.ch
Schaffhauser Fasnacht 31.1.– 3.2. Fasnachtskomitee Schaffhausen www.fakos-sh.ch
Kultur
Solothurner Filmtage 24.– 31.1., Solothurn Solothurner Filmtage www.solothurnerfilmtage.ch
Ewig dein: Alles rund ums Flirten, Verlieben, Lieben und Zusammensein Ausstellung bis 3.3. Historisches Museum Luzern Pfistergasse 24, Luzern Tel. 041 228 54 24 www.historischesmuseum.lu.ch
SCHULDIG – Verbrechen. Strafen. Menschen. Ausstellung bis 7.4.
Historisches Museum Basel Steinenberg 4, Basel Tel. 061 271 05 05 www.historischesmuseumbasel.ch
Grönland – Patagonien –Himalaya 31.1., 19.30 Uhr, Staatssaal Wil, Bahnhofplatz 6 Tel. 031 313 07 76 www.explora.ch
Die Magie des Wassers Ausstellung bis 14.4. Château de Chillon Avenue de Chillon 2 Chillon-Veytaux Tel. 021 966 89 10 www.chillon.ch
Der Tee der drei alten Damen Krimi nach Friedrich Glauser 2.3., 20 Uhr, Langenthal
Stadttheater Langenthal
Aarwangenstrasse 8, Langenthal
Tel. 062 922 26 66
Mann o Mann –Die Midlife-Crisis-Revue 1.2., 19.30 – 21.30 Uhr Maag Areal Hardstrasse 219, Zürich
Weitere Termine: www.vocapeople-show.ch
Weitere Veranstaltungen finden Sie auf _ www.natuerlich-online.ch /agenda
Teil 4

Rücken an Rücken
Bewusstes Wahrnehmen bedeutet Sinnlichkeit – und das wiederum ist die Würze des Lebens. Bis kommenden März stellt Ihnen «natürlich» einfache Feldenkrais-Übungen vor, die sich zu zweit oder alleine ausführen lassen.


Setzen Sie sich zu zweit so auf den Boden, dass Ihre Rücken möglichst grossflächig in Kontakt zueinander sind. Strecken Sie beide Beine gerade vor sich aus, bequem auseinander. An welchen Stellen berühren sich Ihre Rücken? Ist es bequem, wenn sich Ihre beiden Köpfe ebenfalls berühren? Wenn Sie alleine sind, setzen Sie sich mit Ihrem Rücken zu einer Wand.
Bestimmen Sie, wer von Ihnen beiden die Führung übernimmt. Beginnen Sie Ihre rechte Schulter nach vorne und zurück zu bewegen und lassen Sie Ihre Partnerin/Ihren Partner aktiv folgen, sodass Ihre Rücken in Verbindung bleiben. Danach lassen Sie Ihre Schulter nach oben und unten gehen. Merken Sie, wie sich die Schulterblätter bewegen? Tun Sie dies synchron oder unterschiedlich? Welche Teile der Wirbelsäule, welche Rippen sind aktiv? Findet im Becken auch Bewegung statt?
Spezialangebot für «natürlich»-Leser/-innen
Feldenkrais-Wochenendkurse:
➔ 9./10. Februar 2013 im Hotel Lihn, Filzbach (GL)
➔ 23./24. März 2013 im Hotel Aubier, Montézillon (NE)
Details und Anmeldung: www.feldenkraismethod.ch


1 I Strecken Sie beide Arme seitwärts neben sich aus und lassen Sie die Handrücken sich berühren. Wie berühren sich die Schulterblätter?
Bewegen Sie nun Ihren ganzen rechten, gestreckten Arm – die andere Person bewegt gleichzeitig den linken Arm – in Richtung Boden, nach rechts und wieder in die Mitte zurück. Wiederholen Sie diese Bewegung einige Male und gelangen Sie, jedes Mal ein bisschen weiter in die Nähe des Bodens – nicht von Anfang an! Lassen Sie den Kopf mitgehen. Wie verlagern Sie Ihr Gewicht? Wie passen sich Ihre Rippen an, wenn Sie sich seitwärts biegen? Was geschieht mit denjenigen auf der andern Seite? Bewegen Sie stets wenig und leicht! Ruhen Sie sich aus.
2 I Nehmen Sie wieder dieselbe Stellung wie bei 1 ein. Bewegen Sie jetzt Ihre beiden Arme in Richtung Boden und neigen Sie den Kopf in die Gegenrichtung. Können Sie dabei frei atmen? Wie behalten Sie Ihre Balance? Ruhen Sie sich wieder ein wenig aus.
Nehmen Sie nach einer kleinen Pause wieder dieselbe Stellung ein. Biegen Sie sich nun nach unten und lassen den Rücken rund werden – nur so weit, wie es bequem ist. Die Augen begleiten die Bewegung.
4 I Nach einer kurzen Pause legen Sie Ihre Arme nochmals seitwärts ausgestreckt aneinander und drehen die Hände und Arme langsam nach unten und oben. Die Handflächen zeigen also zum Boden und zur Decke. Wie weit lassen sich die vereinten Arme und Hände drehen, ohne dass Sie sich anstrengen? Was geschieht in den Schulterblättern? Verändert sich der Kontakt der beiden Rücken?
Ruhen Sie sich aus und versuchen Sie danach, ohne Anstrengung und Rücken an Rücken aufzustehen. Gehen Sie ein wenig umher, um wahrzunehmen, was sich verändert hat. u

Dorothea Kipfer ist seit über 20 Jahren Feldenkrais-Lehrerin SFV. Sie führt in Affoltern a. A. und in Zürich eine eigene Praxis. www.feldenkraismethod.ch
3 I Nehmen Sie dieselbe Stellung ein, wechseln Sie aber jetzt die Führungsposition untereinander. Krümmen Sie (die führende Person) Ihren Rücken so, dass Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen in Richtung Decke wenden und Ihr Kreuz hohler wird. Wie folgt Ihnen Ihre Partnerin/Ihr Partner? In welche Richtung bewegt sie/er sich? Führen Sie die Bewegung klein aus und lassen Sie Ihre Rücken sich soweit gegeneinander verschieben wie nötig.


Zu gewinnen gibt es:
Gewinnen Sie 12-mal Eisen-Rasayana im Gesamtwert von CHF 312.–.


Mehr Energie und Lebensfreude mit ayurvedischem Eisen-Rasayana Das ayurvedische Eisen-Rasayana ist ein Naturprodukt mit einzigartiger Wirkung. Es versorgt den Körper mit dem notwendigen Spurenelement, fördert die Verdauung und den Eisenstoffwechsel. Die Kombination mit ayurvedischen Kräutern trägt zur besseren Aufnahme des Eisens bei und garantiert eine gute Verträglichkeit. Mit der Einnahme von zwei Tabletten täglich (1 Tablette enthält 7 mg Eisen) wird der nötige Eisenbedarf gedeckt und das Immunsystem auf natürliche Weise gestärkt.
Und so spielen Sie mit: Sprechen Sie das Lösungswort unter 0901 009 151 (1.–/Anruf ab Festnetz) auf Band. Oder senden Sie eine Postkarte mit der Lösung und Ihrer Adresse an: freiraum Werbeagentur AG, «Ayurveda» Wettbewerb, Mühlezelgstrasse 53, 8047 Zürich. Teilnahmeschluss ist der 30. 1. 2013.
Teilnahmebedingungen: Gleiche Gewinnchancen für telefonische oder schriftliche Teilnahme. Mitarbeiter der AZ Medien Gruppe AG und Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht in bar ausbezahlt. Es wird keine Korrespondenz geführt.
Lösung des Rätsels aus dem Heft 12-2012
Gesucht war: Lebenslust
33. Jahrgang. ISSN 2234-9103
Erscheint monatlich.
www.natuerlich-online.ch
Leserzahlen: 188 000 (MACH Basic 2012-1)
Auflage: 52 000 Exemplare, verkaufte Auflage
39 222 Exemplare.
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@azmedien.ch
Herausgeberin
AZ Fachverlage AG
Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax +41 (0)58 200 56 44
Geschäftsführer
Dietrich Berg
Leiterin Zeitschriften
Ratna Irzan Redaktion natürlich
Postfach
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax +41 (0)58 200 56 44
Chefredaktor
Markus Kellenberger
Redaktionsteam
Tertia Hager, Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
Susanne Hochuli, Barbara Hutzl-Ronge, Dorothea Kipfer, Heinz Knieriemen, Andreas Krebs, Fabrice Müller, Eva Rosenfelder, Vera Sohmer, Rita Torcasso, Remo Vetter, Andreas Walker
Layout/Produktion
Renata Brogioli, Fredi Frank
Copyright
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für eingesandtes Material. Die Wiedergabe von Artikeln und Bildern ist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages erlaubt.
Anzeigenleitung
Christian Becker
Tel. +41 (0)44 709 19 20
Rolf Ulrich
Tel. +41 (0)44 710 19 91
Webereistrasse 66
CH-8134 Adliswil
Fax +41 (0)44 709 19 25 cebeco@bluewin.ch
Anzeigentarife unter www.natuerlich-online.ch
Anzeigenadministration
Nicole Lüscher
Tel. +41 (0)58 200 56 16
Leiter Lesermarkt/Online
Valentin Kälin
Aboverwaltung
abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 (0)58 200 55 62
Preise
Einzel-Verkaufspreis Fr. 8.–1-Jahres-Abonnement Fr. 84.–2-Jahres-Abonnement Fr. 148.– inkl. MwSt. Druck
Vogt-Schild Druck AG CH-4552 Derendingen
Ein Produkt der Verleger: Peter Wanner
CEO: Christoph Bauer www.azmedien.ch
Namhafte Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2 StGB: AZ Anzeiger AG, AZ Fachverlage AG, AZ Management Services AG, AZ Regionalfernsehen AG, AZ TV Productions AG, AZ Verlagsservice AG, AZ Vertriebs AG, AZ Zeitungen AG, Basellandschaftliche Zeitung AG, Media Factory AG, Mittelland Zeitungsdruck AG, Solothurner Zeitung AG, Radio 32 AG, Vogt-Schild Druck AG, Vogt-Schild Vertriebs GmbH, Weiss Medien AG
Im Februar lesen Sie

Unser täglich Müll
Trotz aller Bemühungen wächst der Abfallberg – und damit auch das Entsorgungsproblem. Wie kann Abfall reduziert werden? Welchen neuen Kunststoffen gehört die Zukunft?

Tropf um Tropf
Von der Erkältung bis zu psychischen
Problemen: Wie Bach-Blüten-Tropfen Kindern helfen können.
Weitere Themen

Grüne Kraft
Es geht nicht nur um Vitamine: Chlorophyll (Blattgrün) ist für die Gesundheit wichtig und stärkt das Immunsystem.
l Ein Plädoyer für weniger Beton und mehr Natur l Küchenknatsch: Wie sich Männer und wie sich Frauen beim Kochen verhalten l Eingewanderte Winzlinge l Mit den Schneeschuhen am Julierpass l Entspannen mit Feldenkrais
«natürlich» 2-2013 erscheint am 31. Januar 2013
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 62, Fax 058 200 55 63 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch

JÜberlebt
Der Weltuntergang hat nicht stattgefunden. Für Susanne Hochuli ist das ein guter Grund, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was nun angepackt werden soll – und darf.
a, es gibt Sie noch. Sie sitzen irgendwo und lesen meine Kolumne. Das ist bemerkenswert. Schliesslich hätte am 21. Dezember des vergangenen Jahres die Welt untergehen sollen. Gut, wir wissen nun, dass das nicht passiert ist, und einigermassen Interessierten ist auch bekannt, dass nur der Maya-Kalender an diesem Tag endete – und nicht die Welt. Ich finde, die Mayas haben das gut gemacht. Würde ich etwas enden lassen, dann auch am kürzesten Tag des Jahres, der uns 15 bis 17 Stunden Dunkelheit beschert. Da lohnt es sich ja kaum, aufzustehen, geschweige denn etwas Neues anzufangen. Also lassen wir die Dinge besser enden.
Im letzten Jahr ist für viele Menschen die Welt untergegangen. Für die Eltern, deren Kind in der 23. Schwangerschaftswoche zum Engel wurde. Für die Freundin, an Brustkrebs erkrankt, die nach vielen Chemotherapien keinen Lebenswillen mehr spürte und meinte, wie erschreckend es sei, wenn man wünscht, sich aufzulösen. Für den Autofahrer, der unachtsam war und den kleinen Jungen überfuhr. Für den 19-Jährigen, der, schwer depressiv, bei seinem Austritt aus der psychiatrischen Klinik alle im Glauben liess, er hätte es geschafft, stattdessen aber sein Leben und die Welt seiner Familie untergehen liess.
Nun, da die Tage wieder länger werden, überlege ich mir noch viel mehr, was sich lohnt, angepackt zu werden.
Ich habe mir im letzten Jahr keine Sorgen wegen des durch Esoteriker angekündigten Weltuntergangs gemacht, sondern ich wusste, dass ich am kürzesten Tag des Jahres aus der Zeitung ein Fetzchen Papier herausreissen würde; jenes, auf dem der Zeitpunkt des Sonnenauf- und -untergangs festgehalten wird, und dieses Papier würde ich wie jedes Jahr an die Wand pinnen, um dann regelmässig überprüfen zu können, um wie viele Minuten die Tage länger werden. Nur gemessene und nicht gefühlte Minuten. Was auf dem Papier steht, fühlt sich gelebt ganz anders an, weil man sich sehnt nach Vermisstem, sich vorstellt, wie es werden wird, sich freut, weil es noch besser wurde, als vorgestellt. Und das passiert nicht auf einem an die Wand gepinnten Stück Papier, das geschieht im Leben. Genauso wie der Weltuntergang, der uns erspart geblieben ist, im Leben passiert.
«So schwere Kost zum Jahresanfang?», fragen Sie sich. Sind es nicht vielmehr Lebensbruchstücke, die eine Leichtigkeit in unser Sein bringen können, weil sie uns darüber nachdenken lassen, wann unsere Welt im letzten Jahr untergegangen ist? Ich jedenfalls blicke zurück und finde für mich nicht einen vorübergehenden Weltuntergang. Kleine Beben und Erdspalten gewiss, aber keinen einzigen Tag, an dem es sich nicht gelohnt hätte, etwas Neues anzufangen. Und nun, da die Tage bereits wieder länger und heller werden, überlege ich mir noch viel mehr, was sich lohnt, angepackt zu werden, was sich lohnt, begonnen zu werden, auch wenn man nicht weiss, ob es beendet werden kann. Ich stelle mir vor, was ich in diesem Jahr tun werde, damit ich mir, sollte die Welt doch noch untergehen, sagen kann: «Ich habe getan, was ich tun wollte und was getan werden musste.»
Susanne Hochuli, erste grüne Regierungsrätin im Aargau, ist Mutter einer 18-jährigen Tochter und wohnt auf ihrem Biobauernhof in Reitnau, der vom besten Bauern der Welt bewirtschaftet wird.
