
Röntgen
Durchblick ohne Risiko 10
Sonnenstürme
Katastrophen nicht ausgeschlossen 42



Röntgen
Durchblick ohne Risiko 10
Sonnenstürme
Katastrophen nicht ausgeschlossen 42

Vo n de n saft ig en We id en um He rg is wi l am Nap f auf 76 0 Me te rn Hö he sta mm t di e Be rg mi lc h vo n Br uno Am büh l. Ar om at is ch e Kräuter, gesunde Kühe und stolze Bauern schaffen hier zusammen ein unverwechselbares Pro Montagna Produk t. Auch in Zukunf t: De nn bei je de m Ka uf fl ie ss t ein So li da ri täts beit ra g an di e Co op Paten sc haft fü r Be rg ge bi ete. Da mi t un se re Be rg e we iter bewi rtschaftet we rd en . Un d wir Unte rl än de r au ch morgen noch echte Be rg prod uk te ge nies se n dü rfen . www.coop.ch/promont agna Für unse re Be rge. Für unse re Bauer n.


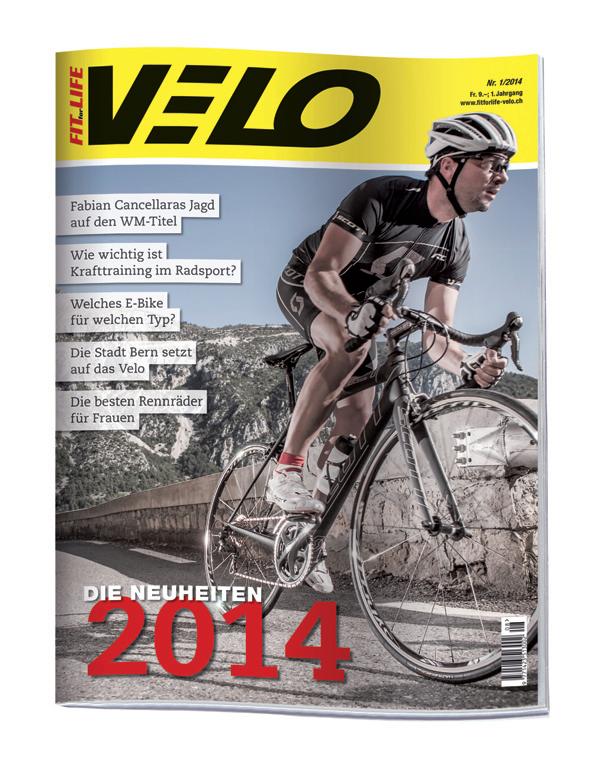












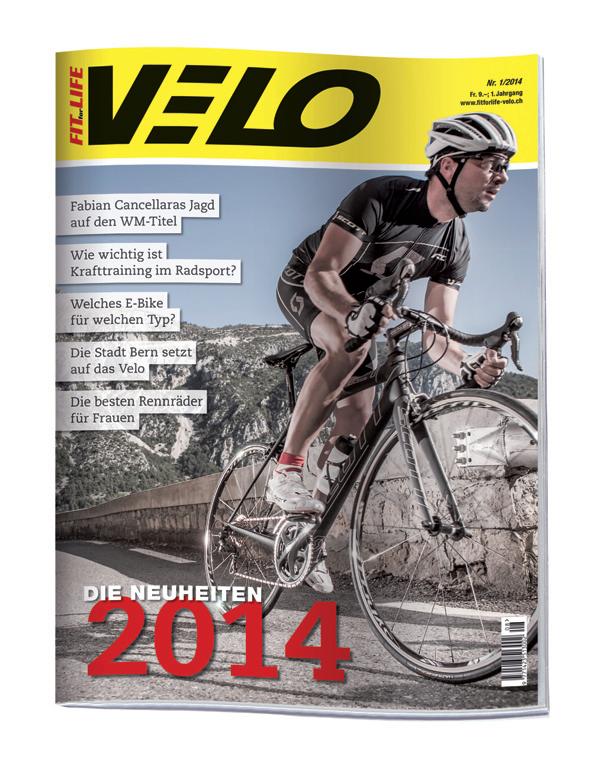




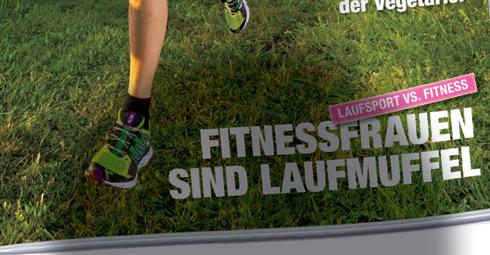
FIT for LIFE
3 Ausgaben für Fr. 20.–


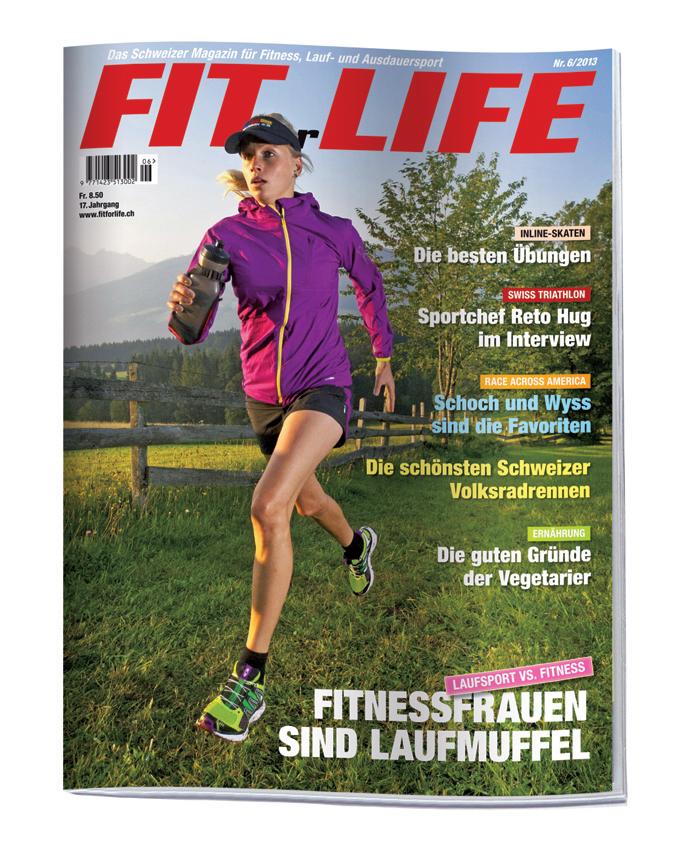


Erscheint 10x jährlich
FIT for LIFE
wir eltern
4 Ausgaben für


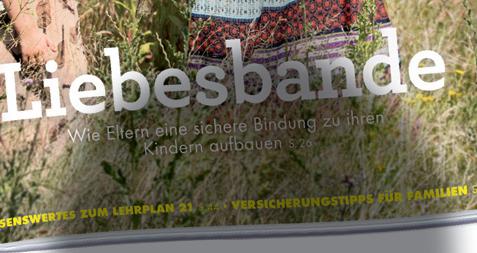
Fr. 20.–



Das Schweizer Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport. Neu und kostenlos im Jahresabo: 2x im Jahr mit «FIT for LIFE VELO».



Erscheint 10x jährlich

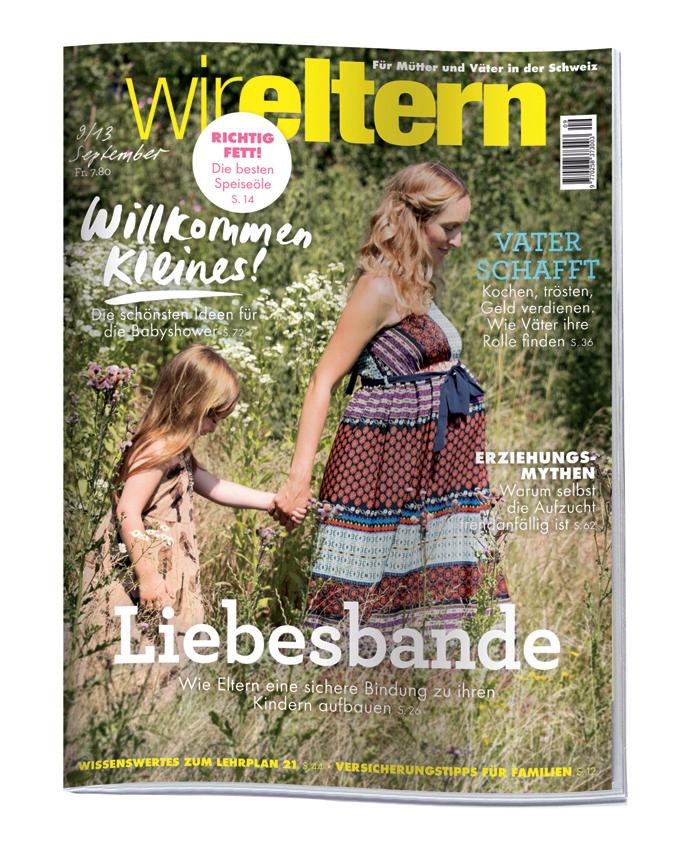
wir eltern
Tipps zu Schwangerschaft, Geburt und Erziehung sowie Unterhaltung und Lifestyle.



Ja, ich profitiere von diesen Angeboten und bestelle folgendes Abo: (Bitte Gewünschtes ankreuzen)
Schnupperabo: 3x FIT for LIFE für nur Fr. 20.–
Jahresabo: 10x FIT for LIFE +2x VELO für nur Fr. 89.–
Schnupperabo: 4x wir eltern für nur Fr. 20.–
Jahresabo: 10x wir eltern für nur Fr. 82.–
Schnupperabo: 4x natürlich für nur Fr. 20.–
Jahresabo: 10x natürlich für nur Fr. 84.–
Schnupperabo: 4x KOCHEN für nur Fr. 20.–
Jahresabo: 10x KOCHEN für nur Fr. 68.–
Ich nehme nur an der Verlosung teil.
Vorname/Name:
Strasse/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon/E-Mail:
Dieses





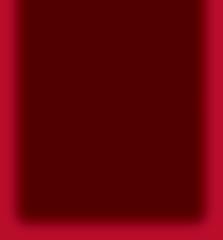
Gewinnen Sie ein iPad Air mit Retina-Display, Wi-Fi, 16 GB, Spacegrau.


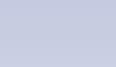




natürlich 4 Ausgaben für Fr. 20.–


Erscheint 10x jährlich
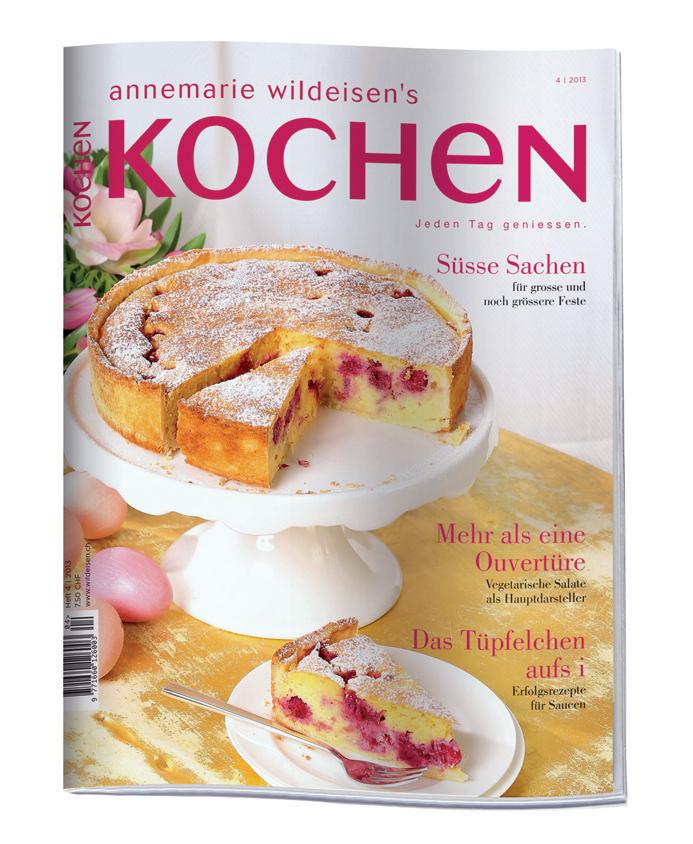

natürlich
Das Magazin für ganzheitliches Leben. Alles Wissenswerte zu den Themen Natur, Gesundheit und Gesellschaft.


KOCHEN

4 Ausgaben für Fr. 20.–

Erscheint 10x jährlich

KOCHEN
Jeden Tag geniessen mit Annemarie Wildeisen’s KOCHEN. Gewürzt mit feinen Ideen, garniert mit guten Tipps und einer Fülle von Rezepten.

Teilnahmebedingungen: Jede Bestellung nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die Wettbewerbsteilnahme ist unabhängig von einer Bestellung. Nur Wettbewerbsteilnahme unter www.lieblingszeitschrift.ch. Einsendeschluss ist der 31.12.2014. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bitte ausfüllen und noch heute einsenden an: AZ Fachverlage AG, Leser-Service, Postfach, 5001 Aarau Noch schneller geht es per Internet: www.lieblingszeitschrift.ch
«ICH BR INGE ME DIZI N UNTER DI E LEUTE»




Liebe Leserin, lieber Leser
Frei nach Jean-Jacques Rousseau proklamierte eine entwicklungskritische Umweltbewegung in den 1980er-Jahren «Zurück zur Natur». Nicht wenige suchten ihr Glück damals als Bauern oder zumindest als Selbstversorger in einem einsamen Tessiner Tal oder in der Toscana. Heute geht der Städter nicht zurück zur Natur, er holt sie sich vor die Haustüre. Urban Gardening, Gemüseanbau in der Stadt, ist im Trend und alle sind begeistert: Politiker, die sich für einen Gemüseanbau auf Verkehrsinseln und Stadtpärken stark machen, zuständige Behörden, die private Initiativen grosszügig unterstützen und findige Unternehmer, die Neu-Gärtner mit Material und Kursen versorgen.
Früher wollte man «Zurück zur Natur», heute holt man sie in die Stadt – vor die Haustür.
Ist die neue Lust am Gemüseanbau mehr als ein modischer Hype von wohlstandsverwöhnten Stadtmenschen, die einmal mehr nach ihren Wurzeln suchen und ein Teilzeit-Leben als Gemüsebauer führen wollen? Zwar wurde schon früher in der Stadt Gemüse angebaut. Doch wir neigen dazu, das Bild vom Arbeitergärtchen zu romantisieren, denn die Arbeiter von anno 1914 hatten keine andere Wahl: Gemüse war nicht jederzeit verfügbar und teuer. Selbstversorgung tat damals Not.
Dennoch: Wenn sich Städter heute im Gemüseanbau versuchen, ist das vielleicht trotzdem mehr als ein kurzlebiger Trend. Einerseits stellt der Welt-Agrarbericht fest, dass die industrielle Landwirtschaft aufgrund ihres enormen Ressourcenverschleisses längerfristig nicht mehr in der Lage sein wird, die Menschen zu ernähren. Andererseits sollen im Jahr 2050 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Damit diese lebenswert bleiben, müsse der Mensch der Natur in der Stadt wieder mehr Raum geben, sind inzwischen auch Städteplaner überzeugt. Da kann ein Garten im Hinterhof oder am Stadtrand durchaus mehr als ein euphorisches Experiment von Stadt-Ökos sein – denn nebst dem umweltgerecht angebauten Gemüse, können auf dem Feld auch soziale Kontakte gedeihen.
Welche Erfahrungen man als Stadtbauer macht und wie wählerische Konsumenten mit den Launen der Natur umgehen, können Sie auf Seite 32 im Interview mit den Initianten des Pflanzplatz Dunkelhölzli in Zürich lesen. Und was glauben Sie?
Ist Urban Gardening mehr als ein Trend?
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen
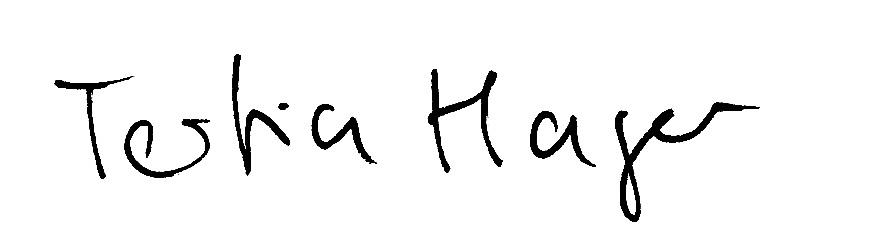
Mehr Fr isc he im Leben mit den neuen Wäschesammlern von WENKO







Produkte in unserem Leserangebot auf Seite 50






Gesundheit
8 Pflanzliches Antibiotika
9 Einfacher geht nicht: Gehen Sie
10 Durchblick: Die verschiedenen Röntgenverfahren
14 Achtsamkeits-Serie: Teil 1. Atmen
Beratung
20 Sabine Hurni beantwortet Leserfragen
Haus & Garten
24 Warm einpacken: Balkonpflanzen
25 Beerenzeit: Geschichten zu Himbeere & Co.
26 Ein starkes Gemüse-Trio
32 Städtisches Gärtnern –eine Erfolgsgeschichte?
34 Auf dem Weg zu mehr Musse mit Remo Vetter
Natur
40 Zeichensprache der Affen
41 Sensible Spürnasen: Rehe
42 Faszinierend und bedrohlich: Sonnenstürme
46 Wandern im spätsommerlichen Tessin
Leben
52 Filmfestival zum Thema Nachhaltigkeit
53 Berauschende Substanzen aus der Natur
54 Seidenproduktion, ein Handwerk wird wiederbelebt
58 Gegen die Gleichgültigkeit der Gesellschaft Plus
3 Editorial 6 Leserbriefe
38 Markt
50 Leserangebote 63 Agenda 64 Rätsel
65 Vorschau
66 Carte blanche

«natürlich» 07/08-14
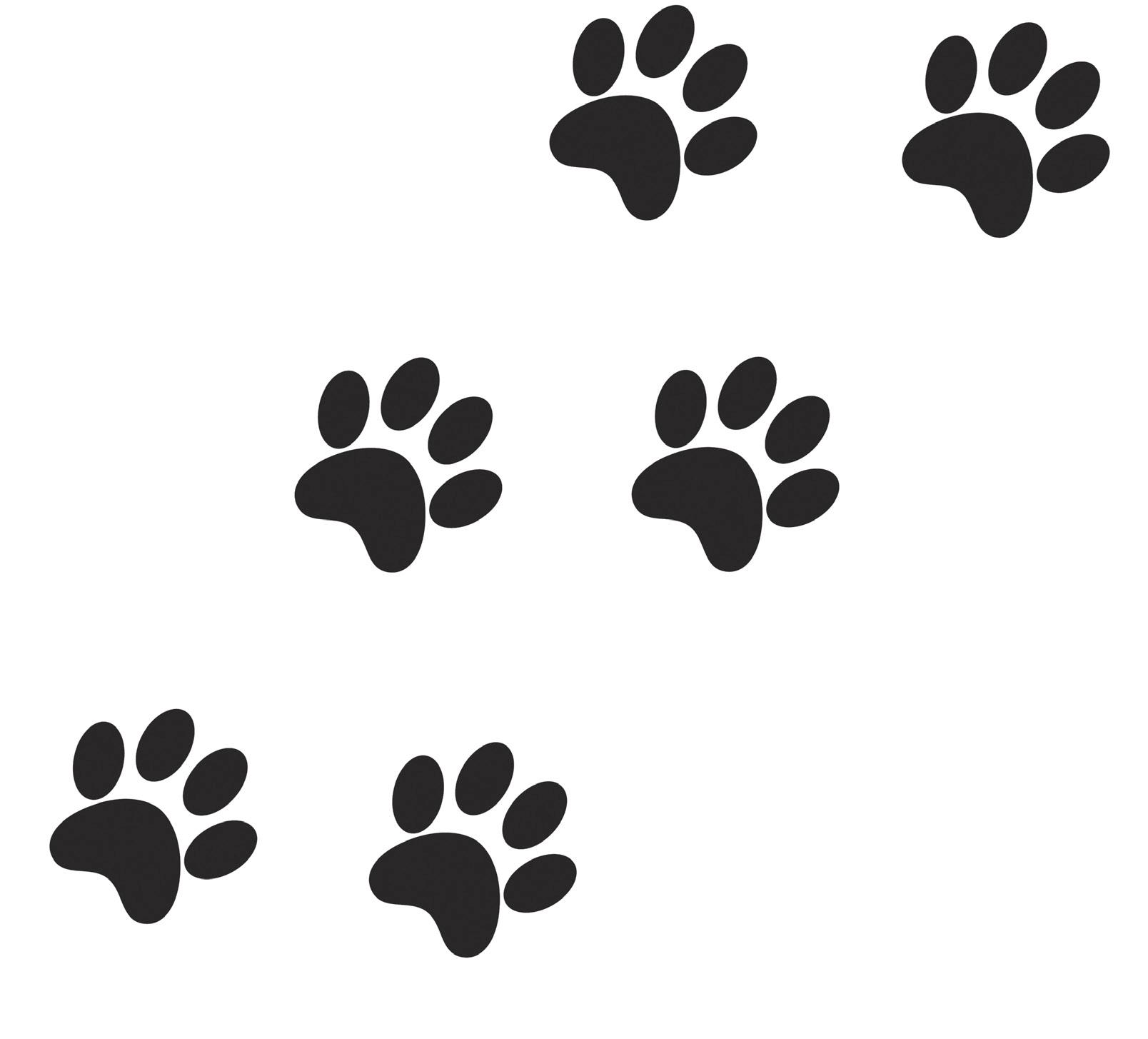
Nmein findet zum Glück langsam ein Umdenken statt, selbst Ladenketten wie Qualipet führen seit neuestem Frischfleisch im Sortiment. Es liegt wie immer am Konsumenten, nur er kann die Nahrungsindustrie-Lobby beeinflussen. Vera Stutz, St.Gallen
Dicht einmal Schweine bekommen solches Futter. Toll, dass Sie den Artikel über Hundeernährung geschrieben haben. Es ist skandalös, was unseren Haustieren von der Industrie angeboten wird. Auch in der Haustierernährung sollte unbedingt ein Umdenken stattfinden. Ich selber ernähre meinen Hund seit vielen Jahren mit BARF und habe seit über drei Jahren ein kleines Geschäft, in dem ich komplette Rohfleischmenüs anbiete. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass Hunde, die gebarft werden, ein seidenes Fell, keinen Körperund Mundgeruch mehr haben und die Verdauung perfekt ist. Das Erstaunlichste von
Briefe an «natürlich» Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik sind willkommen. Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51.
meinen Erfahrungen mit Rohfleisch war aber, dass Hunde mit Epilepsie keine Anfälle mehr bekamen, ausser in aussergewöhnlichen Stresssituationen. Die Hunde leben heute alle medikamentenfrei. Tanja Fricker, per E-Mail
erfreulich, dass auch « natürlich » das Thema Industrietierfutter aufgreift. Ich wundere mich immer wieder, dass Menschen, die zwar biologisch und sehr gesundheitsbewusst einkaufen, ihren Tieren übelste Abfälle vorsetzen. Man darf und soll Tiere unbedingt « verwöhnen », das heisst für mich: sich darum kümmern, was sie wirklich zum artgerechten Leben brauchen. Katzen sind reine Karnivoren ( Fleischfresser) und nicht in der Lage, andere Nahrungsmittel zu verdauen. Man halte sich immer das Beutetier Maus vor Augen: Muskelfleisch, Innereien, Knochen, etwas Mageninhalt (=Gemüse) und Fell als Ballaststoff.
Wir füttern schon lange mit frischem Fleisch (Barfen), es ist weder sehr zeitaufwendig noch teurer. Die Tiere brauchen viel weniger Futter, weil es so hochwertig ist. Wir haben gesunde, vitale und ausgeglichene Katzen. Zum Thema Barfen gibt es gute Anleitungen im Internet. Allge-
anke für den kritischen Artikel über das Tierfutter, dieses dunkle Geschäft kenne ich seit Jahren. Mutig, dass Sie die Fakten so klar dargelegt haben. Das muss klar gesagt werden, denn viele Tierbesitzer sind immer noch im Glauben, dass alles o.k. ist mit ihrem Tierfutter. Aber leider weit gefehlt, darum ernähre ich meine Haustiere schon seit über 13 Jahren mit der Nahrung der Firma A. und empfehle meinen Kunden entweder das Barfen oder eben eine vernünftige Ernährung mit hochwertiger Haustierkost, denn diese gibt es auch – nur nicht in jedem Supermarkt. Weiter so mit dem « natürlich » ! Erica Bänziger, Verscio
D er Artikel spricht eine deutliche Sprache, das sieht man sehr selten in der Medienlandschaft, wahrscheinlich weil eine gewisse Angst besteht, keine Inserate mehr zu bekommen. Ich finde es sehr mutig, in dieser Deutlichkeit darüber zu schreiben. Dazu kann ich «natürlich» und der Autorin Eva Rosenfelder nur gratulieren. Es ist an der Zeit, den Tierhaltern die Augen zu öffnen – und Sie tragen so dazu bei. Im Namen der Tierfreunde möchte ich mich für Ihr Engagement bedanken. Ralf Dietrich, Pfungen
Voll Fett «natürlich » 7/8-14
Ob eine Avocado reif oder unreif ist, lässt sich gut erkennen, indem man den Stielansatz entfernt. Ist er braun, ist die Avocado bereits zu reif. Ist er grün, ist die Avocado gut. Mirjam Oetiker, per E-Mail
Orientierung im Therapiedschungel
«natürlich » 05-14
Leider
musste ich mit Erstaunen feststellen, dass auch Ihr Magazin ins gleiche Horn bläst wie viele andere auch. Mit einigen Bedenken beobachte ich diesen Trend der Ausbildungs-Flut auch in der Naturheilkunde. Ihre Berichterstattung ist in dieser Hinsicht leider ziemlich einseitig und unausgeglichen. Dazu meine Kritik: Niemand will Kurpfuscher oder Quacksalber. Doch helfen da Diplome wirklich?
Wer garantiert denn, dass mit einem Diplom der Therapeut wirklich gut und fachkundig ist? Reduziert denn die langjährige Ausbildung – und sozusagen Indoktrinierung der Ärzteschaft – wirklich Diagnose oder Behandlungsfehler? Falls ja, woher kommt dann der oftmals sorglose Umgang mit Antibiotika oder die meist mangelhafte Aufklärung bei Impfungen?
Ich verstehe den Wunsch nach Garantie und Sicherheit gut. Eine gewisse Ausbildung ist sicherlich auch total nützlich und sinnvoll. Doch wo ist die Grenze? Wann wird aus dem Naturheilkundigen oder dem Naturheilpraktiker ein Theoretiker?
Die Gier nach Ausbildung und Diplomen lässt die Anerkennung von talentierten Heilkundigen immer schwächer werden. Ich selbst habe viele Ausbildungen

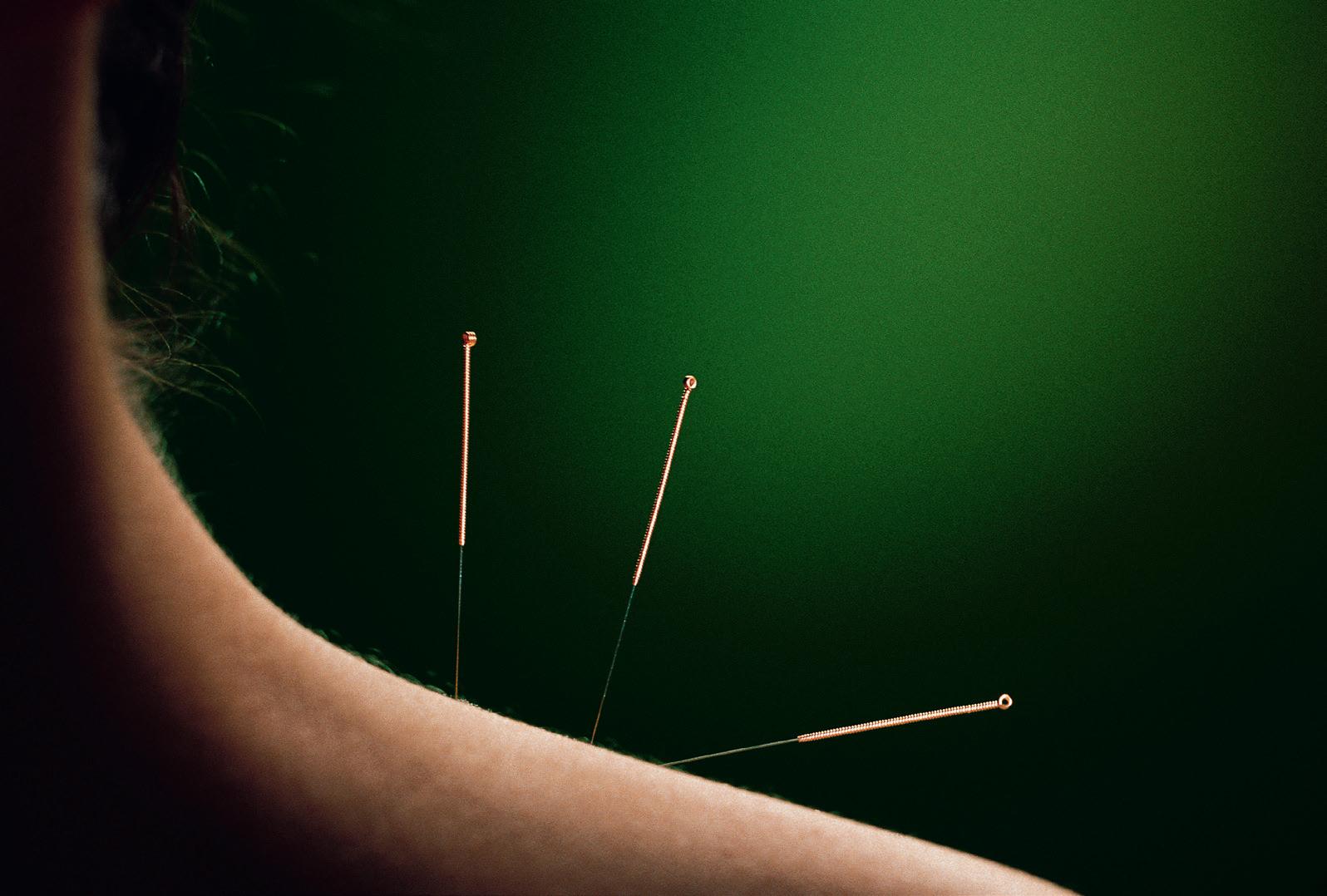
gemacht und erachte diese oft als sinnvoll. Doch zu behaupten, dass die Ausbildungen einen besseren oder zuverlässigeren Therapeuten garantieren oder erahnen lassen, ist zweifelhaft. Manchmal ist weniger mehr. Der Wunsch nach Sicherheit oder Garantie birgt gleichzeitig auch die Gefahr, dass die Selbstverantwortung zunehmend abgegeben wird. Das ist nicht im Sinne der Naturheilkunde. Darum ist die Diplomierung ein zweischneidiges Schwert. Leider. Josef Benz, Wolfhalden
DerBeitrag «Bald mit Garantie» berichtet über die eidgenössische Berufsanerkennung der Komplementärtherapie. Am Beispiel einer Shiatsu-Therapeutin wird ein neuer Beruf präsentiert. Damit berichtet der Beitrag allerdings nur über die Hälfte des aktuellen eidgenössischen Reglementierungsprozesses der Komplementär- und Alternativmedizin (KAM ). Die nichtärztliche KAM-Branche umfasst zwei Berufe: neben dem präsentierten Komplementärtherapeuten wird auch eine Reglementierung für die Alternativmedizin geschaffen. Die Alternativmedizin umfasst die naturheilkundlichen Fachrichtungen Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin und Akupunktur, Ayurvedische Medizin und traditionelle europäische Naturheilkunde.
Die Berufe der Komplementärtherapeutin und des Naturheilpraktikers sind zwar verwandt, unterscheiden sich aber in zentralen Kompetenzen. Der Naturheilpraktiker praktiziert innerhalb seines
alternativmedizinischen Gesamtsystems, wie zum Beispiel der Homöopathie oder traditionellen chinesischen Medizin. Die Naturheilpraktikerin betreut Menschen mit akuten oder chronischen Krankheiten, alleine oder in Zusammenarbeit mit der Schulmedizin.
Im Gegensatz dazu arbeitet der Komplementärtherapeut mit individuellen Methoden, wie zum Beispiel Shiatsu oder Kinesiologie. Die Komplementärtherapeutin begleitet mit diesen Methoden Menschen ergänzend zur Schulmedizin.
Die eidgenössische Reglementierung für Komplementärtherapeuten und Naturheilpraktiker folgt dem Wunsch der Bevölkerung und ist ein zuverlässiges Qualitätsmerkmal und ein erster wichtiger Schritt zur besseren Integration der nichtärztlichen Komplementär- und Alternativmedizin ins schweizerische Gesundheitswesen.
Simon Becker, Vorstandsmitglied OdA AM (Organisation der Arbeitswelt Alternativmedizin Schweiz)
Hilfreiche Feierabend-Lektüre «natürlich » 07-14
Vielen Dank für die Juli-Ausgabe. Von A bis Z lesens- und empfehlenswert. Eine sinnvolle und hilfreiche FeierabendLektüre.
Lea Diem, per E-Mail
Lesen_ Die Kunst des klugen Umgangs mit Konflikten
Meist sind es immer wieder ähnliche Muster, die uns in unangenehme Konfliktsituationen bringen. Die Schweizer Psychologin Ruth Enzler unterscheidet drei Persönlichkeitstypen. Mit einem Selbsttest findet der Leser heraus, ob er der soziale Typ, der Erkenntnistyp oder der Ordnungs-/ Strukturtyp ist. Mit anschaulichen Fallbeispielen und praxisbezogenem psychologischem Fundus zeigt sie, wie es zu schaffen ist, gut mit Konflikten umzugehen – und dabei auch mal über sich selbst lachen zu können.
_ Ruth Enzler Denzler: «Die Kunst des klugen Umgangs mit Konflikten», Springer Verlag, 2014, Fr. 28.90
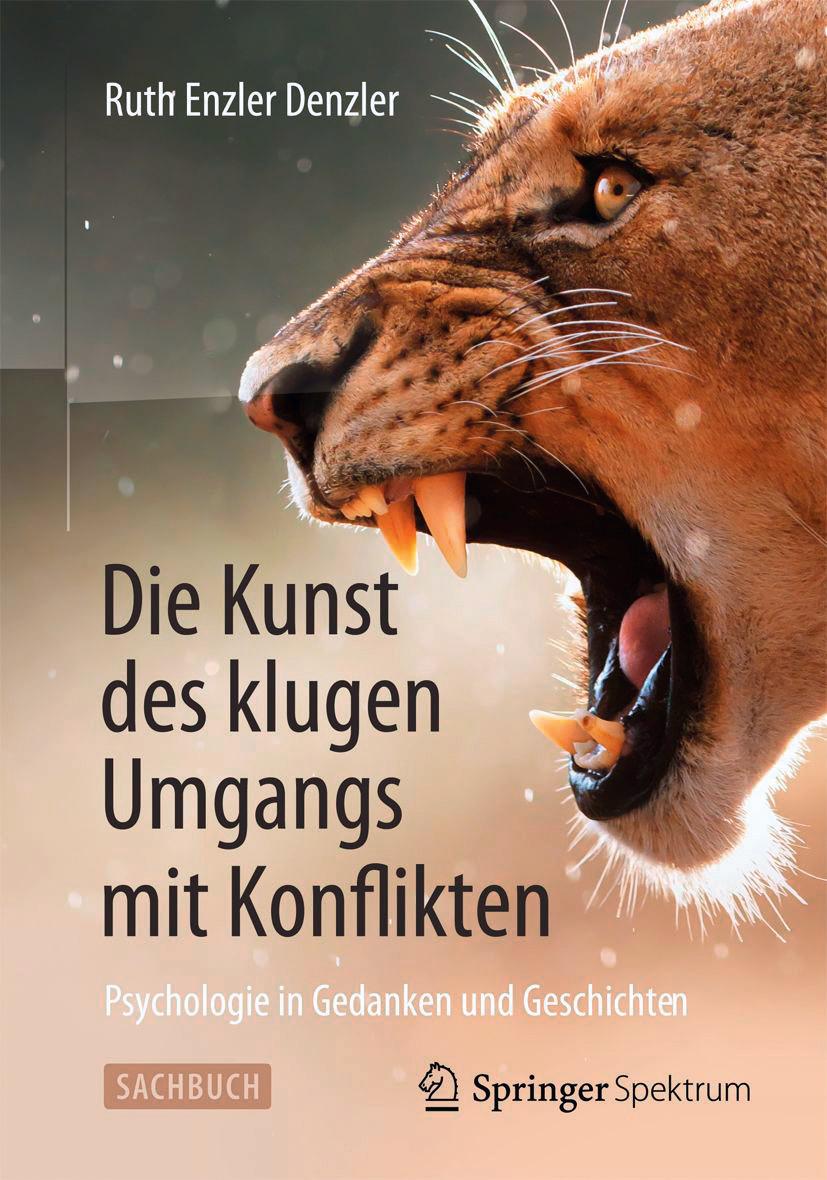
Schwangerschaft_ Zu viel Jod
IForschung_ Pflanzliches Antibiotika
Die Suche nach neuen Antibiotika ist angesichts der zahlreichen, teilweise lebensgefährlichen Krankenhausinfektionen und der zunehmenden Resistenzen gegen gängige Wirkstoffe ein dringendes Problem. Forscher der Jacobs University in Bremen haben möglicherweise eine Lösung gefunden: Sie entdeckten in Rhododendren Substanzen mit antibakterieller Wirkung. Bereits seit zwei Jahren erforscht das Team um den Mikrobiologen Matthias Ullrich, ob in den Pflanzen Wirkstoffe für neue Arzneimittel, etwa für Antibiotika oder für die Krebsbehandlung, enthalten sind. Rund 600 verschiedene Substanzen haben die Forscher extrahiert, von denen 120 genauer analysiert wurden. «Wir sind mindestens einer neuartigen Substanz auf der Spur, die einmal als Antibiotikum eingesetzt werde könnte», sagt Ullrich. Bis zur klinischen Erprobung neuer Medikamente auf Basis der Rhododendren wird es noch einige Zeit dauern. «Wir wissen, was die neuen Substanzen können. Aber wir verstehen ihre Wirkungsweise noch nicht.» Drei bis fünf Jahre, schätzt er, könnte dies in Anspruch nehmen. MM



n den USA greift manch eine lieber zu Nahrungsergänzungsmitteln als zu gesunden, natürlichen Lebensmitteln. Nun kommen dort immer mehr Babys mit einer Unterfunktion der Schilddrüsen zur Welt (Europäisches Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften).
Grund dafür: Die Empfehlung, während der Schwangerschaft zusätzlich Jod einzunehmen. Über die Plazenta gerät dieses in den Organismus des Ungeborenen, welches das Zuviel an Jod nicht abbauen kann. Um eine Überproduktion von Thyroxin zu verhindern, fährt der Fötus die Produktion des jodhaltigen Hormons herunter. Da auch in der Schweiz Schwangeren empfohlen wird, zusätzliches Jod zu nehmen, empfiehlt es sich, Risiken und Nutzen mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin zu besprechen. tha
Es geht auch ganz ohne Sport: Regelmässiges Spazieren – oder zügiges Gehen – hilft nachhaltig die Gesundheit zu erhalten und Arthrose zu lindern.

Es ist eine Binsenwahrheit. Doch nichtsdestotrotz kann man es immer wieder sagen: Gehen ist gut für die Gesundheit. Ob für das Herz, die Muskulatur, die Blutfettwerte oder das seelische Wohlbefinden – so bequem und erst noch gratis gibt es Gesundheitsvorsorge kein zweites Mal.
Gerade auch Menschen mit Gelenk- oder anderen Knochenerkrankungen sollten sich das zu Herzen nehmen. So bekommen viele Patienten mit einer Kniegelenksarthrose irgendwann Schwierigkeiten, von einem Stuhl aufzustehen oder Treppen zu steigen. Täglich 6000 Schritte zu gehen, könnte derartigen Bewegungseinschränkungen vorbeugen helfen. Das gilt sowohl bei bereits vorhandendem Gelenkverschleiss als auch bei einer erhöhten Gefährdung. US-Forscher vom Sargent College an der Boston University in Massachusetts hatten bei 1788 Arthrose-Patienten und solchen mit einem erhöhtem Risiko das Laufverhalten und die damit verbundenen Mobilitätseinschränkungen zwei Jahre später untersucht. Bereits 1000 Schritte zusätzlich am Tag verringerten die Bewegungseinschränkungen um 16 bis 18 Prozent. Als ideal erwiesen sich 6000 Schritte täglich. Studienleiter Dr. Daniel White empfiehlt Betroffenen, wenigstens 3000 Schritte am Tag zu absolvieren und die Laufmenge allmählich auf 6000 Schritte zu erhöhen. Die WHO empfiehlt gar 10 000 Schritte täglich, um die körperliche und geistige Vitalität zu steigern. Das entspricht einer Strecke von 6,3 bis 7,3 Kilometern. Zugegeben: Nicht eben eine Distanz, die man täglich zurücklegen will oder kann. Der österreichische Sportmediziner Josef Niebauer riet gegenüber medizinpopulär.at: «Wer weniger weit gehen möchte, kann bewusst grössere Schritte machen und die Gehgeschwindigkeit steigern, um sich in kürzerer Zeit gleich viel Gutes zu tun.» Da reicht es dann schon, an drei Tagen pro Woche eine halbe Stunde in das Gehen zu investieren und 5000 Schritte zurückzulegen. «Dann sollte man aber so flott gehen, dass man dabei ein wenig ausser Atem und ins Schwitzen kommt», so Niebauer. MM/tha
Viel gelobt und oft gescholten, ist sie in aller Munde und steckt als Schreckgespenst in den Köpfen: die Radiologie. Eine Spurensuche mit erstaunlichen Resultaten.
Text: Heinz Haug
Wir Menschen machen uns gern ein Bild. Bilder helfen: beim Erinnern an die Schulzeit, die erste Liebe, die Autopanne im Gotthardtunnel. Der Volksmund weiss: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Die Radiologie macht Bilder. Nicht nur –aber hauptsächlich. Sie macht Bilder vom Inneren des Menschen. Dabei bedient sie sich der unterschiedlichsten Methoden.
Die vier in der Schweiz am häufigsten angewendeten sind: Ultraschall, Röntgen, Magnetresonanz-Tomografie (MRI) und Computertomografie (CT). Für Ultraschall und das klassische Röntgen sind kaum verlässliche Zahlen zu bekommen. Denn fast jede Hausarztpraxis verfügt über ein Ultraschallgerät. Jeder Zahnarzt röntgt regelmässig das Gebiss seiner Patienten. Und jeder Orthopäde röntgt in seiner Praxis rasch einmal ein Knie. Allesamt Untersuchungen ohne oder mit lediglich geringer Strahlenbelastung.
Bei den MRI und CT- Untersuchungen hingegen gibt es Zahlen: Gemäss des Krankenkassenverbands Santésuisse sind im Jahr 2011 rund 520 000 MRI- respektive 385 000 CT-Untersuchungen durchgeführt worden. Zu viele, wie Kritiker monieren.
«Nicht unbedingt», sagt der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR) Tarzis Jung, «eine radiologische Abklärung wird immer auf Wunsch eines Arztes durchgeführt, der sich davon Klarheit über ein Krankheitsbild erhofft. Eine gemeinsam abgesprochene radiologische Untersuchung, die keine Krankheit zeigt, muss nicht unnötig sein. Im Gegenteil: Sie kann beruhigen und unnötige, kostspielige weitere Abklärungen oder Therapien verhindern.»
Laut aber harmlos
Eine MRI-Untersuchung ist nicht angenehm: Es rumpelt und lärmt in der Röhre, viele Patientinnen und Patienten fühlen sich dabei nicht wohl. Für den Körper aber bleibt die Untersuchung völlig harmlos und kann, wenn indiziert, auch wiederholt werden.
Anders sieht es bei der Computertomografie aus. Diese arbeitet mit Röntgenstrahlen. Dabei liegt die Strahlenbelastung oft höher als bei einer herkömmlichen Röntgenuntersuchung. Rahel Kubik, Chefärztin Radiologie am Kantonsspital Baden sagt: «Die Strahlenbelastung ist abhängig von der zu untersuchenden Re-
gion. Die heute zur Verfügung stehenden Geräte reduzieren die Strahlenbelastung auf das absolut notwendige Minimum. Eine CT wird nur angewendet, wenn der höhere Informationswert die Strahlenbelastung auch rechtfertigt. Wir Radiologinnen und Radiologen nehmen im Zweifelsfall mit den zuweisenden Ärzten Kontakt auf und machen sie, wenn immer möglich, auf ein alternatives bildgebendes Verfahren aufmerksam, das für die Diagnosestellung aber trotzdem Bilder in ausreichender Qualität liefert.»
Wie viel Strahlung?
Um besser zu verstehen, wie intensiv die Strahlenbelastung einer entsprechenden radiologischen Untersuchung ausfällt, helfen Vergleiche. Eine Computertomografie des Schädels zum Beispiel entspricht der natürlichen Strahlendosis, der ein Mensch im Laufe eines Jahres in der Schweiz ausgesetzt ist. Das konventionelle Röntgen der Lungen kommt in etwa der Strahlenbelastung eines Fluges über den Atlantik gleich. In konkreten Zahlen: Die Umgebungsstrahlung pro Jahr beträgt in der Schweiz 2,8 Millisievert (mSv). Ein Röntgenbild des Beckens schlägt mit 0,7 mSv

























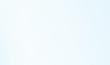









































































Paarkurse in Luzern










Investieren Sie in Ihre Beziehung!




«ZusammenStreiten»
31 Okt. – 2. Nov 2014 «ZusammenSpiel»










27 Febr – 1. März 2015 Info: www.paarweise .ch






































Ausbildungen-Seminare zur Klangschalen-Therapeutin mit Zertifikat






















Info/Unterlagen E. Hauser, Tel. 079 377 25 80 www.gesundheitspraxis-hauser.ch ausgebildet in: Peter Hess, Klang mit Essenzen, Klang in Ayur veda

2_Yoga_University_Lehrerin_90x64_2_Yoga_University_Lehrerin_90x64
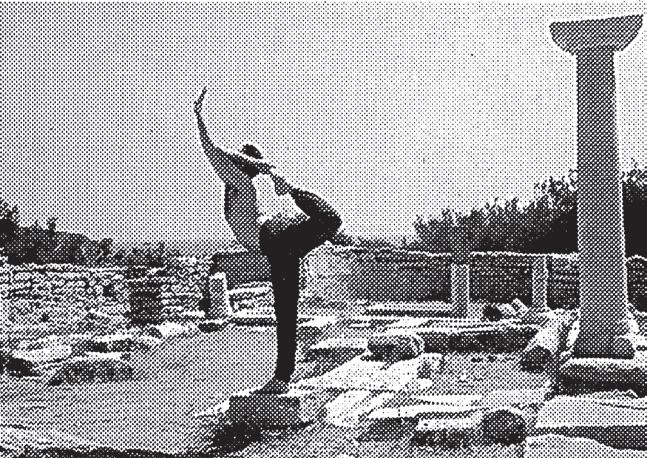

Yoga University Villeret
Diplomausbildung des Schweizer Yogaverbandes zum /zur
Beginn: Oktober 201
■ Mit Diplom des Schweizer Yogaverbandes / EYU anerkannt
■ Mehr als zehn international bekannte DozentInnen öffnen das Tor in ein neues bereicherndes Berufsleben.
Yoga University Villeret, Rue Neuve 1, CH-2613 Villeret Tel. 032 941 50 40, Fax 032 941 50 41, www.yoga-university.ch
Theorie und Praxis in Tibetischer Entspannungsmassage.
Grundkurs 17. & 18. Okt. 2014 in Aarau Infos unter 078 684 09 72 oder www.freunde-tibetischer-medizin.ch


ein-klang GmbH – Peter Hess Akademie Schweiz
Das Schweizer Zentrum für Aus- und Weiterbildung in der Peter Hess Klangmassage und Klangmethoden Praxis für Klangmassage, Klangtherapie und Energiearbeit
Online-Shop und Vertrieb von Klangschalen, Gongs und Zubehör Tel. +41 79 464 95 43, www.ein-klang.ch • willkommen@ein-klang.ch

Info-Abend: 23. Okt.
3 Jahre, ASCAu. SGfB-anerk.

Info-Abend: 9. Sept.
3 Jahre SGfBanerkannt









































«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt» Dr med. Y. Maurer
Berufsbegleitende anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:
Dipl. Ernährungs-Psychologische(r) Berater(in) IKP
Humanistische Psychologie: Sie lernen, Menschen mit Ernährungsproblemen ganzheitlich in ihrer aktuellen Lebenssituation zu beraten und eignen sich fundiertes Ernährungsfachwissen an.
Dipl. Partner-, Paar- und Familienberater(in) IKP
Ganzheitliche systemische Psychologie: Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung rund um Beziehungsprobleme
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden.
Ausbildungsinstitut IKP Zürich und Bern
Seit 30 Ja hren anerkannt




















09.30 - 17.00 Uhr









Die Krankheitsbilder unserer ZeitBedeutung und Wege zur Heilung
18.00 - 22.00 Uhr























Krankheit als Sprache der Seele und der Kinderseele




























Ayur veda-Pension








SHI Haus der Homöopathie







Steinhauserstrasse 51 • 6300 Zug 041 748 21 77 • www.shi.ch
Quelle für Körper, Seele und Geist
Ayur veda-Kuren im Le Cocon Gönnen Sie sich Zeit und lassen Sie sich Ihrer Gesundheit zuliebe ver wöhnen. Persönliche, auf Ihre Bedür fnisse abgestimmte Behandlungen und Massagen wir ken entschlackend, entspannend und nährend. Johanna Wäfler und Mar kus Dür st freuen sich auf Sie.
Unser Angebot: 5-t ägige Individualkuren zum entschlacken und regenierieren. Von Sonnt agabend bis Freit agabend.
Ayur veda-Pension Le Cocon, rue de la Combe-Grède 33, CH-2613 Villeret Tel. 032 941 61 63, mail@lecocon.ch, www.lecocon.ch
Living Matrix mit J. Oschman am 26.10.2015

Ve rlangen Sie das Programm und Infos: info@cranialinstitute.com www.cranialinstitue.com Te l. 044-451 21 88 25 Jahre
Aus- und Fo rtbildungen in Craniosacral, Energiemedizin und Myofascial Release
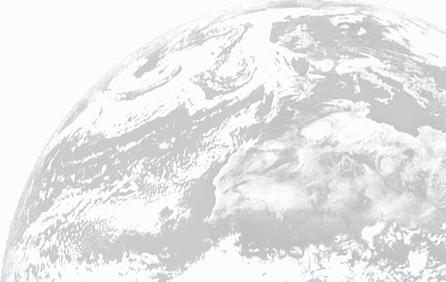

Waldbeersaft als Kontrastmittel lässt den Magen-Darm-Trakt «verschwinden» und macht die zu untersuchenden Gallengänge besser sichtbar.
zu Buche. (Die Masseinheit ist nach dem schwedischen Physiker Rolf M. Sievert benannt.)
Blaubeerensaft als Kontrastmittel
Um die bildliche Darstellung zu verbessern, arbeitet die Radiologie manchmal auch mit Kontrastmitteln. Je präziser sich einzelne Organe und je genauer sich Strukturen bildlich darstellen lassen, desto einfacher fällt es den Fachärzten, die Diagnose zu stellen.
John Fröhlich ist Apotheker und medizinischer Direktor eines weltweit führenden Kontrastmittelherstellers. Wer meint, er sei auf Technik und Chemie eingeschworen, der irrt. Wem eine radiologische Untersuchung bevorsteht, dem rät er erst einmal alles Belastende – wenn immer möglich – zur Seite zu schieben und sich gut vorzubereiten. So sollten Allergiker beispielsweise in der Heuschnupfenzeit darauf achten, dass sie nicht mit aufgequollenen Augen und angeschwollen Schleimhäuten zur Untersuchung kommen. Es gilt, das Immunsystem ins Gleichgewicht zu bringen. Die körpereigenen Abwehrkräfte sollen nicht überschiessen, sondern in geordneten Bahnen reagieren. Zudem können die Nieren durch viel Trinken geschützt werden. Am besten schon zwei, drei Tage vor der Untersuchung beginnen. John Fröhlich braucht das Bild vom ausgetrockneten Bachbett: «Je weniger Wasser fliesst, desto einfacher können sich Ablagerungen bilden. Je mehr Wasser fliesst, desto besser wird Schädliches ausgeschwemmt.»
Nicht jedes Kontrastmittel muss nach dem Untersuch extra ausgeschwemmt werden. Ganz hervorragend zur Dar-

stellung des Magen-Darm-Traktes in der Magnetresonanz-Tomografie eignet sich beispielsweise der Saft von Blaubeeren. Allen voran der Biotta-Wald-HeidelbeerSaft. Der Apotheker führt dies auf den hohen Gehalt an Mangan und Eisen zurück. Braucht es trotz allem chemische Kontrastmittel, dann gilt es, sich gegen allergische Reaktionen zu wappnen, die Funktion der Nieren zu unterstützen und die Schilddrüse zu schützen. Jodhaltige Kontrastmittel belasten die Schilddrüsen. Deshalb sollen die Schilddrüsen mit natürlichem Jod «gefüllt» werden. Das künstliche Jod bekommt so keine Chance anzudocken und wird ausgeschwemmt.
Stress für den Körper
Strahlenbelastung heisst für den Körper auch einen erhöhten oxydativen Stress mit einer vermehrten Bildung von freien Radikalen. Die richtige Ernährung kann helfen, die Zellen vor freien Radikalen zu schützen.
Natürliche Antioxidantien finden sich vor allem in frischem Obst und im Gemüse. Die besten Radikalfänger auf einen Blick: Vitamine A, C und E, Zink, Selen, Mangan, Co-Enzym Q10 und Gelée royale. Ob Schul- oder Alternativmedizin – alle raten, das Immunsystem vor und nach einem Untersuch auf Vordermann zu bringen. Die Spagyrik (Griechisch für herausziehen, trennen) bietet eine grosse Auswahl an Tinkturen.
Um den Stoffwechsel und die Ausscheidung des Zwischenzellgewebes anzuregen,
werden in der anthroposophischen Therapie Präparate mit Moorextrakt, Rosskastanie und Schachtelhalm empfohlen: zum Beispiel Solum uliginosum Globuli und/ oder Öl. Das Öl nicht vor einer Untersuchung auftragen, sondern erst danach. Zusätzlich kann eine Unterstützung der entgiftenden und ausleitenden Organsysteme sinnvoll sein. Hierzu eignen sich Präparate oder verschiedene Tees aus Extrakten des Löwenzahns, der Brennnessel, der Birke, der Goldrute und des Schachtelhalms.
Fazit: Die Radiologie steht nicht im Widerspruch zur Natur oder dem Streben nach einer umweltgerechten, natürlichen Medizin. Die genaue bildliche Darstellung und das Erkennen einer Krankheit erlauben ein rasches Handeln und lassen die Patienten bei der Wahl der Therapie von Anfang an autonom mitentscheiden. u
Was macht die Radiologie?
Untersuchungen ohne Strahlenbelastung: Ultraschall, MRI
Untersuchungen mit Strahlenbelastung: CT, Mammografie, Durchleuchtung, Röntgen
Radiologen greifen auch ein: Und zwar bildgesteuert und minimalinvasiv.
Zum Beispiel für die Entnahme von Gewebe oder die Erweiterung eines verengten Gefässes.
Informationen auf: www.sgr-ssr.ch
«Musse ist der schönste Besitz von allen.» Dieses Zitat von Sokrates trifft mehr denn je ins Schwarze. Die zunehmende Geschwindigkeit in unserem Alltag fordert ihren Tribut: Wir leiden unter Schlafstörungen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen. Die Entspannungs- und Achtsamkeitslehrerin Lioba Schneemann zeigt in einer sechsteiligen Serie Wege auf, wie wir wieder zu mehr Musse und Gelassenheit kommen.
Text: Lioba Schneemann

Lioba Schneemann zeigt Menschen, wie sie sich entspannen und achtsamer leben können. Sie gibt Kurse in der Umgebung von Liestal. www.schneemannentspannt.ch
Ein entspanntes Leben führen
Wer möchte nicht auch auf den Wellen im stürmischen Ozean des Lebens mit mehr Gelassenheit surfen? Doch wir hetzen von einem Termin zum anderen und fühlen uns als Opfer der Umstände. Dabei ist es nicht schwer, zu lernen, mit Stress – und vor allem mit den angelernten Reaktionen darauf – konstruktiver umzugehen. Wir sind den Wellen nicht machtlos ausgeliefert, auch wenn sie noch so hoch sind.
Entspannungsverfahren haben sich zur Vorbeugung und Behandlung von stressbedingten Beschwerden bewährt. Wem es gelingt, Entspannungsübungen in den Alltag zu integrieren, baut sich schwimmende Inseln, die ihn oder ihr bei stürmischer See vor dem Ertrinken retten. Gefühle von mehr Gelassenheit und Entspanntheit stellen sich rasch ein.
Das Ruder in der Hand halten Unsere innere Einstellung bestimmt, ob wir uns von Herausforderungen mitreissen lassen oder nicht. Stellen Sie sich die nächste Zeit wiederholt diese Fragen: «Was ist schlimmer, die Stress auslösende Situation, die mir Sorgen bereitet und mich in die Luft gehen lässt? Oder ist es meine Reaktion auf die Situation, die mich belastet?»
Eine typische Alltagssituation zeigt, wie einfach wir Einfluss nehmen können: Wie reagieren Sie in der Regel, wenn das Telefon klingelt, während Sie gerade in etwas vertieft sind? Nehmen Sie sofort den Hörer ab? Versuchen Sie einmal beim nächsten Anruf zuerst dreimal tief durchzuatmen, bevor sie das Telefon abnehmen. Vielleicht merken Sie, dass Sie dadurch im folgenden Gespräch wirklich präsent sind.


Und Sie werden sich so auch nicht so leicht als Opfer des Telefons fühlen. (Nebenbei: Wer sagt, dass Sie das Telefon abnehmen müssen? Sie haben meist die Freiheit, in einem passenderen Moment zurückzurufen.)
Spannungen lösen
Selbstverantwortung ist denn auch bei allen verschiedenen Entspannungsmethoden ein zentrales Element: Jeder kann sich in jedem Moment des Lebens entscheiden, ob er oder sie angespannt oder gelöst bei einer Sache ist. Dazu muss man jedoch zuerst einmal ein besseres Körpergefühl entwickeln.
Bei der progressiven Muskelentspannung nach Edmund Jacobson (US-amerikanischer Arzt 1888 –1983), bei welcher Muskelgruppen nacheinander angespannt und losgelassen werden, steht die Schulung der Körperwahrnehmung im Fokus. Spannungen werden damit lokalisiert und gezielt gelöst. Es ist zudem eine einfache Methode, um Achtsamkeit einzuüben. Andere bekannte Methoden zur Entspannung und zum Umgang mit Stress sind Atemtraining, Autogenes Training, Imagination sowie Bio- und Neurofeedback. Dazu gesellen sich weitere Verfahren, die zwar auch entspannen, jedoch keine klassischen Entspannungsverfahren sind, wie zum Beispiel Achtsamkeitsmeditation und Körperübungen (Yoga, Qi Gong). Egal für welche Methode man sich entscheidet –es ist ein Entscheid für ein bewusstes, reicheres Leben. «Entspannung ist ein Lebensstil», schrieb Jacobson. u
Buchtipp
_ Cornelia Löhmer, Rüdiger Standhardt: «Die Kunst, im Alltag zu entspannen», Klett-Cotta
Übung Nr. 1: Der Atem
Unser Atem ist immer da und verbindet Körper und Geist, beruhigt und konzentriert uns. Diese Übung ist ideal für Einsteiger. Setzen Sie sich aufrecht hin, schliessen Sie die Augen und nehmen Sie wahr, wie Sie sitzen, spüren Sie den Kontakt mit dem Boden oder der Sitzfläche. Es gibt nichts zu tun, spüren Sie nur die Atmung an der Bauchdecke. Beobachten Sie, wie der Atem ganz von selbst kommt und geht. Nehmen Sie das Fliessen des Atems bewusst wahr, das Ein- und das Ausatmen. Stellen Sie sich vor, wie mit jedem Atemzug etwas mehr Spannung und Schwere von Ihnen abfällt. Wenn der Geist unruhig ist, zählen Sie während der Atemzüge mit, von 1 bis 10. Nehmen Sie wahr, wie sich Ihr Körper immer mehr entspannt. Seien Sie sanft und freundlich mit sich selbst. Geniessen Sie bewusst und einige Minuten lang dieses angenehme Gefühl.
Machen Sie diese Übung «3 × 3 Minuten» täglich. Etablieren Sie sie in den Alltag.
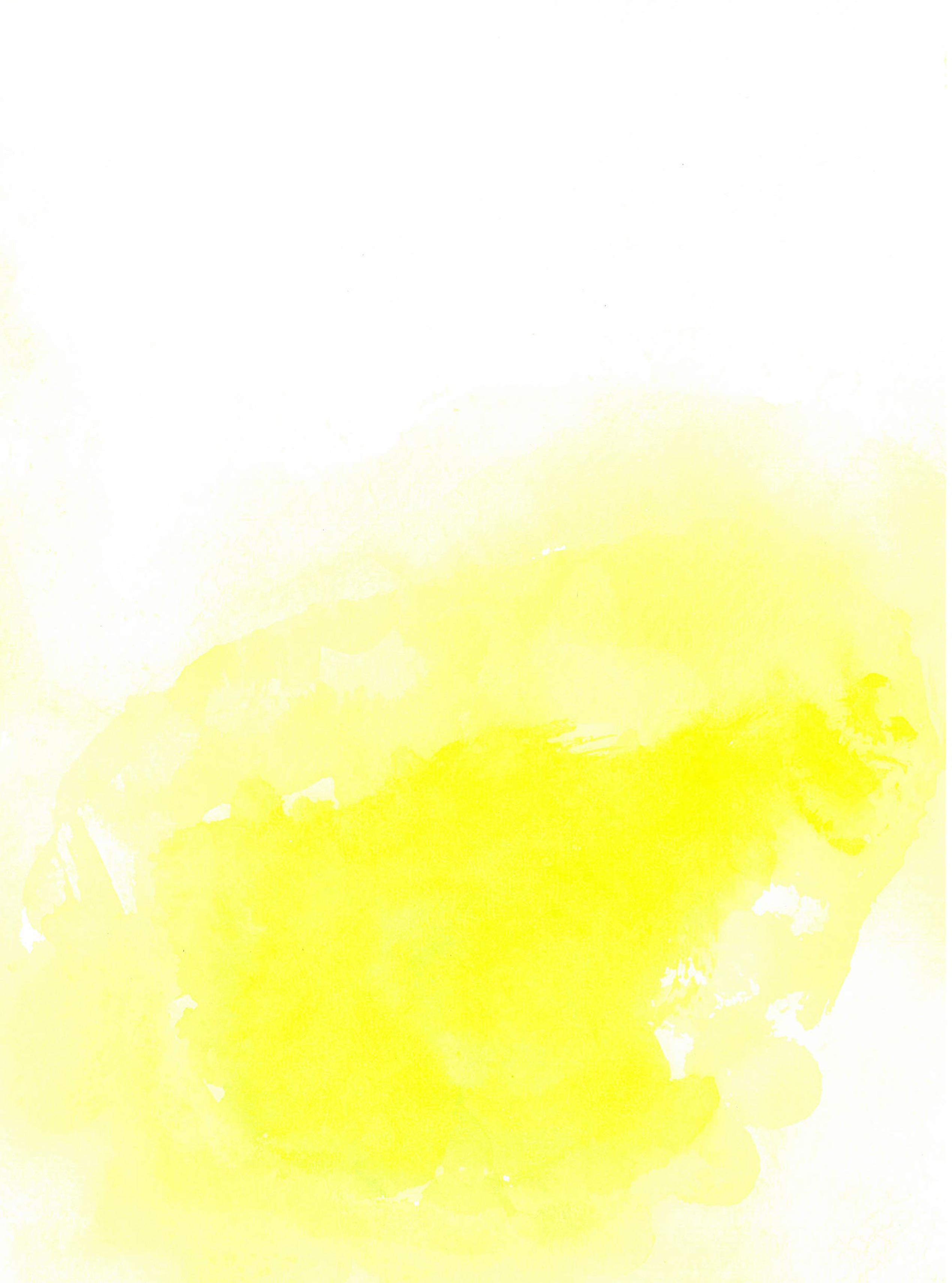

Wenn emotionaler Druck und Stress den Alltag prägen, sind Erholungsphasen umso wichtiger. Die Passionsblume bietet pflanzliche Hilfe beim Herunterfahren.
Text: Sabine Hurni
Nervosität wurde einst als eingebildete «Modekrankheit» der noblen Oberschicht abgetan. Man vermutete, dass die nervöse Unruhe durch eine Reizüberflutung verursacht werde.
Heute weiss man, dass Nervosität mitnichten ein belangloses Krankheitsbild ist und dass das rasche Tempo im Alltag und die Unmengen an Informationen und Reizen das menschliche Nervenkostüm zunehmend auf die Probe stellen. Herzrasen, Schlafstörungen und Angstzustände können die Folge sein. Es wundert deshalb nicht, dass Entspannungsmethoden wie Yoga, Achtsamkeitsübungen (siehe Artikel Seite 14) und Meditation das Interesse des ruhelosen Zeitgenossen wecken. Regelmässige Meditationsübungen und/oder ein Achtsamkeitstraining helfen, konzentriert im Moment zu leben und Energien zu bündeln. Achtsamkeit üben und gedanklich bei dem bleiben, was man gerade tut, kann ganz einfach im Alltag integriert werden: Beim Bügeln beispielsweise gleitet die Aufmerksamkeit mit dem Bügeleisen über die Wäsche. Beim Spazieren ist die Aufmerksamkeit auf die Füsse gerichtet oder auf die Blumen und Vorkommnisse am Wegrand. Beim Warten auf den Zug konzentriert man sich auf die in die Nase strömende Atemluft.
Wie das Nervensystem arbeitet
Wer es schafft, sich wie beschrieben auf einen Moment oder eine Aktion zu fokussieren, beruhigt sein vegetatives Nervensystem sehr effizient. Dieses wird vom Parasympathikus und vom Sympathikus gesteuert. Der Sympathikus ist tagsüber aktiv. Das Herz schlägt schnell, die Pupillen sind gross, die Blutgefässe verengen sich, der Blutdruck steigt, die Verdauung wird langsamer, die Atmung beschleunigt sich und die Schweissproduktion nimmt zu. Auch die Muskelspannung und die Speichelproduktion sind am Tag höher als nachts. Je grösser der Stress, desto stärker sind die Nerven und die Körperfunktionen aktiviert. Wir können sofort reagieren, wegrennen oder angreifen. Erst wenn der Druck nachlässt, wenn man zu Hause ins sichere Sofa sinkt oder wenn man den Alltagsstress mit Sport gelöst hat, kann sich das SympathikusNervensystem beruhigen.
Jetzt wird der Parasympathikus aktiv. Das Herz wird ruhig, die Pupillen verengen sich, die Blutgefässe werden weiter, der Blutdruck sinkt und die Atmung wird ruhiger. Der Körper entspannt sich. Genau dasselbe passiert beim Meditieren. Der Parasympathikus ist aktiv und der Köper erholt sich. Fast, als würden wir ein paar Stunden schlafen. Der Wechsel zwischen
Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist
für das menschliche
Überleben eine äusserst wichtige Körperfunktion.

Anspannung und Entspannung ist für das menschliche Überleben eine äusserst wichtige Körperfunktion. Funktioniert das System bei Dauerstress oder bei starkem, emotionalem Druck nur noch im Sympathikusmodus, ist ein Herunterfahren kaum mehr möglich. Die Folge davon sind innere Unruhe, Leistungsdruck, Schlafstörungen, diffuse Ängste, Herzklopfen und Nervosität.
Die schöne Helferin
Lassen der Stress und der äussere Druck über längere Zeit nicht nach, kann das System mithilfe von Heilpflanzen etwas beruhigt werden. Während Baldrian und Hopfen insbesondere bei Schlafstörungen Verwendung finden, ist bei nervösen Unruhezuständen das Passionsblumenkraut das Heilmittel der Wahl. Die Passionsblume (Passiflora incarnata) hilft bei Schlaflosigkeit, nervlich bedingter Überreizung, Depressionszuständen und bei Hysterie. Auch nervöse Herzbeschwerden und krampfartiges Asthma kann die Passionsblume erfolgreich lindern. Das Kraut der wunderschön blühenden Passionsblume enthält wertvolle Inhaltstoffe wie Flavonoide und Glykoside.
In vielen pflanzlichen Heilmitteln und Tees wird die Passionsblume in Kombination mit Baldrianwurzel, Hopfenzapfen und Melissenblättern verwendet. Das hat den Vorteil, dass das Wirkungsspektrum breiter wird. Für die Zubereitung eines Beruhigungstees werden zwei Gramm fein geschnittene, getrocknete Pflanzenteile


l Mikronährstoffe: In hektischen Zeiten verbraucht der Körper Unmengen an Kalzium, Magnesium, Eisen, B-Vitaminen und Vitamin C. Fehlt die Zeit für eine ausgewogene Ernährung, kann ein Stärkungsmittel oder ein Multivitaminpräparat die schnelle Verpflegung vorübergehend aufpeppen. Wenn die Unruhe von Ängsten begleitet ist, helfen hochdosierte Kalzium-Magnesium-Präparate.
l Nervenfutter: Liegen die Nerven blank, sind Schokolade und Süssigkeiten oft willkommene Trostspender. Sie lassen den Blutzucker aber schnell in die Höhe schnellen. Nach kurzer Zeit sinkt der Blutzuckerspiegel bereits wieder und es folgt ein Zustand der Unterzuckerung. Die Konzentration lässt nach und die Leistungsfähigkeit nimmt massiv ab. Besser sind Lebensmittel, die effektive und lang anhaltende Energie liefern. Zum Beispiel eiweissreiche, warme Mahlzeiten mit Hülsenfrüchten, Fisch, Fleisch und Milchprodukten. Dazu sehr viel Gemüse und Kartoffeln. Als Zwischenverpflegung eignen sich Datteln, Feigen, frische Früchte, Nüsse und Kernen. Diese Kraftpakete geben dem Körper die Nährstoffe, welche er wirklich braucht.
l Entspannung finden: Ist der Tag stressig, sollten die Abende umso ruhiger verbracht werden. Die einen finden den Ausgleich im Sport, andere
Passionsblume hilft bei Stress.
in der Kreativität oder im Garten. Besonders wohltuend ist auch die Entspannung in der Badewanne. Ein Melissen-, Hopfen- oder Lavendelbad beruhigt den Körper und den Geist.
l Viel trinken: Das Nervensystem braucht Flüssigkeit. Besser als aufputschende Getränke wie Kaffee oder Energiedrinks sind reines Wasser, Kräutertee, weisser- und grüner Tee, Karotten- oder frisch gepresster Orangensaft.
l Bewusst atmen: Normalerweise atmet der Mensch acht bis zwölf Mal pro Minute ein und aus. Fühlt man sich ängstlich oder nervös, sollte man nur noch höchstens sechs Mal pro Minute atmen und die Konzentration ganz auf das Ein- und Ausatmen lenken (siehe Artikel Seite 14). Das beruhigt und lenkt von den beängstigenden Gedanken ab. Idealerweise atmet man durch die Nase ein und vom Bauch her durch die knapp verschlossenen Lippen aus.
l Langsam essen: Mahlzeiten, die in entspannter, friedlicher Atmosphäre eingenommen werden, sind besonders bekömmlich. Gespräche über Alltagssorgen und Stresssituationen sollten nicht bei Tisch besprochen werden. Besser ist es, die Aufmerksamkeit und das Gespräch ganz auf das Essen zu richten. So wird die Mahlzeit bewusst gegessen und nicht gedankenverloren einverleibt.
mit kochendem Wasser überbrüht. Davon trinkt man täglich zwei bis drei Tassen oder abends vor dem Zubettgehen eine bis zwei Tassen. Die maximale Tagesdosis beträgt vier bis acht Gramm. Im Handel gibt es die Passionsblume aber auch als Tinktur oder Tabletten zu kaufen.
Passiflora incarnata ist im Südosten von Nordamerika heimisch. Ebenso auf den BermudaInseln, den Antillen und in Mexiko sowie in Brasilien und Argentinien ist die Passionsblume anzutreffen. In diesen warmen Gegenden wächst auch die nahe Verwandte Passiflora edulis mit ihren süsssäuerlichen MaracujaFrüchten.
Passionsblume wächst auch bei uns
Doch auch bei uns kann die Passionsblume gut gedeihen. Sie mag trockene, nicht allzu fruchtbare Böden, feuchte Erde und viel Sonne. Fühlt sie sich wohl, kann die mehrjährige und holzige Klettepflanze bis zu zehn Meter hochwachsen. An einem sonnigen Plätzchen blüht die Pflanze bis in den Herbst hinein. Die fleischfarbene und die blaue Passionsblume können sowohl als Kübelpflanze wie auch als Gartenpflanze gehalten werden. Als Kübelpflanze ist die Passionsblume nicht winterhart und auch im Freiland muss man die Wurzeln im Winter mit einer dicken Laubschicht bedecken, damit sie nicht erfriert.
Der Gattungsname Passiflora wird vom lateinischen passio (Leiden) und flos (Blume) abgeleitet. Offenbar hat der symbolhafte Bau die europäischen Missionare in Südamerika an die Peinigung von Christus erinnert. Die drei Narben sollen Nägel darstellen, der Fadenkranz die Dornenkrone, der gestielte Fruchtknoten den Kelch, die fünf Stabblätter die Wundmale, die Laubblätter die Lanze, die Ranken die Geisseln und die weisse Farbe die Unschuld des Erlösers. ◆






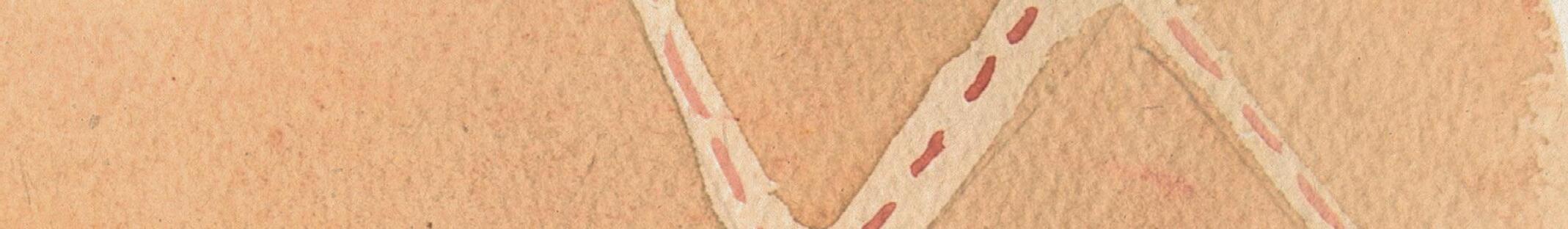







Haben Sie Fragen?
Sabine Hurni, Drogistin HF und Naturheilpraktikerin mit Fachrichtung Ayurveda und Phytotherapie, und das kompetente «natürlich»-Berater-Team beantworten Ihre Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Ökologie, Garten oder Natur.
Senden Sie Ihre Fragen an: sabine.hurni@azmedien.ch oder «natürlich», Leserberatung Neumattstrasse 1, 5001 Aarau
Rat & Tat per Internet Fragen können Sie auch auf unserer Website www.natuerlich-online.ch stellen. Das «natürlich»-Berater-Team ist unter der Rubrik «Beratung» online für Sie da.
Fehlgeburt
Mir wurde in der 10. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt diagnostiziert und eine Curretage empfohlen. Gestern hatte ich starke Schmerzen und Blutungen. Ich gehe von einer «natürlichen Fehlgeburt» aus. Wie könnte ich meinen Körper unterstützen? Soll ich die Curretage trotzdem machen? C. W., Wil
Die Curretage ist in der Tat eine umstrittene Methode, die oft ohne richtige Aufklärung und ohne Aufzeigen von Alternativen angewendet wird. Dabei hätte sich die Menschheit gar nicht entwickeln und fortpflanzen können, wenn der weibliche Körper nach einer frühen Fehlgeburt auf ärztliche Hilfe angewiesen wäre. Auf der Website von «Die Zeit» finden Sie einen guten, kritischen Artikel zum Thema (Titel: «Es geht auch ohne Operation»).

Sprechen Sie sich unbedingt mit der Frauenärztin ab. Allenfalls kennt sie Medikamente, welche die Abstossung der Schleimhaut zusätzlich fördern.
Auf pflanzlicher Ebene können Sie diesen Effekt mit Brennnessel, Schafgarbe und Frauenmantel erreichen. Die Brennnessel schützt vor zu viel Eisenverlust und fördert die Ausscheidung. Die beiden anderen Heilpflanzen stärken die Geschlechtsorgane und gleichen den Hormonhaushalt aus.
Falls Sie sich doch noch für eine Curretage entscheiden, können Sie dieselben Heilpflanzen einsetzen, um die Gebärmutter nach dem Eingriff wieder zu stärken. Sabine Hurni
Zu viel Hitze im Körper und im Kopf
Ich habe immer wieder einen stark erhitzten Kopf. Manchmal in Stresssituationen, manchmal aber auch scheinbar grundlos. Dies führt zu Kopfschmerzen und Schmerzen auf den Augen. Was kann ich (vorbeugend) dagegen tun?
D. M., Hinwil
WasSie schildern, ist die Kombination von viel Stress und Hitze. Mit ayurvedischen Augen betrachtet, sitzt in Ihrem Magen ein Feuer. Es verbrennt die Lebensmittel und wandelt sie von etwas Körperfremdem zu etwas Körpereigenem. Eine sanfte Brise hält das Feuer am Leben. So der Normalfall. Stress verwandelt diese Brise zu einem Wirbelwind, der – bildlich gesprochen – nicht mehr vom Mund hinunter zum Darm bläst, sondern wirr im Körper herumwirbelt. Wenn Sie bei Stress mehr Kaffee trinken oder ungesünder essen, schüren Sie dieses Feuer.
Vermutlich neigen Sie auch zu Verstopfung während der Kopfschmerzen. Das heisst, die Hitze kann nicht über den Stuhlgang weg und geht in den Kopf hoch. Ziel ist es, dass Sie die Hitze besser ausleiten können und weniger Hitze produzieren.
Erhitzend wirken Koffein, Alkohol, Chili und schwarzer Pfeffer. Auch Nikotin und geräuchertes Fleisch wirken erhitzend auf den Körper. Ebenso alles, was sauer oder salzig ist. Also Joghurt, saure Früchte wie auch rezenter Käse, Würste, Frittiertes und Fertigprodukte. Die sind extrem salzig. Was viele Leute nicht wissen: Salzige Speisen erhitzen den Körper mehr, als dies ein scharfes Gericht tut. Wenn also zu viel Hitze in Ihrem Körper ist, sollten Sie auf allzu salzige Speisen verzichten. Kühlend hingegen sind Früchte, Gemüse insbesondere Äpfel, Trauben, Gurken oder Melonen. Von diesen Lebensmitteln können Sie richtig viel essen. Nehmen Sie zudem abends einen Esslöffel voll Rizinusöl in warmem Wasser ein. Das beruhigt den Darm und kühlt den Körper ein bisschen.
Äusserlich können Sie täglich etwas Kokosöl auf den Scheitel geben. Bei tro

ckenem Haar am Morgen, sonst über Nacht. Sehen Sie sich auch nach einem Ventil um, damit Sie sich gut entspannen und innerlich abkühlen können. Schwimmen ist sehr gut geeignet, aber auch Yoga oder Meditation.
Sabine Hurni
Das Knie gesund halten
Ich hatte vor zehn Tagen eine Meniskusoperation. Der Chirurg hat mir angedroht, dass ich in etwa zehn Jahren eine Teilprothese brauche. Am gleichen Knie habe ich seit einem Jahr ein neues Kreuzband. Eine Prothese möchte ich vermeiden. Was kann ich dazu beitragen?
A. W., Fribourg
Das sind ja schöne Aussichten … Am besten vergessen Sie die Worte des Chirurgen und konzentrieren sich darauf, dass Ihr Knie stabil und beweglich bleibt. Gehen Sie ab und zu in die Massage? Wenn nicht, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich regelmässig die Beine massieren zu lassen. Erst recht, wenn Sie viel Sport treiben. Das regt die Durchblutung an und verbessert die Versorgung des Knorpels. Massieren Sie das Knie und die Waden jeweils nach dem Sport mit einem Sesamöl ein und gehen Sie so oft als möglich barfuss. Unterstützen können Sie die Gesunderhaltung des noch vorhandenen Knorpels mit Grünlippmuschelextrakt und den Schüsslersalzen Nr. 5 und 8.
Was übrigens bei Knieproblemen sehr gut wirkt, sind Kneippanwendungen. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe eine Kneippanlage oder sonst eine Möglichkeit, um regelmässig im Storchengang durch kaltes Wasser zu schreiten. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber ich meine es ernst. So altmodisch die Methode auch ist, probieren Sie sie einmal aus. Sabine Hurni
Für mein Frühstück weiche ich am Abend Haferflocken, geschrotete Leinsamen, Weizen- und Haferkleie in etwas Milch ein. Am Morgen gebe ich Zitronensaft dazu, SanddornMark und Honig. Mit einem Messer zerkleinere ich einen Apfel und füge ihn dem Müesli bei. Ich benütze ein Messer und keine Raffel, weil ich die Vitamine des Apfels nicht zerstören will. Ist diese Komposition richtig? Was unterscheidet Haferkleie von Weizenkleie? B. K., Zürich
Bei der Mehlproduktion bleibt Kleie als Rückstand aus der Getreidesamenschale zurück. Bei Vollkornflocken, die aus dem ganzen Getreidekorn gepresst sind, ist die Kleie enthalten. Wenn Sie die Hafer oder Weizenkleie zusätzlich beigeben, haben Sie mehr Ballaststoffe im Müesli. Während die Weizenkleie mit ihren unlöslichen, quellenden Ballaststoffen hauptsächlich die Verdauung begünstigt, hat Haferkleie eine breitere Wirkung; unter anderem hat sie zusätzlich einen positiven Einfluss auf die Blutfette. Wenn Ihnen das Müesli guttut, gibt es keinen Grund, daran etwas zu ändern. Einzig die Kombination von Milch und sauren Früchten macht das Müesli etwas schwer verdaubar. Probieren Sie doch einmal aus, wie Ihnen das Müesli mit Wasser anstatt Milch schmeckt.
Sie können mit den Flocken einige zerstossene Mandeln und ein paar Rosinen einweichen. Das macht den Brei schmackhafter. Im Winter können Sie das Ganze leicht erwärmen. Ein warmer Start in den Tag regt den Stoffwechsel sehr gut an.

Kartoffel – das wiederentdeckte Hausmittel
Die Kartoffel ist bei uns nicht mehr aus der Küche wegzudenken. Ob zum Sonntagsbraten oder als Folienkartoffel –die gelbe Knolle ist ein Teil unserer Esskultur. Umso erstaunlicher, dass über die positiven Eigenschaften der Kartoffel wenig bekannt ist. Oft wurde sie fälschlicherweise als Dickmacher verschrien. Dabei besteht sie hauptsächlich aus Wasser und hat wenige Kalorien. Lediglich das beim Zubereiten verwendete Fett ist die Ursache für das sich hartnäckig haltende Gerücht. Ganz ohne Fett und roh ist die Kartoffel ein altes Hausmittel und dies schon seit Jahrhunderten. Denn sie enthält wertvolle Spurenelemente, Proteine und Mineralien. Vor allem ist sie eine Quelle von natürlichem Kalium. Kalium ist für den menschlichen Körper unverzichtbar und zeichnet sich als Unterstützer für viele wichtige Funktionen aus. So wird Kalium nachgesagt den Blutdruck zu senken und das Nervensystem zu stärken. Der Kartoffelsaft, gepresst aus rohen Kartoffeln, ist für seine wohltuende Wirkung im Magen bekannt. Das in der Knolle enthaltene Lysin schützt und beruhigt die Magenschleimhaut. In den Biotta Kartoffelsaft schaffen es nur beste Bio-Kartoffeln aus dem Thurgau. Direkt gepresst entsteht so ein besonders milder und genussvoller Saft. Man kann ihn pur trinken oder nach Belieben verfeinern. Aufgewärmt und mit frischen Kräutern gewürzt, hat man im Handumdrehen eine köstliche Suppe gezaubert.
› Mehr Infos unter www.biotta.ch


Ich kann Sie also nur ermuntern, Ihr Morgenritual fortzusetzen. Was die Vitamine betrifft, so spielt es meiner Meinung nach keine Rolle, ob Sie den Apfel raffeln oder schneiden. Was die Raffel macht, machen beim geschnittenen Apfel schlussendlich die Zähne. Wenn Sie den Apfel raffeln, wird er eher bekömmlicher, weil Sie dem Körper einen Teil der Arbeit abnehmen. Deshalb der geraffelte Apfel als Krankenkost. Die scharfe Messerklinge hat aber auch ihre Vorteile –zumindest gemäss japanischer Küchenphilosophie. In Japan werden rasiermesserscharfe, grosse Messer benutzt. Durch den scharfen Schnitt werden die Zellen nicht gequetscht, der Saft bleibt erhalten und das ursprüngliche Aroma des Lebensmittels kommt unverfälscht zur Geltung. Mit einem herkömmlichen Rüstmesser, wie es hierzulande verbreitet ist, werden die Zellen hingegen gequetscht.
Sabine Hurni
Bei Nagelpilz auf Zucker verzichten
Seit längerer Zeit habe ich einen Nagelpilz an den Zehen. Weil ich Medikamente einnehmen muss, möchte ich den Nagelpilz natürlich behandeln. Schüsslersalze, Molke,

Basenbäder und ein Nagelpilzstift haben nichts gebracht. Was könnte ich noch probieren? U. K., Bern
Ein Nagelpilz ist selten ein Lokalereignis. Oftmals ist auch der Darm mit Pilzen belastet, welche das Immunsystem schwächen und dem Nagelpilz immer wieder neue Nahrung bieten. Es kann sein, dass die Medikamente, die Sie einnehmen müssen, das ganze Immunsystem oder die Darmflora durcheinandergebracht haben.
Der erste Schritt wäre sicher eine Antipilzdiät. Das heisst, dass Sie vollkommen auf Zucker und zuckerhaltige Speisen verzichten. Essen Sie sehr viel Gemüse und bevorzugen Sie im Moment eine eher kohlenhydratarme Kost. Ersetzen Sie die Teigwaren öfters durch Linsen oder Kichererbsen. Zusätzlich erhalten Sie in Drogerien die TrichophytonverrucosumTinktur von der Firma Sanum. Nachdem Sie die befallene Stelle gesäubert, also den Nagel zurückgeschnitten und den Pilz so gut es geht entfernt haben, können Sie den Nagel mit der Tinktur betupfen. Machen Sie diese Prozedur am besten in der Dusche, damit Sie die Nagelsplitter sofort herunterspülen können.
Der Pilz ist hochansteckend und die Gefahr eines erneuten Befalls ist recht gross. Deshalb sollten Sie die Socken unbedingt mit einem Spezialmittel waschen. Dieses vernichtet die Pilzsporen, damit der neu wachsende Nagel nicht sofort wieder befallen wird. Es gibt übrigens eine sehr gute Heilpflanze, die Sie innerlich einnehmen können. Sie heisst Neem und kann über das Internet oder über den Fachhandel bestellt werden. Neem reinigt den Körper und wirkt sehr gut gegen Pilzund Hautkrankheiten. Eine NeemKur von einigen Wochen empfehle ich Ihnen sehr. Sabine Hurni
Entzündete Regenbogenhaut
Ich leide unter einer Regenbogenhautentzündung am rechten Auge. Ich musste mich krankschreiben lassen, weil ich nicht mehr am PC arbeiten konnte. Was könnte die Ursache sein? F. W., Luzern
Die Frage nach der Krankheitsursache ist selten einfach zu beantworten. Erst recht nicht bei einer Regenbogenhautentzündung. Hier tappen selbst Experten im Dunkeln. Die Forschung nimmt an, dass eine Allergie gegen Eiweisse vorliegt, die von Bakterien oder Viren ausgeschieden werden. Die Infektionsquelle kann irgendwo im Körper schlummern und mit dem Blut ins Auge gelangen. Dort lösen die Eiweissstoffe die krankmachende Reaktion aus. Das Infektionsrisiko steigt durch Infektionen, Rheuma oder auch durch Augenverletzungen. Mehr Informationen zu Thema finden Sie auf www.uveitis-selbsthilfe.de
Auf dieser Website wird auch eine Klimatherapie am Toten Meer empfohlen. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit für eine Auszeit? Wichtig scheint mir, dass Sie regelmässig Ferien vom Computerbildschirm machen und sich einen guten Ausgleich zur Büroarbeit suchen. Manchmal sind körperliche Probleme ein Hinweis darauf, dass die aktuelle Situation zu hinterfragen ist. Allenfalls wäre es sinnvoll, sich umfassend in einer Klinik für Komplementärmedizin untersuchen zu lassen, etwa in der Paracelsusklinik in Lustmühle oder der Aesculapklinik in Arlesheim. Dort werden alle Facetten einer Krankheit untersucht und nicht nur das erkrankte Organ. Sabine Hurni
Saurer Urin bei basenreicher Kost
Letzte Woche habe ich täglich meinen Urin kontrolliert. Laut Beilage des Indikatorpapiers sollte der Wert im Laufe des Tages ansteigen. Das war




bei mir nicht der Fall. Woher kommt der Säureüberschuss? Ich esse sehr viel Gemüse. M. R., Männedorf
Der UrinpH gibt nie ein seriöses Bild über den SäureBasenHaushalt im Körper. Versteifen Sie sich deshalb nicht auf diese Werte. Wichtig sind Ihr Gesamtbefinden und eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst. Gleichzeitig ist es auch sehr wichtig, dass Sie genügend trinken, zum Beispiel ungesüsste Kräutertees. Auch Bewegung fördert ein gesundes SäureBasenGleichgewicht. Denn durch die erhöhte Durchblutung können mehr freie Säuren ausgeschieden werden. Und das ist genauso wichtig wie die Aufnahme von mineralstoffreichen Nahrungsmitteln. Ich empfehle Ihnen ausserdem, dass Sie im Fachhandel ein Basensalz kaufen. So können Sie die Entsäuerung sehr gut unterstützen.
Sabine Hurni
Warme Kompressen helfen bei Schulterschmerzen
Ich habe harte, schmerzhafte «Wucherungen» am Achselgelenk. Jeder Druck von Rucksack, Handtasche, BH-Träger schmerzt. Heilt das mit Johannisölkompressen und Weihrauchsalbe? Oder braucht es etwas anderes? Der Arzt meinte: «Arthrose, nichts zu machen».
B. U., Würenlingen
Die warmen Kompressen werden Ihnen bestimmt gut tun. Auch Massagen, warme Bäder und Entspannungsübungen für den Schulterbereich können die Situation entschärfen. Aber das Ganze braucht Geduld und Eigeninitiative. Legen Sie sich die Kompressen jeweils über Nacht auf die Schulter und ziehen Sie zum Beispiel einen Schulterwärmer darüber. Diesen
gibt es in Sanitätsgeschäften, Drogerien und Apotheken.
Trinken Sie zudem täglich viel warmes Wasser. Das lockert die verhärteten Muskeln ein wenig. Achten Sie beim Wandern darauf, dass Sie immer warmen Tee dabei haben. Essen Sie wenn möglich ein warmes Frühstück, sodass sich der Körper gut aufwärmen kann, bevor Sie losmarschieren. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe auch ein TCMCenter. Die Akupunktur kann bei stark verspannten Nackenmuskeln sehr viel Linderung bringen. Ihr Arzt hat leider schon Recht, eine Arthrose lässt sich nicht rückgängig machen. Jedoch sollte man die Muskulatur rund um den degenerierten Knorpel immer wieder lockern und so die Durchblutung der noch vorhandenen Knorpelsubstanz fördern.
Sabine Hurni




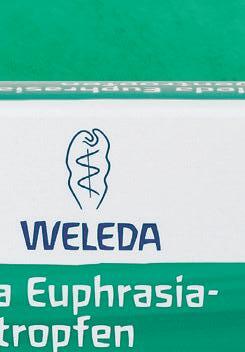
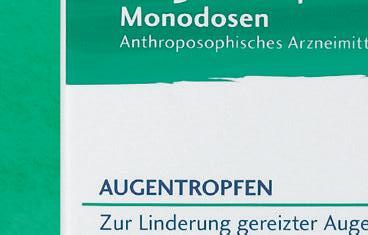

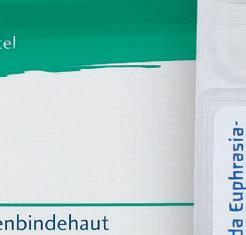






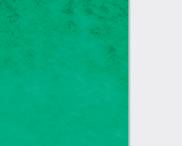






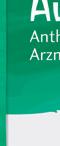











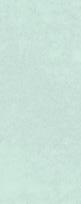
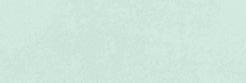



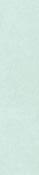


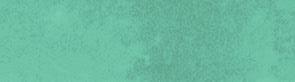
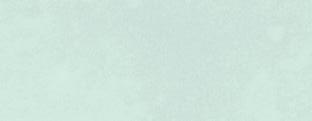



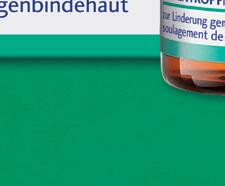






























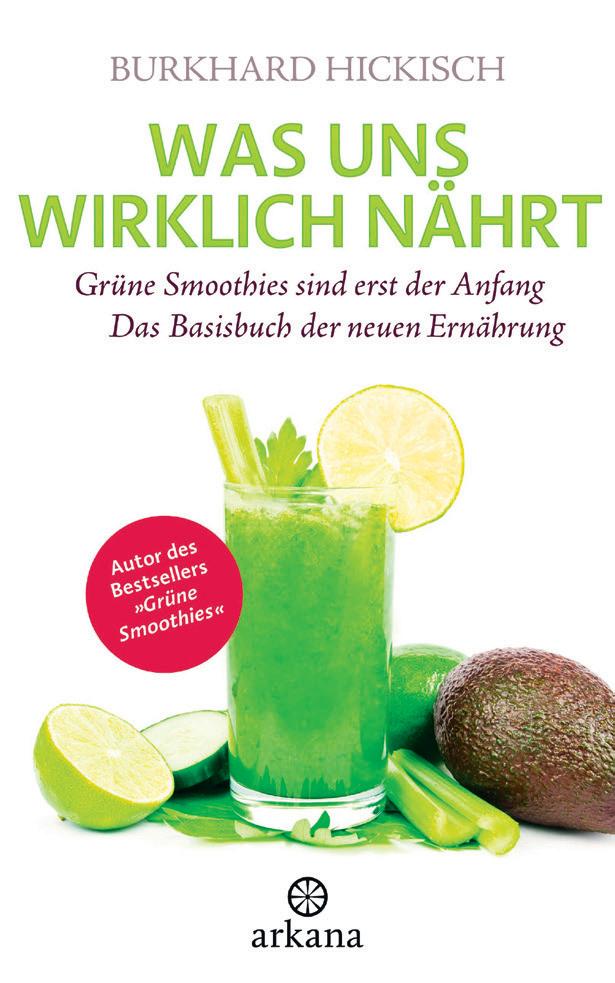
Lesen_ Was uns wirklich nährt
Das «Basisbuch der neuen Ernährung» verspricht vollmundig das Titelbild. Und tatsächlich: Dieses Werk ersetzt nicht nur Koch- und Rezeptbücher, sondern auch so manchen spirituellen Lebensratgeber. Zentrale These des Autors: Unsere Zellen leben von Licht. Wer den Inhalt konsequent verfolgt und von Smoothies, Lichtduschen und Liebe lebt, der lebt wohl erleuchtet. krea
_ Burkhard Hickisch: «Was uns wirklich nährt», Arkana, 2014, Fr. 29.90
Abfall_ Gewusst wie und wo
Es gilt genau hinzuschauen: Schweizer Haushalte produzieren so viel Müll wie kein anderes Land in Europa. Pro Einwohner waren es im Jahr 2012 unglaubliche 690 Kilogramm Abfall, wie Eurostat im Juli meldete. Den persönlichen Konsum reduzieren ist die beste Reaktion auf diese Zivilisationsmüllberge. Die zweitbeste Variante ist das Recycling. Auf der Website www.swissrecycling.ch findet man entsprechende Informationen. tha
Man braucht nicht Rheumapatientin zu sein, um die innovativen Alltagshelfer der Rheumaliga zu schätzen. Auch gesunde Menschen finden Gefallen daran, denn auch sie fluchen hin und wieder über allzu strenge Verschlüsse an Flaschen. Der Öffner «Petboy» aus weichem Silikongummi hilft die meisten PET-, Bier- und Weinflaschen einfach zu öffnen (max. Durchmesser 2,8 cm). «Petboy» und weitere Alltagshelfer findet man auf www.rheumaliga-shop.ch, Telefon 044 487 40 00. tha


Balkonpflanzen_ Warm einpacken
Ab September sollte man kälteempfindliche Balkonpflanzen gegen Nachtfröste schützen und daran denken, dass sie bald auch winterfest gemacht werden müssen.
l Noch genügt es, die Pflanzen über Nacht mit Tüchern abzudecken. Bei empfindlichen Pflanzen Stäbe als Traghilfe in die Erde stecken, damit das Tuch nicht auf den Blättern/Blüten liegt.
l Für den Winter können die Töpfe mit Kokos, Jute, Vlies oder Noppenfolie umhüllt werden. Mit Schnur befestigen.
l Kleine Töpfe kann man auch in grössere stellen und den Zwischenraum mit trockenem Laub oder Stroh ausfüllen.
l Erde im Topf mit Laub, Reisig oder Kokosmatte abdecken.
l Empfindliche Pflanzen oberirdisch mit Jute oder Vlies umhüllen.
l Ebenso empfiehlt es sich, die Töpfe auch von unten zu isolieren und auf Holzstücke oder eine andere isolierende Unterlage zu stellen.

unterschieden werden. An die 500 Arten kennt man auf der Nordhalbkugel. Die nur als Wildform wachsende Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) findet man auch in den Alpen. Eine Verwandte ist die nordamerikanische Heidelbeere. Kulturheidelbeeren werden im grossen Stil in den USA angebaut.
Der Genuss: Erstaunlich, die süsssäuerlichen Früchte intensivieren ihr Aroma, wenn sie im Kühlschrank gelagert wurden. Wegen ihres hohen Pektingehalts eigen sie sich gut zum Einmachen.
Die Anekdote: Neurowissenschaftler wurde der Amerikaner James Joseph vielleicht nur, weil er bereits als Kind täglich Heidelbeeren ass und deshalb ein schlaues Bürschchen wurde. Später verfütterte er dann Laborratten Extrakte der Blaubeeren und stellte fest: Ratten im «reifen» Alter sind dadurch ebenso schlau wie junge Tiere. Trotzdem: Es gibt kein Nahrungsmittel, das uns schlauer macht. Will man aber körperlich und geistig fit sein, lohnt es sich durchaus zu schauen, was auf dem Teller liegt.

in den Finger gestochen haben. So soll die Himbeere, die zuvor weiss war, rot geworden sein. Seit dem 18. Jahrhundert wird die Himbeere intensiv angebaut. Es gibt Sommer- und Herbsthimbeeren, diese werden bis Ende September geerntet. So zart die Beere, so robust die Pflanze: Sie wächst sowohl im rauen Klima Alaskas als auch in heissen Gebieten Südostasiens.
Der Genuss: Vor allem Freilandkulturen schmecken herrlich süss. Lassen sich schlecht lagern, allenfalls im Kühlschrank. Nicht waschen. Pur mit etwas flüssigem Rahm ein Genuss.
Die Anekdote: Am Parteitag der Grünen in Deutschland sorgte ein Mitglied für Realsatire: Es stiess sich daran, dass der Vorstand in seinem Wahlprogramm ausgerechnet Himbeeren im Winter für überflüssig hielt. «Das Wort Himbeeren wird durch das Wort Erdbeeren ersetzt», forderte er. «Es geht hier darum, dass nicht Himbeeren, sondern Erdbeeren in der Öffentlichkeit ein Thema sind.»

dete sie als Heilpflanze. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Dornengewächs im grossen Stil angebaut. Inzwischen gibt es auch stachellose Sorten mit kuriosen Namen wie Loch Ness, Jumbo und Black Satin.
Der Genuss: Süsssauer und sehr saftig. In einer Schüssel waschen, unter direktem Wasserstrahl könnten sie Schaden nehmen. Ein Genuss, auch mit Fleisch und Fisch (Rezepte im Internet).
Die Anekdote: In Österreich wurde die Polizei zu einem Tatort gerufen. Die Nachbarn hätten auf dem Balkon ein Tier geschlachtet. Es stellte sich heraus, dass der Saft von aufgetauten Brombeeren vom Balkon tropfte.

Blumenkohl, Broccoli und Romanesco gehören zur seltenen Sorte der Blütengemüse. Sie sind einfach zu kochen und bereichern sowohl als Solisten als auch im Trio die Alltagsküche.
Text: Vera Sohmer




Er durchziehe die Wohnung mit einem penetranten Geruch, der trotz Dauerdurchzug nicht weichen will, meckern seine Gegner. Blumenkohl hat noch immer einen schlechten Ruf und ist für viele einfach nur «wäh». Das mag auch mit dem Standard-Vegigericht aus vergangenen Zeiten zu tun haben: Totgekochtes Gemüse mit einer dicklichen, künstlich gelben Béchamelsauce. Unter der Pampe fand sich Blumenkohl – wässrig, matschig, eklig.
Hier kommt der Gegenbeweis: Schmackhaft und erst noch einfach in der Zubereitung ist Blumenkohl ein unkompliziertes Alltagsgemüse. Die Röschen einfach in Salzwasser blanchieren, in Butter oder Öl schwenken, ein wenig Muskat darüberreiben, mit gehackten Nüssen bestreuen –fertig ist eine leichte Zwischenmahlzeit. Unter einen Blattsalat gemischt, sind die so zubereiteten Röschen eine Dreingabe mit Biss. Auch ein feines Süppchen ist rasch und einfach gemacht. Selbst den Stiel kann man bei entsprechend guter Qualität verarbeiten: In Stücke geschnitten kann er in der Bouillon mitköcheln. Dann alles pürieren, mit wenig Rahm verfeinern, mit frischen Kräutern bestreuen. Wer denkt da noch an kulinarische Ausrutscher von früher.

Gegen den strengen Geruch gibt ein Mittel: Kaufen Sie Bio-Ware. Sie ist dezenter im Geschmack. Dies im Unterschied zum konventionellen Anbau, bei dem die Pflanze schnell viel Stickstoffdünger auf-
nimmt. So entsteht die senfartige, scharfe Note, «die wir beim Blumenkohl nicht sonderlich lieben», sagt Biobauer Toni Niederberger aus Zug. Sein Gemüse düngt er organisch, mit Kompost oder Mist. Das langsamere Wachstum wirkt sich darüber hinaus positiv auf das Aroma aus. So ist das Garen ohne Geruchsbelästigung möglich.
Von Hand geerntet
Toni Niederberger baut Blumenkohl, Broccoli und Romanesco auf einem Feld an. Die drei seien enge Verwandte und hätten ganz ähnliche Bedürfnisse. Etwas heikel sind sie alle, man muss sie vor allem gegen ihren Hauptschädling, den Kohlweissling, schützen. Im Biolandbau gibt es dagegen zwei Mittel: ein biologisches Bakterienpräparat oder ein feinmaschiges Netz, mit dem die ganze Kultur abgedeckt wird. So kommt die Schmetterlingsraupe nicht mehr an die jungen Blätter heran.
Saison haben alle drei Sorten von Juni bis September. Die Köpfe werden von Hand geerntet. Handarbeit ist übrigens immer ein Muss. Auch auf grossen Schweizer Anbauflächen gibt es bislang keine Maschine, mit der sich die Köpfe abschneiden lassen. Lediglich ein Erntewagen mit Förderband ist im Einsatz. Auf dem Wagen werden die Kohlköpfe von Helfern in Kisten verpackt.
Im Trio ein Genuss
Welche der Kohlsorten ist bei den Konsumenten und Konsumentinnen am beliebtesten? Statistisch hat der Blumenkohl die Nase vorn. Doch Gemüsebauer Niederberger weiss auch: «Kunden lieben die Auswahl, greifen mal zum einen, mal zum anderen.» Und manchmal legen sie auch alle drei Sorten zusammen in den Einkaufskorb. Ein guter Entscheid, denn zum einen passen Blumenkohl, Broccoli und Romanesco geschmacklich hervorragend zusammen und lassen sich auf die gleiche Art zubereiten. Und zum anderen kommen Ästheten auf ihre Rechnung, wenn sie
Für 4–6 Personen als Hauptgericht
je 1 mittlerer Broccoli, Blumenkohl und Romanesco
Salz
100 g Cashewnüsse
100 g Schinken in Tranchen
Sauce:
1 Bund Basilikum
1 TL Senf
2 EL Weissweinessig
1 Becher griechischer Joghurt (150 g)
2 EL Gemüsebouillon
2 EL Olivenöl
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Broccoli, Blumenkohl und Romanesco in Röschen teilen. In einer grossen Pfanne reichlich Salzwasser aufkochen. Die Röschen hineingeben und in etwa 7 Minuten bissfest kochen. In ein Sieb abgiessen und gut abtropfen lassen.
2 Die Cashewnüsse mittelfein hacken. In einer beschichteten Bratpfanne hellbraun rösten, dann beiseitestellen. Die Schinkentranchen in Streifchen schneiden.
3 Für die Sauce das Basilikum in feine Streifchen schneiden. Gut die Hälfte davon mit dem Senf, dem Essig, dem Joghurt, der Bouillon und dem Olivenöl in einen Mixbecher geben und fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
4 In einer grossen Schüssel die Röschen, die Sauce, den Schinken, 2/3 der Cashewnüsse und das restliche Basilikum sorgfältig mischen und 15 Minuten ziehen lassen.
5 Den Salat auf Tellern anrichten und mit den restlichen Cashewnüssen bestreuen.
im Malcantone, Südtessin


Nägeli-Neff Margrit
certif ied Advanced Rolfer Tel. 044 362 61 23

Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung
Ein «etwas anderes» Albergo Individuell, persönlich, wohltuend Für eine Auszeit, zum Entspannen Für Aktivferien und Seminare Te l. 091 609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch
362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U
Die integrier te Str uktur, die im Rolf ing angestrebt wird, vermeidet die Fehlbelastung von Gelenken und Überlastung der Gewebe. Der Kör per bef indet sich wieder in Balance und Einklang mit der Schwerkraft. Tiefe manuelle Bindegewebsarbeit, verbunden mit sensitiver Bewegungsschulung, er möglicht eine differenziertere Selbstwahrnehmung Arbeitsorte: ZH, Vella (GR), Schaan (FL)

Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:
Anouk Claes, Peter Goldman, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Annette Kaiser, Elisabeth Bond, Carlo Zumstein, Renate von Ballmoos, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Marie-Therese Schibig, u.a.
Nächster Ausbildungsbeginn: 24. September 2014
Sass da Grüm – Ort der Kraft
Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen. Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch
Ein Aktivprogramm der Sonderklasse! Erfahren Sie diverse sportliche Aktivitäten kombiniert mit Trinkfasten. Eine wohlige und persönliche Atmosphäre erwartet Sie und bietet, nebst aktivem Bewegungsprogramm, viel Zeit zum Entspannen und Geniessen.
Kur- & Ferienhaus St. Otmar Maya & Beat Bachmann-Krapf CH-6353 Weggis +41 (0)41 390 30 01 www.kurhaus-st-otmar.ch


«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch
Sabine Hurni
Ayurveda Kochkurse Gestaltungskurse
Kursprogramm unter www.sabinehurni.ch
mit Jentschura‘s BasenKur
Jetzt Informationen und kostenlose Proben anfordern: Telefon: +41 (0) 44 -784 79 31 www.p -jentschura.ch
Sabine Hurni GmbH Bruggerstrasse 37 CH-5400 Baden
079 750 49 66 056 209 12 41 info@sabinehurni.ch www.sabinehurni.ch


38 Rohrbach Telefon 06 2 96 5 09 59 www.holzwerks tatt-schmocker.ch
Die drei Verwandten
Blumenkohl gibt es grün, violett, rötlich oder gelb. Hierzulande ist jedoch vor allem die weisse Variante bekannt. Broccoli ist manchmal blau, Romanesco manchmal violett. Die farbigen Sorten bekommen mehr Sonne. Ob sie aromatischer sind, darüber sind sich Fachleute uneins.
• Blumenkohl stammt ursprünglich aus Kleinasien und wird seit dem 16. Jahrhundert in ganz Europa angebaut, zuerst in Italien. Heute gehört er zu den beliebtesten Gemüsesorten und zu jenen seltenen, von denen die Blüten gegessen werden. Seine weisse Farbe hat er, weil er von Blättern umhüllt ist oder mit Folien abgedeckt wird. Er bleibt schön weiss, wenn man ins Kochwasser etwas Milch oder Zitronensaft gibt. Er enthält unter anderem Vitamin C und Kalzium.
• Broccoli ist ein enger Verwandter des Blumenkohls. Was beide gemeinsam haben: Die Röschen des Kopfes bestehen aus den noch nicht ganz entwickelten Blütenständen. Beim Broccoli sind die Knopsen aber schon deutlich zu erkennen. Broccoli gilt als wertvollste Kohlsorte, sie hat viel Vitamin C, Folsäure, Kalzium und Eisen. Harmoniert gut mit Knoblauch, Mandeln, Weisswein, Zitronensaft.
• Romanesco ist eine Variante des Blumenkohls. Er wurde zuerst in der Nähe von Rom gezüchtet. Er ist reich an Vitamin C, Kalzium, Kalium und Phosphor und hat einen höheren Beta-Carotin-Gehalt als Blumenkohl. Romanesco schmeckt ganz ähnlich wie Broccoli, ist aber schöner anzuschauen.
Tipps für den Einkauf und die Lagerung
• Frisch I : Frischen Blumenkohl erkennt man an einer kompakten Oberfläche und an grünen, saftigen Blättern, die eng am Kopf anliegen. Überlagerten hingegen daran, dass die Röschen locker sind, sich eventuell dunkle Flecken gebildet haben. Der Kohl riecht zudem schlecht. Broccoli sollte eine satte Farbe und geschlossene Blütenknospen haben, Romaneso eine leuchtend grüne Farbe. Bei allen drei Kohlsorten sollte der Stiel fest und nicht gummig, die Anschnittstelle saftig und nicht vertrocknet sein.
• Frisch II : Verarbeiten Sie Blumenkohl, Broccoli und Romanesco so frisch wie möglich. Langes Lagern wirkt sich schlecht aus auf das Aroma. Zudem schwinden die Nährstoffe. In einem verschlossenen, luftdurchlässigen Plastikbeutel lässt sich der Kohl jedoch gut zwei bis vier Tage im Gemüsefach des Kühlschrankes aufbewahren.
• Einfrieren : Auch beim Konservieren gilt: Je frischer der Kohl verarbeitet wird, desto besser. Wichtig: Nicht roh einfrieren, das Gemüse wird hässlich dunkel. Immer zuerst in Röschen teilen, dann ungefähr drei Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren, mit kaltem Wasser abschrecken. Gut abtropfen lassen und portionenweise in Gefrierbeutel verpacken. Das Gemüse ist eingefroren rund zehn Monate lang haltbar.
die verschiedenfarbigen Röschen akkurat auf grossen Tellern anrichten können. Apropos ästhetisch: Der Romanesco ist ein Musterbeispiel an Vollkommenheit. Wissenschaftler erklären an ihm gerne, dass Fraktale, geometrische Muster und Strukturen, auch in der Natur vorkommen. Andere betrachten das Gebilde einfach gebannt und staunen über das leuchtend grüne Naturwunder. Das sich übrigens zerkleinert auch in einer Minestrone hervorragend macht, optisch wie geschmacklich.
Üblicherweise werden die drei Kohlsorten gekocht. Das macht sie bekömmlicher. Toni Niederbergers Kundschaft macht aber auch gerne einmal einen Saft daraus. Sie verarbeitet Broccoli und seine nahen Verwandten zu grünen Smoothies. Die dickflüssigen Getränke liegen im Trend und gelten als sehr gesund. Kenner schwören auf die Extraportion Bitter- und Nährstoffe, die sie sich mit den pürierten Gemüsesorten und Kräutern zuführen. Oft werden die Drinks mit Früchten kombiniert und mit Honig, Agavendicksaft oder Joghurt verfeinert. Das Rohgemüse aus dem Mixer hat zudem einen weiteren Vorteil: Die im Mixer zerkleinerten Pflanzenfasern sind leichter verdaulich als Rohkost pur. In diesem Aggregatzustand liegt dann ein roher Blumenkohl gar nicht mehr schwer im Magen. u
Roher Blumenkohl wird leicht verdaulich, wenn er als Smoothie gemixt wird.

Blumenkohl und Co. Haus & Garten

Für 4 Personen als Hauptspeise –Für 8 Personen als Vorspeise
1 kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Lorbeerblatt
1 Gewürznelke
5 dl Milch
½ Teelöffel Chiliflocken oder 1 grosse Prise Cayennepfeffer Salz
90 g Butter
100 g Mehl
6 Eigelb
75 g geriebener Parmesan oder Sbrinz AOC schwarzer Pfeffer aus der Mühle etwas frisch geriebene Muskatnuss
1 Bund Schnittlauch
300–350 g Broccoli wenig Butter für die Form
6 Eiweiss
½ TL Maizena
1 Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Knoblauchzehe schälen und halbieren. Das Lorbeerblatt mit der Gewürznelke bestecken. Alle diese Zutaten mit der Milch, den Chiliflocken oder dem Cayennepfeffer sowie 1 Teelöffel Salz aufkochen. Von der Herdplatte nehmen und kurz ziehen lassen. Durch ein feines Sieb giessen und die Gewürzmilch beiseitestellen.
2 In einer mittleren Pfanne die Butter schmelzen. Das Mehl beifügen und alles so lange rühren, bis sich die Masse vom Boden löst. Dann unter Rühren langsam und kräftig die Gewürzmilch dazurühren. Alles wieder aufkochen und so lange weiterrühren, bis sich die Masse wieder vom Boden löst. Dann vom Feuer nehmen und ein Eigelb nach dem anderen kräftig unterschlagen. Parmesan oder Sbrinz untermischen. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Zuletzt den Schnittlauch in Röllchen schneiden und beifügen.
3 Den Broccoli in etwa baumnussgrosse Röschen teilen; man braucht insgesamt 200 g gerüsteten Broccoli. Diesen in kräftig gesalzenem Wasser nur gerade bissfest garen. Abschütten und gründlich kalt abschrecken. Anschliessend die Röschen vierteln. Bis hierhin kann das Soufflé vorbereitet werden.
4 Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Souffléform von etwa 18 cm Durchmesser oder 8 kleine Portionenförmchen leicht ausbuttern.
5 Die Eiweiss halb steif schlagen. Dann 1 grosse Prise Salz sowie das Maizena darüberstreuen und die Masse sehr steif schlagen. Mit einem Spachtel sorgfältig unter die Käsemasse ziehen. Zuletzt den Broccoli unterheben. Die Masse mindestens 2/3 hoch in die vorbereitete Form füllen.
6 Das Broccoli-Käse-Soufflé im 180 Grad heissen Ofen auf der untersten Rille etwa 50 Minuten backen (Portionenförmchen: etwa 25 Minuten); es soll in der Mitte noch leicht cremig sein. Aus dem Ofen nehmen und sofort servieren, damit das Soufflé nicht zu stark zusammenfällt.
Als Beilage passt ein reichhaltiger Blattsalat.
Rezepte von «Annemarie Wildeisen’s Kochen»
Lachs an BlumenkohlLimonen-Sauce
Für 4 Personen
1 kleiner Blumenkohl (ca. 500 g)
1 Schalotte
1 Limone
½ Bund Dill
1 EL Rapsöl
1 gehäufte Messerspitze scharfer
Curry
2 dl Gemüsebouillon
½ dl Rahm
Salz, Cayennepfeffer
Fisch:
4 Lachstranchen, je ca. 150 g schwer
Salz
2 EL Rapsöl

Mehr zum Thema gut Essen und Trinken unter www.wildeisen.ch
1 Den Blumenkohl in Röschen teilen. Den Strunk sowie die groben Stiele der Röschen grob schneiden. Die Röschen in feine Scheiben schneiden; sie zerfallen dabei ein wenig.
2 Die Schalotte schälen und fein hacken. Die Schale der Limone fein abreiben. Den Saft von ½ Limone auspressen. Den Dill fein hacken.
3
In einer Pfanne das Rapsöl erhitzen. Die Schalotte darin glasig dünsten. Dann den geschnittenen Blumenkohlstrunk und die Stiele sowie das Currypulver beifügen, kurz mitdünsten und mit Bouillon ablöschen. Alles zugedeckt weich kochen.
4 Den Rahm und die Limonenschale zur Sauce geben und alles mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Sauce mit Salz, Cayennepfeffer sowie etwas Limonensaft abschmecken.
5 Den Lachs salzen. In einer beschichteten Bratpfanne die Hälfte des Rapsöls (1 Esslöffel) erhitzen. Den Lachs auf jeder Seite 2–3 Minuten nicht zu heiss braten. Den Fisch auf eine Platte geben und im Ofen warm stellen.
6 Nun im Bratensatz das restliche Rapsöl (1 Esslöffel ) erhitzen. Die fein geschnittenen Blumenkohlröschen beifügen, salzen und 4–5 Minuten braten. Zuletzt den Dill beifügen.
7 Zum Servieren die Sauce auf vorgewärmte Teller geben, etwas gebratenen Blumenkohl und jeweils 1 Lachstranche darauf anrichten.
Als Beilage passt Safranreis.
Acker des Zürcher Vereins «Anbaugemeinschaft».

Urban Gardening ist im Trend. Doch wie machen sich Städter als Gemüsebauern? Wir fragten die beiden Initianten des Pflanzplatz Dunkelhölzli in Zürich.
Interview: Tertia Hager
Ueli Ansorge und Tinu Balmer sind Initianten des Pflanzplatz Dunkelhölzli in Zürich.
Der Verein «Die Anbaugemeinschaft» bewirtschaftet an vier Orten eine Fläche von rund 1,2 Hektaren. Damit können etwa 200 Haushalte mit Gemüse versorgt werden. Die Abonnenten wählen je nach Bedarf eine Gemüsetasche zwischen zwei und fünf Kilo pro Woche und bezahlen dafür zwischen 630 und 1320 Franken pro Saison. Ebenso verpflichten sie sich zu mindestens zwei Tagen Mitarbeit pro Saison.

Vor vier Jahren haben Sie das Projekt Pflanzplatz am Stadtrand von Zürich gestartet. Wie machen sich die beteiligten Städter als Teilzeitgärtner?
Tinu Balmer: Sie werden von uns angeleitet, sie können also nicht so viel falsch machen. Einige sind durchaus euphorisch und gehen mit einem guten Gefühl heim. Es gab aber auch schon solche, die nach einer Stunde Arbeit den Garten verliessen – wohl weil es zu streng war.
Ueli Ansorge: Die meisten kommen ihrer Verpflichtung zum Mithelfen nach und wenn nicht, werden sie vermutlich ein schlechtes Gewissen haben. Es gibt auch solche, die öfters kommen, Routine haben, und sehen, was zu tun ist. Manche sind blutige Anfänger, da gibt es schon einmal ein Missgeschick.
Zum Beispiel?
Balmer: Bei den Tomaten hat einmal jemand alle Blätter weggerupft, weil er das Ausgeizen nicht richtig verstanden hat. Dabei werden die Seitentriebe ausgezupft, damit der Strauch in die Höhe wächst und schöne Früchte macht.
Gemüseanbau ist saisonal und witterungsabhängig. Wie ist garantiert, dass die Arbeiten dann gemacht werden, wenn sie gemacht werden müssen?
Balmer: Wenn es ganz dringend ist, rufen wir unsere Abonnenten auf, zu helfen. Das klappt ganz gut. Dann haben wir zum Glück sieben regelmässige Mitarbeiter, welche über ein Programm des Sozialamts zu uns kommen, und so ihr Einkommen aufbessern können.
Ihre Abonnenten müssen damit rechnen, dass sie auch einmal weniger Gemüse

Materialhäuschen beim Pflanzplatz Dunkelhölzli.
in der Tasche haben oder der Salat durch Hagel etwas mitgenommen aussieht. Wird deshalb reklamiert?
Ansorge: Ende Saison gibt es immer Abokündigungen. Es kann gut sein, dass dies auch damit zusammenhängt. 80 Prozent der Abonnenten bleiben aber. Balmer: Man geht auch das Risiko ein, dass der Ertrag einmal nur die Hälfte von dem ausmacht, was erwartet wurde. Und unser Gemüse sieht nicht immer so aus, wie im Regal des Grossverteilers. Aber das hat auch etwas Romantisches, es gehört einfach dazu. Letztes Jahr war der Frühling so kalt, dass wir erst einen Monat später mit Säen und Setzen beginnen konnten. Entsprechend ging es länger bis zur Ernte. Kaufst du im Supermarkt ein, merkst du solche Schwankungen gar nicht. Das ist aber auch der Reiz vom Selberanpflanzen, es ist unmittelbar. Sie beide sind an mindestens drei Tagen pro Woche auf dem Feld. Was können Sie sich für einen Lohn bezahlen?
Ansorge: Zusammen haben wir 130 bezahlte Stellenprozente, zum Ansatz eines Bauernlohns.
Wie ist das Projekt im Quartier verankert?
Ansorge: Vielleicht ein Drittel der Leute sind aus der näheren Umgebung.
Hat sich der Pflanzplatz so entwickelt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ansorge: Grundsätzlich sind wir offen für Neues. Wenn beispielsweise jemand Hühner halten möchte und sich auch entsprechend engagieren könnte, dann würden wir das sicher unterstützen. Beispielsweise gibt es inzwischen auf einem


Städtische Gärten bei Bologna in Italien.
Feld Bienenstöcke, die von jemandem gepflegt werden, ohne dass wir direkt etwas damit zu tun haben. Auch ein Blumenfeld ist dazugekommen.
Was raten Sie Leuten, die ein ähnliches Projekt starten möchten?
Balmer: Mein Tipp: Klein anfangen. Wir starteten mit 30 Abos, heute sind es rund 200.
Ansorge: Das schwierigste ist Land zu finden. Man sollte natürlich auch ein bisschen eine Ahnung vom Anbau haben. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Land schwieriger ist, Leute zu finden, die mitmachen. Wir lernten viel dazu: Die Vielfalt der Gemüse und Pflanzen wurde mit den Jahren grösser. Auch können wir uns erlauben, mehr auszuprobieren, weil wir so viele Leute haben, die mitarbeiten, im Gegensatz zu einem «normalen» Gemüsebauer. u
Urban Gardening, Guerilla Gardening, Urban Farming ... plötzlich waren sie da, all die neuen Begriffe und mit ihnen eine neue Generation von Gärtnern, Bauern und Un-ternehmern, die in der Stadt Brachflächen, aber auch winzige Hinterhöfe oder Dächer mit Gemüse bepflanzten. Ein Versuch etwas Ordnung in den Anbaudschungel zu bringen.
” Urban Gardening
Oberbegriff für städtisches Gärtnern. In Gärten, Höfen und auf Brachland ziehen Menschen in kleineren und grösseren Gruppen Gemüse, Beeren und Blumen für den Eigengebrauch. Das Gemüse wächst auch in Kisten, Säcken oder in alten Badewannen. Wer im Schrebergarten oder daheim auf dem Balkon Gemüse zieht, ist neuerdings auch ein Urban Gardener. Beispiele: www.quartiergarten-hard.ch www.st-georgen.ch
” Urban Farming
Städtischer Gemüseanbau, der kommerziell betrieben wird und mit neuen Anbaumethoden wie der Kombination von Gemüse- und Fischzucht experimen-
tiert und ganz ohne Erde funktioniert wie beispielsweise die Urban Farmers in Basel. www.urbanfarmers.com.
Auch ein Bauernhof in städtischem Gebiet ist natürlich ein Urban Farmer.
” Urban Agriculture
Der Name ist Programm: Bei Agriculture geht es einerseits darum, bereits bestehende Landwirtschaftsprojekte zusammenzubringen und andererseits auch darum, Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen und Interessen zusammenzubringen. Sei es beim Gärtnern oder an einem Kurs über nachhaltige Ernährung. www.urbanagriculturebasel.ch vereint momentan 40 solcher Projekte vom Stadthonig über Teeanbau auf Schiffscontainern bis zum Schulgartenprojekt. Auch die www.stadionbrache.ch vereint verschiedene Projekte.
” Essbare Stadt
Viele Städte – in Europa vor allem in Deutschland – unterstützen einerseits Privatinitiativen zur Stadtgärtnerei materiell und ideell, pflanzen andererseits aber auch selbst Gemüse statt Blumen in die städtischen Beete. Ab Frühling 2015 gibt es in der Stadtgärtnerei Zürich ein Bildungszentrum für Urban Gardeners. www.stadt-zuerich.ch/stadtgaertnerei
” Guerilla Gardening
Dass heute in vielen Städten bunte Malven und andere Blumen spriessen, ist vor allem auch den «Blumenkriegern» zu verdanken, die wild Samen streuten.
” Anbaugenossenschaften
Neben den vielen kleineren Gartenprojekten sind die Anbaugenossenschaften wohl die grösste Gruppe innerhalb des neuen Gärtnerns. Als Mitglied bezahlt man einen gewissen Betrag, bekommt dafür Gemüse und verpflichtet sich tageweise im Garten mitzuhelfen, so zum Beispiel bei www.dunkelhoelzli.ch www.orotoloco.ch
Lernen wir doch von den Kindern: Für sie ist Musse eine Selbstverständlichkeit. Unser Kolumnist Remo Vetter denkt über unser mit Aktivitäten vollgepacktes Leben nach.
Text: Remo Vetter
Eigentlich wollte ich diesen Artikel von längeren Reisen über Landstrassen quer durch die Schweiz
sich erholt. Vieles spricht dafür, dass es uns schlecht gelingt, abzuschalten, runterzufahren oder auszuspannen (siehe Seite




l Machen Sie aus Ihren Gartenabfällen Mulch. Holzabfälle von Bäumen und Sträuchern, Rasenschnitt und Laub eignen sich am besten dazu. Sammeln Sie diese Materialien und kompostieren Sie sie mehrere Monate. Das organische Material deckt den Boden ab und schützt ihn vor allen Witterungseinflüssen. Mulch hält die Feuchtigkeit im Boden, gibt ihm neue Nährstoffe und hält Unkraut ab.
l Wenn abgeerntet wurde, braucht die Erde noch einmal Nährstoffe. Die Bodenstruktur wird verbessert, indem man grüne Pflanzen und angewelktes Pflanzenmaterial, wie zum Beispiel Stroh, in das Beet einarbeitet. Diese Gründüngung unterstützt die Bildung von Humus und ist wirksam gegen Bodenerosion und Unkraut. Auch für die
Lebewesen im Boden bietet sie eine gute Nahrungsquelle. Sie können dafür Bienenweide, Raps, Klee oder Ölrettich anpflanzen.
l Damit die Vögel nicht auf ihre beliebten Brutplätze in Hecken verzichten müssen, ist der Heckenschnitt von März bis Ende September nicht ratsam, nur Formschnitte sind in dieser Zeit erlaubt. Da ein Heckenschnitt immer zu neuem Wachstum anregt, sollte man nicht zu spät, etwa ab Ende August zu schneiden beginnen. Andernfalls könnten die neuen Triebe Frostschäden erleiden und die Hecke würde im Frühjahr nicht mehr gut aussehen.
l Auch jetzt im Herbst ist das richtige Giessen sehr wichtig. Die meisten Schäden an den Pflanzen entstehen durch einen trockenen oder verfaulten Wurzelballen.

Aprikosenspalier
Wir möchten vor die Betonmauer (Neubau) im Spätherbst ein Aprikosenspalier pflanzen. Wir wohnen auf quasi 1000 Meter über Meer in Graubünden. Welche Sorte ist vor allem robust und schmeckt aber auch gut? Es müsste eine Sorte sein, die nicht zu früh aber auch nicht zu spät blüht. Wie müsste ich den Boden dafür vorbereiten (Humus, Dünger, Sorte Erde)?
Carole Ebinger, per EMail
alle Sorten können auf dieser Höhe gezogen werden, wenn der Standort warm und sonnig ist. Da die Aprikose früh reif ist, können sie auch in höheren Lagen ausreifen. Das Problem sind aber meistens die Spätfröste, und die gibt es auf 1000 Meter über Meer sehr oft; dadurch erfriert oft die Blüte, da Aprikosen an warmen, sonnigen Standorten sehr früh blühen. Spindelbäume können beim richtigen Schnitt zu Spalier gezogen werden. Ideale Sorten sind «Goldrich» und die Zwergaprikose «Aprigold». Zwergaprikosen können im Topf gezogen werden und dementsprechend bei Frost geschützt werden. Aprikosen lieben keine Staunässe, benötigen aber im Sommer zu Fruchtreife relativ viel Wasser. Der Boden soll humos sein.
Sie haben vor einiger Zeit geschrieben, dass man einen «Schneckengarten» machen soll, damit die Schnecken dort fressen und nicht an Orten, wo sie nicht sollen. Ich weiss allerdings nicht mehr, was man dort anpflanzen soll und wie das Vorgehen ist. Dann habe ich noch eine andere Frage: Wir haben Maibeeren. Die sollten doch zuckersüss sein, doch unsere sind bitter. Das letzte Jahr dachte ich, es sei eine Ausnahme, doch dieses Jahr ist es wieder so. Liegt dies an der Bodenbeschaffenheit?
Sandra Unternährer, per EMail
In unserem Garten haben wir die Wege mit Holzhäcksel eingestreut, was die Schnecken nicht lieben. Eine weitere Variante wäre ein Schneckenzaun (abgewinkeltes Blech). Schnecken lieben es feucht, dunkel, nass. Eine Möglichkeit wäre Bretter auszulegen, worunter sich die Schnecken verkriechen, danach kann man sie einsammeln. Auch Grashaufen oder Grünabfälle aus der Küche mögen sie. Dann zu den Maibeeren: Es kann sortenbedingt sein, einige sind süsser und andere weniger. Was aber einen grossen Einfluss hat, ist das Wasser. Maibeeren werden bitter, wenn sie zu trocken stehen. Das kommt bei Topfkultur oft vor. Im März, April und Mai war es sehr heiss und in einigen Lagen recht trocken, das könnte mit ein Grund sein.
Wir haben die Zucchini in einem Tunnel, die kleinen Zucchini sehen zuerst gut aus und werden dann vorne, wo Blüte war, dünner als beim Ansatz und schrumpeln und faulen dann bei der Spitze. Bei den Rhabarbern bekommen die Blätter so rot-braune Flecken. Habe einmal etwas von Magnesium-Mangel gelesen und Magnesium-Kali gegeben. Haben Sie sonst noch einen Tipp? Sonja Eisenhut, per EMail
Es kann sein, dass die Zucchini zu nass oder zu trocken stehen, beziehungsweise nicht genügend Nährstoffe aus dem Boden bekommen. Die unruhige Wetterlage in den letzten Wochen mit viel Niederschlag führte aber auch dazu, dass Zucchinis schweizweit auf den Beeten faulen. Den Rhabarbern würde ich eine gute Kompostgabe geben und mit Brennessel und Beinwell-Wasser (verdünnte Jauche) düngen.

_ Haben Sie Fragen rund um Garten und Balkon?Remo Vetter gibt Ihnen die richtigen Tipps. Schreiben Sie an: «natürlich», Gartenberatung, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, oder remo.vetter@natuerlich-online.ch

dem Dazugehören, nach Aufmerksamkeit und dem Genuss vieler Angebote, unsere wahren Bedürfnisse zu erkennen.
Erholung beginnt für mich mit einer Selbstreflexion des eigenen Lebens und Arbeitens: Was macht mich nur (ehrlich) müde – und was macht mich fertig, kaputt? Was fehlt mir, damit ich mich wirklich erholen kann? Wie fühlt sich richtig erholen eigentlich an? Und so schreibe ich diesen Artikel nicht von der Königsinsel an der schönen Westküste Frankreichs, sondern zu Hause im Garten, hier wo ich meine Batterien am besten aufladen kann – beim Arbeiten oder auch nur beim Beobachten der Natur.
Blütenshow der Extraklasse
Der Herbst löst jetzt langsam den Sommer ab und die Gartensaison neigt sich ihrem Ende zu. Es wird deutlich kühler und die Tage werden spürbar kürzer. Jetzt gilt es, die Ernte einzuholen, haltbar zu machen und einzulagern. Die Hecken müssen geschnitten werden. Bei schönem Wetter dauert die Blüte einiger Rosen noch immer an. Das Bild bestimmen nun aber Astern, Sonnenhut, Fetthennen und andere Blütenstauden. Diese Spätsommerblüher legen sich voll ins Zeug und bieten im Garten eine Blütenshow der Extraklasse. Die Apfel- und Kartoffelernte kommt in den Keller, Konfitüren und Gelees aus geernteten Früchten und Beeren können eingekocht werden. Und das nächste Gartenjahr wird bereits geplant. Zwiebeln für Krokusse, Tulpen und Narzissen werden bestellt. u
l Tomatenpflanzen tragen nun die letzten Früchte und noch grüne Tomaten reifen am Strauch aus, wenn man sie mit Folienhauben einpackt. Auf jeden Fall sollten Sie neu gebildete Blüten besser entfernen, damit alleine die Früchte von den Nährstoffen profitieren können.
l Zucchini werden vor dem ersten Frost geerntet. Bis dahin gilt es, die Pflanze regelmässig zu wässern und zu düngen.
l Die FrühherbstSonne lässt Kürbisse jetzt richtig ausreifen und sorgt dafür, dass das Fruchtfleisch schön süss und die Schale holzig wird. Der jetzt schon mögliche Nachtfrost schadet den Früchten nicht. Sie sollten bei trockenem Wetter möglichst lange auf den Beeten liegenbleiben und nachreifen.
l Der Spätsommer ist ein idealer Zeitpunkt, um Rosen zu setzen. Am besten stellt man den Rosenstock zunächst einen Tag lang ins Wasser, damit er kräftig gewässert wird. Der optimale Rosenboden ist ein humusreicher, sandi ger Lehmboden. Denken Sie daran, den Boden ausreichend aufzulockern, bevor Sie die Pflanzen einsetzen, denn die Wurzeln der Rose brauchen sehr viel Sauerstoff. Entfernen Sie auch verletzte und abgestorbene Wurzelteile. Beim Ein setzen der Pflanze ist es wichtig, dass die Veredelungsstelle der Rose etwa fünf Zentimeter unter der Erdoberfläche sitzt.
l Herbstblühende Zwiebelpflanzen müssen im September in die Erde. Die Knollen werden vorher 24 Stunden lang in Wasser eingeweicht.
l Dahlien sollte man nach der Blüte ausdünnen: Entfernen Sie Verblühtes, damit die Nachblüte üppig ausfällt und die Pflanze ihre Kraft nicht in die Samenbildung verliert. Eine schwache
Dahlie ist ausserdem anfälliger für schädliche Pilze und Blütenfäulnis.
l Wintergrüne Gehölze wie Eibe und Efeu werden gepflanzt. So haben sie vor dem Winter noch genug Zeit, Wurzeln zu bilden, sodass sie im Frühjahr schnell loslegen können.
l Je früher die Zwiebeln von Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen, Krokussen und anderen Frühblühern in den Boden kommen, desto besser wachsen sie an und umso schöner blühen sie im nächsten Frühjahr auf. Setzen Sie die Zwiebeln für Frühlingsblumen vor dem ersten Frost. Alle Arten brauchen lockeren Boden, damit sich keine Nässe stauen kann. Wenn man etwas Kompost mit in das Pflanzloch gibt, ist auch gleich für genügend Nährstoffe gesorgt.
l Kaltkeimer wie Eisenhut, Phlox, Frauenmantel und Taglilie müssen vor dem Winter ins Beet. Ihre Samen

Der Schiefstand der Grosszehe, medizinisch Hallux Valgus, ist die am häufigs ten vorkommende Fussfehlstellung. Für Hanwag Grund genug, passende Berg- und Trekkingschuhe für Betroffene anzubieten. Die sogenannten Bunion-Modelle mit speziellem Leisten und weichem Lederfutter entwickelten sich schnell zu Bestsellern. Stellvertretend für dieses Konzept wurde der «Tatra Bunion GTX» mit dem «Outdoor Industry Award 2014» ausgezeichnet. Preis Tatra Bunion Men/Lady Fr. 319.–.
_ Mehr Infos unter www.hanwag.de


Drunter und drüber
Pur für den Sonnengenuss oder als wärmendes Drunter für kühle Nebeltage bietet sich «Erna», die Inzip-Fleecejacke, an. Farblich abgesetzte Seiten unterstreichen die taillierte Schnittführung. Das pflegeleichte, softe Tecnopile-Fleece wärmt angenehm und bietet einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch. In modischen Farben erhältlich ab Fr. 139.–.
_ Mehr Infos unter www.schoeffel.com
Kompakt und dennoch grosszügig: Die Grills der Linie «2 Series Compact» sind perfekt für Grilleure mit wenig Platz oder für mobile Geniesser. Diese Gasgrills mit einer Grillfläche von 2100 cm² lassen sich ganz einfach zusammenfalten und vertikal lagern. Das macht die 3 Modelle der «2 Series Compact» zu idealen Balkongrills und Begleitern fürs Camping oder den Ausflug ins Grüne.
Preis ab Fr. 290.–.
_ Mehr Infos unter www.campingaz.ch


Kräuterzauber aus dem Garten
Für reine Naturkosmetik steht das kleine aber feine Label «Kräuterzauber». Ob Cremen, Lippenpomade oder Badezusatz – alles wird in liebevoller Handarbeit von Martina Rocco stets frisch hergestellt. Die Produkte enthalten ausschliesslich natürliche Rohstoffe, viele davon stammen aus Martinas eigenem Garten oder von nahen Wiesen und Wäldern. Wer eine Creme für spezielle Bedürfnisse wie z.B. Allergien benötigt, kann sich von der fachkundigen Kräuterzauber-Frau beraten lassen und erhält so sein ganz persönliches Produkt.
_ Bestellmöglichkeiten und weitere Angebote unter www.kräuterzauber.ch
Einfache Idee mit grosser Wirkung
Diese Matte wirkt sehr entspannend, schmerzlindernd, schlaffördernd und ausgleichend auf unseren gesamten Organismus.
6210 Stimulationspunkte wirken nach einem jahrtausendealten Heilverfahren aus Asien, der Akupressur.
_ Mehr Infos auf www.gesundundgluecklich.ch und Tel. 056 534 93 26


Der ultraleichte «Conspiracy II OutDry» ist ein Multifunktions-Sportschuh mit zukunftsweisender Laminier-Technologie, die ihn absolut wasserdicht macht, während die Techlite Zwischensohle eine leichte Dämpfung bietet. Die rutschfeste Omni-Grip-Technologie des «Conspiracy» verspricht Bodenhaftung auf jedem Gelände.
Preis Damen/Herren Fr. 129.–.
_ Mehr Infos unter www.columbiasportswear.ch


Sterngucker im September_ Die Milchstrasse und 200 Milliarden Sonnen
Betrachtet man in einer mondlosen Nacht den Himmel, sieht man mit blossem Auge mehrere Tausend Sterne leuchten. Sie erscheinen uns als kleine Punkte, die aussehen wie Diamantsplitter, und doch sind es alles Sonnen. Viele von ihnen sind um einiges grösser als unser Muttergestirn. Zwischen diesen Punkten erstreckt sich ein schwach schimmerndes Band – die Milchstrasse.
Unsere Sonne, ein einfacher gelber Zwergstern, befindet sich in ihrem Randbereich. Von diesem Teil der Galaxie sehen wir die Anhäufung von Sternen –wie wenn wir uns am Rand eines Tellers befänden und umherblickten. Diese ungeheure Menge an Sternen präsentiert sich uns als das Band der Milchstrasse. Sie hat einen Durchmesser von etwa 100 000 Lichtjahren und beherbergt rund 200 Milliarden Sonnen. Unser Mutterstern ist 25 000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Andreas Walker
Ökologie_Mittelmeerfische stark bedroht
Während sich die Fischbestände im Norden erholen, sind die Tiere im Mittelmeer akut bedroht, wie griechische Wissenschaftler berichten. Seit 1990 würden immer mehr und vor allem auch (zu) junge Fische wie beispielsweise Seehechte aus dem Meer gefischt.Vor der Geschlechtsreife gefischt, kann sich der Bestand niemals stabilisieren, geschweige denn erholen.Trotz gleicher gesetzlicher Vorschriften ist die Lage am Mittelmeer viel schlechter. Das hätte unter andrem mit der grossen Zahl von kleinen Fischerbooten, unterschiedlichsten Fangmethoden, vielen Häfen und einer dadurch letztlich schwierigeren Kontrolle zu tun. tha


Zoologie_ Was sich Affen zu sagen haben
Wie Menschenaffen kommunizieren, war schon Objekt zahlreicher Studien und Untersuchungen. Nun aber ist es den beiden Forschern Catherine Hobaiter und Richard Byrne gelungen, die bereits bekannten Gesten von Schimpansen zu übersetzen («Current Biology»). So will der eine Affe dem andern beispielsweise sagen: «Komm, klettere auf meinen Rücken», wenn er ihm die Fusssohlen hinstreckt. Durch auffälliges Kratzen am Unterarm wird signalisiert: «Lausen!» und wenn der Affe mit seinen Zähnen Streifen von einem Blatt rupft und das Gegenüber direkt anguckt, ist das eine Aufforderung zum Flirt. Gut aufgepasst beim nächsten Zoobesuch! tha
Lesen_ Ewiger Wald
Raoul Heinrich Francé (1874–1943), einer der grössten biologischen Forscher, hat den Begriff des Edaphons geprägt, «das im Boden Lebende», und mehr als 70 Bücher geschrieben. Seit einigen Jahren werden diese Bücher wiederentdeckt und neu aufgelegt, so auch «Ewiger Wald». «Ein wunderbares Theater ist so ein Wald für den Wissenden», schreibt Francé und lässt es vor unserem geistigen Auge auferstehen, mit Ameisen und Ameisenlöwen, Zauberworten und Totentänzen. krea _ Raoul H. Francé: «Ewiger Wald», OLV-Verlag, 2013, Fr. 24.40
Das Romantikerherz schlug höher, als zur Vernissage dieser Ausstellung fünf Hornisten Weisen bliesen, die einen akustisch direkt in den Wald versetzten. Wie reagieren denn Rehe bei Jagden auf diese Klänge? «Interessante Frage», meinte der RehExperte, «denn obschon ihre Aufmerksamkeit auf höchster Stufe ist, hören sie der Musik durchaus zu, solange sie sich nicht davon bedroht fühlen.»
Vorsichtige Tiere wie die Rehe, so erfährt man in dieser schlicht gestalteten, aber aufschlussreichen und informativen

Ausstellung, brauchen scharfe Sinne. Rehe hören und sehen sehr gut, nehmen aber weniger Farben wahr als der Mensch. Geradezu phänomenal ist ihr Geruchsinn, die Feinheit ihrer Nasen übertrifft selbst jene des Hundes. Vor Holzparavents zu Themen wie «Erfolgreich», «Wachsam» und «Risikoreich» stehen häufig lebensechte Präparate von Rehen, etwa beim Verbeissen einer jungen Tanne oder aber als Opfer eines ebenso lebensechten Luchses. Filme und interaktive Einrichtungen – man kann beispielsweise via Knopfdruck sowohl das Fiepsen eines Rehkitzes als auch das nachgeahmte eines Jägers erklingen lassen – ergänzen die Schau. Rehe, die
heute häufigsten wildlebenden Huftiere der Schweiz, waren um 1870 fast ausgestorben; dass sich die Population mehr als erholt hat, ist ein Resultat von Jagdplanung und Waldgesetzen. Hans Keller
_ Naturmuseum Winterthur, Museumstrasse 52, Tel. 052 267 51, bis 26. Oktober, www.natur.winterthur.ch
Wie im Science-Fiction-Drehbuch: Sonnenstürme könnten ganze Landstriche von der Stromversorgung kappen. Sie lassen am Himmel aber auch wunderbare Polarlichter entstehen.
Text: Andreas Walker
Die Sonne war von rötlicher Farbe, und sie erhielt einen schwarzen Dampf ähnlich einer Elster, der sich erst nach einigen Monaten auflöste.»
Diese Beschreibung von Sonnenflecken stammt aus einer chinesischen Aufzeichnung aus dem Jahr 188 nach Christus. Schon früh wurde das Himmelsphänomen beobachtet.
Heute kennt man die Ursachen, die hinter diesem Naturschauspiel stecken. Da die Sonne in verschiedenen Breitengraden unterschiedlich schnell um ihre eigene Achse rotiert, kommt es im Verlauf
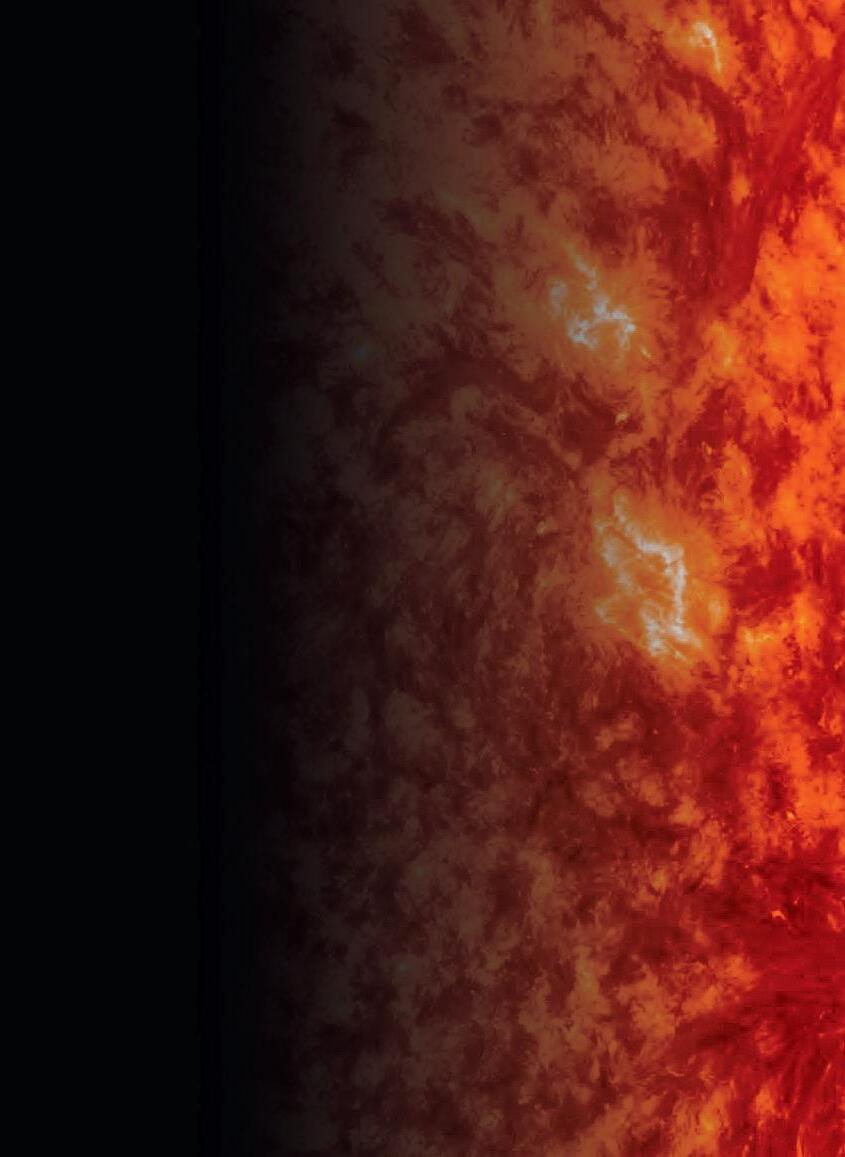
von Jahren zu starken magnetischen Störungen auf der Sonnenoberfläche. Die sogenannten Sonnenflecken sind das auffälligste Merkmal dieser Aktivität, die im Durchschnitt alle elf Jahre ein Maximum erreicht.
Bei erhöhter Sonnenaktivität entstehen viele Sonnenflecken, und auf der Erde kann man ein häufigeres und stärkeres Vorkommen von Polarlichtern beobachten. Je nach Aktivität können in komplexen aktiven Gebieten lokal begrenzte Explosionen auftreten – die Flares. Diese Sonneneruptionen finden statt, wenn in
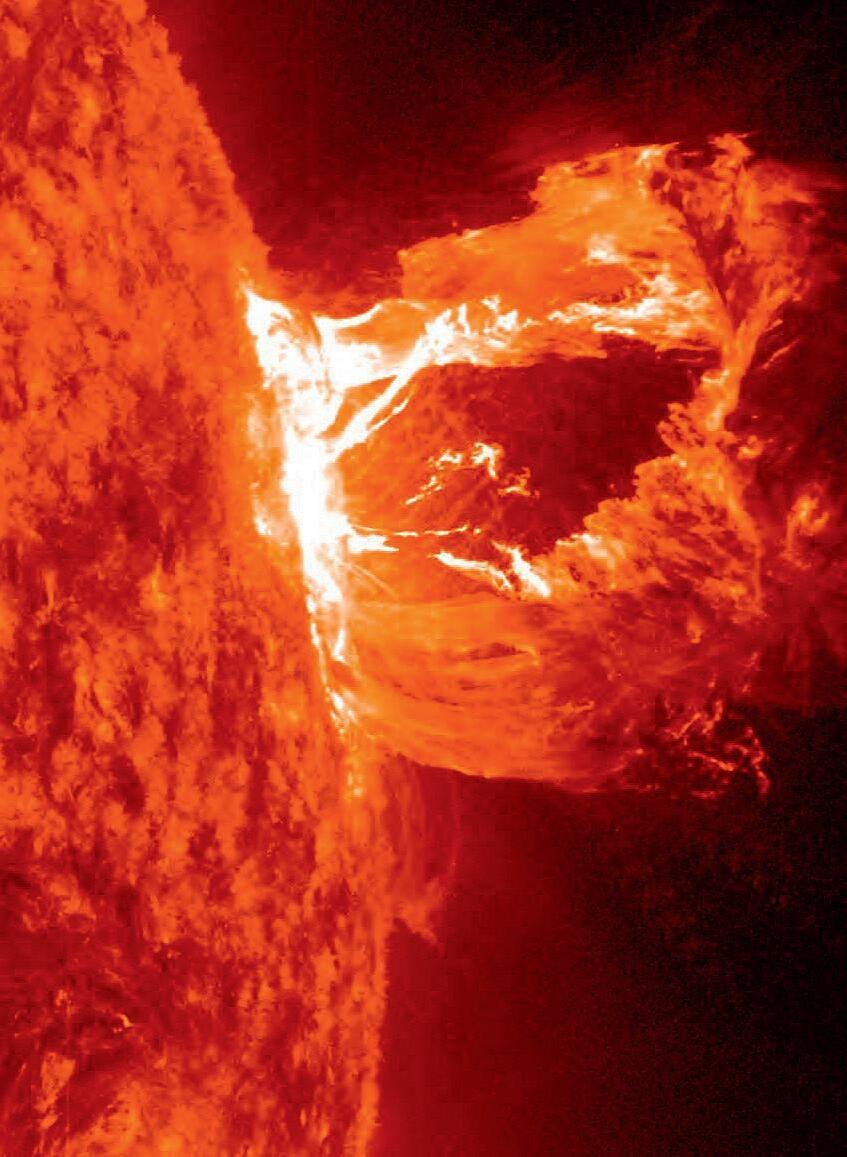
Über der Chromosphäre steigen leuchtende Wolken und Bögen in die Höhe, die «Protuberanzen». Es handelt sich dabei um gigantische, glühende Plasmawolken, die sich in riesigen Bögen entlang der Magnetfeldlinien der Sonne erstrecken.
Naturspektakel auch im Aargau: Die Polarlichter waren im November 2003 zu sehen.
solchen Gebieten schlagartig magnetische Energie in thermische Energie umgewandelt und freigesetzt wird. Die während dieser Ausbrüche ausgesendete energiereiche Teilchenstrahlung verstärkt den Sonnenwind, daher treten wenige Tage nach der Eruption oftmals intensive Polarlichter auf, die gelegentlich sogar bei uns gesehen werden können.
4000 Grad heiss und 20 000 Kilometer lang
Sonnenflecken treten paarweise auf, wobei der eine Fleck eine positive, der andere eine negative magnetische Polarität aufweist, ähnlich wie die Pole eines Hufeisenmagneten. Die Sonnenoberfläche ist etwa 5500 Grad heiss. Da die Sonnenflecken eine Temperatur von «nur» etwa 4000 Grad haben, erscheinen sie dem Beobachter als dunkle Gebilde. Sie haben einen typischen Durchmesser von etwa 20 000 Kilometern. Grössere Fleckengruppen können sich über hunderttausend und mehr Kilometer erstrecken. Im April 1947 wurde eine Riesengruppe mit einer Ausdehnung von fast 300 000 Kilometern beobachtet – dies sind mehr als drei Viertel der Strecke von der Erde zum Mond.
In der westlichen Kultur wurden die Sonnenflecken lange ignoriert. Die Kirche, die im Mittelalter ein Weltbild strikt ablehnte, das die Sonne und nicht die Erde in den Mittelpunkt stellte, konnte sich mit dem Gedanken von Flecken auf der makellosen Sonnenscheibe ohnehin nicht anfreunden. Nach damaliger Ansicht hatte die Sonne perfekt und «rein» zu sein. Eine arabische Aufzeichnung aus dem Jahr 840

berichtet: «Im 225. Jahr nach der Hedschra, in der Regierungszeit des Kalifen alMu’tasim, erschien mitten auf der Sonne ein schwarzer Fleck […] der Fleck hielt sich 91 Tage lang auf der Sonne.»
Stürme verpuffen im Weltall
Die Kirche konnte sich mit Flecken auf der makellosen Sonne nicht anfreunden.
Die Sonne sendet mit ihrer Strahlung einen permanenten Strom von geladenen Teilchen – den Sonnenwind – aus. Das Erdmagnetfeld fängt normalerweise diese Teilchen ab und schützt uns davor. Erst bei einem Sonnensturm – wenn sich die Stärke des Sonnenwindes durch eine erhöhte Sonnenaktivität stark gesteigert hat, können diese geladenen Teilchen viel weiter vordringen. Allerdings ist dies nur der Fall, wenn der Sonnensturm erdgerichtet ist. Viele Sonnenstürme treffen die Erde nicht direkt und verpuffen für uns ohne Folgen im Weltall. Nicht so 1859: Vom 28. August bis 2. September ereigneten sich mehrere starke Sonneneruptionen. Dieser Sonnensturm produzierte Polarlichter, die bis nach Rom, Havanna und Hawaii sichtbar waren, und verursachte Starkströme in den Telegrafenleitungen in Nordeuropa und Nordamerika, sodass diese Funken schlugen. Das erst gerade weltweit installierte Telegrafennetz wurde massiv beeinträchtigt. Heute können schwere Sonnenstürme bei Satelliten, elektrischen Anlagen, Navigationssystemen wie GPS und Funkverbindungen starke Störungen verursachen. Am 30. Oktober 2003 führte ein solcher
Sturm zu einem mehrstündigen Stromausfall in Malmö (Schweden) und einem Ausfall des europäischen Flugradarsystems. Über 60 Flüge in den USA mussten verschoben werden. Die USLuftfahrtbehörde empfahl Fluggesellschaften, nördlich des 35. Breitengrades tiefer zu fliegen, da die Strahlendosis in dieser Höhe geringer war. Die Navigationssysteme für den automatischen Landeanflug auf USFlughäfen fielen teilweise aus, weil die Signale der GPSSatelliten gestört wurden. Der Sonnensturm zerstörte auch die Solarzellen des japanischen Erdbeobachtungssatelliten Midori II und mit ihnen den 630 Millionen USDollar teuren Satelliten.
Ein Sonnensturm wie 1859 wäre heute fatal Experten sind überzeugt davon, dass Sonnenstürme für unsere technisierte Gesellschaft eine ernsthafte Gefahr darstellen, da die Stromversorgung, der Flugverkehr, unsere Kommunikationssysteme, ja sogar die Finanzwirtschaft von Satelliten und anderen komplexen verletzlichen technischen Installationen abhängen.
Das Weltraumwetterereignis von 1859, das schwere Schäden im gerade entstehenden Telegrafennetz verursachte, würde sich in der heutigen hoch technisierten Welt fatal auswirken. Eine Studie des britischen Strom und Gasversorgers UK National Grid zeigt, dass ein derartiger Son


nensturm heute manche Regionen für mehrere Monate von der Stromversorgung abschneiden könnte. Dabei war der Sonnensturm von 1859 im historischen Vergleich nicht einmal besonders stark. Beim Ansturm der energiereichen Teilchen auf die Erde können zudem elektrische Ströme in Überlandleitungen oder ÖlPipelines erzeugt werden. Ausserdem kann es zu Unterbrechungen in der Stromversorgung, dem Zusammenbruch des Telefonnetzes sowie zu Korrosionsschäden an den Rohren von Pipelines kommen.
In der Nacht zum 13. März 1989 nahm die Häufigkeit und Stärke der Polarlichter nach einer grossen Sonneneruption sehr stark zu. Der von der Sonne hereinprasselnde Teilchenschauer verursachte in der kanadischen Provinz Quebec eine Überlastung des Stromnetzes und führte zu einer Unterbrechung der Elektrizitätsversorgung im Gebiet um Montreal. Dabei fielen Verkehrsleitsysteme, Flughäfen sowie die Fernwärmeversorgung aus. Sechs Millionen Menschen waren von diesem Ereignis betroffen.
Die National Academy of Sciences (NAS) in den USA erstellte ein mögliches Szenario eines grossen Sonnensturms. Dieser Report gleicht dem Drehbuch eines ScienceFictionFilms. Die in Überlandleitungen induzierten Ströme könnten in vielen Bundesstaaten mehr als die Hälfte der vorhandenen Transformatoren beschädigen. Als Folge davon wären bis zu
Ein Omegaband erstreckt sich über die nordnorwegische Stadt Tromsø.
Der Sonnensturm verursachte Starkströme in den Telegrafenleitungen, dass es Funken schlug.
130 Millionen Amerikaner zum Teil Wochen lang von der Stromversorgung abgeschnitten. In einer Welt, in der praktisch keine Maschine mehr ohne einen Computerchip funktioniert, gleicht ein solches Szenario einem Supergau.
Sonne unter Beobachtung
Deshalb steht unsere Sonne unter dauernder Beobachtung von Satelliten. Unter anderem zeichnet das Sonnen und Heliosphärenobservatorium «Soho», das mit einem Dutzend Detektoren an Bord ausgerüstet ist, alles auf – von den schnellen Protonen des Sonnenwindes bis zum langsamen Pulsieren der Sonne selbst. Wenn Satelliten jedoch den Partikelstrom eines Sonnensturms aufzeichnen, ist die
ser praktisch schon auf der Erde angekommen. Allerdings können grosse Solarausbrüche direkt vom Satelliten beobachtet werden. Danach dauert es etwa ein bis zwei Tage, bis der Sonnensturm die Erde erreicht. Computermodelle berechnen dann die mögliche Ankunft der geladenen Teilchen auf der Erde. Im Oktober 2011 nahm die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ein neues Computermodell in Betrieb. Damit kann auf sechs Stunden genau vorhergesagt werden, wann ein Sonnensturm die Erde treffen wird. ◆

Da wir uns zurzeit in einem Maximum der Sonnenaktivität befinden, sind immer wieder grössere Fleckengruppen auf unserem Muttergestirn zu sehen. Das Bild zeigt einen Sonnenaufgang, der am 6. Februar 2014 in Hallwil (AG) aufgenommen wurde.
Die Via Alta im Maggiatal führt den Wanderer in sechs Tagen von Cardada oberhalb Locarno nach Fusio (fast) zuhinterst im Maggiatal – unterwegs auf der ersten Etappe.
Text: David Coulin
Die Via Alta della Vallemaggia ist so etwas wie die sanfte Alternative zur Via Alta della Valle Verzasca. Ohne auf dauernde Tiefblicke in die wilden Tessiner Täler und Weitblicke bis fast hinunter nach Mailand zu verzichten, kann man auch hier während sechs Tagen eine Grat- und Hüttentour der Superklasse geniessen. Sie ist nicht ganz so hochalpin wie diejenige im Val Verzasca, dafür näher bei den Tessiner Ziegenalpen. Wir nehmen die erste Etappe – inklusive einer oder zwei Übernachtungen von Cimetta zur Alpe Nimi unter die Füsse.
Übernachten und früh losziehen
Die wohl berühmteste Ziegenalp ist die Alpe Nimi. Da wollen wir hin und starten bei der Capanna Cimetta auf 1670 Metern über Meer. Ideal ist es, dort schon zu übernachten. Am Vortag reist man mit Standseilbahn, Luftseilbahn und Sesselbahn von Locarno über Orselina, Cardada bequem nach Cimetta. Wem das zu gemütlich ist,
steigt ab der Bergstation Cardada in rund 1½ Stunden zu Fuss nach Cimetta auf, geniesst die Aussicht und kann sich abends voller Vorfreude auf die Wanderung in ein Bett der Capanna Cimetta plumpsen lassen.
So lässt es sich am Morgen dann richtig früh losziehen – und man muss nicht auf den Betriebsstart der Sesselbahn warten. Es darf auch noch etwas dunkel sein, denn den Weg auf die Cima della Trosa auf 1869 Metern über Meer, den ersten Gipfelpunkt der Gratreise, kann man kaum verfehlen. Warum nicht dort den Sonnenaufgang geniessen, im frischen und klaren Morgenlicht? Auch der Weiterweg zum Madone (2039 Meter über Meer) ist klar vorgespurt. Ein bisschen steil ist der Abstieg zwar und rutschig auch, aber an sich gutmütig, sodass er auch Teil der Leichtwandervariante sein kann. Auf dem Madone spätestens drängt sich eine erste


Morgendämmerung auf dem Madone.
Pause auf. Denn obwohl das auf der Karte distanzmässig gar nicht so weit aussieht –das Auf und Ab braucht seine Zeit. Zwischen dem Madone und dem Pizzo di Corbella verläuft der bezeichnete Weg etwas unterhalb der Gratkrete. Eigentlich schade, denn diese bietet ein ideales Übungsgelände für Alpinwanderer. Leichte Kraxelei über Tessiner Gneisblöcke, dazwischen mal etwas Alpenrosen oder Dornengebüsch – da kommt richtiges Südalpen-Feeling auf. Den Aufstieg auf den Pizzo di Corbella (2065 Meter über Meer) sollten sich auch die Leichtwanderer nicht entgehen lassen. Es winkt der Adlerhorst Nummer drei und damit ein weiterer Ruhepunkt, um wieder innezuhalten und Stimmung in sich einzusaugen.
Die Ruhe wird schon bald gewürzt mit hellem Glockengebimmel. Dieses rührt von den Ziegen her, die hier im Sommer ihr kärgliches Auskommen fristen. Das Gebimmel begleitet einen von nun an, wie

Neue Perspektiven: Die Sesselbahn von Cardada nach Cimetta.
Charakter
Genussvolle Gratwanderung (mit der Möglichkeit einer 6-tägigen Weitwanderung bis Fusio).
Schwierigkeit
Entlang der markierten Piste T3 (Anspruchsvolles Bergwandern, gute Kondition und Trittsicherheit), mit Varianten T4 (Vertrautheit mit exponiertem Gelände). Etwas Ausdauer ist hilfreich.
Ausgangspunkt
Capanna Cimetta (1647 Meter), mit SBB bis Locarno, mit Standseilbahn nach Cardada, dann Sessellift. Herberge mit 52 Betten, Telefon 091 743 04 33.
Endpunkt
Maggia (ca. 325 Meter), Rückreise mit Bus nach Locarno.
Höhendifferenz
1400 Meter Aufstieg, 1000 Meter Abstieg (bis Alpe Nimi), 1400 Meter Abstieg Alpe Nimi bis Maggia (2. Tag).
Wanderzeit
6 bis 7 Stunden (bis Alpe Nimi), Abstieg Alpe Nimi bis Maggia 3 Stunden (2. Tag).
Route
1. Tag. Von der Capanna Cimetta auf gutem Wanderweg hinauf zur Cima della Trosa (1869 Meter). Nordwärts steil hinunter bis zu einem Sattel, dann wieder auf besserem Weg hinauf zum Madone (2039 Meter). Vom Madone immer entlang der Gratkrete (oder auf Alpinwanderweg leicht unterhalb) zum Pizzo di Corbella (2065 Meter).
Wieder hinunter zur Bocchetta di Orgnana, dann auf dem Alpinwanderweg bleibend hinauf zum Pizzo d’Orgnana (2218 Meter). Von dort auf dem Grat bleibend weiter bis zum unübersehbaren Abzweiger auf dem Passo di Nimi. Dort hinunter zur Alpe di Nimi.
2. Tag. Von der Alpe di Nimi auf dem Alpweg via Alarlo nach Maggia.

Leichtwandervariante
Bis zur Senke zwischen dem Madone und dem Pizzo di Corbella entlang dem Alpinwanderweg. Dann unter dem Pizzo di Corbella durch. Unter der Bocchetta di Orgnana westwärts hinunter Richtung Alpe Pizzit, dann in der Flanke zur Alpe Nimi querend (T3, 1100 Meter Aufstieg, 700 Meter Abstieg, 5 bis 6 Stunden Wanderzeit bis Alpe Nimi).
Unterkunft und Verpflegung unterwegs Alpe Nimi (1718 Meter), bewartet von Juni bis September, ca. 20 Schlafplätze in einem eher engen Schlafraum, Telefon 079 230 48 79
Karten
Landeskarte 1: 25 000, 1312 Locarno, 1292 Maggia
Landeskarte 1: 50 000, 276 Val Verzasca Landeskarte 1: 33 333, 3308 T Locarno
auch der Ziegenkot, der vor allem im Gipfelbereich des nächsten Höhepunktes, des Pizzo d’Orgnana (2218 Meter über Meer), die Felsen überzieht. Für den Aufstieg nimmt man am besten den Alpinwanderweg – ein Direktaufstieg über den Grat ist zu schwierig. Der Rest ist wieder reiner Gratgenuss, und bald schon findet man sich bei der Alpe Nimi.
Berühmt geworden ist diese wegen des Älplers Pietro Zanoli. Er war Banker, Campingplatzdirektor, Skilehrer und Animateur beim Club Med, bis er dem Ruf seines Onkels folgte, der mit 78 Jahren die Alp aufgeben musste. Seither lebt Pietro im Sommer mit seinem Käser und seiner Partnerin da oben und ist von den Medien als «Geissenpeter» abgefeiert worden. Die Folge war, dass er innert vier Jahren die Übernachtungszahlen in seiner sehr bescheidenen Unterkunft um einen Viertel steigern konnte und jetzt unter den herrschenden baulichen Bedingungen an die Kapazitätsgrenzen gelangt ist. Trotzdem wird man eine Übernachtung nicht verschmähen, ausser man ist früh dran und kann den wildromantischen Abstieg nach Maggia anschliessen. Oder man hat mehr Zeit, bleibt oben und wandert weiter, über die sieben Berge und Täler bis nach Fusio. u

Gewinnen Sie
Je eine Damen- und Herren-Outdoor-Hose «Karl und Karla Trousers» von Fjällräven im Wert von je 159 Franken. Der unverwüstliche Klassiker ist aus strapazierfähigem G-1000Material. Die Hose hat vorgeformte Knie und ungekürzte Länge. Die Seiten- und Gesässtaschen sowie die grossen Beintaschen bieten Platz für Karten, Werkzeuge und Krimskrams. _ Mehr Infos unter www.fjallraven.de

Als Zusatzpreis gibt es dreimal zwei Paar Socken X-SOCKS Trekking Silver.

Wettbewerbsfrage
Bis wohin kann man auf der Via Alta Vallemaggia wandern?
A: Bis nach Fusio
B: Bis nach Cevio
C: Bis nach Olivone
Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
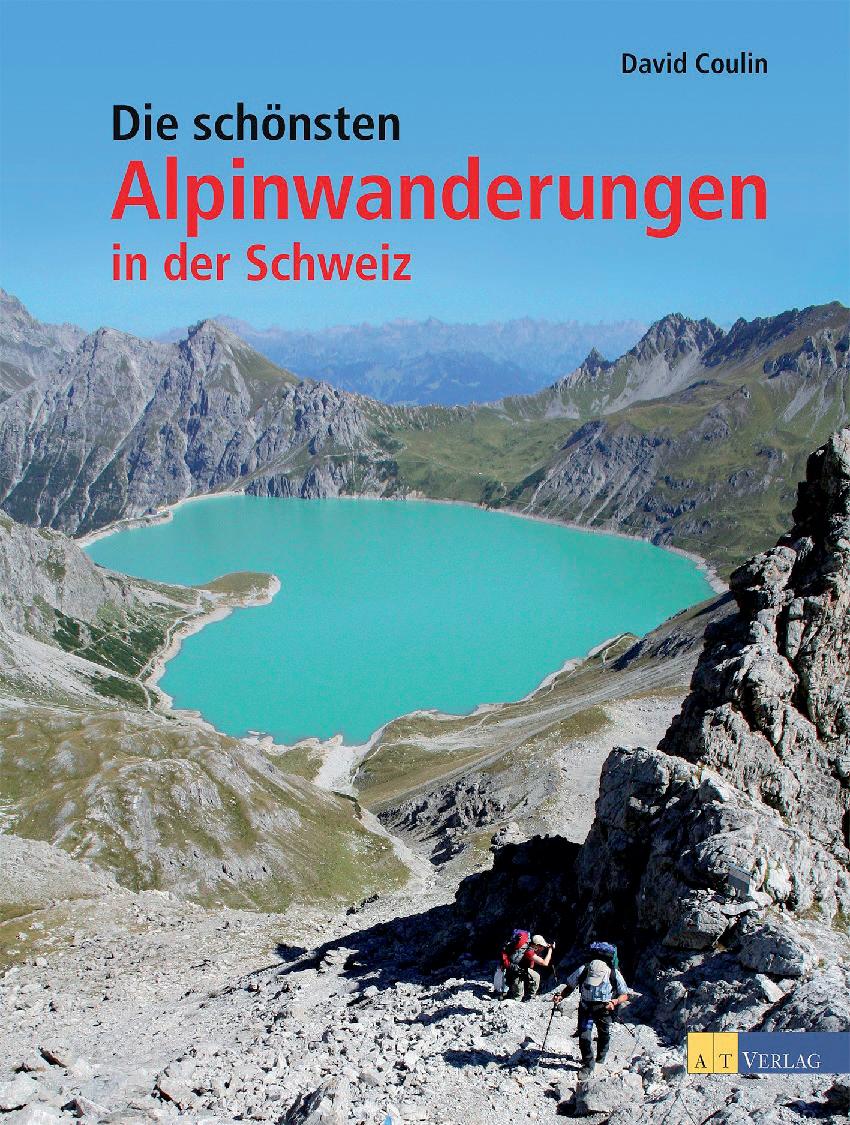
Leserangebot
Das Buch «Die schönsten Alpinwanderungen in der Schweiz» stellt 50 Alpinwanderungen vor und zu jeder Tour auch noch eine Leichtvariante für alle, die das Gebiet ohne speziellen Adrenalinkick erkunden wollen. Selbstverständlich finden sich im Buch ausführliche Routenbeschreibungen sowie alle nötigen Informationen.
Bestellen Sie das Buch aus dem AT-Verlag zum Vorzugspreis von Fr. 39.90 statt Fr. 49.90.


Herrenmodell «Karl»

Damenmodell «Karla»
Wir gratulieren!
Auflösung aus Heft 6-2014: B, Titlis
Je eine Damen- und Herren-OutdoorHose «Karl und Karla Trousers» von Fjällräven haben gewonnen:
• Thomas Bolt, Rickenbach
• Regina Haller, Reinach
Je zwei Paar «X-Socks Trekking Silver» haben gewonnen:
• Anne Humbert, Lancy
• Gabriela Arnold, Neuenkirch
• Stefano Rota, Egg
So nehmen Sie am Wettbewerb teil: Mit untenstehendem Bestellcoupon oder gratis im Internet unter www.natuerlich-online.ch/wettbewerb
Senden Sie mir:
«Alpinwanderungen in der Schweiz» à Fr. 39.90, inkl. MwSt. und Versandkosten. Zudem nehme ich automatisch am Wettbewerb teil..
Wettbewerbslösung: u A: Fusio u B: Cevio u C: Olivone
Name Vorname
Strasse, Nr.
PLZ / Ort
Datum Unterschrift
09-2014
Wenn ich eine Outdoor-Hose «Karl und Karla Trousers» von Fjällräven im Wert von Fr. 159.– gewinne, wünsche ich mir folgende Grösse und Farbe (nach Verfügbarkeit):
Damenmodell: u 34 u 36 u 38 u 40 u 42 u 44 Farben: u dark grey u dark navy
Herrenmodell: u 46 u 48 u 50 u 52 u 54 u 56 u 58 Farben: u dark grey u sand
Das Leserangebot ist gültig bis 31. Oktober 2014 und gilt nur für die Schweiz. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. September 2014. Coupon einsenden an: AZ Fachverlage AG, Lesermarketing, «Alpinwanderungen», Postfach, 5001 Aarau

Teeset «TeaTime» von WMF
Teeliebhaber schwören auf losen Tee. Das Aufgiessen der Blätter, dessen Aromen sich frei entfalten, ist eine Zeremonie. Mit der Kollektion
«TeaTime» von WMF lässt sich die Teezeit stilvoll zu Hause zelebrieren.
Das moderne Design und das hochwertige Material der Kollektion machen den Genuss perfekt.
Praktisch: Der Tee kann nach dem Ziehen im Sieb bleiben. Sobald der Pressteller nach unten gedrückt wird, zieht der Tee nicht mehr weiter.
● Höhe: 21,3 cm Länge: 20,6 cm Volumen: 1,2 l
Aktionspreis Fr. 79.90 statt Fr. 99.–20%
Rüstbrett mit Stahlgriff von WTB – Werkstatt-Team Bubikon
Das formschöne Rüstbrett aus einheimischem Kirschholz kann vielseitig verwendet werden. Es ist mit einem praktischen Griff ausgestattet (ideal zum Versorgen).
Hergestellt an geschützten Arbeitsplätzen von Menschen mit einer Behinderung im Werkstatt-Team Bubikon.
● Masse: 40 3 24 3 2 cm
«natürlich»-Preis Fr.

Rabatt für 20%


«natürlich»
Abonnentenpreis
Rabatt für Abonnenten
Wäschesammler Duo von Wenko
Abnehmbarer Wäschesammler aus strapazierfähigem Material mit stabilem und leichtem Gestell. Mit Trageriemen, zwei Fächern für optimale Wäschetrennung und Sichtschutzabdeckung, platzsparend zusammenfaltbar.
● Fassungsvermögen: 120 Liter
● 59 3 38 3 57 cm
● In Braun oder Beige erhältlich
Aktionspreis Fr. 49.– statt Fr. 62.–
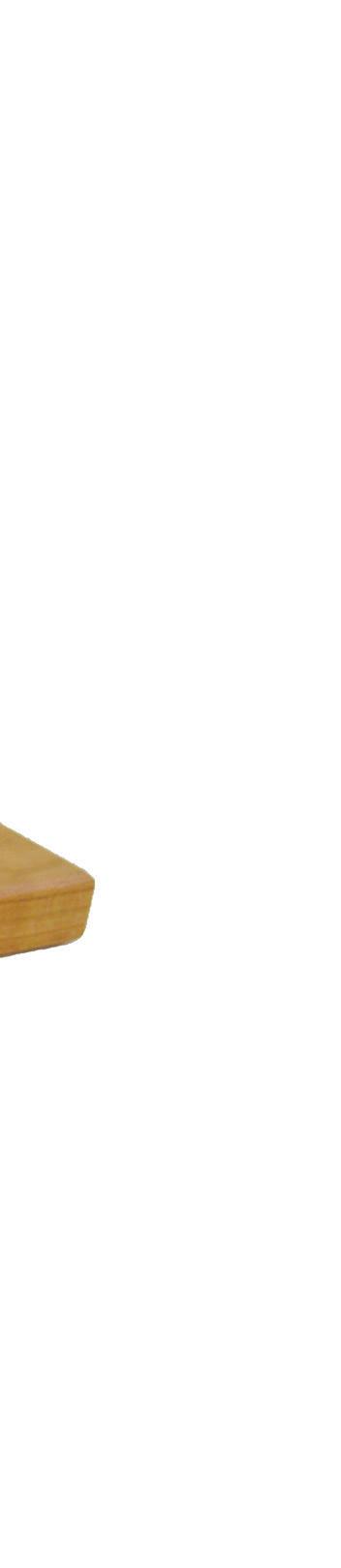
Susanne Fischer-Rizzi: Das grosse Buch der Pflanzenwässer vom AT-Verlag Pflanzenwässer (Hydrolate) werden wie ätherische Öle durch Wasserdampfdestillation aus Heilpflanzen hergestellt. Sie sind sanft in der Anwendung, hochwirksam und haben ein breites Anwendungsspektrum. Ein Grundlagen-, Lese- und Anleitungsbuch für Laien und Fachleute. Mit Sammel- und Destillationskalender sowie umfangreichem Register der Indikationen. Reichhaltig bebildert mit wunderschönen Pflanzenfotos, die das Wesen und die Kräfte der Pflanzen vermitteln. Mit über 200 Rezepten zum Selbstherstellen.
Aktionspreis Fr. 39.90 statt Fr. 49.90
20%
Rabatt für Abonnenten
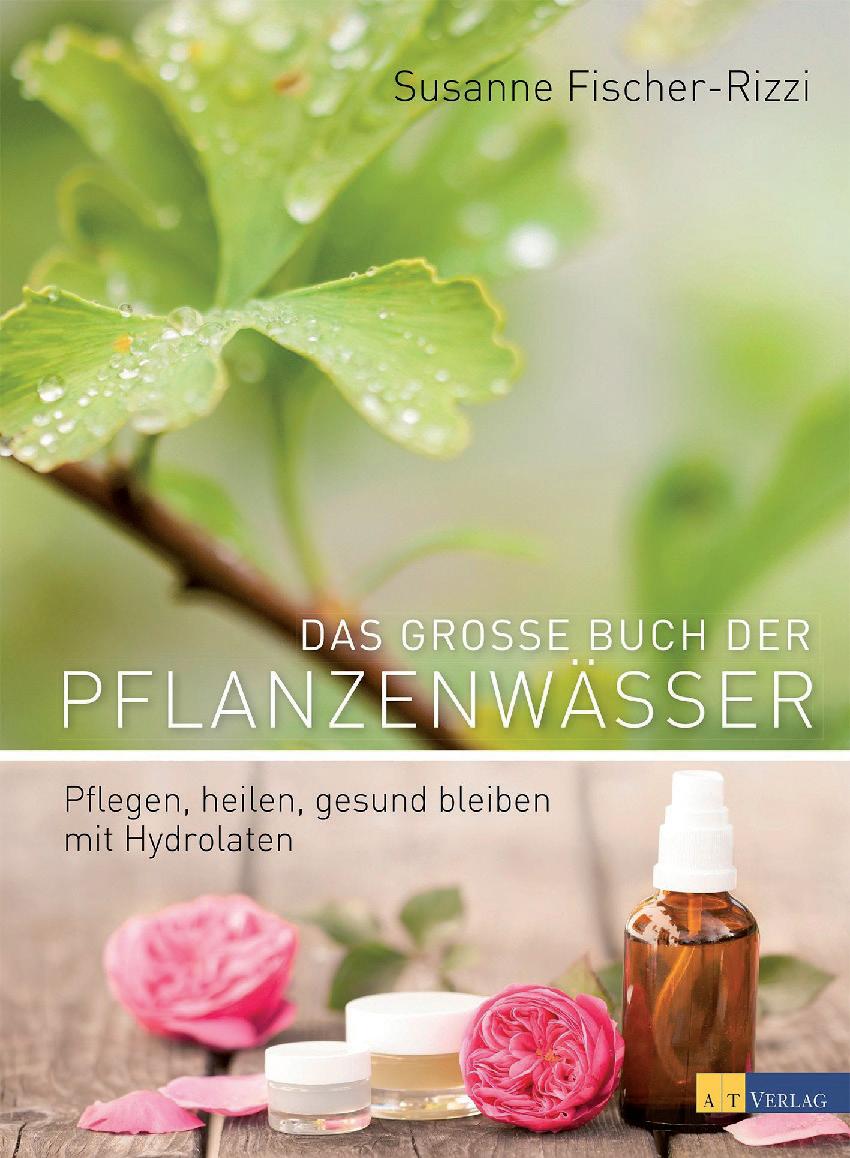
➜ Online: www.natürlich-online.ch/leserangebote Telefon 071 274 68 72 oder einfach Coupon einsenden!
Ja, ich möchte profitieren und bestelle folgende Angebote:
Ich bin «natürlich»-Abonnent /-in und bestelle zum Vorzugspreis.
Ich möchte Abonnent /-in von «natürlich» werden und profitiere vom Preisvorteil! Ich bestelle ein Jahresabonnement zum Preis von Fr. 84.–. 1401E01
❍ Ich bin Nichtabonnent /-in und bestelle zum Normalpreis.
___ St. Teeset «TeaTime», für nur Fr. 79.90 statt Fr. 99.– 14545
St. Rüstbrett mit Stahlgriff, für nur Fr. 59.– 14541
___ St. Wäschesammler Duo, für nur Fr. 54.–
Beige 14553 Braun 14554
___ St. Das grosse Buch der Pflanzenwässer, 14568 für nur Fr. 39.90 statt Fr. 49.90
Angebot gültig bis 31. Oktober 2014, solange Vorrat. Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt. und vRG, zuzüglich Fr. 8.60 Verpackung und Porto. Ab Fr. 150.– Bestellwert portofrei.
Vorname
Name
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Telefonnummer
Datum und Unterschrift
Coupon einsenden an: «natürlich», Leserangebote, Postfach, 9029 St. Gallen
Rückgaberecht: Für alle ungebrauchten Artikel garantieren wir ein 14-tägiges Rückgaberecht nach Erhalt der Ware. Sollte die Ware bei der Rücksendung ( in der Originalschachtel ) Spuren von Benutzung oder Beschädigung aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen.
Lesen_ Caspar
er Schweizer Illustrator François Chalet versteht es vorzüglich – und ganz ohne Worte –, die Freuden und Leiden als Familie mit einem kleinen Kind wiederzugeben. Seit der Geburt seines Sohnes Caspar zeichnete er jeden Tag eine Illustration. Die Bilder zeigen lustige und nervige Alltagssituationen, wie sie sowohl frischgebackene Eltern als auch Grosseltern, Tanten und Onkel kennen – genau beobachtet, liebevoll gezeichnet. Ein Buch zum Schmunzeln, Staunen und sich erinnern.
_ François Chalet: «Caspar», Echtzeit Verlag, 2014, Fr. 27.–, direkt bestellen: www.echtzeit.ch
Filmfestival_ Nachhaltigkeit
Am Freitag, 19. September findet in 14 Schweizer Städten das Filmfestival «Filme für die Erde» zum Thema Nachhaltigkeit statt. Mit «Growing Cities» zum Thema Urban Gardening gibt es gar eine Europapremiere. «Diese Filme schärfen das Bewusstsein. Sie unterstützen den Wandel unserer Gesellschaft», sagt Festivalgründer Kai Pulfer. Seine Empfehlung: Drei Filme schauen, danach beginne der innere Wandel. «Dann hast du die Nase voll und willst nicht mehr Teil des zerstörerischen Systems sein. Denn dann gibst du kein Geld mehr aus für Kinderarbeit, Tierquälerei, Umweltsünden etc.» Hingehen und sich selbst überzeugen. Einige Filme kosten keinen Eintritt. Zudem sind weitere Filme nach dem Festival in der Umweltarena Spreitenbach zu sehen. Das detaillierte Programm gibts im Internet. krea _ www.filmefuerdieerde.org


Europäische Forscher unter Beteiligung der ETH Zürich haben das erste harmonisierte Referenzmodell zur Erdbebengefährdung Europas und der Türkei herausgegeben – die sogenannte «European Seismic Hazard Map 2013». Ausgehend von diesem Kartenmaterial lassen sich europäische und nationale Baunormen für erdbebensicheres Bauen ableiten. In Italien, Island, Griechenland und der Türkei sind gefährliche Erdbeben keine Seltenheit. Die Schweiz hingegen ist mehrheitlich als gering gefährdet eingestuft – mit Ausnahme des Wallis und der Region Basel, wo immer wieder mit Erdbeben von relativ geringer Stärke zu rechnen ist. krea
«Wir stehen vor dem ökologischen, sozialen und geistigen Zusammenbruch. Rettung ist nur möglich durch Bewusstseinsveränderung, durch ein neu geschaffenes Gleichgewicht.»
Albert Hofmann (1906 – 2008), Entdecker des LSD

Zur Familie der Nachtschattengewächse gehört die Gattung der Solanum; Nutzpflanzen wie Kartoffel und Tomate, aber auch Medizin und Rauschpflanzen wie Bilsenkraut, Tabak, Tollkirsche und Engelstrompete zählen dazu. Auf letztere bezieht sich der Name Nachtschatten Verlag, der heuer sein 30JahrJubiläum feiert.
Der Solothurner «Fachverlag für drogenmündige, unabhängige Menschen» tut dies mit einem Symposium mit vielen Koryphäen. Stanislav Grof, Christian Rätsch, Markus Berger, WolfDieter Storl und andere Experten auf dem Gebiet werden «offen und ehrlich über die Wirkung von Drogen, Halluzinogenen und ähnlichen Substanzen» informieren. Neben Ayahuasca, Holotropem Atmen und Alchemistischer Divination ist vor allem auch Hanf ein Thema; sein Einsatz in der Medizin zum Beispiel, aber auch die Gefahren und strafrechtlichen Folgen für kiffende Autofahrer.
Ein Podiumsgespräch zum Thema «Psychedelische Erfahrungen als Chancen unserer Gesellschaft», die LSDVertonung Akasha Project und eine Psychonautenparty runden das Programm ab.
4. bis 7. September in Solothurn, weitere Informationen _ www.nachtschattenverlag.ch

Im Bernbiet knüpfen einige Bauern an das alte Handwerk der Seidenproduktion an. Im September nun kommt die erste Krawatte aus heimischer Zucht und Verarbeitung auf den Markt.
Text: Regine Elsener

«Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren die Zürcher Seidenhöfe weltberühmt.»
Seide – ein magisches Wort und für viele Synonym für Eleganz, Luxus und Exotik. Doch die Seidenstrasse führt nicht nur nach China, sondern auch nach Hinterkappelen im Bernischen. In der Garage von Ueli Ramseier ist es angenehm warm mit rund 25 Grad. Zahlreiche flache, oben offene Holztabletts liegen hier auf Obsthurden und dienen den Seidenraupen als Heimstatt. Jede ist voller Grünzeugs, Blätter des Maulbeerbaums. Im frischen Laub herrscht ein weisses Gewusel: Der Maulbeerspinner, Bombyx Mori wie die Seidenraupe richtig heisst, schlägt sich von früh bis spät den Bauch voll, bis sie von ursprünglich zwei Millimeter innerhalb eines Monats auf acht bis neun Zentimeter Länge herangewachsen ist. Während dieser Fressorgie legt sie das 10 000-fache an Gewicht zu.
60 000 Raupen im Bernbiet
Um diese Fressgier zu befriedigen, pflanzte Ueli Ramseier rund 700 Maulbeerbäume, die er als Stecklinge aus Frankreich importierte. Die Plantage prägt mittlerweile das Stück Land beim Schützenstand oberhalb des Dorfes. Den Schützen sei Dank: Weil der Boden von den Kugeln zu bleibelastet ist und für die Landwirtschaft nicht mehr genutzt werden darf, konnte Ramseier das Areal pachten. Er pflegt verschiedene Sorten Maulbeerbäume, doch der Seidenspinner ist «schnäderfräsig»: Er liebt die Blätter des weissen Maulbeerbaumes, Morus alba, über alles.
Ursprünglich ist der Baum ein stattliches Hochstamm-Exemplar, für dessen Blätterschnitt jedoch eine Leiter nötig ist. Bei dreimaliger Futtergabe pro Tag eine
mühsame Angelegenheit. Deshalb halten die Seidenbauern ihre Maulbeeren kurz: «Bei einer Höhe von etwa 1,60 Meter kann man die Blätter viel einfacher ernten», so Ramseier.
Von Haus aus Textilchemiker und Landwirt, ist Ueli Ramseier hauptberuflich beim Bund in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Doch er hat eine Vision: Er will die Schweizer Tradition der Seidenproduktion auferstehen lassen. Dafür gründete er im Jahr 2009 zusammen mit anderen aktiven Seidenraupenzüchtern und -züchterinnen den Verein Swiss Silk. Heute zählt der Verein 140 Mitglieder und steht allen interessierten Personen offen.
An die 60 000 Seidenraupen werden im Bernbiet gezüchtet. Damit können 20 Kilogramm Rohseidenfaden gewonnen werden. Anknüpfen an die florierenden Zeiten der einstmaligen Schweizer Seidennation werden Ramseier und seine Mitstreiter freilich nicht können, aber als Nischenprodukt in der Landwirtschaft hätte die Raupenzucht durchaus Chancen. «Wir wollen Schweizer Seide produzieren, die sich im gehobenen Segment etablieren kann», sagt er. Es ist ein gemeinsames Projekt von Seidenbauern und -industrie. In regem Kontakt steht man mit Schweizer Modedesignern und der Seidenweberei Weisbrod im zürcherischen Hausen am Albis.
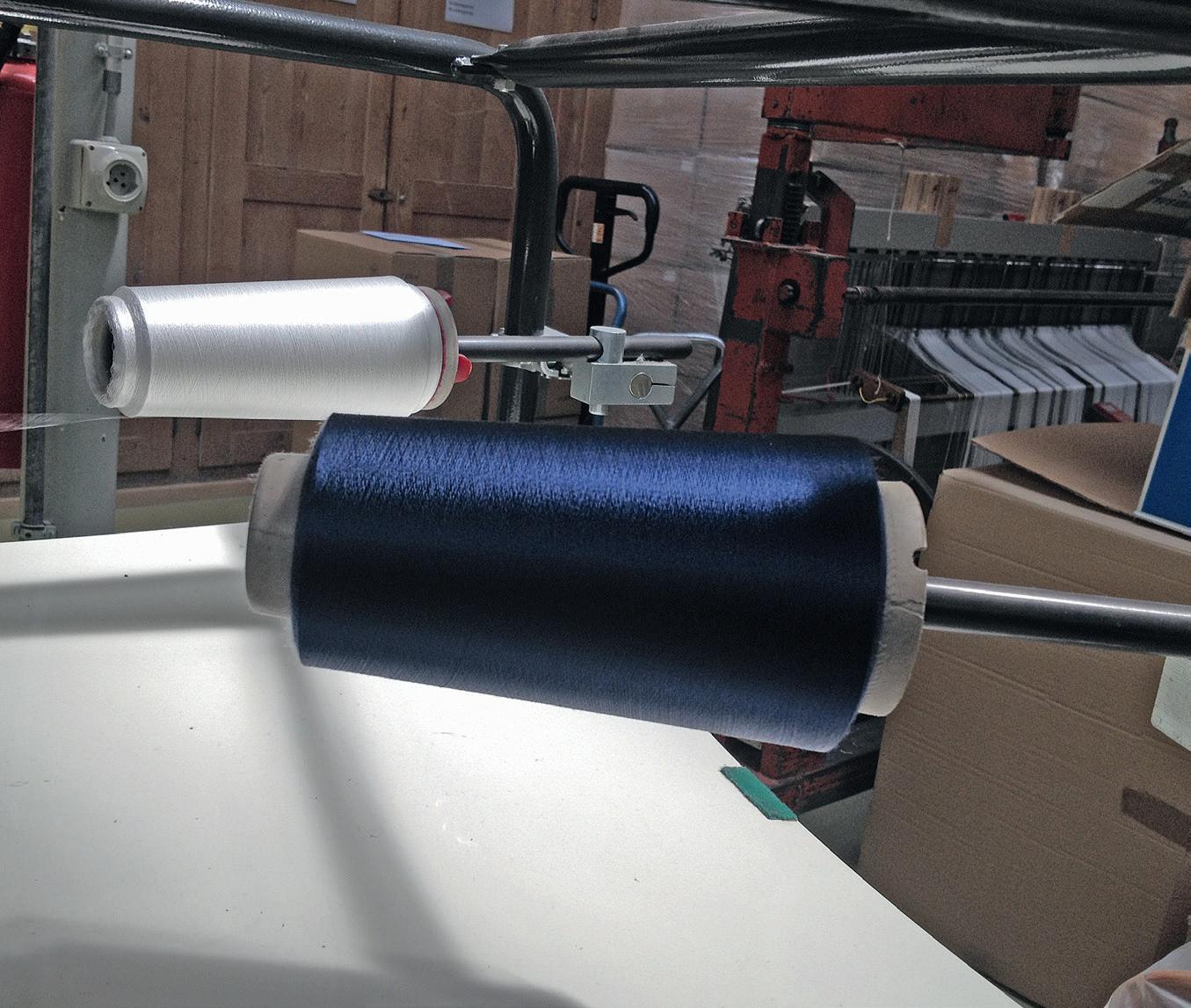






Die Früchte des Maulbeerbaums sind den Raupen des Seidenspinners egal. Sie ernähren sich von den Blättern, bevor sie sich verpuppen und den Kokon mit einem hauchdünnen Faden umwickeln. Aus dem wiederum wird industriell die begehrte Seide gesponnen.
Das Handwerk in Indien gelernt
Obwohl im September die ersten Produkte, Krawatten, aus heimischer Zucht und Verarbeitung auf den Markt kommen, gibt sich Ramseier selbstkritisch: «Wir müssen noch besser werden», betont der Schweizer Seidenpionier, «denn für den Seidenbau muss man drei Handwerke lernen.» Statt Graswirtschaft den Futterbau mit Bäumen, statt Kuhhaltung die Tierzucht mit Raupen und natürlich die Rohseidenproduktion, das Abhaspeln, also das Abwickeln des Fadens vom Kokon. Für das dritte Handwerk flog Ramseier nach Indien, um das Abhaspeln zu lernen und die dafür nötige Maschine in die Schweiz zu bringen. Dereinst könnten die Seidenbauern rund 20 Franken Stundenlohn erarbeiten, was deutlich über dem gängigen Stundenlohn von rund 15 Franken in der Landwirtschaft liegt.
Auch bei der Futterproduktion gilt es weiterzukommen: Ramseier kontaktierte ProSpecieRara, um herauszufinden, ob in der Schweiz noch alte Maulbeerbäume stehen. Schweizweit sind aktuell etwa 420 Bäume inventarisiert. Ein bescheidener Bestand angesichts der rund 860 000 Maul-
beerenbäume, die es während der Blütezeit der Schweizer Seidenindustrie gab. «Unser Ziel ist, alte genetische Ressourcen anzulegen und jene, die geeignet sind, zu vermehren,» sagt Melanie Glaser von ProSpecieRara. Von den Vermehrungsfähigen hat ProSpecieRara in einer Baumschule Stecklinge ziehen lassen. Allerdings laufe dieser Prozess noch nicht wie gewünscht.
Beere vom Menschen geschätzt Doch nicht nur Seidenraupen schätzen den Maulbeerbaum – es gibt auch Liebhaber seiner essbaren Beeren: Sie sind weiss, dunkelrot oder schwarz. Optisch erinnern sie an längliche Brombeeren und sind sehr schmackhaft. «Den Rebbauern kam die schwarze Maulbeere überaus gelegen. Am Bieler- und Neuenburgersee, aber auch im Wallis verwendeten die Winzer die Beeren als Färbemittel für ihren Wein», erzählt Melanie Glaser. Und schon die Klosterfrau Hildegard von Bingen erwähnte die Heilkraft der schwarzen Maulbeere. Sie soll als Mus, Saft oder Kompott gegen Fieber und Verdauungsstörungen helfen, das Herz- und Gefässsystem stärken und
Schleimhautentzündungen in Hals und Mundhöhle mindern.
Ursprünglich stammt der weisse Maulbeerbaum – wie auch die Seide – aus China. Viele Geschichten und Legenden ranken sich um den Siegeszug des Gewächses und seines Seidenspinners bis hin nach Europa. Eine davon berichtet, dass zwei Mönche im Jahr 522 nach Byzanz gewandert seien und in ihren Wanderstäben Samen des Maulbeerbaumes sowie Eier des Seidenspinners geschmuggelt hätten. Damit soll die Seidenraupenzucht im Mittelmeerraum angefangen haben.
Zürichs «Seidenhöfe»
In klimatisch günstigen Regionen – dort, wo auch Reben wachsen – konnte sich die Maulbeere etablieren. Auch hierzulande: Die Schweizer Seidenproduktion und der damit verbundene Handel gehen auf das Jahr 1250 zurück. Früh entwickelten sich Basel und Zürich zu wichtigen Zentren. Man exportierte das teure Tuch nach England, Schwaben, Südfrankreich und ostwärts nach Prag und Ungarn.


Die Raupe frisst und frisst und frisst – und legt schliesslich das 10 000fache an Gewicht zu.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren die Zürcher «Seidenhöfe», die Seidengasse in der Zürcher Innenstadt erinnert daran, weltberühmt. Zwischen den Jahren 1840 und 1900 war im Kanton die Seidenindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig: Um 1860 stieg die Region Zürich zur weltweit zweitwichtigsten Seidenstoffproduzentin auf. Das Aufkommen synthetischer Fasern und chemischer Farben bedeutete jedoch den Niedergang der Schweizer Seidenindustrie. Das trifft aber nur auf die Verarbeitung von Rohseide zu und nicht auf die Seidenraupenaufzucht: Vor knapp 100 Jahren erst stellte die letzte im Tessin ihren Betrieb ein – aufgrund günstiger Importware und Krankheiten bei den Seidenraupen.
Jetzt, fast 800 Jahre nach der Entstehung der Seidenproduktion in der Schweiz und fünf Jahre nach der Gründung von Swiss Silk, bringt die Seidenweberei Weisbrod ihre ersten Swiss-Silk-Produkte auf den Markt: Ab September sind die Seidenkrawatten aus heimischer Zucht und Verarbeitung erhältlich, im Museumsshop des Landesmuseums Zürich, bei der Firma Weisbrod in Hausen am Albis und über den Webshop von Weisbrod. ◆
Krawatten aus Schweizer Seide –ein exklusives ModeAccessoire.
erst ab Mai genügend grosse Blätter als Futter entwickelt. Bevor sich die Raupe verpuppt, zieht sie sich in ein bereitgestelltes Regal oder dürres Reisig zurück. Dann beginnt sie sich in den selber produzierten Faden einzuwickeln. Nach drei Tagen ist ein wunderschöner weisser Kokon entstanden. Nach weiteren zwölf Tagen schlüpft der Falter. Unmittelbar nach dem Schlüpfen paaren sich die Falter. Nach dem Akt sterben die Männchen sofort, die Weibchen nach der Eiablage. Sie legen 300 bis 500 mohnsamengrosse Eier. Für die Seidengewinnung lässt man allerdings nur jene Tiere schlüpfen, die man zur Weiterzucht benötigt.
Mit der fertigen Hülle ist deshalb auch das Leben der Tiere zu Ende: Der Züchter sammelt ebenmässige Kokons ein und tötet sie bei 110 Grad im speziellen Trocknungsofen. Um den Faden vom Kokon abwickeln zu können, muss der Seidenleim im heissen Wasserbad gelöst werden. Ein Kokon liefert einen ein Kilometer langen Faden; mehrere Fäden werden miteinander verzwirnt, damit ein genug starker Seidenfaden zur weiteren Verarbeitung entsteht. Aus 5000 Kokons entsteht ein Kilogramm Seidenfaden. Die toten Maulbeerspinner können als Futter in der Fischzucht Verwendung finden.


Es war ein Paradigmenwechsel in meinem Leben», sagt Stefan Schmidt. Der 73-Jährige rettete vor zehn Jahren an der Küste Siziliens 37 Bootsflüchtlinge. Nach der Rettung blockierte die italienische Marine das Schiff, das im Auftrag des Komitees «Cap Anamur –Deutsche Notärzte» auf dem Weg in den Iran war. Der Kapitän erzählt: «Als wir in den Hafen einfuhren, wurde nicht nur ich, sondern auch der Erste Offizier und der Leiter der Hilfsorganisation Cap Anamur verhaftet.» Die Anklage lautete: bandenmässige Mithilfe zur illegalen Einreise in einem besonders schweren Fall. Die drei Angeklagten blieben eine Woche im Gefängnis, die geretteten Bootsflüchtlinge wurden mit einer Ausnahme ohne Asylverfahren sofort ausgeschafft.
Im Gerichtsprozess, der erst nach fünf Jahren mit einem Freispruch endete, forderte der Staatsanwalt für die Angeklagten zwölf Jahre Gefängnis und eine halbe Million Euro Busse. «Wir haben hautnah erfahren, wie Europa den Tod von Menschen auf der Flucht in Kauf nimmt», sagt Schmidt. «Wieder zu Hause konnten wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.» Er wurde Mitbegründer von «borderline-europe – Menschenrechte ohne Grenzen». Der Verein beobachtet, dokumentiert und klagt Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen Europas an. Angeklagt, weil er geholfen hat
Seit dem Jahr 2000 starben 23 000 Menschen beim Versuch, nach Europa zu gelangen, und das sind nur jene, deren Iden-
«Wir haben hautnah erfahren, wie Europa den Tod von Menschen auf der Flucht in Kauf nimmt»
Gleichgültigkeit tötet, auch in Europa, und wir sind Beteiligte. Jeder Einzelne kann sich für eine Kultur der Menschlichkeit einsetzen, welche die Grundrechte respektiert.
Text: Rita Torcasso
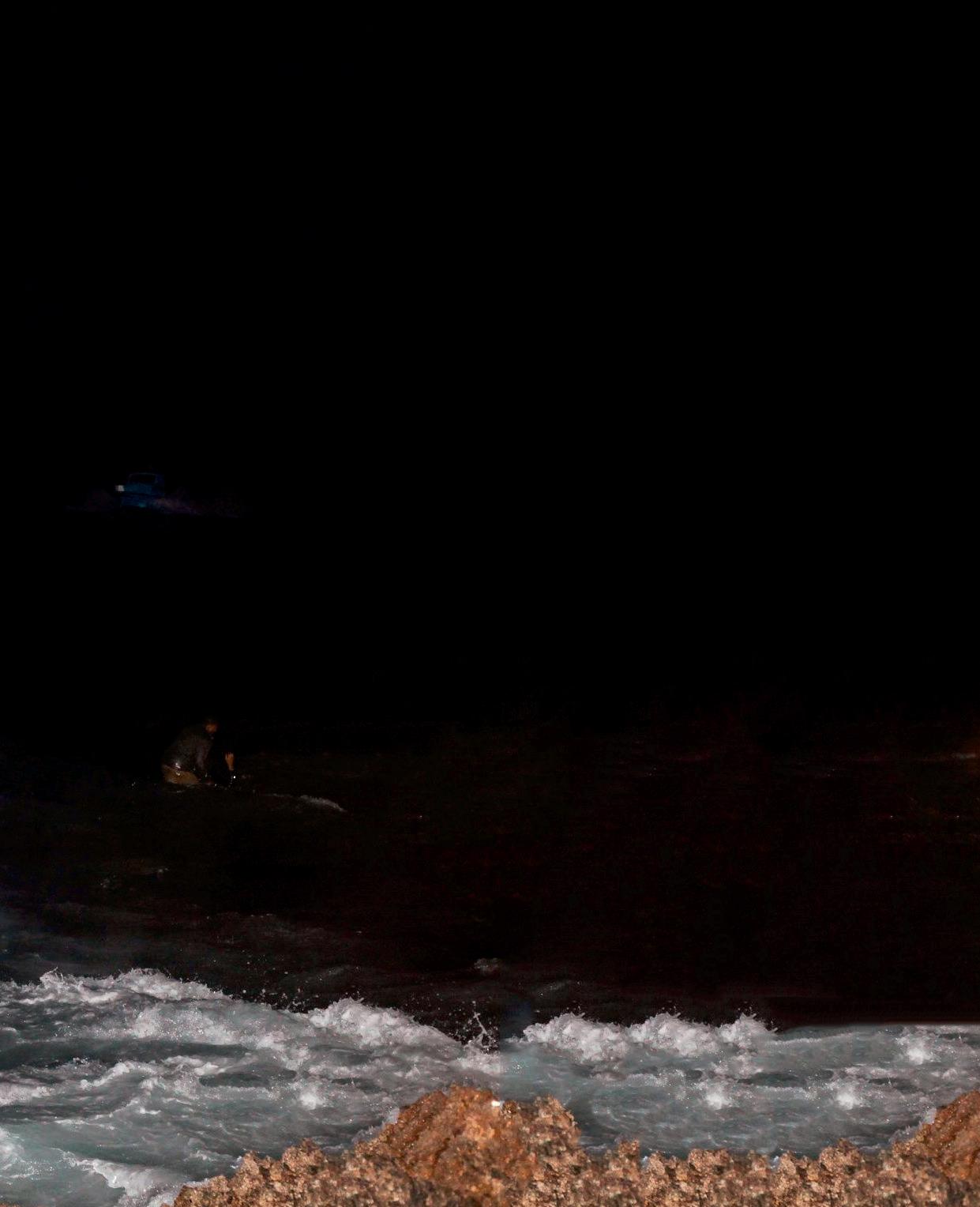
tität man feststellen konnte. Im letzten Sommer prangerte der Papst auf Lampedusa die «Globalisierung der Gleichgültigkeit» an. Doch erst als Anfang Oktober 2013 vor der Küste von Lampedusa 364 Tote aus dem Meer geborgen wurden, gab es einen internationalen Aufschrei. Zuvor waren mehrere Schiffe am Boot vorbeigefahren. «Es ist unsere Schande, es sind unsere Toten», titelten damals Zeitungen. Stefan Schmidt bemerkt dazu: «Eine solche Katastrophe stellt unsere Integrität als Europäer infrage und beschädigt unser viel beschworenes Werte-Fundament.»
Statt Menschen werden Grenzen geschützt
Die politische Antwort war eine weitere Aufrüstung der Festung Europa. Ende
2013 startete die EU das gemeinsame Überwachungssystem Eurosur, um grenzüberschreitend mit Satelliten und Drohnen die Aussengrenzen «vor illegalen Einwanderern zu schützen».
Im ersten Halbjahr 2014 sind rund 50 000 Flüchtlinge über das Meer in Italien eingetroffen, der grosse Teil aus den Kriegsländern Syrien und Eritrea. Die Schweiz reagierte auf die neun Millionen Menschen, die in Syrien auf der Flucht sind, im letzten Jahr mit einem Flüchtlingskontingent von 500 Visa, verteilt auf drei Jahre. Rund 3000 Flüchtlinge, die Familienangehörige in der Schweiz haben, konnten einreisen – mit finanziellen Garantien ihrer Gastfamilie. Trotz der wachsenden Zahl an Flüchtlingen – die UNO spricht von der höchsten Flüchtlingszahl seit dem

Was kann man selber gegen Gleichgültigkeit tun?
Sich interessieren und engagieren
• Sich mit Fluchtgründen und Flüchtlingspolitik auseinandersetzen.
• Aufzeigen, dass mit Wörtern wie Wirtschaftsflüchtling und Wohlstandsflüchtling Flüchtlinge, die vor Krieg, Armut, Folter, Diktaturen fliehen, stigmatisiert werden.
• Mit Zivilcourage auf alltäglichen Rassismus reagieren.
• Soziale Medien nutzen, Petitionen unterschreiben, Menschenrechtsorganisationen unterstützen.
• Politiker wählen, die sich für Menschenrechte und für eine menschenwürdige Asylpolitik einsetzen.
• Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen finanziell unterstützen.
Aktiv Flüchtlinge unterstützen
• Flüchtlingsfamilien privat aufnehmen (Informationen bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, www.fluechtlingshilfe.ch, Telefon 031 370 75 75).
• Selber Flüchtlinge im Haushalt oder im Hausdienst beschäftigen.
• Flüchtlinge bei der Arbeitssuche unterstützen.
• Als Freiwillige an Kursen für Flüchtlinge mitwirken oder eine Flüchtlingsfamilie begleiten.
• Einladungen an Mittagstische, Gemeindefeiern, in Kinder- und Jugendgruppen, an Spielnachmittage.



26.-28.09.14 FL-Vaduz, Vaduzersaal 17.-19.10.14 CH-Thun, Kongresshaus KK-Thun 05.-07.12.14 CH-Bern, Bern Expo www.happiness-messe.com
27.9.- 4.10., 4.-11.10 Wellness Hotel Höri direkt am Bodensee. Neues erleben mit Energieund Bewusstseinsarbeit, kreativen Impulsen, Tanz, QiGong Fr 1170 Kurs, Einzelzimmer inkl 052-741 46 00, www.fasten.ch
La Gomera/Kanaren
Das abgeschiedene, ökologische Paradies für Familien, Seminare und Individual-Urlauber. Hotel Finca El Cabrito Telefon 0034-922-14 50 05, www.elcabrito.es
Zeigt die Summe der Kräfte in Körper-Seele-Geist. Mehrfarbig, Kalenderform, Taschenformat, 12 Monate Fr. 36.–. Bitte Geburtsdaten an: Hermann Schönenberger, Churerstr. 92 B, 9470 Buchs SG Telefon 081 740 56 52, bioschoen@bluewin.ch
fasten-wandern-wellness.ch Fasten ist in der Natur des Menschen vorgesehen und tut enorm gut. Ida Hofstetter, Telefon 044 921 18 09


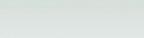
BI O- URLAUB IN SÜ DTIROL im 1. Biohotel Italiens
› Kurzurlaub Körper & Geist
3 Nä ch te ab € 207
› gehobene regionale Bio-Küche
Gemüse und Kräuter v. Hausgarten
› Yoga › VinschgauCard
Buchung und Infos: www.biohotel-panorama.it
Familie Steiner +39 0473 83 11 86
Hellsichtige Beratung und Hilfe für alles, was Dir am Herzen liegt! 0901 5 8 70 5 8 Fr 2.9 0 / Min. ab Festnetz


Postkonto 40-260-2 | www.terredeshommesschweiz.ch
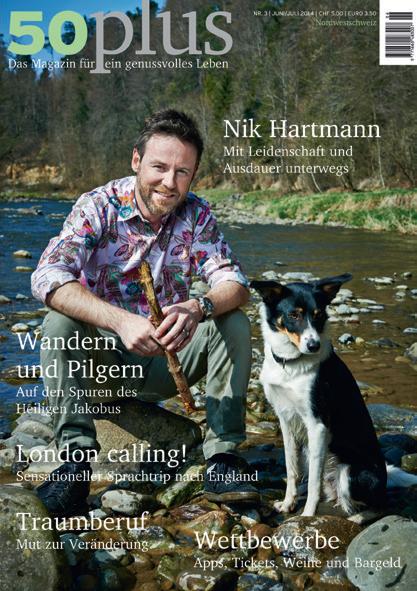


Bestellen Sie telefonisch unter +41 (0)31 311 01 93, unter www.plus.ch/abo oder schriftlich an: plus .ch, Bundesgasse 26 , 30 11 Bern .
Jahresabonnement: CHF 25.–

Spezialangebot: 2-Jahresabonnement zum Preis von CHF 35.–(nur mit Angabe «Natürlich» bis 30 11 20 14 gültig)


«Mitgefühl hört an der Schweizer Grenze auf.»
Zweiten Weltkrieg – hat die Schweiz das Aufnahmekontingent nicht erhöht. Und Flüchtlinge, die aus Italien die Schweiz erreichen, werden zurückgeschafft.
sicher auch zur Prägung ihrer Werte beigetragen, dass sie von ihrer deutschen Mutter viel über den Zweiten Weltkrieg hörte. «Ich bin immer wieder fassungslos, dass das Mitgefühl und Verantwortungsgefühl der meisten Menschen nur gerade bis an die Schweizer Grenze reicht», bemerkt sie. Es sei eine abstrakte Form von Mitgefühl, ähnlich wie Gefühle, die beim Schauen eines Filmes entstehen, die aber keine Taten auslösen.
Leben Gleichgültigkeit

Unser Land nahm früher aus humanitärer Tradition Flüchtlinge auf: 13 000 nach dem Ungarn-Aufstand, etwa gleich viele nach dem Einmarsch Russlands in Prag. Nicht alle haben das vergessen, wie der wachsende Widerstand zeigt. 150 Personen möchten Flüchtlingsfamilien bei sich aufnehmen; seit einem halben Jahr laufen in den Kantonen Abklärungen. Mehrere Petitionen an den Bundesrat forderten eine Erhöhung des Kontingents von 500 auf 5000. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen in Thun sammelten über 3000 Unterschriften. In ihrem Brief an Bundesrätin Sommaruga zitieren sie Sophie Scholl, die 1943 den Mut, Flugblätter gegen das Hitler-Regime zu verteilen, mit dem Leben bezahlte: «Wenn ich auch nicht viel von Politik verstehe, so habe ich doch ein bisschen ein Gefühl dafür, was Recht und Unrecht ist.»
Abstrakte Form von Mitgefühl
Andrea Huber arbeitet für die Informationsplattform Humanrights.ch. Gleichgültigkeit gegen Menschenrechtsverletzungen erklärt die Politologin so: «Wenn wir Emotionen für die Schicksale anderer Menschen entwickeln, wird unsere Welt komplizierter. Um uns vor dem Gefühl der Ohnmacht zu schützen, verdrängen wir.»

Ob und wie man reagiere, werde von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Wertehaltungen bestimmt. «Wenn ich mich betroffen fühle und nichts unternehme, fühle ich mich ohnmächtig, das raubt mir alle Energie, also handle ich», beschreibt sie ihre Haltung. Als Kind habe
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), um den Frieden zu stärken. Nun will die SVP mit einer Initiative das Schweizer Recht über das Völkerrecht stellen, was einer Kündigung des EMRK gleichkommt. «Der Schutz der Grundrechte ist das Fundament unserer Demokratie», betont sie. «Das Argument, dass Menschenrechtsverletzungen halt vielerorts zur Kultur gehörten, wird benutzt, um uns von der Verantwortung freizusprechen.» Sie weist darauf hin, dass auch wir einen Beitrag an die Lebensumstände leisten, vor welchen Menschen fliehen. «Die Wirtschaft exportiert Menschenrechtsverletzungen.» Als Beispiele nennt sie Billigkleider, die unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden. Oder dass die Vereinigten Arabischen Emirate, die trotz Verbot Schweizer Handgranaten an Syrien geliefert hatten, weiterhin Waffen aus der Schweiz erhalten.
Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal anderer Menschen hat viele Facetten: Gefühllosigkeit, Desinteresse, Arroganz, Passivität, Untätigkeit, Trägheit. Ein Psychogramm der Gleichgültigen erstellte der deutsche Soziologe Wolfgang Sofsky in seinem Essay «Am Nullpunkt des Sozialen» (NZZ 10. 11. 07). «Gleichgültigkeit schützt vor den Nachbarn, den Nächsten und anderen Zumutungen.» Einer der Hauptgründe für Gleichgültigkeit sieht er darin, dass Gleichgültige ganz in der Gegenwart leben, die Vergangenheit für sie ebenso belanglos ist wie die Zukunft. «Wissen bedeutet ihnen nichts, sie begnügen sich mit dem Glauben und Meinen. Manchmal geben sie diese Haltung als Toleranz aus», schreibt Sofsky.
Handeln, weil man nie genug tut Seit nunmehr zehn Jahren setzt sich Kapitän Stefan Schmidt für Flüchtlinge ein. «In der Zivilbevölkerung wächst jetzt der Druck für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik», ist er überzeugt. Und im ver-

Kapitän und Lebensretter Stefan Schmidt.
gangenen April verfügte das Europaparlament endlich, dass Retter nicht mehr bestraft werden dürfen. Zu seinem Kampf gegen Gleichgültigkeit sagt er bei seinem Besuch anlässlich der Flüchtlingstage in Zürich: «Man denkt ja immer, dass man nicht genug tut.» Und er fügt hinzu: «Eigentlich bin ich mit über 60 spät auf das Flüchtlingselend gestossen, obwohl ich selber 1945 als Vierjähriger mit meiner Mutter aus Stettin fliehen musste.» Vielleicht habe er deshalb mehr Empathie für andere entwickeln können. Für ihn hat Gleichgültigkeit viel damit zu tun, ob man Verletzlichkeit zulassen könne. «Kriege werden nur führbar, wo Menschen dazu erzogen wurden, ihre eigene Verletzlichkeit zu leugnen, zu verdrängen, abzulegen.»
Ein Schicksalsschlag ist nur einer von vielen Gründen für mehr Menschlichkeit. Andrea Huber wählte den Einsatz für Menschenrechte als Beruf, andere, wie eine Gruppe von Frauen im Tessin, handeln spontan: Als sie die Bilder mit Tausenden von Flüchtlingen im Bahnhof Mailand sahen, begannen sie Transporte mit Lebensnotwendigem zu organisieren. ◆
Surftipps
_ www.natuerlich-online.ch/surftipps Buchtipp
_ Gabriele del Grande: «Das Meer zwischen uns», Loeper Literaturverlag

Seminare
Honeymoon-Effekt mit Bruce Lipton
Liebe geht durch die Zellen 30. 9., bei Basel, Abendseminar www.sphinxworkshops.ch
Tagesseminar –«Ein Tag nur für mich» 20. 9., Seminarhaus Leuenberg, Hölstein
Lioba Schneemann www.schneemann-entspannt.ch
Kinesiologisch begleitete Frauen-Ferien-Woche in Medels 28. 9.– 4.10.
Nähere Informationen unter www.energieimfluss.ch

Sammeln+Prospekt verlangen, 056 4442222
BEA-Verlag, 5200 Brugg 056 444 22 22, bea-verlag.ch
Auch beim Atmen gilt: «Weniger ist mehr»
Wirksame Atemtechnik Buteyko 26./27. 9. und 3.10., Zürich
Atempraxis Brigitte Ruff Tel. 044 350 69 50 www.atem-praxis.ch
Die Krankheitsbilder unserer Zeit – Bedeutung und Wege zur Heilung Dr. Rüdiger Dahlke in der Schweiz 24. 9., 9.30 –17 Uhr
Krankheit als Sprache der Seele und der Kinderseele 24. 9., 18 – 22 Uhr
SHI Homöopathie Schule, Zug Tel. 041 748 21 77 www.shi.ch
Feng Shui in der Praxis 8./9.11., 9.15 –17.15 Uhr
Apamed Fachschule, Jona www.apamed.ch www.kraftreich.ch
Singe, was ist –Einführung ins Voicing 8./9.11., in St. Gallen
BEA-Verlag 5200 Brugg 056 444 22 22 bea-verlag.ch
StimmRäume, Bea Mantel Tel. 079 208 98 02 www.stimmraeume.ch
Sardona: Knorriger Bergwald und duftende Heualpen 21. 9., 8.45 –16.30 Uhr, Geopark Sardona Tel. 071 221 72 30 www.wwfost.ch/naturlive
Workshops für bewusste Raumgestaltung 12. 9., Sargans
Fatima Tschenett Tel. 079 746 61 55 www.atelier-sulai.ch
Lenzburger BaumTrilogie 2014
Die etwas andere Begegnung mit Bäumen 5. 9., Referat Michel Brunner 14. 9., Baumbegehung in Lenzburg 19.– 28. 9., Ausstellung Baumporträts www.baumtrilogie.ch
Wasser-Shiatsu für den Hausgebrauch
Einführungskurse: 20./21. 9., (Wila) 21.10.–11.11., 4 Abende (Bern) 15./22.11., (Winterthur) www.iaka.ch
Über sieben Brücken
Heil-Singen und Heil-Tönen für die Chakren 20./21. 9., in Küblis, GR www.stimmausbildung.at
Magie der Landschaft, Leichtigkeit des Schreibens «Lärchengold und Feuerglut» 12.–16.10., im Landschaftspark Binntal
Ursula Walser-Biffiger Tel. 056 426 16 58 www.ursulawalser.ch

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf www.natuerlich-online.ch /agenda


Fasten,Wandern und Yoga
Wildkräuter-Kochkurs «grüne
Smoothies und bunte Tapas»
13. 9., 13 Uhr in Eiken
Herbstliche Wildkräuter
Exkursion
20. 9., 13.30 Uhr in Eiken
Kochkurs: Das Herbstmenü – Wilde Beeren und Kräuter 4.10., 13 Uhr in Eiken
Grünzeug, Bianca Zogg, Eiken
Tel. 079 709 51 45 www.gruenzeug.bz
Meditative Fastenferien –ein Weg zum Neubeginn
27. 9.– 4.10., 4.–11.10., im Wellness Hotel Höri am Bodensee
Essenz-Institut, Stein am Rhein Tel. 052 741 46 00 www.fasten.ch
Fasten – Wandern – Wellness 27. 9.– 4.10., in Flüeli-Ranft OW, Jugendstil-Hotel Paxmontana
Ida Hofstetter, Männedorf Tel. 044 921 18 09 www.fasten-wandern-wellness.ch
Entfache Dein inneres Licht
Yoga, Kinesiologie, Klang und Rituale
27.– 30.11., in Stels (Prättigau)
Tel. 079 749 31 15 www.kinesiologie-ammonit.ch
Kriya Yoga mit Kripanandamoyima
Einführungskurse in die Meditationstechnik 13./14. 9., Zürich 4./5.10., Rheinfelden
Sabine Schneider Tel. 044 350 21 89 www.kriya.ch
Qi Gong 21.– 27. 9.
Yogaferien mit Esther Fuchs 5. –10.10.
Angeli & Christian Wehrli
Casa Santo Stefano, Miglieglia Tel. 091 609 19 35 www.casa-santo-stefano.ch
Festival und Kultur
Filme für die Erde – Festival 19. 9. in 14 Städten
Tickets und Info: http://filmefuerdieerde.org
Energiewendefestival 4.–17. 9., Rubigen bei Bern www.energiewendefestival.ch/ uebersicht
«Heute ist Morgen» Ausstellung
Sophie Taeuber-Arp Noch bis zum 16.11.
Aargauer Kunsthaus, Aarau Tel. 062 835 23 30
Ergänzungsausbildung Atemtechnik Buteyko Für Komplementärtherapeutinnen und med. Fachpersonen 18. und 25.10.; 14.,15. und 22.11., Zürich
Atempraxis Brigitte Ruff Tel. 044 350 69 50 www.atem-praxis.ch
Stärkung der Selbstund Beratungskompetenz Lehrgang 2014/15
Lilo Schwarz, dipl. Arbeitspsychologin/Coach FH Tel. 041 410 43 82 www.liloschwarz-seminare.ch
Infoabend Aus-/Fortbildungen 25. 9., 19 – 20.30 Uhr, am Future Health Institute Zürich Tel. 044 451 21 88 www.cranialinstitute.com
Weiterbildung in Lachyoga zum zertifizierten
«Laughter Yoga Leader» 19. 9.– 21. 9.
Christian Hablützel, Zürich www.lachdichgesund.com

››› Sie wünschen einen Agenda-Eintrag?
Schicken Sie die Angaben für Ihre Veranstaltung an agenda.natuerlich@azmedien.ch
Küchen sind mehr als Kochnischen. Küchenwünsche wahr werden lassen ist unsere Faszination! Wir gestalten, planen und konzipieren die komplette Küche auch mit den kleinsten Details. Sie werden von Ihrer persönlichen «Holzweg-Küche» fasziniert sein!
Jud Vinzenz GmbH Massivholz-Möbelschreinerei
Grabackerstrasse 21 8722 Kaltbrunn
Tel. 055 283 27 23 www.holzweg.ch info@holzweg.ch Von der Planung bis zur Fertigstellung

Erleben Sie ein komplett neues Hautgefühl mit NOLEA Naturkosmetik

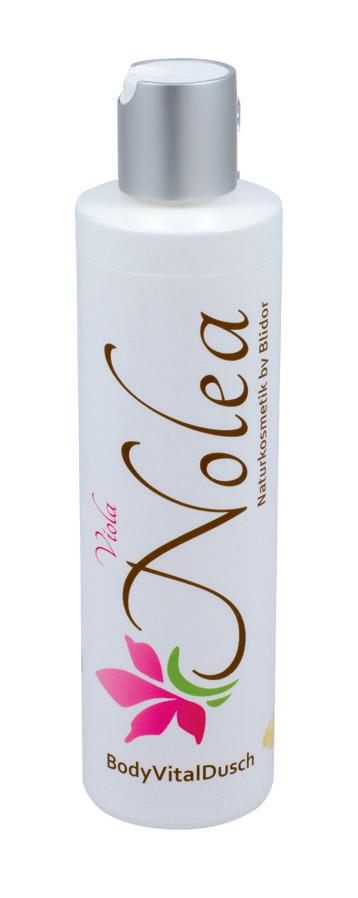


Was ist besonders an NOLEA Naturkosmetik?
• Enthalten keine optischen Bleichmittel
• Hygienische Spender, handliche Flaschen
• Der Umwelt zuliebe wenig Verpackung
NOLEA Naturkosmetik erhältlich als:

• NOLEA FaceVitalCreme, 30 ml
• NOLEA BodyVitalDusch, 250 ml
• NOLEA HaarVitalShampoo, 250 ml
• NOLEA BodyVitaLotion, 250 ml
• NOLEA HandVitalCreme, 100 ml
pure ture NOLEA
® Naturkosmetik by Blidor NOLEA ist eine registrierte Marke von Blidor AG, Langnau am Albis
Zu gewinnen gibt es:
5-mal 1 Gutschein von NOLEA Naturkosmetik im Wert von je Fr. 40.–
NOLEA Naturkosmetikprodukte
• Ohne künstliche Farbstoffe
• Ohne Konservierungsstoffe
• Ohne Parabene, Paraffine, Silikon, PEG
• Ohne Tierversuche hergestellt
NOLEA Naturkosmetik eignet sich für alle Hauttypen. Eine hochwirksame Wirkstoffkombination hilft aber, besonders sensitiver, trockener und zu Fältchen neigender Haut, sich zu erholen und wieder jugendlich frisch zu erscheinen. Das Hautbild wirkt gesamthaft entspannter, kann sozusagen «entschleunigen» und findet so zu einem frischeren Erscheinungsbild zurück. Neben der Herstellung der benötigten Ruhe für die Haut setzt NOLEA Naturkosmetik vor allem stark auf hochwertige Pflege für beanspruchte und sensible Haut und wirkt mit hochwirksamen Inhaltsstoffen möglicher Faltenbildung entgegen.
Und so spielen Sie mit:
Sprechen Sie das Lösungswort und Ihre Adresse unter 0901 009 151 (1.–/Anruf ab Festnetz) auf Band. Oder senden Sie eine Postkarte mit der Lösung und Ihrer Adresse an: freiraum Werbeagentur AG, «NOLEA Naturkosmetik» Wettbewerb, Mühlezelgstrasse 53, 8047 Zürich. Teilnahmeschluss ist der 24. 9. 2014.
Teilnahmebedingungen: Gleiche Gewinnchancen für telefonische oder schriftliche Teilnahme. Mitarbeiter der AZ Medien Gruppe AG und Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht in bar ausbezahlt. Es wird keine Korrespondenz geführt.
Lösung des Rätsels aus dem Heft 7/8-2014
Gesucht war: Bioresonanz
34. Jahrgang. ISSN 2234-9103
Erscheint monatlich. Doppelnummern: Dezember/Januar und Juli/August www.natuerlich-online.ch
Leserzahlen: 147 000 (MACH Basic 2014-1)
Auflage: 21 000 Exemplare, verkaufte Auflage 18 000 Exemplare (Verlagsangaben).
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@azmedien.ch
Herausgeberin
AZ Fachverlage AG
Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax +41 (0)58 200 56 44
Geschäftsführer
Roland Kühne
Leiterin Zeitschriften
Ratna Irzan
Redaktion «natürlich»
Postfach
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax +41 (0)58 200 56 44
Chefredaktor
Markus Kellenberger
Redaktionsteam
Andreas Krebs, Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
David Coulin, Regine Elsener, Heinz Haug, Lioba Schneemann, Vera Sohmer, Rita Torcasso, Remo Vetter, Andreas Walker, Simon Libsig
Layout/Produktion
Rahel Blaser, Lina Hodel, Manuel Saxer, Renata Brogioli, Fredi Frank
Copyright
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für eingesandtes Material. Die Wiedergabe von Artikeln und Bildern ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages erlaubt.
Verkaufsleiterin
Alexandra Rossi
Tel. +41 (0)58 200 56 52 Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau alexandra.rossi@azmedien.ch Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Anzeigenadministration
Corinne Dätwyler
Tel. +41 (0)58 200 56 16
Leiter Lesermarkt/Online Valentin Kälin
Aboverwaltung abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 (0)58 200 55 62
Preise
Einzel-Verkaufspreis Fr. 8.90 1-Jahres-Abonnement Fr. 84.–2-Jahres-Abonnement Fr. 148.– inkl. MwSt. Druck
Vogt-Schild Druck AG CH-4552 Derendingen
Ein Produkt der Verleger: Peter Wanner CEO: Axel Wüstmann www.azmedien.ch
Namhafte Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2 StGB: AZ Anzeiger AG, AZ Fachverlage AG, AZ Management Services AG, AZ Regionalfernsehen AG, AZ TV Productions AG, AZ Verlagsservice AG, AZ Vertriebs AG, AZ Zeitungen AG, Belcom AG, Dietschi AG, Media Factory AG, Mittelland Zeitungsdruck AG, Vogt-Schild Druck AG, Vogt-Schild Vertriebs GmbH, Weiss Medien AG

Unser Essen
Heute scheint es selbstverständlich, dass Lebensmittel immer und überall verfügbar sind. Warum wir wieder bewusster einkaufen und essen müssen.

Schlafmütze
Laut, flink und mit grossen Kulleraugen ausgestattet: der Siebenschläfer.
Weitere Themen

Allein im Wald
Was Jugendliche an einem naturpädagogischen Initiationsritual erleben.
l Schöne Haut ist Gesundheit pur l Die Folgen der Lichtverschmutzung l Wie die Natur bei Diabetes hilft l Achtsamkeit – Sinnesorgan Ohr l Remo Vetter über Herbstgärten
«natürlich» 10-2014 erscheint am 25. September 2014
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 62, Fax 058 200 55 63 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch

Eigentlich wollte Simon Libsig nur Croissants kaufen, doch in der Bäckerei wird er unversehens Zeuge eines dramatischen Telefongesprächs.
axime! Hör auf zu weinen! Ich verstehe kein Wort, hör auf zu weinen. Maxime, was ist passiert?! »
Südfrankreich. Nicht weit vom Strand und der Ferienwohnung. Neun Uhr morgens.
Als ich die Bäckerei betrete, spricht die Bäckerin bereits energisch in ihr Handy. Sie schaut kurz auf, bedeutet mir mit einem Kopfnicken, dass sie gleich bei mir sein werde, dann dreht sie sich weg, Rücken zur Theke. Aus ihrer Hochsteckfrisur haben sich einzelne Strähnen gelöst, ihre freie linke Hand unterstreicht jedes ihrer Worte. Sie bittet, sie beschwört, sie befiehlt: «Beruhige dich, Maxime! Sag mir, was los ist! Hör doch auf zu weinen!»
«Maxime, bitte hör auf zu weinen und sag mir jetzt, was passiert ist!»
Die Bäckerin zieht am Bändel ihrer Bäckersschürze, der Knoten löst sich sofort.
Die Bäckerin zieht am Bändel ihrer Bäckersschürze, der Knoten löst sich sofort.
Ich bin der einzige Kunde, trotzdem trete ich etwas zurück, als würde ich jemanden vorlassen. Ich bin hier wegen drei Croissants, einem Pain au chocolat und einer Baguette, und vor meinen Augen, das spüre ich, zerbröselt etwas im Leben der Bäckerin. «Maxime, bitte, was ist los! Was ist passiert?! Sprich doch!»
Ich verstehe zwar nicht perfekt Französisch, aber ich verstehe Angst. Plötzlich ist sie da. In der Stimme der Bäckerin. In ihren Schritten, die sie nun hinter der Theke auf und ab geht. In ihren Augen. Ja, die Bäckerin dreht ihren Kopf nochmals zu mir, versucht, «Entschuldigung» zu sagen, mit den Augen, aber ihre Augen sagen Angst. Ich nicke und tätschle zweimal die Luft vor mir, eine automatische Geste, die mir sogleich unangebracht und salopp vorkommt. Als würde die arme Frau in einer Quartierstrasse zu schnell auf mich zu fahren und ich wollte ihr bedeuten, den Fuss vom Gas zu nehmen.
«Warte!» Sie nimmt das Handy vom Ohr, zieht die Schürze über den Kopf und lässt sie zu Boden gleiten wie ein Nachthemd. «Ich komme zu dir! Beruhige dich!» Die Bäckerin tippt zittrig über die Kasse, die Kasse springt auf. «Sag mir einfach, was passiert ist, Maxime, bitte!» Sie fischt einen Autoschlüssel aus der Kasse und bugsiert die Lade mit dem Handrücken gleich wieder zu. Es klingelt. Nicht die Kasse, hinter mir. Ein Mann mit Fischerhut schiebt sich durch die Türe, in der Hand ein Einkaufsnetz. «Maxime! Maxime!» Die Bäckerin rupft zwei Baguettes aus dem Brotkorb, wie Pfeile aus einem Köcher, und wirft sie auf die Theke. Die Baguettes rollen noch über ihre knusprige Kruste auf uns zu, als die Bäckerin schon durch die Tür ist. Und weg. «Ist etwas passiert?», fragt mich der Fischerhut auf Englisch.
«Je ne sais pas», sage ich. u
Simon Libsig kann nicht nur reimen, sondern auch lesen und schreiben. Der Badener gewann mehrere Poetry-Slams und einen Swiss Comedy Award – und hat mit «Auf zum Mond» auch ein wunderbares Kinderbuch herausgebracht. Mehr Libsig auf www.simon-libsig.ch