Das Magazin für ganzheitliches Leben





















Heilende Zeichen statt Globuli






GRÜNTEE FÖRDERT DIE GESUNDHEIT 18 AUS DEM ALL



vom Twannberg 56







bietet Kranken mehr Lebensqualität 22












Die Paluwatar Daunenjacke überzeugt durch die sehr gute Wärmeleistung und das geringe Gewicht. Die Daune ist mit PFC-freiem Nikwax wasserabweisend behandelt und verliert auch in feuchtem Zustand weder an Bauschkraft noch an Wärmerückhaltevermögen. Das wetterfeste Rainshield-Aussenmaterial ist stark abriebfest, wasserabweisend und daunendicht.

Daunenjacke








Liebe Leserin, lieber Leser
Wie viel darf ein Lebensjahr kosten ? Nur 100 000 oder doch eher 200 000 Franken? Die Frage wird in der Gesundheitsbranche ernsthaft diskutiert, denn die Behandlung todkranker Menschen wird mit jedem neuen Medikament, das auf den Markt kommt, teurer – und dadurch steigen auch die Krankenkassenprämien, Jahr für Jahr.
Todkranke Menschen in unserer Gesellschaft sind immer häufiger Krebspatientinnen und Krebspatienten.
Dank modernster Operations- und Bestrahlungstechniken in Kombination mit ausgeklügelten Chemotherapien sind heute viele Krebsarten heilbar. Einige sind es partout nicht. Bei diesen geht es in der Regel nicht um Heilung, weil dies trotz aller Hoffnung in der Regel nicht möglich ist, sondern um eine reine Lebensverlängerung um einige Wochen, im besten Fall um einige Monate, vielleicht sogar um ein Jahr.
Aber unter welchen Umständen wird diese Lebenszeit gewonnen ? Welche Lebensqualität erwartet einen Menschen, der den sicheren Tod vor sich hinschiebt und sich in dieser Zeit von Therapie zu Therapie schleppt – und sich dazwischen von den Folgen und Nebenwirkungen dieser teuren Behandlungen kaum mehr erholt?

Auch die Naturheilkunde kann keine Wunder bewirken, wie Sie ab Seite 22 lesen können. Aber sie kann, wie das zum Beispiel die Homöopathie macht, schonend die Selbstheilungskräfte mobilisieren oder die Nebenwirkungen der schulmedizinischen Rosskuren abfedern. Fast ohne Neben wirkungen und auf jeden Fall viel günstiger als die Schulmedizin verbessert die Naturheilkunde so die Lebensqualität von Krebspatienten. Das Sterben kann sie nicht verhindern – aber sie kann das Leben davor eindeutig lebenswerter machen.
Ihr

Chefredaktor


Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung
Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:
Anouk Claes, Peter Goldman, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Annette Kaiser, Elisabeth Bond, Carlo Zumstein, Renate von Ballmoos, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Marie-Therese Schibig, u.a.
Nächster Ausbildungsbeginn: 19. Mai 2017
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch


Info-Abend: 17.1.17
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt» Dr med. Y. Maurer
Berufsbegleitende, anerkannte Weiterbildungen mit eidg Dipl.: 3 Jahre, SGfB-anerk.

Info-Abend: 22.11.16 3 Jahre SGfB-anerk.
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP
Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung Dipl. Partner-, Paar- und Familienberater/in IKP
Beide We iterbildungen können mit einem eidg Dipl. abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern
Ganzheitliche systemische Psychologie und Coaching-Tools rund um Beziehungsprobleme Seit 30 Ja hren anerkannt



Nägeli-Neff Margrit certif ied Advanced Rolfer Tel. 044 362 61 23
Die integrier te Str uktur, die im Rolf ing angestrebt wird, vermeidet die Fehlbelastung von Gelenken und Überlastung der Gewebe. Der Kör per bef indet sich wieder in Balance und Einklang mit der Schwerkraft. Tiefe manuelle Bindegewebsarbeit, verbunden mit sensitiver Bewegungsschulung, er möglicht eine differenziertere Selbstwahrnehmung. Arbeitsorte: ZH, Vella (GR), Schaan (FL) www.silicea.ch
Silicea hilft















14 Heilende Zeichen und Symbole
18 Grüntee vom Monte Verità
22 Hoffnung für Krebspatienten

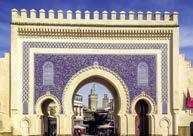
56
Meteoriten: Wir suchen und fi nden
Ausserirdische am Twannberg bei Biel
60 Remo Vetter macht den Garten wintersicher
26 Sabine Hurni über das Wassertrinken
28 Leserberatung
31 Heilpfl anze des Monats: Wacholder
32 Unterschätzte Schätze: Hülsenfrüchte
34 Rezepte mit einer Prise Orient
38 SAC-Hütten – ein Knigge
49 Wanderstöcke ja, aber ...
52 Winterwanderung durch das Goms
64
Blau ist mehr als eine Farbe –Reise in den Orient
Plus
3 Editorial
6 Augenblick – im Märchenwald
8 Aktuell und Wissenswert
12 Bye-bye AKW!
37 Nice to have
59 Bücher, Apps und Co.
69 Gedankensplitter
70 Rätsel
71 Markt-Aktiv
72 Markt-News
73 Vorschau
74 Carte Blanche





Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.
O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält, Denn heute löst sich von den Zweigen nur, Was von dem milden Strahl der Sonne fällt.
Friedrich Hebbel (1813 –1863)

GESUNDHEIT
Vorsicht vor Blutdruckschwankungen
Ein zu hoher Blutdruck gilt als belastend für das Herz-Kreislauf-System. Eine aktuelle britische Studie an der Universität Oxford zeigt nun, dass auch langfristige Blutdruckschwankungen das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und die Sterblichkeit erhöhen, schreibt die Ärztezeitung. Blutdruckregulierend wirken Tees und Tinkturen von Mistel, Besenginster, Ginseng und Jiaogulan, dem «Kraut der Unsterblichkeit».
OKTOBER



FINANZWELT

YES WE CRASH!
Am 3. Oktober ging das Fiskaljahr der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ende. Barack Obama hat in seinen zwei Amtszeiten die Schulden nahezu verdoppelt: Der US-Schuldenberg beträgt mittlerweile 19,64 Billionen Dollar. Wenn Sie jeden Tag eine Million Dollar zum Fenster rausschmissen, würde es 53 808 Jahre dauern, bis Sie so viel Geld vernichtet hätten. Laut IWF hat die globale Verschuldung den Rekord von 152 Billionen Dollar über schritten. Das sind 225 Prozent des Welt-BIP. krea
Das Sternbild Orion ist bei uns von August (Morgenhimmel) bis April (Abendhimmel) zu sehen. Beteigeuze, sein östlicher Schulterstern leuchtet hell und rötlich, Rigel, der den Fuss des Orions markiert, funkelt in weissbläulichem Licht. Zwischen den beiden stehen aufgereiht drei Sterne, die den Gürtel des Orions darstellen – deshalb der Begriff «Gürtelsterne». Der Orion ist das auffallendste Sternbild des Winterhimmels. Momentan hat es durch die Kreiselbewegung der Erdachse nahezu seine nördlichste Stellung erreicht. In 13 000 Jahren wird der Orion jedoch von Mitteleuropa aus nicht mehr vollständig sichtbar sein.
Der griechischen Mythologie zufolge war Orion der Sohn des Poseidon und einer Tochter des kretischen Königs Minos. Homer beschreibt Orion in seiner Odyssee als riesigen Jäger, der mit einer unzerbrechlichen bronzenen Keule bewaffnet war. Er prahlte vor Artemis, der Göttin der Jagd, dass er jedes Tier auf Erden töten könne. Darauf schüttelte sich die Erde zornig und aus einem Riss im Boden kroch ein Skorpion, der den Jäger stach und tötete. Deshalb fl ieht Orion jeweils unter den westlichen Horizont, wenn der Skorpion im Osten aufsteigt.
Andreas Walker
TIPP
DES MONATS

GEWINNEN
SIE
KINOTICKETS
3 × 2 Tickets für den Film Wild Plants:
Schicken Sie bis am 11. November 2016 eine Postkarte mit Ihrer Adresse und dem Vermerk «Wild Plants/Natürlich» an: Look Now! Filmdistribution, Gasometerstrasse 9, 8005 Zürich. Die Gewinner werden benachrichtigt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Der poetische Dokumentarfilm Wild Plants porträtiert Menschen wie den rebellischen Gärtner Maurice Maggi, der mit seinen nächtlichen Guerilla-Aktionen Zürich verändert hat, oder den indianischen Naturphilosophen Milo Yellow Hair. Die Protagonisten aus aller Welt stehen für eine Rückkehr zum Wesentlichen. Dem Komfort der Konsumgesellschaft kehren sie den Rücken und wenden sich wieder der Erde zu, den Pflanzen und Mitmenschen und der Spiritualität. Durch den radikalen Bruch mit Marktgesetzen und der Wachstumsideologie wird ihre Rückeroberung der Natur zur revolutionären Tat.
Nicolas Humbert: «Wild Plants», jetzt im Kino.
DER MEINT…
... so wird das Wetter im November
Der November sieht schöner aus, als er wirklich ist. Es wird noch einmal beinahe sommerlich. Umso kälter sind die Nächte: Es sind jähe Wetterstürze zu erwarten. Mancher Tag, der vielversprechend begonnen hat, endet mit Sturm und Regen. Es ist sehr windig.

Und das sagt die Bauernregel im November «St. Martins Sommer währt nicht lange.»
Eine warme Periode im November wird auch als Martini-Sommer bezeichnet. Der Begriff geht der Legende nach auf den heiligen Martin zurück, der nach dem Besuch eines neu gegründeten Klosters im französischen Tours unerwartet gestorben war. Als sein Leichnam auf der Loire in die Stadt transportiert wurde, erfolgte ein starker Wärmeeinbruch. Die Natur begann neu zu blühen, und die Wiesen ergrünten wie im Frühling. Dieses «Wunder» wurde dem heiligen Martin zugeschrieben, dessen Namenstag die katholische Kirche am 11. November feiert.

+ Ob der 100-jährige Kalender recht gehabt hat, lesen Sie auf www.natuerlich-online.ch/wetter

Frankreich verbietet Plastikgeschirr
Bei uns kosten Einwegplastiksäcke bald fünf Rappen. Derweil verkaufen die Detailhändler weiter Salate, Birchermüesli und anderen Convenience Food in viel gewichtigerem Einwegplastikgeschirr. Ernsthaft geht Frankreich mit dem Thema um: Ab 2020 will unser Nachbarland Plastikgeschirr ganz verbieten. krea


AUSSTELLUNG
WILDE KÜCHE
Wissen Sie, wie man aus Bergahornblättern Sauerkraut macht? Wie ein Distelrisotto zubereitet wird? Oder wie aus Flechten Suppen werden? Das und viel mehr erfährt man in der aktuellen Ausstellung im Kabinett des Alpinen Museums Bern. + Ausstellung «Wilde Küche» Alpines Museum der Schweiz, Bern Bis 8. Januar 2017 www.alpinesmuseum.ch














































Similasan Wirkformel bringt empfindliche Haut wieder ins Gleichgewicht und erhält sie natürlich schön. Bereits nach
Gleichge vier Wochen wird die Haut spürbar besser, wie Studien zeigen. Mehr über die ehrliche Naturkosmetik aus der Schweiz : www.similasan.ch


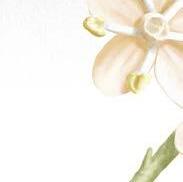



Am 27. November kann die Schweiz – können wir – Geschichte schreiben. Weichen stellen, die Einfl uss haben auf das Leben unserer Kinder und Enkel und deren Kinder und Enkel. Wir können Ja sagen zur Volksinitiative für einen geordneten Atomausstieg. Wird die Initiative angenommen, müssen die AKW Beznau und Mühleberg – die ältesten der Welt – innert Jahresfrist abgestellt werden; die AKW Gösgen und Leibstadt 2024 respektive 2029. Wir müssten vorübergehend mehr Strom aus dem Ausland beziehen (dafür kein Uran mehr importieren). Mittelfristig kann sich die Schweiz





Georg Schramm ist einer der bissigsten und erfolgreichsten politischen Kabarettisten Deutschlands. Er wurde mit nahezu allen namhaften Kabarettpreisen des deutschsprachigen Raums ausgezeichnet, darunter der Deutsche Kleinkunstpreis, der Salzburger Stier und der Schweizer Kabarettpreis Cornichon.
aber selber mit Energie versorgen. Der Bundesrat schätzt die Kosten für die Energiewende auf 200 Milliarden Franken. Die würden überwiegend ins heimische Gewerbe fl iessen, nicht wie die 12 Milliarden, die wir Jahr für Jahr für Öl, Gas und Uran ausgeben. Auch das schön färberisch «Rest risiko» genannte Damoklesschwert, das über uns allen schwebt, wäre endlich gebannt. Es ist Zeit, die gefährlichen und teuren Meiler abzustellen, bevor uns einer um die Ohren fl iegt. Sonst kommt es womöglich, wie es der wunderbar renitente Lothar Dombrowski prophezeit.


von Georg Schramm alias Lothar Dombrowski tschernobyl – da war doch was. nur eine schnee ocke, die der nuklearen eiszeit vorauseilte. bophal – nie was von gesehen. nur nsternis in 100 000 inderköpfen. vivian und wiebke – nie gehört. nur ein hauch des windes, der zu neuen ufern führt. der nächste krieg – weiss nicht, wann. nur vertagt, bis die hungrigen kinder des islam ihn führen können gegen den ungeist der moderne. die uhren der vierten dimension stehen bereits auf fünf nach zwölf. allein die endliche lichtgeschwindigkeit gewährt uns noch aufschub. aber wenn uns die zeit erreicht, werden wir nicht einmal als farbenspiel einer supernova die galaxis erfreuen. denn die büchse der pandora steht schon überall und sie ist spaltbreit offen. zurückbleiben werden müllhalden, abschussrampen und kernkraftwerke – als kathedralen des hasses und der sachzwänge einer untergegangenen epoche – als letzte metastasen des fortschritts-krebses – als wegweiser für den zug der sechs milliarden aufrechten lemminge zu den klippen. unser gleichzeitiges ersaufen würde den meeresspiegel noch nicht einmal um einen tausendstel millimeter anheben. vor 50 jahren töteten kz-ärzte im namen der wissenschaft unzählige frauen beim üben einer neuen methode der schnell-sterilisation. sie landeten nicht auf dem elektrischen stuhl, sie landeten auf dem lehrstuhl westdeutscher universitäten, und die von ihnen entnommenen organe sind noch heute im handel.



heute lassen sie abtreibung verbieten als menschenverachtung, züchten gleichzeitig hirnlose embryonen als lebende ersatzteillager und testen synthetische cholera als b-waffe in den krankenhäusern von armenvierteln. das sind die bausteine eures fortschritts. aber es gibt einen trost: dieser seuche kann eine ära aufblühenden erdenlebens folgen, in der kellerasseln und tausendfüssler als hyperintelligente gattungen herrschen werden – über myraden von einzellern, – umgeben von endlosen algen- und echtenwäldern, – in palästen aus witterungsbeständigen plastiktüten, – und endlich ungestört durch die irrtümlich homo sapiens genannte art. und im olymp der entwicklungsgeschichte werden krebs und hiv höchstes ansehen geniessen als helden im abwehrkampf gegen die hominidenplage für eine befreite natur. und sollte jemals in den annalen des universums unser kurzes gastspiel erwähnt werden, dann bleiben von uns vielleicht fünf zeilen übrig: mensch, eine art, die sich selbst die denkende nannte. entwickelte ein hoch differenziertes zentralnervensystem, ohne die daraus resultierenden fähigkeiten arterhaltend nutzen zu können, und verschwand durch selbstzerstörung ihrer genstruktur zugunsten anpassungsfähiger kleinstlebewesen.
AKTUELL
Bürgerinitiative
Obwohl die AKW-Inhaber per Gesetz verpflichtet sind, für Schäden durch einen Atomunfall vollumfänglich aufzukommen, sind Land und Gebäude nur im Promillebereich versichert. Der Privatbankrott wäre bei einem GAU sicher. Eine Bürgerinitiative fordert Immobilienbesitzer auf, von den AKW-Inhabern eine Schuldanerkennung einzufordern. Falls keine positive Antwort zurückkomme, könne man das Risiko nur minimieren, indem man am 27. November Ja sagt zur Atomausstiegsinitiative.
Schuldanerkennung und Briefvorlage zum Downloaden auf www.versicherungsluecke.ch
Willkürliche Grenzwerte
Aus dem Buch «Lassen Sie es mich so sagen –Dombrowski deutet die Zeichen der Zeit», Blessing, 2007.





Wie gefährlich Strahlung ist, definiert die Internationale Strahlenschutzkommission ICPR, ein privates Gremium, das niemandem Rechenschaft ablegen muss. Zusammen mit der Internationalen AtomenergieAgentur IAEA legt es die Grenzwertempfehlungen fest, die von den meisten Ländern übernommen werden, auch von der Schweiz. Unabhängige Wissenschaftler kritisieren diese Praxis. Gemäss Europäischem Komitee für Strahlenrisiken ECRR werden die Folgen von niedriger ionisierender Strahlung systematisch verharmlost. «Die vorgeschlagene Strahlendosis ist viel zu hoch», schreiben auch die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz in der aktuellen Ausgabe ihrer Fachzeitung «oekoskop».

Wissenskunst
Seit 30 Jahren dokumentiert die wissenschaftliche Zeichnerin Cornelia Hesse-Honegger morphologische Missbildungen von Insekten. Demnach kommt es in Regionen mit erhöhter Strahlenbelastung öfters zu Fehlbildungen. 2015 wurde HesseHonegger mit dem Nuclear Free Future Award 2015 für die Kategorie Aufklärung ausgezeichnet. «Es hängt von uns allen ab, wie die Geschichte ausgeht», schreibt sie in ihrem aufrüttelnden Buch, das sie allen widmet, «die die Machen schaften der Atomindustrie nicht widerspruchslos hinnehmen».
+ Cornelia Hesse-Honegger: «Die Macht der schwachen Strahlung – Was uns die Atomindustrie verschweigt», 2016, edition Zeitpunkt, Fr. 29.–
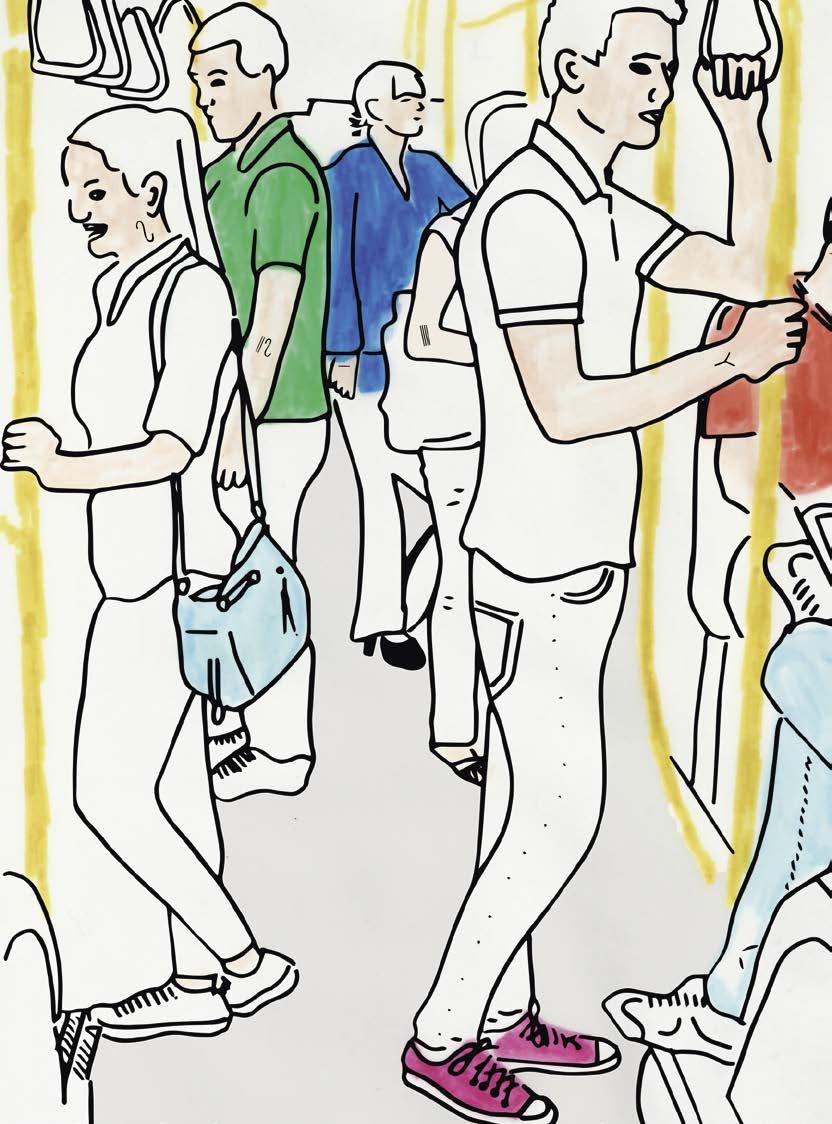

WIE DIE KLASSISCHE HOMÖOPATHIE ARBEITET AUCH DIE NEUE HOMÖOPATHIE AUF DER INFORMATIONSEBENE.
JEDOCH NICHT MIT POTENZIERTEN SUBSTANZEN, SONDERN MIT ZEICHEN UND SYMBOLEN.
TEXT: FABRICE MÜLLER ILLUSTRATIONEN: LINA HODEL
91 wurde am Similaungletscher eine zirka 7000 Jahre alte Mumie entdeckt, die als «Ötzi» Weltruhm erlangt hat. Ötzi hatte am Rücken sowie an den Beinen und Füssen Strichcodes und Kreuze tätowiert. Nur Schmuck? Wohl kaum, sind Rücken und Füsse doch wenig geeignet, um Tattoos zur Schau zu stellen. Doch welchen Zweck hatten sie dann, die Zeichen und Symbole auf Ötzis Haut?
Für den 1984 verstorbenen Wiener Entwickler der Neuen Homöopathie Erich Körbler war klar: Das ist die Geometrienmedizin unserer Urvölker. Körbers These wurde zehn Jahre später wissenschaftlich durch den Innsbrucker Radiodiagnostiker Dieter zur Nedden untermauert. Ötzis Zeichen dienten laut zur Nedden der Behandlung von Gelenk-, Meniskus-, Seitenbänder-, Sprunggelenkleiden und starken Schmerzen an der Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel.
INTENSIVE FORSCHUNGARBEIT. Erich
Körbler vereinte sein Wissen über den menschlichen Energiekörper mit der messtechnischen Methodik der Einhandrute. Er untersuchte unter anderem die Wirkung von Strichkombinationen auf lebendige Systeme, zuerst an Nahrungsmitteln, später auch am menschlichen Meridiansystem. Unterstützt wurde er bei seinen Forschungen durch den Akupunkturspezialisten Dr. Georg König, der in den 70er-Jahren die Akupunkturlehre an den österreichischen Medizinuniversitäten hoffähig gemacht hatte. Ausserdem begleiteten verschiedene Physiker die Forschungen von Körbler, darunter der Schweizer Naturarzt und Blutforscher Bruno Haefeli.
TRANSFORMIERENDE PROZESSE. Wie das Beispiel von Ötzi zeigt, ist die Idee, mithilfe von Zeichen und Symbolen zu heilen, nicht neu. Tattoos bei australischen Aborigines, Narbensetzungen in Schwarzafrika, Körperbemalungen bei den nordamerikanischen Indianern, Ohrkauterisationen (Ätzungen) in Südost-Asien – viele Urvölker erschufen sich eine Reihe einfacher Symbole wie Kreis, Kreuz, Punkt, Dreieck und Spira-
len. Ähnliche Zeichen fand man beispielsweise auch bei den skythischen Mumien der sogenannten Pazyryk-Kultur (5.–3. Jh.v. Chr.) in der heutigen Mongolei, in Ägypten und bei den Huicholen in Mexiko.
Im Gegensatz zu den «zivilisierten» Kulturen verstehen auch heute noch viele Urvölker die Zeichen und Symbole der Natur als Sinnbilder für tiefere Bedeutungsinhalte, als Zugang zur Sprache der Seele. Aus diesem Bewusstsein heraus erreichen Symbole unbewusste und unterbewusste Regionen des Seins und können dort auch heilende und transformierende Prozesse in Gang setzen. Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung (1875–1961) entdeckte und würdigte die Macht des Symbols wieder. Für ihn waren die Symbole, die sich den Menschen nicht nur über den Verstand, sondern vor allem über die Intuition erschliessen, eine «Offenbarung».
Der 1945 verstorbene italienische Neurologe Guiseppe Calligaris entdeckte auf der menschlichen Haut optisch kaum wahrnehmbare Punkte und einfache geometrische Formen, deren Stimulierung, etwa durch Akkupressur, negative Energien auflösen konnte. Der Professor nannte diese Punkte «Fenster zum Universum» oder auch «magische Spiegel».
MIT DEM TENSOR ZUM PASSENDEN SYMBOL. Der ehemalige Präsident des Schweizerischen Verbandes für Natürliches Heilen (SVNH) Romuald Schaniel, heute Leiter der Schule Fontisana, setzt die Neue Homöopathie häufig in Kombination mit anderen Naturheildisziplinen ein. «Die Neue Homöopathie arbeitet stark auf der körperlichen Ebene über Akupunkturpunkte und Meridiane», erklärt er. «Gezielt angebrachte Zeichen stimulieren den Körper, lösen Blockaden und öffnen den Menschen für weiterführende Behandlungen – zum Beispiel auf der biochemischen Ebene.» Mithilfe der Einhandrute, auch Tensor genannt, fragt Schaniel beim Patienten ab, was für Störungen vorliegen und welche Zeichen es für die Behandlung braucht. Krank machende Informationen können laut Schaniel durch gezielte Impulse in Form bestimmter Symbole, geometrischer Zeichen und Farben korri-
Viele Urvölker verstehen auch heute noch die Zeichen und Symbole der Natur als Sinnbilder für tiefere Bedeutungsinhalte, als Zugang zur Sprache der Seele.
giert und in positive Impulse verwandelt werden, welche die Seele und auch den Körper heilen können. Die Neue Homöopathie geht davon aus, dass auf diese Weise jede Störung menschlicher Regelkreise ausgleichbar ist. Sprich: Jede Krankheit lässt sich mit Symbolen heilen.
Neben bis zu neunteiligen Strichcodes kommt zum Beispiel das aufrechte oder umgekehrte Ypsilon zum Einsatz, das dem Körper hilft, Antikörper gegen Viren und Bakterien aufzubauen bzw. ein Symptom abzuschwächen. Die Sinuskurve hilft unter anderem bei akuten Fällen wie Entzündungen oder Insektenstichen. «Das Sinuszeichen auf dem Insektenstich führt zu einer sehr schnellen Linderung von Schmerzen und Juckreiz», sagt Schaniel.
DIE ZEICHEN WIRKEN DIREKT DURCH
DIE HAUT. «Die Zeichen werden auf ausgewählten Körperstellen aufgemalt», erklärt Schaniel. «Das Symbol wirkt mit seiner In-
formation direkt durch die Haut auf den Körper, vergleichbar mit der Sonneneinstrahlung, die den Körper über die Haut mit Vitamin D versorgt.» Der Naturheilpraktiker schätzt an der Neuen Homöopathie auch, dass sie anzeigt, ob eine Person beispielsweise stark mit elektromagnetischer oder anderer Strahlung belastet ist. Dann gibt er dem Patienten einen Zeichensatz mit nach Hause, der ihn auf der Informationsebene vor elektromagnetischer Strahlung oder Wasseradern schützen soll. «Durch den Einsatz kosmischer Symbole auf der Haut werden bei den behandelten Menschen für den Moment wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt», sagt Schaniel. Dies könne Folgen auf physischer Ebene haben, aber auch zur Auflösung psychischer Veränderungen führen. «So bringen die Symbole oftmals erstarrte Lernerfahrungen, grobstoffliche Störungen, emotionale Negativmuster und


blockierte Gedankenmuster wieder in Fluss.»
«Durch den Einsatz kosmischer Symbole auf der Haut werden bei den behandelten Menschen wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt».
Romuald Schaniel
WIRKSAMKEIT VON MEDIKAMENTEN TESTEN. Mit der Neuen Homöopathie lassen sich laut Erich Körbler auch Unverträglichkeiten testen, etwa von Lebensmitteln, Kosmetika, Allergenen oder elektromagnetischen Strahlen. Über den Einsatz von energetisch wirksamen Zeichen und Symbolen könne die individuelle Verträglichkeit gesteigert werden.
Das macht sich Lily Dobler, diplomierte Lebens-Energie-Beraterin nach Körbler, zunutze. In ihrer Naturheilpraxis in Wädenswil testet sie mithilfe der Neuen Homöopathie häufig die Wirksamkeit von Medikamenten und Nahrungsmitteln für ihre Klienten. Daneben setzt sie auf ein ausführliches Aufnahmegespräch sowie die Analyse mithilfe der Astromedizin. «So erhalte ich ein ganzheitliches Bild meiner Klienten und erkenne auch die seelischen Ursachen der Körpersymptome», schildert Dobler.
Neben der Behandlung von körperlichen Beschwerden habe sie auch gute Erfahrungen bei der Behandlung von psychischen Problemen mit der Neuen Homöopathie gemacht – zum Beispiel bei Depressionen oder Angstzuständen. Dazu benutzt sie oft informiertes Wasser. Denn die Neue Homöopathie arbeitet neben sogenannten aufgemalten Vektoren auch mit Wasser, das mit bestimmten Zeichen aufgeladen und getrunken wird. Sie macht sich dabei die Speicherfähigkeit des Wassers mit feinstofflichen Informationen, das sogenannte Wassergedächtnis, zunutze.
WIESO EIGENTLICH «HOMÖOPATHIE»?
Was hat die Neue Homöopathie mit der klassischen Homöopathie zu tun? «Nicht viel», sagt Beatrice Soldat vom Verband Homöopathie Schweiz (HVS). «Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso diese Methode den Begriff Homöopathie verwendet. In der klassischen Homöopathie arbeiten wir mit potenzierten Substanzen, die gemäss Arzneimittelbild verschrieben werden.»
Was jedoch beiden Disziplinen gemein ist: Sie arbeiten auf der Informationsebene
am menschlichen Körper. Im Gegensatz zur klassischen Homöopathie ist die Neue Homöopathie in der Schweiz noch wenig bekannt. Das Verfahren ist von den Registrierstellen ASCA und EMR nicht anerkannt und kann daher auch nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden. Die Idee, dass Zeichen Heilung auslösen, ist, trotz Ötzi, doch noch etwas gar ungewöhnlich. ◆
+ Literatur
Layena Bassols Rheinfelder
«Gesunde Entgiftung mit Zeichen. PraNeoHom® – Praxisorientierte Neue Homöopathie» 2015, PraNeoHom-Verlag Fr. 28.90
Petra Neumayer
«Medizin zum Aufmalen –Symbolwelten und Neue Homöopathie» 2013, Mankau Verlag, Fr. 17.90
«Die Sprache der Natur verstehen lernen –Das Lebenswerk Erich Körblers und seine Weiterführung. Eine Dokumentation» 2010, Ehlers Verlag, Fr. 52.–






















Jetzt am Kiosk.


Schweizer LandLiebe. Mit Liebe gemacht. Entdecken Sie LandLiebe 6 × jährlich im Abo: landliebe.ch
eizer Mit Liebe gemac n Sie 6 × im

GRÜNTEE IST PURER GENUSS – UND ER SOLL VOR DIVERSEN KRANKHEITEN SCHÜTZEN. ZU BESUCH BEI TEEPIONIER PETER OPPLIGER AUF DEM MONTE VERITÀ, DER EINZIGEN TEEPLANTAGE DES EUROPÄISCHEN FESTLANDES.
Text: CHRISTINE WULLSCHLEGER
Bereits im Jahr 2700 vor Christus sollen die Chinesen die Heilwirkung der Teepflanze genutzt haben. Eine alte chinesische Legende beschreibt, wie der damalige Kaiser Sen Nung im Jahr 2737 vor unserer Zeitrechnung den Tee kennenlernte: Ein Teeblatt fiel vom Baum in den darunter stehenden Kochtopf voller Wasser. Das Wasser färbte sich, der experimentierfreudige Kaiser trank davon und der Siegeszug des Tees nahm seinen Lauf. Die Teepflanze ist eine subtropische Regenwaldpflanze, die in freier Wildnis sieben bis acht Meter hoch wird. Sie gehört zur Gattung der Kamelien. Weltweit gibt es rund 30 000 Kameliensorten, doch nur deren zwei – die Camellia sinensis und die Camellia assamica – können als Tee verwendet werden. Beide Sorten werden auch auf dem Monte Verità angepflanzt.
Ein vielstimmiges Grunzen. In den Büschen raschelt es, dann rennen drei junge Wildschweine quer durch die Teeplantage auf dem Monte Verità ob Ascona. Peter Oppliger verscheucht sie armwedelnd. Widerwillig trotten die Wildschweine davon, aber nur bis zum Zen-Brunnen, wo sie ein Bad nehmen. Offensichtlich fühlen sich die Wildschweine hier wohl. «Am liebsten graben sie zwischen den Teepflanzen nach Eicheln und pflügen die Erde um», ärgert sich Oppliger. «So zerstören sie die Wurzeln der Teepflanzen. Deshalb haben wir die Plantage eingezäunt.» Manchmal findet das Borstenvieh aber einen Weg in die Plantage – und dann bricht Hektik aus bei Oppliger und seinen Mitarbeitern. Sind die Wildschweine vertrieben, legt sich Stille auf die Teeplantage. Es ist ein ruhiger, kraftvoller Ort. Oppliger hat vor gut zehn Jahren auf dem «Berg der Wahrheit» angefangen, Tee zu kultivieren.
Der 76-Jährige ist Spezialist für Naturheilkunde und war vor seiner Pensionierung Inhaber einer Drogerie und Apotheke. «1964 bin ich auf der Suche nach meiner Wahrheit nach Indien gegangen. Die Wahrheit habe ich zwar nicht gefunden, aber die Teepflanze», erzählt Oppliger, während er durch die Plantage spaziert mit seinem weissen, gepflegten Bart und dem Strohhut; die Brille hat er in der Brusttasche seines beigen Hemdes verstaut. Seit jener Indienreise habe ihn die Pflanze nicht mehr losgelassen, erzählt Oppliger. Heute bezeichnet er sich selbst als Teephilosophen – als Mensch, der sich mit viel Leidenschaft allen Facetten des Tees widmet.
Ein mystischer Ort. Deshalb hat er in der rund 2500 Quadratmeter grossen biologisch bewirtschafteten Plantage auf dem Monte Verità auch einen kleinen Zen-Garten mit Pavillon anlegen lassen. Denn das Teetrinken ist für Oppliger unweigerlich mit der Zen-Philosophie und deren vier Aspekten Harmonie, Respekt, Reinheit und Ruhe verbunden. Der Teephilosoph lässt sich auf einer Holzbank im japanischen Garten nieder, legt seinen Strohhut behutsam neben sich und atmet tief ein und aus. Dann erzählt er weiter.
Dass er 2005 die Möglichkeit bekam, oberhalb von Ascona Teepflanzen zu kultivieren, habe er einem erfolgreichen ersten Versuch zu verdanken: Zwei Jahre zuvor hatte Oppliger auf den Brissago-Inseln 80 Teepflanzen angepflanzt und festgestellt, dass die klimatischen Bedingungen für das Gedeihen der Pflanze im Tessin ideal sind. Mittlerweile wachsen 1400 Teepflanzen auf dem Monte Verità, der mit seinen rund 320 Metern über Meer mehr Hügel als Berg ist. Die Plantage ist die einzige auf dem europäischen Festland.
Die Anlage im Park des Monte Verità hat Oppliger «Cultura del Tè» genannt. Sie umfasst neben dem Weg durch die Plantage und dem Zen-Garten auch ein japanisches Teehaus, wo regelmässig Teezeremonien durchgeführt werden. «Weil der Monte Verità ein spezieller und mystischer Ort ist, passt die Cultura del
Tè besonders gut hierher, nicht nur aus klimatischen, sondern auch aus kulturellen und geschichtlichen Gründen», sagt Oppliger. Auf dem Monte Verità haben vor rund hundert Jahren Lebenskünstler eine Gemeinschaft gegründet. Ihr gemeinsames Ziel war eine gesunde, vegetarische Lebensweise. Die Gründer wanderten später aus, das Anwesen wurde verkauft, es entstand ein Hotel. Heute werden Hotel und Park von der kantonalen Stiftung Fondazione Monte Verità verwaltet.
Heilwirkung oder purer Genuss. Dreimal im Jahr wird auf der Teeplantage des Monte Verità geerntet. Von Hand –rund sechs bis acht Kilogramm pro Jahr, abhängig von der Witterung. Nach der Ernte werden die Blätter kurz gedämpft, getrocknet und von Hand gerollt. Der Monte Verità-Grüntee ist meist schnell ausverkauft; es gibt sogar Wartelisten.
Oppliger erhebt sich von der Bank und streift weiter durch seine Plantage, zwickt hier und da ein Teeblatt ab, begutachtet es und sagt: «Die Teepflanze ist die faszinierendste aller Heilpflanzen.» Das Spektrum der Heilwirkung sei so gross wie bei keiner anderen Heilpflanze. Die Teepflanze wirke aber nicht in jedem Fall heilend. «Durch verschiedene Verarbeitungsprozesse können aus der Pflanze echte Tees wie Grüntee, Schwarztee oder Weisser Tee hergestellt werden», erklärt Oppliger. «Die grösste Heilwirkung entfaltet die Teepflanze, wenn sie als Grüntee serviert wird.» Bei der Grünteeproduktion werden die Oxidationsprozesse (fälschlicherweise auch Fermentation genannt) verhindert, sodass die natürlichen Wirkstoffe im Blatt erhalten bleiben. Genau das Gegenteil passiert bei der Herstellung von Schwarztee: Die Oxidation wird bewusst eingeleitet. Dadurch gehen die wertvollen Wirkstoffe und damit die Heilwirkung verloren. «Ein hochwertiges Naturprodukt wird so zum reinen Genussmittel gemacht», kommentiert Oppliger. Je länger das Teeblatt oxidiere, desto wertloser werde der Tee für die Gesundheit. «Schwarztee ist aber für die Gesundheit immer noch besser als Kaffee.» Das Koffein im Tee halte den Geist wach und rege die Intuition an; das Koffein im Kaffee hingegen halte zwar ebenfalls wach, fördere aber die Konzentrationsfähigkeit keineswegs, sagt der Teekenner und ergänzt: «Auch ein länger angesetzter Tee wirkt niemals beruhigend, wie oft behauptet wird, da das Teeblatt keine beruhigenden Wirkstoffe enthält und solche auch bei längerem Ziehenlassen nicht entstehen können.»
Ein Tee gegen viele Leiden. Wer von der heilenden Wirkung der Teepflanze profitieren will, sollte also Grüntee trinken. Dieser wurde in den letzten Jahrzehnten gut erforscht. Grüntee soll den Cholesterinspiegel senken, das Herzinfarktrisiko verringern, Arteriosklerose vorbeugen oder das Auftreten und Wachstum von Krebszellen hemmen. «Grüntee ist ein Allerweltsmittel», sagt Oppliger. Er wirke vorbeugend und heilungsfördernd bei vielen Zivilisationskrankheiten. Er soll auch
Wir benutzen das Wort «Tee» für alle Kräuteraufgüsse, das Wort verweist aber explizit auf die Teepflanze. «Echter Tee» wird aus den Blättern der Teepflanzen Camellia sinensis oder Camellia assamica hergestellt. Diese werden in mehr als 30 Ländern angebaut. Aus diesen beiden Teepflanzen werden Grün- und Schwarztee, weisser und gelber Tee sowie Oolong- und Pu Erh-Tee hergestellt.
Diese Teesorten unterscheiden sich durch den Zeitpunkt der Ernte sowie die Verarbeitung, genauer gesagt durch den Oxidationsgrad (oft spricht man auch von Fermentation), der Aussehen und Geschmack stark beeinflusst.
Schwarztee
Für Schwarztee, den Klassiker, welken die Blätter nach dem Pflücken zunächst einige Zeit. Anschliessend werden sie gerollt oder geschnitten. Durch das Austreten des Zellsaftes wird die anschliessende Oxidation beschleunigt. Nach der vollständigen Oxidation werden die Blätter abschliessend sehr heiss getrocknet. Geschmacklich gibt es eine riesige Vielfalt. Die berühmtesten Teeanbaugebiete von Schwarztee sind Darjeeling, Assam und Ceylon.
Grüntee
Für Grüntee werden die Blätter direkt nach der Ernte gedämpft bzw. geröstet. Die kurzzeitige Hitzezufuhr unterbindet die Oxidation, bevor sie überhaupt richtig einsetzt. Danach werden die Teeblätter gerollt und abschliessend schonend getrocknet. Grüntee
stammt vor allem aus China, Indien und Japan.
Weisser Tee
Weisser Tee ist im Prinzip sehr junger Grüntee. Die bekanntesten Sorten stammen überwiegend aus China. Für die Herstellung von weissem Tee werden meist nur junge Knospen aus den ersten Ernten des Jahres verwendet. Nach dem Pflücken erfolgt umgehend eine schonende Trocknung, wobei die Blätter regelmässig gewendet und belüftet werden müssen. Weisser Tee ist der unver arbeitetste von allen. Sein Aroma ist mild fruchtig oder auch nussig. Seinen Namen verdankt er dem weissen seidigen Flaum, der die jungen Teeknospen bedeckt.
Gelber Tee
Eine hierzulande noch wenig bekannte Teesorte, die im Prinzip ein etwas länger oxidierter Grüntee ist. Durch die längere
Oxidation verändert sich das Aroma: Die herberen teilweise auch grasigen Aromen werden etwas reduziert. Gelber Tee schmeckt insgesamt recht mild, süss und sehr vollmundig. Er wird vor allem in China hergestellt.
Oolong
Wie beim Schwarztee welken die Blätter nach der Ernte, bevor sie gequetscht werden, damit sie besser oxidieren können. Durch Rösten bei hohen Temperaturen in einer Gusseisenpfanne wird die Oxidation gestoppt und die Aromastoffe werden fixiert. Danach werden die Blätter gerollt und anschliessend gebacken. Oolong ist stärker oxidiert als Grüntee, aber nicht so stark wie Schwarztee.
Pu Erh-Tee
Wie beim Schwarztee welken die Blätter nach der Ernte. Dann werden sie geröstet und anschliessend gerollt. Abschliessend folgt der längste Produktionsschritt aller Teearten:
Pu Erh muss Monate, teilweise Jahre reifen –sprich gut lagern. Dadurch erhält er seine dunkle rötliche Farbe und den kräftigen erdigen Geschmack. In der Stadt Pu’er in der chinesischen Provinz Yunnan wird der Tee seit etwa 1700 Jahren so hergestellt.


Peter Oppligers wichtigste Grünteeregeln:
★ Die Verpackung des Tees ist ausschlaggebend: Sie sollte luft-, wasser-, lichtdicht und wiederverschliessbar sein. Wenn man Grüntee in Form von Teebeuteln kauft, sollten diese einzeln entsprechend verpackt sein.
★ Auf dem Etikett sollten detaillierte Angaben zur Herkunft und im besten Fall auch zur Plantage angegeben sein.
★ Vorsicht vor aromatisiertem Tee: Meist sind die Aromen synthetischer Natur.
★ Wählen Sie Teequalitäten aus biologischem, natürlichem und organischem Anbau.
★ Man sollte den Tee nie überdosieren. Besser zu wenig als zu viel Kraut aufgiessen.
★ Man sollte die Kräuter zwei bis zweieinhalb Minuten ziehen lassen. Sie können ein zweites Mal aufgegossen werden, dann enthalten sie allerdings nur noch wenig Koffein.
★ Die Wassertemperatur ist auf die jeweilige Grünteesorte abzustimmen; sie darf höchstens 90 Grad Celsius betragen – also nicht mit kochendem Wasser übergiessen.
★ Grüntee trinkt man ohne Zucker.
schwach antidepressiv und karieshemmend wirken. Ein Schlankheitsmittel sei er aber nicht, so Oppliger, auch wenn er zuweilen als solches angepriesen wird. «Grüntee wirkt zwar cholesterinabbauend, harntreibend und begünstigt einen gesunden Stoffwechsel. So kann Grüntee Fastenkuren oder Diätkuren unterstützen. Mehr aber nicht.» Schon gar nicht sei Grüntee ein Allheilmittel.
Ähnlich tönt es bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE): Ein Lebensmittel alleine könne nie die Lösung für alles sein. «Dem Grüntee werden verschiedene gesundheitliche Vorteile nachgesagt, ausreichende wissenschaftliche Studien liegen dazu jedoch nicht vor», sagt Sabine Oberrauch, SGE-Fachberaterin, «Insofern gibt es aus ernährungsphysiologischer Sicht keinen Grund, Grüntee speziell zu empfehlen.»
Tee trinken ist ein Ritual. Peter Oppliger sagt: «Ein Tee gehört nicht an die Espressobar. Tee trinken sollte Freude bereiten. Wenn man den Tee bewusst zubereitet und ihn bewusst trinkt, hat er einen ganz anderen Wert.» Er streicht noch einmal mit der Hand über die Teepflanzen; dann steuert der Teephilosoph auf das japanische Teehaus zu. Dort wird auf traditionelle Art und Weise der teure grüne Pulvertee Mattcha rituell zubereitet. Teemeisterin Eri Gnarini Homma stellt auf einer Reismatte, Tatami genannt, die Utensilien für die Zeremonie bereit. Auf glühender Kohle in einem gusseisernen Gefäss erhitzt sie
Inserat
Wasser. Ruhig und sorgsam sind ihre Bewegungen. Die Teemeisterin lässt sich Zeit. Mit einem Bambuslöffel misst sie das Pulver ab, mischt es mit dem heissen Wasser und rührt es bedächtig mit einem kleinen Bambusbesen schaumig. Sie reicht den Mattchatee zusammen mit kleinen Süssigkeiten. Ruhig und genüsslich schlürfen wir den Tee und lassen das Kastaniengebäck auf der Zunge vergehen.
Peter Oppliger hat auf dem Monte Verità einen einzigartigen Ort geschaffen. Einen Nachfolger für sein Werk hat er mit dem Familienunternehmen Länggass-Tee in Bern bereits gefunden. Aber noch hat er nicht genug. Ein neues Projekt im Nationalpark Locarnese ist schon in Planung. Den genauen Ort will Oppliger noch nicht verraten. Nur so viel: «Einige Hundert Teepflanzen sind bereits gepflanzt. Sie gedeihen prächtig.» ◆
Der Buchtipp
Peter Oppliger «Grüner Tee. Kultur – Genuss – Gesundheit», 2010, AT Verlag, Fr. 31.90


Burgerstein BIOTICS-G mit lebenden Bakterien- und He fe kulturen so wie Mikronährstoffen gehört zum Mo rg en wie das Fr ühstück. Denn re gelmässig eingenommen gib te sI hnen ein gutes Bauchgefühl. Bio tin trägt zur Erhaltung der normalen Darmschleimhaut bei und die Vitamine B6 und B12 un terstütz en die Fu nktion des Immuns ys tems. www.burgerstein-biotics.ch

KREBS BEDEUTET KRIEG – ZUMINDEST FÜR DIE SCHULMEDIZIN. IHRE AUSROTTUNGS
METHODEN: OPERATION, BESTRAHLUNG, CHEMOTHERAPIE. ES GIBT ALTERNATIVEN.
Text: FABRICE MÜLLER
«Ich habe wieder Singen gelernt. Mit dem Singen kann ich ausdrücken, was ich vorher nicht sagen konnte», freut sich Anita Herrmann (Name geändert), die nach einer konventionellen Brustkrebsbehandlung nun eine ambulante Rehabilitation am Sokrates Gesundheitszentrum Bodensee macht. Dank der hier angebotenen komplementären Therapien habe sie wieder neuen Lebensmut geschöpft. Viele der Therapien hätten tiefe Spuren hinterlassen; ganz besonders die Musiktherapie. «Mir war immer bewusst, wie wohltuend die Arbeit mit Musik ist», sagt Herrmann, «aber die Erfahrung, mich so intensiv wahrzunehmen, hat meine Erwartungen weit übertroffen.»
Die Erfahrung, mich so intensiv wahrzunehmen, hat meine Erwartungen weit übertroffen. Anita Herrmann (Name geändert )
Das Therapieprogramm des Sokrates Gesundheitszentrums Bodensee im thurgauischen Güttingen integriert Schul- und Komplementärmedizin bei der Rehabilitation von Krebspatienten. Das Konzept ist einmalig in der Schweiz: Die Klinik mit christlichkaritativer Ausrichtung kombiniert bewährte schulmedizinische und rehabilitative Behandlungen durch komplementärmedizinische und naturheilkundliche Heilmethoden sowie spirituelle Angebote. Dabei bilden Schulmedizin, Homöopathie, Musiktherapie und Spiritualität die vier Schwerpunkte.
Gemäss der Carstens-Stiftung wählten in Europa in den Jahren 2003 bis 2005 zwischen 12 und 24 Prozent aller Krebspatienten Homöopathie als Begleittherapie der konventionellen, schulmedizinischen Behandlungsmethoden. Heute dürften es schon deutlich mehr sein.
Warum haben Sie Krebs?
Krebs ist zu einer Zivilisationskrankheit geworden, vergleichbar mit früheren Krankheiten wie Syphilis, Tripper oder Tuberkulose. «Die Namen ändern sich», sagt Mohinder Singh Jus, Leiter der SHI Homöopathie Schule in Zug, «aber die wahre Ursache dieser Krankheiten werden wir nie herausfinden. Sie liegt nicht im Labor, sondern im Innersten des Menschen, auf einer immateriellen, dynamischen Ebene.» Warum ein Mensch krank geworden ist, wisse im Grunde genommen nur er selbst. «Wenn ein Patient mit Krebs zu mir kommt, ist eine meiner ersten Fragen: Warum haben Sie Krebs?» Gemäss Singh Jus muss der Krebs als
Symptom verstanden werden, das dem betroffenen Menschen etwas sagen will. Die Schulmedizin jedoch habe sich zur Symptomjägerin entwickelt, und mit ihr der Patient, meint der Homöopath mit indischen Wurzeln. Zu schnell würden Fieber, Ausfluss, Blutungen, jeder Hautausschlag, jede Entzündung gnadenlos unterdrückt. «Wie soll unser Immunsystem stark werden und uns schützen, wenn wir es in seiner Arbeit ständig stören?»
Die Homöopathie betrachtet Krebs als Gesamtkrankheit, nicht als lokales Symptom, wie es die Schulmedizin in der Regel handhabt. «Folglich sprechen wir nicht von Lungen- oder Leberkrebs, sondern von Krebs an der Lunge oder an der Leber», erklärt Singh Jus. Der Krebs sei die Frucht einer Krankheit, die sich vom Samen bis zum sicht- oder spürbaren Symptom entwickelt habe. «Weil die Zeitspanne des Prozesses vom Samen bis zur Frucht, dem Tumor, oft sehr lange dauert, bleibt der Krebs am Anfang meist unbemerkt.»
Der Mensch in seiner Ganzheit steht bei naturheilkundlichen Behandlungen im Zentrum. «Besonders bei Krebs ist es wichtig, nicht nur die Krankheit, sondern den Menschen ins Zentrum zu stellen», betont Simon Feldhaus vom komplementärmedizinischen Schulungsinstitut und Ambulatorium Paramed in Baar. Wie Singh Jus berücksichtigt er bei seinen Patienten nicht nur die körperliche Konstitution, sondern ebenso die Psyche, den Charakter und das Naturell. Dazu gehören Fragen zum eigenen Umgang mit dem Körper und der Seele – ist man zufrieden mit dem Leben? Hat man sich selbst gern (siehe «natürlich» 10-16)? «Ich versuche, über das Gespräch hinter die Fassade eines Menschen zu blicken und zu erkennen, was ihn bewegt oder wo es Blockaden gibt», sagt Feldhaus. Die Überlegungen zum eigenen Ich stehen für ihn in einem engen Zusammenhang mit der Konsumhaltung des Menschen. Denn: «Steigt der Wunsch nach immer mehr materiellen Werten, steigt meist auch die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Das wiederum begünstigt gewisse Krankheiten wie Krebs.»
Die Gene und Geerd Hamer
Weitere Faktoren, die sich förderlich auf den Krebs auswirken, sind familiäre Veranlagungen: Neigen Familienmitglieder oder Verwandte zu Depression, Sucht, Suizid oder Krebs, beeinflusse diese eine Grundtendenz in der körperlichen Konstitution, so Singh Jus. «Krankheiten in der eigenen Vorgeschichte wirken oft Jahre später noch nach, obwohl sie schulmedizinisch längst ausgeheilt sind.» Unterdrücktes Fieber, ein behandelter Scheidenpilz oder regelmässige Mittelohrenentzündungen hinterlassen laut dem Homöopathen Spuren im Körper und begünstigen, je nach Konstitution, eine neue Krankheit wie eben Krebs. «Vergangene

Krankheiten sind wie Narben, die im Körper ihre Spuren hinterlassen. Emotionale Schocks oder Tiefpunkte wie eine Scheidung, Liebeskummer, starker Stress oder ein Todesfall wirken sich stimulierend auf gewisse Grundtendenzen eines Menschen aus», sagt Singh Jus.
Noch radikaler sieht es Ryke Geerd Hamer, Wegbereiter der sogenannten Neuen Medizin: Er geht davon aus, dass ausnahmslos jedem Krebs ein seelischer Schock vorausgeht; diesen Schock könne man im Gehirn lokalisieren («Hamer’schen Herd»). Aufgrund dieser Lokalisation könne man auf die Krebsart und den Ort, wo er auftritt schliessen. Die These ist umstritten, Hamer selbst ist es noch viel mehr. Die Pharmazeutin Florence KunzGollut hat sich vom Drumherum nicht beeinflussen lassen und eine gut verständliche Zusammenfassung der Hamer’schen Theorie geschrieben: «Krebs ist eine Reaktion keine Krankheit». Darin erfahren wir auch, dass der Zusammenhang zwischen Krebs und Emotionen schon vor über 2000 Jahren vom griechischen Arzt Galenus behauptet wurde. Demnach werden alle Krankheiten durch Ungleichgewichte in Körper und Seele verursacht. Um Heilung zu bewirken, meint Galenus, müsse man am Temperament arbeiten und vor allem die Balance zwischen Blut, Schleim, schwarzer und gelber Galle wiederherstellen. Für den Krebs macht er einen Hang zur Melancholie und einen Überschuss an schwarzer Galle verantwortlich.
Krebs ist eine Reaktion, keine Krankheit. Ryke Geerd Hamer
Laut Simon Feldhaus wird die Krebsentwicklung aber auch durch Umwelteinflüsse begünstigt, etwa durch Elektrosmog, toxische Metalle, zum Beispiel Aluminium in Deos oder Quecksilber in Impfstoffen, und sogenannte Nitrosamine, das sind Stickstoffverbindungen, die den Stoffwechsel belasten.
Die Homöopathie unterscheidet zwischen der konstitutionellen und der palliativen Behandlung. Bei Krebs im Anfangsstadium wählt der Homöopath eine Therapie, die auf die Konstitution des Patienten einwirkt, sodass die Selbstheilungskräfte gestärkt, die Psyche unterstützt, Schmerzen gelindert und das Wachstum des Tumors gehemmt wird. Immer öfter kommt die Homöopathie begleitend zu schulmedizinischen Massnahmen wie Chemotherapie oder Bestrahlung zum Einsatz. Dabei gelte es, die starken Nebenwirkungen dieser Therapien abzuschwächen, den Körper zu stärken und gleichzeitig auf den Tumor einzuwirken, so Mohinder Singh Jus. Er unterscheidet zwischen der Behandlung der IchEbene, bei der es um Aussagen wie zum Beispiel «Ich habe Angst» geht, und der Mein-Ebene, wo konkrete Körpersymptome zur Sprache kommen. Die Wahl der homöopathischen Mittel wird individuell auf den Patienten abgestimmt. Sogar das bekannte Traumamittel Arnica kommt je nach Fall zum Einsatz – was für die Theorie Geerd Hamers spricht.
Die Naturheilmedizin arbeitet an der Stärkung des Immunsystems, das im Falle einer Chemotherapie oder Bestrahlung stark geschwächt ist. Sogenannte Immunstimulanzien aus Pflanzen, zum
Wir behandeln immer wieder Krebspatienten rein homöopathisch. Mohinder Singh Jus
Beispiel Misteln, kommen dabei ebenso zum Einsatz wie die Eigenblut-Ozon-Therapie. Neben der Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte setzt die Naturheilmedizin aber auch gezielt auf die Bekämpfung des Tumors. Auch dabei kommt der Mistel eine besondere Bedeutung zu: Einige Studien bestätigen die Wirksamkeit von Misteltherapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. «Die Misteltherapie erhöhe erwiesenermassen die Lebensqualität und Überlebenschancen der Patienten», sagt Simon Feldhaus. Eine weitere Möglichkeit sind hoch dosierte Vitamin-C-Infusionen. Vitamin C hat im Organismus eine wichtige Funktion als Radikalfänger, reguliert die Zellteilung, regelt das Immunsystem und bekämpft krebserregende Stoffe. Forscher untersuchen auch eine mögliche Heilwirkung von Kurkuma. Versuche bestätigen ein langsameres Wachsen von Tumoren. Zudem konnte man nachweisen, dass Kurkuma freie Radikale stabilisiert.
Neueste Studien sprechen von hervorragenden Ergebnissen gegen Krebs bei der Gabe von Propolis. Das Bienenharz-Molekül CLU-502 soll in den Krebszellen ein Gen dämpfen, das das Wachstum des Tumors antreibt. Eine brasilianische Studie hat ergeben, dass eine Kombination aus Propolis, speziellen Pilzen und den Samen des Orleanstrauches «Annatto» einen krebsblockierenden Effekt hat. Professor Hinz von der Universität Rostock beschäftigte sich mit der Wirkung von Cannabinoiden, die aus der Hanfpflanze gewonnen werden. Laut Hinz blockieren Cannabinoide im Experiment das Eindringen von Tumorzellen in das umliegende Gewebe. Sie hemmen zudem das Wachstum bösartiger Gehirntumore. Die Enzymtherapie mit dem Papaya-Enzym Papain, den Bauchspeicheldrüsen-Enzymen Trypsin und Chymotrypsin sowie dem Ananas-Enzym Bromelain führt offenbar dazu, dass Krebszellen, die sich mit einer Eiweissschicht tarnen, vom Abwehrsystem erkannt und angegriffen werden. Weihrauch wiederum wird zur Reduktion eines Hirnödems bei Patienten mit Hirntumoren eingesetzt. Und Lapacho-Tee lindert die Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Belegt ist auch der positive Effekt der Hyperthermie zur Krebsbehandlung, der Überwärmung des ganzen Körpers oder einzelner Körperteile. Sie wird an manchen Universitätskliniken in den USA, in Deutschland, Holland und auch in der Schweiz angewandt, ebenso in vielen Zentren für Komplementärmedizin. Sonnenlicht und das damit gebildete Vitamin D gelten übrigens als eine der wichtigsten präventiven Massnahmen zum Schutz vor Krebs. Natürlich soll man nicht in der Sonne brutzeln, sondern vernünftig sonnenbaden.
Forschungsergebnisse haben laut Simon Feldhaus von Paramed gezeigt, dass sich besonders aggressive Krebsarten wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brustkrebs oder Lungenkrebs von Zucker ernähren. Deshalb wählt die Naturheilmedizin oftmals auch eine ergänzende Ernährungsbehandlung, um durch den Entzug von Zucker die Krebszellen zu schwächen. Untersuchungen an Mäusen bestätigten den starken Einfluss von Zucker auf die Krebsentwicklung.
Der Homöopath Mohinder Singh Jus ist überzeugt, dass eine Krebsbehandlung nicht zwingend schulmedizinisch durchgeführt werden muss. «Wir behandeln immer wieder Krebspatienten rein homöopathisch.» Das bedinge aber eine entsprechende Einstellung des Patienten. «Wer ohne Angst in eine Krebsbehandlung einsteigt, hat die besseren Heilungschancen. Die positive Energie unterstützt die Heilkraft.»
An der medizinischen Universität Wien führten Wissenschaftler im Rahmen der Ambulanz «Homeopathy in Malignant Diseases» eine Studie mit 538 Patienten mit malignen Krebserkrankungen durch. Zusätzlich zur konventionellen onkologischen Behandlung wurden die Patienten mit homöopathischen Mitteln therapiert: Den Patienten wurde auf individueller Basis Q-Potenzen, in Akutfällen auch C-Potenzen verschrieben. Von den 538 dokumentierten Fällen erfüllten 54 Patienten die Einschlusskriterien und standen für die Analyse zur Verfügung. In der Gesamtbetrachtung zeigte sich, dass 65 Prozent der Patienten die erwartete Überlebenszeit erreichte respektive übertraf. Je nach Krebsart hatten sie eine bis zu dreimal längere Überlebenszeit, und das bei besserer Lebensqualität.
Die Verbesserung der Lebensqualität war für die Brustkrebspatientin Anita Herrmann besonders wichtig. «Mir geht es heute gut», sagt sie. «Die Musiktherapie hat mein Selbstvertrauen gestärkt und ich lebe im Jetzt. Die Bedeutung jedes einzelnen Tages, jedes Momentes ist mir bewusster denn je. So kann ich mich wieder am Leben erfreuen.» ◆
Inserat
Literatur
Claudia Ritter
«Superfood von A bis Z gegen Krebs», 2016, Herbig Verlag, Fr. 26.90
Jean-Lionel Bagot
«Krebs und Homöopathie. Natürliche Hilfe bei den häufigsten Nebenwirkungen von Chemo, Strahlentherapie und Operation», 2015, Narayana Verlag, Fr. 37.90
György Irmey und Anna-Luise Jordan «110 wirksame Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs», 2001, Trias, Fr. 28.90
Mohinder Singh Jus
«Die Reise einer Krankheit. Homöopathisches Konzept von Heilung und Unterdrückung», 2016, Homöosana Verlag, Fr. 37.90
Jörg Spitz und William B. Grant «Krebszellen mögen keine Sonne», 2010, Mankau Verlag, Fr. 17.90
Florence Kunz-Gollut
«Krebs ist eine Reaktion, keine Krankheit», 2013, sokutec Verlag, Fr. 19.90


„Meine Cr eme de la Cr ème für natürlich schöne Hände.“

















Wirkt für mich. Wirkt auf andere. rkt Wi


Natürliche Pflege für die Hände mit wertvollen Bio -Inhaltsstoffen. Optimal abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedür fnisse von trockener, anspruchsvoller und beanspruchter Haut Wirkt intensiv für natürlich schöne, gepflegte Hände und ein zar tes und geschmeidiges Hautgefühl




10 0 % zer tifizier te Naturkosmetik







Dafür steht lavera Naturkosmetik – seit über 25 Jahren. Mit der 10-fach Qualitätsgarantie Mehr unter lavera.de/natuerliche -pflege



























































lavera. wirkt natürlich schön.
lavera. wirkt natürlich schön.


















.

Genug Wasser trinken ist nicht nur gesund, es ist lebensnotwendig. Die meisten Leute trinken jedoch zu wenig, besonders in der kalten Jahreszeit. Ein Plädoyer fürs Wassertrinken.
Kennen Sie das ? Morgens füllen Sie einen Krug mit Tee oder Wasser und abends ist der Krug noch fast voll. Sie hatten halt keinen Durst oder waren den ganzen Tag so beschäftigt, dass Sie das Trinken schlicht vergessen haben. Kennen Sie? Ist nicht gut!
Im Sommer fällt das Trinken leichter. Doch sobald die Tage kühler werden, nimmt das Durstgefühl ab und entsprechend sinkt die Flüssigkeitsmenge, die wir dem Körper zuführen. Dabei wäre es gerade jetzt, wo die Heizungen wieder laufen und draussen Wind und trockene Kälte die Haut austrocknen, enorm wichtig, den Körper mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen.
Trinken ist viel mehr als oben rein und unten raus. Ohne Nahrung kommt der Mensch mitunter Wochen aus. Bei Wassermangel hingegen bricht der Kreislauf innert weniger Tage zusammen, weil die Nieren keine Giftstoffe mehr ausscheiden können. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Wasser der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers ist: Eine Frau besteht, rein materiell gesehen, zu 50 bis 55 Prozent aus Wasser; bei Männern sind
es bis zu 60 Prozent, bei einem Neugeborenen sogar bis zu 75 Prozent. Bei starkem Übergewicht kann der Wasseranteil im Körper allerdings auf 45 Prozent sinken. Das Wasser befindet sich in den Zellen, im Blut und in den Lymphbahnen. Knochen bestehen zu 22 Prozent aus Wasser, Muskeln zu 75 Prozent, Blut zu 90 bis 95 Prozent. Der Wassergehalt des Kopfes beträgt 80 bis 85 Prozent, jener der Augen sogar 99 Prozent.
Es ist das Wasser, das im Blut den Sauerstoff und die Nährstoffe transportiert, Stoffwechselendprodukte aus den Zellen holt und die Nieren aktiviert. Es ist auch das Wasser, das Stresshormone ausscheidet und Bandscheiben zu kleinen Kissen anschwellen lässt. Wasser brauchen wir zum Weinen, Schwitzen, Atmen, Ausscheiden und Einspeicheln. Ohne Wasser kein Leben!
Je nach körperlicher Aktivität und Aussentemperatur verliert der Mensch täglich zwei bis fünf Liter Flüssigkeit, auch während des Schlafs: Allein über Nacht atmen und schwitzen wir ein bis zwei Liter Wasser aus dem Körper. Husch, husch zwischen Bett und Büro ein, zwei Tassen Kaf-
Trinken / Idealerweise trinkt man schon vor dem Frühstück ein bis zwei grosse Gläser warmes Wasser.
fee trinken reicht nicht aus, um den Flüssigkeitsverlust der vergangenen Nacht zu ersetzen. Es braucht mindestens zwei grosse Gläser Wasser – am besten warm –, um Stoffwechsel und Kreislauf zu aktivieren und die Verdauungsorgane auf das Frühstück vorzubereiten. Als Faustregel für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme gelten drei Deziliter pro zehn Kilogramm Körpergewicht. Bei einer 70 Kilogramm schweren Frau sind das 2,1 Liter. Wer zu wenig trinkt, merkt dies oft lange nicht. Doch viele Erkrankungen hängen indirekt mit der Trinkmenge zusammen. Rückenschmerzen, Rheuma, Muskelkater, Kopfschmerzen, Verstopfung, trockene Haut, trockene Schleimhäute und Arthrose zum Beispiel sind allesamt Beschwerden, die sich positiv verändern, wenn die Trinkmenge stimmt.
Wer abnehmen möchte, sollte nicht nur Kalorien zählen, sondern in erster Linie den Stoffwechsel ankurbeln. Das geht ganz einfach: Vor jeder Mahlzeit mindestens einen halben Liter (lauwarmes) Wasser trinken. Wem trockene Heizungsluft zu schaffen macht, kann sich den Luftbefeuchter sparen, wenn er genügend Wasser trinkt. Leute mit Rückenschmerzen sollten nicht nur an ihrer Haltung arbeiten – sie sollten auch genügend Wasser trinken. Denn der Muskel besteht, wie bereits erwähnt, aus 75 Prozent Wasser; bei Wassermangel lagert sich im Muskel sehr viel Säure ein. Und die Bandscheiben können ihre Stossdämpferfunktion nur wahrnehmen, wenn bei jeder Bewegung Wasser zwischen die Wirbel strömen kann. Ausserdem kann der Körper die durch Schmerz und Stress ausgelösten Hormone nur ausscheiden, wenn genügend Wasser die Zellen durchströmt.
Trinken Sie also genug! Am besten über den Tag verteilt, vor allem am Morgen und am Nachmittag. Abends sollten Sie keine grossen Mengen mehr trinken, sonst werden Sie nachts von einer vollen Blase am Durchschlafen gehindert. Trinken Sie ungesüsste, neutrale Flüssigkeiten, am besten reines Wasser oder aber ungesüssten Tee oder stark verdünnte Fruchtsäfte. Denn je neutraler das Getränk ist, desto schneller kann es der Körper für sich nutzen. Jeder Kräutertee, jedes Süssgetränk und jeder Smoothie versorgt Körper und Geist mit Informationen, die sie zu verdauen haben. Wir müssen sonst schon enorm viele äussere Einflüsse emotional

verarbeiten. So ist es für den Körper eine wahre Wohltat, wenn er bei den Getränken nicht auch noch aus der Fülle aller Einzelteile das Wesentliche herausziehen muss. Damit der Krug in Zukunft nicht mehr nur zur Dekoration auf dem Schreibtisch steht, möchte ich Ihnen ein paar Tipps mitgeben, um Sie zum Trinken zu animieren: 1. Füllen Sie morgens zehn Gläser mit Wasser und stellen Sie diese an verschiedene Orte in Ihrer Wohnung. Jedes Mal wenn Sie an einem vorbeilaufen, trinken Sie es aus. 2. Das Glas neben dem Schreibtisch immer wieder füllen, sobald es leer ist. 3. Den Wecker jede volle Stunde stellen und jeweils ein Glas Wasser trinken. Im Büro machen Sie das am besten im Kollektiv. 4. Wasser mit Minz- oder Melissenblättchen aufpeppen, im Winter eignen sich auch Ingwerscheiben, Zitronenschnitze oder Kardamomsamen. ◆
Inserat
Von den Zusatzversicherungen der Krankenkassen anerkannt
füreine kostenlose TCM-Diagnose
SABINE HURNI ist dipl. Drogistin HF und Naturheil praktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Ayurveda-Kochkurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharma industrie und Functional Food auseinander.
In der Erstkonsultation wird aufgrund einer Puls-Zungen-Diagnose abgeklärt, ob eine Therapie der TCM sinnvoll ist

Gültig in einer Gong TCM Praxis Ihrer Wahl! Sie erreichen uns via Gong TCM Hotline 055/410 35 66 oder via www.gongtcm.ch

Meine Achillessehne ist angerissen. Inzwischen kann ich wieder normal laufen, aber noch nicht rennen. Yoga scheint zu helfen. Was könnte ich sonst noch tun? Hilft Ayurveda? S. S., Zürich
Wenn eine Sehne reisst, weisst das darauf hin, dass der Körper eher zu trocken ist und die Sehnen etwas spröde sind. Im Ayurveda bedeutet das, dass das Vata (Windenergie) erhöht ist und beruhigt werden sollte: Sie müssen Ihrem Körper äusserlich wie innerlich möglichst viel Feuchtigkeit zuführen. Äusserlich mit Salben oder Ölwickeln, zum Beispiel mit Johanniskraut, Öl, Arnikasalbe oder einem mit warmem Pflanzenöl angerührten Lehmwickel. Innerlich können Sie das Amla(«Indische Stachelbeere»)-Fruchtmus Chyavanprash einnehmen. Es gibt Ihnen eine gute Basis, Energie und eine Extraportion Vitamin C. Zudem versorgt es den Körper mit Feuchtigkeit. Das alles lässt die Achillessehne zwar nicht direkt zusammenwachsen, mobilisiert aber die Selbstheilungskräfte und hilft, Trockenheit vorzubeugen. Unterstützung bieten auch Omega3-Fettsäuren, Grünlippmuschel-Extrakt und allem voran eine ausgewogene Ernährung mit regelmässig eingenommenen warmen Mahlzeiten. Vermeiden Sie trockene Speisen wie Brot, Rohkost, nicht gekochte Getreideflocken und trockene Kräcker. Besser sind saftige, warme, gekochte Speisen.
Was tun gegen Fingernägelkauen?
Meine Freundin kaut an Ihren Fingernägeln und den Nagelhäutchen. Sie weiss nicht, wie sie damit aufhören soll. Was können Sie raten? C. E., Cham
Das Nägelkauen ist ein starker Ausdruck von innerer Spannung. Diese gilt es abzubauen, damit das Nagelkauen ein Ende nimmt. Das ist leichter gesagt als getan. Häufig sind sich die Betroffenen ihrer Ängste nicht bewusst oder leben schon so lange in einem Spannungsfeld, dass sie sich an den Zustand gewöhnt haben. Aber eben nur vermeintlich. Im Unterbewusstsein drückt die Spannung trotzdem durch.
Eine gute Möglichkeit, an das zugrunde liegende Thema heranzukommen, ist die therapeutische Arbeit mit Kinesiologie. Bei dieser Methode wird mittels eines Muskeltests nach dem wahren Grund der inneren Spannung gesucht. Das kann ich sehr empfehlen. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihre Freundin bereit ist, das Thema anzugehen. Eine andere Methode ist die Hypnose. Mit ein bis zwei Sitzungen können Verhaltensänderungen erzielt werden. Für einen Ausgleich im Alltag würden Meditationen, Yoga oder Kampfsport sorgen.
Als vorübergehende Prävention wären künstliche Nägel hilfreich. Sie helfen dabei, dass die natürlichen Nägel wieder wachsen können, ohne ständig wieder angeknabbert zu werden. Das ändert zwar nichts an der inneren Spannung, aber es durchbricht zumindest das gewohnte Muster.

Seit einer Hüftoperation sind meine Beine länger; die Muskeldehnung verursacht starke Schmerzen. Was kann ich tun, damit sich die Muskeln schneller an die neue Situation anpassen ? I. F., Fou
Sobald die Narben weitgehend verheilt sind, sollten Sie Ihre Beine jeden Tag massieren. Es gibt von Weleda ein sehr gutes Arnikaöl. Es fördert die Durchblutung, lindert die Schmerzen und lockert die Muskulatur. Massieren Sie sich damit kräftig die Gesässund Oberschenkelmuskulatur. Für die Waden und die Knöchel können Sie vielleicht jemanden um Hilfe bitten, falls Sie noch zu unbeweglich sind für die Massagen. Wenn die Selbstmassage schwierig ist, gönnen Sie sich regelmässig eine Massage oder Fussreflexmassage. Das ist sehr wohltuend. Auch ein Besuch im Thermalbad oder ein Bad in der eigenen Badewanne kann die Muskelschmerzen lindern und die «Neuorientierung» der Muskeln fördern. Innerlich könnten Sie sich einen Verletzungsspray auf homöopathischer oder spagyrischer Basis kaufen. In diesen Produkten sind verschiedene Heilmittel enthalten, die Muskelkater lindern und die Neubildung von Zellen anregen. Auch die Sportdrink-Mischung mit den Schüssler-Salzen Nr. 3, 5 und 7 kann Muskelzellen und Regeneration unterstützen.
Etwas jung in die Wechseljahre gekommen, hat mir die Ärztin Kalziumtabletten verschrieben, um Osteoporose vorzubeugen. Sind die sinnvoll oder gibt es eine natürliche Alternative? Und was kann ich gegen trockene Schleimhäute machen?
S. A., Brunnen
Fehlt das Östrogen, trocknet der Körper innerlich etwas aus, insbesondere die Scheide, aber auch die Kehle. Das betrifft viele Frauen.

Hier gilt es, kräftig Gegensteuer zu geben: Trinken Sie jeden Morgen ein Glas warmes Wasser, in das Sie einen Teelöffel voll Leinöl gemischt haben. Das Leinöl ist auch als Kapsel erhältlich, in dieser Form ist es angenehmer einzunehmen und auch länger haltbar. Zudem sollten Sie täglich morgens und abends Aloe Vera-Saft einnehmen. Aloe Vera heisst in Sanskrit «Kumari», was Mädchen oder junge Frau bedeutet. Der Saft hilft, den Körper und die Schleimhäute nachhaltig zu befeuchten. Auch die Pflege mit Öl ist wichtig. Sie können ab und zu einen Tampon mit Sesamöl aufsaugen lassen und ihn über Nacht einführen. Das Öl nährt und befeuchtet die Scheide.
Was die Osteoporose-Prophylaxe betrifft, versucht man in der Naturheilkunde den Körper mit Silikaten und Vitamin K2 zu nähren. Silikate sind im Schachtelhalm enthalten. Schachtelhalm sorgt für Stabilität im Körper und festigt das Bindegewebe. Vitamin K2 befindet sich in fettreichen Milchprodukten, japanischen Sojabohnen (Natto) und in Fertigpräparaten. Gute Kalziumquellen sind Hirse, Mandeln, Sesam (Tahin-Paste), Haselnüsse, Petersilie, grünes Gemüse und Trockenobst (über Nacht in Wasser einweichen). Auf trockene Speisen wie Salat und Brot sollten Sie weitgehend verzichten oder wenn, dann mit viel Sauce oder fettigen Brotaufstrichen essen. In Trockenreis oder Couscous können Sie einige Rosinen geben, damit das trockene Getreide etwas feuchter wird.
Meine Herzklappe zur rechten Herzkammer schliesst nicht ganz. Nun wird untersucht, was zu tun ist. Für den Kardiologen ist bereits klar, dass eine traditionelle Klappenoperation mit Öffnen des Brustbeins durchgeführt werden muss. Mir graust vor dieser grossen Operation. Gibt es Alternativen?
J. S., Burgdorf
Ich kann Ihr Unbehagen gut verstehen. Eine abschliessende Antwort kann ich Ihnen leider nicht geben. Hat Ihr Arzt Sie über die Auswirkungen der undichten Herzklappe beraten? Oder anders gefragt: Wie lange können Sie abwarten, bis tatsächlich Handlungsbedarf besteht? Ist Ihre Atmung immer gleich streng? Oder gibt es Phasen, in denen Sie beschwerdefrei sind? Wie stark sind Sie im Alltag eingeschränkt durch die erschwerte Atmung?
Sollte Abwarten ein zu hohes Risiko bergen, müssen Sie zwingend operieren. Wenn Sie Ihre Atembeschwerden aber nicht allzu fest beeinträchtigen und eine Operation nicht zwingend nötig ist, können Sie meiner Meinung nach zwischen Lebensqualität und Herzleistung abwägen.
Das Herz ist ein Muskel, den man trainieren kann, indem man sich täglich mindestens 30 Minuten lang an der frischen Luft bewegt. Herzstärkend wirken auch Weissdorn-Tinktur, KaliumMagnesium-Tabletten und Omega3-Fischöl-Kapseln. Das sind sehr gute Heilmittel für das Blut und das Herz. Im besten Fall bleibt das Herz stabil. Im schlimmsten Fall müssen Sie in ein paar Jahren trotzdem operieren. ◆
Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. sabine.hurni@azmedien.ch oder «natürlich», Leserberatung, Neumattstr. 1, 5001 Aarau. www.natuerlich-online.ch

Die Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) mit ihren orange und gelb leuchtenden Blüten wächst in vielen Gärten. Die würzig-scharfen Blätter und Blüten peppen im Sommer und Herbst Salate, Omeletten und Gratins auf. Im Winter ist die Kapuzinerkresse ein wirksames Heilmittel zur Stärkung des Immunsystems. So hilft die Kapuzinerkresse: Die Blüten und Blätter der Kapuzinerkresse enthalten neben Vitamin C auch SenfölGlykoside. Diese sind für den scharfen Geschmack verantwortlich, wirken antibakteriell, pilztötend und schleimlösend. Man kann die Kapuzinerkresse deshalb bei allen Arten von Erkältungen anwenden.
Wie anwenden: Wer im Sommer oder Herbst erkältet ist, nascht zwischendurch ein Blatt. Im Winter nimmt man Tropaeolum allein oder als Mischung in Form einer spagyrischen Essenz ein, die man sich im Fachgeschäft mischen lassen kann.
Weitere Tipps für das Immunsystem:
• Ideale Ergänzungen zur Kapuzinerkresse als Spagyrikmischung sind Roter Sonnenhut (Echinacea), Taigawurzel und Propolis (Bienenkitharz).
• Vitamin C ist im Winter wichtig für die Immunabwehr. Verzichten Sie aber auf Zitrusfrüchte; bevorzugen Sie Sauerkraut, Grünkohl oder Brokkoli.
• Auch im Winter sollte man mindestens 30 Minuten draussen aktiv sein. Das hilft gleichzeitig gegen Winterdepressionen.
3000 Naturheilpraktiker und Therapeutinnen kennen sich aus.
www.naturaerzte.ch Naturärzte Vereinigung Schweiz


















Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
• Kamillosan Creme und Kamillosan Salbe: Bei Schürfungen, Kratzwunden, aufgesprungener Haut.
• Kamillosan Liquidum: Entzündungshemmendes, juckreiz-milderndes, leicht desinfizierendes Mittel (Enthält 43% [V/V] Alkohol).



• Kamillosan Ocean Nasenspray: Zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenhöhlen.
• Kamillosan Mund- & Rachenspray: mit entzündungshemmender, schmerzlindernden und antibakterieller Wirkung.


WMAGISCH / Über Türen aufgehängter Wacholder vertreibt Hexen, gegen Epilepsie trägt man 14 Wacholderbeeren um den Hals.






ACHOLDERBEEREN sind weit mehr als ein Würzmittel im Sauerkraut. Als Heilmittel stärken sie die Nieren und entspannen die Muskeln, als Räucherware desin zieren sie Räume. Der bis zu drei Meter hohe Wacholderstrauch, auch Weihrauchoder Gichtbaum genannt, gehört zur Familie der Zypressengewächse und gedeiht gut in unseren Breitengraden. Hierzulande gehört er zu den geschützten und seltenen Arten. Die als Heilp anzen oder Gewürz verwendeten Wacholderbeeren stammen deshalb vorwiegend aus Italien, Kroatien und Albanien.
GENAU GENOMMEN sind die fünf bis acht Millimeter grossen, kugeligen, violettbraunen Wacholderbeeren gar keine Beeren, sondern runde Zapfen aus eischigen Samenschuppen, die sich ausschliesslich aus den weiblichen P anzen entwickeln. Die reifen Früchte werden im Spätsommer geerntet und danach möglichst schonend getrocknet, damit sich das ätherische Öl nicht ver üchtigt.
NEBEN DEM HAUPTWIRKSTOFF, dem ätherischen Öl, enthalten Wacholderbeeren Invertzucker, Gerbstoffe, Harze und Flavonoide. So schmecken Wacholderbeeren bitter und scharf und haben auf die Verdauung
eine erwärmende, tonisierende Wirkung. In der Küche werden sie für die Zubereitung blähender Speisen wie zum Beispiel Sauerkraut verwendet. Wacholderbeeren sind aber auch in verschiedenen Blasen- und Nierentees enthalten. Sie wirken nierenanregend, entgiftend, harntreibend und blutreinigend und sind deshalb gut geeignet für eine Durchspülungstherapie der Harnwege. Bei lang andauernder Anwendung (mehrere Wochen) und bei Überdosierung kann es zu Nierenreizungen kommen. Schwangere sollten keine Wacholderbeeren konsumieren.
DOCH NICHT NUR ALS TEE oder Extrakt nden die Wacholderbeeren in der Naturapotheke Verwendung. Wacholdersalben, Wacholdergeist oder Wacholderöl wirken durchblutungsfördernd und helfen bei Gelenk- und Muskelschmerzen. Um das Wacholder-Muskelöl selber herzustellen, nimmt man 100 Milliliter Olivenöl und 15 Tropfen Wacholderöl. Gut mischen und bei Bedarf jeden Abend kräftig einmassieren. Bei künstlichen Gelenken sollte man eine Wacholdersalbe oder Wacholdergeist verwenden, weil Olivenöl zu tief eindringt und dadurch das künstliche Gelenk schädigen kann. ◆


1. Räuchern: Fein geraspeltes Wacholderholz eignet sich hervorragend zum Räuchern. Es desinfiziert Räume, zum Beispiel Krankenzimmer, wirkt stärkend, klärend und erdend. Wenn jemand in der Familie erkältet ist, kann das Räuchern mit Wacholder vor Ansteckung helfen.
2. Harnwege durchspülen: Man beginnt mit fünf Beeren pro Tag und erhöht die Dosis täglich um eine Beere. Bei 15 Beeren angelangt, reduziert man die Menge um täglich eine Beere. Die Tagesdosis sollte 10 Gramm nicht überschreiten. Die Beeren kann man kauen, zerquetscht als Tee zubereiten oder in Form einer Urtinktur kaufen.
3. Verdauungsprobleme: Bei Blähungen, Sodbrennen oder Völlegefühl nach der Mahlzeit eine Wacholderbeere kauen.
BISHER ERSCHIENEN: Hopfen, Heckenrose, siehe www.natuerlich-online.ch

HÜLSENFRÜCHTE WIE LINSEN, BOHNEN, UND SOJA HABEN DAS POTENZIAL, DIE WACHSENDE WELTBEVÖLKERUNG ZU ERNÄHREN. IN DER SCHWEIZ FRISTEN SIE JEDOCH EIN NISCHENDASEIN. ZU UNRECHT, DENN EIN REGELMÄSSIGER VERZEHR KANN SOGAR VOR DIABETES UND KREBS SCHÜTZEN.
Text: GUNDULA MADELEINE TEGTMEYER
Mit ihrem Proteinreichtum ermöglichen Hülsenfrüchte eine ausgewogene Ernährung auch ohne Fleisch. Für den Anbau braucht es in der Regel keinen mineralischen Stickstoff, daher ist er per se mit weniger schädlichen Nebenwirkungen verbunden als der Anbau anderer Kulturen. Gemäss der Vereinten Nationen (UNO) spielen Hülsenfrüchte denn auch eine entscheidende Rolle für die Ernährungssicherheit – deshalb haben sie das Jahr 2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte ausgerufen. Und auch in der Gastronomie sind Linsensuppen und Erbseneintöpfe, einst als ArmeLeuteEssen verschrien, wieder hip.
Hülsenfrüchte sind die Früchte der Pflanzen der botanischen Familie der Fabaceen, auch Leguminosen genannt. Je nach Art stecken in den Hülsen 1 bis 12 Körner oder Samen von variabler Grösse, Form und Farbe. Zur Familie der Leguminosen zählen etwa 730 Gattungen und rund 20 000 Arten. Damit sind sie – nach Orchideen und Korbblütlern – die drittgrösste Pflanzenfamilie der Welt. Auch exotische Gewächse wie Tamarinde, Johannisbrotbaum und die Erdnuss sind mit unseren Hülsenfrüchten verwandt, die zu den ältesten Kulturpflanzen gehören.
Bereits im Neolithikum waren Hülsenfrüchte für die Menschen bedeutende Eiweisslieferanten und eine wichtige Ergänzung zum Getreide. Ursprünglich waren in Europa nur wenige Sorten bekannt, diese dafür schon in bronzezeitlichen Siedlungen, etwa in Savognin im Kanton Graubünden, wie ein archäologischer Fund auf dem südlich vom Ort gelegenen Padnalhügel belegt.
Brotersatz in Krisenzeiten.
Um Versorgungsengpässe auf seinen Reisen durch sein Reich zu vermeiden, erliess Karl der Grosse im Jahr 812 eine Landgüterverordnung nach dem Vorbild der Klostergärten, die «Capitulare de villis vel curtis imperialibus». Es ist die erste Land und Wirtschaftsordnung des Mittelalters. Im letzten Kapitel sind 89 Pflanzen und Heilkräuter aufgelistet, darunter die äusserst proteinhaltige Kichererbse, die die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung in Frankenreich verbessern sollte. Denn mit dem Untergang des Römischen Reiches im fünften Jahrhundert brach auch die medizinische Versorgung zusammen.
Die meisten Hülsenfrüchte haben ihren Ursprung in Ländern des Mittleren Ostens, in Mittel und Südamerika, Afrika und Asien, vor allem China. Der Anbau von Erbsen ist dort ab etwa 8000 v. Chr. belegt.
Neue Sorten eroberten im Laufe des 16. Jahrhunderts von Amerika aus Europa. In Dörfern um den Zürichsee wurden die nahrhaften Leguminosen im 17. Jahrhundert während Erntekrisen im Getreideanbau zu einem wichtigen Brotersatz. Ein kluger Entscheid, denn der Eiweissgehalt der Hülsenfrüchte ist rund doppelt so hoch wie der von Vollkorngetreide von Weizen, Hafer, Gerste und Reis.
Mit dem Erfolg der Kartoffel im 19. Jahrhundert verloren die Hülsenfrüchte in der Schweiz aber an Bedeutung. Und später, in Zeiten des Wirtschaftswunders, galt Fleisch als Statussymbol. Mit der Abkehr vom hohen Fleischkonsum gewinnen Hülsenfrüchte nun wieder an Bedeutung und Popularität. Sie sind eine erschwingliche und gesunde Alternative zu tierischem Eiweiss und spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der weltweiten Ernährungssicherheit.
Fleischersatz der Moderne. Viele vegetarische Alternativen zu Fleischgerichten entstehen auf Basis von Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen oder Soja. Sie sind eine fettarme Proteinquelle mit hohem Anteil an Ballaststoffen und niedrigem glykämischen Index. So lässt sich mit Bohnen, Erbsen und Co. der Fettleibigkeit zu Leibe rücken. Behandlungen von chronischen Krankheiten, wie etwa Typ2–Diabetes sowie Herzgefässerkrankungen können durch den regelmässigen Verzehr von Hülsenfrüchten unterstützt werden. Eine amerikanische Studie mit 121 Typ2Diabetikern zeigte, dass der tägliche Verzehr von 200 Gramm gekochten Hülsenfrüchten nicht nur die Blutfettwerte, sondern auch den Langzeitzuckerwert HbA1c sowie den Blutdruck verbessern kann. Zudem fördern die enthaltenen Ballaststoffe die Verdauung. Gesunde Ballaststoffe stecken übrigens fast ausschliesslich in Pflanzen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt den Verzehr von mindestens 30 Gramm pro Tag, für Diabetiker sogar mindestens 40 Gramm. Im Idealfall sollte gut die Hälfte aus Gemüse und Obst bestehen, der Rest aus Getreide, Nudeln und Reis.
Ein hoher Verzehr von Ballaststoffen beugt Funktionsstörungen des Darms wie Verstopfung vor. Da Hülsenfrüchte die Eigenschaft haben, Wasser zu binden und aufzuquellen, erhöhen sie das Stuhlvolumen. Das regt die Darmaktivität an, der Stuhlgang rutscht schneller durch den Darm; dadurch sinkt das Risiko für Dickdarmkrebs. Angenehmer Nebeneffekt: Durch das Aufquellen fördern Hülsenfrüchte ein Sättigungsgefühl

● ROTE LINSEN werden beim Kochen gelb. Sie schmecken leicht süsslich und eignen sich gut für Gemüsefüllungen. Garzeit von nur 10 Minuten.
● GELBE LINSEN sind geschält und eignen sich sehr gut für vegetarische Aufstriche. Garzeit von nur 10 Minuten.
● BERGLINSEN, auch Pardinalinsen genannt, haben eine graubraune Schale und schmecken sehr aromatisch. Sie eignen sich für fast alle Linsengerichte, wie beispielweise für ein herzhaftes Linsen Moussaka mit Auberginen. Garzeit um die 30 Minuten.
● SCHWARZE LINSEN, auch Belugaoder Kaviarlinsen genannt, sehen roh fast aus wie Kaviarperlen. Sie haben ein feines Maronenaroma und passen sehr gut zu Fischgerichten sowie als kulinarisches i Tüpfelchen in Salaten. Sie zerkochen nicht und sind in etwa 25 Minuten gar.
● TELLERLINSEN sind unsere Alltagslinsen. Mit einem Durchmesser von 5 bis 7 Millimeter sind sie die grössten aller Linsen. Sie brauchen auch die längste Kochzeit: 45 Minuten.
● PUY-LINSEN sind grün gesprenkelt und benannt nach der französischen Region Puy de Dome in der Auvergne. Da sie nicht zerfallen, sind sie die ideale Sorte für Linsensalat. Garzeit von 20 bis 30 Minuten.
● VOR ALLEM MENSCHEN mit empfindlichem Magen sollten Linsen – wie andere Hülsenrüchte auch – über Nacht einweichen. Ausnahmen: Rote Linsen müssen nicht eingeweicht werden, bei Gelben Linsen reicht eine Stunde. Besser erst nach dem Kochen salzen.
300 g Kichererbsen
300 g Hammel- oder Lammfleisch (Schulter oder Nacken, vorzugsweise mit etwas Fett)
1 TL Salz
1 EL Butterschmalz
1 EL Tomatenmark
½ TL gemahlener Kreuzkümmel
2 persische getrocknete Limetten
2 l Gemüsebrühe
1 Lammknochen (ca. 500 g)
1 grosse mehligkochende Kartoffel
2 Tomaten
1. Die Kichererbsen am Vortag mindestens 12 Stunden im kalten Wasser einweichen. Eine Stunde im Wasser vorkochen.
2. Das Fleisch in grobe Würfel schneiden und salzen. Das Butterschmalz in einem Topf erhitzen und die Fleischwürfel anbraten. Tomatenmark, Kreuzkümmel und Limetten (mit einem Messer anschneiden, dann geben sie mehr Aroma ab!) hinzufügen.
3. Die Kichererbsen durch ein Sieb abgiessen, unter fliessendem, kaltem Wasser abspülen und ebenfalls zugeben. Mit der Gemüsebrühe auffüllen, den Lammknochen hinzufügen und ca. 90 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch und die Kichererbsen weich sind.
4. Die Kartoffel schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Tomaten waschen, den Stielansatz entfernen und in Viertel schneiden. Die Kartoffelwürfel und die Tomaten dazugeben und nochmals 15 Minuten köcheln lassen.
5. Den Knochen und die Reste der Limetten (soweit diese nicht verkocht sind) entfernen, den Eintopf mit Salz und Kreuzkümmel abschmecken und in einem tiefen Teller anrichten.



















































Für 4 Personen
300 g weisse Bohnen
1 weisse Zwiebel
1 Knoblauchzehe
2 EL natives Olivenöl
500 ml Gemüsebrühe
½ TL Salz
5–6 Thymianzweige
1 Granatapfel
1 kleiner Bund Schnittlauch je ½ TL schwarzer und heller Sesamsamen
½ TL grobes Meersalz
1. Die Bohnen über Nacht im kalten Wasser einweichen.
2. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. 1 Esslöfel Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln sowie den Knoblauch glasig anbraten. Die Bohnen dazugeben und die Gemüsebrühe angiessen. Salz und 2–3 Thymianzweige hinzufügen und ca. 50 Minuten weich kochen.
3. Die Thymianzweige herausnehmen, die Kochflüssigkeit abgiessen, dabei eine Tasse auffangen, und die Bohnen zu einer cremigen Masse pürieren. Eventuell dabei etwas von der Kochflüssigkeit hinzufügen. Das Püree mit Salz nochmals abschmecken und das restliche Olivenöl unterrühren.
4. Den Granatapfel entkernen. Die Blättchen von den restlichen Thymianzweigen abstreifen. Den Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in 3 cm lange Stücke schneiden.







5. Zum Anrichten das Bohnenpüree auf den Teller geben und mit Thymianblättchen, Schnittlauch, Sesam, grobem Meersalz und Granatapfelkernen bestreuen.





und beugen Übergewicht vor. Zudem sind Hülsenfrüchte reich an Mineralien wie Eisen, Kalium, Magnesium und Zink und enthalten viele BVitamine. Gemäss dem Schweizer Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) soll ihre Folsäure helfen, das Risiko von Spina bifida, einer Neuralrohrfehlbildung bei Säuglingen, zu verringern; die Phytoöstrogene wiederum sollen die Symptome der Menopause mildern.
Enormes Potenzial.


Bestellen Sie das Buch «Mit einer Prise Orient» zum Vorzugspreis von Fr. 31.90 Fr. statt 39.90 (inkl. Versandkosten) beim AT Verlag, Bahnhofstrasse 41, 5000 Aarau, Telefon 058 200 44 10 oder unter www.atverlag.ch. Geben Sie beim Gutscheincode den Vermerk «Orient» ein. Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2016 und nur für die Schweiz.
______ Exemplar(e) «Mit einer Prise Orient» zum Vorzugspreis von Fr. 31.90 statt Fr. 39.90 (inkl. Versandkosten)
Name Vorname
Strasse, Nr.
PLZ/Ort
Datum
Unterschrift
Gut für Mensch und Natur. Die biologische Wertigkeit von tierischen Eiweissen wird von Ernährungswissenschaftlern mit 100 Prozent angegeben. In einem eigens zum «Jahr der Hülsenfrüchte» herausgegebenen Dossier klärt der LID darüber auf, dass pflanzliche Eiweisse diesen Wert nicht erreichen; ihre Eiweisswertigkeit könne aber durch Kombination mit anderen Nahrungsmitteln erheblich erhöht werden. Der LID führt folgendes Beispiel an: Isst man Bohnen mit Mais, wird der niedrige Methioningehalt der Bohnen durch den Methioninüberschuss im Mais ausgeglichen, während gleichzeitig der zu niedrige Lysingehalt im Maisprotein durch das im Bohneneiweiss reichlich vorhandene Lysin substituiert wird. Ein weiter Tipp: Hülsenfrüchte mit Getreide kombinieren. Auch so kann der Körper deutlich mehr Mineralien aufnehmen.
Hülsenfrüchte enthalten für den Menschen schwer verdauliche Zuckermoleküle, sogenannte Dreifachzucker wie etwa Raffinose. Diese können Blähungen verursachen. Ein einfaches Mittel beugt dem vor: über Nacht einweichen und mit Kurkuma, Fenchel, Kümmel oder Bohnenkraut kochen, bis sie gut durch sind.
Leguminosen sind nicht nur gesund für den Menschen, sondern auch für die Umwelt. Sie sind ihre eigene Stickstofffabrik, wovon der Boden, auf dem sie wachsen, enorm profitiert. Der Trick: Leguminosen gehen eine Symbiose mit Bakterien ein, die an ihren Wurzeln Stickstoff anreichern, natürlicher Dünger also. Und: Stehen Hülsenfrüchte auf dem Feld, kann der Boden besser Wasser speichern und somit Erosion entgegenwirken – in vielen Ländern ist das ein extrem wichtiger Aspekt.
Hülsenfrüchte sind anspruchslos, überstehen Dürre und Frost. Allerdings können sie starken Ertragsschwankungen unterliegen und kränkeln schnell. Dafür können sie trocken über ein Jahr gelagert werden, ohne dass sie ihren Nährwert verlieren. Somit könnten Ernteausfälle gepuffert werden.
Vor allem die Kichererbse preisen einige Ernährungswissenschaftler als Ernährungsbombe mit einem der niedrigsten GIWerte überhaupt. Der sogenannte glykämische Index ist ein Mass zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Je höher diese Wirkung ist, desto höher steigen der GIWert und damit der Blutzuckerspiegel. Kichererbsen bestehen etwa zu einem Fünftel aus Eiweiss, enthalten Vitamin A, B, C und E und sind reich an den beiden essenziellen Aminosäuren Lysin und Threonin. Auch Proteine sind für den menschlichen Körper existenziell. Ihre wichtigste Funktion ist der Aufbau von Körpergeweben. Der in den Aminosäuren enthaltene Stickstoff benötigt der Organismus für die Herstellung der DNA, verschiedene Aminosäuren dienen als Ausgangssubstanz für körpereigene Botenstoffe. Kichererbsen sind ein optimaler Proteinlieferant. Aus ihnen und dem Sesambrei Tahina wird in den Ländern des Mittleren Ostens das traditionelle Hummus hergestellt – ein Snack, der auch in unseren Breiten immer beliebter wird.
Auch wenn die Beliebtheit der Hülsenfrüchte zunimmt, so fristen sie in Europa ein Nischendasein. In der Schweiz macht die Anbaufläche gemäss LID weniger als drei Prozent der Körnerfruchtfläche aus! Zum weltgrössten Exporteur wurde in den letzten 35 Jahren Kanada. «Auch wenn die Schweiz nicht über dieselben Möglichkeiten zum grossflächigen Anbau verfügt wie Kanada, wäre ein hoher Selbstversorgungsgrad mit Hülsenfrüchten zur Humanernährung möglich», kommentiert der LID, weist aber auch darauf hin, dass der Anbau nicht ohne Tücken ist: die Unkrautunterdrückung sei schlecht, Krankheiten wirkten sich ertragsermüdend aus und die Abhängigkeit der Ernteerträge vom Witterungsverlauf sei gross. Vor allem aber, so der LID, sei der Anbau bislang nicht lukrativ – denn Anbaubeiträge für Linsen, Kichererbsen und Co. sind, obwohl in der offiziellen Ernährungspyramide weit oben, nicht vorgesehen. Dennoch versuchen einige Bauern die Marktlücke für sich zu erschliessen und der steigenden Nachfrage nach Hülsenfrüchte gerecht zu werden, wie etwa der Anbau von Linsen in der Westschweiz und von Lupinen im Mittelland zeigen (siehe «natürlich» 07/082016). ◆



4
1
Warm, wasserdicht und erst noch atmungsaktiv
Aus der Columbia Titanium Kollektion stammend und ausgestattet mit der OutDry™ Extreme Technology, ist das die erste Regenjacke, die sowohl Atmungsaktivität als auch Wasserdichtheit garantiert. Ganz egal, welches Abenteuer da draussen auf Sie wartet, überzeugt diese Jacke mit einer hervorragenden Isolierung.
Preis Fr. 350.–. www.columbiasportswear.ch
2
Daunenjacke für echte Abenteurerinnen
Wer bei winterlichen Temperaturen in entlegenen Gebieten unterwegs ist, der muss sich voll und ganz auf seine Ausrüstung verlassen können. Die lang geschnittene und mit Daunen gefüllte Singi Down Jacket von Fjällräven bietet exakt diese Verlässlichkeit und Langlebigkeit, um sorgenfrei zu Winterabenteuern bei selbst eisiger Kälte aufzubrechen.
Preis Fr. 700.–. www.fjallraven.com
3



5
6 5 1
2 3
gloryfy G14 – Lifestyle trifft Hightech
Markant in der Formsprache zeigen sich die Modelle der gloryfy-G14-Serie. Die charakterstarken Sonnenbrillen «Made in Austria» kombinieren zeitgeistiges Produktdesign mit unzerbrechlichen HightechEigenschaften: Bügel, Rahmen und Linsen der Brille sind dank des eigens entwickelten High-End-Polymers NBFX unzerbrechlich und gehen durch den Memory Effect des Materials immer wieder in die Ausgangsform zurück.
Preis Fr. 159.90. www.gloryfy.ch
4
Sehen und gesehen werden im Winter
Die Imjin 800 von Light & Motion ist der neue Stern am Lampenhimmel. Die kompakte, 85 Gramm leichte Lampe mit externem Akku bietet eine Leuchtkraft von 800 Lumen und leuchtet je nach Modus 2 bis 16 Stunden. Zwei kleine Dioden an den Seiten sorgen für seitliche Sichtbarkeit. Die Halterung erlaubt eine Befestigung am Lenker und auf dem Helm. Preis Fr. 249.–. www.lightandmotion.com
Leicht, warm und erst noch topmodisch
Die klein verpackbare Isolationsjacke Pheriche des Schweizer Outdoor-Brands Sherpa ist die ideale Begleiterin für kalte Tage. Die Isolierung mit Kunstfasern macht die Jacke unkompliziert, pflegeleicht und wärmt auch in feuchtem Zustand. Der Wind bleibt zuverlässig draussen und Wasser lässt sie abperlen. Die Jacke gibt es in der Farbe schwarz und olive. Preis Fr. 179.–. www.sherpaoutdoor.com
6
Echter Sonnenschutz aus Neuseeland
Der Sonnengel Skinnie mit Lichtschutzfaktor 30 aus Down Under ist frei von Parabenen, Konservierungsstoffen, Emulgatoren sowie Duftstoffen. Die Produkte werden nicht an Tieren getestet und alle Verpackungen sind recycelbar. www.skinnies.ch Produkte News

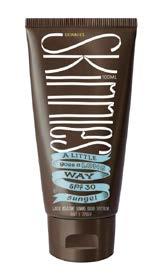







VON WEGEN «HOCH OBEN UND PRIMITIV EINGERICHTET»! DIE ÜBER 160 HÜTTEN DES SCHWEIZER ALPENCLUBS SAC HABEN IN DEN LETZTEN JAHREN MÄCHTIG AUFGERÜSTET, OHNE DABEI DIE VON VIELEN GESCHÄTZTE URSPRÜNGLICHKEIT ZU VERLIEREN. «NATÜRLICH» ERKLÄRT, WAS BEI EINEM HÜTTENBESUCH VON IHNEN ERWARTET WIRD UND WAS SIE ERWARTEN DÜRFEN.
Text: TOMMY DÄTWYLER
In den Dörfern und Städten wird es immer enger, der Druck auf Erholungsgebiete immer grösser. Das ist auch in den Bergen spürbar. Wo man dem Nebel entfliehen und die Natur noch ursprünglich erfahren kann, prallen immer mehr unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Die einen suchen Ruhe und familiäre Gemütlichkeit, die anderen Fun und Action. In den über 160 Hütten des Schweizer Alpenclubs SAC treffen sich die einen wie die anderen – und das rund 330 000 Mal pro Jahr. Dabei wird der rücksichtsvolle Umgang untereinander zur Pflicht, die gegenseitige Hilfe und die wertschätzende Begegnung sind ein Qualitätsmerkmal. Was auf den ersten Blick als selbstverständlich erscheint, ist in der Realität nicht immer der Fall. Nicht selten beruhen Auseinandersetzungen auf Missverständnissen.
Für jedermann offen «Die über 160 SAC-Hütten stehen allen Bergbegeisterten offen, Bergsteigern, Wanderern, Mountainbikern und natürlich auch Familien mit Kindern», erklärt Bruno Lüthi, Hüttenobmann beim SAC. Will jemand während der Saison auf der Hütte übernachten, ist eine telefonische Anmeldung oder eine Buchung der Schlafplätze direkt beim entsprechenden Hüttenwart dringend empfohlen, denn vor allem an den Wochenenden und in der Wandersaison sind die Hütten sehr gut frequentiert und nicht selten ausgebucht. Fast die Hälfte der rund 160 Hütten kann man auch online buchen: auf www.saccas.ch können Schlafplätze und Mahlzeiten reserviert und Reservationen geändert oder annulliert werden. Die anderen Hütten respektive ihre Warte sind per Telefon erreichbar. Ist die Hütte bewartet, muss in der Regel ein Halbpensions-Arragement (Nachtessen/ Übernachtung/Morgenessen) gebucht werden. SAC-Mitglieder erhalten gegen Vorweisung ihres Mitgliederausweises Rabatt. Billig sind Hüttenübernachtungen nicht. Es gilt aber zu bedenken, mit wie viel Aufwand Esswaren und Getränke in die Hütte transportiert werden müssen und unter welchen Bedingungen auf dem Berg gearbeitet wird. Die Gegenleistung entschädigt für vieles: Hüttenübernachtungen sind eine wertvolle Erfahrung und bleibende Erinnerung.
Verhindert? Frühzeitig abmelden Weil in den letzten Jahren immer mehr Berggänger unentschuldigt ferngeblieben sind und deshalb immer öfters «für die Katz» gekocht wurde, muss eine «Fernbleibe-Ge -
bühr» bezahlen, wer eine Reservation bis am Vorabend nicht absagt. Dabei handelt es sich gemäss Bruno Lüthi nicht um eine Busse, sondern um einen «Selbsthilfeakt der Hüttenwarte». Diese sind – um ihren Lebensunterhalt zu verdienen – quasi als Pächter der Hütten auf jede Übernachtung angewiesen und spüren es direkt, wenn die halbe Hütte wegen nicht stornierter Reservationen leer bleibt. Die sogenannte No-Show-Gebühr beträgt meist rund 20 Franken und ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der einzelnen Hütten ersichtlich. «Für wetterbedingte Absagen haben wir Verständnis», betont Lüthi. «Es tut aber weh, wenn ich einer Gruppen absage, weil das Haus voll gebucht ist, am Schluss aber doch noch Schlafplätze übrig sind, weil Angemeldete nicht erschienen sind.» Immerhin, dank guter Information habe die Zahl der eingeforderten Ausfallentschädigungen in den letzten Jahren in einem vertretbaren Mass gehalten werden können.
Die Anzahl Übernachtungen seien in den letzten Jahren zunehmend stärker vom Wetter abhängig geworden, stellt Lüthi fest. «Genauere Wetterprognosen haben die Anforderungen ans Bergwetter in die Höhe geschraubt. Wenn im Fernsehen für den nächsten Tag ein Gewitter angesagt ist, hat das direkten Einfluss auf die Zahl der Annullierungen, obwohl dann von eben diesem Gewitter tags darauf oft gar nichts zu sehen ist – genauso wie von den ursprünglich angemeldeten Gästen. Damit müssen wir Hüttenwarte leben.»
Was darf der Gast erwarten?
Wer einen Hüttenbesuch plant oder in einer SAC-Hütte übernachten möchte, darf – neben einem freundlichen und hilfsbereiten Hüttenwart oder einer charmanten und kompetenten Hüttenwartin – eine saubere Hütte und einen sauberen Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer, oft sogar mit Duvet, erwarten. Ein persönlicher Seidenschlafsack ist Pflicht; in den meisten Hütten kann ein solcher gekauft werden. Ja, die Zeit der kratzigen Wolldecken ist vorbei. Und immer mehr Hütten verfügen über kleinere (Familien-)Zimmer, auf die das Prädikat «Massenschlag» nicht mehr zutrifft. Einige Hütten werben unterdessen sogar mit Zweierzimmern. Und die Hüttenwarte haben sich in den letzten 25 Jahren dank einheitlicher Ausbildung zu professionellen Gastgebern «gemausert».
Das Leben als Gastgeber auf einer SACHütte unterscheidet sich in vielfacher Hin-
sicht vom Leben eines Gastwirtes im Tal. Jedes Kilo Ware muss per Helikopter transportiert, jeder Liter Wasser aufbereitet und jedes Grad Wärme vor Ort aufwändig mit Holz oder Gas produziert werden. Wasserversorgung und Abfallbewirtschaftung, die Instandhaltung des Hüttenweges sowie Reparaturen der technisch immer komplizierteren Apparaturen halten die Hüttencrew auch dann auf Trab, wenn wegen schlechten Wetters nur wenige Gäste auf der Hütte sind.
Trotzdem dürfen Hüttengäste auch aus der Küche jederzeit überzeugende Kost erwarten. Eine Suppe, ein Salat, ein Hauptgang mit oder ohne Fleisch und ein Dessert gehören laut Bergführer Bruno Honegger, Hüttenwart der Maighelshütte (GR) dazu. «Vielleicht ein wenig einfacher als im Tal», ergänzt seine Frau Pia, «aber mit viel Liebe zubereitet.» Zur Halbpension gehört auch ein währschaftes Zmorge. Wer danach fragt, bekommt einen Tee oder einen ganzen Lunch für unterwegs.
Meist sind es die gemütlichen Stunden mit alten und neuen Freunden in der Hüttenstube oder vor der Hütte, die einen Hüttenaufenthalt zum Erlebnis machen. «Wie sich Gäste untereinander verhalten, entzieht sich unserer Verantwortung. Wir greifen nur im Notfall ein», sagt Honegger.
Was vom Gast verlangt wird
Damit der Aufenthalt unter heimeligem Dach im Schatten der Berge für alle zu einem erholsamen Erlebnis wird, gibt es ein paar «eiserne Regeln». Die Nachtruhe –meist um 22 Uhr – ist genauso einzuhalten wie die Regel, dass keine Ausrüstungsgegenstände ins Schlafzimmer mitgenommen werden; essen im Zimmer ist aus hygienischen
Die Top 5
der meistbesuchten Hütten (Übernachtungen 2015): Britanniahütte (VS) Lämmerenhütte (BE) Monte-Rosa-Hütte (VS) Tracuithütte (VS) Blüemlisalphütte (BE)
Mitglieder SAC
gesamtschweizerisch: rund 150 000
Hütten und Biwaks: gegen 170
Bewartete Hütten: 120
Schlafplätze: 10 000
Übernachtungen
pro Jahr: rund 320 000
Anzahl Tagesgäste: über 1 Million
Gründen nicht erlaubt. Grundsätzlich gilt, was auch unten im Tal für gute Stimmung sorgt: Rücksichtnahme! «Im Normalfall», erklärt der Hüttenwart der Tierberglihütte, Bergführer Hans-Peter Imboden, «im Normalfall begegnen sich die Hüttengäste sehr zuvorkommend und freundschaftlich.» Ausnahmen gebe es zwar immer wieder, genauso wie jedes Jahr ein oder zwei Gäste behaupteten, auf der Hütte bestohlen worden zu sein. Bei solchen Fällen sei er machtlos, meint Imboden. «Aber oft findet ein Diebstahl bloss im Kopf des Bestohlenen statt. Es ist nicht immer einfach, am Morgen im Dunkeln oder im Licht der Taschenlampe alle seine Sachen zu finden.» Der Hüttenwart rät deshalb: Den Rucksack packen, solange es hell ist.
Als «ärgerlich und beschämend» bezeichnet Hüttenobmann Bruno Lüthi den Umstand, dass immer wieder mal eine Hütte aufgebrochen sowie Mobiliar mutwillig zerstört wird und Notreserven aufgebraucht oder gar gestohlen werden. Dies vor allem in der Zwischensaison, wenn die Hütten nicht bewartet und wenig kontrolliert sind. In Hütten mit separaten Winterräumen für Selbstkocher werde bisweilen auch übernachtet und Holz verbrannt, ohne Geld dafür in die Kasse zu legen. Für solcherlei Verhalten haben Hütteninhaber (SAC-Sektionen) und Hüttenwarte kein Verständnis. An der sprichwörtlichen Gastfreundschaft aber sollen solche Erfahrungen nichts ändern.
Wo die Regeln eingehalten werden, herrscht normalerweise auch die sprichwörtliche Hüttenfreundschaft vor: ein von Respekt geprägter Umgangston, freundliche, wenn auch ab und zu müde Gesichter und die Gewissheit, in der Hütte inmitten der grandiosen Berglandschaft gut aufgehoben zu sein. ◆

Die älteste Hütte:
Grünhornhütte (2448 m ü. M., GL). Sie wurde 1863, im Gründungsjahr des SAC, erstellt.
Die am besten besuchte Hütte: Britanniahütte (3030 m ü. M., VS). Knapp 10 000 Besucher pro Jahr.
Die höchst gelegene Hütte: Solvayhütte (4003 m ü. M., VS). Schutzhütte am Matterhorn.
Die Margherita-Hütte im Monte-RosaGebiet (4554 m ü. M.), ebenfals eine Schutzhütte, steht auf italienischem Boden.
Die höchst gelegene bewartete Hütte: Cabane de la Dent Blanche (3507 m ü. M., VS).
Die kleinste bewartete Hütte: Seetalhütte (2065 m ü. M., GR). 16 Schlafplätze.
Die tiefst gelegene Hütte: Treschhütte (1475 m ü. M., UR).
Die modernste Hütte: Neue Monte-Rosa-Hütte (2883 m ü. M., VS).
Planung – was habe ich vor?
Eine sorgfältige Vorbereitung schützt vor unliebsamen Überraschungen. Planen Sie Route, Zeitbedarf (inklusive Zeitreserven) sowie mögliche Ausweichrouten. Berücksichtigen Sie dabei Anforderungen, Wegverhältnisse und Wetter. Informieren Sie Dritte über Ihre Tour, besonders wenn Sie alleine unterwegs sind.
Einschätzung – eignet sich die Wanderung für mich? Überforderung steigert das Unfallrisiko und schmälert den Genuss! Bergwanderwege (weiss-rot-weiss markiert) sind teilweise steil, schmal und exponiert und erfordern Trittsicherheit. Schätzen Sie ihre Fähigkeiten realistisch ein und stimmen Sie Ihre Planung darauf ab. Unternehmen Sie schwierigere Touren in einer Gruppe.
Ausrüstung – habe ich das Richtige dabei? Wanderwege können rutschig sein. Tragen Sie feste Wanderschuhe mit Profilsohlen. Nehmen Sie Sonnen- und Regenschutz sowie warme Kleidung mit. Das Wetter kann in den Bergen sehr schnell umschlagen. Aktuelles Kartenmaterial, Taschenapotheke und Mobiltelefon mit den richtigen Apps sind hilfreiche Begleiter. Werden Sie (versichertes) Mitglied bei der Rettungsflugwacht (Rega). Das Geld ist gut investiert.
Kontrolle – bin ich noch gut unterwegs?
Müdigkeit kann die Trittsicherheit stark beeinträchtigen. Legen Sie regelmässig Pausen ein und verpflegen Sie sich so, dass Sie leistungsfähig und konzentriert bleiben. Beachten Sie ihren Zeitplan und die Wetterentwicklung. Kehren Sie wenn nötig rechtzeitig um.















Nassk altes Herbstw etter, eisige Te mperaturen und winterliche Landschaften – die perfekte Zeit für wa rm ge fütterte und we tterfeste Wi nter schuhe vo n LO WA Gerade in der Übergangszeit bieten die Cold We ather Boots eine perfekte Ko mbination aus idealer Pa ssform, bester Isolation und optimalem Grip auf rutschigem Un tergrund. Aber auch im harten Wi ntereinsatz wissen die ro busten Beg leiter zu überzeugen, halten sie die Füsse doch zuv erlässig trock en und wunderbar wa rm.











Der SEATTLE GT X ® QC ge ht als bequemer Freizeitsneak er im natürlichen Ru gged-Outdoor-Look nicht nur mit der Zeit, sondern ist dank des Material-Mix es aus Canv as, Jeans und Glattleder mit GORE-TEX ®-Membran auch funktional absolut up to date.











We r einen klassischen Wi nter stiefel mit breitem Einsatzgebiet sucht, der liegt mit dem DISENTIS GT X ® MID ge nau richtig. Der Schuh ist bestens ge eignet für ka lte Bedingungen. Bei Schnee und Eis spielt das GORE-TEX ® Pa rtelana Fu tter seine Stärk en vo ll aus.










Ausgedehnte Wi nter spaziergä nge liegen dem LEVENTINA GT X ® MID Ws ebenso wie der Stadtbummel und der Skiurlaub in den Berge n. Das GORE-TEX ® Pa rtelana Fu tterlaminat spielt seine Vo rzüge bei den unwirtlichsten We tter ve rhältnissen bestens aus und sorgt für ein wa rmes und trock enes Innenklima.











Dieser klassische Wi nter-Schlupf stiefel ist mit wa sserdichtem und kuschelig-w armen GORE-TEX ® Pa rtelana Fu tterlaminat ausgestattet, das für garantiert trock ene und wa rme Füße sorgt. Der wider standsf ähige Schaft trotzt auch den härtesten Beanspruchungen, denen unternehmungslustige Kids ihre Schuhe beim To ben, Schlittern und Ro deln aussetzen.











Dieser coole Girls-Wi nter-Boot zeigt sich in angesagter Sno wboard-Optik und ist der perfekte Beg leiter für Ro delnachmittage und ausgelassene Schneeballschlachten. Der mittelhohe Schaft aus anschmiegsamem Ve lour sleder und strapazierf ähigem Te xtilmaterial unter stützt die perfekte Pa ssform.












Der MAINE GT X ® QC Ws ist als Freizeitsneak er ein modischer Allrounder für trendbe wusste Damen, die viel We rt auf Ko mfort legen. So hält der funktionale Materialmix aus Canv as, Jeans und Glattleder mit GORE-TEX ®Membran die Füsse zuv erlässig trock en, wä hrend der mit Tw eed abgesetzte Schaft für optische Akzente sorgt.





Früher wurden sie als «Stockenten» belächelt.
Heute schätzen viele Wanderer die Vorzüge von Wanderstöcken. Richtig eingesetzt schonen sie die Gelenke und Muskulatur.
Text: TOMMY DÄTWYLER
Der Weg ins Tal ist für viele Wanderer eine Qual. Schlotternde Knie und ein zünftiger Muskelkater drohen. Wanderstöcke könnten das verhindern, sagt Sportarzt und Gebirgsmediziner Urs Hefti von der Berner Swiss Sportclinic : «Die von den Beinen zu leistende Bremsarbeit beim Abwärtsgehen ist für die Kniegelenke und ihre Muskeln eine sehr grosse Belastung.» Vor allem weniger gut trainierte Wanderer würden beim Abwärtsgehen schnell einmal ihre Gelenke und die Muskulatur überlasten, so Hefti. «Die wirkenden Spitzenkräfte können ein Mehrfaches des eigenen Körpergewichts betragen. Besonders belastet wird dabei das Kniegelenk.» Bekannt ist der «Chnüüschlotteri»: Beschwerden, die durch ungenügend trainierte und erschöpfte Beinmuskulatur entstehen, wenn beim Abstieg die auf Stossbelastung empfindlichen Kniegelenke nicht mehr ausreichend abgefedert werden können. Von den Folgen kann fast jeder ein Liedchen singen: Knieschmerzen, Muskelermüdung und Muskelkater. Trekking oder Wanderstöcke können gemäss Sportarzt Urs Hefti diese Belastungen reduzieren.
Nur ein Stock bringt nichts
Studien haben gezeigt, dass rund 30 Prozent der Berggänger mindestens zeitweise über Schmerzen in den Kniegelenken klagen –und dass richtig eingesetzte Wanderstöcke Muskulatur und Kniegelenke um bis zu 22 Prozent entlasten können. Das entspricht bei einer achtstündigen Durchschnittstour einer Gewichtsentlastung von 250 Tonnen! Vom Stockeinsatz profitieren nicht nur Oberschenkel und Knie, auch andere Gelenke und die Wirbelsäule werden entlastet, sofern die Stöcke richtig eingesetzt werden. Stöcke entlasten gemäss Hefti nämlich nur, wenn man beim Abstieg beide Stöcke gleichzeitig parallel vor dem Körper absetzt, den Oberkörper in Vorlage bringt und die Beine anwinkelt, um die Stöcke weit nach vorne zu setzen. «Ein einzelner Stock bringt eher Unruhe in den Bewegungsablauf und gefährdet so das Gleichgewicht.» Beide oder keinen, lautet hier also die Devise.
Auch beim Bergaufgehen können verstellbare Wanderstöcke, sogenannte Teleskopstöcke, Hilfe und Unterstützung leisten: Sie haben – eher kurz eingestellt – beim Hochsteigen eine ermüdungsreduzierende Funktion: Arm und Schultermuskulatur unterstützen und entlasten die Beinmuskula
Wann macht der Stockeinsatz Sinn?
● Verwenden Sie Stöcke vor allem dann, wenn es die Gelenke auch wirklich benötigen. Verzichten Sie gelegentlich bewusst auf Stöcke, besonders wenn Sie sich schon daran gewöhnt haben.
● Trainieren Sie auf flachen Passagen Muskeln und Koordination ohne Stöcke.
● In schwierigem Gelände und insbesondere wenn zum Vorwärtskommen die Hände gebraucht werden, gehören die Stöcke in den Rucksack.
● Teleskopstöcke und ihre Verschlüsse müssen regelmässig kontrolliert werden. Zusammenrutschende Stockteile führen häufig zu Stürzen und Unfällen.

tur. Der gleichmässige Stockeinsatz führt zudem zu einer entspannenden, ruhigen Atmung, wodurch wiederum die Ausdauer erhöht wird. Dazu trägt auch der aufrechte Gang bei, der die Lungenventilation verbessert. Bei kurzen Steilpassagen fasst man einfach unterhalb des Griffs – so muss man den Stock nicht extra verkürzen. Manche Modelle sind deshalb mit verlängerten Griffzonen ausgestattet. Gemäss Hefti werden die Stöcke beim Bergaufgehen oft zu lang eingestellt. «Das erschwert die Durchblutung von Händen und Vorderarmen.» Wanderstöcke eignen sich übrigens auch dazu, nach einem Unfall ein gebrochenes Bein oder einen verletzten Arm ruhigzustellen, wie mit einer Schiene. Dazu die Stöcke auf beiden Seiten ober und unterhalb des Bruches oder der Verletzung eng anbinden.
Zuviel ist ungesund
Der ständige Stockeinsatz kann aber auch negative Folgen haben, gibt Hefti zu bedenken. «Wer ständig mit Teleskopstöcken unterwegs ist, riskiert, dass wichtige Fähigkeiten wie Koordinationsvermögen und Gleichgewichtssinn verkümmern.» Erfahrungen hätten gezeigt, dass nach mehrmonatigem Gehen auf «vier Beinen» das Balancegefühl auf zwei Beinen stark beeinträchtigt wird. «Das Gehen ohne Stöcke fällt nach langem Stockeinsatz schwer, weil die Koordination zum Halten des Gleichgewichts neu gelernt werden muss. Man fühlt sich ohne Stöcke verloren und unsicher.» Einer solchen Entwicklung gelte es vorzubeugen. Hefti empfiehlt deshalb, ab und zu bewusst auf die Stöcke zu verzichten. ◆
Der rechte Winkel ist massgebend: Stöcke vor die Füsse auf den Boden stellen. Der Unterarm muss einen rechten Winkel zum Ende der Stöcke bilden.
Zum Wandern werden mit Vorteil Wanderstöcke benutzt, die in der Länge meistens verstellbar sind. Zum Walken die etwas längeren Walkingstöcke, die sich oft in der Länge nicht verstellen lassen.
Die Teller am unteren Ende der Wanderstöcke können bei den meisten Modellen ausgewechselt werden. Im Sommer ist der kleine Teller der richtige, im Winter der grosse. Es gibt auch Einheits grössen, die für Winter und Sommer geeignet sind.


Kunststoff ist schwer, im Sommer schwitzt man schnell, das begünstigt Blasen, im Winter ist der Griff kalt, mit Handschuhen unter Umständen wenig griffi g. Kork bietet ein angenehmes Griffgefühl, wird allerdings schnell speckig. EVA-Schaum ist ein Hightechmaterial: sehr leicht, griffi g, angenehm. Es kann aber zu Abfärbungen kommen. Schaumstoffgriffe sind eher bei teuren Stöcken zu fi nden.

Karbon ist ein Hightechmaterial und viel leichter als Aluminium. Karbonstöcke brechen jedoch leicht und sind nicht recyclierbar, sondern einmal ausgemustert Sondermüll. Achten Sie beim Kauf ihrer Teleskopstöcke vor allem auf einen zuverlässigen Klemmmechanismus.





Eine Winterwanderung durch das ruhige Goms entpuppt sich als Kultur- und Genusstour.
Text: HEINZ STAFFELBACH

URIG / In manchen der jahrhundertealten, wettergegerbten Häuser kann man übernachten und speisen.
IM GOMS ist alles ein bisschen anders. Das Goms liegt zwar ganz zuoberst im langgezogenen Rhonetal und könnte sich damit durchaus mit dem Label «Top of Wallis» schmücken. Es bietet ursprüngliche Natur, vorbildlich erhaltene Dorfbilder und direkten Blick auf das mächtige Weisshorn. Und es ist Heimat des grossen Hotelpioniers Cäsar Ritz, dem Gründer der RitzHotels in Paris, London und Madrid, und der Hoteldynastie Seiler. Ganz schön mondän. Trotzdem scheint sich das Goms in einer Art Dornröschenschlaf zu befinden. «Brachliegendes Potenzial» würde der Tourismusexperte mit hochgezogenen Augenbrauen bemerken. «Unverbrauchtes und authentisches Wallis», denkt der Wanderer, der im alten Dorf Blitzingen steht, umgeben von jahrhundertealten, wettergegerbten Häusern, plätschernden Dorfbrunnen und knorrigen Apfelbäumen, die auf einen weiteren Frühling warten.
KULTUR- UND GENUSSTOUR. Etwas anders ist auch das Winterwandern im Goms. Zwischen Oberwald, am oberen Ende des Tales, und Niederwald erstreckt sich mit etwa 20 Kilometern Länge einer der längs
ten Winterwanderwege der Schweiz. An der Route reihen sich etwa ein Dutzend Dörfer aneinander wie Perlen auf einer Schnur, regelmässig alle paar Kilometer, meist auf der Sonnenseite des Tales. Fast jedes bietet mindestens ein Hotel und ein Restaurant, natürlich eine Kirche und einen eigenen Bahnhof.
Aus der Ferne ähneln sie sich sehr mit ihren Zeilen aus schwarz gebrannten Häusern und weissen Kirchen. Und doch hat jedes Dorf seinen eigenen Charakter und seine eigene Ausstrahlung. So kann man eine Winterwanderung von Oberwald nach Niederwald zu einer Kulturtour machen und sich ein paar der Dörfer genauer ansehen. Oder zu einer Genuss und Gastronomiewanderung. Dazu geniesse man zum Beispiel im «Gommerhof», im «Spycher» oder in der «Walliser Sonne» ein Raclette, eine Cholera (gedeckter LauchKartoffelKuchen) oder ein Fondue.
UNBESTEIGBARE GIPFEL. Anders – und mit Bestimmtheit unerwartet – ist auch das Schneeschuhlaufen im Goms, jedenfalls wenn man es so praktiziert, wie es hier vorgeschlagen wird. Natürlich könnte
man von jedem der Dörfer einfach in die Berge hochsteigen – in regelmässigem Abstand reihen sich hier schliesslich weite, anmutige Bergrücken aneinander. Dass weiter oben aber wilde Bergwelten warten, das ahnt man auch ganz unten im Tal. Und doch sollte man wissen, worauf man sich bei einer solchen Tour einlässt. Zuerst ist man nämlich meist für eine ganze Weile im Wald unterwegs – falls dieser überhaupt begehbar ist, denn die meisten Wälder auf beiden Talseiten sind Wildschutzgebiete.
Hat man eine begehbare Route gefunden und es bis über die Waldgrenze geschafft, geht es erst mal steil weiter. Hat man schliesslich den Berg erreicht, entpuppt sich dieser lediglich als Vorgipfel; ist man auf dem nächsten, stellt man abermals dasselbe fest. Hat man dann endlich und definitiv den Gipfel vor sich, entpuppt sich dieser als unbesteigbar, während es inzwischen links und rechts vom Bergrücken atemberaubend steil in die Tiefe geht.

RUHIGE FLACHWANDERUNG. Nein, eine solche Tour wird dem Goms eigentlich gar nicht gerecht. Viel besser, und mit Bestimmtheit genüsslicher, ist dies: In Oberwald starten und nach Lust und Laune den eigenen Weg durch das lange, meistens angenehm breite und kaum bebaute Tal suchen. Einmal parallel zur Langlaufloipe die Rhone entlang, einmal schnurgerade über eine weite Ebene, einmal kurz auf dem Winterwanderweg durch ein Wäldchen.
Für Winterwanderinnen und Schneeschuhläufer gut zu wissen: Eine Tour durch das Goms kann man durchaus in beide Richtungen unternehmen. Da der Höhenunterschied zwischen Ober und Niederwald trotz 16 Kilometer Distanz nur gerade 120 Meter beträgt, wird man auch bei einer Wanderung talaufwärts die Steigung kaum bemerken. Wer talabwärts wandert, hat die Nachmittagssonne im Gesicht und die mächtige Pyramide des Weisshorns als Fixpunkt am Horizont. Wer talaufwärts unterwegs ist, hat am Nachmittag die Sonne im Rücken und vor sich die steile Kuppe des Galenstocks als ständigen Begleiter. Schön sind beide Varianten. ◆
GEMÜTLICH / Eine Winterwanderung – mit oder ohne Schneeschuhe – durch das kaum bebaute Goms ist wenig beschwerlich.

Einer der längsten Winterwanderwege der Schweiz. Kaum Höhenunterschiede und auch für Schneeschuhläufer ein Genuss.
AN- UND ABREISE
Alle Dörfer im Goms haben einen Bahnhof. Der Zug verkehrt im Stundentakt. Man kann also nach Belieben irgendwo die Tour beginnen oder beenden. Und je nach Zeit und Laune die Nacht in einem der Dörfer verbringen.
WINTERWANDERUNG
Anfahrt und Ausgangspunkt: Mit dem Zug nach Oberwald.

1. Tag, Münster: Vom Bahnhof südlich zur Rhone und stets in der Nähe des Flusses via Obergesteln, Ulrichen und Geschinen nach Münster.
Länge 9,5 km, je 30 m Auf- und Abstieg, 2 ¾ Std.
2. Tag, Niederwald: Beim Hotel Diana am westlichen Dorfende auf dem Winterwanderweg oberhalb der Kantonsstrasse nach Reckingen. Beim Bahnhof weiter, in der Nähe der Bahnlinie, nach Gluringen, durch das alte Dorf und an der Muttergotteskapelle vorbei nach Ritzingen. Durch das Dorf zur
Bahn und südlich von ihr nach Blitzingen. Hoch zum Dorf und etwas oberhalb der Kantonsstrasse nach Niederwald.
Länge 10,3 km, 70 m Aufstieg, 170 m Abstieg, 3 Std.
DIE SCHNEESCHUHTOUREN
Die Routen für Schneeschuhläufer verlaufen dem Winterwanderweg entlang. Flexibel sein ist die Devise. Es gibt sechs markierte Schneeschuh-Trails von 1½ bis 4 ½ Std.
UNTERKÜNFTE
In allen Dörfern (ausser in Geschinen und Selkingen) gibt es ein oder mehrere Hotels. Informationen finden sich im Internet und bei Goms Tourismus.
KARTEN
Landeskarte 1: 25 000, 1250 Ulrichen, 1270 Binntal Landeskarte 1: 50 000, 265 oder 265 S Nufenenpass
INFORMATIONEN
Goms Tourismus, 3984 Fiesch, Tel. 027 971 10 70, www.goms.ch, Gästecenter Obergoms, Im Kehr, 3985 Münster, Tel. 027 974 68 68, www.obergoms.ch
eine von fünf leuchtstarken und wasserdichten Taschen- und Velolampen Light & Motion Deckhand 350 im Wert von je 90 Franken. Egal ob Sie Ihren Outdoorausflug im Schnee, im Regen, am oder auf dem Wasser planen –die Deckhand 350 liefert genau das Licht, das Sie brauchen, und passt dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Abmessung in jede Hosentasche und in jeden Rucksack. Der hochleistungsfähige
Lithium-Ionen-Akku lässt sich via Micro-USBAnschluss aufladen.
+ Mehr Infos unter www.lightandmotion.com




















Als Zusatzpreis gibt es dreimal zwei Paar Socken X-SOCKS Trekking Silver.


In welchem Tal liegt das Goms?
A: Rhonetal
B: Simmental
C: Rheintal
Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
So nehmen Sie am Wettbewerb teil: Mit nebenstehendem Bestellcoupon oder gratis im Internet unter www.natuerlich-online.ch/wettbewerb


«Wandern und geniessen im Winter» bietet 30 ausgewählte Winter wanderungen mit und ohne Schneeschuhe in der Schweiz mit Berg hotel-Komfort. Alle wichtigen Routen, Adressen und praktische Infos runden jede der vorgeschla genen Wanderungen ab, so dass Sie morgen schon starten können.
Bestellen Sie das Buch aus dem AT-Verlag zum Vorzugspreis von Fr. 47.90 statt Fr. 59.90.

Auflösung aus Heft 09 -2016: A: BE / VS


Je eine Stanley Adventure Flasks haben gewonnen:




+ Stefan Amacker, Eischoll; Martin Lampart, Zofingen; Rolf Goldschmidt, Oberwil BL; Gertrud Hiltbrunner, Steffisburg; Daniela Strebel, Sins; Edith Corrieri, Piazzogno; Doris Lehmann, Warth; Vreni Suess, Suhr; Hanna Ziegler, Köniz
Je ein Paar «Leki»-Wanderstöcke haben gewonnen:
+ Regina Fricker, Diegten; Vreni Blaser, Münsingen; Hedy Bühlmann, Arlesheim
Senden Sie mir:
«Wandern und geniessen im Winter » à Fr. 47.90 inkl. MwSt. und Versandkosten. Zudem nehme ich automatisch am Wettbewerb teil.
Wettbewerbslösung: A: Rhonetal B: Simmental C: Rheintal
Name Vorname
Strasse, Nr.
PLZ / Ort
Datum Unterschrift
Falls ich X-SOCKS gewinne, brauche ich folgende Sockengrösse:
11-2016
Damen Herren
Das Leserangebot ist gültig bis 31. Dezember 2016 und gilt nur für die Schweiz. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. November 2016. Coupon einsenden an:
AZ Fachverlage AG, Lesermarketing, « Winter», Postfach, 5001 Aarau

BESUCH AUS DEM ALL? GIBT ES! WIR SUCHEN UND FINDEN
AUSSERIRDISCHE AM TWANNBERG BEI BIEL. DORT HABEN FORSCHER DAS BISHER GRÖSSTE BEKANNTE METEORITENSTREUFELD EUROPAS ENTDECKT. Text: HANS KELLER
Wir treffen den Meteoritenjäger
Marcel Häuselmann auf dem Spitzberg, französisch Mont Sujet genannt, der sich als riesiges bewaldetes Oval parallel zum Bielersee erhebt. Oben, auf einem über 1300 Meter hoch gelegenen Plateau, das mit seinen Wiesen, Steinen und Einzelbäumen bereits an die jurassischen Freiberge erinnert, geniesst man eine eindrückliche Aussicht auf die lang gezogene Bergwand des Chasseral.
Häuselmanns hochsensibler Detektor grummelt, jault und piepst, je nachdem, was er gerade unter dem Gras im Erdreich ortet. Unglaublich, wie viel Metallschrott sich da ansammelt, in diesem doch eher abgelegenen Gebiet! Kübelweise Messer, Hufeisen, Gürtelschnallen, Nägel und dergleichen mehr hat Häuselmann auf dem Mont Sujet gefunden. Dabei ist er auf der Suche nach etwas ganz anderem: nach Ausserirdischen. Nein, keine grünen Männchen, sondern Eisenmeteoriten.
Bote aus dem All
Vor schätzungsweise 160 000 Jahren ist der «TwannbergMeteorit», ein zwischen sechs und 20 Meter grosser Bote aus dem All, in die Erdatmosphäre eingetaucht und dabei explodiert. Seit drei Jahren suchen Meteoritenjäger wie Häuselmann unter der Führung von Beda Hofmann, Geologe an der Universität Bern, auf dem Mont Sujet systematisch nach Fragmenten des TwannbergMeteoriten. Rund 600 Stück, gut 75 Kilogramm, haben sie bisher gefunden. Sie sind erstaunlich gut erhalten. Üblicherweise verwittern Meteoriten im europäischen Klima innerhalb von 5000 bis 10 000 Jahren. Doch die Kuppe des 1382 Meter hohen Mont Sujet blieb während der vorletzten Eiszeit eisfrei. Auch darum blieb das Streufeld weitgehend intakt. Deshalb sind die Chancen gross, dass Häuselmann hier weitere Teile des Eisenmeteoriten findet. Während er langsam über die Wiese schreitet, schwenkt er den Detektor langsam hin und her. Der Detektor surrt, fiepst, piepst. Manchmal bleibt Häuselmann stehen, will es genauer wissen, doch immer wieder entfährt ihm ein verächtliches «Schrott!».
Von Winzlingen und Riesen
Dann: ein aussergewöhnlich stabiles Piepsen. Häuselmann, ganz aufgeregt, greift zur Spitzschaufel und fängt an zu graben. Und tatsächlich: rund 20 Zentimeter unter der Grasnarbe kommt ein kleines Stückchen zum Vorschein, das deutlich auf den Detektor anspricht – ein Teilchen des TwannbergEisenmeteoriten, vermutet Häuselmann. Er putzt den Winzling, wiegt ihn – 5,2 Gramm –, dokumentiert den Fund und tütet ihn in ein Plastiksäckchen.
Das mit Abstand grösste Stück, ein 15,9KilogrammKlumpen, hat die Bäuerin Margrit Christen am 9. Mai 1984 auf einem Acker in Twannberg entdeckt. Als sie in der Gruebmatt ein Haferfeld pflügte, war ein Stein von der Grösse eines Brotes im Weg. Als sie ihn aufheben wollte, erschrak sie, so schwer war der Brocken. Bald stellte sich heraus, dass es sich um einen Eisenmeteoriten handelte. Er wurde TW1 benannt und ist seit 2002 im Naturhistorischen Museum Bern zu bewundern.
Es dauerte 16 Jahre bis zum zweiten einschlägigen Fund – eine kurlige Geschichte: Eine Nachbarin des Antikmöbelhändlers Marc Jost aus Twann bot diesem Anfang August 2000 einen alten Stuhl an, der auf ihrem Estrich stand. Jost schaute sich den Stuhl an. Dabei entdeckte er einen seltsamen, im Mörtel der Brandwand eingemauerten Stein. Ein Meteorit, glaubte Jost, doch bei Fachleuten stiess er auf taube Ohren. Einzig UniProfessor Beda Hofmann interessierte sich für die Entdeckung. Der Leiter der Erdwissenschaftlichen Abteilung des Naturhistorischen Museums Bern liess den Stein durchsägen und die Fläche schleifen: spiegelblanker Eisenglanz, ein klares Indiz. Die folgende chemische Analyse brachte Gewissheit: TW1 und dieser Brocken (TW2) stammen vom selben Meteoriten.
Dialog mit dem Kosmos Mit diesem zweiten Fund war der reale Mythos «TwannbergEisenmeteorit» geboren. Für Sammler und Forscher begann eine Art Dialog mit dem Weltall. Und tatsächlich lie
Meteoroiden nennt man Objekte, die innerhalb des Sonnensystems die Sonne umkreisen. Wenn Meteoroiden in die Erdatmosphäre eindringen, dann wird die dabei auftretende Leuchterscheinung Meteor genannt – oder im Volksmund Sternschnuppe. Das Leuchten wird von der Ionisation der Luft verursacht. Ein Meteoroid, der die Erdoberfläche erreicht, wird Meteorit genannt.
Täglich fallen bis zu 40 Tonnen Meteoriten auf die Erde nieder. Der Grossteil misst weniger als 0,1 mm. Man unterscheidet vor allem zwischen zwei Gruppen: Steinmeteorite (Aerolite) und Eisenmeteorite (Siderite), davon gibt es Mischformen. Die meisten Bruchstücke stammen aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, manchmal kommen sie jedoch auch aus Kometenschweifen oder von anderen Planeten.
Weltweit sind gut 53 700 Meteoriten dokumentiert, acht davon in der Schweiz; jener von Twannberg ist der einzige, von dem es mehrere Fragmente gibt. Er hat den niedrigsten Nickelgehalt aller bekannten Eisenmeteoriten überhaupt und zählt zur Klasse IIG. Von dieser Kategorie gibt es weltweit nur sechs Exemplare. Sie entstanden bereits rund 2 Millionen Jahre nach der Geburt des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren. Das Streufeld des Twannberg-Meteoriten ist das grösste bisher bekannte in Europa –es umfasst fünf bis möglicherweise gegen 15 Kilometer Länge und einige Hundert Meter Breite.
Einige Meteoriten erlangten geschichtliche Bedeutung, so etwa der 470 v. Chr. auf Phrygien gefallene schwarze Meteorit, mit dem die Göttin Kybele verehrt wurde; heute ist er in Rom zu sehen. Auch beim schwarzen Stein in der Kaaba, dem islamischen Heiligtum in Mekka, soll es sich um einen Meteoriten handeln. krea



Bei einem Meteorschauer (Meteorstrom) gibt es besonders viele Sternschnuppen. Bekannt sind die Perseiden, die uns im August erfreuen. Im November können wir die Leoniden bewundern, dieses Jahr vom 14. bis 21. mit dem Höhepunkt am Donnerstag, 17. November. Vom 7. bis 17. Dezember (Höhepunkt 13.12.) erfreuen uns die Geminiden und vom 17. bis 26. Dezember (Höhepunkt 22.12.) die Ursiden.
fern die Meteoriten gewisse Einsichten, etwa über die Entstehung des Sonnensystems (siehe Box).
Ab 2007 wurde eine intensive Streufeldsuche losgetreten, die bis heute rund 600 Fragmente des TwannbergMeteoriten zu Tage brachte. Sie stammen allesamt vom gleichen Urmeteoriten, der kurz vor dem Aufprall auf die Erde in zahllose Stücke zerbarst.
Die Suche konzentriert sich heute auf den ergiebigen Mont Sujet. «Anhand der hiesigen Funde lässt sich feststellen, dass der Meteorit wahrscheinlich in ostwestlicher Richtung herangerast kam», mutmasst Häuselmann. Er habe am bewaldeten Westabhang des Mont Sujet grössere Meteoriten gefunden als im Osten, und die grossen, schweren flögen weiter, so die Theorie.
Im Naturhistorischen Museum Bern findet zurzeit eine MeteoritenSchau statt, in der dem Twannberg Meteoriten gebührend Platz eingeräumt wird. Im Soussol ist in einer langen beleuchteten Vitrine eine grosse Auswahl wichtiger Fragmente zu sehen. Beginnend mit TW1, TW2 und TW3 gelangt man über mittelgrosse Stücke zu zahlreichen kleinen und winzigen schwarzen oder braunrot gefleckten Objekten. Viele davon sehen
aus wie misslungene Schokoladenpralinen; besonders prägnant geformte Stücke tragen Namen wie «Batman», «Venus vom Spitzberg» oder «Hexe».
Beda Hofmann, Verantwortlicher der Ausstellung, macht uns mit wissenschaftlichen Fakten zum TwannbergMeteoriten vertraut. «Er gehört zu einer seltenen Art von Meteoriten», sagt er. «Weltweit kamen erst sechs Eisenmeteoriten mit derselben chemischen Zusammensetzung herunter –zwei in Alabama USA, zwei in Chile, einer in Südafrika und einer eben in Twannberg.»
Über die Herkunft und die Zeit des Niedergangs des TwannbergMeteoriten gebe es lediglich Mutmassungen. «Der Absturz, bei dem der schätzungsweise 33 000 Tonnen schwere Meteorit in Tausende Teile zerbarst, liegt wohl um die 160 000 Jahre zurück», spekuliert Hofmann. «Wahrscheinlich stammt der Meteorit von dem aus unterschiedlich grossen Objekten bestehenden Asteroidengürtel, der zwischen Mars und Jupiter um die Sonne rast. Vermutlich hat eine Kollision den Meteor dazu gebracht, seine Bahn zu verlassen und Richtung Sonne abzudriften.»
Zum Geschäft gemacht
Von Mutmassungen zu Konkretem: Wem gehören eigentlich die gefundenen Fragmente? Dazu gebe es staatliche Regelungen, erklärt Hofmann. Wissenschaftlich wertvolle Funde gehören dem Kanton, in dem sie gefunden wurden. Den wissenschaftlichen Wert von Meteoriten beurteilt das Naturhistorische Museum Bern in Absprache mit dem Institut für Geologie und dem Physikalischen Institut der Universität Bern. Meteoritenjäger müssen archäologisch interessante Funde bei der Fundstelle sorgfältig dokumentieren und dem Archäologischen Dienst abliefern. Professionelle Sucher brauchen eine
Bewilligung. Der Finder hat Anspruch auf eine «angemessene Entschädigung», im Falle von Twannberg erhält er eine prozentuale Abgeltung in Form von Meteoritenfragmenten. Ein Beispiel: Meteoritenjäger Häuselmann habe ihm, Hofmann, gerade erst sieben Funde präsentiert, von denen er fünf als «Honorar» behalten durfte.
Die Meteoritenjagd kann durchaus ein lukratives Geschäft sein. So wird auf dem internationalen Markt für ein Gramm TwannbergMeteorit bis zu fünfzig Franken bezahlt. Doch ihm gehe es primär um die Sache, nicht ums Geld, sagt Häuselmann. Das Erlebnis in der Natur, das Fieber beim Suchen, der Rausch, den das Finden auslöst, das Rätsel Kosmos – das mache die Faszination aus. Aber auch die Kasse muss stimmen, denn Häuselmann ist Profi: Vor gut einem Jahr hat er seinen bisherigen Job auf zehn Prozent reduziert, um sich sieben bis zehn Stunden täglich den Meteoriten zu widmen. Und schon gehört er zu den erfolgreichsten Meteoritenjägern, von denen es in der Schweiz rund 50 gibt. «Von den zig Tonnen des Urmonsters wurden erst 75 Kilogramm gefunden », sagt er. «Wir können auf dem Mont Sujet also noch viele Jahre erfolgreich weitersuchen.» ◆
Twannberg-Meteorit –Jäger des verlorenen Schatzes
Ausstellung im Naturhistorischen Museum Bern bis 20. August 2017. www.twannbergmeteorit.ch


Gärtner legen derzeit die Beine hoch. Wer nächste Saison auch seine Beete hochlegen will, dem liefert das Buch Inspiration und konkrete Tipps. 20 reich bebilderte Beispiele von grossen Gärten bis Dachterrassen veranschaulichen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die Hochbeete bieten. Der fundierte Praxisteil informiert über die richtige Standortund Pflanzenwahl und darüber, wie man eine besonders ertragreiche Ernte erzielt.
+ Victoria Wegner: «Gartengestaltung mit Hochbeet», 2016, Callwey, Fr. 52.–
Energie ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft. Nun hat sich Globi der Sache angenommen. Er recherchiert, lässt sich erklären, wie ein AKW oder Solarzellen funktionieren und was Vor- und Nachteile sind. Er erfährt auch, dass es in der Schweiz zweimal zu schweren Reaktorunfällen gekommen ist (1967 und 1969).
Globis Fazit: Energieverbrauch reduzieren. Das «Sachbuch für Kinder» ist auch für Erwachsene eine unterhaltsame und lehrreiche Lektüre.
+ Atlant Bieri: «Globi und die Energie – Globis Reise in die Energiezukunft», 2016, Globi Verlag, Fr. 29.90

Die kostenlose App «Tinycards» funktioniert ähnlich wie Fremdwörter lernen mit Karteikarten: Auf digitalen Karten stehen Informationen; per Klick lassen sich die Karten drehen, so dass ein zugehöriger Begriff oder ein passendes Bild auftaucht. So kann man sich allerlei Wissen aneignen, von Landesaggen über Meeres sche bis hin zu Fremdsprachen und medizinischen Fakten.
+ Gratis im App Store


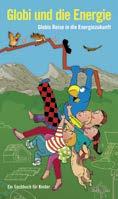




Das ist kein gewöhnliches Kochbuch. Natürlich, es enthält Rezepte –von Buchweizenpolenta bis Hirschfilet. Vor allem aber erzählt es Geschichten. Von tierischen Einwanderern etwa, von radikal regionalen Küchen und wilden Kräutern, von Bäuerinnen und Sterneköchen. Wie vom Verlag gewohnt, ist das Buch schön gemacht. Schade nur, wird die Schweiz fast links liegen gelassen – nur ein Engländer wird porträtiert, Dan Durig, der in Lausanne seit 15 Jahren Pralinen herstellt. Frankreich wird gar komplett ignoriert.
+ Yvonne Cornelius (Herausgeberin): «Die Küche der Alpen und ihre Ge schichten», 2016, teNeues, Fr. 35.90
Atomstrom sei sauber, behaupten die Atomlobbyisten gebetsmühlenartig. Das stimmt natürlich nicht. Die Naturzerstörung fängt beim Uranabbau an, der überwiegend in Gebieten indigener Völker statt ndet und deren Lebensgrundlagen und Gesundheit vernichtet. Doch während das Thema Endlagerung hierzulande immerhin diskutiert wird, ähnelt der Anfang der nuklearen Kette einer Terra incognita. Kein Wunder: über dem Uranerzbergbau liegt ein Ge echt aus Geheimhaltung und Desinformation. Der Film schenkt verstörende Einblicke und entlarvt die Schwätzer vom sauberen Strom als Lügner.
+ Joachim Tschirner: «Yellow Cake – Die Lüge von der sauberen Energie», 2010, zirka Fr. 20.–

Im November kann der erste Schnee fallen. Höchste Zeit also, die letzten Arbeiten dieser Gartensaison zu erledigen.
Text: REMO VETTER
NICHT VIELE Menschen schätzen den November. Die Tage sind grau und der Nebel schlägt manch einem Zeitgenossen auf das Gemüt. Mein Plädoyer: Tägliche Bewegung und frische Luft sind gesund! Und ich finde, die Aktivitäten machen besonders Spass, wenn man sie mit einer nützlichen Tätigkeit verbindet – zum Beispiel mit Gärtnern. Mir ersetzt das Gärtnern das Fitnessstudio. Durch das Graben, Heben, Schieben, Bücken und Strecken werden bei der Arbeit im Garten alle möglichen Muskeln beansprucht. Wer regelmässig im Garten arbeitet, kann also effektiv seine Muskeln trainieren. Überdies hinaus wage ich sogar zu behaupten, dass der Aufenthalt im Garten einen glücklicher, ausgeglichener und entspannter macht.
Wer neben Blumen auch Gemüse, Kräuter, Obst und Beeren anbaut, kann mindestens doppelt profitieren: Bei allem, was wir selber pflanzen, wissen wir genau, woher es kommt und dass keine Pestizide oder chemischer Dünger verwendet wurden. Und: frischer als aus dem eigenen Garten geht nicht. Zudem schmecken selbst gezogene Lebensmittel am besten!
MIT HERZ UND HIRN Gerade in der heutigen Zeit, in der viele Menschen zahlreiche Stunden an Bildschirmen verbringen und Verkehrslärm und Staus ausgesetzt sind, ist es für unsere Sinne und die Seele eine Wohltat, «freie Zeit» ungestört im Garten zu verbringen. Ein gepflegter Garten verschönert nicht nur die Umgebung, sondern kann für Familie und Freunde eine wahre Wohl-
fühloase sein. Damit wir diese Oase in der nächsten Gartensaison geniessen können, ist jetzt, vor Wintereinbruch, das grosse Aufräumen angesagt.
Dabei sollten wir nicht kopflos zu radikal vorgehen. Viele Pflanzen sollte man auch nach dem Verblühen stehen lassen für die Vögel und Insekten. Andererseits können wir Laub- und Asthaufen aufschichten, in denen Nützlinge wie Igel, Kröten, Salamander und Blindschleichen Unterschlupf finden. Regenwürmer und andere Bodenlebewesen profitieren davon, wenn man auf den Gemüse- und Blumenbeeten Laub verteilt. Unter der wärmenden Decke produzieren unsere wichtigsten Gartenhelfer besten Humus für die kommende Saison.
Wenn sich in den Wintermonaten die stehen gelassenen Pflanzen mit Raureif oder Schnee bedecken, entstehen oft fantastische, bizarre Skulpturen, die uns immer wieder faszinieren. Wir Gärtner können uns dann zurücklehnen und das Gartenjahr Revue passieren lassen; und natürlich schmieden wir schon Pläne für die neue Saison.
Diese Zeit des Rückzugs, der Ruhe und Musse finde ich als Gärtner extrem wichtig. Schon oft ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen – und ruckzuck habe ich neue Ideen und Pläne für einen bestimmten Gartenteil entwickelt. Und wenn es draussen so richtig «hudelt», geniesse ich es bei einer Tasse Kräutertee, in wunderschön bebilderten Gartenbüchern zu stöbern und mich so auf die kommende Saison einzustimmen. ◆

REMO VETTER
wurde 1956 in Basel geboren. 1982 stellte ihn der Heilpflanzenpionier Alfred Vogel ein. Seither ist Vetter im A. Vogel Besucherzentrum in Teufen Appenzell Ausserrhoden tätig.

• Bäume, Sträucher und Hecken schneiden.
• Hügelbeete anlegen macht jetzt Sinn, da viel Grünzeug abgeräumt wird.
• Der Kompost vom letzten Jahr ist jetzt reif. Wir sieben ihn und lagern ihn abgedeckt mit einer Blache. So können wir den Kompost im Frühjahr direkt für frische Aussaaten nutzen. Wir können aber auch jetzt schon Kompost verteilen: Er kommt in einer etwa ein bis zwei Zentimeter dicken Schicht auf die abgeräumten Beete.
• Pflanzen schützen: Bepflanzte Beete mit Mulch oder Tannenreisig abdecken. Sehr frostempfindliche Pflanzen mit Folie einpacken oder im Gartenhäuschen oder Keller überwintern.
• Giessen: Immergrüne Pflanzen brauchen auch im Winter etwas Wasser; Kübelpflanzen im Winterquartier nicht vergessen.
• Rasenpflege: Sobald alles Laub von den Bäumen gefallen ist, ist es Zeit, den Rasen zum letzten Mal zu mähen. Dabei kann, wenn nicht zu grosse Mengen angefallen sind, das Laub gleich mitgemäht werden.
• Wasseranschlüsse vor den ersten strengen Frösten entleeren, Haupthahn abstellen. Schläuche einrollen und frostgeschützt im Schuppen oder Keller lagern.
• Bodenpflege: Ein vitaler und nährstoffreicher Boden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gärtnern. Vor dem Winter müssen wir dafür sorgen, dass die Bodenlebewesen den bevorstehenden Frost überstehen. Dafür muss die Erdkrume vor Frost und Trockenheit geschützt werden. In der Natur schützt eine Decke aus Laub und verrotteten Pflanzenresten den Boden. Nach diesem Vorbild mulchen wir den Garten. Dazu wird gesundes Laub oder Stroh auf die Beete gestreut. Wo wir Gründüngungen ausgesät haben, mähen wir die Pflanzen und lassen sie einfach auf dem Boden verrotten. Schwere, lehmige Böden neigen zu Staunässe und verkrusten nach Regenfällen schnell. Das können wir jetzt bei der Vorbereitung der Beete auf den Winter ändern: Zuerst lockern wir die abgeernteten Beete mit dem Sauzahn und graben dann angerotteten Stallmist ein. Wenn wir keinen Mist haben, streuen wir halbfertigen Kompost auf die gelockerten Beete.


• Chinakohl: Der Chinakohl erträgt leichte Fröste. Es ist ratsam, die Köpfe rechtzeitig zu ernten und als Wintervorrat einzulagern. Man kann ihn kopfüber an den Strünken aufhängen. Zuckerhut, Weiss- und Rotkohl lassen sich auf die gleiche Weise lagern.
• Sellerie: Die Selleriebeete müssen jetzt abgeerntet werden. Die Knollen werden wie Kartoffeln gelagert: in Kisten, dunkel, kühl und vor allem frostfrei.
• Federkohl: Mit der Ernte des Federkohls warten wir bis zu den ersten Frostnächten, denn erst dann erlangt er sein volles Aroma.
• Kürbisse: Wenn wir Kürbisse ernten, belassen wir ein längeres Stück des Stieles an der Frucht, das fördert die Haltbarkeit. Im trockenen, kühlen Keller können Kürbisse bis weit über den Jahreswechsel hinaus gelagert werden.
• Radieschen: Wenn wir im August oder Anfang September Radieschen ausgesät haben, können wir diese jetzt noch ernten. Auch die Blätter sind als Salat oder in Suppen geniessbar.

• Rettiche: Winterrettiche können auf dem Gemüsebeet stehen bleiben, bis starke Fröste einsetzen. Zum Einlagern von Rettichen, Randen und Karotten nehmen wir Kisten und füllen diese mit feuchtem Sand, in den wir das Gemüse legen. Wir lagern im Keller oder in einem frostfreien Schuppen. So bleiben die Pflanzen bis weit in den Winter hinein frisch.
• Schwarzwurzeln: Da ausgegrabene Wurzeln nicht lange frisch bleiben, ernten wir sie portionenweise. Sie sind winterhart und können mit einer leichten Laubdecke geschützt noch lange im Beet bleiben. Bei der Ernte muss vorsichtig ausgestochen werden, da die Wurzeln leicht brechen.

Salbei, Thymian, Rosmarin, Currykraut und Ysop stammen aus wärmeren Regionen und müssen im Winter geschützt werden. Vor allem während Kälteperioden ist es wichtig, rund um die Pflanzen mit trockenem Laub anzuhäufeln. Kräuter wie Strauchbasilikum, Zitronenverbene und Rosmarin müssen wir rechtzeitig an einen hellen, kühlen Platz stellen, da sie draussen bei Frost erfrieren würden.
Schnittlauch kann man auch im Winter ernten: Wir graben einige Wurzelballen aus und pflanzen diese in Töpfe; auf einer hellen, warmen Fensterbank gedeiht er wunderbar.
Stauden mit Samenkapseln lassen wir stehen. Sie sind ein schöner Schmuck im winterlichen Garten, besonders wenn sich Reif auf sie legt. Stauden und Pflanzen, die eher wässrig sind und verpappen, schneiden wir jetzt zurück. Rosen: Wir geben den Rosen eine Gabe gut abgelagerten Pferde- oder Rindermist. Es kann auch Kompost genommen werden. Die Nährstoffe versorgen die Wurzeln und die Schicht schützt vor der Kälte. Die Rankgitter der Kletterrosen müssen wir vor dem Winter überprüfen, ob sie stabil sind, damit die Rosen gut Halt finden. Sonst kann die Last des Schnees die Zweige brechen.
Die Pflanzenkübel sollten nicht direkt auf dem Boden stehen, damit das Wasser ablaufen kann. Also zum Beispiel auf Holzleisten stellen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Töpfe gefrieren und zerspringen. Nicht winterharte Pflanzen an einen geschützten, frostfreien Ort stellen.

Biorhythmus – die innere Uhr
zeigt Ihr Kräfteverhältnis in Körper – Seele – Geist. Persönliche Ausführung als Kalender im Taschenformat. 12 Monatskarten Fr. 36.–. Bitte Ihre Geburtsdaten an: H. Schönenberger, Churerstrasse 92 B, 9470 Buchs SG Telefon 081 740 56 52, bioschoen@bluewin.ch



Liebe zum Menschen Liebe zur Natur
Heilfasten – Fastenwandern ganzjährig möglich www.friedbor n.de
natürlich 59x98_Inserat 28.09.2016 12:05 Seite 1
«Geborgenheit» gibt Ihnen Antwort auf viele Lebensfragen. Es schildert unser Dasein vor der Menschwerdung und unser Leben über das Erdendasein hinaus.

Prof. Dr Walther Hinz Geborgenheit
317 Seiten, CHF 12.–ISBN 978-3-85516-015-0
Zwölf Verstorbene berichten über ihre Heimkehr in die jenseitige Welt. Diese Berichte sind auf ungewöhnliche, aber doch erklärbare Weise zustande gekommen.

Beatrice Brunner Was uns erwartet
297 Seiten, CHF 12.–ISBN 978-3-85516-010-5
ABZ VERLAG ZÜRICH

BEA-Verlag, 5200 Brugg 056 444 22 22, bea-verlag.ch
La Gomera/Kanaren
Das abgeschiedene, ökologische Paradies für Familien, Seminare und Individual-Urlauber. Hotel Finca El Cabrito Telefon 0034-922-14 50 05, www.elcabrito.es

Das ganzheitliche Gesundheitszentrum am Vierwaldstättersee
Leicht, frei, energievoll, reich, wohlig, glücklich, seelig, offen, vital, lustig, erholt, neu, frisch, fröhlich, fit, regeneriert, schön, jung einfach fastinierend!
Persönlich und am schönsten Platz der Schweiz.
Kur- & Ferienhaus St. Otmar Maya & Beat Bachmann-Krapf CH-6353 Weggis +41 (0)41 390 30 01 www.kurhaus-st-otmar.ch
Inserate-Kurhaus-59x64-V1.indd 4 14.12.15 16:17
Sabine Hurni Ayurveda Kochkurse Gestaltungskurse
Kursprogramm unter www.sabinehurni.ch
Sabine Hurni GmbH Bruggerstrasse 37 CH-5400 Baden

079 750 49 66 056 209 12 41 info@sabinehurni.ch www.sabinehurni.ch

Werte wahren für naturnahes Wohnen Umbaulös ungen aus einer Hand ▪ Beratung ▪ Planung


INS BLAUE FAHREN! DAS STELLT MAN SICH WUNDERBAR VOR.
NUR: WO IST ES DENN, DIESES BLAUE? UND WAS HAT ES MIT DER FARBE AUF SICH? EINE SPURENSUCHE IM ORIENT.
Text und Fotos: RITA TORCASSO

PRÄCHTIG / Von der Stadtburg Alhambra im spanischen Granada (linke Seite) führt die Reise in die marokkanischen Städte Asilah (oben), Chefchaouen (unten) und Fès (unten rechts).



«Das ganze Leben ist eine Fahrt ins Blaue.»
Erhard Blanck, deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler
Auf unserer Fahrt ins Blaue spüren wir dem mystischen Blau nach, denn Blau ist mehr als eine Farbe. Die Reise beginnt in Andalusien in der Provinz Granada. Die gleichnamige Hauptstadt war das letzte Emirat, das die Christen im 15. Jahrhundert nach 700 Jahren muslimischer Herrschaft zurückerobert haben. Wir besuchen die mächtige Palastanlage Alhambra auf dem Sabikah-Hügel. Sie gilt als eine der schönsten Beispiele des maurischen Stils der islamischen Kunst und ist seit 1984 Weltkulturerbe. Besonders beeindruckend sind die grossen blauen Bögen mit den filigranen Kachelmosaiken – wie aus Tausendundeiner Nacht.
Solche Mosaikmeisterwerke werden wir noch viele sehen auf unserer Reise, die uns von Cordoba nach Marokko in die Königsstadt Fès führt, deren ältester Teil, Fès el Bali, im neunten Jahrhundert von Flüchtlingen aus Cordoba gegründet wurde. Heute wird Fès als «Blaue Stadt Marokkos» bezeichnet. Wegen ihres Wahrzeichens, dem Bab Boujloud, dem Haupteingang zur Medina von Fès el babi. Der Bab Boujloud ist allerdings nur aussen blau; innen ist er grün. Zudem wurde das Tor erst 1913 blau und grün gefliesst.
STERBEN ZUR BLAUEN STUNDE. Wir fahren weiter durch die Wüstenlandschaft Marokkos. Nirgendwo ist das Himmelblau intensiver als in der Wüste. Wo kaum eine andere Farbe das Auge ablenkt, leuchtet der Himmel, und man weiss, die Etymologie stimmt: Das Wort «blau» stammt vom althochdeutschen Blao ab, und Blao ist auf die indogermanische Wurzel bhel zurückzuführen, was glänzen, scheinen, leuchten bedeutet. Wüstenhimmelblau! Wer hier die «blaue Stunde» erlebt, kann nachvollziehen, wieso Fata Morganas Durstige in den Tod locken können – der Horizont: ein blau-silbern schimmernder See.
Wir lassen die Wüste hinter uns, fahren in grüne Berge zur «Blauen Stadt» Chefchaouen im Norden Marokkos. Vom Hügel schweift der Blick über die Stadt: ein Häusermeer in allen Farbschattierungen von Blau. Gebaut wurde die Stadt vom Führer Moulay Ali Ben Rachid El Alami, als die aus Andalusien vertriebenen Muslime und Juden im rauen Rifgebirge Zuflucht fanden. Sie bauten nach dem Vorbild der maurischen Architektur, doch nicht in Weiss, sondern eben in Blau. Über Jahrhunderte galt Chefchaouen als heilige Stadt. Ausländern war der Eintritt verwehrt. Als die Spanier nach fünf Jahre erbittertem Widerstand Chefchaouen 1926 besetzten, sprachen viele Bewohner noch das Kastilisch aus der Zeit der Mauren.
DIE FARBE DES ORIENTS. Ein Exkurs zum Mythos Blau führt aber nicht nach Mauretanien, sondern nach Ägypten. Hier war Blau die Farbe der Götter und wurde als Symbol des Lebens verwendet. Der Lapislazuli war ein heiliger Stein. Schon 3600 Jahre v. Chr. mischten die alten Ägypter daraus das Pigment Ägyptischblau. Eine ähnliche Formel kannte man in China: die 7000 lebensgrossen TerrakottaKrieger für das Grab des ersten Kaisers waren blau glasiert. Ein Stadttor von Babylon war mit tiefblauen Fliesen ausgekleidet – Nebukadnezar II hatte es 600 Jahre v. Chr. der Göttin Ischtar geweiht, der Herrscherin des Himmels und der Liebe. Heute kann man es im Pergamon-Museum in Berlin bewundern.
Babylon war vielleicht die erste blaue Stadt überhaupt. Auf dem ganzen Stadtgebiet fand man blaue Fliesen. Heute gilt neben Chefchaouen auch Jodhpur im indischen Rajasthan als alte blaue Stadt. Beide Städte wurden im 15. Jahrhundert gegründet.
SEIN BLAUES WUNDER ERLEBEN. In vielen Kulturen hat die Farbe Blau eine besondere Stellung. Im alten Ägypten steht Blau für Leben, in China für Unsterblichkeit und in Indien für göttliche Erleuchtung; im Judentum gilt Blau als Gottes- und Glaubensfarbe, in der christlichen Kultur symbolisiert Blau Reinheit und Treue. Früher waren Trauerkleider blau und auch die Leichen wurden blau gekleidet –das sollte Dämonen abhalten. Das englische «blue» bedeutet übrigens auch traurig, trübsinnig und melancholisch. Diese Gefühle fliessen bis heute in den Blues ein.
Das Universalgenie Leonardo da Vinci betrachtete Blau nicht als Farbe, sondern als «optisches Phänomen, in dem sich das Hell des Sonnenlichtes mit dem Schwarz der Weltfinsternis mischt». Von einer zwiespältigen Wahrnehmung der Farbe Blau zeugen viele volkstümliche Redewendungen. Einen «blauen Dunst vormachen» bedeutet täuschen und irreführen. Man lügt das Blaue vom Himmel herunter. Sein blaues Wunder erleben will eigentlich niemand, weil damit eine unangenehme Überraschung gemeint ist. Und wer blau ist oder wem es blau vor Augen wird, dem schwankt der Boden unter den Füssen. Weit zurück reichen Ausdrücke wie der «Blaue Montag», der aus dem Färberhandwerk stammt: Am Sonntag kam die Wolle ins Farbbad der gelben Pflanze Färberwaid; am Montag liess man sie trocknen – und an der Sonne wurde die Wolle blau, ganz ohne Zutun der Färber. Der Blaue Montag ist also ein arbeitsfreier Montag. Den gönnt sich auch, wer montags «blaumacht». Blaumachen steht aber nicht nur für unerlaubtes Fernbleiben von der Arbeit, sondern auch für Müssiggang im Allgemeinen.
CHEFCHAOUEN / Die blaue Stadt im Norden Marokkos gilt seit 2013 als immaterielles Kulturerbe der Menschheit.

«Blau ist die einzige Farbe, bei der ich mich wohl fühle.»
Franz Marc (1880–1916), deutscher Maler und Grafiker, Mitbegründer der Künstlergemeinschaft «Blauer Reiter»
EINE BLAU-WEISSE PERLENKETTE. Zurück in Chefchaouen. Der Klopfer am blauen Tor unserer Herberge ist eine Fatima-Hand. Sie gilt als allgemein schützend und als wirksamste Abwehrmassnahme im Kampf gegen den Bösen Blick und die Dschinnen, die aus Feuer erschaffenen Geistwesen. Die Farbe Blau wiederum symbolisiert im Islam Unergründlichkeit und Unendlichkeit. Paradox: Blau ist die Farbe des Unglücks; gleichzeitig wird mit ihr Unheil abgewehrt.
Unsere Fahrt ins Blaue führt uns weiter in die Mondlandschaft des Anti-Atlas. In der Nähe von Tafraoute liegen die «Blauen Steine» des belgischen Künstlers Jean Vérame. 1984 hat er hier riesige Steinblöcke in blaue Farbe getaucht und dann in der Landschaft verteilt. Er schuf im kargen «Nichts» einen magischen Ort. Blau wählte der Wüstenmaler, wie er sich selber bezeichnet, als Farbe des Friedens. Als die Farben verblassten, begannen die Dorfbewohner die Steine wieder zu bemalen, neben Blau nun auch mit Türkis, Rosa und Pastellgrün.
Zum Abschluss unserer Reise fahren wir an den Atlantik. Dort hinterliess das Maurenreich Al-Andalus eine Perlenkette weiss-blauer Dörfer, an denen wir vorbeifahren bis nach Essaouira, was so viel wie die Festgehaltenen bedeutet. Essaouira ist von den alten Festungsmauern der portugiesischen Eroberer umringt. Im Hafen, einst der grösste Han-


Kadinsky, Marc und der Blaue Reiter Ausstellung in der Fondation Beyeler, Riehen (BS), bis 22. Januar 2017. www.fondationbeyeler.ch
«Um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht um die Welt zu reisen.»
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Dichter und Naturwissenschaftler
HIRTENNOMADEN / Die Tuareg, auch das blaue Volk genannt, werden zunehmend sesshaft – nicht immer freiwillig. Deshalb kommt es immer wieder zu Aufständen.

Zehnmal Blau
01 Das deutsche Wort «blau» stammt vom althochdeutschen Blao, blâ ab, das schimmernd und glänzend bedeutete.
02 In Johann Wolfgang von Goethes Farbenlehre gibt es nur zwei reine Farben: Nachtblau und Lichtgelb.
03 Die Website color-check.com listet über 500 deutsche Namen für Blau auf, z. B. Admiral, Beintürkis, Facebook, rgb-Blau oder Zwetschge.
04 In zehn Ländern aller Kontinente ist Blau die am häufigsten genannte Lieblingsfarbe.
05 UN-Blau wurde durch die Flagge und die Blauhelme zur Friedensfarbe. Die EU wählte 1955 Blau «als Farbe des Himmels, in der das Sternenrund für Einheit steht und 12 als Zahl der Vollkommenheit».
06 Die Bluejeans haben ihren Namen vom Indigoblau, mit dem sie ursprünglich eingefärbt wurden.
07 Die Tuareg wurden das «blaue Volk» genannt. Weil der mit Indigo eingefärbte Gesichtsschleier auf die Haut abfärbte.
08 Blau war die Farbe der Könige und Adligen, die auch wegen ihrer bleichen Gesichtsfarbe Blaublüter genannt wurden.
09 Dass Blau gegen Mücken und Fliegen schützt, wurde von Forschern widerlegt. Lange galt dieser Volksglaube auch als Erklärung für die «Blauen Städte».
10 Lieber blau als blöd, weil der Rausch vergeht. (Kalenderspruch)
delsplatz Marokkos, liegen Hunderte von tiefblau bemalten Fischerbooten. Hier verluden die Karawanen die Waren aus der legendären malischen Oasenstadt Timbuktu, die mit dem Handel von Salz, Sklaven und Eunuchen zu unvorstellbarem Reichtum gelangte. Noch heute pflegen die Nachkommen der Sklaven die Rhythmen der Gnoua-Musik, die schon Jimmy Hendrix, die Rolling Stones und Bob Marley in Bann zogen. Am Weltfestival der Gnoua tanzen sich die Frauen in Trance, natürlich ganz in Blau gekleidet, denn Blau ist auch die Farbe des Propheten Moses, der die Juden aus der Knechtschaft der Pharaonen erlöst hat.
FARBE DER SEHNSUCHT. In der Kuppel der Hagia Sophia begegnen sich heute zwei blau-goldene Kulturen: die Madonna in Tiefblau gekleidet und die erste Sure des Korans in Gold auf Blau. In der Malerei wurde Blau über Jahrhunderte für den Mantel der Gottesmutter als Zeichen der Reinheit und Erhabenheit verwendet.
Die Farbe Ultramarin wurde früher aus dem kostbaren Lapislazuli hergestellt. Die Edelsteine wurden über den Hindukusch nach Persien und über das Mittelmeer bis nach Venedig transportiert. Die Bezeichnung Ultramarin bedeutet folgerichtig «von jenseits des Meeres». 1508 beklagte sich der deutsche Maler und Mathematiker Albrecht Dürer über den Preis der Ultramarin-Pigmente. 30 Gramm kosteten 12 Dukaten, das entsprach 42 Gramm Gold. Die würden heute um die 1780 Dollar kosten – ganz schön viel für ein bisschen Farbe. Später wurde der Lapislazuli ersetzt durch das günstigere Mineral Azurit, ein Kupfercarbonat, das schon die alten Ägypter und die Maya kannten. Der pflanzliche Farbstoff Indigo wurde nur in geringer Menge aus Indien importiert. Bei uns wurde er oft ersetzt durch die viel billigere Färberwaid, auch Deutsche Indigo genannt. Im 19. Jahrhundert gelang es dann, Ultramarin und Indigoblau synthetisch herzustellen.
Auf der Schwelle zur modernen Kunst erzeugte Pablo Picasso in der Blauen Periode mit der Farbe eine bedrückende Stimmung; zum Zyklus gehört auch das Bild «Melancholie». Für die Künstlergruppe «Der Blaue Reiter» war Blau Ausdruck des Geistigen. Vassily Kandinsky (1866 –1944) schrieb dazu: «Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schliesslich Übersinnlichem.» Ähnliche Gefühle drückt ein zentrales Symbol der Romantik aus: die Suche nach der «blauen Blume». Sie steht für Sehnsucht und Liebe und für das metaphysische Streben nach dem Unendlichen. Die blaue Blume wurde später auch ein Sinnbild der Sehnsucht nach der Ferne und ein Symbol der Wanderschaft. Wenn das nicht passt zu unserer Fahrt ins Blaue! ◆








Zen-Einführung
mit Marcel Steiner und Johanna Rütschi (9. bis 11. Dez., Fr. 18 bis So. 13 Uhr): Stille und Einkehr auf einem spirituellen, östlichen Weg.
Shibashi Qi-Gong mit Barbara Lehner (9. bis 11. Dez., Fr. 18.30 bis So. 13.30 Uhr): Shibashi ist Meditation in Bewegung, harmonisiert den Qi-Fluss im Körper, beruhigt, zentriert und weitet Geist und Seele. Weihnachten feiern mit Tobias Karcher und Noa Zenger (23. bis 27. Dez., Fr. 18.30 bis Di. 9 Uhr): Heimat und Fremde – Werke von Künstlern und Musikern, Schriftsteller und Philosophen begleiten die Kurs teilnehmenden durch die Weihnachtstage. Standortbestimmung mit Lukas Niederberger (20.1. bis 22.1.2017, Fr. 18.30 bis So. 13.30 Uhr) «Was will ich – was ist wichtig ?» Blick zurück und nach vorne mit dem Ziel, den inneren und äusseren Kompass neu auszurichten.
Mehr Infos und Anmeldung unter Telefon 041 757 14 14 info@lassalle-haus.org www.lassalle-haus.org
Das Lassalle-Haus in Edlibach ist ein von Jesuiten geführtes interreligiöses, spirituelles Zentrum mit einem breiten Kursangebot , das von Zen-Meditation über Naturseminare bis zu klassischen Exerzitien reicht. Für «natürlich» schreiben der Jesuit Tobias Karcher und die Pfarrerin Noa Zenger abwechselnd die Kolumne «Gedankensplitter».
WIR MITTELLÄNDER kommen auch dieses Jahr nicht drumherum: In keinem anderen Monat darben wir so häu g in einer dicken Nebelsuppe wie im November. In den Bergen hingegen ist es strahlend schön, nicht selten gar angenehm warm. Ich mag es den Hochländern von Herzen gönnen, sie pro tieren von der Inversion, die unsere Landesteile besonders oft im November im Griff hat – Meteorologen könnten das genau erklären, aber darum geht es hier nicht.
Vielmehr will ich mich rüsten, wenn die kalten Nebelschwaden auch meinen dicksten Mantel durchdringen und mir das Gemüt beschlagen. Erst recht, weil oft keine Aussicht besteht, irgendwo eine Gondel zu besteigen und mich aus dem Alltag buchstäblich aufzuseilen. So werde ich auch dieses Jahr zu einem bewährten Mittel greifen – und ein paar Sauna-Abende fest in der Agenda vermerken.
Die Sauna hat ihren Ursprung wohl schon in der Steinzeit. Auch die Römer schätzten das Schwitzbad, ebenso die Russen. Doch erst die Finnen machten die Sauna weltbekannt. Sie war der wärmste, sauberste, ruhigste Platz im Haus und galt als heiliger Ort. Kinder wurden hier geboren, Kranke zur Genesung gebettet – eine Art Apotheke der Armen. Und klar: Wie heute diente die Sauna der Entspannung und Reinigung. Es war der Ort, wo man weder uchen noch schreien durfte, vielmehr sich «wie in der Kirche benehmen» sollte, wie eine alte nnische Redensart besagt. Welch schöne Vorstellung! Während ich so weitersinne, spüre ich förmlich die Wärme, die tief in die Knochen dringt. Der Puls steigt, der Körper sammelt sich auf geheime Weise, ebenso der Geist. Ein Zeitfenster tut sich auf – zwei Stunden in der Sauna sind für mich das Minimum. Unverplanbar, wunderbar.
Oft schon habe ich dabei die Erfahrung gemacht: Je absichtsloser ich mich dem Ablauf von Hitze, Kälte und Ruhe unterziehe, umso klarer steigen Gedanken und Ideen auf und kristallisieren sich zu Handlungssträngen. Oft bin ich ihnen auch tatsächlich gefolgt. So habe ich etwa eine verlockende gesellschaftliche Einladung ausgeschlagen und mich dafür mit einer Freundin getroffen, für die ich schon lange nicht mehr ausgiebig Zeit hatte. Auch schon sind mir in der Sauna Anfänge zu Predigten, erhellende Einsichten zu komplexen Situationen zugefallen; oder einfache, banale Entschlüsse wie diesen oder jenen Schuh nicht oder erst recht zu kaufen. Entscheide ich auch bei kleinen Dingen bewusst, gehe ich de nitiv leichtfüssiger durchs Leben.
Wenn sich doch bald ein dicker, kalter Nebel über dem Mittelland festklammern würde und ich so richtig in der Sauna abtauchen könnte! Sagte nicht schon die grosse Mystikerin Teresa von Ávila vor mehr als 500 Jahren: « Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.»




• 50% Rabatt in hunderten TopHotels in der Schweiz und im angrenzenden Ausland.
Lösung des Rätsels aus dem Heft 10-2016
Gesucht war: Mondphase
Wettbewerbstalon

• Die Hotels sind im Schnitt an 75% der Tage zum ½ Preis verfügbar.
• Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten oder zweiten Übernachtung.
• Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.
• Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt eine Hotelcard.



Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung
Und so spielen Sie mit:
Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: AZ Fachverlage AG, «natürlich», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau. Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 24. November 2016. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


20× je eine Hotelcard im Wert von je Fr. 95.–. Gewinnen Sie!
Shiatsu, eine sanfte, ganzheitliche Körpertherapie, die uns lehrt, den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele zu verstehen. Mit Shiatsu wird die Lebensenergie in den Meridianen harmonisiert und der Energiefluss und die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Shiatsu eignet sich für Men schen jeden Alters zur Gesundheitsförderung, als eigenständige oder ergänzende Therapie, bei Beschwerden und Krankheiten wie Kopf- und Rückenschmerzen, Mens-Beschwerden, Angst und Schlafstörungen.
+ Liselotte Weibel, Möriken, www.shiatsu-weibel.ch


Verbringen Sie im Frühling 2017 vom 12. bis 14. Mai drei Tage und zwei Nächte voller sinnlicher Eindrücke und seelischer Erfahrung mit dem Natur therapeuten Christian Mulle und «natürlich» auf der Alp Gonzern. Die in den Urner Bergen gelegene Alp ist ein Kraftort und Übergangsraum zwischen Zivi lisation und Wildnis. Das dreitägige Besinnungsseminar kostet für «natürlich»-Leserinnen und -Leser 410 statt 590 Franken.
+ Mehr Infos und Anmeldung unter www.walkout.ch
Die Natur zieht sich zurück und macht sich für kältere Monate bereit. Auch für uns Menschen ist ein persönlicher Rückzug wichtig. Ein Fasten bietet uns eine Auszeit auf allen Ebenen. Bei uns im Kurhaus St. Otmar in Weggis – die Adresse für ganz heitliche Fasten-Kuren – geniessen Sie eine persönliche und fami liäre Betreuung. Sie fasten bei uns jederzeit, beinahe das ganze Jahr. Attraktive Kurse und Aktivitäten wie Regenera tionswoche, Verwöhn-/Wohlfühlwoche oder Therapieanwendungen ergänzen das Angebot. Sich entspannen und wohlfühlen.
+ Kurhaus St. Otmar, Weggis, Maya und Beat Bachmann-Krapf, Telefon: 041 390 30 01, www.kurhaus-st-otmar.ch

3
Produkte News

2

1


4 1 5

3
2
Ein gesunder Darm schützt vor Krankheit
Der Darm als Wiege des Immunsystems ist auf die Milchsäurebakterien angewiesen. Sind die Schleimhäute als Verteidigungslinie gut besetzt, haben Invasoren kaum eine Chance. Lactibiane Abwehr enthält pro Kapsel 10 Milliarden Milchsäurebakterien Lactobacillus acidophilus und zusätzlich 10 mg Zink und 80 mg Vitamin C, die beide zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Frei von Gluten, Lactose, Farbstoffen und Konservierungsmittel eignet es sich für alle Altersgruppen. Lassen Sie sich in Apotheken und Drogerien beraten. + www.phytolis.ch
Wadenkrämpfe, kalte Füsse oder eingeschlafene Hände?
Die Durchblutung findet überall im Körper statt und ist für die Gesundheit des ganzen Organismus wichtig. Kalte Hände und Füsse, Wadenkrämpfe und kribbelnde Beine sind erste Anzeichen einer Durchblutungsstörung. Basierend auf dem jahrhundertealten Wissen der tibetischen Medizin entstand das bewährte pflanzliche Arzneimittel Padma 28. Es fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen und wirkt antioxidativ. Eingesetzt wird es bei Durchblutungsstörungen. Es wird in der Schweiz hergestellt und ist in Apotheken oder Drogerien erhältlich.
+ www.padma.ch
4
Erkältungsfrei durch den Winter Ob und wie stark ein grippaler Infekt ausbricht, hängt massgeblich von der Fitness des Immunsystems ab. Echinaforce forte aus frischem Roten Sonnenhut stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und hilft beim Aufbau eines wirksamen Erkältungsschutzes bei Anfälligkeit auf grippale Infekte. Zeigen sich bereits erste Anzeichen einer Erkältung wie Kratzen im Hals oder laufende Nase, kann Echinaforce forte den Heilungsverlauf günstig beeinflussen.
+ www.bioforce.ch
Natürliche Lippenpflege beugt Herpes vor Silicea Naturkosmetik Lippenpflegebalsam bietet besonderen Schutz für herpesempfindliche Lippen bei täglicher Anwendung in der beschwerdefreien Zeit. Melisse und Lavendel wirken beruhigend auf die strapazierte Haut, wertvolles Sonnenblumen, Sesam und Jojobaöl spenden Feuchtigkeit und unterstützen die Haut bei der Regeneration. Sheabutter komplettiert die intensive Pflege durch ihre rückfettenden Eigenschaften. Wirksamkeit und Hautverträglichkeit sind dermatologisch getestet. Lichtschutzfaktor 6, Natrue und BDIHzertifiziert.
+ www.somona.ch
5
Aus Bestandteilen wie Oliven-, Distel- und Rapsöl sowie Kokosbutter, Honig, Kräutern sorgfältig komponiert, sorgen die handgemachten und veganen Naturseifen von Karolina Kasa für eine strahlend schöne Haut. Neu im Sortiment sind attraktive Geschenkkombinationen wie zum Beispiel eine OlivenholzSeifenschale mit je einem Stück hochwertiger Oliven und Rosenseife für Fr. 31.80.
+ www.pflegeseife.ch
37. Jahrgang. ISSN 2234-9103
37. Jahrgang. ISSN 2234-9103
Erscheint monatlich. Doppelnummern: Januar/Februar und Juli/August
Erscheint monatlich. Doppelnummern: Januar/Februar und Juli/August
www.natuerlich-online.ch
Leserzahlen: 116 000 (MACH Basic 2015-2)
Leserzahlen: 116 000 (MACH Basic 2015-2)
Auflage: 22 000 Exemplare, verbreitete Auflage 18 713 Exemplare (WEMF 2015).
Auflage: 22 000 Exemplare, verbreitete Auflage 18 713 Exemplare (WEMF 2015).
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@azmedien.ch
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@azmedien.ch
Herausgeberin
Herausgeberin
AZ Fachverlage AG
AZ Fachverlage AG
Neumattstrasse 1
Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Geschäftsführer
Fax +41 (0)58 200 56 44
Roland Kühne
Geschäftsführer
Leiterin Zeitschriften
Roland Kühne
Maike Juchler
Leiterin Zeitschriften
Redaktion «natürlich»
Ratna Irzan
Postfach
Redaktion «natürlich»
CH-5001 Aarau
Postfach
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax. +41 (0)58 200 56 44
CH-5001 Aarau
Chefredaktor
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax. +41 (0)58 200 56 44
Markus Kellenberger
Chefredaktor
Redaktionsteam
Markus Kellenberger
Andreas Krebs, Sabine Hurni (Leserberatung)
Redaktionsteam
Autoren
Tertia Hager, Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
Tommy Dätwyler, Hans Keller, Fabrice Müller, Georg Schramm, Heinz Staffelbach, Gundula Madeleine Tegtmeyer, Rita Torcasso, Remo Vetter, Andreas Walker, Thomas Widmer, Christine Wullschleger, Noa Zenger


Layout/Produktion
Stella Cornelius-Koch, Marion Kaden, Sandra Papachristos Rickenbach, Eva Rosenfelder, Urs Beat Schärz, Heinz Scholz, Vera Sohmer, Gundula Madeleine Tegtmeyer, Remo Vetter, Andreas Walker, Thomas Widmer
Rahel Blaser, Matthias Kuert, Fredi Frank
Layout/Produktion
Rahel Blaser, Lina Hodel, Fredi Frank
Copyright
Copyright
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für eingesandtes Material. Die Wiedergabe von Artikeln und Bildern ist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages erlaubt.
Wir verlieren uns zunehmend im Aussen. Um den Kontakt zu uns wiederzu nden, müssen wir sinnlich werden. Die Praxis der Achtsamkeit hilft dabei.
Sozial und ökologisch integrierte Nachbarschaften können dazu beitragen, dass unser Leben entspannter, gerechter, besser wird. Worauf warten wir?
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für eingesandtes Material. Die Wiedergabe von Artikeln und Bildern ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages erlaubt.
Verkaufsleiter ad interim
Thomas Kolbeck
Verkaufsleiterin
Tel. +41 (0)58 200 56 31
Alexandra Rossi
Neumattstrasse 1
Tel. +41 (0)58 200 56 52
Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau thomas.kolbeck@azmedien.ch
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
CH-5001 Aarau alexandra.rossi@azmedien.ch
Anzeigenadministration
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Corinne Dätwiler
Tel. +41 (0)58 200 56 16
Anzeigenadministration
Corinne Dätwiler
Leiter Werbemarkt
Tel. +41 (0)58 200 56 16
Jean-Orphée Reuter
Leiter Lesermarkt/Online
Leiter Lesermarkt/Online
Christine Ziegler
Christine Ziegler
Aboverwaltung abo@natuerlich-online.ch
Aboverwaltung abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 (0)58 200 55 62
Tel. +41 (0)58 200 55 62
Preise
Preise
Einzel-Verkaufspreis Fr. 8.90
Einzel-Verkaufspreis Fr. 8.90
1-Jahres-Abonnement Fr. 84.–2-Jahres-Abonnement Fr. 148.– inkl. MwSt.
Druck
Druck


Vogt-Schild Druck AG CH-4552 Derendingen
Vogt-Schild Druck AG CH-4552 Derendingen
Hochgeistige Genüsse
Ein Produkt der Verleger: Peter Wanner
Ein Produkt der Verleger: Peter Wanner
Obst, Korn, Kartoffeln werden zu edlen Bränden destilliert, mitunter illegal. Vor allem im Wallis ist die Schwarzbrennerei gang und gäbe.
Zwei Drittel der in der Schweiz verkauften Weihnachtsbäume stammen aus dem Ausland. Es gibt aber auch Ökotannen und nachhaltigen Weihnachtsschmuck.
CEO: Axel Wüstmann www.azmedien.ch
CEO: Axel Wüstmann www.azmedien.ch
Namhafte Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2 StGB
AZ Anzeiger AG, AZ Verlagsservice AG, AZ Fachverlage AG, Atmosphären Verlag GmbH, AZ Management Services AG, AZ Regionalfernsehen AG, AZ TV Productions AG, AZ Zeitungen AG, FixxPunkt AG, Belcom AG, Media Factory AG, Mittelland Zeitungsdruck AG, Vogt-Schild Druck AG, VS Vertriebs GmbH, Weiss Medien AG, Dietschi AG, TrisCom-Media AG, Radio 32 AG, AZ Vertriebs AG, Zofinger Tagblatt AG
Namhafte Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2 StGB AZ Anzeiger AG, AZ Verlagsservice AG, AZ Fachverlage AG, Atmosphären Verlag GmbH, AZ Management Services AG, AZ Regionalfernsehen AG, AZ TV Productions AG, AZ Zeitungen AG, FixxPunkt AG, Belcom AG, Media Factory AG, Mittelland Zeitungsdruck AG, Vogt-Schild Druck AG, VS Vertriebs GmbH, Weiss Medien AG, Dietschi AG, TrisCom-Media AG, Radio 32 AG, AZ Vertriebs AG, Zofinger Tagblatt AG
natürlich 11 | 2016 Fotos: istockphoto.com | zvg
«natürlich» 12-16 erscheint am 24. November 2016
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 62 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch




Thomas Widmer ( 53 ) schreibt im « Tages-Anzeiger » die Wanderkolumne « Zu Fuss ».
Wanderkolumnist Thomas Widmer macht sich Gedanken über Gipfelkreuze – und jene, die sie freveln.
« Kreuzmordrätsel. » So elegant übertitelte unlängst eine deutsche Zeitung ihren Bericht über seltsame Vorgänge in den bayerischen Alpen. Ein Unbekannter hatte die Axt an mehrere Gipfelkreuze gelegt. Wer und warum : unklar.
Ein Einzelfall ist das nicht. Vor Jahren attackierte ein Greyerzer Bergführer drei Gipfelkreuze, weil er fand, dass Kreuze auf Bergen fehl am Platz seien. Er kassierte eine bedingte Geldstrafe.
In Oregon zog der Duckbill, eine pilzförmige Felsformation, viele Leute an. Bis vor Kurzem. Dann tauchte auf Youtube ein Handy lmchen auf : Es zeigt drei Leute, die unter Gejohle den Millionen Jahre alten Stein kippen. Er zerschellt am Boden. Der Duckbill ist – einverstanden − kein Symbol, schon gar kein religiöses. Und doch sind beide Arten von Vorfällen geprägt durch dieselbe krude Gewalt gegen Dinge. Etwas ist lange da. Und dann ist es schnell weg durch das Handeln einzelner oder ganz weniger Menschen.
Beispiele gefällig? Die Sowjets degradierten ehrwürdige Kirchen zu Hallenbädern ; in der Reformation wurden Heiligenstatuen aus den Kirchen geschleift und zertrümmert ; die turmhohen Felsnischen von Bamiyan in Afghanistan sind leer, seit die Taliban die Buddha-Statuen sprengten.
Solche Zerstörer, ob gestern oder heute, handeln aus Hass und ihr Tun tut anderen weh. Dass das Vorgehen in der Regel von langer Hand geplant ist, macht alles noch schlimmer. Wer ernennt diese Zerstörer zu Richtern und Henkern? Wenn man konsequent kaputtmacht, was einen stört, so führt das ins Chaos.
Zurück zu den Gipfelkreuzen. Gipfelkreuze sind eine vieldeutige Sache. Sicher, sie kommen aus dem christlichen Glauben. Sie setzen aber auch ganz allgemein menschlich ein Zeichen des Guten auf einen exponierten Punkt. Mir als Bergwanderer sagen sie : Du bist jetzt oben. Wir hoffen, dass dich eine Kraft auch beim Abstieg schützt!
Vor Kurzem berichteten die Medien über einen Appenzeller Künstler. Er hatte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf dem Berg Freiheit im Alpstein einen riesigen Halbmond platziert. Gipfelkreuze störten ihn als Atheisten, sagte er. Seltsame Logik. Der Halbmond ist das Zeichen des Islams, und auch der Islam ist eine Religion. Es gibt Leute, die lehnen einen zentralen Bereich unserer Kultur – das Christentum − und dessen Zeichen – das Kreuz − radikal ab. Dabei haben Kultur und Zeichen viel mit uns zu tun – ja, sie machen uns aus, im Guten wie im Schlechten. So erinnert das Kreuz an die Kreuzzüge ebenso wie an die Friedensbotschaft des Evangeliums. Jedenfalls aber gehört das Kreuz als christliches Symbol zu unserer Geschichte. Wer sind wir, wenn wir sie entfernen? Identitätslose Niemande! ◆
Kompakt für Sie zusammengestellt:
Die Sammeleditionen Nr. 1 bis 8 zu einem bestimmten Thema mit je über 45 Rezepten.













Nur Fr. 9.95 pro zuzüglichAusgabe Fr. Portokosten.1.90

Ihr Bestellcoupon
Nr 1 Guetzli (14649)
Nr. 2 Frühlingsküche (14709)
Nr. 3 Grill (14754)
Nr. 4 Gratins & Eintöpfe (14876)
Nr 5 Gästeküche (14904)
Nr. 6 Spargeln (15031)
Nr. 7 Einmachen (15038)
Nr. 8 Pasta & Risotto (15039)
Datum / Unterschrift 2 3 1 4 5 6 7
Bitte ausfüllen und noch heute einsenden an: KOCHEN-shop, Leserangebote, Postfach, 9029 St. Gallen
Online: www.kochen-shop.ch/sammeleditionen
Telefon: 071 274 68 74 Preise






Ich bestelle ger ne folgende Sammeledition(en) à Fr 9.95 und Fr 1.90 Versandkosten pro Bestellung. (Bitte gewünschte Anzahl angeben)
Vorname Name
Strasse / Nr PLZ / Ort Telefon

ETHIKFONDS: RENDITE UND ETHIK IM
Ist Ihnen verantwor tungsvolles Handeln auch beim Geld anlegen wichtig? Dann setzen Sie auf unsere Produktinnovation, welche ethische und finanzielle Ansprüche auf höchstem Niveau vereint.
szkb.ch /ethikfonds