Schwerpunktthema: Durchflussmessung
Modernisierungsprogramm für Kraftwerk Ferrera
Schlitters macht Schritt in die Energieunabhängigkeit
Restwasserkraftwerk überzeugt mit innovativer Technik
Fachmagazin für Wasserkraft

Schwerpunktthema: Durchflussmessung
Modernisierungsprogramm für Kraftwerk Ferrera
Schlitters macht Schritt in die Energieunabhängigkeit
Restwasserkraftwerk überzeugt mit innovativer Technik
Fachmagazin für Wasserkraft








Das mediale Echo war leise und verhalten. Nur wenigen Medien war es überhaupt eine Schlagzeile wert: Die globale Durchschnittstemperatur hat mit Anfang des Jahres die 1,5-Grad-Marke überschritten. Jene Marke, die im Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 als Grenzwert vorgegeben wurde und auf den sich damals immerhin 195 Staaten einigen konnten. Wir sprechen also von einem historischen Moment der unrühmlichen Art, dessen Folgen nicht zur Gänze abzuschätzen sind. Trotzdem sollten wir keineswegs in Resignation und Defätismus verfallen. Diese Wegmarke kann auch zu einem Beschleunigungspunkt für die immer stärker werdende Climate-Tech-Branche werden. Wie Jan Lozek, Gründer der Future Energy Ventures, kürzlich schrieb, steht die Klimatechnologie derzeit vor dem Spagat, einerseits Lösungen für die Anpassungen an den Klimawandel zu finden und andererseits die Transformation hin zur Klimaneutralität voranzutreiben. Dabei erkennt er auch Grund zu leichtem Optimismus. „Das Überschreiten der 1,5-Grad-Schwelle könnte paradoxerweise genau der Katalysator sein, den die ClimateTech-Branche braucht. Es verstärkt die Dringlichkeit für Investitionen in Klimatechnologien und schafft neue Märkte für Anpassungslösungen“, argumentiert Lozek. In diesem Zusammenhang teilt der Experte die Meinung vieler anderer Energiefachleute: KI könnte der Schlüssel für die Energiewende sein, ihr kommt jetzt schon eine entscheidende Rolle zu in der Integration und Optimierung dezentraler Energiequellen, und sie macht Stromnetze effizienter. Aus diesem Grund wird man auch in politischen Kreisen gut beraten sein, trotz schwächelnder Konjunktur weiterhin die Forschung und natürlich den Ausbau der Erneuerbaren unter Zuhilfenahme sämtlicher digitaler Möglichkeiten zu unterstützen. Diese Einschätzung korrespondiert gut mit der aktuellen Prognose des World Energy Outlook 2024 (WEO), der das mit Abstand höchste Wachstumspotenzial am Energiesektor bei den Erneuerbaren konstatiert – allen aktuellen politischen Entwicklungen zum Trotz. Der WEO geht davon aus, dass bis 2050 der Anteil der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen weltweit von 30 Prozent (Stand 2023) bis auf 83 Prozent ansteigt. Die Prognose für Europa liegt sogar bei 84 Prozent. Zwar werden sich auf lange Sicht Photovoltaik und Windkraft zu den Wachstumstreibern der Branche entwickeln, dennoch wird die Wasserkraft weiterhin ein unverzichtbarer Player für die Energiewende bleiben – speziell in Mitteleuropa.
In der vorliegenden, ersten Ausgabe der zek HYDRO – die übrigens das letzte Mal in diesem Design erscheint – dürfen wir wieder einige interessante Projekte vorstellen. Wir haben uns unter anderem ein Kleinwasserkraftwerk im Tiroler Zillertal (S 24) angesehen, das mit einigen innovativen technischen Lösungen aufwartet. Gleiches gilt für ein Restwasserkraftwerk im Salzburger Pinzgau (S 47) oder auch für das modernisierte Bündner Kraftwerk Ferrera. Außerdem haben wir diesmal den Schwerpunkt auf das Thema Durchflussmessung (ab S 56) gesetzt. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.
Ihr
Mag. Roland Gruber (Herausgeber) rg@zek.at



24.-25. SEPTEMBER 2025 | FORUM LANDQUART, SCHWEIZ https://www.kleinwasserkraft-anwenderforum.de/






Komplettlösungen für eine nachhaltige Zukunft.




Reliability beyond tomorrow.








08 Interessantes & Wissenswertes SHORT CUTS
20 Analyse: Das Leid mit der Wiederverleihung KOLUMNE LINDNER
21 energieUri optimiert Energieproduktion auf dem Arni KW INTSCHIALP
24 Schlitters macht Schritt in die Energieunabhängigkeit KW ÖXLBACH
34 Die ganze Welt der Wasserkraft für drei Tage vereint in Graz HYDRO 2024
36 Bayerischer Turbinenspezialist setzt weiter auf Innovationskraft WATEC 2025
03 Editorial
06 Inhalt
08 Impressum
30 Graubündner Kraftwerk bestens für die Zukunft gerüstet KW FERRERA
39 Wasserkraftprofis erneuern Kraftwerkskaskade und Stromnetz KW TABERBACH




44 Anlagen-Engineering à la carte –von der Kür bis zur Pflicht EPLAN
47 Restwasserkraftwerk in Salzburg punktet mit innovativer Technik RWKW SULZAU
50 Europäischer Treffpunkt für Was serkraft in der Mozartstadt RENEXPO INTERHYDRO 25
52 KWK Österreich mit 4 Forderungen an die neue Regierung INTERESSENSVERTRETUNG
53 Spezialist bietet Lösungen für anspruchsvolle Sanierungsfälle MOBILES
56 Effiziente Durchflussmessung in Niederdruckanlagen
60 Vom hydraulischen Blindflug zum optimierten Wasserkraftwerk
GRÜNES LICHT FÜR DEN BAU VON KRAFTWERK TRAUNFALL
Gute Nachrichten zu Jahresbeginn für das Kraftwerksprojekt Traunfall der Energie AG: Wie das Nachrichtenportal www.meinbezirk. at und weitere Regionalmedien berichteten, wurde vor kurzem die offizielle Genehmigung für das Projekt erteilt. Es handelt sich dabei um einen geplanten Ersatzneubau für die bestehenden Kraftwerke Gschröff, Siebenbrunn und Traunfall. Der baulichen Umsetzung steht nun – nach erfolgreich absolvierter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – nichts mehr im Wege. Das Kraftwerksprojekt wird einen erheblichen Leistungssprung ermöglichen. Kamen die drei Altkraftwerke zusammen auf eine installierte Leistung von knapp 12,7 MW, wird die Ausbauleistung des neuen Kraftwerks bei 25 MW liegen, es wird also de facto eine Verdopplung ermöglichen. Das historische Kraftwerk Gschröff, das 1888 in Betrieb genommen wurde und als Österreichs ältestes noch funktionierendes Flusskraftwerk gilt, bleibt als Schaukraftwerk erhalten. Die beiden anderen Anlagen Siebenbrunn und Traunfall werden rückgebaut. Der Baubeginn für das neue Kraftwerk Traunfall ist noch für 2025 avisiert. 2029 möchte die Projektbetreiberin Energie AG mit dem neuen Kraftwerk ans Netz.
KRAFTWERK WALLSEE-MITTERKIRCHEN:
TURBINENTAUSCH-PROGRAMM ANGELAUFEN
Das von VERBUND betriebene Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen, das zwischen 1965 und 1968 errichtet wurde, wird in den kommenden Jahren schrittweise modernisiert. Konkret werden alle sechs Turbinen, die bereits ungefähr je 400.000 Betriebsstunden auf dem Zähler haben, ausgetauscht. Bis 2030 soll das Modernisierungsprogramm abgeschlossen sein. Mitte November letzten Jahres wurde bereits der Ausbau des ersten Laufrads mithilfe des kraftwerkseigenen Portalkrans durchgeführt. Das Ausheben des 120 Tonnen schweren Bauteils mit einem Durchmesser von 7,8 m erforderte dabei von Kranführer und Betriebsmannschaft höchste Konzentration und Fingerspitzengefühl. Durch das geplante Modernisierungspaket erfährt das Donaukraftwerk eine Erhöhung der Engpassleistung um rund 10 MW auf insgesamt 220 MW, sowie eine Steigerung der durchschnittlichen Erzeugung um rund 54 Mio. kWh auf nahezu 1,4 Mrd. kWh. Damit werden zukünftig allein aus dem Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen 390.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgt. Die Maßnahme schließt an eine bereits laufende Überholung der elektrischen Teile der Maschinensätze, der Generatoren, an.

Das bestehende Kraftwerk Siebenbrunn an der Traun in Oberösterreich wird für den Ersatzneubau Kraftwerk Traunfall geschliffen.

Die Wehranlagen des Altbestands des Kraftwerks Traunfall sind in die Jahre gekommen und werden im Zuge des Bauvorhabens ebenfalls rückgebaut.

VERBUND
Auftakt zur Revitalisierung Wallsee-Mitterkirchen: Karl Heinz Gruber (GF VHP), Achim Kaspar (Vorstand VERBUND AG), LAbg. Anton Froschauer (Perg), Michael Amerer (GF VHP)

Das Ausheben des 120 Tonnen schweren Laufrads erforderte höchste Konzentration bei allen Beteiligten.
HERAUSGEBER
Mag. Roland Gruber
VERLAG
Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG
Brunnenstraße 1, 5450 Werfen
Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at www.zek.at
CHEFREDAKTION
Mag. Roland Gruber, rg@zek.at Mobil +43 (0)664-115 05 70
REDAKTION
Mag. Andreas Pointinger, ap@zek.at Mobil +43 (0)664-22 82 323
ANZEIGENLEITUNG / PR-BERATUNG
Mario Kogler, BA, mk@zek.at Mobil +43 (0)664- 240 67 74
GESTALTUNG
Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG
Brunnenstraße 1, 5450 Werfen
Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at www.zek.at
UMSCHLAG-GESTALTUNG
MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Stabauergasse 5, A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662/8746 74
E-Mail: m.maier@rizner.at
DRUCK
Druckerei Roser
Mayrwiesstraße 23, 5300 Hallwang
Tel.: +43 (0)662-6617 37
VERLAGSPOSTAMT
A-5450 Werfen
GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN
zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich.
ABOPREIS
Österreich: Euro 78,00, Ausland: Euro 89,00 inklusive Mehrwertsteuer
zek HYDRO erscheint 6x im Jahr.
Auflage: 8.000 Stück
ISSN: 2791-4089

Das vor drei Jahren gegründete Wasserkraft-Labor Hydro Alps Lab der HES-SO Valais-Wallis kann seit kurzem mit OIKEN einen neuen Partner begrüßen. Gemeinsam werden sie Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen der Energiewende erarbeiten. 2021 unterzeichneten die Hochschule für Ingenieurwissenschaften, Alpiq, FMV (Forces Motrices Valaisannes) und HYDRO Exploitation anlässlich der Gründung des Forschungslabors einen Fünfjahresvertrag. Seitdem hat das Labor mehrere anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Optimierung von Hochdruckanlagen und Laufwasserkraftwerken durchgeführt, die über nationale und europäische Fonds finanziert wurden. Sein Auftrag besteht darin, sich für eine moderne und nachhaltige Wasserkraft einzusetzen. Ein Auftrag, an dem sich OIKEN als neuer Partner beteiligen wird. Zu den Vorzeigeprojekten des Labors gehört CaVision. Im Rahmen dieses innovativen Projekts wurden Schallsensoren zur Zustandsüberwachung von Kraftwerken entwickelt. Diese tragen dazu bei, den schädlichen Auswirkungen von Kavitation und somit dem Verschleiss der Anlagen vorzubeugen. Nach Ablauf des Fünfjahresvertrags im Jahr 2026 plant das Labor, seine bisherigen Ergebnisse zu konsolidieren und neue Lösungen zur Stärkung der Wasserinfrastruktur in der Schweiz und Europa zu erarbeiten.

GENERATOREINBAU IM WASSERKRAFTWERK BONDO
Seit rund zwei Jahren laufen die Bauarbeiten für die Wiederinbetriebnahme des ewz-Kraftwerks Bondo im Bündner Bergell. Nun wurde mit dem Generator eines der Herzstücke des Kraftwerks eingebaut. Ab Frühling 2025 soll das Kraftwerk wieder erneuerbaren Strom produzieren. Das ewz-Kraftwerk Bondo steht seit dem Bergsturz vom Piz Cengalo im Sommer 2017 still. Der Zürcher Stadtrat genehmigte Ausgaben von 10,9 Millionen Schweizer Franken für den Wiederaufbau. Neben der Wasserfassung Prä werden auch die maschinellen Anlagen in der Energiezentrale erneuert. Anfang Januar konnte eines der Herzstücke des Kraftwerks eingebaut werden: der Generator. Am vergangenen Donnerstag wurde der 20 Tonnen schwere Rotor in den Stator eingefahren. Eine außergewöhnliche Herausforderung, bei der eine so schwere Last mit millimetergenauer Präzision positioniert werden muss. Nun steht die Ausrichtung der Maschine und das Auswuchten des Rotors an. Im Anschluss folgt die Montage aller Hilfsbetriebe sowie die Verkabelung der elektrischen Komponenten. In der Zwischenzeit wird die Wasserfassung Prä im Bondascatal fertiggestellt. Im Mai 2025 soll das Kraftwerk in Betrieb genommen werden. Dann wird es pro Jahr wieder 18 Gigawattstunden erneuerbaren Strom aus Wasserkraft ins Netz einspeisen.
Energieverteilung
Wasserversorgung
Wasserkraftanlagen
Inselanlagen
Planung / Konstruktion
Wasserkraftanlagen
Haus interne Fertigung von:

Hochdruck-Turbinen

Mittelspannungsanlagen

































T








Automatisierungen

Niederspannungsanlagen
Niederdruck-Turbinen Inselanlagen
Regelungen






Schutztechnik




Ratschings/Gasteig











Anlagen Revitalisierung Service & Montage vorher
















































Jahresproduktion liegt bei 480 GWh.
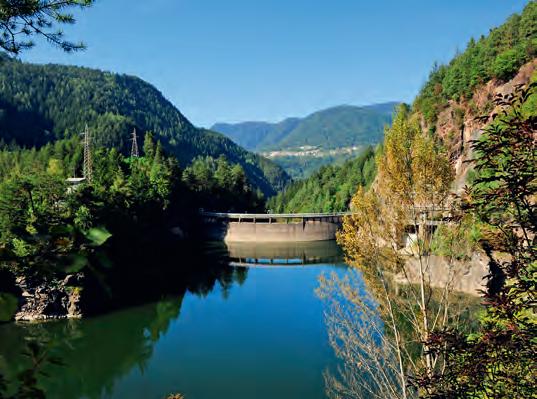
Einsatzleiter Alexander
Reuter und LEW-Taucher
Harald Schunn freuen sich über den „Zuwachs“ in der LEW Tauchergruppe.

GEMEINSAM FÜR EINE
ZUKUNFT.
MODERNISIERUNG AM KW ST. FLORIAN ABGESCHLOSSEN
Der Ausbau des Wasserkraftwerks St. Florian, das von SF Energy GmbH betrieben wird und an dem Alperia und die Gruppe Dolomiti Energia jeweils 50 Prozent halten, ist vor Kurzem abgeschlossen worden. Damit wurden die Energieproduktion, die Leistung und die Sicherheit gemäß den Konzessionsauflagen der Autonomen Provinz Bozen gesteigert. Im Rahmen des Ausbaus, der 2020 begonnen wurde, wurden die Maschinen im Wasserkraftwerk erneuert sowie die Sicherheit und die betrieblichen Abläufe der Anlage verbessert. Die Gesamtinvestitionen betrugen 27 Mio. Euro. Das Projekt wurde vom Bereich Engineering & Consulting von Alperia koordiniert, der den gesamten Prozess von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Abnahme begleitet hat. Dank der Modernisierung wird das Wasserkraftwerk St. Florian seine jährliche Produktion um etwa 15 Millionen kWh steigern können – das entspricht dem Jahresbedarf von 6.000 Haushalten.
NEUER TAUCHROBOTER UNTERSTÜTZT LEW-BERUFSTAUCHER
Die Berufstaucher von LEW Wasserkraft setzen seit Kurzem auf technische Unterstützung unter Wasser: Der neue Tauchroboter „Nautilus“ ergänzt das Team bei Inspektionen und Wartungsarbeiten. Das ferngesteuerte Fahrzeug ist mit einer hochauflösenden Kamera, einem Greifarm und einem Navigationssystem ausgestattet. Im Einsatz am Kraftwerk Altusried prüfte der Roboter kürzlich einen 10 m tiefen Schacht an der Iller auf Schäden und erstellte detaillierte Bildaufnahmen für die Analyse. „Die Nautilus erlaubt uns, Einsatzorte vorab zu erkunden und gezielte Maßnahmen zu planen“, erklärt Einsatzleiter Alexander Reuter. Der Roboter wird von Land aus gesteuert und kann in gefährlichen Bereichen eingesetzt werden, die für die Taucher ein erhöhtes Risiko darstellen. Die Arbeitstiefe von bis zu 305 m und eine Reichweite von 300 m machen ihn besonders vielseitig.

WASSERKRAFTWERK STEGENWALD SALZBURG-AG.AT/WIRARBEITENDRAN
KRAFTWERK LEUTASCH: RÜCKENWIND FÜR KRAFTWERKSPROJEKT
Wie das Landesverwaltungsgericht Tirol unlängst mitteilte, ist im Widerstreitverfahren um das geplante grenzüberschreitende Kraftwerk in der Geisterklamm eine Entscheidung zugunsten der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen und gegen einen privaten Interessenten gefallen. Im Zuge des Widerstreitverfahrens wurde geprüft, welches Projekt dem öffentlichen Interesse besser dient. Die zuständigen Behörden entschieden sich für das bayerische Kraftwerkskonzept, da dieses eine ca. zehnmal höhere Stromproduktion verspricht. Laut dem Gericht kommt dabei dem Klimaschutz eine wichtige Rolle zu: Eine höhere Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen reduziere die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das Landesverwaltungsgericht Tirol betonte aber gleichzeitig, dass diese Entscheidung noch nicht grünes Licht für die endgültige Realisierung des Projekts bedeutet. Dafür fehlen noch die wasser- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen.
KERSTIN ANDREAE IST „ENERGIEMANAGERIN DES JAHRES“
Die E&M-Auszeichnung „Energiemanager des Jahres“ geht dieses Mal an eine Verbandsmanagerin. Die Jury hat sich mit großer Mehrheit für Kerstin Andreae ausgesprochen, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Sie steht seit 2019 an der Spitze des größten deutschen Energieverbands mit seinen rund 2.000 Mitgliedsunternehmen. Eine Jury mit Experten und Expertinnen aus Energiewirtschaft, Wissenschaft und Medien bestimmt die jährliche Preisträgerin beziehungsweise den jährlichen Preisträger. Die Jury hat überzeugt, wie Andreae den BDEW in den vergangenen Jahren durch bewegte Zeiten geführt hat. Nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen hat sie maßgeblich dazu beigetragen, die Gasversorgung in Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen.
alte Kraftwerksstandort in der Geisterklamm soll wiederbelebt werden. Nun wurden juristisch erste Pflöcke dafür eingeschlagen.








KRAFTWERKE OBERHASLI AG FEIERT 100-JÄHRIGES JUBILÄUM
Im Jahr 2025 feiert die Kraftwerke Oberhasli AG ihr 100-jähriges Jubiläum. Ende Juni gibt es an der Grimsel ein großes Fest für die Öffentlichkeit. Die Kraftwerke Oberhasli AG wurde am 20. Juni 1925 in Bern gegründet. Federführend im Planungsprozess war die damalige Bernische Kraftwerke AG BKW (heute BKW Energie AG). Die BKW hatte bereits 1906 eine Konzession zur Ausnutzung der Wasserkräfte im Oberhasli erhalten. Mit der eigenständigen Aktiengesellschaft KWO verfolgte man die Idee, weitere Partner für das Vorhaben zu gewinnen. Dies gelang jedoch erst nach einiger Zeit: 1928 kam die Stadt Basel als Aktionärin dazu, 1930 die Stadt Bern und 1938 die Stadt Zürich. Seither ist die KWO ein Partnerwerk mit bis heute gleichgebliebenen Besitzverhältnissen: Die KWO gehört zur Hälfte der BKW, die andere Hälfte teilen sich die drei Städte Basel, Bern und Zürich.
FREIE BAHN FÜR DEN BAU DES KRAFTWERKS GEMÜND
Wie die Kölnische Rundschau unlängst in ihrer Online-Ausgabe berichtete, kann das Kraftwerk Gemünd endlich realisiert werden. Nicht weniger als 15 Jahre Vorlaufzeit liegen zwischen den ersten Planungen und der nun erfolgten Genehmigung. Die entscheidende Hürde war bislang der Schutz der Äschenlarven in der Urft, die in Gemünd in der Eifel zur Energiegewinnung genutzt werden soll. Erst unlängst hatte das Verwaltungsgericht in Aachen eine Auflage des Kreises Euskirchen zurückgenommen, wonach das geplante Wasserkraftwerk zum Schutz von Äschenlarven zwei Monate im Jahr abgeschaltet werden müsse. Einen Überblick über die Äschenpopulation soll dagegen ein Monitoring liefern, das vor und nach dem Bau erfolgen soll. Das Kraftwerk wird in Betrieb rund 450.000 kWh sauberen Strom im Jahr liefern.
MESSTECHNIK-PIONIER VERABSCHIEDET SICH IN RUHESTAND Er hat VEGA, den Hersteller für Füllstand- und Druckmesstechnik aus Schiltach, geprägt wie kaum ein anderer: Nach mehr als 50 Jahren im Unternehmen, davon 25 Jahre in der Geschäftsleitung, ging Günter Kech zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand. Er war an der Entwicklung der ersten Geräte mit Ultraschall-Messtechnik in den 1970erJahren ebenso beteiligt wie an der des ersten Radar-Zweileitergeräts der Welt, mit dem VEGA 1997 eine Sensation gelang und die den Grundstein für die Marktführerschaft legte. Ebenfalls revolutionär: die Einführung der Plattform plics® im Jahr 2003, die als innovatives Baukastensystem die Bedienung aller Messprinzipien vereinheitlicht hat. Günter Kech: „Ich habe mich immer als Richtungsgeber, Entscheider und Dienstleister für die Mitarbeiter gesehen.“

Das neue Kleinwasserkraftwerk Turbach in Gstaad soll ab 2026 alljährlich rund 7,3 Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren.
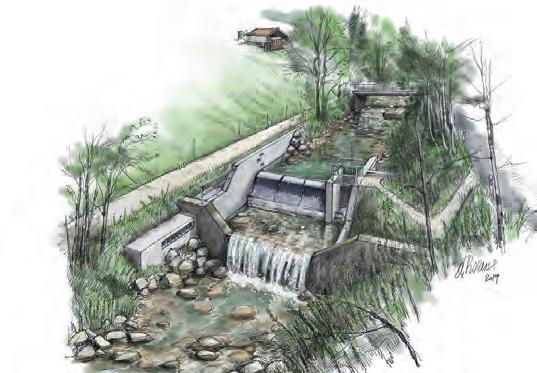
BAU VON KRAFTWERK TURBACH IM BERNER OBERLAND SCHREITET VORAN
Zwischen Sommer 2024 und 2026 baut die Kraftwerk Turbach AG, eine Partnerschaft der BKW mit der Grünstromproduzentin aventron, ein neues Kleinwasserkraftwerk in Gstaad im Kanton Berner Oberland. Nach seiner Fertigstellung wird die Anlage pro Regeljahr rund 7,3 GWh erneuerbaren Strom produzieren. Seit Mitte September des Vorjahres wird an der Errichtung der Wasserfassung, der Druckrohrleitung und der Zentrale gleichzeitig gearbeitet. Die ersten vorbereitenden Bauarbeiten begannen bereits im Juni mit der Einrichtung der Installationsplätze und des Materialaufbereitungsplatzes. Die Grabenund Rohrverlegearbeiten für die rund 3.000 m lange Druckrohrleitung starteten im Juli, rund die Hälfte des Kraftabstiegs konnte bis zur Winterpause bereits verlegt werden. Nach der witterungsbedingten Unterbrechung werden im Frühjahr 2025 die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Ab März 2025 folgen die Ergänzung des Aushubs und der Baugrubenabschlüsse, der Rohbau des Zentralengebäudes sowie die Anlieferung und der Einbau des Turbinengehäuses. Der BKW-Projektleiter Patrick Manz zeigte sich im November hinsichtlich des Projektfortschritts zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir mit diesem wichtigen, nachhaltigen Projekt so gut vorwärtskommen wie bisher.“ Das Kraftwerk nutzt das Wasser des Turbachbachs mit einem Bruttogefälle von rund 230 m und wird zukünftig mit seiner auf 2,5 MW Engpassleistung ausgelegten Pelton-Turbine Ökostrom für ca. 1.400 4-Personen-Haushalte erzeugen.

Vertragsunterzeichnung für das neue Kraftwerk Øksenelvane – links vorne: Knut Arild Flatjord, General Manager von SFE Produksjon AS, links hinten: Bjarte Lofnes Hauge, General Manager von Firdakraft AS, rechts vorne: Kjetil Toverud, Managing Director von ANDRITZ Hydro AS in Norwegen, rechts hinten: Ole Johnny Winther, Business Unit Manager Large Hydro von ANDRITZ Hydro AS.
ANDRITZ ERHÄLT AUFTRAG FÜR KRAFTWERK ØKSENELVANE IN NORWEGEN Sogn og Fjordane Energi (SFE), ein führender Lieferant erneuerbarer Energie im Westen Norwegens, hat über die 100-prozentige Tochtergesellschaft Firdakraft AS ANDRITZ einen Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstungen für das neue Wasserkraftwerk Øksenelvane in Bremanger erteilt. Das neue Kraftwerk wird neben dem bestehenden errichtet, das nach über 70 Jahren Betrieb stillgelegt wird. Der Auftrag umfasst die Konstruktion, Fertigung und Lieferung hocheffizienter Ausrüstung sowie deren Montage, Testbetrieb und Inbetriebnahme. ANDRITZ wird zwei hochmoderne Peltonturbinen mit einer installierten Leistung von je 55 MW einschließlich Turbinenreglern, Hauptabsperrorganen, Druckrohrleitungen und Kühlsystemen liefern. Ebenfalls Teil des Lieferumfangs sind zwei Generatoren, Nebenanlagen, Erregersysteme mit Transformatoren sowie umfassende komplette Automatisierungs- und Überwachungssysteme. Mit einer erwarteten Jahresproduktion von 171 GWh wird das neue Kraftwerk Øksenelvane 21 GWh mehr saubere Energie erzeugen als die bestehende Anlage, was eine beachtliche Steigerung bedeutet. Die Maschinensätze wurden speziell dafür konzipiert, die Netzstabilität zu unterstützen und wertvolle Netzdienstleistungen zu erbringen. Das Projekt, das 2028 abgeschlossen sein soll, wird eine wichtige Rolle beim Beitrag von SFE zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Norwegen spielen. Derzeit erzeugt SFE jährlich 2,4 TWh Strom aus erneuerbaren Quellen und deckt damit den Bedarf von rund 130.000 norwegischen Haushalten.

Impression vom Anwenderforum 2024 im deutschen Kempten. 2025 findet die Veranstaltung am 24. & 25. September in der Graubündner Gemeinde Landquart

ANWENDERFORUM KLEINWASSERKRAFT IM HERBST 2025 IN DER SCHWEIZ
Das Anwenderforum Kleinwasserkraft ist das praxisnahe Forum für Betreiber, Planer und Hersteller von Kleinwasserkraftanlagen. 2025 wird die Fachveranstaltung am 24. und 25. September in der Schweizer Gemeinde Landquart stattfinden. Den Veranstaltern liegt es am Herzen, den Austausch und die Stärkung des Gemeinschaftsgeistes in der Branche voranzutreiben. Gemeinsam will man den Anteil der kleinen Wasserkraft am Energiemix weiter ausbauen. Es braucht Ideen und Strategien, wie sich die Kleinwasserkraft mit intelligenten Konzepten und dem Schutz der Umwelt in Wirtschaft und Gesellschaft am besten durchsetzen kann – und genau diese werden auf dem Forum diskutiert. Durch die Fokussierung auf Praxiserfahrungen und Anwendungen füllt das Forum eine wichtige Lücke bei der Weiterentwicklung der Kleinwasserkraft. Eine weitere Besonderheit ist das grenzüberschreitende Zusammentreffen von Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Alpenraum.


NEUES VORSTANDSTEAM FÜR ENERGIE STEIERMARK
Mitte Dezember 2024 hat der Aufsichtsrat der Energie Steiermark einstimmig beschlossen, DI (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA (48) und MMag. Werner Ressi (57) für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstand des Konzerns zu bestellen. Der entsprechende Prozess wurde im Juli gestartet, rund 30 internationale BewerberInnen stellten sich dem Auswahlverfahren. „Wir sind davon überzeugt, mit den Persönlichkeiten des neuen Vorstands-Teams Kraft ihrer Expertise eine hervorragende Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Energie Steiermark als wichtigstes Landes-Unternehmen zu haben“, so der Präsident des Aufsichtsrates, Univ.-Prof. DI Karl Rose. Werner Ressi wird zukünftig u.a. die Bereiche Erzeugung, Vertrieb, Technik, Fernwärme und Informationstechnologie verantworten. Martin Graf wird weiterhin u.a. die Bereiche Finanzen, Controlling, Treasury, Recht sowie Personal und den Bereich der Netze verantworten.





EWO STARTET VORPROJEKT FÜR PSKW SARNERSEE – LUNGERERSEE
Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) prüfte im vergangenen Jahr das Projekt Pumpspeicherkraftwerk Sarnersee – Lungerersee mittels einer Machbarkeitsstudie, die positiv ausgefallen ist. Aus vier geprüften Varianten folgt nun ein Vorprojekt für die beste Variante, verlautbarte die EWO Anfang 2025. Als beste Lösung erwies sich eine Variante, die aus einer Zubringer- und einer Hauptpumpturbine sowie einer erdverlegten Druckleitung zwischen dem Sarnersee und dem Kraftwerk Unteraa besteht. Diese Lösung überzeugt durch ihre technische Machbarkeit, die vertretbaren Kosten und die daraus resultierende optimale Wirtschaftlichkeit. Zudem wird ein Teil der bestehenden Infrastruktur des Lungererseewerks genutzt, wodurch eine ressourcenschonende Synergienutzung ermöglicht wird. Aufgrund dieser Vorteile wird diese Variante in das Vorprojekt überführt. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Variante belaufen sich auf rund 56 Millionen CHF.

SALZBURGER GEMEINDE BERGHEIM ERRICHTET NEUES KLEINKRAFTWERK In der an die Salzburger Landeshauptstadt angrenzende Gemeinde Bergheim sind die Arbeiten zur Errichtung des neuen Kleinwasserkraftwerks Muntigl voll im Gange. Die Laufwasserkraftanlage mit einer Leistungskapazität von ca. 260 kW entsteht direkt an der Einmündung des Gewässers Fischach in die Salzach. Für die Lieferung der elektromaschinellen Ausrüstung und den Stahlwasserbau sorgt der oberösterreichische Kleinwasserkraftallrounder Jank GmbH. Rund 4 Millionen Euro werden von der Gemeinde in den Bau des Kraftwerks investiert, wobei der erzeugte Ökostrom für die Deckung des kommunalen Energiebedarfs aufgewendet wird. Die Realisierung der Anlage ist an einige Herausforderungen gekoppelt. Dazu zählen die naheliegende Gleise der Salzburger Lokalbahn und die unmittelbare Nähe des Abwassersammelkanals der Landeshauptstadt sowie eine am Kraftwerk vorbeiführende Hochdruck-Erdgasversorgungsleitung.

• 10x leichter als Beton
• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen
• Optimale hydraulische Eigenschaften
• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit
• Einfache Verlegung in jedem Gelände
• Erfahrene Anwendungstechnik / Engineering
• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)
• Entwickelt für Generationen
Die interaktive Karte findet man online unter der Adresse https://oesterreichsenergie.at/wassermassnahmen
Wikimedia / Martin Lopatka
© Oesterreichs Energie

INTERAKTIVE KARTE MIT ÖKOLOGISCHEN VERBESSERUNGSMASSNAHMEN
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie bildet die Grundlage für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Gewässern. Die Verbesserungsmaßnahmen, die die österreichischen Wasserkraftunternehmen im Zuge des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans bereits gesetzt haben, hat Oesterreichs Energie, der Verband der österreichischen E-Wirtschaft, nun in Form einer digitalen Karte veröffentlicht. Aktuell umfasst diese Darstellung rund 170 Projekte zur Verbesserung der Gewässerökologie - von Fischwanderhilfen und Restwasseranpassungen über Renaturierungen bis hin zu Strukturierungsmaßnahmen. Die Karte wird laufend aktualisiert und zeigt damit den Fortschritt in der Umsetzung des Maßnahmenprogramms für aquatische Ökosysteme. Insgesamt haben die Wasserkrafterzeuger bei der Umsetzung dieser Maßnahmen mehr als 300 Millionen Euro in die Gewässerökologie in Österreich investiert.
KANADISCHE PROVINZEN SCHLIESSEN NEUE VEREINBARUNG
Maschinenhalle des kanadischen Kraftwerks Churchill Falls mit 5.428 MW Leistungskapazität.

Koehler-Gruppe

Die kanadische Provinz Neufundland und Labrador hat ein wegweisendes Verständigungsmemorandum mit dem benachbarten Quebec unterzeichnet, das die Wasserkrafterzeugung in Labrador grundlegend neugestaltet, berichtete Mitte Dezember „Eulerpool News“. Diese Vereinbarung soll bis 2075 schätzungsweise 200 Milliarden kanadische Dollar lukrieren. Die neue Abmachung ersetzt den umstrittenen Vertrag von 1969, der die Stromexporte von der Churchill-Falls-Anlage regelte und Jahrzehnte lang für Spannungen zwischen den Provinzen sorgte. Obwohl Neufundland und Labrador die Mehrheit der Anlage besitzt, flossen die Einnahmen größtenteils nach Quebec. Dies lag an Quebecs Rechten, Strom zu extrem niedrigen Festpreisen zu erwerben und mit profitablen Margen in die USA weiterzuverkaufen. Die Premierminister der Provinzen betrachten die neue Lösung als Gewinn für beide Seiten.
KOEHLER-GRUPPE ERWIRBT SCHOTTISCHES WASSERKRAFTWERK Koehler Renewable Energy setzt seine Expansion im Bereich der Entwicklung von Kraftwerken zur Erzeugung nachhaltiger Energie fort und hat am 1. November 2024 das Pitnacree Wasserkraftwerk in Schottland erworben. Das Unternehmen hat die Akquisition über seine Tochtergesellschaft in Großbritannien abgeschlossen. Das Pitnacree Wasserkraftwerk befindet sich auf dem Pitnacree Estate, Ballinluig, in der Nähe von Pitlochry, Schottland. Es wurde von den Eigentümern des Pitnacree Estates entwickelt und gebaut und ist seit der Inbetriebnahme im Dezember 2015 ein wichtiger Bestandteil der erneuerbaren Energieinfrastruktur in der Region. Mit einer installierten Leistung von 300 kW und einer hohen Effizienz von 82 Prozent bei maximalem Wasserdurchfluss von 236 l/s sichert das Wasserkraftwerk eine zuverlässige Energieversorgung.

Wellenschwingungsmessung
Diagnose 24/7 oder mobil
Erfassen von Bus-Daten
Schockrobuste Messgeräte
Software Updates kostenlos








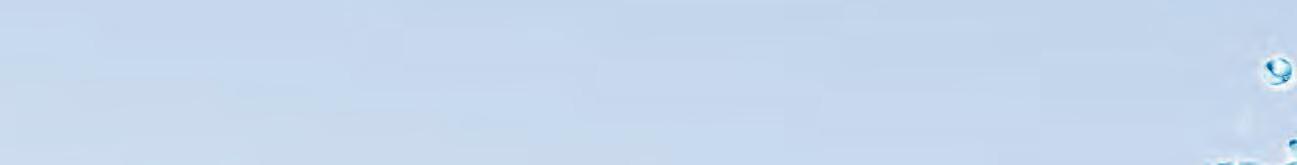









































































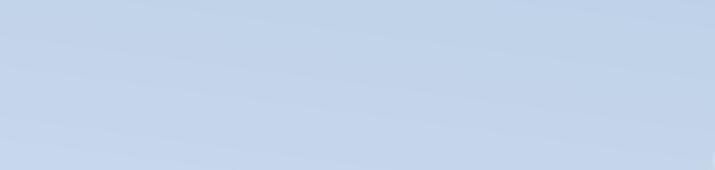
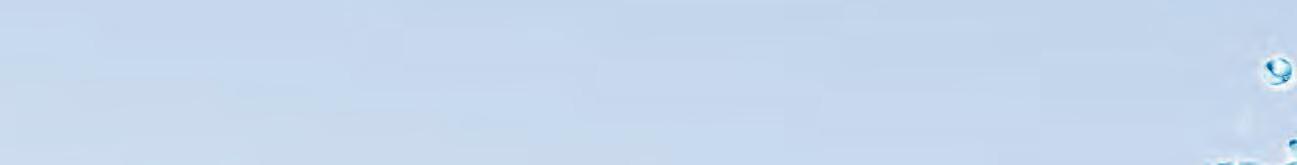

































Alles aus einer Hand – ETERTEC unterstützt Sie bei Rohrleitungsprojektierung, Engineering und der Auswahl der richtigen Produkte und Zubehörteile, sorgt für die Logistik zur punktgenauen Lieferung und führt die Baustellenbetreuung bei der Verlegung der Rohrsysteme oder der Sanierung durch.
ETERTEC ist Ihr Spezialist für GFK-Rohrsysteme und verkauft GFK-Rohre von namhaften ISO 9001 zertifizierten Herstellern. Mit unseren GFK-Formteilen –Kurzrohre und Sonderrohre aus GFK – runden wir unser Lieferprogramm ab.
Produktportfolio:
•Kreisrund Nennweiten DN100 bis DN 4000
•Druckstufen PN 1 bis PN 32
•Standardbaulängen 3, 6 bzw. 12 Meter
•Standardfestigkeiten SN 2500, 5000 und 10000
•Sonderrohre (Oval, Ei, Maul, Quadrat) bis DN 3000 auf Anfrage!
Gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, von der Beratung bis hin zur Ausführung, sind unser Markenzeichen.













Wasserkraftwerke dürfen seit 1959 in Österreich nur mehr befristet bewilligt werden. Dabei beträgt die Maximaldauer einer solche Befristung 90 Jahre. Der Ablauf dieser Frist bedeutet jedoch nicht das Ende der Wassernutzung, das Wasserrecht kann unter bestimmten Voraussetzungen wiederverliehen werden. Entscheidendes Kriterium für eine solche Wiederverleihung ist eine Anpassung des Wasserkraftwerks an den aktuellen Stand der Technik. Die Überprüfung dieser Voraussetzung erfolgt im Rahmen eines Wiederverleihungsverfahrens, das immer wieder Anlass für negative Überraschungen bietet.
Die häufigsten Fallen und Stolpersteine im Wiederverleihungsverfahren sind:
- Rechtzeitige Antragstellung innerhalb der vorgegebenen Fristen
- Anpassung an den Stand der Technik
- Erwirkung der Zustimmung für die Inanspruchnahme fremder Rechte
Der Antrag auf Wiederverleihung kann frühestens fünf Jahre und muss spätestens sechs Monate vor Ablauf der Befristung des Wasserrechts gestellt werden. Eine verspätete Antragstellung ist von der Behörde zurückzuweisen und hat zur Folge, dass das Wasserrecht mit Ablauf der Befristung automatisch wegfällt (ein Bescheid ist nicht notwendig), Betreiber:innen sind dann verpflichtet, letztmalige Vorkehrungen zu treffen. Als Lichtblick am Horizont ist jedoch festzuhalten, dass die Judikatur bei Versäumung der Frist eine „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ ermöglicht. Wird die Frist aufgrund eines unvorhersehbaren und unabwendbaren Ereignisses versäumt, kann binnen vierzehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein Wiedereinsetzungsantrag unter zeitgleicher Einbringung des Wiederverleihungsantrags gestellt werden. Ein solcher Antrag ist oft die letzte Möglichkeit, den Verlust des Wasserrechts abzuwenden.
Sinn der Wiederverleihung ist es, die Wasserkraftnutzung stets am aktuellen Stand der Technik zu halten. Bei zahlreichen aktuell anstehenden Wiederverleihungen ist insbesondere die nachträgliche Errichtung eines Fischaufstiegs eine notwendige Voraussetzung für die Wiederverleihung dar. Die Vorgehensweisen der Behörde sind dabei unterschiedlich. Teilweise wird ein Anpassungsverfahren (im Ergebnis ein Änderungsbewilligungsverfahren) von den Behörden vorgezogen und aufgrund des dann erlassenen Bescheides erst das Wiederverleihungsverfahren durchgeführt. Welche Maßnahmen konkret durchzuführen sind, um die Anlage an den Stand der Technik anzupassen, sollte immer mit den Behörden vorab geklärt werden um sich unangenehme Überraschungen im Wiederverleihungsverfahren zu ersparen. Ob und welche dieser Maßnahmen letztlich tatsächlich erforderlich sind, um den Stand der Technik zu erreichen, ist in vielen Fällen ein wesentlicher Streitpunkt.
Oft wird vergessen, dass durch die Wiederverleihung das Wasserbenutzungsrecht neu erteilt wird. Aus diesem Grund müssen auch Zustimmungserklärungen im Wiederverleihungsverfahren erneuert werden. Zustimmungen sind von allen betroffenen fremden Rechten (insbesondere Grundeigentümer:innen) erforderlich. Hier erweist sich die Judikatur als besonders streng: Im Fall des Vorliegens von Verträgen mit Grundeigentümer:innen wird nämlich im Zweifel angenommen, dass die Zustimmung nur für die Dauer des befristeten Wasserrechtes erteilt wurde, nicht aber auf unbestimmte Zeit. Durch kluge Vertrags-
gestaltung mit Grundeigentümern kann für künftige Wiederverleihungen sichergestellt werden, dass nicht neuerlich Verträge abgeschlossen und möglicherweise neue Entschädigungen gezahlt werden müssen.
Im Wiederverleihungsverfahren selbst sollte darauf hingewirkt werden, eine möglichst lange Bewilligungsdauer zu erhalten. Das WRG gibt hier einen Rahmen bis zu 90 Jahren vor, dem seitens der Behörde immer wieder mit dem ständigen Anpassungsbedarf gekontert wird. Tatsächlich haben aber gerade die jüngsten Anpassungen in Folge der Umsetzung des Wasserrahmenrichtlinie (Stichwort Sanierungsverordnungen nach § 33 d, Anpassungen nach § 21a) gezeigt, dass eine lange Befristung eines Wasserrechtes einem erforderlichen Eingriff im öffentlichen Interesse nicht entgegenstehen. Im Sinne eines effizienten Behördenverfahrens ist es daher durchaus sinnvoll, Wasserrechte eher länger als kürzer zu befristen. Konsensdauern von 40 bis 60 Jahren sollten daher eher der Standard als die Ausnahme sein. Deutlich kürzere Konsensdauern dienen eher der Arbeitsbeschaffung für Behörden, als einer effizienten Bewirtschaftung der Gewässer.
Keiner Wiederverleihung bedarf in der Regel die naturschutzrechtliche Bewilligung, sofern diese nicht ihrerseits befristet wurde. Die Naturschutzgesetze kennen aber das Institut der Wiederverleihung nicht, was gerade bei befristeten Naturschutzbescheiden zu einem Problem werden kann. Wasserbenutzungsrechte können nämlich während der Dauer des Wiederverleihungsverfahrens weiter genutzt werden. In Ermangelung einer vergleichbaren Regelung in den Naturschutzgesetzen führt dies dazu, dass bei einer Befristung das naturschutzrechtliche Neubewilligungsverfahren im Zeitpunkt des Ablaufs der Befristung bereits abgeschlossen sein muss, weil der Fortbetrieb ansonsten nicht mehr gedeckt ist. In solchen Fällen sind Betreiber:innen daher aufgerufen, so rechtzeitig eine neue Bewilligung zu beantragen, dass diese dann auch rechtzeitig vorliegt.
Das Leid bei der Wiederverleihung ist vielfältig. Die Verfahren müssen rechtzeitig geplant und eingeleitet werden, um den Worst-Case einer Neubewilligung zu vermeiden. Rechtzeitige Vorbereitung und kluge Vorgehensweise lässt die Verfahren aber meist ohne Probleme bewältigen.
Von
Berthold Lindner
Berthold Lindner berät und begleitet Wasserkraftbetreiber:innen bei der Umsetzung von Projekten und im laufenden Betrieb. Als Mitautor des WRG-Kommentars von Oberleitner/ Berger ist er als kompetenter Ansprechpartner im Wasserrecht bundesweit tätig.

Kontakt: Lindner Stimmler Rechtsanwälte GmbH & Co KG Lindner@lindnerstimmler.at


Das Kraftwerksgebäude für das neue KW Intschialp wurde auf 1.386 m Seehöhe errichtet. Die Anlage dient der Optimierung der seit rund 115 Jahren bestehenden Energieproduktion aus Wasserkraft auf dem Arni in der Gemeinde Gurtnellen.
Kurz vor dem Jahreswechsel konnte das neueste Kraftwerk des Urner Energiedienstleisters energieUri, das Kraftwerk Intschialp, erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die neue Ökostromanlage nutzt dabei bislang brachliegendes Potenzial im Triebwasserweg des Traditionskraftwerks Arniberg. Mit der 330 Kilowatt starken Durchströmturbine erzeugt das Kraftwerk Intschialp im Regeljahr rund 600.000 kWh, was in etwa dem Verbrauch von 140 Haushalten entspricht.
Die Nutzung der Wasserkraft auf dem Urner Arni hat Tradition und geht auf eine technische Pionierleistung zurück, deren Bedeutung über die Schweizer Grenzen hinaus reicht. Als das Kraftwerk Arniberg 1910 in Betrieb genommen wurde, gab es in ganz Europa noch kein Kraftwerk, das für eine derart hohe Gefällstufe gebaut wurde. Die 852 Meter Fallhöhe stellten zu diesem Zeitpunkt eine Rekordmarke dar, und die Umsetzung des Kraftwerks gilt bis heute als ingenieurtechnische Meisterleistung. Gespeist wird die Anlage unter anderem von den beiden Bächen Leitschachbach und Intschialpbach, für deren Nutzung energieUri bereits 1908 die ursprüngliche Konzession erwirkte. Das Triebwasser aus beiden Gewässern fließt in den Sammelschacht Torli, von wo aus es in den Arnisee geführt wird. Dabei handelt es
sich um einen künstlich angelegten Speicher, der mit einem Nutzinhalt von 175.000 m3 vom Kraftwerk Arniberg als Wochenspeicher bewirtschaftet wird. Zwischen 1967 und 1969 wurde das Kraftwerk im Wesentlichen erneuert und modernisiert.
OPTIMIERT BESTEHENDE ENERGIEPRODUKTION
Um die Gefällstufe zwischen der bestehenden Wasserfassung am Leitschachbach und dem Sammelschacht Torli hydroelektrisch zu nutzen, wurde 2009 das Kraftwerk Leitschach errichtet. Das Oberlieger-Kraftwerk zum Kraftwerk Arniberg verfügt über eine Bruttofallhöhe von 23 m und kann einen Konzessionsdurchfluss von 1,1 m3/s nutzen. Analog zum Konzept des KW Leitschach beschloss energieUri 2022 auch das verbliebene hydroelektrische Potenzial am Intschialpbach
zu heben. Konkret sollte mit dem neuen Kraftwerk Intschialp die bestehende Gefällstufe zwischen der Quelle Näcki und dem Sammelschacht Torli zur Energieproduktion genutzt werden. Da die Ausbauwassermenge unverändert bleibt und somit nicht in die bestehende Konzession eingegriffen wird, konnte man sich auf Seiten der Projektbetreiber auch eine zusätzliche Gewässerschutzbewilligung ersparen. Wie beim KW Leitschach ist die Anlage auf einen Durchfluss von 1,1 m3/s ausgelegt, die Bruttofallhöhe liegt bei knapp 26 Metern. Mit der Projektrealisierung setzt der Urner Energiedienstleister ein weiteres Zeichen für den Ausbau seines Kraftwerksportfolios. „Unser jüngstes Kraftwerksprojekt optimiert die bereits seit rund 115 Jahren bestehende Energieproduktion aus Wasserkraft auf dem Arni in der Gemeinde Gurtnel-

len weiter“, sagt Werner Jauch, CEO von energieUri. Im Frühsommer 2024 erfolgte der Startschuss für die Bauarbeiten.
NEUER KRAFTABSTIEG – NEUES KRAFTHAUS
Diese konzentrierten sich im Wesentlichen auf die Errichtung des neuen Krafthauses in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Maschinenhaus des KW Leitschach sowie den Bau der Druckrohrleitung. Die bestehende Wasserfassung Intschialpbach blieb in ihrer Funktion und Ausführung unverändert. „Der neue Kraftabstieg ersetzt über eine Länge von rund 800 m die bestehende Hangrohrleitung, eine Freispiegelleitung aus Gusseisen und Kunststoff, die zum Teil bereits am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt war“, erklärt Heinz Niederberger, Senior Projektleiter
Energie bei energieUri. Die neue Druckrohrleitung wurde mittels GFK Rohre der Dimension DN800 im Bereich der bestehenden Rohrtrasse unterirdisch verlegt.
Auf 1.386 m Seehöhe wurde das neue Kraftwerksgebäude errichtet, in dem die gesamte elektromechanische Ausrüstung, die dazugehörigen Hilfssysteme sowie die neue Transformatorenstation inklusive Niederspannungsverteilung untergebracht sind. Es wurde als Betonbau mit begrüntem Flachdach ausgeführt, wodurch es sich hervorragend in die Naturlandschaft des Arni einfügt.
TURBINE ÜBERZEUGT MIT ROBUSTHEIT
Das technische Herz der Anlage bildet eine Durchströmturbine, die über zwei regulierbare Zellen verfügt. Für die Betreiber die richti-

ge Maschine unter den gegebenen Umständen. Heinz Niederberger: „Die Funktion der Entsanderanlage in der bestehenden Wasserfassung ist prinzipiell gut, aber nicht mehr 100-prozentig sicher. Und da wir sie nicht umbauen konnten, fiel unsere Wahl auf eine hochrobuste Maschinenvariante – und das ist die Durchströmturbine von Ossberger, die mitunter auch mit schwierigen Triebwasserbedingungen problemlos zurechtkommt.“ Bei einem Schluckvermögen von 1,1 m3/s und einer Nettofallhöhe von 22,32 m erreicht die Turbine eine Nennleistung von rund 330 kW. Über ein Präzisions-Stirnradgetriebe erfolgt die Kraftübertragung an einen Synchrongenerator mit 306 kVA Leistung.
Die erzeugte Energie wird anschließend zur neuen Niederspannungsverteilanlage transportiert und danach über einen Transformator von 0,4 kVA auf 15 kVA hochgespannt. Über die Mittelspannungsschaltanlage wird die Energie ins Netz von energieUri eingespeist. Das neue Kraftwerk wurde in das übergeordnete Leitsystem des Urner Energiedienstleisters eingebunden und wird von dessen 24-Leitstelle im Urner Kantonshauptort Altdorf aus via Fernsteuerung überwacht und gesteuert.
BYPASS GARANTIERT SICHEREN BETRIEB
Konzipiert ist die Anlage als reines Laufkraftwerk. „Das heißt, dass die Leistung der Zweizellen-Crossflow-Turbine analog dem Abfluss des Intschialpbachs verläuft. Über die Turbine wird somit der Staupegel am Einlaufschacht geregelt“, erklärt Heinz Niederberger. Da das neue Kraftwerk Intschialp als Oberstufe zum Kraftwerk Arniberg fungiert, muss gesichert sein, dass auch bei eventuellen Betriebsstörungen oder während Abschaltungen
Technische Daten
• Netto-Fallhöhe: 22,32 m
• Ausbaudurchfluss: 1,1 m3/s
• Turbine: Durchströmturbine
• Anzahl der Zellen: 2
• Fabrikat: Ossberger
• Drehzahl: 685 Upm
• Leistung elektr.: 330 kW
• Generator: Synchron
• Drehzahl: 1.010 Upm
• Generatorspannung: 3 x 400 V
• Druckrohrleitung: Länge: ca. 800 m
• Material: GFK
• Energieproduktion: ca. 600.000 kWh
• Inbetriebnahme: Dez. 2024
Hydraulisches Schema der Stromproduktion auf dem Arni. Die beiden Kraftwerke Intschialp und Leitschach sind als Oberlieger-Kraftwerke des Traditionskraftwerks Arniberg situiert. Beide sind als reine Laufkraftwerke konzipiert.

das Triebwasser ungehindert in den Sammelschacht Torli gelangt. Aus diesem Grund wurde parallel zum Absperrorgan im neuen Maschinenhaus ein Bypass vorgesehen. „Der Bypass verfügt über ein Ringkolbenventil, das für eine geregelte Abgabe des Triebwassers in den Unterwasserkanal sorgt. Es muss sichergestellt sein, dass bei einem Turbinenausfall das Wasser nicht in die Hangrohrleitung gestaut wird“, so der Senior Projektleiter Heinz Niederberger.
STROM FÜR 140 HAUSHALTE
Kurz vor dem Jahreswechsel war es schließlich soweit. Nach einer Bauzeit von circa einem halben Jahr produzierte das neue Kraftwerk Intschialp ein erstes Mal Strom aus erneuerbarer Urner Wasserkraft. Mit seiner elektromechanischen Ausrüstung wird die Ökostromanlage im Durchschnittsjahr rund 600.000 kWh sauberen Strom erzeugen. Das bedeutet,
dass damit in etwa 140 Urner Haushalte mit lokal erzeugtem, erneuerbarem Strom versorgt werden können. Das Kraftwerk stellt somit einen weiteren kleinen Baustein in der Gesamtenergiestrategie von energieUri sowie in den energiepolitischen Zielsetzungen der Schweiz dar.
Im Zuge des Kraftwerksbaus nutzten die Projektbetreiber auch sich bietende Synergiemöglichkeiten. So wurden etwa bestehende Freileitungen zurückgebaut. Außerdem wurde eine neue Trafostation installiert und in Betrieb genommen, die zu einer weiteren Erhöhung der Versorgungssicherheit vor Ort beitragen wird.
13. WASSERKRAFTWERK SEIT 2006
Für energieUri ist das Kraftwerk Intschialp das 13. Wasserkraftwerk, das der Urner Energiedienstleister zusammen mit Partnern in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt hat.

Diese Aus- und Neubauprojekte sorgen auch für konkrete Wertschöpfung vor Ort. „Für diese 13 Kraftwerksprojekte haben wir zusammen mit Partnern fast 140 Millionen Franken investiert; rund 80 Prozent davon blieben in Form von Aufträgen für lokale Unternehmen im Kanton Uri“, betont Werner Jauch und ergänzt: „Im Betrieb generieren diese Kraftwerke zudem jährlich namhafte Abgaben von circa 4 Millionen Franken für die öffentliche Hand. Zudem schaffen die Projekte hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region. “ Total betragen die jährlichen finanziellen Leistungen von energieUri an die Urner öffentliche Hand damit inzwischen über 15 Millionen Franken. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss auf dem Arni plant energieUri mit dem Kraftwerk Meiental bereits das nächste Wasserkraftwerk. Der Baustart für das 37-Millionen-Franken-Projekt erfolgt voraussichtlich Ende 2025.
Ihr Partner für Energieund Kraftwerksdienstleistungen
– Planung, Projektierung und Realisierung von Wasserkraftwerken
– Betriebs- und Geschäftsführung Wasserkraftwerke
– Direktvermarktung und Kraftwerksoptimierung
– Energiewirtschaft und Zertifikatehandel
Auf ca. 1.238 m Seehöhe wurde die Wasserfassung für das neue Kraftwerk Öxlbach errichtet. Am Coanda-System aus dem Hause Wild Metal werden konzessionsgemäß bis zu 300 l/s eingezogen. Das neue Kraftwerk wartet mit modernster Technik auf und liefert im Jahr

Knapp 15 Jahre dauerte es, bis man in der Zillertaler Gemeinde Schlitters Nägel mit Köpfen machen und die Pläne für ein modernes Kleinwasserkraftwerk in die Tat umsetzen konnte. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel 2023/24 war es gelungen, das neue Kraftwerk Öxlbach in Betrieb zu nehmen. Mittlerweile können die Tiroler Betreiber auf ein volles Betriebsjahr zurückblicken, in dem die Ökostromanlage die Erwartungen vollumfänglich erfüllt hat. Sie produziert im Durchschnittsjahr rund 5 bis 5,5 GWh sauberen Strom und bringt die Gemeinde im vorderen Zillertal damit in die günstige Lage, zumindest rechnerisch energieautark zu sein. Ein echtes Generationenprojekt – darüber sind sich die Zillertaler einig.
Wie heißt es doch bei Wilhelm Busch so trefflich: „Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später.“ Davon kann man auch in der Zillertaler Gemeinde Schlitters ein Lied singen. Knapp 15 Jahre hatte es für die Umsetzung eines gemeindeeigenen Wasserkraftwerks gebraucht, wie Bürgermeister Josef Wibmer bestätigt: „Wir haben 2008 mit den Wassermessungen am Öxlbach begonnen. Nach einigem Hin und Her lag 2016 schließlich die behördliche Genehmigung für das Projekt vor. Bauen konnten wir trotzdem noch nicht. Es hatten sich Unklarheiten mit einem Grundeigentümer ergeben, die es zuerst zu bereinigen galt.“ Er verweist darauf, dass sich die Gemeinde unter der Führung seines Vorgängers ursprünglich gar nicht aktiv am Projekt beteiligen wollte. Dies sollte sich erst ändern, als man eine Kooperationsbasis mit dem Zillertaler Unternehmer und erfahrenen Wasserkraft-
betreiber Ing. Rudi Hirschhuber gefunden hatte. „Das war für uns der Knackpunkt. Da Rudi das Wasserkraft-Know-how mitbrachte, das uns bislang gefehlt hat“, erklärt Josef Wibmer. Für die spätere Umsetzung des Projekts wurde die Wasserkraft Öxlbach GmbH gegründet, an der die Gemeinde 50 Prozent der Anteile hält, die anderen 50 Prozent entfallen auf Rudi Hirschhuber und auf Hansjörg Hirschhuber. Ende 2022 hatte man mit einem leicht geänderten Konzept die letzten bestehenden Hürden beseitigt – und für den Bau des Kraftwerks lagen nun sämtliche Bescheide vor. Grünes Licht sozusagen von allen Seiten.
Auch wenn schon seit vielen Jahren kein Strom mehr aus der Kraft des Öxlbachs gewonnen wurde: Ganz neu ist dessen hydroelektrische Nutzung nicht. Ganz im Gegenteil, wie Bürgermeister Wibmer bekräftigt:
„Am Öxlbach gab es – knapp unterhalb des Standorts für das neue Krafthaus – schon vor gut 100 Jahren ein kleines Wasserkraftwerk. Es hat zu Beginn die Bauern in der Umgebung mit Strom versorgt. Später lieferte es noch Strom für ein hiesiges Sägewerk. Als im Laufe der Zeit umfangreiche Sanierungen unumgänglich wurden, beschloss der Betreiber die Stillsetzung der Anlage. Heute zeugen von ihrer Existenz nur noch die Überreste der alten Wasserfassung.“
Mitte der 1970er Jahren, speziell nach dem zweiten großen Hochwasser im Sommer 1974, war man entschlossen, die Gefährlichkeit des Öxlbachs einzudämmen. In der Folge wurde der Wildbach mit mehreren massiven Schutzmauern verbaut, um die Gemeinde vor Hochwasser und Muren zu schützen. Im Hinblick auf die Rohrverlegung für die neue Druckrohrleitung sollten diese in weiterer Folge noch eine Rolle spielen.

Hansjörg und Rudi Hirschhuber am Werk, die dabei Umsichtigkeit, organisatorisches Talent und einschlägige Erfahrung bewiesen.
Über eine Gesamtlänge von ca. 3.000 m wurden TRMGussrohre in schub- und zuggesicherter Ausführung der Dimensionen DN400/500 verlegt.
Foto: zek
Deutlich mehr Einfluss auf das Kraftwerkskonzept sollte allerdings ein Naturdenkmal in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks nehmen: der Schlitterer Wasserfall. Diesen wollte man unbedingt bewahren, auch wenn dies einige Meter an möglicher Nutzfallhöhe kostete. „Der Schlitterer Wasserfall ist ein hohes Gut, natürlich auch in touristischer Hinsicht. Uns war es deshalb wichtig, dass unsere Kinder und Kindeskinder in Zukunft den Wasserfall noch so erleben, wie wir ihn erlebt haben. Daher war es für uns auch keine Frage, dass wir das Krafthaus oberhalb davon errichten und ihm das turbinierte Wasser somit im Freispiegel wieder zuführen“, so Bürgermeister Wibmer. Für die Planung der aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen erforderlichen Modifikationen und für die Optimierung der bewilligten Anlage, sowie die Abwicklung des gegenständlichen Behördenverfahrens, die Ausschreibung, die Ausführungsplanung und die Bauüberwachung holte man sich mit Ing. Mag Klaus Zwirner vom Ingenieurbüro AlpinConsulting einen erfahrenen Planer an Bord. Neben dem engen Zeitkorsett für die Umplanungen sowie letztlich auch der gesamten Umsetzung lagen für den Planer die zentralen Herausforderungen vor allem in den Gegebenheiten im Baufeld: „Sowohl die extrem steile Leitungstrasse, als auch der Standort des Krafthauses sowie die Rückführung des Unterwassers waren speziell und verlangten nach Sonderlösungen“, so Zwirner. Im Hintergrund der baulichen Abwicklung des Kraftwerksprojekts waren vor allem die vereinten Kräfte von
HOHE LEBENSDAUER ALS KRITERIUM Im März 2023 war es soweit: Die Bauarbeiten konnten beginnen. Wie dies häufig bei Hochdruckanlagen in den Alpen der Fall ist, lagen die größten Herausforderungen in der unterirdischen Verlegung der Druckrohrleitung durch steiles, zum Teil unwegsames Gelände. Mit den Verlegearbeiten betrauten die Projektverantwortlichen mit der Firma GeoAlpin eine Baufirma aus Tirol. Und die sollte in den nächsten Wochen ausreichend Gelegenheit bekommen, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Konkret wurde auf einer Länge von knapp 3 Kilometern eine Rohrleitung aus den bewährten Gussrohren des Tiroler Qualitätsherstellers Tiroler Rohre –TRM gebaut. Zum Einsatz kamen dabei Rohrschüsse der Dimension DN500 bzw. DN400. Dass man auf die Qualität der Gussrohre von TRM vertraute, lag für die Bauherrn auf der Hand: „Wir waren von Anfang an der Meinung, dass das Kraftwerk mit Komponenten ausgerüstet wird, die eine hohe Standfestigkeit und eine lange Lebensdauer sicherstellen. Und daher haben wir uns auch für die TRM-Gussrohre entschieden“, erklärt Rudi Hirschhuber.
MAXIMALE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die Stabilität der Gussrohre von TRM ist längst sprichwörtlich. Das liegt vorrangig daran, dass sie äußeren und inneren Belastungen effektiv widerstehen können. Gerade die bewährte längskraftschlüssige VRS-T-Verbindung, wie sie im Fall der neuen Druckrohrleitung für das KW Öxlbach eingesetzt wurde, gewährleistet ein schub- und zuggesichertes Rohrsystem. Dieses stellt einerseits eine hohe Scheiteldruckfestigkeit sicher und andererseits auch eine extreme Flexibilität. Damit kann die Druckrohrleitung sogar Hangrutschungen

oder Muren schadlos überstehen. Betonierte Fixpunkte sind damit überflüssig. Für die mit dem Rohrleitungsbau beauftragte Baufirma spielte die gute Verlegbarkeit der Gussohre eine wesentliche Rolle. Gearbeitet wird im schwierigen alpinen Gelände nach der „Auf-Zu-Methode“: Das bedeutet, dass ein Rohrgraben ausgehoben, das Rohr eingebaut und anschließend die Künette wieder zugeschüttet wird. Das klingt nicht spektakulär, bringt aber entscheidende Vorteile gegenüber anderen Methoden. Denn auf diese Weise kann bei fast jedem Wetter verlegt werden, was sich speziell in Bergregionen aufgrund der Zeitersparnis bezahlt macht. Erschwert wurden die Verlegearbeiten in Schlitters speziell durch die zahlreichen Wildbachsperren. „Entscheidend dabei war, dass wir die dicken Mauern für die Rohrdurchführung durchbohren konnten, ohne dass die bauliche Substanz der Sper-


Auch so lässt sich ein Krafthaus umsetzen: Das Gebäude ist nur fußläufig zu erreichen, aber sämtliche schweren Maschinen und Bauteile können mittels Seilwinde und dem Schienenstrang in das Krafthaus gehievt werden.
ren beeinträchtigt wurde“, erklärt Hansjörg Hirschhuber. Über den Projektverlauf bewies die Verlegemannschaft ihr Know-how und ihre Erfahrung eindrucksvoll und stellte sicher, dass die Arbeiten im vorgegebenen Zeitrahmen gehalten werden konnten.
SYNERGIEN IM ROHRLEITUNGSBAU
Für die Almbetreiber am Schlitterberg wurden die Arbeiten dennoch zu einer kleinen Belastungsprobe. Schließlich musste der Almweg,
den. Ein Wermutstropfen, den die Almbetreiber aber gerne in Kauf nahmen. Schließlich erhielten sie dank der Bauarbeiten am neuen Kraftwerk nun erstmalig eine Abwasserleitung sowie ein Glasfaserkabel für die Internetanbindung. „Uns war wichtig, dass wir auch die sich bietenden Synergiemöglichkeiten in der Projektumsetzung nutzen und den Infrastrukturbau ermöglichen konnten, der ohne dieses Bauprojekt nicht so einfach umzusetzen gewesen wäre“, erklärt Bürgermeister Josef Wibmer

Mit der bewährten „Auf-Zu-Methode“ lassen sich die Gussrohre von TRM einfach und schnell verlegen – auch in schwierigem, alpinem Gelände.
Druckrohrleitung haben wir auch eine Löschwasserversorgung integriert. Das bedeutet gerade für die Höfe in der Umgebung eine Erhöhung der Sicherheit im Brandfall. So effektiv hätten wir das Wasser sonst nicht in diesen Ortsbereich bringen können.“
INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE FASSUNG
Für die Entnahme des Triebwassers aus dem Öxlbach errichtete die Baufirma von Frühling bis Sommer 2023 auf ca. 1.238 m Seehöhe das neue Fassungsbauwerk, das die Handschrift des Südtiroler Branchenspezialisten Wild Metal aus Ratschings trägt. Konkret lieferte Wild Metal den Coanda-Rechen vom Typ Grizzly PROTEC Vibro Bars, der aus drei baugleichen Modulen besteht – und der

Wir steuern die


geschiebeführenden Wildbach angepasst ist. Die strömungsoptimierten, feuerverzinkten Schutzrechenelemente halten das Geschiebe vom Feinsieb fern und bewahren dieses somit vor Beschädigungen. Der Edelstahl, auf den Wild Metal bei der Fertigung seiner Grizzly-Serie setzt, gewährleistet höchste Abriebbeständigkeit. Das Sieb ist zum größten Teil selbstreinigend, die unerwünschten Partikel werden mit dem Fließgewässer weitertransportiert. Der Sandeintrag in die Wasserfassung ist durch die geringe Spaltweite von 0,6 mm auf ein Minimum reduziert. An den drei Grizzly-Modulen können in Summe bis zu 300 l/s eingezogen werden.
Orographisch rechts installierte das Team von Wild Metal eine 1,15 m breite Spül- und Dotationsklappe mit integriertem Wintereinlauf. Generell wurde das System so konzipiert, dass

die Fassung auch im Winter bei Eis und Schnee funktioniert – und somit ein ganzjähriger Kraftwerksbetrieb gesichert bleibt. „Nachdem wir die Anlage nun bereits im zweiten Winter beobachten, können wir nur unterstreichen, dass die ersten Betriebserfahrungen damit sehr gut sind“, erzählt Rudi Hirschhuber und findet lobende Worte für die Südtiroler Stahlwasserbauer: „Das Team von Wild Metal hat sehr genau und zuverlässig gearbeitet. Zudem kamen von den Südtirolern immer wieder praktische Verbesserungsvorschläge.“ Für das Entsanderbauwerk lieferte Wild Metal auch die Entsanderabzugsrohre DN300, die effektiv dafür sorgen, dass der Sandeintrag ausgespült wird, ohne dass der Kraftwerksbetrieb dafür sistiert werden muss.
SCHIENENVERKEHR INS KRAFTHAUS
Rund 500 m unterhalb der Wasserfassung, auf etwa 722 m Seehöhe, oberhalb des bekannten Schlitterer Wasserfalls, wurde das neue Kraft-
Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:
• Rechenreinigungsmaschinen
• Schützen & Stauklappen
• Rohrbrucheinrichtungen
• Einlaufrechen
• Komplette Wasserfassungssysteme
•
haus errichtet. Um das Gebäude optimal in die Landschaft zu integrieren, ohne dabei eine eigene Zufahrt errichten zu müssen, entwickelten die Projektbetreiber gemeinsam mit ihrem Planer, Ing. Mag. Klaus Zwirner aus Hall, eine spezielle Lösung, die sich in weiterer Folge als goldrichtig herausstellen sollte. Josef Wibmer: „Ein Besuch bei einem Kraftwerk in Südtirol hat uns auf die Idee gebracht: Wir müssen keine eigene Zufahrt errichten, wenn wir eine Schienenbahn errichten, über die wir die schweren Maschinen und Komponenten mithilfe einer Seilwinde hochziehen können. Es ist eher ungewöhnlich, hat im Grunde aber nur Vorteile.“
Den Bau der rund 29 m langen, circa 39 Grad geneigten Schienenbahn wurde vom Osttiroler Turbinenspezialisten Unterlercher realisiert, der bei diesem Projekt auch seine Qualitäten im klassischen Stahlbau unter Beweis stellen konnte. Auch den Hallenkran lieferte und montierte der Osttiroler Branchenprofi.








Und selbstredend kam auch die Turbine vom Wasserkraftspezialisten aus Hopfgarten. Konkret handelt es sich dabei um eine vertikalachsige, 4-düsige Peltonturbine mit elektrisch gesteuerten Düsenreglern. Ausgelegt ist die Maschine auf eine Ausbauwassermenge von 300 l/s und eine Netto-Fallhöhe von knapp 498 m und erreicht damit eine Ausbauleistung von 1.318 kW. Was die Turbine auszeichnet, sind einerseits Top-Wirkungsgrade – sowohl im Teil- als auch im Volllastbetrieb. Andererseits überzeugt sie mit einer außergewöhnlichen Laufruhe. „Wir haben im Zuge der Inbetriebnahme den ‚Münztest‘ gemacht: also eine Münze auf das unter Vollbetrieb stehende Turbinengehäuse gestellt. Sie ist nicht umgefallen“, erzählt Bürgermeister Josef Wibmer mit erkennbarer Zufriedenheit.

Unterlercher mit einer Nennleistung von 1.318 kW. Das Laufrad treibt einen direkt gekoppelten, wassergekühlten Generator vom Fabrikat Hitzinger an.
STROMPRODUKTION AUCH MIT WENIG WASSER
Die ausgeprägte Laufruhe stellt eine zentrale Voraussetzung dar, dass die Maschine lange und zuverlässig ihren Dienst versehen wird können. Wichtig für den Betrieb an einem alpinen Wildbach ist darüber hinaus, dass die Anlage auch bei geringen Wassermengen –wie sie nicht selten in den Wintermonaten Januar oder Februar vorherrschen – weiterläuft und nicht abgestellt werden muss. „Wir haben derzeit (Mitte Januar, Anm.) rund 30 l/s zur Verfügung. Damit läuft die Maschine aktuell mit einer Düse, erzeugt aber immer noch problemlos weiter Strom. Das heißt, dass wir unsere Turbine auch noch im Bereich von 10 Prozent des Volllastbereichs und darunter betreiben können“, erklärt Hirschhuber. Besonderes Augenmerk wurde auch auf den direkt gekoppelten Generator gelegt. Die Be-

treiber entschieden sich für ein Qualitätsprodukt des bekannten Linzer Generatorenherstellers Hitzinger, der eine maßgeschneiderte 3-phasige Synchronmaschine für das Kraftwerk Öxlbach lieferte. Der Generator ist wassergekühlt und ist auf eine Nennscheinleistung von 1.700 kVA ausgelegt. Mit knapp 8 Tonnen Gewicht ist er auch das schwerste Bauteil im neuen Maschinenhaus, das über den Schienenstrang ins Krafthaus gelangte.
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Rund neun Monate dauerten die gesamten Bau- und Montagearbeiten, ehe man sich im Dezember 2023 mit der Inbetriebsetzung langsam dem Projektabschluss näherte. „Als wir die Druckprüfung im Dezember ´23 durchführten, lag bereits Schnee. Die Wasserfassung war nur mehr mithilfe von Skidoos zu
Technische Daten
• Netto-Fallhöhe: 497,8 m
• Ausbauwassermenge: 300 l/s
• Turbine: 4-düsige Peltonturbine
• Fabrikat: Unterlercher
• Ausbauleistung: 1.318 kW
• Drehzahl: 1.000 Upm
• Generator: 3-Phasen-Synchron Generator
• Fabrikat: Hitzinger
• Nennscheinleistung: 1.700 kVA
• Druckrohrleitung: Material Guss DN400/500
• Fabrikat: TRM - Tiroler Rohre Länge: 3 km
• Rohrverlegung: Geoalpin Bau
• Bau Fassung & Krafthaus: Berger & Brunner
• Stahlwasserbau & Coanda-Technik: Wild Metal
• Coanda: Grizzly Protec Vibro Bars 1300
• Spaltweite: 0,6 mm
• Rohrbruchklappe: DN500 Restwasser: DN200
• Steuerung & Leittechnik: EN-CO
• Planung: Alpin Consulting
• Regelarbeitsvermögen: 5 - 5,5 GWh
erreichen. Aber das Entscheidende war, dass die Druckprüfung auf Anhieb perfekt passte. Damit stand der Inbetriebnahme nichts mehr im Weg“, erinnert sich Rudi Hirschhuber. Nun wollte man auch die Turbine noch vor Weihnachten andrehen und das Kraftwerk in den Probebetrieb bringen. Am 20. Dezember war es schließlich soweit: Das Kraftwerk erzeugte zum ersten Mal Strom – und sämtliche Parameter waren im grünen Bereich.
Für die Projektverantwortlichen ein Moment der großen Erleichterung. Das Kraftwerksprojekt, dessen erste Planung 15 Jahre zurücklag, konnte endlich finalisiert werden – ohne Unfälle, ohne Misstöne, ohne Fehlkalkulation. „Für uns bedeutet das Kraftwerk eine Investition für die nächste Generation und die Zukunft unserer Gemeinde. Gerade für kleine Gemeinden ist der wirtschaftliche Spielraum für Investitionen üblicherweise nicht allzu groß. Der Erlös aus dem Kraftwerk eröffnet uns mittelbis langfristig Möglichkeiten für weitere Projekte, von denen alle Bürger der Gemeinde profitieren können“, freut sich Bürgermeister Wibmer.
TRINKWASSERKRAFTWERK SOLL FOLGEN
Mittlerweile können die Betreiber auf ein ganzes Betriebsjahr zurückblicken – und das Resümee fällt rundum positiv aus: „Das erste Betriebsjahr hat uns gezeigt, dass sowohl das Konzept für das Kraftwerk als auch die gesamte Ausrüstung optimal gewählt worden sind. Wir sind sehr zufrieden und können uns nur bei unseren Partnern und den ausführenden Firmen bedanken“, zieht Josef Wibmer ein erfreuliches Fazit. Im Regeljahr liefert das Kraftwerk zwischen 5 und 5,5 GWh sauberen Strom. Damit können rund 1.400 Tiroler Haushalte versorgt werden. Rein rechnerisch ist die Gemeinde Schlitters damit bereits energieautark. Die Tatsache, dass man mit dem Bau des Kleinkraftwerks auch Infrastrukturprojekte wie die Abwasserentsorgung oder die Internetanbindung für den Schlitterberg realisieren konnte, zeigt die übergeordnete


Bedeutung des Gesamtprojekts für die Gemeinde Schlitters. Und damit noch nicht genug: Im Zuge der Projektumsetzung wurde auch eine in die Jahre gekommene Trinkwasserleitung durch eine neue, druckfeste Leitung ersetzt. Dies versetzt die Gemeinde nun in die erfreuliche Lage, ein Trinkwasserkraftwerk errichten zu können, mit dem man schon in absehbarer Zeit weiteren erneuerbaren Strom aus heimischer Wasserkraft produzieren wird können.




Mit einem umfassenden Modernisierungsprojekt hat die Schweizer Energieversorgerin Repower AG im Vorjahr das Kraftwerk Ferrera in Graubünden zukunftsfit gemacht. Abgesehen von der baulichen Infrastruktur und der Druckrohrleitung wurde im Prinzip die gesamte technische Ausstattung der Anlage erneuert bzw. revitalisiert. In der Kraftwerkszentrale wurde die 2-düsige Pelton-Turbine und der direkt gekoppelte Synchron-Generator einem Retrofit-Programm unterzogen. Völlig neu ausgeführt wurden das gesamte elektro- und regelungstechnische Equipment, das in der Vergangenheit immer wieder für Störungen und Betriebsausfälle verantwortlich war. Ebenfalls modernisiert bzw. saniert wurden verschiedene Stahlwasserbaukomponenten sowie die Absperr- und Regulierorgane an der Wasserfassung. Dank der umfassenden Modernisierung ist das Bündner Wasserkraftwerk Ferrera mit einem mittleren Regelarbeitsvermögen von 17,6 GWh bestens gerüstet für die kommenden Jahrzehnte.
Als größte Energieversorgerin in Graubünden betreibt die Repower AG eine ganze Reihe von Wasserkraftwerken unterschiedlicher Bauart und Leistungsklassen im Kanton. Dabei ist das Unternehmen von der Produktion über den Handel bis hin zur Verteilung zum Vertrieb entlang der ganzen Stromwertschöpfungskette tätig. Neben der Schweiz produziert Repower auch in Italien und Deutschland Strom mit eigenen Kraftwerken sowie über Beteiligungen, wobei der Großteil der Energieproduktion aus der Bündner Wasserkraft stammt.
UMFASSENDE MODERNISIERUNGEN
Damit Repower mit seinen Anlagen auch zukünftig mit maximaler Effizienz sauberen
Strom produzieren kann, betreibt das Unternehmen beträchtlichen Aufwand. Davon
zeugt in etwa der Ersatzneubau des Traditionskraftwerks Robbia, in dessen Totalerneue-

rung Repower zwischen 2020 und 2024 rund 115 Millionen CHF investiert hat. Über dieses Projekt hat zek HYDRO in der August-Ausgabe 2024 ausführlich berichtet. Ein weiteres Modernisierungsprojekt des Bündner Energiedienstleisters wurde ebenfalls im Vorjahr erfolgreich abgeschlossen. Konkret handelt es sich um das Kleinwasserkraftwerk Ferrera in der Gemeinde Trun, dessen technische Ausstattung in der Zentrale und an der Wasserfassung umfassend erneuert wurde. Das Kraftwerk, das seit seiner Erstinbetriebnahme im Jahr 1998 sauberen Strom produziert, steht im Besitz der Aktiengesellschaft Ovra electrica Ferrera SA, an der die Gemeinde mit 51 Prozent mehrheitlich beteiligt ist, die restlichen Anteile stehen im Besitz von Repower, die gleichzeitig für den Betrieb und den Unterhalt der Anlage zuständig ist. Die Hochdruckanlage mit ca. 750 m Fallhöhe nutzt das hydroenergetische Potential des Ferrerabachs in der Region Val Punteglias und ist dank ihres 8.000 m³ fassenden Kavernenspeichers ideal für die zielgerichtete Produktion von Spitzen- und Regelenergie geeignet.
SEKUNDÄRTECHNIK MACHTE PROBLEME
„In den letzten Jahren sind an der Anlage vermehrt Störungen aufgetreten, die zu Betriebsausfällen geführt haben. Zudem gab es auch immer wieder Probleme mit der Steue-
© Gebrüder Meier

Die Revitalisierungsspezialisten der Gebrüder Meier AG führten am SynchronGenerator des Maschinensatzes ein umfassendes Refurbishmentprogramm durch.
rung bzw. mit der Anbindung des Kraft werks an die übergeordnete Repo Leitstelle in Robbia, die 2019 völlig neu gebaut wurde. Ausgegangen sind die diver sen Störungen in erster Linie von den elekt rotechnischen Komponenten der Anlage, die seit der Erstinbetriebnahme im Einsatz wa ren und ihr technisches Lebensende erreicht hatten. Um die Probleme in den Griff zu be

Wir prüfen, revidieren, reparieren oder ersetzen Ihre:
Generatoren
Getriebe
Maschinentransformatoren

Elektromotoren Notstromaggregate gebrueder-meier.ch Tel. +41 44 870 93 93
Wir sorgen für eine sichere Stromversorgung!

Die 2-düsige Pelton-Turbine wurde einem Refurbishment-Programm unterzogen, wozu unter anderem auch die Fertigung eines neuen Laufrads mit optimierter Geometrie zählte. Der direkt gekoppelte SynchronGenerator wurde vom Schweizer Branchenspezialisten Gebrüder Meier AG auf Vordermann gebracht.

Gespräch mit zek HYDRO nicht unerwähnt lässt, dass Repower sowohl im Projektvorfeld als auch bei der praktischen Umsetzung maßgeblich beteiligt war. So wurden sowohl die gesamten planerischen Agenden als auch die Erneuerung der Elektrotechnik von Repower-Fachkräften in Eigenregie ausgeführt. Der Projektleiter weist darauf hin, dass die im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung eine flexible Herangehensweise erforderlich machte: „Ursprünglich war es geplant, zunächst die Technik an der Wasserfassung zu erneuern und danach die Modernisierung der Zentrale in Angriff zu nehmen. Allerdings machten diesem Vorhaben die winterlichen Witterungsbedingungen an der Wasserfassung einen Strich durch die Rechnung, weswegen Anfang 2024 zu-
Vom Schweizer Branchenprofi Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG revitalisierte Schützentafel kurz vor dem Wiedereinbau.

erst die Erneuerungsmaßnahmen im Maschinengebäude durchgeführt wurden.“
STAHLWASSERBAU REVIDIERT –
E-TECHNIK ERNEUERT
An der Wasserfassung und der dazugehörigen Kaverne starteten die Revitalisierungsmaßnahmen schließlich im September des Vorjahres. Dabei standen neben der Erneuerung der Elektrotechnik- und Stahlwasserbaukomponenten auch bauliche Sanierungsarbeiten an der Wasserfassung auf der To-Do-Liste von Repower, womit die Gefahr von drohenden Unterspülungen am Bauwerk gebannt werden konnte. Da sich die Fassung in der Val Punteglias in einem für Straßenfahrzeuge unerschlossenen Gebiet auf rund 1.600 m ü.M. befindet, waren für den Transport der schweren Baumaschinen und der Stahlwasserbaukomponenten die Dienste eines Transporthelikopters unumgänglich. Bei der Revision des Stahlwasserbaus setzten die Betreiber auf die Kompetenz der in Glarus ansässigen Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG. Die Branchenspezialisten sorgten für das fachgerechte Refurbishment des Entleerungsschiebers, der Einlauf- und Spülschützen sowie der Dammbalken für den Einlauf und den Entleerungskanal. Ebenfalls einer Totalrevision unterzogen wurde die Sicherheitsdrosselklappe, wobei diese Maßnahme von der ADAMS Schweiz AG durchgeführt wurde. Die Erneuerung der gesamten Elektrotechnik an der Wasserfassung wurde von Repower in Eigenregie umgesetzt, so Gabriele Castellina: „Sämtliche Schaltschränke der Sekundärtechnik wurden neu ausgeführt und mit Komponenten am Stand der Technik bestückt. Ebenfalls modernisiert wurde die Überwachungssensorik für die Pegel-, Sediment- und
Dank des Kavernenspeichers mit einem nutzbaren Volumen von 8.000 m³ ist das Kraftwerk ideal für die Produktion von Spitzen- und Regelenergie geeignet.

Druckmessungen. Neu implementiert wurde zudem eine Differenz-Durchflussmessung für die Überwachung der Druckrohrleitung. Darüber hinaus wurde für die Sicherstellung der digitalen Kommunikation zwischen Wasserfassung und Zentrale ein neues Lichtwellenleiterkabel eingezogen. Keine Sanierungsmaßnahmen waren hingegen an der 2.808 m langen Druckrohrleitung notwendig, die im Rahmen des Projekts ebenfalls einer Inspektion unterzogen wurde.
ZENTRALE AUF STAND DER TECHNIK GEBRACHT In der Kraftwerkszentrale im Gemeindegebiet blieb in elektromechanischer bzw. leittechnischer Hinsicht kein Stein auf dem anderen. Das Herzstück der Anlage bildet eine 2-düsige Pelton-Turbine in horizontalachsiger Aus-
• Ausbauwassermenge: 600 l/s
• Bruttofallhöhe: ca. 750 m
• Druckrohrleitung: 2.808 m
• Wasserfassung: Tiroler Wehr
• Kaverne Nutzinhalt: ca. 8.000 m ³
• Turbine: 2-düsige Pelton-Turbine
• Turbinenachse: Horizontal
• Drehzahl: 1.000 U /min
• Engpassleistung: 4,2 MW
• Hersteller: ANDRITZ Hydro
• Generator: Synchron
• Spannung: 6.300 V
• Nennscheinleistung: 4.500 kVA
• Hersteller: AvK
• Regelarbeitsvermögen: ca. 17,6 GWh


führung mit 4,2 MW Engpassleistung, die einer Komplettrevision unterzogen wurde. Dazu zählte unter anderem die Fertigung eines neuen Turbinen-Laufrads, das sich durch eine strömungstechnisch optimierte Geometrie auszeichnet. Ebenfalls revitalisiert wurde die hydraulische Regelung der Pelton-Düsen. Im Zuge des Refurbishments wurde sichergestellt, dass die auf 600 l/s Ausbauwassermenge und ca. 750 m Bruttofallhöhe ausgelegte Maschine bei sämtlichen Betriebszuständen ein Maximum an Effizienz erreicht. Für die Revision des direkt mit der Turbinenwelle gekoppelten Synchron-Generators in wassergekühlter Ausführung war der Schweizer Branchenexperte Gebrüder Meier AG zuständig. Wie die Turbine wurde auch der auf 4.500 kVA Nennscheinleistung und 1.000 U/min Drehzahl ausgelegte Generator demontiert und werkseitig einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Zu den durchgeführten Maßnahmen der Revitalisierungsexperten zählten unter anderem die Revision und Reinigung der Wicklungen, die Revision der Gleitlager, der Ersatz der Lagerdichtungen sowie die Wicklungsdiagnose an der Statorwicklung. Zudem erfolgte der Umbau der Spannungswandler in einen neuen Klemmkasten, die Auslegung, der Umbau und die Inbetriebnahme eines neuen digitalen Spannungsreglers. Völlig neu konstruiert wurde das Lüfterrad, um den Volumenstrom der Kühlluft zu steigern. Darüber hinaus sorgten die Gebrüder Meier für den Ersatz der Sensorik des Generators und die Revision und den Umbau des Ölaggregats. Die Modernisierung des elektro- und regelungstechnischen Equipments in der Anlagenzentrale wurde wie an der Wasserfassung von Repower-Fachkräften durchgeführt. Auch die elektrischen Schutzeinrichtungen wurden von den Betreibern auf den neuesten Stand gebracht. Bei der Anlagensteuerung setzen die Betreiber auf das bewährte SCADA-System von Siemens, das branchenübergreifend einen hervorragenden Ruf genießt. Selbstverständlich kommt im Zuge des Erneuerungsprojekts auch ein neues Leitsystem zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine von Repower in Eigenregie programmierte Lösung, die sich auch bei anderen Repower-Kraftwerken bestens bewährt. „Ein zentraler Punkt im Rahmen des Erneuerungsprojekts war zudem die stabile Anbindung der Anlagensteuerung an die zentrale Repower-Leitstelle in Robbia, wodurch nun eine zuverlässige Überwachung und Regelung des Kraftwerks gewährleistet ist – das war in der Vergangenheit aufgrund diverser Ausfälle und Störungen durch die Sekundärtechnik nicht der Fall“, sagt der Projektleiter: „Neben der Modernisierung der Primär- und Sekundärtechnik wurde zudem auch
die Klimatisierung im Maschinengebäude erheblich verbessert. Vor der Erneuerung kam es immer wieder vor, dass die Anlage aufgrund der vom Generator verursachten Abwärme auf Störung ging. Diese Problematik gehört durch den Einbau einer aktiven Klimaanlage in der Zentrale nun endgültig der Vergangenheit an.“
REPOWER MODERNISIERT WEITER
Kurz vor dem Wintereinbruch ging das rundum modernisierte Kraftwerk Ferrera im November 2024 wieder ans Netz. Wenige Monate nach der Wiederinbetriebnahme kann Gabriele Castellina ein rundum positives Resümee über das Erneuerungsprojekt ziehen: „Die notwendige Sanierung des Kraftwerks zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktionalität und Erzeugung der Anlage hat im Großen und Ganzen sehr gut geklappt. Es ist zwar keine erhebliche Produktonssteigerung zu erwarten, dennoch ist der sichere Betrieb der Anlage und deren Verfügbarkeit durch die umfassenden Modernisierungsmaßnahmen für die kommenden Jahre gewährleistet. Der Projektleiter betont, dass der Erhalt der bestehenden Kraftwerke auch weiterhin eine hohe Priorität in der Repower-Unternehmensstrategie einnimmt, wie eine ganze Reihe von aktuellen Projekten zeigt. Erst Ende Januar 2025 wurde das erneuerte Repower-Kleinwasserkraftwerk Papierfabrik 2 in der Gemeinde Landquart wieder in Betrieb genommen. Wie beim Kraftwerk Ferrera wurden auch dort die Turbine und der Generator revidiert, zusätzlich wurde die gesamte Sekundärtechnik inklusive Niederspannung ersetzt. Beim leistungsstärksten Repower-Kraftwerk in Poschavio ist man gerade dabei die Wasserfassung am Speichersee komplett zu erneuern, darüber hinaus wird das Großkraftwerk um zwei komplett neue Dotierkraftwerke ergänzt.


Das Veranstaltungs-Highlight in Sachen Wasserkraft ging im Herbst 2024 in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz über die Bühne. Von 18. bis 20. November traf sich die internationale Wasserkraftgemeinschaft in der Messe Congress Graz, um sich im Rahmen der HYDRO 2024 über neueste Trends und Entwicklungen zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen. Unter dem Leitslogan „Sichere Wasserkraft für turbulente Zeiten“ standen die aktuell drängendsten und brisantesten Fragen heutiger Wasserkraftnutzung im Brennpunkt der Veranstaltung. Rund 1.200 Teilnehmer aus 72 Ländern nahmen daran teil und trugen ihren Teil zum Erfolg der Aqua-Media-Tagung bei.
Nach dem Erfolg der HYDRO 2023 im schottischen Edinburgh waren die Erwartungen an die diesjährige Auflage hoch und alle Augen auf die HYDRO 2024 in Graz gerichtet. In den Hallen der Messe Congress Graz (MCG) galt der allgemeine Fokus für drei Tage zur Gänze allen Aspekten der Wasserkraft. Nach der herzlichen Begrüßung durch die Veranstalterin und Direktorin von Aqua-Media Ms. Alison Bartle sowie den Willkommensworten von Vertretern von AMI, ICOLD, IEA, Verbund und ATCOLD folgte die Präsentation der EU-geförderten ETIP-Initiative durch die drei bekannten Wasserkraft-Experten D. Aelbrecht, Prof. A. Schleiss und A. Harby. Im Anschluss daran stand Tag 1 der renommierten Veranstaltung im Zeichen unterschiedlicher Wasserkraft-Themen, die dabei einen weiten Bogen spannten. So ging es unter anderem um schwimmende Photovoltaik-Anlagen, kurz FPP, sowie diverse hybride Projekte. Vorgestellt wurden dabei grundsätz-
liche Designaspekte und konkrete Anwendungsbeispiele aus Brasilien und den Philippinen. Bei den hybriden Konzepten wurde in den Vorträgen aufgezeigt, wie Photovoltaik
und Wasserkraft optimal zusammenspielen können. Ein weiteres zentrales Thema befasste sich mit den unterschiedlichen Arten des Monitorings erosiver Kavitation. Konkret

wurden etwa Anpassungen von Turbinentypen an Bedingungen mit starker Erosionsgefahr beleuchtet. Außerdem wurden neuartige Ansätze bei „Turbulent Vortex Turbinen“ vorgestellt, die neue Perspektiven für LowHead-Einsätze bieten können. Weitere Themen waren etwa die verschiedenen Ansätze im Hinblick auf Design, Betrieb, Sicherheit und Unterhalt von Staudämmen auf der ganzen Welt in Theorie und Praxis sowie die Möglichkeiten von Projektfinanzierungen, verbunden mit rechtlichen Aspekten mit Bezug auf Versicherung und Risikomanagement. Das Themenfeld Pumpspeicherung mit zahlreichen Anwendungsbeispielen und Fallstudien aus aktuellen Kraftwerksprojekten wurde ebenfalls bereits am ersten Veranstaltungstag erörtert.
DIGITALE LÖSUNGEN FÜR DIE WASSERKRAFT
Tag 2 in Graz startete mit der Schwerpunktbetrachtung der Wasserkraftentwicklung in Afrika mit einigen interessanten Projektbeispielen aus jüngster Zeit. Zudem wurden Projekte thematisiert, die speziell in geographischen Grenzbereichen entwickelt werden und wurden, und worauf es dabei besonders zu achten gilt. Zwei Sessions waren dem zunehmend wichtiger werdenden Thema der künstlichen Intelligenz gewidmet, und welche Rolle sie in der weiteren Entwicklung der Wasserkraft einnehmen kann und wird. Als vorrangiges Beispiel wurde das Thema Digital Twins, der digitale Zwilling, im Dienst der Wasserkraftnutzung in den Brennpunkt gerückt. Eine weitere Session drehte sich zur Gänze um digitale Lösungen für Betrieb und Wartung bestehender Anlagen.
Neben dem Themenfeld Sicherheit von Staudämmen sowie Risiko-Management kamen auch Pumpspeicherkraftwerke in ihren vielfältigen Formen zur Sprache. Sogar Anwen-

dungen mit Meerwasser wurden thematisiert. Eine weitere Session stand unter dem Zeichen des so wichtigen Stahlwasserbaus: Verschlussund Absperrorgane und technische Lösungen für Wasserfassungen. Weitere Themenschwerpunkte an Tag 2 umfassten die Bereiche Klima und hydrologische Bedingungen sowie Fragen des Tunnel- respektive Stollenbaus.
Am Abschlusstag wurden zu Beginn einschlägige Aktivitäten der großen Wasserkraft-Organisation IEA Hydro vorgestellt. Weiters standen ökologische Themen rund um den Fischschutz im Mittelpunkt der Vortragsreihen. Zudem befasste sich eine Session ausschließlich mit dem wichtigen Thema „Druckrohrleitung“ sowie deren Überwachung und Erhaltung. Viel Raum wurde außerdem einem weiteren zunehmend wichtigen Thema eingeräumt: Sedimentmanagement – und mit welchen modernen technischen Mitteln dieses heute bestmöglich

bewerkstelligt werden kann. Mit vielen Beispielen aus der Praxis. Zudem rundeten die Themenfelder Elektro-Engineering sowie Umwelt- und gesellschaftsrelevante Aspekte den finalen Veranstaltungstag ab. Das Veranstaltungsteam von Aqua-Media konnte in der österreichischen „Mur-Metropole“ einmal mehr eine erfolgreiche Bilanz ziehen. Sowohl die rund 1.200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 72 Ländern als auch die zahlreichen Vertreter der Wasserkraftbranche zeigten sich in ihren Reaktionen rundum zufrieden. Die diesjährige Auflage, die in Thessaloniki, Griechenland von 22. bis 24. Oktober 2025 stattfinden wird, sollten sich Europas Wasserkraft-Interessierte schon jetzt rot im Kalender markieren. Der Veranstaltungsort ist gut gewählt, schließlich betritt Griechenland gerade eine neue Epoche der Wasserkraftentwicklung, in der sowohl Laufwasserkraftwerke als auch Pumpspeicherkraftwerke in größerer Zahl geplant sind.


Seit über 20 Jahren behauptet sich WATEC-Hydro mit seinen Maschinen am Markt und genießt einen hervorragenden Ruf in der Branche. Wer moderne, leistungsstarke Turbinen für Niederdruckstandorte sucht, kommt am Wasserkraftspezialisten aus dem Unterallgäuer Heimertingen nicht vorbei. Mittlerweile kann das mittelständische Unternehmen auf rund 350 erfolgreich umgesetzte Kleinwasserkraftwerke verweisen, zwei davon zuletzt 2024 auch in Österreich. Dass Innovation bei WATEC-Hydro großgeschrieben wird, belegt die jüngste Initiative des Turbinenbauers: Im Januar 2025 wurde das hydraulische Design der WATEC-Maschinen von den Forschern der Universität Stuttgart auf Herz und Nieren untersucht. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass noch kleine Steigerungen im Teil- wie im Spitzenlastbereich möglich sein werden.
Zuverlässigkeit, Robustheit und natürlich hohe Wirkungsgrade: Vor allem diese Qualitäten erwarten sich Kraftwerksbetreiber von einer modernen Wasserkraftturbine. Das weiß man auch beim bayerischen Wasserkraftspezialisten WATEC-Hydro und setzt daher seit zwei Jahrzehnten alles daran, diese Erwartungen zu erfüllen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf leistungsstarke doppeltregulierte Kaplanturbinen in unterschiedlichen Varianten. Obgleich man in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit auf einen gewissen Grad an Standardisierung baut, sind WATEC-Turbinen keine serienmäßig produzierten Maschinen, wie WATEC-Geschäftsführer Dr.-Ing. Daniel Brumme betont: „Jede Anlage wird von uns individuell an die jeweiligen Standortanforderungen und an die Wünsche des Kunden angepasst. Das heißt, jede einzelne Anlage wird im Grunde maßgeschneidert.“ Mit dieser Firmenphilosophie befindet sich der bayerische Wasserkraftspezialist seit Jahren auf der Erfolgsspur. Die Auf-
tragsbücher für 2025 sind bereits vollständig gefüllt, und auch das vergangene Jahr 2024 fasst Daniel Brumme als erfolgreich zusammen. Ihm und seinem Team ist es gelungen, im abgelaufenen Jahr wieder einige neue Kleinkraftwerke in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich auszurüsten. Ein Blick auf die beiden Referenzanlagen in Österreich zeigt, dass mit modernen Turbinen von WATEC-Hydro erhebliche Sprünge in Sachen Performance und Zuverlässigkeit möglich sind.
Der Linke Traisenwerkbach in Niederösterreich gilt als uralter Mühlenstandort. Der Ausleitungskanal aus der Traisen versorgt auch heute noch rund 23 Kleinwasserkraftwerke an seinem Lauf. Eines davon ist das Kraftwerk Pöll-St. Pölten, das aus der historischen „Maiermühle“ hervorging. Die Mühle wurde in den 1920er Jahren für die Stromgewinnung umgebaut, erzählt der Planer des
neuen Kraftwerks Dipl.-Ing. Georg Zeleny von Zeleny Infrastrukturplanung aus Traismauer. „Vor 20 Jahren wurden an dem Standort Wohnungen errichtet – und das war der wesentliche Grund, warum die Anlage damals stillgelegt wurde.“ Doch heute wird am historischen Mühlenstandort wieder Strom produziert – sauber, effizient und nachhaltig. Seit August letzten Jahres ist das Kraftwerk PöllSt. Pölten in Betrieb. Realisiert wurde die Anlage von der KW Pöll GmbH, die bei der technischen Ausrüstung ihres Kleinkraftwerks auf die Erfahrung und Kompetenz von WATEC-Hydro setzte. „Wir haben für das Kraftwerk neben unserer bewährten doppeltregulierten Kaplanturbine auch den Permanentgenerator, das Hydrauliksystem, die Saugrohrschalung sowie die Steuerung mit einer speziell angepassten Blindleistungskompensation geliefert“, fasst Daniel Brumme zusammen und ergänzt: „In den vergangenen Jahren haben wir erhebliche Ressourcen – Zeit, Kapital und Fachwissen – in die Entwicklung
KRAFTWERK PÖLL-ST. PÖLTEN, Baujahr 2024

• Fallhöhe: 2,53 m
• Nenndurchfluss: 5,00 m3/s
• Drehzahl: 187,5 U/min
• Turbine: dopp.ger. Kaplan
• Flügelzahl: 4
• Fabrikat: WATEC-Hydro
leistungsstarker Blindleistungskompensatoren investiert. Unser Ziel: den neuen technischen Anforderungen der Netzbetreiber mit unserem PMG optimal gerecht zu werden.“ Dass dies gut gelungen ist, kann Planer Georg Zeleny nur unterstreichen: „Die Anlage funktioniert heute sehr gut. Mit einer Nennleistung von 105 kW konnte auch ein deutlicher Sprung im Effizienzvergleich zum Altbestand erreicht werden.“
Ebenfalls im August letzten Jahres wurde an einem Ausleitungskanal an der Ragnitz, rund 40 Kilometer südlich von Graz, ein weiteres Kleinkraftwerk mit neuem WATEC-Hydro-Equipment ans Netz genommen. Das Kraftwerk Ragnitzmühle ersetzt zwei Altanlagen aus 1896 und 1953, die mit ihren bestehenden Francis-Turbinen zusammen eine Ausbauleistung von rund 250 kW erreichten. „Die Maschinen wurden zwar in den 1980ern noch einmal überholt, aber nun hatten sie das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Nachdem behördlich auch die Umsetzung einer Fischaufstiegshilfe gefordert war, entschloss sich die Betreiberin, die Firma Kiendler, zu einem kompletten Neubau“, sagt der Projektleiter der Firma Kiendler, Prokurist Ing. Reimar Zrinski. Warum man dabei auf die Technik des bayerischen Turbinenspezialisten setzte, erklärt Reimar Zrinski mit den bisherigen guten Erfahrungen: „Wir hatten bereits in Kärnten Erfahrungen mit einer Turbine von WATEC-Hydro sammeln können. Und die waren ausgezeichnet. Außerdem konnten andere Anbieter weder in puncto
• Generator: PMG
• Engpassleistung: 105 kW
Für das KW Pöll-St.Pölten lieferte WATEC-Hydro unter anderem auch die Saugrohr-Schalung.

Technik noch beim Preis-Leistungsverhältnis mithalten.“ Konkret lieferten die bayerischen Wasserkraftprofis auch für dieses Projekt neben der doppeltregulierten Kaplanturbine den Generator – in diesem Fall einen direkt gekoppelten Synchrongenerator mit 152 U/
KRAFTWERK RAGNITZMÜHLE, Baujahr 2024

• Fallhöhe: 3,15 m
• Nenndurchfluss: 12 m3/s
• Drehzahl: 152 U/min
• Generator: Synchron
• Turbine: dopp.ger. Kaplan
• Laufraddurchm.: 1,78 m
• Flügelzahl: 4
• Fabrikat: WATEC-Hydro
• Engpassleistung: 300 kW
• RAV: 2,5 GWh
min – und dazu noch die Schalungen für Einlauf und Auslauf. Für Daniel Brumme und sein Team eine durchaus besondere Referenz: „Zum einen war es für uns Premiere, dass wir mit dem tschechischen Generatorenhersteller TES VSETIN zusammengearbeitet haben. Und zum anderen handelt es sich um die bislang größte WATEC-Maschine in Österreich. Die Turbine hat ein Gewicht von 13,2 Tonnen, der Generator bringt immerhin 11,6 Tonnen auf die Waage.“ Nach den ersten Betriebsmonaten fällt das Fazit der Betreiber sehr positiv aus. Nicht nur, dass die Anlage flüsterleise arbeitet. Darüber hinaus weist sie einen Effizienzschub um rund 20 Prozent Plus auf. „Mit der neuen Technik und dem modernen hydraulischen Design, aber auch dank geringfügiger Erhöhung von Ausbauwassermenge und Fallhöhe, erreicht die Anlage heute 300 kW Leistung. Angesichts des relativ konstanten Zustroms im Ausleitungskanal rechnen wir im Regeljahr mit einer Erzeugung von rund 2,5 GWh“, freut sich Reimar Zrinski, der darauf verweist, dass Steuerung, Leittechnik und Elektroinstallation für beide Anlagen durch die hauseigene Kiendler Elektrotechnik ausgeführt wurden und die Abstimmung und Zusammenarbeit mit WATEC perfekt funktionierten.
KOMPENSATOREN FUNKTIONIEREN
Speziell die Weiterentwicklungen in Sachen Blindleistungskompensation, die WATEC-Hydro in den letzten Jahren in enger Abstimmung mit einem bewährten Partner in Sachen Steuerungstechnik umsetzen konnte, machen sich heute bezahlt.
Die Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Blindleistungskompensation, die eben von Netzbetreiber zu Netzbetreiber variieren können, haben sich mittlerweile längst bewährt und werden in der Regel von den Netzbetreibern angenommen und akzeptiert, wie auch das Projekt St. Pölten zeigt.
ZURÜCK ZU DEN WURZELN – MIT BLICK NACH VORNE Dass WATEC-Hydro auch in Zukunft zur Spitzenklasse der Hersteller gehören wird, steht für Geschäftsführer Dr.-Ing. Daniel Brumme außer Frage. Er stellt klar, dass in einer schnelllebigen Zeit Stillstand Rückschritt bedeute. Daher hat der CEO im Sommer 2024 entschieden, das sehr gute Turbinendesign der WATEC-Maschinen einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen, um den hohen Qualitätsstandard langfristig zu sichern und weiter zu optimieren. „Bis Ende Januar 2025 wurde unser Turbinendesign von Spezialisten des IAG – Institut für Aerodynamik und Gasdynamik der Universität Stuttgart untersucht und auf eventuelle Optimierungsmöglichkeiten überprüft.“ Für den bayerischen Turbinenbauspezialisten ist das quasi eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Schließlich wurde genau hier, an den Rechnern der Uni Stuttgart, das originale Design von Leit- und Laufrad der mittlerweile hundertfach bewährten WATECTurbine entwickelt. Damals noch im vereinfachten 2D-Verfahren. Das Design der WATEC-Turbine bewährt sich bis heute. Mithilfe neuester Berechnungsmethoden können allerdings noch messbare Verbesserungen erzielt werden.
EFFIZIENZSTEIGERUNG IM BEREICH DES MÖGLICHEN
Die Grundlage für diese in Aussicht stehende Optimierung bilden fortschrittliche 3DSimulationsverfahren, wie sie heute auch von den Wissenschaftlern der Universität Stutt-

gart eingesetzt werden. In den letzten fünf Jahren haben sich diese Verfahren hinsichtlich der immer höheren Rechenleistungen signifikant weiterentwickelt. Dabei steht insbesondere bei einer Niederdruckmaschine wie der doppeltregulierten Kaplan-Turbine die zentrale Herausforderung im Fokus: Wie lässt sich die optimale Abstimmung zwischen Leitradund Laufradposition realisieren, um die bestmögliche Gesamtperformance der Anlage zu erzielen? „Das Hauptziel liegt in der Effizienzsteigerung – sowohl im Teillast- als auch im Volllastbetrieb. Darüber hinaus spielen jedoch weitere Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die Minimierung ungünstiger Anströmbedingungen, welche unter anderem Schwingungen oder Kavitation auslösen können,“ erklärt Dr.-Ing. Daniel Brumme, der im Rahmen seiner Dissertation selbst technische Forschungen im Bereich 3D-Simulation durchgeführt hat. Nach Abgabe des 3D-Modells einer idealisierten Halbspiralkammer

mit Turbine und Saug-rohr an die Uni-Stuttgart konnte durch die konsequente Anwendung der 3D-CFD-Simulation (Computational Fluid Dynamics) das Gesamtsystem der Turbine detailliert betrachtet und analysiert werden, wie verschiedene Parameter und Randbedingungen die Maschinenleistung beeinflussen. Die ersten Simulationsergebnisse aus dem Dynamik- Institut der Universität Stuttgart im Januar 2025 bestätigten die Erwartungen des WATEC-Teams. Die Optimierung der Kaplan-Turbine mittels komplexer 3D-Simulationen hat gezeigt, dass eine theoretische Effizienzsteigerung von 5 bis 6 Prozent über einen weiten Betriebsbereich bei idealisierten Annahmen möglich ist. Das WATEC-Team rechnet unter realen Einsatzbedingungen mit Effizienzsteigerungen von 3 bis 4 Prozent. Für weitere Informationen steht WATEC Ihnen gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen unter: www.watec-hydro.de

Die Troyer AG rüstete die drei Kleinwasserkraftwerke mit ihren elektro- und leittechnischen Lösungen aus. Darüber hinaus lieferten die Südtiroler für das völlig neu gebaute Mittelstufenkraftwerk eine hocheffektive 2-düsige Pelton-Turbine mit direkt gekoppeltem Synchron-Generator.

Innerhalb weniger Jahre hat die in Niederösterreich ansässige Anton Kittel Mühle Plaika GmbH in Osttirol eine mehrstufige Kraftwerksanlage modernisiert und erneuert. Die Kleinwasserkraftwerke nutzen das hydroenergetische Potential der Gewässer Taberbach und Haiglbach und versorgen mit dem regional erzeugten Ökostrom rund 450 Energieabnehmer im lokalen Stromnetz, das 2018 von den Niederösterreichern erworben wurde. Nach der Übernahme wurden von den neuen Besitzern, die auch in ihrem Heimatbundesland ein eigenes Stromnetz betreiben, erhebliche Investitionen getätigt, um die Versorgungsqualität in den Gemeinden Ainet und Schlaiten zu gewährleisten. Das jüngste und gleichzeitig leistungsstärkste Kraftwerk am Taberbach mit über 1,5 MW Engpassleistung ging im Sommer des Vorjahres erstmals ans Netz. Im Regeljahr kann die Osttiroler Kleinkraftwerkskaskade rund 9,5 GWh sauberen Strom produzieren.
In den Osttiroler Gemeinden Ainet und Schlaiten steht die Energieproduktion aus Wasserkraft hoch im Kurs. Das ist nicht verwunderlich, denn das privat betriebene Stromnetz der beiden Ortschaften wird seit über 80 Jahren durch mehrere Kleinwasserkraftwerke mit sauberem Strom versorgt. Zu verdanken ist dies dem 2015 verstorbenen Max Hechenblaikner, der als geschickter Elektrounternehmer und E-Werk-Betreiber seit den 1960er Jahren maßgeblich für den Aufbau des lokalen Stromnetzes und die Errichtung mehrerer Wasserkraftwerke verantwortlich war.
KITTEL MÜHLE ERWIRBT STROMNETZ
2018 wurde das E-Werk Hechenblaikner schließlich von der in Niederösterreich ansässigen Anton Kittel Mühle Plaika GmbH übernommen. Neben der Mehlproduktion ist
die Kittel Mühle seit Jahrzehnten auch als privater Stromnetzbetreiber in Niederösterreich
aktiv, darüber hinaus betreibt das Unternehmen im In- und Ausland zahlreiche Wasser-

Außenansicht vom Maschinengebäude der Mittelstufe

Das Coanda-System „Grizzly Power Protec“ von der Südtiroler Wild Metal GmbH kurz vor der Montage an der Wasserfassung des Mittelstufenkraftwerks. Ein zweites Coanda System vom Typ „Grizzly Power Optimus“ kommt bei der Nebenfassung am Haiglbach zum Einsatz.
kraftwerke und ist zudem im Stromhandel und Großvertrieb tätig. „Wir haben das Stromnetz in Ainet und Schlaiten und die dazugehörigen Kraftwerke im November 2018 erworben. Schon im Vorfeld der Übernahmne hatten wir als erfahrene Netz- und Kraftwerksbetreiber eine Perspektive für die in die Jahre gekommene Infrastruktur entwickelt, damit die rund 450 Stromkunden in Ainet und Schlaiten auch zukünftig sicher und zuverlässig mit Energie versorgt werden können“, sagt der Kittel Mühle-Geschäftsführer Hannes Taubinger: „Johannes Steiner und ich waren praktisch vom ersten Tag an im Netz stark gefordert. Dem Herbststurm 2018 fielen zahlreiche Strommasten zum Opfer. Im November 2019 zerstörte eine Mure eine ganze Trafostation. An allen Netzausläufern war die Spannungsqualität unzureichend. Mit erheblichen Investitionen errichteten wir innerhalb von sechs Jahren das Netz fast komplett neu. Dafür gibt es heute keine Engpässe mehr für die Netzkunden bei PV-Anlagen oder E-Tankstellen.“

Rodungsarbeiten im Steilhangbereich als Vorbereitung für die Verlegung der Druckrohrleitung. Durchgeführt wurden die gesamten Hoch-, Tief- und Spezialtiefbauarbeiten von der Salzburger Empl Baugesellschaft m.b.H.
Der beträchtliche finanzielle und technische Aufwand für die Gewährleistung der Versorgungsqualität betraf auch die Modernisierung bzw. den Neubau der Kleinwasserkraftwerke. Vor der Übernahme des Stromnetzes durch die Kittel Mühle wurde dieses von insgesamt vier im Laufe der Jahre errichteten Kraftwerke versorgt. „Der Vorbesitzer hatte bereits ein durchdachtes Konzept für die Inselversorgung entwickelt, an dem wir im Großen und Ganzen auch nach den Erfahrungen im Herbst und Winter 2018 – 2020 mit stundenlangen Unterbrechungen bei Tinetz festgehalten haben. Eine wesentliche Änderung wurde allerdings vorgenommen: Anstelle von vormals vier Anlagen wird nun mit drei Kraftwerken sauberer Strom erzeugt,“ so Hannes Taubinger. Das alte Konzept bestand aus einer Oberstufe mit ca. 300 kW Engpassleistung, einer Mittelstufe mit ca. 540 kW Engpassleistung und einer Unterstufe mit ca. 38 kW Engpassleistung, die allesamt mit dem hydroenergetischen Potential
Oberstufe
• Ausbauwassermenge: 340 l/s
• Bruttofallhöhe: 166, 4 m
• Turbine: 2-düsige Pelton-Turbine
• Turbinenachse: Horizontal
• Drehzahl: 750 U/min
• Engpassleistung: 443 kW
• Hersteller: EFG Turbinenbau
• Generator: Synchron
• Nennscheinleistung: 625 kVA
• Hersteller: Hitzinger
Mittelstufe
• Ausbauwassermenge: 450 l/s
• Bruttofallhöhe: 398 m
• Turbine: 2-düsige Pelton-Turbine
• Turbinenachse: Horizontal
• Drehzahl: 1.000 U/min
• Engpassleistung: 1.525 kW
• Hersteller: Troyer AG
• Generator: Synchron
• Nennscheinleistung: 2.000 kVA
• Hersteller: TES Vsetin
Regelarbeitsvermögen gesamt: ca. 9,5 GWh
des Taberbachs betrieben wurde. Zusätzlich erzeugte noch an dem kleineren Parallelgewässer Haiglbach ein weiteres Kraftwerk, das über einen eigenen Speicherteich verfügte, mit ca. 40 kW Maximalleistung Strom. Im Zuge der umfassenden Modernisierung wurde die Anlage am Haiglbach aufgelassen. Anstelle dessen wird das Triebwasser des Haiglbachs vom bestehenden Speicherteich nun durch den Bau einer neuen Druckrohrleitung zur völlig neu gebauten Mittelstufe geleitet, wodurch diese ein erhebliches Plus an Leistungs- und Erzeugungskapazität erreicht. Neben dem Neubau der Mittelstufe wurden auch das obere und das untere Kraftwerk modernisiert, wobei sowohl das elektromechanische als auch das steuerungstechnische Equipment grundlegend erneuert wurden. Für die Planung des Erneuerungsprojekts setzte die Kittel Mühle auf das Ziviltechnikerbüro DI Klaus Oberacher aus Reith bei Kitzbühel, das schon auf eine Reihe von ausgezeichneten Referenzen in der Wasserkraft verweisen kann.
Unterstufe
• Ausbauwassermenge: 200 l/s
• Bruttofallhöhe: 48 m
• Turbine: 4-düsige Pelton-Turbine
• Turbinenachse: Vertikal
• Drehzahl: 500 U/min
• Engpassleistung: 72 kW
• Hersteller: Maschinenbau Unterlercher
• Generator: Asynchron
• Nennleistung: 75 kW
• Hersteller: WEG
Der gebürtige Osttiroler Johannes Steiner, der die Erneuerung der Kraftwerkskaskade und des Stromnetzes von Beginn an begleitet hat, sorgt für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung der Kittel Mühle-Anlagen und des Stromnetzes.

OBERSTUFE KOMMT ZUERST DRAN
Die Modernisierung der Wasserkraftwerke startete im Sommer 2020 an der Oberstufe. Zuerst wurde die Druckrohrleitung mittels Molch von Rostpartikeln im Innenrohr befreit. Zeitgleich wurden die komplette 400 V Anlage und Leittechnik erneuert. Als neues Herzstück der Anlage lieferte der Kärntner Kleinwasserkraftspezialist EFG Turbinenbau eine 2-düsige Pelton-Maschine in horizontalachsiger Bauform. Die hydraulisch geregelte Turbine wurde auf eine Ausbauwassermenge von 340 l/s und 166,4 m Bruttofallhöhe ausgelegt, womit diese bei vollem Wasserdargebot 443 kW Engpassleistung erzielt. Dabei wurde aber schon eine etwaige spätere Konsenswassermengen- und/oder Fallhöhenerweiterung mitgedacht, und die Turbine darauf ausgelegt. Der bestehende Generator vom Fabrikat Hitzinger wurde komplett überholt und mit einem Schwungrad im Hinblick auf den Inselbetrieb des Netzes Ainet ausgerüstet. Völlig neu ausgeführt hingegen wurden das elektround regelungstechnische Equipment sowie die

Das Coanda-System von Wild Metal mit seinem funktionsbedingten Selbstreinigungseffekt gewährleistet den vollautomatischen Triebwassereinzug am Taberbach.

Steuerung der Anlage vom Südtiroler Wasserkraftallrounder Troyer AG. „Bei der Leittechnik für das Oberstufenkraftwerk haben wir uns ganz bewusst für Troyer entschieden. Uns war ein Anbieter mit Erfahrung in Leittechnik und Betrieb von Wasserkraftwerken unter Inselnetzbedingungen wichtig. Troyer überzeugte nicht nur damit, sondern auch durch ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und den Einsatz zukunftsträchtiger Leittechnikkomponenten“, sagt Hannes Taubinger.
Im Sommer 2023 startete schließlich der komplette Neubau des Mittelstufenkraftwerks, dessen Leistungskapazität durch eine höhere Wassermenge, den Wegfall enormer Rohrreibungsverluste und die Einbeziehung des Speicherteichs am Haiglbach nahezu verdreifacht werden konnte. Bei den beiden Wasserfassungen des Kraftwerks setzten die Betreiber auf das bewährte Coanda-System „Grizzly“ vom Südtiroler Branchenexperten Wild Metal GmbH, das seine Praxistauglich-
Staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent f ü r Bauingenieurwesen
W asserkraft - Siedlungswasserbau - Infrastruktur
Planung - Beratung - ÖBA - Prüfung - Gutachten
Dipl. -Ing. Klaus Oberacher Ziviltechniker mit aufrechter Befugnis Kitzbüheler Straße 18, A-6370 Reith bei Kitzbühel

keit mittlerweile an mehr als 500 Standorten im gesamten Alpenraum unter Beweis stellt. Die zentralen Merkmale des Südtiroler „Grizzlys“ sind seine charakteristisch geschwungene Form sowie dessen Feinsieb mit äußerst geringer Spaltweite. Dank des namensgebenden Coanda-Effekts – vereinfacht beschrieben: Flüssigkeiten folgen konvexen Oberflächen – wird das Triebwasser mit äußerst geringem Sedimentanteil eingezogen. Das Funktionsprinzip beinhaltet zudem auch einen Selbstreinigungseffekt der sicherstellt, dass durch die Wasserströmung größere Steine oder Kiesel sowie Laub und Geschwemmsel automatisch von der Rechenfläche abspült werden. Die Wasserfassung am Taberbach wurde mit dem System „Grizzly Power Protec“ ausgestattet, bei dem das Feinsieb durch einen darüber angeordneten Grobrechen vor Steinen und Treibgut geschützt wird. Außerdem lieferten die Südtiroler für die Hauptfassung eine Rinne für die dynamische Restwasserabgabe, eine Spülklappe mit integriertem Wintereinlauf sowie ein Hydraulikaggregat
Danke für das Vertrauen. Wir wünschen viel Erfolg!

samt Steuerölleitungen. Am Speicherteichauslauf Haiglbach, von dem das Triebwasser der Hauptdruckrohrleitung zugeführt wird, kommt durch einen „Grizzly Power Optimus“ ein weiters Coanda-System zum Einsatz. „Dank des Speicherteichs können wir das Mittelstufenkraftwerk auch im Schwellbetrieb fahren und damit Verbrauchsspitzen im Netz abfangen bzw. PV-Strom besser nutzen“, merkt Hannes Taubinger an. Für die Schlosserarbeiten an der Mittelstufe war der Osttiroler Stahl- und Anlagenbauspezialist Trost GmbH aus Matrei zuständig. Der Auftrag umfasste sämtliche Schlosserarbeiten inkl. Lieferung und Montage von Armaturen und Stelleinrichtungen, den fachgerechten Einbau diverser Rohrleitungen und Durchführungen sowie die Montage von Schachtabdeckungen, Zugangsstiegen und Fußgängerbrücke.
ARBEITEN IM STEILGELÄNDE
Die in der Salzburger Gemeinde Mittersill ansässige Empl Baugesellschaft m.b.H. konnte sich im Zuge der Ausschreibung den Zuschlag für die Durchführung der gesamten Hoch-, Tief- und Spezialtiefbauarbeiten für die mittlere Kraftwerksstufe sichern. Dies beinhaltete den Bau der beiden Wasserfassun-
gen, des Krafthauses und die Verlegung der Druckrohrleitungen. Aufgrund des abschnittsweise extrem steilen und schwierigen Geländes waren vor allem die Errichtung der Wasserfassungen und die Rohrverlegung mit beträchtlichen Herausforderungen verbunden. So verläuft ein mehrere 100 Meter langer Abschnitt der Druckrohrleitung über einen Geländeabschnitt mit mehr als 40 Grad Neigung. Somit musste die Rohrverlegung mit angeseiltem Schreitbagger, Seilbahn und Hubschrauberunterstützung erfolgen, aufwändige Sicherungsmaßnahmen eingeschlossen. Hergestellt wurden die beiden Rohrleitungsstränge von der Haupt- und Nebenfassung mit duktilen Gussrohren von der Tiroler Rohre GmbH (TRM), welche zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Wegen des anspruchsvollen Geländes wurden die Muffenverbindungen der Druckrohrleitung zur Gänze zug- und schubgesichert ausgeführt. Das äußerst robuste Rohrmaterial kommt mit den oft extremen Anforderungen im alpinen Raum problemlos zurecht und gewährleistet darüber hinaus optimale Fließ be dingungen durch sehr geringe Reibungsverluste.
Von der Hauptfassung am Taberbach bis zum Maschinengebäude wurde der Kraftabstieg, der eine Strecke von ca. 1.600 m überwindet, in der Dimension DN500 hergestellt. Die Druckrohrleitung DN200 vom Haiglbach zur Hauptleitung ist mit ca. 350 m Länge bedeutend kürzer.
LEISTUNGSSTARKE MITTELSTUFE
Das Maschinengebäude der Mittelstufe wurde von Troyer mit einem Komplettpaket ausgestattet, dessen Kern eine 2-düsige Pelton-Turbine mit direkt gekoppeltem Synchron-Generator bildet. Ausgelegt wurde die Maschine auf 398 m Bruttofallhöhe und 450 l/s Ausbauwassermenge, womit diese bei vollem Wasserdargebot 1.525 kW Engpassleistung erzielt. Die exakte Regelung der beiden Pelton-Düsen, dank der die Turbine auch bei stark variierendem Wasserdargebot in einem breiten Teillastbereich hohe Wirkungsgrade erreicht, übernehmen zwei elektrische Stellmotoren. Der Generator vom Hersteller TES Vsetin wird von der Turbine mit 1.000 U/min angetrieben. Der Generator mit 2.000 kVA (690 V) verfügt über einen aufgesetzten Luft-Wasser-Wärmetauscher, über den die Abwärme ins Unterwasser des Triebwassers abgeführt wird. Im Winter ermöglicht ein Bypass eine gezielte Temperierung des Krafthausgebäudes. Komplettiert wurde der Troyer Lieferumfang durch das gesamte elektro- und regelungstechnische Equipment sowie die Kraftwerkssteuerung. Dem Stand der Technik entsprechend funktioniert der Anlagenbetrieb vollständig automatisiert. Selbstverständlich kann die Anlage mittels Online-Anbindung auch aus der Ferne rund um die Uhr überwacht bzw. geregelt werden. Nach Abschluss der finalen Installationsarbeiten konnte die neue Mittelstufe Ende Mai 2024 bei voller Wasserführung den Probebetrieb aufnehmen. Im Oktober 2024 erfolgten die von

Das Oberstufenkraftwerk wurde

Betreiberseite mit Spannung erwarteten Netztests. „Vorgabe war bei Volllast aller Anlagen (2 MW), geringer Netzlast (0,2 MW) und Ausfall des vorgelagerten 25 kV Netzes unterbrechungsfrei und mit <2 Hz Überfrequenz in den Inselbetrieb überzugehen. Dank ausgeklügelter Steuerung, Schwungrädern an den Pelton-Turbinen der Ober- und Mittelstufe und schnellstmöglicher Bewegung der Strahlablenker der Troyer-Turbine konnte der Test einwandfrei auf Anhieb bestanden werden“, so Hannes Taubinger.
Aufgrund eines Turbinenschadens an der alten Turbine wurde die Unterstufe am Taberbach ebenfalls 2024 komplett modernisiert. Wie bei den Oberliegerkraftwerken wurde

auch dort das elektro- und regelungstechnische Equipment von Troyer ausgeführt. Die neue vertikalachsige Pelton-Turbine stammt von der Maschinenbau Unterlercher GmbH, die in der Osttiroler Nachbargemeinde Hopfgarten in Defereggen ansässig ist. Ausgelegt wurde die mit vier elektrisch geregelten Pelton-Düsen konzipierte Turbine auf 200 l/s Ausbauwassermenge und 48 m Bruttofallhöhe, womit diese unter Volllast 72 kW Engpassleistung erzielt. Komplettiert wird der Maschinensatz durch einen direkt mit dem Laufrad gekoppelten Asynchron-Generator mit 75 kW Nennleistung.
ERZEUGUNGSKAPAZITÄT MASSIV GESTEIGERT
Hannes Taubinger zieht im Rahmen des zek HYDRO-Interviews Mitte Jänner 2025 ein
durchwegs positives Fazit über das Kittel Mühle-Projekt in Osttirol: „Die Erneuerung der Kraftwerke konnte dank hoch kompetenter Fachfirmen mit wenigen Komplikationen und etwas Geduld bei den Genehmigungsverfahren realisiert werden. Die Modernisierung des Netzes war trotz Kostenteilung der Grabarbeiten mit dem Glasfaserausbau der Gemeinde Ainet mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Wir freuen uns über 450 nunmehr zufriedene Netzkunden in Ainet und Schlaiten und dass wir die Erzeugungskapazität trotz höherer Restwasserabgabe von 6,5 auf fast 10 GWh steigern konnten. Am meisten aber freuen wir uns über drei feine Kraftwerke samt kleiner Tagesspeicherkapazität, die uns hoffentlich noch viele Jahre Freude bereiten werden.“





„Unser Anlagen-Engineering ist breit aufgestellt, denn wir planen und dokumentieren für kleine bis große Standard- und Sonder-Auftragsarbeiten“, konstatiert Alexander Krabacher, Regionalmanager Elektroinstallation und Anlagentechnik bei der EWR Technik GmbH in Reutte. „Dazu benötigen wir allerdings ein mächtiges Engineering-Werkzeug, mit dem wir vor allem nachhaltig, rasch, flexibel und zuverlässig sämtliche Anlagen unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Gebäude sowie unsere Mutterfirma, die Elektrizitätswerke Reutte AG, bedienen können. Die Eplan Software-Werkzeuge samt ihrem digitalen Angebot bieten uns dies in einzigartiger Art und Weise – à la carte, von der Kür bis zur Pflicht!“
1901 war die Geburtsstunde der Elektrizitätswerke Reutte in Tirol. Nachhaltiges wie umweltbewusstes Engagement in Sachen Energieversorgung für die Region war und ist bis heute ihr umfänglicher Auftrag in all ihren Handlungsfeldern. So hat die heutige stetig wachsende Unternehmensgruppe Elektrizitätswerke Reutte AG ihr Leistungsspektrum kontinuierlich auf sämtliche Energiedienstleistungen für Häuslbauer bis hin zu Industriebetrieben erweitert. Daraus hat sich über die Jahre u. a. auch der Bereich des Elektroanlagenbaus für Kunden aus Industrie, Gewerbe und Gebäude entwickelt, der seit 2018 unter der EWR Technik GmbH als eigenständig geführtes Tochterunternehmen firmiert. Mit ihren sechs Leistungsbereichen Elektroinstallation, Anlagentechnik, Glasfaser LWL, IT-Dienstleistungen, Sicherheitstechnik und Smart Home bietet die EWR Technik GmbH ein Produktportfolio mit über 100 Jahren Erfahrung in der Elektrotechnik. Dazu engagieren sich aktuell über 100 MitarbeiterInnen und über 30 Lehrlinge.
EIN POTENTES ENGINEERING-TOOL FÜR
WEITREICHENDE ANLAGENTECHNIK
In der Sparte der Anlagentechnik kümmert sich die EWR Technik GmbH um Elektroins-
tallationen und Sicherheitstechnik in den Bereichen Verteilerbau, Automatisierungstechnik sowie um den E-Check bei Anlagenüberprüfungen. „Im Verteilerbau planen


und fertigen wir Schaltanlagen für Industrie, Gewerbe und Private – egal ob für Niederspannungs-, Produktionsanlagen, Smart Home oder diverse Verteilungen“, erklärt Alexander Krabacher, Regionalmanager Elektroinstallation und Anlagentechnik der EWR Technik GmbH, und stellt dazu seine engsten Mitarbeiter vor: „Seit 2009 arbeiten in dieser Abteilung Christoph Alber und Michael Friedle. Seitdem haben sie etliche Projekte mit hoher Kompetenz sowie umfangreichem Know-how in der Planung und Digitalisierung betreut und umgesetzt.“ Dass dazu Herr Alber und Herr Friedle ein hochwertiges Planungstool für ihre Engineering-Aufgaben benötigen, versteht sich von selbst. Die Findung einer derartig potenten Software, die auch in der Lage ist, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu ermöglichen, beschreibt Alexander Krabacher so: „In der Vergangenheit hatten wir dazu schon verschiedene Versuche unternommen, einfache bzw. schlanke Programme zu nutzen – doch mit diesen kamen wir nicht weit. Als wir dann erstmalig die Software von Eplan versuchten, waren wir ob der Mächtigkeit der unterschiedlichen Eplan-Lösungen zu verschiedensten Disziplinen und Branchen sowie den dazugehörigen Services schwer beeindruckt – wenn nicht zu sagen, fühlte es sich ein paar Nummern zu groß für uns an. Doch dieser erste Eindruck legte sich sehr rasch, da das Eplan-Portfolio die Möglichkeiten bot, stetig mit unseren Aufgaben mitwachsen zu können. Weitere wesentliche Gründe mit Eplan zu arbeiten, finden sich für uns in den schnellen Reaktionen, den regelmäßigen Updates, den umfangreichen Serviceleistungen und der System-Offenheit. Da hat Eplan wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Demnach verwenden wir für all unsere Steuerungs- und Konstruktionsplanungen im Installationsbereich ausschließlich Eplan – und das bereits auf der
neuesten Version 2025. Dabei unterstützt uns besonders das Eplan Data Portal mit seinem unschlagbar umfassenden Artikelangebot namhafter Komponentenanbieter. Damit wird die qualitative Pflege der von uns verwendeten Artikel in unseren Anlagenplanungen enorm erleichtert. Und von der Zeitersparnis auf der Suche nach passenden Komponenten brauchen wir gar nicht reden. So hat sich Eplan mittlerweile zur Existenzgrundlage unserer Leistungen gemausert und wir schätzen jede dynamische Weiterentwicklung sämtlicher Programme und digitalen Applikationen. Man kann sogar sagen, dass Eplan zu unserer hohen Marktstellung in der Anlagenprojektierung wesentlich beigetragen hat!“
# EPLAN – IM EINSATZ AB DEM ERSTEN PLANUNGSSCHRITT …
… dazu äußert sich Christoph Alber: „Hauptsächlich arbeiten wir mit der Ausprägung Eplan Electric P8. Vorwiegend verantwortlich für die Erstellung von Verteilerplänen und Dokumentationen all unserer Kundenprojekte, konstruiere ich die Schaltpläne. Das Eplan

Schaltschrank für die Pumpstation des Hochwasserschutzes der Stadt Reutte und deren umliegende Gemeinden – geplant, gebaut und betreut von den Mitarbeitern der EWR Technik GmbH im Auftrag der EWR AG.
Data Portal hilft mir, die für unsere Kundenanforderungen richtigen Komponenten zu suchen und gleich in die Schaltplanerstellung miteinfließen zu lassen. Der Detaillierungsgrad der Produkte, sowie die zur Verfügung gestellten Makros oder auch 3D-Daten für einen 3D-Aufbau sparen am Ende des Tages Konstruktionsaufwand und Zeit. Ein wesentlicher Teil ist dann auch der 3D-Aufbau des Schaltschranks. Hier dokumentieren wir die jeweils komplette Anlage bzw. die Werksübersicht samt entsprechendem Umfeld. Das betrifft zu 50 Prozent Industrieanlagen und zu 50 Prozent Gebäude-Applikationen. Egal welche Standard- oder Sonderaufträge wir zu bewerkstelligen haben, mit Eplan funktioniert wirklich immer alles einwandfrei und unkompliziert!“
… ZU KLEIN- BIS GROSSPROJEKTEN „Unter all unseren Kunden finden sich auch Großprojekte, die wir fortlaufend betreuen“, ergänzt Michael Friedle und führt exemplarisch dazu aus: „Z. B. planen wir für einen namhaften Industriekunden schon seit 2011 werksübergreifend die Sicherheitstechnik für

sein Gebäudeleitsystem – von der Signalgebung ausgeklügelter Sensorik, bis hin zu dynamischen Netzwerkverbindungen. Dieses Projekt haben wir über Jahre unter EplanNutzung auf ein sehr dynamisches Level gemeinsam und ausschließlich mit Eplan-Profis bringen können. Dieses Team verfügt über ein hohes Maß an Kompetenz und Verantwortung – besonders wenn es um sensible Auswertungen geht. Solch umfangreiche Projekte sind kaum mit einer anderen Engineering-Software als Eplan durchführbar. Weil Eplan über eine Struktur verfügt, die über Produktionsbereiche bis runter zu dortigen Achsenauslegungen, verschiedensten Steuerungen unterschiedlichster Anbieter und Glasfaserverbindungen sowie Netzwerken alles verknüpfen und alles dokumentieren kann. Probleme zu Systembrüchen oder Inkompatibilität bei Schnittstellen gibt es dabei nicht. Über all dem steht eine nahtlose gewerks- und unternehmensübergreifende sichere Zusammenarbeit zwischen allen Projektpartnern.“
… BIS HIN ZUR EINHALTUNG DER ÖVE/ÖNORM
„Selbst für E-Checks zur Einhaltung der gesetzlichen Prüffristen der ÖVE/ÖNORM in der Produktion von Schaltanlagen unterstützt uns Eplan. Dadurch können wir unseren Kunden die ordnungsgemäße Funktion ihrer elektrischen Anlage garantieren“, führt Alexander Krabacher eine der weiteren vielfältigen Eplan Software-Funktionen aus und detailliert dies: „Dazu begleiten wir unsere Kunden im privaten und gewerblichen Bereich von der Sichtprüfung, über die Messung, Prüfung und Befundung bis hin zum Anlagenbuch. Hierzu erhalten wir von unse-

ren Auftraggebern die zumeist in Eplan erstellten Konstruktionspläne – oftmals als Prototypen – und bauen dazu die entsprechenden Schaltanlagen. Da dabei immer wieder Planungsfehler in den doch sehr dynamischen Bauplänen auftreten, greifen wir mitunter auch direkt in die jeweilige Konstruktion mittels des Eplan-Multifunktionstools API (Application Programming Interface) berichtigend in die Planung ein. Durch derart kompetente Anlagen-Dokumentationen für unsere Kunden, konnten wir uns über die Jahre dieses weitere sehr stabile Standbein aufbauen.“
… AUCH WENN´S UM INFRASTRUKTURPLANUNGEN GEHT
Ein an sich naheliegendes weiteres Betätigungsfeld der EWR Technik GmbH würde man aufgrund ihrer EWR-Herkunft im Kraftwerksbau vermuten. Da allerdings deren sämtliche Kraftwerksanlagen naturgemäß über zig Jahre Bestand haben, übernimmt die EWR Technik GmbH hierzu maximal, und auch nur vereinzelt, die Überholung von Altanlagen bzw. Einzelteilen davon. „Allerdings haben wir vor etwa drei Jahren das Abwassernetz sowie den Hochwasserschutz für die Stadt Reutte und deren umliegende Gemeinden geplant und betreuen beide Projekte darüber hinaus fortlaufend“, berichtet Alexander Krabacher über einen Infrastruktur-Auftrag, der von der EWR stammt. Und Michael Friedle fügt dazu an: „Auch hier setzen wir die Eplan Softwarelösungen für die Schaltplan-Erstellung der Quellwasser- und Pumpstationsanlagen für die Wasserversorgung von Gemeinden und Hütten ein. Allerdings kommen aktuell in der Infrastruktur-Planung –
wie z. B. bei den Wasserkraft-Anlagen – bei all unseren verschiedenen Ansprechpartnern noch immer unterschiedlichste Softwaresysteme zum Einsatz. Das kompliziert für unsere externen Planungspartner zweifellos die Zusammenarbeit mit uns. Allerdings sehen sie, wie wir in unserer Arbeit von Eplan profitieren und so ziehen zunehmend etliche unserer Infrastruktur-Partner ebenso den Einsatz von Eplan in Betracht.“
WAS STEHT DEMNÄCHST AN?
„Demnach hoffen wir, dass Eplan sich in den nächsten Jahren zum verwendeten Software-Standard in unserem Umfeld etablieren wird“, vervollständigt Alexander Krabacher den Gedankengang seines Kollegen, „denn das würde speziell in der Wasserkraft- wie Elektrizitätswirtschaft in deren Projektbereichen der Instandhaltung, beim Condition Monitoring wie auch im Predictive Maintenance enorme Vorteile für alle Projektanten, aber auch Versorgungssicherheit für die Energielieferanten selbst und deren Kunden bringen.“ Diesen Überlegungen folgend, wirft Mathias Kapeller, Sales Manager Industrial Energy bei Eplan, informativ ein: „Gerade im energietechnischen Bereich – egal ob Erzeugung oder Verteilung – tut sich einiges. Unser Eplan Data Portal wird stetig mit namhaften Lieferanten bzw. deren Komponenten erweitert. Aber auch auf der Softwareseite gibt es stetige Upgrades. So wurden u. a. mit der Plattform 2025 energiespezifische IEC-Symbole in die Bibliotheken mit aufgenommen. Und auch die unterschiedlichen SoftwareAusprägungen der Eplan Plattform bieten für die gesamte Energiebranche grenzenlose Engineering-Vorteile, die viele Kunden des Energiesektors bereits seit langem schätzen. So nutzen sie z. B. klassisch Eplan Electric P8 für die Schaltplan- und Makroerstellung, Eplan ProPanel für den 3D-Aufbau eines Schaltschranks und den digitalen Zwilling oder Preplanning, um bereits in einer Vorplanungsphase auf vorhandene Informationen oder Strukturen zuzugreifen, diese in ihre Planung einzuarbeiten und so mit einem effizienten Engineering starten zu können. Und das sind nur kleine Ausschnitte aus der Vielseitigkeit an Bestlösungen, die Eplan im Engineering bietet!“
„Wenn das keine guten Aussichten sind – was dann?“, lautet der gemeinsame Schlussakkord der hier angeführten Gesprächsrunde, die ihre Stühle rückt, um eilends zu neuen Engineering-Ufern aufzubrechen
Für die Stromerzeugung aus dem Dotierwasser am Obersulzbach wurde eine innovative DIVE COAX Turbine ohne Krafthaus installiert. Der Maschinensatz wird im Regeljahr rund 1 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Aktuell errichtet der Salzburger Energieversorger Salzburg AG in Neukirchen am Großvenediger im Pinzgau ein neues Kleinwasserkraftwerk am Obersulzbach, das noch in diesem Jahr den Vollbetrieb aufnehmen wird. Gleich drei unterschiedliche Turbinenvarianten kommen dabei im Kraftwerk Sulzau für die Stromproduktion zum Einsatz. Als technisch besonders innovativ sticht dabei die kleinste der drei, die Restwasserturbine, ins Auge. Es handelt sich um eine DIVE Maschineneinheit, die zur Gänze in einer senkrecht stehenden, gut 20 Meter langen Druckrohrleitung installiert ist. Das für diesen Zweck hydraulisch optimierte System liefert im Regeljahr rund 1 Million Kilowattstunden.
Seit April 2023 laufen die Bauarbeiten im idyllischen Obersulzbachtal im Salzburger Pinzgau, um das Kraftwerksprojekt Sulzau zeitgerecht bis Frühling 2025 ans Netz zu bringen. Rund 23,5 Millionen Euro investiert die Salzburg AG gemeinsam mit der Lichtgenossenschaft Neukirchen in die Anlage, die im Regeljahr rund 18,4 Gigawattstunden sauberen Strom liefern soll. Damit zählt die neue Ökostromanlage zu den kleineren im Wasserkraftwerkspark des Salzburger Energieversorgers. Aus technischer Sicht hat sie allerdings einiges zu bieten: So sind im Maschinenhaus eine größere Francisturbine und eine
kleinere 6-düsige Peltonturbine installiert. Bei einer Fallhöhe von ca. 78 Metern arbeitet die Francisturbine hohe und konstante Wassermengen ab, wie sie etwa in der Schneeschmelze und bei anhaltenden Niederschlägen gegeben sind. Die Peltonturbine agiert dagegen eher flexibel, passt sich bei konstant guten Wirkungsgraden an schwankende Triebwassermengen an und lässt sich ideal zur größeren Francisturbine dazuschalten. Zusammen erreichen die beiden Turbinen eine Engpassleistung von rund 5,6 MW. Ergänzt werden sie noch um eine dritte Turbine, die allerdings nicht im Krafthaus ihren Dienst versieht.
ÖKOSTROM AUS DOTIERWASSER
Vielmehr befindet sich diese im Bereich der Wasserfassung, die geprägt ist von zwei massiven Sperren, die schon vor Jahren von der Wildbach- und Lawinenverbauung errichtet worden waren. Das Einlaufbauwerk für das neue Kraftwerk wurde an der sogenannten „alten Blauseesperre“ gebaut, wo eine Gefällstufe von rund 21 Metern vorliegt. Und genau hier, wo das Dotierwasser in den Obersulzbach zurückgeführt wird, wollten die Kraftwerksplaner die gegebene Stufe ebenfalls zur Stromproduktion nutzen. Die Frage, die sich dabei stellte: Mit welcher technischen Lösung ließ

An der „alten Blauseesperre“, wo das Restwasser des neuen KW Sulzau in den Obersulzbach zurückgeführt wird, liegt eine Gefällstufe von rund 21 Metern vor. Diese nutzt die neue DIVE-COAX-Turbine.
sich dies effektiv und wirtschaftlich realisieren?
Die Antwort lieferte die moderne DIVECOAX-Turbine, die vom bayerischen Turbinenspezialisten speziell für Standorte dieser Art entwickelt wurde. Generell ist die DIVE Turbine dadurch charakterisiert, dass es sich um eine vertikal durchströmte, drehzahlgeregelte Propellerturbine handelt, bei der das Laufrad über die Turbinenwelle direkt mit dem zumeist komplett überspülten Generator verbunden ist. „Abhängig vom jeweiligen Zufluss kann die DIVE Turbine ein Wasserdargebot von weniger als 200 bis 2.200 l/s verarbeiten“, erläutert Thomas Friedrich, Projektleiter der Salzburg AG, die Flexibilität der Turbine und warum man sich für diesen Maschinentyp entschieden hatte. Im Detail sprachen für die DIVE Turbine der geringe bauliche Aufwand und darüber hinaus die vergleichsweise hohe Jahresarbeit mit dieser Technologie. Ein weiterer Vorteil für den Betreiber: Die Turbine muss auch bei minimalem Wasserdargebot nicht abgeschaltet werden. Gerade wenig Wasser resultierend aus extrem kalten Temperaturen würde bei einer Abschaltung zu Vereisungen führen
Zentrale Anforderung im Konzept des Restwasserkraftwerks war, die Rohrleitung möglichst landschaftsverträglich und unauffällig direkt am Naturfels in unmittelbarer Nähe zur „alten Blauwassersperre“ zu integrieren. „Im Flussbett wäre ein Gebäude für die Maschine nicht möglich gewesen. Es war von vornherein klar, dass die Einheit in der freistehenden Rohrleitung im überfluteten Bereich installiert wird“, sagt Christian Winkler, Vertriebsleiter bei DIVE Turbinen GmbH & Co. KG und erläutert im gleichen Atemzug, warum gerade diese Betriebsweise den Eigenschaften der DIVE Turbine entgegenkommt: „Dank ihres patentierten Maschinendesigns, also der kompakten Lagereinheit für Turbine und Generator, und der wartungsfreien DIVE Dichtung ist ein hochwasserfester permanenter Unterwasserbetrieb der DIVE Turbine gewährleistet, was sie natürlich für diese Art von Einsatz prädestiniert.“ Das bedeutet selbstredend auch, dass die Maschine absolut hochwassersicher ist.

Konkret lieferte der bayerische Wasserkraftspezialist neben der Turbine-Generatoreinheit, die Druckrohrleitung, die elektrische Ausrüstung und den Wechselrichter für den drehzahlvariablen Betrieb. Die Montagearbeiten wurden im September und Oktober 2024 durchgeführt.
PROJEKTSPEZIFISCHE ADAPTIONEN ERFORDERLICH Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts war die von Ingenieuren von DIVE maßgeschneiderte Lösung für den Standort. Neben einer speziell angepassten Leitungsführung stand dabei die Adaption

des hydraulischen Designs im Fokus der Ingenieure. Letzteres wurde mittels 3D-CFD-Verfahren bei DIVE „inhouse“ realisiert. Christian Winkler: „Bei der Anpassung der Maschine an die Gegebenheiten konzentrierten wir uns nicht nur auf die optimalen Wirkungsgrade im Nennpunkt, sondern auch auf ein exzellentes Teillastverhalten. Das Ziel lautete: Maximierung der Jahresarbeit – und das ist uns gelungen.“
Grundsätzlich handelt es sich bei der DIVE Turbine um eine doppeltgeregelte Maschine, deren Laufrad über feste Laufschaufeln verfügt. Die doppelte Regulierung ergibt sich durch die verstellbaren Leitschaufeln und die Drehzahlvariation. Die hydraulische Auslegung basiert auf dem Prinzip einer für den drehzahlvariablen Betrieb optimierten Diagonalturbine mit feststehenden Laufradschaufeln und Außenkranz. DIVE bezeichnet dieses Laufrad wegen der halbaxialen Anströmung als HAX-Laufrad. Die Maschine selbst ist eine COAX-Turbine, da der Leitapparat ebenfalls koaxial durchströmt wird. Basierend auf diesem Maschinenkonzept kann die DIVE Turbine entlang eines breiten Lastbandes effektiv betrieben werden. Eine zentrale Qualität speziell für den Einsatz im Restwasserkraftwerk Sulzau. Schließlich wird die Turbine im Winter üblicherweise auch bei extrem niedrigem Wasserdargebot, das durchaus deutlich unter 10 Prozent des Nenndurchflusses liegen kann, betrieben.
BELASTUNG DURCH GESCHIEBE
Ein weiterer Punkt, warum die DIVE Turbine beste Voraussetzungen für den Standort an dem Pinzgauer Wildbach mitbringt: Aufgrund ihrer Geometrie, dem gesamten hy-


Der bayerische Wasserkraftspezialist lieferte auch das Rohrleitungssystem für das Restwasserkraftwerk, das zusammen mit der Turbinen-Generator-Einheit per Lkw angeliefert wurde.
draulischen Design, aber auch aufgrund der eingesetzten Materialien zeigt sie sich in der Regel sehr widerstandsfähig im Hinblick auf Abrasion durch Geschiebe. Gerade größere Partikel verursachen grundsätzlich kaum Schäden am Laufrad. Die hohe mechanische Qualität des eingesetzten Laufrads basiert im Wesentlichen darauf, dass es aus dem Vollen gefertigt – also aus einem Stahlrohling gearbeitet – wird. „In diesem speziellen Fall wurde das Laufrad nach der Bearbeitung auch noch speziell gehärtet. Das war notwendig, da der Obersulzbach auch viel Gletscherschliff mit sich führt, was bekanntermaßen die Gefahr für Abrasion erhöht“, erklärt Projektleiter Felix Frey.
DREHZAHLVARIABEL – DANK UMRICHTERTECHNIK
Großes Augenmerk wurde auch auf die von der Firma DIVE-Turbinen durchgeführte elektrische Projektierung der projektspezifischen elektrischen Ausrüstung inkl. der Wechselrichter für den drehzahlvariablen Kraftwerksbetrieb gelegt. „Wichtig bei einem derartigen Anwendungsfall ist natürlich die applikationsspezifische Drehzahlsollwertgenerierung. Diese wurde so umgesetzt, dass auf hydraulische und elektrische Stabilität geachtet wurde. Mechanische und elektrische Resonanzen während der regenerativen Rückspeisung durch die geberlose Drehzahlführung galt es zu vermeiden“, geht Sven Hermann, Leiter der Elektrotechnik, ins Detail. Generell verweist er darauf, dass zugunsten der Robustheit der Steuerung die Komplexität in der Kundenschnitte reduziert werden konnte. Die Drehzahlregelung wird ermöglicht durch einen Permanentmagnetgenerator, der vom Laufrad der DIVE Turbine getriebefrei angetrieben wird, und elektronische Umrichter. Der Umrichterbetrieb der DIVE Turbine ermöglicht die Stromgewinnung bereits ab 5 Prozent des Nenndurchflusses – ein wesentlicher Faktor, warum die Maschineneinheit für den Einsatz in dem alpinen Wildbach bestens geeignet ist.
STARKES KRAFTPAKET MIT 360 KW
Konkret installierte das Team des bayerischen Wasserkraftspezialisten am Obersulzbach eine DIVE-COAX-Turbine mit einem Laufraddurchmesser von 650 mm, das bei einer Fallhöhe von 21,05 m auf eine Ausbauwassermenge von 2,2 m3/s ausgelegt wurde. Dabei erreicht die Restwassermaschine eine Ausbauleistung von 360 kW. Da die Anlage in einem komplett geschlossenen Rohrsystem betrieben wird und Turbine und Generator im Inneren eine kompakte Einheit ohne Getriebe bilden, zeichnet sich das Ensemble auch durch einen sehr schall- und vibrationsarmen Betrieb aus. In Summe erzeugt das Restwasserkraftwerk im Regeljahr rund 1 GWh erneuerbaren Strom, womit ca. 400 Salzburger Haushalte versorgt werden können. Während die Restwassermaschine im November 2024 erfolgreich in Betrieb genommen wurde, laufen aktuell die Arbeiten an der Fertigstellung des Hauptkraftwerks, das im zweiten Quartal dieses Jahres plangemäß seine Tätigkeit aufnehmen wird. Gemeinsam mit dem neuen Restwasserkraftwerk wird das KW Sulzau der Salzburg AG dann im Regeljahr Strom für 5.000 Haushalte liefern.
• Brutto-Fallhöhe: 21,05 m
• Netto-Fallhöhe: 20,55 m
• Ausbaudurchfluss: 2,2 m3/s
• Turbine: DIVE-COAX-Turbine
• Turbinenachse: vertikal
• Laufrad-Durchmesser: 650 mm
• Leistung: 360 kW
• Hersteller: DIVE Turbinen GmbH & Co. KG
• Generator: PMG
• Regelung: Leitapparat & Drehzahl
• Drehzahl: 100 - 650 Upm
• Energieproduktion: 1,0 GWh
• Inbetriebnahme: Nov. 2024
Die Fachmesse Renexpo Interhydro in Salzburg gilt alljährlich als Branchentreffpunkt für Europas führende Unternehmen im Bereich der Hydroenergie.

Am 27. und 28. März 2025 findet die Renexpo Interhydro im Messezentrum Salzburg statt – der zentrale Treffpunkt für Wasserkraft-Experten aus ganz Europa. Die Fachmesse bietet eine einzigartige Plattform für Fachleute aus allen Bereichen der Wasserkraft, von Planern und Betreibern bis hin zu Lieferanten und Dienstleistern. Nutzen Sie die Gelegenheit, neue Innovationen zu entdecken, wertvolle Erfahrungen auszutauschen und ein Netzwerk aus hochkarätigen Kontakten aufzubauen.
Am 27. und 28. März 2025 findet die Renexpo Interhydro im Messezentrum Salzburg statt – der zentrale Treffpunkt für Wasserkraft-Experten aus ganz Europa. Die Fachmesse bietet eine einzigartige Plattform für Fachleute aus allen Bereichen der Wasserkraft, von Planern und Betreibern bis hin zu Lieferanten und Dienstleistern. Nutzen Sie die Gelegenheit, neue Innovationen zu entdecken, wertvolle Erfahrungen auszutauschen und ein Netzwerk aus hochkarätigen Kontakten aufzubauen.
DIE RENEXPO INTERHYDRO ALS INNOVATIONSMOTOR DER BRANCHE
Die Renexpo Interhydro ist eine zentrale Plattform für die (Klein-) Wasserkraftbranche und präsentiert die neuesten Entwicklungen und Trends. In Zeiten wachsender Bedeutung erneuerbarer Energien spielt die Wasserkraft eine Schlüsselrolle. Die Messe fördert den Austausch von Wissen und die Schaffung neuer Partnerschaften, die den Fortschritt der Branche vorantreiben. Sie bietet eine ideale Gelegenheit, sich über die neuesten Technologien zu informieren und gemeinsam an der nachhaltigen Zukunft der erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft zu arbeiten.



FACHVORTRÄGE UND EXPERTENSESSIONS ZU AKTUELLEN THEMEN
Die Renexpo Interhydro bietet ein anspruchsvolles Rahmenprogramm mit wertvollen Einblicken in wissenschaftliche und politische Entwicklungen der Wasserkraft. Ein Highlight ist der Energy Talk zu „RED III und Wasserkraft – Wann beginnt die Beschleunigung?“, der wichtige Fragen zur zukünftigen Entwicklung der Wasserkraft im Kontext der EU-Vorgaben behandelt. Fachvorträge und Podiumsdiskussionen bieten Lösungen und Best Practices zu Themen wie rechtlichen Rahmenbedingungen aber auch zu den ökologischen Herausforderungen. Die Fachmesse ist ein idealer Ort für Austausch, Networking und die Präsentation von Lösungen für die drängendsten Branchenfragen.
EXPERTEN ZU INNOVATION UND ÖKOLOGIE IN DER WASSERKRAFT
Parallel zur Renexpo Interhydro finden zwei Expertenveranstaltungen in Zusammenarbeit mit vgbe energy e.V. und dem Verein für Ökologie



und Umweltforschung (VÖU) statt. Die beiden Expertenveranstaltungen „Innovationen im Betrieb und in der Wartung von Wasserkraftwerken 2025“ und „Flussmanagement und Ökologie 2025“ behandeln sowohl neue Technologien als auch ökologische Fragestellungen wie Renaturierung, Biodiversität und die Integration ökologischer Anforderungen in den Betrieb von Wasserkraftanlagen.
EINE PLATTFORM FÜR ZUSAMMENARBEIT UND ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
Die Renexpo Interhydro bietet der Wasserkraftindustrie in Europa eine ideale Plattform, um gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen zu arbeiten. Die Veranstaltung trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung der Branche bei, indem sie den Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fördert. In einer Zeit, in der die Welt auf eine nachhaltige und resiliente Energiezukunft hinarbeitet, liefert die Messe wichtige Impulse und trägt zur Stärkung der Wasserkraft als unverzichtbare Energiequelle bei.

SCHNELLERE VERFAHREN DURCH
DIE UMSETZUNG VON RED III
Mit der am 20. November 2023 in Kraft getretenen Renewable Energy Directive (RED III) hat die EU eigentlich den emissionsfreien Turbo in Richtung Energiewende gezündet. RED III enthält klare Zeit- und Zielvorgaben in Richtung Erneuerbaren-Ausbau, sieht dafür schnellere Verfahren und Beschleunigungsgebiete vor und schreibt verbindlich ein überragendes öffentliches Interesse an Erneuerbaren vor. Kleinwasserkraft Österreich fordert, dass die nächste Bundesregierung sowie die Bundesländer die RED III-Vorgaben rasch umsetzen.
EIN STABILER FÖRDERRAHMEN DURCH ÄNDERUNGEN IM ERNEUERBAREN-AUSBAU-GESETZ (EAG)
• Keine naturschutzrechtlichen Zusatz-Auflagen für bereits als ökologisch verträglich bewilligte Kraftwerke.
• Die Förderung für die Revitalisierung von Kleinwasserkraftwerken muss attraktiver werden.
• Mehr Förderung von Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken und Förderung für den Umbau bestehender Anlagen zur besseren Systemintegration.
MEHR WISSENSCHAFTLICHE STANDARDS UND WENIGER BEHÖRDENSPIELRAUM BEI LEITFÄDEN UND DER INTERPRETATION VON VERORDNUNGEN
• Leitfäden für den Bau von Fischaufstiegshilfen und deren Monitoring bieten derzeit

eine sehr „breite Interpretations-Spielwiese“ für Beamte und Behörden. Teilweise müssen Betreiber oder Betreiberinnen von Kleinwasser-Kraftwerken Aufstiegshilfen für Fische in einer Größe dimensionieren, die es im Gewässer gar nicht gibt und absehbar auch nicht geben wird.
• Verursacherprinzip bei der Gewässerqualität: Derzeit wird die Verantwortung für die Gewässerqualität der Kleinwasserkraft aufgebürdet – der Einfluss anderer Stakeholder (z.B. Fischerei, Landwirtschaft) wird im Wesentlichen völlig ausgeblendet.
• Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und Neuentwicklungen sollen in standardisierten Verfahren rasch umgesetzt werden –ohne lange und zeitraubende Verfahren.

DAS LANDSCHAFTSBILD UND TEURE DOPPELPRÜFUNGEN IM NATURSCHUTZ DÜRFEN NICHT LÄNGER VERHINDERER SEIN
• Durch das Naturschutzgesetz sollen nur jene Punkte geprüft werden, die nicht ohnehin nach dem Wasserrecht geregelt sind. Doppelprüfungen kosten viel Zeit und Geld.
• Ein Kleinwasserkraftwerk, das sämtliche Auflagen erfüllt und alle Genehmigungsverfahren positiv hinter sich gebracht hat, kann alleine mit dem Verweis auf das Landschaftsbild verhindert werden. Das geht so weit, dass ein Kraftwerksprojekt abgelehnt werden kann, wenn dadurch der „sprudelnde Weißwasser-Anteil“ geringfügig reduziert wird. [www.kleinwasserkraft.at]
Normen einhalten, Versorgung sicherstellen, Lastverteilungen optimieren:
Die Herausforderungen im Energiesektor sind groß.
Gleichzeitig erfordern Klimaschutzziele und der Wandel der Energiepolitik innovative Lösungen und eine nachhaltige Steigerung der Energieeffizienz.
Meistern Sie diese Aufgaben mit einem leistungsfähigen Anlagen-Engineering als Grundlage für die Erzeugung, Verteilung oder Nutzung von Strom.
Mehr erfahren unter: eplan.at/energie

Auch Maschinenkomponenten, die in einem Wasserkraftwerk nur sehr aufwendig oder gar nicht demontierbar sind, können einer professionellen Sanierung bzw. Reparatur unterzogen werden. Das Zauberwort heißt „mobile Zerspanungstechnik“ – oder auch „OnSite-Machining“ genannt: Es bedeutet, dass betroffene Metallflächen und Bauteile mittels transportabler Spezialmaschinen und falls erforderlich unter Zuhilfenahme von 3D-Laser-Tracking vor Ort in Werkstattqualität bearbeitet und repariert werden – eine Dienstleistung, die heute nur von wenigen Unternehmen professionell angeboten wird. Ein etabliertes und erfahrenes davon: die BSA Engineering GmbH aus Elsdorf bei Köln, die seit über 10 Jahren schnelle Unterstützung im Bedarfsfall garantiert – und das weltweit.
Gerade in der Wasserkraft sind Material und Bauteile im täglichen Betrieb extremen Kräften ausgesetzt. Als häufige Folge davon stellen sich nach Jahren und Jahrzehnten Verschleiß und diverse Schäden durch Korrosion, Kavitation oder Kerbwirkung ein. Was letztlich bedeutet, dass es zu Undichtigkeiten kommt und zum Beispiel Konzentrizitäten von Durchmessern sowie Parallelitäten von Flächen die zulässigen Toleranzen verlassen. In weiterer Konsequenz entwickeln Antriebsstränge von Rotor bis Laufrad Unwuchten und unruhiges Laufverhalten, lassen sicherheitstechnische Mängel entstehen und die Effizienz sinken. Ist der Zeitpunkt erreicht, an dem eine Revision unumgänglich wird, stellt sich für den Betreiber die Frage: Wie kann ich meine Anlage mit geringstmöglichen Stillstandzeiten sanieren? Und vor allem: Wie können Anlagenteile mechanisch bearbeitet werden, die nur mit großem Aufwand oder gar nicht demontierbar sind, wie etwa eine einbetonierte Turbinenspirale oder einbetonierte Fundamentplatten? Antworten auf diese Fragen liefert der nordrhein-westfälische Branchenprofi BSA Engineering GmbH, der auf mobile Zerspanungsarbeiten spezialisiert ist.
PRÄZISIONSARBEIT AM „ENTZÜNDUNGSHERD“
„Als Dienstleister bieten wir Metallbearbeitung in allen Varianten an – angefangen vom Drehen, Fräsen, Spindeln, über Bohren und

Wenn es gilt, schwer demontierbare Bauteile eines Kraftwerks vor Ort in Werkstattqualität zu reparieren oder zu bearbeiten, braucht es Spezialisten für On-Site-Machining wie die BSA Engineering GmbH. Im Bild: Die mobile Bearbeitung einer Funktionsfläche in einem Kraftwerk in Ungarn.
Schleifen bis zum Herstellen und Reparieren von Gewinden aller Art und einigem mehr. Was uns aber von anderen Unternehmen in diesem Metier unterscheidet, ist der Umstand, dass die Reparaturarbeiten nicht irgendwo in der Werkstätte eines Lohnfertigers, sondern direkt vor Ort, in der Anlage des Kunden durchgeführt werden. Wir gehen sozusagen direkt in den ‚Entzündungsherd’ hinein“, erklärt BSA-Geschäftsführer Mounir Baghdadi und führt im Detail aus: „Anders als in einer Werkstatt wird bei uns das Werkstück nicht in eine Maschine eingespannt, sondern – umgekehrt – die Bearbeitungsmaschine wird je nach Aufgabenstellung auf, bzw. unter oder in das Werkstück, gespannt.“ Dieses Arbeitskonzept des „On-site-Machining“ bringt gleich mehrere Vorteile für den Kunden: Zum einen können auf diese Weise Bauteile saniert wer-
den, die gar nicht oder nur mit extremem Aufwand demontiert werden können. Zum anderen erspart man sich Zeit und Kosten, da Stillstandzeiten minimiert und aufwändige (Spezial-)Transporte hin zur Reparaturwerkstatt und retour zum Kraftwerk obsolet werden.
SONDERMASCHINEN AUS EIGENER KONSTRUKTION
Die BSA Engineering GmbH wartet dabei nicht nur mit großem Know-how aus über zehnjähriger Firmenerfahrung, sondern auch mit einem hoch modernen und innovativen Maschinenpark auf. Das spezialisierte Unternehmen greift in der Regel auf Sondermaschinen zurück, die aus eigener Entwicklung stammen und die dank ihrer modularen Bauweise an die jeweilige Anforderung angepasst werden – oder im Bedarfsfall auch neu entwickelt werden. Die Bearbeitungsmaschinen
Die mobile 3D-Laservermessung ermöglicht hochpräzises Arbeiten.

sind dabei entweder konventionell oder – mittlerweile in der Regel –CNC-gesteuert. Zudem verfügt das Unternehmen über mehrere LaserTracker, die nicht nur eine Vermessung von Bauteilen im Hundertstel-Millimeter-Bereich ermöglichen, sondern auch der Maschinenausrichtung und der Qualitätskontrolle während der mechanischen Bearbeitungen dienen. Aussagekräftige Protokolle vor und nach der Bearbeitung ermöglichen eine genaue Dokumentation über den Zustand der betroffenen Anlagenteile und das Ergebnis der Bearbeitung.
Wie ein derartiger Projektablauf von Anfang bis Ende üblicherweise vonstattengeht, erläutert Mounir Baghdadi: „In der Anfragephase erhalten wir in der Regel vom Kunden technische Dokumentationen, idealerweise mit Fotos und – falls verfügbar – auch schon ein 3D-Modell, um den Umfang der Aufgabenstellung definieren zu können. In der darauffolgenden Angebotsphase erarbeiten wir die kaufmännische, technische und organisatorische Evaluierung. Außerdem führen wir gegebenenfalls auch 3D-CAD-Simulationen durch, nicht zuletzt, um eventuelle Störfaktoren zu detektieren und den Vorrichtungsbau abzu-


Bei der Laservermessung setzt man bei BSA Engineering auf eine spezielle, hochentwickelte Lasertracker-Software
schätzen. Im Zuge der Auftragsphase wird der Auftrag projektiert und die benötigten Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt, beziehungsweise im Bedarfsfall dafür gefertigt. Auch die Organisation von Zollabwicklung, Speditionen, Unterkünften und dergleichen sind Teil der Auftragsphase. Schließlich folgt die Durchführungsphase, die in enger Abstimmung mit dem Kunden verläuft – ebenso wie die Abnahme. Ergänzend zur konventionellen Vermessung bieten wir nach der Bearbeitung zur Protokollierung und Qualitätskontrolle auch noch die Laservermessung mit an.“ BSA Engineering punktet dabei vor allem mit der Option, alles aus einer Hand liefern zu können. Das bedeutet konkret, dass der Kunde für die Laservermessung kein weiteres Unternehmen beauftragen muss und damit Schnittstellenprobleme ausspart. „Wenn Bearbeitung und Vermessung von zwei unterschiedlichen Firmen ausgeführt werden, kommt es fast zwangsläufig zu Verzögerungen. Schließlich ist die Abstimmung sowohl im Hinblick auf die Maschinenausrichtung als auch auf das Timing anspruchsvoll. Wir treten als Team auf, in dem die ‚Zahnräder‘ von Vermessung und Bearbeitung optimal ineinandergreifen“, argumentiert Baghdadi. „Auch unser In-House Engineering und unser Sondermaschinenbau ermöglichen es uns, flexibel und effizient auf spezielle Anforderungen unserer Kunden zu reagieren.
HÖCHSTE PRÄZISION IM HUNDERTSTEL-MILLIMETER-BEREICH Zu den absoluten Spezialitäten des Unternehmens zählt unter anderem das mobile Ausdrehen von einbetonierten Turbinenspiralen, wie man es in der Vergangenheit zigfach unter Beweis stellen konnte. Erst kürzlich nahm das Team von BSA Engineering an einer Sanierung im Pumpspeicherkraftwerk Erzhausen, nahe Kassel teil. Dabei wurden die Funktionsflächen der Pump- und Turbinenspirale saniert. „Bei einem Durchmesser und Planflächen von bis zu 3,20 m galt es eine Bearbeitung durchzuführen, die bis auf 0,1 mm genau sein musste. Die Be-
Konkrete Anwendungsbeispiele sind:
• Mobiles Ausdrehen von Turbinenspiralen und Laufradmänteln
• Flanschbearbeitungen aller Art
• Mobiles Einbringen von Nuten
• Wellenbearbeitungen
• Spindeln von Kupplungsbohrungen an Generator- und Turbinenwellen
• Mobiles Überfräsen von Fundamentplatten
• Mobile Bearbeitung an Kugelschiebern
• Mobiles Fräsen von Polkeilnuten an Rotoren
• Mobiles Spindeln von Leitschaufellagersitzen

arbeitung haben wir mit einer unserer modernen CNC-gesteuerten transportablen Drehmaschinen in Tag- und Nachtschicht durchgeführt. Der Auftrag konnte zur vollen Zufriedenheit des Kunden ausgeführt werden“, sagt Baghdadi. Mithilfe der CNC-gesteuerten Drehmaschinen ist BSA Engineering in der Lage, hochpräzise Drehbearbeitung an Wasserkraftturbinen, wie Francis-, Kaplan- und Peltonturbinen durchzuführen, und das bis zu einem Durchmesser von 10 Metern. Dank modernster Software können die Techniker von BSA Engineering die CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschinen hochpräzise ausrichten und diese im Bearbeitungsprozess permanent überwachen. Außerdem – so Mounir Baghdadi – sei es möglich, vor Ort Programme für den Prozess zu schreiben, sodass selbiger beliebig reproduzierbar ist. „Das ist sehr hilfreich, wenn es gilt, identische Arbeitsschritte an anderen Maschinen zu wiederholen, oder wenn das Personal auf der Baustelle wechselt und man später einfach auf ein vorgegebenes Programm zurückgreifen kann.“
MASCHINEN WACHSEN MIT ANFORDERUNG Erfahrung, Flexibilität und technische Kreativität sind die essenziellen Voraussetzungen für das On-Site-Machining, wie es BSA Engineering bietet. Die Kernkompetenz im Dienstleistungsportfolio der nordrhein-westfälischen Branchenprofis liegt allerdings in der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung eigener Bearbeitungsmaschinen. Sämtliche großen
Bearbeitungsmaschinen, die BSA Engineering GmbH heute regelmäßig zum Einsatz bringt, sind Eigenkonstruktionen. Entsprechend dem Leitprinzip des Unternehmens „Zuhören – Verstehen – Lösen“ liefern seine Ingenieure maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen. „Unsere Maschinen werden ständig weiterentwickelt und wachsen mit den Anforderungen auf der Baustelle“, erklärt Mounir Baghdadi und ergänzt: „Der maximale Spanndurchmesser für die Fixierung der Bearbeitungsmaschine liegt beim mobilen Drehen von Turbinenspiralen heute bei etwa 6 Metern. Sollten es einmal 7 Meter sein, dann wird die Maschine dahingehend weiterentwickelt. Durch den modularen Aufbau von vielen unserer Sondermaschinen lässt sich das machen, und es ergeben sich viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ein Fräsbalken entsprechend angepasst werden muss.“ Dabei handelt es sich bei den mobilen Sondermaschinen keineswegs um filigrane Technik. Im Gegenteil, die selbstentwickelten Bearbeitungsmaschinen sind robust und bringen je nach Aufbau auch gut und gerne mal bis zu drei Tonnen auf die Waage. Vor 4 Jahren hat das Unternehmen in einen Neubau auf grüner Wiese investiert und seither auch viele neue stationäre Bearbeitungsmaschinen angeschafft. „So sind wir noch flexibler und effizienter, wenn es um den projektbezogenen Vorrichtungsbau und das Fertigen von Maschinenkomponenten geht“, führt Baghdadi weiter aus.
„SCHNELLBOOT“ BLEIBT AUF ERFOLGSKURS
Flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, zählt zu den augenscheinlichsten Qualitäten des Teams von BSA Engineering. Schlanke Strukturen, kurze Vorlaufzeiten, Innovationskraft und jahrelange Erfahrung sind die Garanten für den Projekterfolg. „Wir sehen uns selbst als eine Art ‚Schnellboot‘ in der Branche, haben keinen großen Overhead, und sind daher flexibel, reaktiv und eine at-

traktive Alternative zur stationären Werkstatt“, so Mounir Baghdadi. Er verweist darauf, dass das Unternehmen im Jahr im Schnitt rund 60 bis 80 Projekte im Bereich On-SiteMachining erfolgreich abwickelt – und das weltweit. Zwar bedient BSA Engineering nach wie vor seine stärksten Märkte Schweiz, Österreich und Deutschland intensiv, ist mittlerweile aber auch auf der ganzen Welt aktiv. „Unsere Service Techniker kommen ganz schön rum auf der Welt, der Begriff ‚Work-and-Travel’ trifft es schon sehr gut.“ Bei- spiele hierfür sind Projekte in Mexiko, Norwegen, Island, Pakistan, Marokko oder Saudi-Arabien, sie belegen die Internationalität des inhabergeführten Mittelständlers aus Elsdorf bei Köln. Mit Effizienz und Präzision direkt vor Ort bleibt das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs.
Der Spezialist für mobiles Zerspanen BSA Engineering aus Elsdorf bei Köln gilt als „Schnellboot“ in der Branche: Ein Unternehmen, das prompt, flexibel und effizient mobile Sanierungen bzw. Bearbeitungen in Werkstattqualität ermöglicht.

Messflügel-Durchflussmessung

Niederdruckanlagen liefern in den Alpenländern bedeutende Anteile der hydroelektrischen Stromproduktion. In der Schweiz beispielsweise liefern Niederdruckanlagen, die zumeist mit doppeltregulierten Turbinen (Kaplan- und Rohrturbinen) ausgestattet sind, rund ein Viertel der gesamten hydroelektrischen Stromproduktion. Diese Turbinentypen zeichnen sich in erster Linie durch verstellbare Leit- und Laufradschaufeln aus. Für den Betrieb bei bestem Wirkungsgrad und damit maximaler Produktion ist der optimale Zusammenhang zwischen Leit- und Laufradposition äußerst wichtig. Für sämtliche Analysen in Niederdruckanlagen wird der Durchfluss als Eingangsgröße benötigt. Doch wie kann dieser für diesen Anlagentyp bestimmt werden?
Es gibt grundsätzlich zwei Typen von Wirkungsgradmessungen - die absolute und die relative Wirkungsgradmessung. Bei Niederdruckanlagen fließt der absolute Wirkungsgrad direkt in die Nutzenergie, die Stromproduktion, ein. Ist ein höherer absoluter Wirkungsgrad vorhanden, dann resultiert – bei gegebenem Wasserdargebot und gegebener Fallhöhe – eine höhere Stromproduktion. Relative Wirkungsgradmessungen werden auch als Indexwirkungsgradmessungen bezeichnet. Indexwirkungsgradmessungen – gleichbedeutend mit dem Begriff der Zusammenhangsmessungen bei den Niederdruckanlagen – werden meistens zur Kontrolle und Optimierung des Zusammenhangs mit geringem Aufwand durchgeführt. Hierbei werden die optimalen Leit- und Laufradpositionen zueinander durch die Aufnahme von sogenannten Propellerkurven kontrolliert. Bei Niederdruckanlagen basieren solche Indexwirkungsgradmessungen hauptsächlich auf Differenzdruckmessungen. Dies sind Differenzdruckmessungen zwischen zwei Positionen, bei welchen der Druckunterschied vom Quadrat der Durchflussänderung abhängig ist.
BESTIMMUNG VON WIRKUNGSGRADEN
Muss man den Turbinenwirkungsgrad bestimmen oder einen Garantienachweis durchführen, so kommt man um absolute Wirkungsgradmessungen nicht herum. Dies gilt ebenso für die Abschätzung des Potentials einer Produktionserhöhung bei Erneuerungs-
projekten. Diese müssen den effektiven Durchfluss durch die Maschinengruppen als Randbedingung kennen. Abschätzungen basierend auf Muschelkurven von Modellversuchen (die oft nicht mit den Muschelkurven in der Anlage übereinstimmen) oder basierend auf theoretischen Berechnungen im Turbi-


nenregler sind erfahrungsgemäß fehleranfällig. Dies hat insbesondere damit zu tun, dass bei Modellversuchen für Niederdruckanlagen die realen Zu- und Abströmbedingungen nicht vollständig abgebildet werden können. Etliche Prototypen zeigen dann in der Realität ein unerwartetes Verhalten. Bei Erneuerungsprojekten ist es daher ratsam, einem Turbinenlieferanten den aktuellen Wirkungsgradverlauf sowie die weiteren bei der Wirkungsgradmessung erfassten Randbedingungen zur Auslegung der neuen Turbine zur Verfügung zu stellen. Vorgängige Wirkungsgradmessungen bei Erneuerungsprojekten können in die Ausschreibung aufgenommen werden, um eine Transparenz zu schaffen, die bei Fehlen nach der Erneuerung oft zu Diskussionen führt. Beispielweise kann in der Ausschreibung explizit erwähnt werden, dass mit den zur Verfügung gestellten Zulaufströmungen zu rechnen ist. Messflügelmessungen können hierzu das vollständige, reale Strömungsbild vor der Neuauslegung liefern. Obwohl die Bedeutung der Kaplan- oder Rohrturbinen und der Niederdruckanlagen unbestritten ist, werden Wirkungsgrad- und Zusammenhangsmessungen oft nicht durchgeführt. Oder es erfolgen nur Messungen mit minimalem Aufwand in Form von sogenannten Fingerprintmessungen. Fingerprintmessungen werden vor allem zum Nachweis der Schwingwerte durchgeführt. Welche Anforderung oder welcher Nachweis durch welche Art von Wirkungsgradmessungen abgedeckt werden kann, ist in Bild 2 tabellarisch zusammengefasst.
Absolute Wirkungsgradmessungen sind aufwändiger als Indexwirkungsgradmessungen. Etaeval hat sich jedoch das notwendige Wissen aufgebaut, um anspruchsvolle Messflügelmessungen bei Niederdruckanlagen durchzuführen. Des Weiteren bieten wir für Niederdruckanlagen auch unsere Expertise mit akustischen Durchflussmessungen an. Aus unserer Sicht kann mit diesen beiden absoluten Messmethoden praktisch für jede
Niederdruckanlage der absolute Durchfluss und somit der absolute Wirkungsgrad gemessen werden.
Messflügelmessungen erfolgen meistens im Dammbalkenschlitz vor der Turbine oder in Ausnahmefällen vor dem Rechen. Dabei wird eine größere Anzahl kalibrierter Messflügel an einem Messrahmen montiert. Anschließend wird durch das Verschieben des Messrahmens das Geschwindigkeitsprofil an vielen einzelnen Punkten gemessen und in einem weiteren Schritt zum Durchfluss integriert. Als Beispiel für solche Messflügelmessungen ist in Bild 3 der Messrahmen im Dammbalkenschlitz des Gezeitenkraftwerks von La Rance, Frankreich, gezeigt. Diese Niederdruckanlage hat 24 Maschinengruppen mit einer Nennleistung von je 10 MW. Die Messung des Durchflusses in La Rance ist herausfordernd, da die Fallhöhe ständig und je nach Gezeitenverlauf zwischen 2 und 11 m variiert. Der Durchfluss durch eine einzelne Turbine schwankt zwischen 75 und 280 m³/s. In einem typischen Jahr beläuft sich die jährliche Stromproduktion der Anlage auf 540 GWh.
OPTIMIERUNGSPOTENTIAL FESTGESTELLT
Am von etaeval ausgelegten und mit einer Strukturanalyse überprüften Messrahmen
wurden 24 Messflügel auf zwei Höhenlagen montiert. Für das Bewegen des Messrahmens stand ein separater Dammbalkenkran zur Verfügung. Der Betreiber Électricité de France (EDF) hatte sich entschieden, von etaeval absolute Wirkungsgradmessungen durchführen zu lassen, gefolgt von Zusammenhangsmessungen mit einer Differenzdruckmessung, die durch die Messflügelmessung kalibriert wurde. Nach der Auswertung der Messkampagnen bei dieser Niederdruckanlage konnte von EDF ein Verbesserungspotential von 2 Prozent im Anlagenwirkungsgrad und damit in der Stromproduktion detektiert werden. Das von den Engadiner Kraftwerken (EKW) betriebene Dotierkraftwerk Pradella, Schweiz, liefert das Restwasser, das flussabwärts von Pradella in den Inn geleitet werden muss. Es sind zwei vertikale Kaplanturbinen mit einer Nennleistung von je 450 kW installiert. Die Nennfallhöhe beträgt 10,5 m und der Nenndurchfluss 5 m³/s für jede Turbine. In einem typischen Jahr beläuft sich die jährliche Stromproduktion der Anlage auf 2,9 GWh. Etaeval installierte vorübergehend ihre 8-pfadige akustische Durchflussmessung im Einlaufkanal (siehe Bild 4). Der Kanal hat eine Breite von 3,214 m und die mittlere Wassertiefe betrug 3,331 m an der Position der Mess-

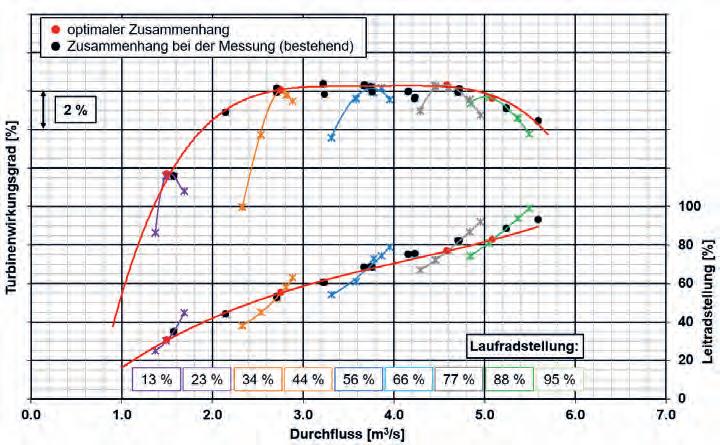
strecke. Die akustische Durchflussmessung besteht aus zwei gekreuzten Ebenen, mit acht akustischen Pfaden auf vier Höhen. Die gekreuzte Anordnung war notwendig, da sich stromaufwärts eine 90° Krümmung befindet. Der Messquerschnitt, die Sensorpositionen und die Winkel wurden für jeden Pfad einzeln mit einem Theodoliten vermessen. Die Wasserpegel im Kanal vor dem Rechen, am Eintritt zur Turbine, und nach dem Saugrohraustritt, dem Austritt der Turbine, wurden mit Ultraschallsensoren gemessen. Weitere Messeinrichtungen wie Leistungsmessung, Druckaufnehmer und Stellungsmessungen wurden im Turbinengebäude installiert. Zusätzlich zu den Garantiemessungen für den Turbinenwirkungsgrad wurde auch der Zusammenhang der Kaplanturbinen untersucht. Es wurden mehrere Propellerkurven über den gesamten Betriebsbereich gemessen (siehe Bild 5). Eine einzelne Propellerkurve ergibt sich aus Messpunkten mit konstanter Laufradposition und variierenden Leitschaufelpositionen. In einem nächsten Schritt wird eine Hüllkurve des Wirkungsgrades an die verschiedenen Propellerkurven angepasst. Die Hüllkurve berührt die Propellerkurven tangential. Die Hüllkurve charakterisiert die optimalen Turbinenwirkungsgrade bei einer bestimmten Fallhöhe und für verschiedene Leistungen.
Die Ergebnisse zeigten, dass beide Maschinengruppen nahe an der Hüllkurve für die optimalen Zusammenhänge arbeiten. Geringfügige Korrekturen des Zusammenhangs wurden in die Turbinenregler implementiert. Dieses positive Ergebnis ermöglichte dem Betreiber den Abschluss der Inbetriebnahme und die Bestätigung des vom Turbinenregler ermittelten Durchflusses durch die absolute Durchflussmessung von etaeval.
Als Beispiel einer relativen Wirkungsgradmessung, oder eben Indexwirkungsgradmessung, werden die Zusammenhangsmessungen im KW Rüchlig, Schweiz, der Axpo gezeigt. Die Niederdruckanlage hat 4 Maschinengruppen mit je einer Nennleistung von 2,4 MW. Die Nennfallhöhe beträgt 3 m und der Nenndurchfluss 90 m³/s für jede Turbine. In einem typischen Jahr beläuft sich die jährliche Stromproduktion der Anlage auf 54 GWh. Bei allen vier Maschinengruppen wurden Zusammenhangsmessungen durchgeführt. Bei einer Niederdruckanlage reicht es nicht, eine Maschinengruppe zu messen, und dann auf alle anderen zu schließen. Jede Maschinengruppe hat andere Zuströmverhältnisse und damit auch andere optimale Zusammenhänge von Leit- und Laufradstellungen. Bei solchen Zu-

sammenhangsmessungen sind die Differenzdruckmessungen entscheidend (siehe Bild 6). Solche Differenzdruckmessungen sind sensibel gegenüber Verstopfungen und Lufteintritte. Verstopfungen werden durch regelmässiges Spülen reduziert. Zu Beginn der Messkampagne erfolgt dies sogar mit Hydraulikpumpen in die Gegenrichtung. Lufteintritte werden durch den Einsatz von permanenten Entlüftungsbehältern eliminiert. Ist eine Betriebsmessung (Differenzdruckaufnehmer) bereits vorhanden, führt etaeval die Referenz-Differenzdruckmessung parallel durch und kann so die Betriebsmessung kontrollieren / abgleichen.
DURCHDACHTE MESSKAMPAGNEN
In Bild 7 ist ein Beispiel eines Resultats der Messkampagne in dieser Anlage dargestellt. Aufgetragen ist der Index-Turbinenwirkungsgrad in Funktion des Index-Volumenstroms. Auf der Sekundärachse sind die Leitradstellungen angegeben. Die für die jeweiligen Propellerkurven konstant gehaltenen Laufradstellungen sind als Zahlenwerte ebenfalls integriert. Es werden 6 bis 8 Propellerkurven über den gesamten Betriebsbereich aufgenommen. Mit den schwarzen Punkten im Diagramm sind die resultierenden IndexTurbinenwirkungsgrade ersichtlich, welche beim aktuell eingestellten Zusammenhang resultieren. Bis zum Zeitpunkt der Messungen wurde demnach die Turbine auf dem relativen Wirkungsgradniveau der schwarzen Ausgleichskurve betrieben. Mit der roten Ausgleichskurve ist das mögliche, optimale Wirkungsgradniveau aufgetragen. Als Schlussfolgerung muss somit bei einer gewissen Laufradstellung, das Leitrad mehr geöffnet werden, um im optimalen Turbinenwirkungsgrad zu produzieren. Mit der im Diagramm aufgeführten Skalierung von 5 Prozent zwischen zwei Hauptstrichen wird klar, dass in dieser Anlage ein beträchtliches Optimierungspotential vorhanden war. Durch eine einfach umzusetzende Anpassung – also von im Turbinenregler hinterlegten Tabellenwerten – kann dieses Potential genutzt werden.
MESSUNGEN MACHEN SICH BEZAHLT
Nach der Durchführung der Messungen und der Implementierung der Optimierungen, hat etaeval den Effekt der Messkampagne weiter untersucht. Zur Analyse des Effekts der Messkampagne wurden Leitsystemwerte herangezogen. Jedes hydrologische Jahr in einer Niederdruckanlage sieht anders aus. Deshalb ist es wichtig, die Messdaten über einen längeren Zeitraum zu betrachten. In Bild 8 ist die Auswertung des Index-Anlagenwirkungsgrades in Funktion des Index-Durchflusses dargestellt. In blau sind die Anlagenwirkungs-
grade bis zum Zeitpunkt der Optimierung markiert. Mit den orangen Punkten sieht man die Index-Anlagenwirkungsgrade nach der Optimierung. Es resultieren also mit den neuen Zusammenhängen deutlich höhere Anlagenwirkungsgrade als vor der Optimierung der Zusammenhänge. Was bedeutet ein höherer Anlagenwirkungsgrad? Wenn man beispielsweise die Anlage immer bei 250 m³/s und gleicher Fallhöhe betreiben würde, könnte die Produktion bei diesem Betriebspunkt um 4,2 Prozent erhöht werden. Das Kraftwerk wird über das Jahr bei unterschiedlichen Volumenströmen und Fallhöhen betrieben, dies ist durch das hydrologische Jahr gegeben. In dieser Niederdruckanlage ist die Verteilung übers Jahr relativ ausgeglichen, so dass man sich für eine einfache Analyse mit dem Mittelwert begnügen kann. Demnach hat etaeval durch die Optimierungen mittels der Messkampagnen im Mittel eine Produktionserhöhung von 3,5 Prozent erreicht.
SCHLUSSWORT
Durchflussmessungen in Niederdruckanlagen sind anspruchsvoll. Geeignete Messmethoden sind allerdings vorhanden. Wie in der Wasserkraft üblich, sind auch Niederdruckanlagen immer Prototyp-Anlagen. Bei jeder Anlage sind die Randbedingungen wieder etwas anders als bei einer anderen, es gibt andere Bedingungen für den Zulauf, andere Möglichkeiten für die Messung usw. Etaeval steht aufgrund seiner Erfahrung gerne für eine unverbindliche und unabhängige Beratung zur Verfügung, um für Ihre individuelle Niederdruckanlage die optimale Messmethode zu evaluieren.


Ihr unabhängiger Partner für Durchfluss- und Wirkungsgradmessungen in Wasserkraftanlagen


erfahren Sie mehr unter etaeval.ch


Durchflussmessung von einer Behelfsbrücke aus mit aufgelegtem Maßband

Die mobile Durchflussmessung unterstützt Kraftwerksbetreiber auf vielfältige Weise – sei es klassisch bei der Ermittlung des Wirkungsgrades am Kraftwerk oder durch die Kalibrierung der Fischwanderhilfe bzw. der Restwasserabgabe. Die gemessene Geschwindigkeitsverteilung liefert wertvolle Informationen über die Anströmung der Turbine und hilft oft, deren Leistung deutlich zu erhöhen. Durch das Beratungsprogramm Kleinwasserkraft des Klima- und Energiefonds werden Machbarkeitsstudien zur Revitalisierung mit bis zu 3.000 € unterstützt. Das Ingenieurbüro Lashofer bietet Dienstleistungen rund um die Wasserkraft seit 2014 in Österreich und Bayern an und ist seit 2019 als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger tätig.
Für den Bereich der Kleinwasserkraft mit Messungen zwischen 10 und 10.000 l/s eignen sich stangengebundene mobile Geräte, die rasch und kostengünstig sehr präzise Messungen ermöglichen. Je nach lokalen Gegebenheiten kommen dabei klassische Messflügel, elektronische MID-Geräte sowie moderne Ultraschall-Profiler zum Einsatz. Obwohl die zugrunde liegenden physikalischen Messungen unterschiedlich sind, basiert jede Methode auf derselben physikalischen Ausgangsgröße: Zunächst werden Fließgeschwindigkeiten (v) ermittelt und dann über den Fließquerschnitt (A) integriert, um den Durchfluss (Q) zu berechnen [Q = v x A]. Die Fließgeschwindigkeit kann 1) punktuell oder 2) in einem vertikalen Profilschnitt (Sektion) in vielen Punkten zeitgleich erfasst werden. Zweiteres Prinzip ergibt, insbesondere bei Fließtiefen ab 1 m, eine deutlich höhere Auflösung, also ein genaueres Bild der Verteilung der Geschwindigkeiten über den Fließ- bzw. Messquerschnitt.
MESSUNGEN IM WANDEL DER ZEIT
Bereits seit dem späten 18. Jahrhundert werden punktuelle Fließgeschwindigkeiten mit dem hydrometrischen Flügel gemessen. Die
Messung funktioniert mechanisch nach dem Prinzip eines Turbinenlaufrads, das sich mit dem strömenden Wasser dreht. Seit den 1950er Jahren wird auch der magnetisch-induktive Durchflussmesser (MID) eingesetzt. Die MID-Messung hingegen ähnelt einem Generator, bei dem die durch das vorbeifließende Wasser im Messmagnetfeld induzierte Spannung gemessen wird. Beide Methoden sind heute mit digitaler Auswertung ausgestattet und liefern schnell Messwerte. Seit den frühen 1960er Jahren wird auch Ultraschall
als Clamp-On-System für vollgefüllte Rohre zur Durchflussmessung eingesetzt. Diese Methode nutzt Wasser-Ultraschallwellen, ähnlich der Positionsbestimmung an Schützen oder der Wasserspiegelmessung mit LuftUltraschall.
GAMECHANGER MIKROPROZESSOR
Erst das in den späten 1990er Jahren umgesetzte Ultraschall-Kreuzkorrelationsmessprinzip ermöglichte auch eine mobile Messung in offenen Gerinnen. Dabei werden die komple-

Der Messflügel im Einsatz bei der Kalibrierung einer Fischwanderhilfe

xen Echomuster der im Wasser enthaltenen Streuer (Partikel, Mineralien oder Gaseinschlüsse) von Mikroprozessoren interpretiert. Der große Vorteil dieser Technik liegt darin, dass ein vertikales Fließprofil in bis zu 16 Fließhöhenschichten (sogenannte Fließgates) gleichzeitig erfasst wird, ohne dass jeder Punkt einzeln angefahren werden muss. Durch Hunderte von Einzelmessungen entsteht ein detailliertes Bild der Strömungsverteilung im Querschnitt. Eine im Sensor integrierte Druckmesszelle sorgt für die zuverlässige Tiefenmessung, die zur Ermittlung des Sohlverlaufs und in Folge zur Erstellung des Messquerschnitts in Echtzeit genutzt wird.
PRAXISEINSATZ
Das Ingenieurbüro Lashofer setzt sowohl den klassischen Messflügel Ott C31 als auch den erweiterten Ultraschall-Profiler NivuFlow Stick für Messungen ein. Beide Geräte haben ihr Einsatzoptimum, weshalb auf keines verzichtet werden kann. Warum? Das lässt sich gut anhand des typischen Messablaufs im Freiland erläutern. Für eine aussagekräftige Messung muss zunächst ein geeigneter Messquerschnitt gefunden werden, um Fehlerquellen zu minimieren. Idealerweise sollte der gewählte Querschnitt:
- eine möglichst gleichmäßige Strömung aufweisen,
- keine Bypassmöglichkeiten (Schotter, Spülkanal) bieten,
- nicht durch Bewuchs oder Einbauten beeinträchtigt sein.
- einen sicheren Zu- und Ausstieg haben, der auch nach einem unfreiwilligen Bad bewältigt werden kann.
MESSLOTRECHTE UND MESSNETZ-EINTEILUNG
Jede Messung unterteilt sich in viele sogenannte Messlotrechten. Diese gedachten ver-
Die Messung erfolgt in Messlotrechten. Diese Vertikalschnitte zeigen eine Strömungsgeschwindigkeitskurve für einzelne Sektoren.

tikalen Linien bestehen aus mehreren Geschwindigkeitsmessungen in verschiedenen Tiefen, wobei sich idealerweise ein gleichmäßiger Verlauf der Strömungsgeschwindigkei-
ten ergibt. Die ÖNORM EN ISO 748 definiert dabei Messtiefen für Verfahren mit reduzierter Messpunktzahl (1, 2, 3, 5 oder 6 Punkte).
Der Ultraschall-Profiler NivuFlow Stick gibt nach Messende direkt das PDF-Messprotokoll aus.



Direkter Vergleich von Flügelmessung zu hochaufgelöster Profilermessung im selben Messquerschnitt
Es gibt zwei gängige Messmethoden: 1.) Messung im Gewässer: Hier kann je nach Fließgeschwindigkeit bis ca. 1,4 m Tiefe gemessen werden (oberes Ende der Wathose). 2.) Messung von einer Brücke oder Brückenkonstruktion: Hier genügt bereits ein stabiler Holzpfosten um eine exakte Messung zu ermöglichen. Messungen sind bis zu einer Fließtiefe von 4 m möglich. Eine Herausforderung besteht in der exakten Positionierung der Messlotrechten entlang des Messquerschnitts. Auf Brücken können Maßbänder befestigt werden, oder bei der Messung im Gewässer kann ein langes Maßband von Ufer zu Ufer gespannt werden.

Die Messkoffer für Messflügel und Ultraschall-Profiler mit umfangreichem Zubehör

ANWENDUNGSBEISPIELE
-) Quellschüttungsmessung: Bei kleinen, klaren Rinnsalen mit hohen Turbulenzen und Querströmungen und wenigen Streuern im Wasser ist der Ultraschall-Profiler ungeeignet, während der Messflügel über Mittelwertbildung dennoch brauchbare Werte liefert.
-) Niederdruck-Turbinenzulauf: In tiefen Rechteckgerinnen wäre eine Messung mit dem Flügel extrem aufwendig. Der Ultraschall-Profiler kann hier innerhalb von ca. 15 Minuten ein vollständiges Geschwindigkeitsprofil liefern um zu sehen, wie (un-)gleichmäßig der Leitapparat angeströmt wird.
-) Große Stauräume oder Niederwassersituationen: Falls dem Ultraschall-Profiler die Streuer fehlen, kann es sinnvoll sein, im Unterwasserkanal nach der „Belebung“ des Wassers durch die Turbinen zu messen. -) Fischwanderhilfen bzw. sehr ungleichmäßige Strömungsbereiche: Ohne ein entsprechend beruhigtes Fließprofil leidet die Genauigkeit bei jeder Messmethode. Der Messflügel hat den Vorteil, dass er durch Mikro-Turbulenzen oder leicht schräge Anströmung nicht beeinflusst wird. Hier kommt auch eine Eigenheit des Ultraschallsystems zum Tragen, das von der Sohle aus mit einer, je nach Sensor, um 35° oder 50° zur Horizontalen geneigten Messachse flussaufwärts misst. Dieser Umstand macht bei guten Messverhältnissen bzw. bei geringen Fließtiefen keinen Unterschied, mindert aber bei möglichen Sekundärströmungen oder ungleichmäßiger Querschnittsentwicklung die Aussagekraft der Messung, bzw. liefert erkennbare Abweichungen.
EFFIZIENTER ABLAUF
Aufgrund der schnellen Messung, der hohen Auflösung des Fließgeschwindigkeitsprofils, der Echtzeit-Auswertung am Handy und der sofortigen Visualisierung als PDF-Messprotokoll ist der NIVUS-Profiler die bevorzugte Wahl – immer, wenn es die Messbedingungen zulassen. Speziell mit dem vom Ingenieurbüro Lashofer im Haus maßgeschneiderten Messgestänge und der auf 4 m Wassertiefe erweiterten Sensorik, die in Zusammenarbeit mit Ing. Johannes Bugl (österr. Repräsentant der NIVUS GmbH) entwickelt wurde, ist der Messablauf äußerst effizient.
Eine sorgfältige Handhabung und regelmäßige Kalibrierung der Geräte sollten für jeden Anwender selbstverständlich sein. Als Gutachter und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger ließ das Ingenieurbüro Lashofer den adaptierten Profiler zu Beginn des Einsatzes 2022 vom Institut für Wasserbau und Hydrometrische Prüfung in Wien, einem Teil des Bundesamtes für Wasserwirtschaft (BAW), überprüfen. Die Ergebnisse waren hervorragend – mit mittleren Abweichungen von lediglich 1 Prozent vom Referenzwert.




Gemeinsam die Zukunft der Kleinwasserkraft gestalten. Das ist unser Anspruch. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und fundiertem Know-how steht Voith an Ihrer Seite, um das umfangreiche Potenzial der Kleinwasserkraft sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch optimal zu nutzen.
Flexibilität bei individuellen Kundenwünschen, Qualität, termingerechte Lieferung und Serviceleistungen über
die gesamte Lebensdauer von Wasserkraftwerken haben bei Voith oberste Priorität.
Tauchen Sie ein in die Voith Welt der Kleinwasserkraft und gestalten Sie durch Ihr Projekt gemeinsam mit uns die nachhaltige Energielandschaft von morgen.