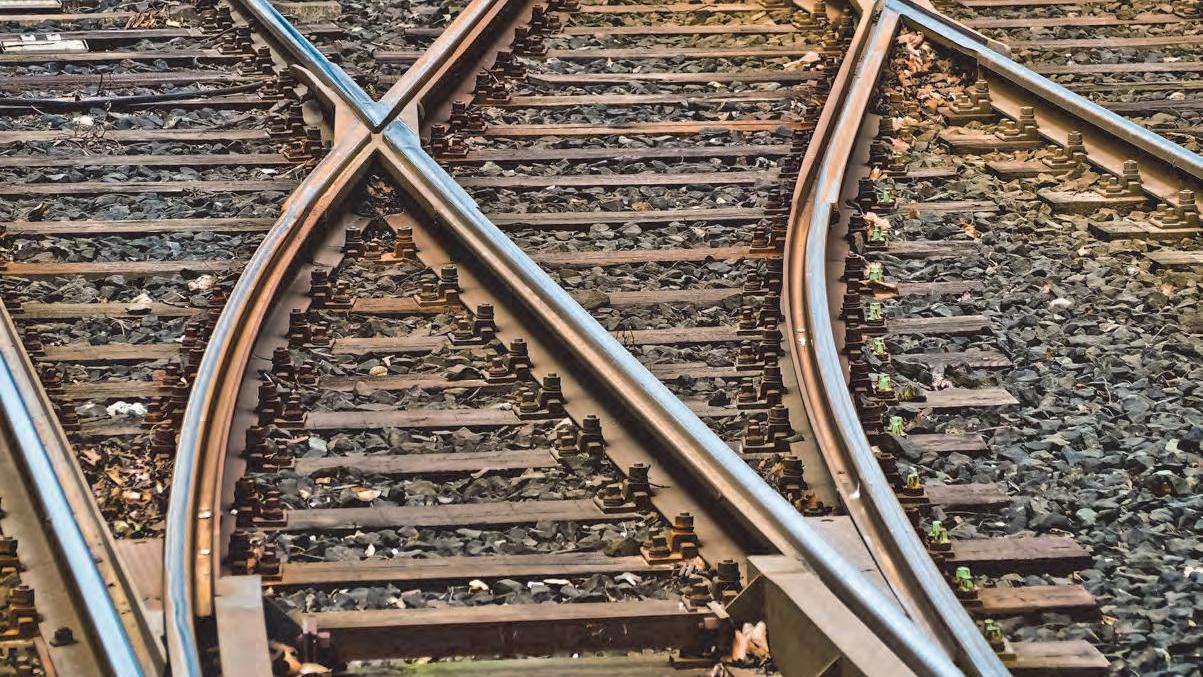
11 minute read
Stahlkartelle
KARTELLE: ERST SCHIENENFREUNDE, JETZT FLACHSTAHLFREUNDE
eder Schie e freu d ist ei Bah freu d ag sei – aber ur s a ge er ei e berh hte Preise f rdert! 2011 STELLTE DIE DEUTSCHE STAATSANWALTSCHAFT FEST, DASS ZEHN DER WICHTIGSTEN EISENBAHNHERSTELLER JAHRELANG SCHIENEN ZU ÜBERHÖHTEN PREISEN VERKAUFT HATTEN. DAS ILLEGALE KARTELL OPERIERTE UNTER DEM KRYPTONYM „SCHIENENFREUNDE“. DOCH ES WAREN NUR FREUNDE DES ERBEUTETEN GELDES.
Advertisement
Alleine 2006 soll die Deutsche Bahn aufgrund überhöhter Preise rund 100 Millionen Euro zu viel für Schienen bezahlt haben, insgesamt wurde der Schaden auf etwa 300 Millionen Euro summiert — und die DB war ja nur einer der geschädigten Kunden. Zumindest von 2006 bis 2011, so stellten es Gerichte fest, wahrscheinlich aber wohl schon seit 1998 unterliefen 14 Stahlmanager mit selbstgegebenen Decknamen wie „Domina“ und „Hannibal Lecter“ den Wettbewerb. Direkte Selbstbereicherung fand
wohl nicht statt, doch die Herren pflegten einen ausschweifenden Lebensstil. Klandestine Zusammenkünfte fanden in der Duisburger Pizzeria „Da Bruno“ statt, die durch Mafia-Schießereien bekannt wurde, aber auch in dem Berliner Etablissement „Bel Ami“. Alleine die Manager eines der Geheimbündler reichten bei ihrem Unternehmen Spesenrechnungen für Champagner zum Flaschenpreis von 250 Euro ein, die sich mit weiteren Dienstleistungen auf über 100.000 Euro summierten und zunächst offenbar durchgewunken wurden. Der Deal kam ans Licht, als der indische Konzern Arcelor-Mittal 2008 den Stahlhersteller Huta Katowice kaufte und Schienen anbot, die bis zu 35 Prozent billiger waren als die von Thyssen-Krupp, Voest Alpine und Kollegen. Das Bundeskartellamt verhängte in einem Verfahren über vier deutsche Unternehmen Bußgelder von über 124 Millionen Euro, die Unternehmen mussten den entstandenen Schaden ersetzen. Doch die Buße hielt wohl nicht lange. Das Bundeskartellamt verhängte im Dezember 2019 gegen vier Flachstahlhersteller wegen Preisabsprachen bei Quartoblechen in Deutschland Bußgelder in Höhe von insgesamt 646 Millionen Euro. Darüber informierte den bahn manager die auf private Kartellschadensregulierung spezialisierte Anwaltskanzlei Hausfeld (Berlin/Düsseldorf). Offenbar fiel dieses Mal auch eine Tochter von Arcelor-Mittal negativ auf — das Stahlmetier scheint zu verlockend zu sein, um stets eine strahlend weiße Weste zu tragen. Die Höhe der Bußgelder, so Hausfeld, lässt auf erhebliche Volumina der betroffenen Quartobleche schließen. Außerdem habe das Bundeskartellamt im Juli 2018 und im Januar 2019 gegen sieben Edelstahlhersteller, zwei Verbände und mehrere Einzelpersonen Geldbußen in Höhe von insgesamt etwa 290 Millionen Euro wegen Preisabsprachen und des Austausches wettbewerblich sensibler Informationen verhängt. Gegen weitere Unternehmen dauern die Ermittlungen an. Die Edelstahlhersteller hatten von mindestens 2004 bis längstens November 2015 Kartellabsprachen zu StahlLangerzeugnissen der Produktgruppen Edelbaustahl, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie RSH-Stahl getroffen. Laut einer Studie führender Wirtschaftswissenschaftler im Auftrag der Europäischen Kommission („Oxera-Studie“) liegt die durchschnittliche kartellbedingte Preisüberhöhung bei ungefähr 18 bis 20 Prozent des Kartellpreises. Diese kartellbedingte Preisüberhöhung kann den Marktpreis auch solcher Anbieter verfälschen, die selbst nicht Teil des Kartells waren — für versierte Wirtschafts- und Anwaltskanzleien bieten sich viele Ansätze, um Mandanten zum Schadensersatz zu verhelfen. Denn die Feststellungen des Bundeskartellamts zu Kartellen sind für Zivilgerichte bindend und können von den Stahlherstellern nicht bestritten werden. Geschädigte Unternehmen müssen den ihnen entstandenen Schaden allerdings selbst ermitteln und nachweisen. Die Kanzlei Hausfeld rät möglicherweise betroffenen Unternehmen, sich ausführlich zu informieren und gegebenenfalls eine Zivilklage zu prüfen. Denn für die ältesten Vorkommnisse des Kartellzeitraums droht bald die Verjährung. (hfs)

– ANZEIGE –

VERBÄNDE LOBEN BERLINER ERKLÄRUNG DER EU-VERKEHRSMINISTER UND FORDERN MEHR
AM 21. SEPTEMBER 2020 HATTE BUNDESVERKEHRSMINISTER ANDREAS SCHEUER IM RAHMEN DER DEUTSCHEN EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT SEINE EU-KOLLEGEN ZU BERATUNGEN NACH BERLIN EINGELADEN (VIRTUELL WEGEN CORONA). DIE DABEI VERABSCHIEDETE „BERLINER ERKLÄRUNG“ FAND DAS LOB DER BAHNVERBÄNDE, DOCH DER DRUCK ZU KONKRETEN WEITEREN REGIERUNGSBESCHLÜSSEN LÄSST NICHT NACH.
Zum Abschluss der Pressekonferenz blitzte sein spitzbübisches Lächeln kurz auf, als Verkehrsminister Scheuer summierte: „Das war echt ein guter Schienengipfel mit auch Nachhaltigkeit!“ Die Erwartungen der Bahnbranche waren hoch, die Forderungen konkret. Die Idee, interministeriell die Förderung des Schienengüterverkehrs zu erklären, war 2016 aufgekommen. Damals verabschiedeten die Verkehrsminister der EU-Mitgliedstaaten, der Schweiz und Norwegens die Rotterdamer Ministererklärung über „Schienengüterverkehrskorridore zur Förderung des grenzüberschreitenden Schienengüterverkehrs“. Zwei Jahre später erneuerte unter der österreichischen Ratspräsidentschaft die Wiener Erklärung „Fortschritt bei der Förderung des Schienengüterverkehrs“ diese Festlegung. So war es für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Ehrensache, unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft seinerseits eine „Berliner Erklärung“ beschließen zu lassen. „In ihren Grünen Deal hat die Europäische Kommission den Güterverkehr als eine der obersten Prioritäten aufgenommen, da die Schiene einer der umweltfreundlichsten Verkehrsträger ist“ — mit dieser Feststellung geben die europäischen Verkehrsminister die Richtung vor. Ein wirksamer Lärmschutz sowie die Digitalisierung der Prozesse vor allem auch in der Infrastruktur leiste einen „wesentlichen Beitrag zur weiteren Verbesserung des Umweltvorteils des Schienengüterverkehrs“ und zur „effizienteren Nutzung“ der Investitionen. „Wir, die Verkehrsminister, wollen den grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr fördern und die Schienengüterverkehrskorridore weiter stärken“ — das ist im Weiteren ein Schlüsselsatz der Berliner Erklärung. Dazu gehöre die „Möglichkeit, Züge mit einer Länge von 740 Metern im Kernnetz zu betreiben“. Ein wenig verklausuliert wird ein abgestimmtes Vorgehen auf EU- und nationaler Ebene bei der „Förderung des Einbaus von ETCS-
Fahrzeugausrüstung“ angekündigt — „unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sowie der Notwendigkeit, die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Verkehrsträgern zu bewahren“. Will sagen, es wird wohl eine Bezuschussung geben, doch Details bleiben auszuarbeiten. Ähnlich sieht es beim von der Branche am sehnlichsten erwarteten Thema der Digitalen Automatischen Kupplung DAK aus. Hier heißt es, die Minister „betrachten die Umsetzung der digitalen automatischen Kupplung, der automatischen Zugvorbereitung und anderer digitaler Plattformen als eine der Hauptprioritäten und beabsichtigen, uns diesbezüglich bis 2022 auf eine gesamteuropäische Strategie zu einigen, die gemeinsame Normen sowie die Aufteilung etwaiger Lasten vorsieht“. Das ist erfreulich konkret und lässt hoffen, dass dann auch Beschlüsse zur Ko-Finanzierung dieses strategischen Schlüsselprojekts für einen leistungsfähigen Schienengüterverkehr folgen werden. Das deutsche Verkehrsministerium unterstreicht, dass es schon ganz im Geiste dieser Erklärung „ein Forschungsprojekt gestartet und mit 13 Millionen Euro gefördert“ habe, den „DAK-Demonstrator“. Dabei werden verschiedene Systeme in der Praxis getestet. Die Allianz pro Schiene und der bahnpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Matthias Gastel begrüßten die Festlegungen der „Berliner Erklärung“ zur DAK. Allianz-Geschäftsführer Dirk Flege: „Eine große Chance für den Schienengüterverkehr in ganz Europa“. MdB Gastel: „Den heutigen Ankündigungen der Verkehrsminister müssen jetzt zügig konkrete verkehrspolitische Maßnahmen folgen.“ Prinzipiell begrüßt wird auch die Vorstellung durch Minister Scheuer eines Konzepts „TEE 2.0 — Grenzüberschreitender Hochgeschwindigkeits- und Nachtverkehr auf der Schiene für den Klimaschutz“. Das Konzept wurde durch die Geschäftsstelle des Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr (GS-BSV) MdB Enak Ferlemann unter Beteiligung mehrerer Hochschulen und Verkehrsplanungs-Institute erarbeitet und sieht den Aufbau europaweiter harmonisierter Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen zu Tages- und Nachtzeiten vor. Dieses Konzept soll in den Deutschlandtakt des deutschen Bahnsystems integriert werden. Auch hier erwartet Dirk Flege von der Allianz pro Schiene weitergehende Schritte: „Fliegen muss deutlich teurer werden, damit Fern- und Nachtzüge durch Europa eine Chance haben.“ Wie Grünen-MdB Gastel fordert die Allianz pro Schiene eine Gleichbehandlung von internationalen Flügen und Bahnfahrten bei der Mehrwertsteuer. Gastel spricht auch die weiterhin vorhandene Subventionierung von Kerosin für den Flugverkehr an, die „fairen Wettbewerbsbedingungen“ für den Schienenverkehr entgegenstehe. Nach Meinung Gastels müsse sich Deutschland durch beschleunigten Schienenbau für grenzüberschreitende Zugverbindungen einsetzen: „Während die Schweiz den Ausbau der Gotthardachse für mehr Güterverkehr und schnelle Züge in diesem Jahr vollendet, dauern in Deutschland die Bauarbeiten an der Zulaufstrecke am Oberrhein noch über das Jahr 2035 hinaus. Die Verbindungen nach Polen fristen auch 30 Jahre nach Öffnung der Grenzen ein Schattendasein, so dass die Fahrzeiten unter dem Niveau liegen, das vor 80 Jahren erreicht wurde.“ Auch für konkrete europäische Zugrelationen dürfe eine staatliche Bezuschussung kein Tabu sein: „Während die Regierungen von Schweden und Dänemark aktuell die neuen Nachtzugverbindungen Stockholm — Hamburg und Malmö — Köln — Brüssel mit einer Anschubfinanzierung ins Rollen bringen, sitzt die Bundesregierung mit Andreas Scheuer im Bremserhaus und lehnt jede Unterstützung dieser wichtigen Verbindungen ab.“ Auch an anderen Fronten der Bahnpolitik äußern Verbände Forderungen. Die durch die Deutsche Bahn angekündigte Ausweitung des Angebots im Fernverkehr zur Gewährleistung von Corona-Schutzabständen in den Zügen, obwohl es weniger Nachfrage gibt, betrachtet das Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr mofair als einen „impliziten Verkehrsvertrag zwischen dem Bund und dem Staatsunternehmen Deutsche Bahn AG“. „Der Bund fordert angesichts der Pandemie, dass das Angebot ausgeweitet wird,“ sagte mofair-Präsident Christian Schreyer. „Das geht rechtlich sauber nur über eine Notvergabe der Leistungen an die DB Fernverkehr. Im Gegenzug müssen die Kosten transparent gemacht werden.“ Dass die DB Fernverkehr gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringt, sei spätestens jetzt nicht mehr zu bestreiten. Wie derzeit in Österreich praktiziert müsse sich die deutsche Bundesregierung aber legal verhalten. Schreyer: „Eine Notvergabe ist die einzige nach EU-Recht vorgesehene Möglichkeit, einem Eisenbahnverkehrsunternehmen Geld für gemeinwirtschaftlich notwendige Leistungen zukommen zu lassen. Mindestens gemäß ihrem bisherigen Marktanteil müssen auch die anderen Fernverkehrsanbieter auf der Schiene berücksichtigt werden.“
kehrsminister müssen jetzt zügig konkrete verkehrspolitische Maßnahmen folgen.“ Prinzipiell begrüßt wird auch die Vorstellung durch Minister Scheuer eines Konzepts „TEE 2.0 — Grenzüberschreitender Hochgeschwindigkeits- und Nachtverkehr auf der Schiene für den Klimaschutz“. Das Konzept wurde durch die Geschäftsstelle des Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr (GS-BSV) MdB Enak Ferlemann unter Beteiligung mehrerer Hochschulen und Verkehrsplanungs-Institute erarbeitet und sieht den Aufbau europaweiter harmonisierter Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen zu Tages- und Nachtzeiten vor. Dieses Konzept soll in den Deutschlandtakt des deutschen Bahnsystems integriert werden. Auch hier erwartet Dirk Flege von der Allianz pro Schiene weitergehende Schritte: „Fliegen muss deutlich teurer werden, damit Fern- und Nachtzüge durch Europa eine Chance haben.“ Wie Grünen-MdB Gastel fordert die Allianz pro Schiene eine Gleichbehandlung von internationalen Flügen und Bahnfahrten bei der Mehrwertsteuer. Gastel spricht auch die weiterhin vorhandene Subventionierung von Kerosin für den Flugverkehr an, die „fairen Wettbewerbsbedingungen“ für den Schienenverkehr entgegenstehe. Nach Meinung Gastels müsse sich Deutschland durch beschleunigten Schienenbau für grenzüberschreitende Zugverbindungen einsetzen: „Während die Schweiz den Ausbau der Gotthardachse für mehr Güterverkehr und schnelle Züge in diesem Jahr vollendet, dauern in Deutschland die Bauarbeiten an der Zulaufstrecke am Oberrhein noch über das Jahr 2035 hinaus. Die Verbindungen nach Polen fristen auch 30 Jahre nach Öffnung der Grenzen ein Schattendasein, so dass die Fahrzeiten unter dem Niveau liegen, das vor 80 Jahren erreicht wurde.“ Auch für konkrete europäische Zugrelationen dürfe eine staatliche Bezuschussung kein Tabu sein: „Während die Regierungen von Schweden und Dänemark aktuell die neuen Nachtzugverbindungen Stockholm — Hamburg und Malmö — Köln — Brüssel mit einer Anschubfinanzierung ins Rollen bringen, sitzt die Bundesregierung mit Andreas Scheuer im Bremserhaus und lehnt jede Unterstützung dieser wichtigen Verbindungen ab.“ Auch an anderen Fronten der Bahnpolitik äußern Verbände Forderungen. Die durch die Deutsche Bahn angekündigte Ausweitung des Angebots im Fernverkehr zur Gewährleistung von Corona-Schutzabständen in den Zügen, obwohl es weniger Nachfrage gibt, betrachtet das Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr mofair als einen „impliziten Verkehrsvertrag zwischen dem Bund und dem Staatsunternehmen Deutsche Bahn AG“. „Der Bund fordert angesichts der Pandemie, dass das Angebot ausgeweitet wird,“ sagte mofair-Präsident Christian Schreyer. „Das geht rechtlich sauber nur über eine Notvergabe der Leistungen an die DB Fernverkehr. Im Gegenzug müssen die Kosten transparent gemacht werden.“ Dass die DB Fernverkehr gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringt, sei spätestens jetzt nicht mehr zu bestreiten. Wie derzeit in Österreich praktiziert müsse sich die deutsche Bundesregierung aber legal verhalten. Schreyer: „Eine Notvergabe ist die einzige nach EU-Recht

vorgesehene Möglichkeit, einem Eisenbahnverkehrsunternehmen Geld für gemeinwirtschaftlich notwendige Leistungen zukommen zu lassen. Mindestens gemäß ihrem bisherigen Marktanteil müssen auch die anderen Fernverkehrsanbieter auf der Schiene berücksichtigt werden.“ Kritisch sieht mofair auch andere Formen öffentlicher Stützung der DB: „Eine Eigenkapitalaufstockung zum Ausgleich von Unternehmensverlusten, die aufgrund der Übernahme von Leistungen, die ohne Gewinnaussicht im öffentlichen Interesse erbracht werden, ist grundsätzlich der falsche Weg. Daher kann die EU-Kommission einer Eigenkapitalerhöhung für diesen Zweck nicht zustimmen. Die Bundesregierung weiß dieses und hat daher bislang den Antrag zur Notifizierung dieser staatlichen Beihilfe noch nicht einmal gestellt, weil sie wettbewerbsschützende Auflagen fürchtet.“ Im Gegensatz dazu hält dies die Allianz pro Schiene für „notwendig und richtig, um die massiven CoronaSchäden auszugleichen“. Allerdings bemängelt das Verkehrsbündnis, dass diese Kompensation nicht an alle Unternehmen der Branche geht. Denn auch die Wettbewerbsbahnen ständen durch den massiven ökonomischen Einbruch schwer unter Druck. Geschäftsführer Flege: „Eine weitere Trassenpreissenkung bleibt angesichts der schwerwiegenden Corona-Lasten auf der Tagesordnung. Sie käme dem gesamten Schienensektor zugute. Das ist gerade in diesen schweren Zeiten überfällig.“ Lob erhielt zugleich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags für Korrekturen an der Regierungsvorlage des Bundeshaushalts. Zu den hilfreichen Korrekturen des Regierungsentwurfs durch die Abgeordneten zählt die Schienenallianz eine zusätzliche Ermäßigung der Anlagenpreise in Rangierbahnhöfen. Diese Förderung wurde von 40 Millionen auf 80 Millionen Euro aufgestockt. „Ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um den Schienengüterverkehr in der Konkurrenz mit besonders klimaschädlichen Verkehrsträgern zu stärken“, betonte Flege. Dazu passe auch die Reduzierung der umweltpolitisch äußerst fragwürdigen staatlichen Subvention für Gas-Lkw. Hier hat der Haushaltsausschuss die Streichung der Kaufprämien durchgesetzt. „Aus der Dreifach-Subventionierung durch Kaufprämien, Energiesteuer-Nachlass und Maut-Begünstigungen wird eine Zweifach-Subventionierung“, so Flege. „Immerhin ein erster Schritt hin zu mehr Vernunft bei den staatlichen Verkehrssubventionen.“
Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, Obmann im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, pocht auf eine weitere Absenkung der Trassenzugangskosten: „Anstatt allein der Deutschen Bahn AG mit Milliarden-Subventionen zu helfen, sollten diese Mittel für eine befristete Senkung der Trassenpreise eingesetzt werden. Eine solche wettbewerbsneutrale Unterstützung des Schienenverkehrs für alle Eisenbahnunternehmen wäre nicht nur gerechter, sie ließe sich vor allem viel schneller umsetzen. Denn bis heute ist vollkommen unklar, ob und wann die Europäische Kommission die Beihilfe für die Deutsche Bahn AG genehmigt.“ Nicht zuletzt könne durch eine Trassenpreissenkung auch vermieden werden, dass mit dem Geld Finanzlöcher der DB AG gestopft werden, die bereits lange vor Beginn der Corona-Pandemie existierten. Corona-Hilfen auf gleichem Niveau wie für den bundeseigenen Mitbewerber DB Cargo fordert von der deutschen Bundesregierung das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE). NEE-Vorstandsvorsitzender Ludolf Kerkeling: „Wir liefern — auch in der Krise. Dafür erwarten wir mehr als warme Worte von der Politik und eine deutlich stärkere Kundenorientierung unseres wichtigsten Dienstleisters, der DB Netz AG.“ Mit einem stetig wachsenden Marktanteil von mittlerweile deutlich mehr als 50 Prozent „halten wir es für überfällig, dass die nicht zur DB gehörenden Eisenbahnverkehrsunternehmen (…) im Aufsichtsrat vor allem der DB Netz AG eine Vertretung erhalten.“ argumentierte der Verband bereits im Dezember 2018 in einem Schreiben unter anderem an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der DB Netz AG, Ronald Pofalla, das aber unbeantwortet blieb. Jetzt wiederholt das Netzwerk — es will in den Aufsichtsrat des deutschen Infrastrukturbetreibers.
HERMANN F. SCHMIDTENDORF
Chefredakteur beim Hanse-Medien Verlag.










