
7 minute read
Menschenrecht …
Die Freiheitsrechte
• Die Freiheitsrechte der Menschenrechte begrenzen den staatlichen Einfluss auf bestimmte Bereiche des menschlichen Lebens (Abwehrrechte) und ermöglichen jeder Person gesellschaftliche Teilhabe (Mitwirkungsrechte). Die wichtigsten Freiheitsrechte sind: Diskriminierungsverbot, Recht auf Leben, Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung, Verbot der Sklaverei, Gedankenund Religionsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Vereinigungs und Versammlungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre und des Familienlebens, Recht auf ein faires Gerichtsverfahren.
Advertisement
• Im 18 Jh. entstanden die ersten umfassenden Menschenrechtserklärungen: die Virgina Bill of Rights von 1776 und die französische Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers von 1789. 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNO) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der u. a. die obengenannten Freiheitsrechte enthalten sind. In der Europäischen Menschenrechtskonvention (1951) sowie im Internationalen Pakt der UNO über bürgerliche und politische Rechte (1966) wurden diese Rechte international verbindlich.
AnMERKung: Die Freiheit der Anderen – Grenze und Bereicherung
»… SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT …« (GRUNDGESETZ, ART. 2)
Für aufgeklärte Menschen ist ohne Weiteres einsichtig, dass man jedem Mitglied der Gemeinschaft ebenso viel Freiheit zugestehen muss, wie man für sich selbst fordert. Jeder hat das Recht auf die gleiche Freiheit, und wo immer Freiheit eingeschränkt wird, muss dies um der größeren Freiheit aller willen geschehen. Dies bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Allgemeinheit. Individuelle Freiheit und kollektive Freiheit bedingen einander wechselseitig. Einer allein kann nicht frei sein. In einer Gemeinschaft von Unfreien ist auch der Einzelne nicht frei. Die Selbstbegrenzung der Freiheit aus Freiheit und um der Freiheit aller willen findet ihren Niederschlag in den Normen der Moral des Rechts, die in Form ungeschriebener oder geschriebener Gesetze menschliches Handeln an Regeln binden und damit die Gesamtheit möglicher Freiheiten im Hinblick auf den legitimen Freiheitsanspruch jedes Individuums einschränken.
Annemarie Pieper, Philosophin
Unver Usserlich
1. Identifizieren und erläutern Sie Freiheitsrechte im deutschen Grundgesetz.
2. Informieren Sie sich über Konzeption und Anliegen der Straße der Menschenrechte in Nürnberg (links). Machen Sie ggf. eigene Fotos.
3. Vergleichen Sie das Freiheitsverständnis A. Piepers mit der Plakatwand (unten).


4. Sammeln und diskutieren Sie Beispiele, bei denen die von A. Pieper beschriebene Begrenzung von Freiheit zu Konflikten führt.
DIE FREIHEIT, DIE SIE MEINEN
In einem Urteil vom 29. April 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz von 2019 nachbessern muss, um die Freiheit kommender Generationen zu schützen. Das Bundesverfassungsgericht hat ein »epochales« Urteil zum Klimaschutz gefällt. Dabei liegt der Entscheidung ein Freiheitsbegriff zu Grunde, der den politischen Diskurs* der kommenden Jahre massiv prägen dür fte. Dass das Bundesverfassungsgericht die aktuellen Klimaschutzziele im Endeffekt als, salopp gesagt, zu lasch und unkonkret aburteilte, begründete es nämlich wie folgt: Da Deutschland sich gemäß dem Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet hat, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, sind die Regelungen des aktuellen Klimaschutzgesetzes insofern nicht ausreichend, als dass sie »hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030« verschieben. Die nach 2030 erforderlichen Minderungen müssten »dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden«. Und da von diesen Maßnahmen »praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen« wäre, »weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden« sind, wären die »zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden« in der Zukunft »durch die angegriffenen
... AUCH IN ZUKUNFT
1. Interpretieren und diskutieren Sie die Karikatur. Entwerfen Sie ein Gespräch zwischen Eltern und Kind.
2. Informieren Sie sich über das Urteil des BVerfG und recherchieren Sie, wieweit es schon umgesetzt wurde.
3. Erläutern Sie den im Text beschriebenen Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Freiheit an Beispielen.
4. Auch Gegner und Gegnerinnen der Maßnahmen gegen Klimaschutz [10] berufen sich auf Freiheit und sprechen z. B. von einer »Klimadiktatur«. Verfassen Sie dazu ein Statement auf der Basis der Materialien dieser Doppelseite.
Bestimmungen [...] in ihren Freiheitsrechten verletzt.« Damit macht sich das Gericht einen Freiheitsbegriff zu eigen, den der Philosoph Claus Dierksmeier in seinem 2016 erschienenen Buch Qualitative Freiheit auf den Begriff gebracht hat. Dierksmeier differenziert zwischen quantitativer und qualitativer Freiheit. Ein quantitatives Freiheitsverständnis zielt vor allem auf die Erhöhung subjektiver Präferenzen sowie die Minderung persönlicher Einschränkungen ab. Liegt diesem die Maßgabe »je mehr, desto besser« zugrunde, geht es also, zugespitzt gesagt, darum, dass der Einzelne möglichst das machen kann, was er möchte. Im Extremfall wäre das jener AuspuffLiberalismus, der sich im Wesentlichen in einer »freie Fahrt für freie Bürger«Ethik erschöpft. Ein qualitativer Freiheitsbegriff folgt hingegen dem umgekehrten Motto: »je besser, desto mehr«. Bei ihm geht es also nicht »nur« um die Erhöhung individueller Wahlmöglichkeiten, sondern vor allem auch um die wechselseitige Verbesserung von Lebenschancen. Hat die qualitative Freiheit also immer ein Abwägen von Freiheiten zum Ziel, um Letztere nicht nur einigen wenigen, sondern möglichst vielen zukommen zu lassen, so ist das genau jener Geist, den auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts atmet. Schließlich forderten die Karlsruher Richterinnen und Richter – de facto – ein höheres Maß an Klimaschutzregelungen ein, die den Einzelnen zwar womöglich punktuell einschränken können, die Freiheit vieler anderer – insbesondere künftiger Generationen – aber überhaupt erst ermöglicht. Oder umgekehrt formuliert: Wo ökologische Zerstörung herrscht, können die allermeisten Menschen nicht frei sein. Nils Marquardt
»DER SINN VON POLITIK IST FREIHEIT«
Arendts Vision hatte den unschätzbaren Vorzug, dass sie in Athen, »in der Frühzeit der abendländischen Geschichte«, schon einmal verwirklicht worden war. Gemeint ist die Polis*, die Gemeinschaft der Bürger in den Stadtstaaten, die sich »unvergessen der europäischen Menschheit eingeprägt hat«.
Warum die Polis? Weil das sprachbegabte Tier hier zum ersten Mal mit seiner Freiheit experimentiert und das macht, was nur Menschen können: einen Anfang. Die »Sterblichen« erproben, was es bedeutet, sich in einer gemeinsamen Welt zu orientieren, einander etwas zu versprechen und kollektiv zu handeln. Während sich im Haushalt alles um das Notwendige dreht, um das ÜberL eben, geht es im »Erscheinungsraum« der Polis um das GutL eben. Es gibt hier weder Herrscher noch Beherrschte; obwohl von Natur aus verschieden, sind alle Bürger gleich. Jeder mutet dem anderen die eigene Perspektive zu; jeder erprobt im Hin und Her der Meinungen die »erweiterte Denkungsart«. In seltenen Augenblicken erfahren die Polisbürger das Glück der Öffentlichkeit und das Wunder der pluralen Freiheit. Während des VietnamKrieges* und nach der Veröffentlichung der PentagonPapiere* fällt Hannah Arendt »im Arsenal der menschlichen Torheiten« etwas Neues auf. Nervös beobachtet sie, dass die US Regierung Methoden aus der Werbung einsetzt, sie spricht von imaging, von Bildermachen, von »Totalfiktionen«. Der Begriff FakeNews* fehlt ihr zwar, aber genau das meint Arendt, wenn sie Politikern vorwirft, sie würden Tatsachenwahrheiten zu Meinungen umlügen. Nicht nur, dass sie damit Orientierungssinn und Urteilsfähigkeit der Bevölkerung »vernichteten«; sie schafften Scheinwelten, in die die Bürger hineingelockt und in denen sie über die Wahrheit getäuscht würden. In dem Maß wie sich die Regierung der öffentlichen Einflussnahme entzieht, laufen die PolisEnergien der Bürger ins Leere, werden ins Private abgedrängt, die Zersplitterung der Gesellschaft wächst. In der Folge davon beginnen die Bürger an Gespenster oder – wie man heute sagt – an Verschwörungsideologien zu glauben: »Ein merkliches Abnehmen des gesunden Menschenverstandes und ein merkliches Zunehmen von Aberglauben deuten darauf hin, dass die Gemeinsamkeit der Welt abbröckelt.«
Thomas Assheuer
»Freiheit und Gleichheit beginnen erst, wo die Lebensinteressen ihre Grenze haben und ihnen Genüge getan ist.
»Politisch zu sein, in einer Polis* zu leben, das hieß, dass alle Angelegenheiten vermittels der Worte, die überzeugen können, geregelt werden und nicht durch Zwang und Gewalt.
»Der irdische Raumvorrat ist aufgebraucht […]. Von der Freiheit der Menschen, von ihrer Fähigkeit, Unheil zu wenden, mag diesmal mehr abhängen als je zuvor, nämlich die Fortexistenz der Menschheit auf Erden.
FREIHEIT BEI HANNAH ARENDT
• Ein zentrales Thema im Lebenswerk von Hannah Arendt ist die Freiheit. Nach dem Vorbild der von ihr bewusst idealisierten antiken Polis* beschreibt sie Freiheit als politische Freiheit, die Welt in einer Gemeinschaft gleichberechtigter Personen denkend und handelnd mitzugestalten. Diese ist aber erst möglich auf der Basis der Befreiung von Zwang, sei es von staatlicher Willkür, von Sorge um das tägliche Überleben oder vom Beherrschtwerden durch Arbeit und Konsum. Diese Befreiung nennt sie »negative« bzw. »bürgerliche« Freiheit.
• Sosehr Freiheit für H. Arendt im Handeln besteht, so wichtig ist es ihr, die Grenzen des Handelns zu berücksichtigen, z. B. die Unantastbarkeit eines Gegenübers, die Anerkennung von Fakten oder die Eingebundenheit in die Natur.
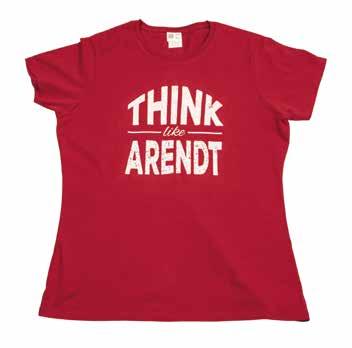
Negative Und Positive Freiheit

Diese begriffliche Unterscheidung findet sich in einem außerordentlich einflussreichen Aufsatz von Isajah Berlin aus dem Jahre 1958, doch ist die Idee einer solchen Freiheit schon sehr viel älter. Mit negativer Freiheit bezeichnet Berlin solche Freiheitskonzeptionen, die Freiheit wesentlich als die Abwesenheit von Hindernissen und Beschränkungen begreifen, wie sie etwa vorliegen in den klassischen liberalen Ansätzen von Hobbes*, Locke* oder Mill*. Auch in zeitgenössischen Freiheitstheorien begegnen wir rein negativen Konzeptionen, wie etwa bei Hayek*, wenn er schreibt, Freiheit sei jener »Zustand der Menschen, in dem Zwang auf einige von seiten anderer Menschen so weit herabgemindert ist, als dies im Gesellschaftsleben möglich ist«.
Gegenüber einem solchen, rein formalen negativen Freiheitsbegriff als Abwesenheit von Zwang sehen Konzeptionen positiver Freiheit diese darin, bestimmte Optionen verfolgen zu können, bestimmte Fähigkeiten realisieren zu können bzw. ein selbstbestimmtes Leben führen zu können (klassisch etwa Rousseau*).
Positive Freiheit bedeutet folglich zunächst einmal, dass Personen die Kontrolle darüber haben, das machen zu können, was sie selbst als sinnvolle Option für sich begreifen, was Ausdruck ihres wesentlichen Selbst ist oder Ausdruck dessen, als welche Person sie sich verstehen wollen.
Nun hat jedoch Charles Taylor* gezeigt, dass sich beide Freiheitsbegriffe nicht gegenseitig auszuschließen brauchen: Wir können, so wendet er ein, über die Abwesenheit von Hindernissen nur reden – Welche sind wichtiger? Warum wollen wir gerade diese Einschränkungen nicht? –, wenn wir zugleich auch eine Vorstellung davon haben, was wir eigentlich mit der Freiheit wollen. Es ist also weder sinnvoll noch möglich, eine klare Grenze zwischen negativer und positiver Freiheit zu ziehen; negative Freiheit verweist immer auf positive und umgekehrt.
Wir schätzen also negative Freiheit, weil wir frei sein wollen, bestimmte Dinge zu tun, eine bestimmte Person zu sein, unser Leben auf unsere Weise leben zu wollen. Um dies erklären zu können, reicht ein negativer Begriff von Freiheit allein nicht aus. Beate Rössler, Philosophin
FREIHEIT VON … – FREIHEIT ZU …
1. Diese Doppelseite ist mit dem Titel eines Essays von H. Arendt überschrieben. Erläutern Sie ihn mithilfe der Texte auf S. 118.
2. »Think like Arendt« ( S. 118) – begründen und diskutieren Sie die Aktualität von H. Arendts Freiheitskonzeption.
3 Entwerfen Sie Möglichkeiten für Jugendliche, im Raum der Schule, aber auch darüber hinaus, im Sinne von H. Arendt ( S. 118) politisch zu handeln.
4. Beziehen Sie die von B. Rössler erläuterte Unterscheidung bzw. Verschränkung von negativer und positiver Freiheit auf H. Arendts Ansatz ( S. 118).
5. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie sich selbst frei gefühlt haben. Untersuchen Sie, inwieweit hier »negative« bzw. »positive« Freiheit eine Rolle gespielt haben.
MERKwürdig – über »Freiheit von« redet sich’s leichter.



