FAZITGESPRÄCH Bildung als Wert an sich
KFU-Rektor
Peter Riedler im Interview

FAZITGESPRÄCH Bildung als Wert an sich
KFU-Rektor
Peter Riedler im Interview
April 2025
FAZITESSAY
Christian Wabl über den amerikanischen Glauben an Gott und Gold
Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.

FAZITTHEMA SCHWERES ERBE

grawe.at/mymed
INKL.PHYSIO-THERAPIE, HEIL-MASSAGE, UVM.
Da Gesundheit das höchste Ziel ist, bezeichnen wir unsere Krankenversicherung als Gesundheitsversicherung. * Alljährlich werden in einer unabhängigen, österreichweiten Studie 8.000 Versicherungs- und Bankkund:innen zu ihrer Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft befragt. Auch 2024 wurde die GRAWE für ihre besondere Kundenorientierung ausgezeichnet. In der Kategorie „Versicherungen bundesweit“ belegen wir den 1. Platz – bereits zum 12. Mal in Folge! Mehr unter: grawe.at/meistempfohlen
Von Christian Klepej
Vor wenigen Tagen, am Josefitag 2025, hat der deutsche Bundestag eine weitreichende Grundgesetzänderung beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung im Bundesrat wird die »Schuldenbremse« außer Kraft treten und eine ungeheure Summe an Krediten die Bundesrepublik, Österreichs wichtigster Handelspartner, über unabsehbare Zeit in ein schwarzes Finanzloch stürzen. 500 Milliarden Euro sind dabei als »Sondervermögen« für infrastrukturelle Maßnahmen und »für Klimaschutz« geplant, der Rest auf die Billion – das soll die Gesamtmenge dieses Fiatgelds sein –, steht auf Abruf für Rüstungsausgaben bereit. Als wäre das alleine nicht an Irrwitz genug, wurde »der Klimaschutz« mit der Fixierung und Selbstverpflichtung der (»totalen«, hör ich mich mitdenken) »Klimaneutralität« Deutschlands bis zum Jahr 2045 eben auch ins Grundgesetz geschrieben. Josef Urschitz schreibt in der Presse trefflich davon, dass diese beiden Maßnahmen zum einen »praktisch das Ende der deutschen (und damit europäischen) Stabilitätspolitik« und zum anderen »möglicherweise das Ende
Es ist das Mittelmaß, das unsere Demokratie langsam aber sicher zerstört

der deutschen Industrie, wie wir sie kennen« bedeuten. Das alleine macht mich fassungslos. Dass Deutschland (und im Grunde die ganze EU) in unverantwortlicher Weise über Jahrzehnte die Landesverteidigung ausgedünnt und verkommen hat lassen, ist bekannt, dass aber auch eine so hohe Summe nur für die Rettung maroder Infrastruktur benötigt wird, ist nicht mehr nachvollziehbar. Wenn man nämlich bedenkt, dass Deutschland die letzten zehn Jahre immer wieder Rekordsteuereinahmen gemacht hat. Damit steht es nun schwarz auf weiß im Grundgesetz, dieses Land gibt sein Geld für die falschen Dinge aus. Nun kann die inhaltliche Beurteilung dieser Beschlüsse, vor allem, wenn man gerne das Geld anderer Leute ausgiebt, sicher auch anders aussehen. Endgültig an der Welt verzweifeln aber lässt mich der Umstand, wie diese Abstimmung zustande gekommen ist. Die notwendige Zweidrittelmehr ist im Bundestag für die (wahrscheinliche) Koalition aus Union und SPD nicht mehr vorhanden, also hat man einfach den »alten« Bundestag nocheinmal zusammenfinden lassen. Ich halte das für einen klassischen »Grödtaz«. Also für die größtmögliche demokratische Trickserei aller Zeiten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hatte Eilanträge vom linken wie rechten Rand gegen ein solches Vorgehen schon vor der Abstimmung abgewiesen. Trotzdem bin ich der Überzeugung, das kann nie und nimmer Intention des Gesetzesgebers gewesen sein. Am 23. Februar d. J. war die Wahl zum 21. Bundestag, es liegt ein amtlich bescheinigtes Ergebnis vor, das neugewählte Parlament könnte bereits lange konstituiert sein. Einfach den 20. Bundestag noch einmal einzuberufen, um mit alten Mehrheiten die Verfassung zu ändern, kann kein echter Demokrat gutheißen, ganz egal, ob er das Ansinnen dahinter teilt oder nicht. Die Spielregeln so zu dehnen, eine offensichtliche Lücke frevelhaft auszunützen, erscheint verantwortungslos. Und damit bin ich beim Kern des heutigen Pudels. Ich schreibe oft, ich kanns nicht mehr lesen, von der Spaltung unserer Gesellschaft, oft auch von der Politik- und damit einhergehend Demokratieverdrossenheit der Men-
schen. Und dann merken diese mediokren Gestalten, die wir europäischen Entitäten in unsere Parlamente entsenden, nicht einmal, wie sehr sie der Politik schaden, wenn sie Hirn und Herz unserer Demokratie – also den Parlamentarismus – so schänden.
Ich war immer großer Anhänger der Vertretungsdemokratie, allzuviele plebiszitäre Momente in den Geschicken eines Landes habe ich immer argwöhnisch betrachtet. Diese Vertretungsdemokratie bedingt Parteien. Aber diese Parteien haben vergessen, wo Politik anfängt und wo sie aufhört, in unseren Landtagen, in unseren Parlamenten. Und sie schaffen es nicht mehr, seit Jahr und Tag nicht mehr, qualifizierte, gut durchmischte Listen an Abgeordneten aufzustellen. Im Plenum »bedanken« sich Klubobleute regelmäßig kniefällig bei der Landesregierung und Nationalratsabgeordnete bei Ministern. Man bekommt den Eindruck, die wissen gar nicht, dass sie – in unser Namen, mit unseren Stimmen – Regierer und Minister beauftragen, für uns zu arbeiten. Das gilt für Deutschland wie für Österreich, für die Steiermark wie für Hessen. Und deswegen passieren solche Aberwitze wie diese Trickabstimmung im Bundestag. Unsere Demokratie ist nicht gefährdet, weil es ein paar extreme Linke oder Rechte gibt. Sie ist gefährdet, weil viel zu viele Einfaltspinsel in den Parlamenten sitzen. n
Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Gekündigter Generationenvertrag
Die kommende Generation Arbeitender sollte jene finanzieren, die nicht mehr arbeiten können. Doch damit ist jetzt Schluss.

Bildung als Wert an sich
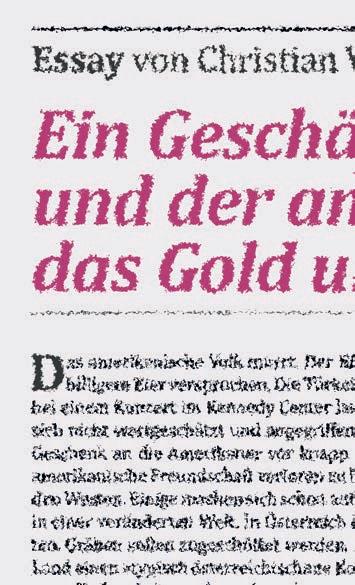
Die Uni Graz ist ein Supertanker im heimischen Wissenschaftsgefüge. Rektor Peter Riedler im Fazitgespräch. Renaissance des Christentums (3) Christian Wabl über den nach außen hin tiefgläubigen US-Präsidenten und seinen Vize, die gerade die Welt aus den Angeln heben.

Così fan tutte opert wieder
Unterhaltsames gibt es in der Grazer Oper. »So machen es alle (Frauen) oder Die Schule der Liebenden« fetzt dahin wie ein Springbock im Frühling.
Seite 80

Rubriken
Editorial 3
Politicks 16
Investor 32 Außenansicht 38
Oberdengler 46
Immobilien 68
Alles Kultur 78

Heide Pock-Springer ist »Putzmacherin« bzw. »Modistin«. Und betreibt als solche eines der letzten Hutgeschäfte des Landes.
Schluss 82

Tischlerei, deck dich!
»Erfolgsgeschichte« trifft bei Hans Jürgen Maurer den Nagel auf den Kopf. Seine Tischlerei in Köflach macht Millionenumsätze.
Im Fazitthema »Die letzte Generation« geht es um die Zukunft des Pensionssystems. Denn der Generationenvertrag, einst tragendes Fundament des Sozialstaats, steht vor dem Kollaps: Zu wenige Erwerbstätige finanzieren zu viele Pensionisten. Sinkende Geburtenraten und eine veränderte Arbeitsmoral verschärfen ein Riesenproblem. Migration bietet kaum Entlastung, Reformen bleiben aus. Das Umlagesystem scheitert gerade.
Mit ihren fast 29.000 Studierenden steht die Universität Graz vor großen Herausforderungen: Wie bleibt Forschung sichtbar, wenn Budgets schrumpfen? Wie begegnet man Wissenschaftsskepsis in Zeiten von KI und Digitalisierung? Wie schafft man als Allgemeinuniversität große wissenschaftliche Erfolge, die auch international wahrgenommen werden? Wir sprachen mit Rektor Peter Riedler über Österreichs zweitgrößte und zweitälteste Universität.
Erfolg durch Innovation zeigt auch der Köflacher Tischler Hans Jürgen Maurer, der aus bescheidenen Anfängen ein florierendes Unternehmen geschaffen hat. Und für beste Unterhaltung sorgt die Grazer Oper mit einer spritzigen Inszenierung von »Così fan tutte«. Gutes Lesen! -red-
IMPRESSUM
Herausgeber
Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl
Medieninhaber & Verleger
Klepej & Tandl OG
Chefredaktion
Christian Klepej Mag. Johannes Tandl
Redaktion
Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina
Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Kim Vas (Satz und Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)
Lektorat AdLiteram
Druck
Walstead-Leykam
Vertrieb & Anzeigenleitung
Horst Futterer
Kundenberatung
Irene Weber-Mzell
Redaktionsanschrift
Schmiedgasse 38/II, A-8010 Graz
Titelfoto von Erwin Scheriau
T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin
gibt es noch!

Von Johannes Roth
Der Sozialstaat und das Umverteilungssystem beruhen seit Jahrzehnten auf
einer einzigen Annahme: dass die kommende Generation Arbeitender jene finanziert, die nicht mehr arbeiten können. Das ist nun zu Ende.
Die Idee war an und für sich gut und ist – wie vieles, das uns sozialpolitisch heute Kopfzerbrechen bereitet – uralt. Aber natürlich konnte im 18. und 19. Jahrhundert, als der Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft, Alexis de Tocqueville, in Frankreich seinen berühmten » social contract « veröffentlichte, niemand ahnen, dass es einmal Nachkriegsjahre geben würde, die eine derartig disruptive Bewegung wie die 1968er auslösen könnten. Eine Bewegung, die plötzlich alles in Frage stellte, was Jahrhunderte Gültigkeit hatte und sich nicht scheute, gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen und neu zu schaffen, ohne über die langfristige Wirkung dieser als gerecht empfun-
denen Disruption nachdenken zu wollen. Tocqueville jedenfalls formulierte unter dem Eindruck der Französischen und Amerikanischen Revolution nicht nur einige bis heute aktuelle Perspektiven zu Freiheit, Revolution und Demokratie, sondern erstmals auch eine weitere damals bahnbrechende Idee: dass nämlich das Fortkommen einer Gesellschaft auf einem Vertrag der Generationen untereinander beruht. Die Idee brauchte allerdings bis Mitte der 1950er Jahre, um zu reifen. Ihre Wirkmacht zu entfalten begann sie, als in Deutschland das Konzept des »Solidarvertrags zwischen den Generationen« von Wilfried Schreiber erstmals beschrieben wurde.

Ich finde es wirklich schlimm, dass sich auch diese Regierung wieder nicht traut, das gesetzliche Pensionsalter langfristig hinaufzusetzen.
Fiskalratschef Christoph Badelt
Der Generationenvertrag
Die Grundidee basiert auf der Erkenntnis, dass das durch Erwerbstätigkeit erzielte Arbeitseinkommen als Lebenseinkommen betrachtet werden muss. Dieses Einkommen müsse, so Schreiber, nicht nur die aktive Erwerbsphase abdecken, sondern auch die Abschnitte davor und danach – die Kindheit und Jugend, in denen Fähigkeiten für die berufliche Tätigkeit erworben werden, sowie natürlich das erwerbslose Alter. Wo man eine Gesellschaft als Solidargemeinschaft begreift, ist es demnach notwendig, Mechanismen zur gerechten Verteilung des von der erwerbstätigen Generation erwirtschafteten Einkommens zu schaffen. Diese Verteilung soll sowohl den Lebensunterhalt der arbeitenden Generation selbst als auch die Versorgung von Kindern und Pensionisten gewährleisten. So weit, so gut; für diese Idee sprechen tatsächlich einige bestechend treffsichere Argumente, die kaum von der Hand zu weisen sind. Und tatsächlich funktionierte sie auch einige Jahrzehnte ganz gut – gerade gut genug jedenfalls, um eine Alternative zum davor existierenden System eines auf rein familiärer Bindung beruhenden, anderen Generationenvertrages zu bilden: Nicht mehr die direkten Nachkommen waren nun für das Auskommen der Eltern und Großeltern nach deren Erwerbsleben verantwortlich, sondern die Gesamtheit der Erwerbstätigen einer Gesellschaft – für kinderlose Ehepaare, Witwen und Witwer, Individualisten und unverheiratet gebliebene Menschen ein unschätzbarer Vorteil. Aber auch mit ei -
nem gravierenden Nachteil: Der gesellschaftliche Wert von Kinderreichtum veränderte sich mit dem Schwinden der Notwendigkeit, Ehen einzugehen und intakt zu halten, um im Alter versorgt zu sein. Dieses Prinzip setzte sich in der westlichen Welt durch, während in der Zweiten und Dritten Welt möglichst viele Kinder immer noch der Garant für das Überleben im Alter blieben. Das Zitat des französischen Revolutionärs Pierre Vergniaud, der auf dem Weg zur Hinrichtung gesagt haben soll „Die Revolution frisst ihre Kinder“ erhielt somit relativ schnell eine neue Bedeutung: Der Zeitgeist in westlich geprägten Gesellschaften bedingte, dass immer weniger Kinder zur Welt kamen. Das belegt auch die Geburtenbilanz – in Österreich ist sie seit fünf Jahren in Folge defizitär: »76.873 Neugeborenen standen 87.407 Verstorbene gegenüber – das heißt, 2024 starben um 10.534 Menschen mehr, als geboren wurden. Die Gesamtfertilitätsrate, also die zu erwartende Kinderzahl pro Frau, ist 2024 mit 1,31 auf einen neuen Tiefstand gesunken « , erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.
Commitment zur Familie schwindet Nun kann der Generationenvertrag, wie wir ihn heute kennen, aber nur aufrechterhalten werden, wenn zumindest zwei Grundvoraussetzungen gegeben sind. Erstens: Jener Teil des Erwerbseinkommens einer Gesellschaft, den diese abgeben muss, ist nicht höher als jener Teil, der der Erwerbsgesellschaft selbst zum komfortablen Überleben bleibt. Und zweitens: Es müssen genug Kinder geboren werden, die später als Erwerbstätige in Summe genug Beiträge leisten, um die Pensionszahlungen für die künftigen Ruheständler zu decken.
Beides ist nicht mehr gegeben, weshalb der Generationenvertrag, so wie wir ihn kennen, schon als Konzept eigentlich hinfällig ist. Er funktioniert nicht mehr – und das hat mehrere Gründe. Denn Kinder in ausreichender Zahl zu zeugen, sie zu gebären und zu ernähren, sie zu erziehen widerspricht dem von der Emanzipation der 1968er-Generation getragenen Zeitgeist. Kurz: Eine weitgehend lebenslange Einschränkung der individuellen Entfaltung durch Aufgabenerfüllung für die Familie ist für Frauen und Männer schlicht unmodern geworden.
Pflegethema ungelöst
Das betrifft unter anderem zwei wichtige gesellschaftliche Bereiche, die bis in die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts eigentlich über Jahrtausende tragende Säulen der Gesellschaft waren: das Gebären und Erziehen von Kindern in ausreichender Zahl und die häusliche Pflege von körperlich eingeschränkten Lebensgefährten, Eltern und Großeltern. Womit wir bei einem weiteren Problem für das Funktionieren des Generationenvertrages angekommen sind: Die Menschen werden immer älter und müssen daher immer länger alimentiert werden. Noch ist das Problem nur am Rande sichtbar. Denn überraschenderweise steigt die Anzahl der Erwerbspersonen; alle Statistiken weisen im Bereich der selbstständigen und unselbstständigen Erwerbstätigen derzeit noch eine signifikante Steigerung aus (nur die selbstständigen Landwirte nehmen statistisch gesehen dramatisch ab). Das Problem: Ihre Zahl erhöht sich nicht im gleichen Maß, wie die Zahl der Pensionisten steigt. Allerdings können viele Geringverdiener trotz hoher Kopfzahl Probleme im Umlagesystem verursachen; wo etwa die Teilzeitquote zum Problem zu werden droht, ist es wahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Umgekehrt gibt es theoretisch Hoffnung für die Zeit, in der die Zahl der Erwerbstätigen sinkt – was schon bald der Fall sein wird: Nur wenn die nachkommenden Erwerbstätigen deutlich produktiver oder besser bezahlt sind, kann eine kleinere Zahl von ihnen theoretisch mehr Pensionisten finanzieren. Laut Statistik Austria steigt die Zahl der Menschen im Pensionsalter (65+) bis 2040 von 1,77 auf 2,57 Millionen, während die Zahl der Menschen im Erwerbsalter (20 bis unter 65) von 5,54 auf 5,3 Millionen zurückgeht. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Pensionsneuzugänge durch die generationenstarken Jahrgänge steigen – mehr als jeder Dritte der derzeit unselbstständig Beschäftigten wird bis 2040 in Pension gehen. Der so genannte Altersquotient verschiebt sich rasant: Sind in den 50er Jahren 10 Personen im Erwerbsalter auf »nur « 1,7 Personen im Pensionsalter gekommen, sind es 2024 bereits 3,3 Personen und 2042 sogar fünf Personen. „Durch diese Entwicklung steigt die Pensionslücke, also der Bundesbeitrag rasant an. Dieser wird

vom Steuerzahler und damit wieder vor allem von den (weniger werdenden) Menschen im Haupterwerbsalter aufgebracht“, ist einem Papier der WKO zu entnehmen. Wann die Demografie endgültig zum Problem wird, lässt sich also mathematisch leicht ausrechnen. Dann nämlich, wenn die Baby Boomer – das ist die letzte Generation, für die der Kinderreichtum noch einen gewissen Stellenwert hatte, also die zwischen 1960 und 1965 Geborenen – in Pension gehen. Und das ist ungefähr jetzt.
Hoffnung Migration
Dass unter diesem Aspekt eine besondere Hoffnung auf Migration, insbesondere der Arbeitsmigration liegt, ist weiter nicht verwunderlich. Alleine – sie hat sich bislang nicht erfüllt. Eine Vielzahl an Migranten, die in unser Sozialsystem einwandern und es zusätzlich belasten, steht einer zu geringen Grundgesamtheit an arbeitswilligen oder arbeitsfähigen Migranten gegenüber – wobei man sich in diesem Kontext vor Pauschalisierungen tunlichst hüten sollte. Dennoch fehlen echte Fachkräfte, die mit jenen besonderen Qualifikationen ausgestattet sind, die Industrie und Wirtschaft dringend brauchen würden. Denn auch die leiden unter der demografischen Entwicklung. Um ihre Produktivität mittel- und langfristig zu sichern, braucht es schlicht und ergreifend eine kritische Masse an zur Verfügung stehenden, gut ausgebildeten und arbeitswilligen Arbeitskräften.
Jugend ohne Ehrgeiz
Hier trifft man nicht nur auf ein demografisches Problem: Die, die Umlage künftig finanzieren müssen, gehören einer Generation an, der man nachsagt, tendenziell leistungsfeindlich eingestellt zu sein. Das stimmt natürlich so nicht. Die Gen Z – also die zwischen 1995 und 2015 Geborenen – will nicht weniger arbeiten, sondern nur die Bedingungen diktieren, zu denen sie Leistung erbringt: Sinnvoll soll die Arbeit sein, Beruf und Privatleben sollen streng getrennt sein, Remote Work soll möglich sein und wenn schon Leistung, dann soll sie bitte auf Augenhöhe anerkannt werden. Kurz: Die Generationenvertragserfüller von morgen wollen den Begriff Arbeitsleistung neu und in ihrem Sinne definiert wissen. Das aber passt nur bedingt in die Strukturen jener, die diese Arbeitsleistung nachfragen, weshalb die Gen Z, für die ihr eigenes Einkommen nicht die höchste Priorität hat, sich eher dort um Arbeit umsieht, wo man weniger Steuern zahlt. Und wo man weniger Steuern zahlt, weil man Teilzeitjobs und Work-Life-Balance einem mühsamen Vollzeitjob und Wochenendfreizeit vorzieht, wird der Steuertopf eben zusätzlich belastet.
Dieser Steuertopf wiederum ist bereits bis zur Neige geleert. Mehr noch: Ohne Schulden zu machen, kann der Staat seinen Aufgaben – oder dem, was er dafür hält – nicht mehr nachkommen. Schon ein Blick auf die derzeitige Budgetsituation spricht


Die Panik wird gemacht, damit man die Fakten nicht mehr hört und sieht.
Momentum-Institut-Chefin
Barbara Blaha
Bände: Ein knappes Viertel der gesamten Staatsausgaben betrifft die Pensionen: Beamte erhalten 12,8 Milliarden Euro aus dem Steuertopf; für alle anderen, die Geld aus den Verpflichtungen der Pensionsversicherung beziehen, sind 16,6 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind insgesamt satte 23,9 Prozent aller Staatsausgaben. Heute.
Pensionsalter anheben
Von »morgen« wagt in diesem Zusammenhang kaum jemand zu sprechen. Einer, der es doch immer wieder und mit Vehemenz tut, ist Fiskalratschef Christoph Badelt. Jüngst ließ er sich in der


Der Preis wurde im Rahmen der 20. Druck&Medien Awards in Berlin verliehen, nachdem eine unabhängige Jury aus Branchen-Experten und Printbuyern die zahlreichen Einreichungen in einem mehrstufigen Verfahren geprüft hatte.
Das Team der Walstead Leykam freut sich über eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Branche, die eine Bestätigung der Leistungen ist, die wir für unsere Kunden und gemeinsam mit unseren Kunden erbringen.
ORF-Pressestunde dazu hinreißen, hinsichtlich des Budgets einmal mehr das demografische Problem und das Ausbleiben entsprechender Maßnahmen zu benennen. »Ich finde es wirklich schlimm, dass sich auch diese Regierung wieder nicht traut, das gesetzliche Pensionsalter langfristig hinaufzusetzen«, so Badelt. Er gehe davon aus, dass nur diese Maßnahme geeignet sei, das Budget sinnvoll zu entlasten.»Wenn in den nächsten Jahrzehnten keine Maßnahmen gesetzt werden, wird das Defizit um zwei bis drei Prozent pro Jahr steigen.« Dafür seien drei Faktoren verantwortlich: Die Pensionen, die Pflege und die Gesundheit, wobei man sozial verträglich lediglich an den Pensionen als Stellschraube drehen könne. Es brauche, so der Fiskalratschef, nicht nur Maßnahmen, um das gesetzliche, sondern auch das faktische Pensionsalter anzuheben – »nicht, weil die Pensionen sonst morgen nicht mehr finanzierbar wären, sondern weil der gesamte Staatshaushalt in den kommenden Jahrzehnten demografisch so unter Druck kommt, dass man dringend langfristige Maßnahmen setzen müsse, um diesen Druck zu verringern. Sonst lassen sich Budgets in fünf oder zehn Jahren überhaupt nicht mehr darstellen.«
Ideologische Interpretationen
Dass das Umlagesystem, wie wir es bisher kannten, gefährdet sei, ist indessen alles andere als Common Sense. Ganz im Gegenteil, die Interpretation der Faktenlage fällt von konservativen
und progressiven Kräften im Land völlig unterschiedlich aus. Wo wirtschaftsliberale Kräfte eine Pensionsreform und Opfer für das große Ganze – den Sozialstaat – einmahnen, wirken sozialdemokratische Kräfte naturgemäß dagegen. Wenn es überhaupt notwendig sei, Opfer zu bringen, dann sollen das die „starken Schultern“ im Land tun, also die Milliardäre und Millionäre, die Unternehmer und Gutverdiener – keineswegs die Pensionisten. Wann immer etwa eine Organisation oder Institution die Notwendigkeit zu einer Pensionsreform fordert, hält zum Beispiel das rote Momentum Institut dagegen und gibt ein Argumentarium vor. „Die Panik wird gemacht, damit man die Fakten nicht mehr hört und sieht“, vermutet Momentum-Chefin Barbara Blaha im Kurier. Blaha: „Die größte Gruppe in der Pensionsversicherung sind alle, die arbeiten. Technisch formuliert: die Gruppe der unselbstständig Beschäftigten. Sie zahlen einen Teil ihres Gehalts in die Pensionsversicherung ein. Und aus der nehmen sich alle, die heute in Pension sind, ihre Pensionszahlung heraus. Was kaum jemand weiß: Die Beschäftigten zahlen mehr ein, als über die Alterspensionen wieder abfließt. Die Pensionsversicherung schreibt hier ein Plus. Der Löwenanteil der Alterspensionen trägt sich selbst und braucht keinen Zuschuss des Finanzministers“, ist sich Blaha sicher. Warum aber, so die Momentum-Chefin weiter, würde dann trotzdem
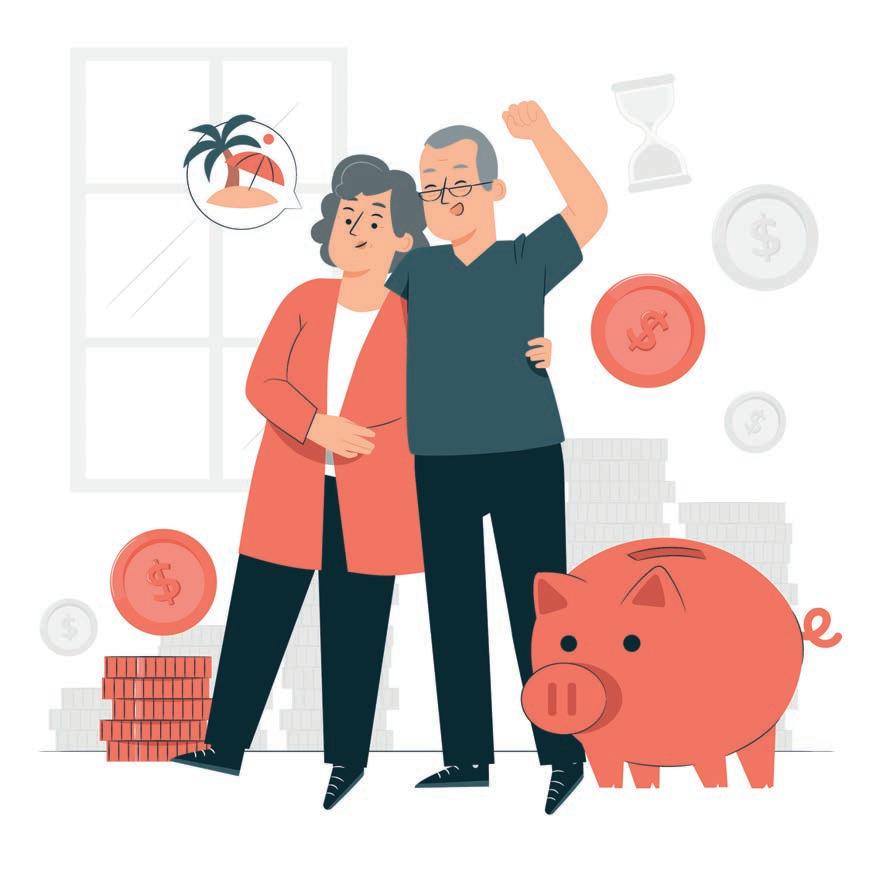
Steuergeld in das Pensionssystem fließen? „Erstens: Weil die Bauern und Selbstständigen in ihre Versicherung weniger einzahlen, als sie herausnehmen. Der Grund dafür ist, dass es dort keine Arbeitgeber:innen (sic!) gibt, die etwas beitragen. Ein Unternehmer ist sein eigener Chef. Zweitens zahlen wir über das Pensionssystem viel mehr als nur Pensionen. Es unterstützt Waisenkinder, Witwen und Witwer und alle Leute, die wegen schwerer Krankheit oder Unfall berufsunfähig sind. Das Pensionssystem sichert ihnen allein wenigstens eine Mindestpension. Und es finanziert auch Kuraufenthalte und Reha-Maßnahmen für Berufstätige.“ Aber, keine Sorge: Denn selbst wenn „Selbstständige und Bauern mehr herausnehmen, als sie einzahlen“, wo doch aus diesem Topf auch „Waisenkinder und Witwen“ unterstützt werden müssen, ist dann doch –entgegen der Annahme echter Experten – alles gut, denn: „Das alles können wir uns als reiches Land leisten. Auch in Zukunft. Jetzt gehen zwar mehr Menschen in Pension – aber der Beitrag aus Steuern zur Pension bleibt auf lange Sicht stabil. Ja, die Boomer-Generation geht jetzt in Pension, aber ab 2035 sinkt die Zahl der Pensionierungen wieder. Und auf der Kostenseite wird parallel gegengesteuert, weil wir immer weniger für die Pensionen bei Beamt:innen (sic!) ausgeben müssen. Unterm Strich bleiben die Kosten konstant: bis 2070 etwa sechs Prozent der Wirtschaftsleistung.“
Verrückte Ideen
Wer also nach Gerechtigkeit im Umlagesystem sucht, der wird sich an das Momentum Institut wenden müssen. Oder an Nationalbank-Ökonom Markus Knell, der jüngst ebenfalls mit einer schrägen Idee zu einer Pensions-Teilreform auf sich aufmerksam machte. „Derzeit folgt das österreichische Pensionssystem einem einheitlichen Modell: Wer mit 65 Jahren in Pension geht und 45 Beitragsjahre aufweist, erhält eine Erstpension in Höhe von 80 Prozent des durchschnittlichen Lebenseinkommens. Ein früherer Pensionsantritt ist zwar möglich, führt aber zu Abschlägen von 5,1 Prozent pro Jahr. Diese Regelung gilt für alle Versicherten – unabhängig von ihrem Lebenseinkommen. Doch dieses proportionale System ist keineswegs alternativlos“, konstatiert Knell. Sein Vorschlag: „Statt einer starren Ersatzrate könnte eine progressive Staffelung eingeführt werden, ähnlich wie bei Einkommenssteuern. Höhere Einkommen würden die 80 Prozent erst bei einem späteren Pensionsantritt (z. B. mit 67 Jahren) erreichen, während Geringverdienende dieselbe Ersatzrate bereits mit 63 Jahren erhalten könnten.“ Auf diese Weise, so die Überzeugung von Knell, ließe sich eine nachhaltige Anhebung des Pensionsantrittsalters sozial gerechter gestalten. Dass dieses Gedankenspiel auf Widerspruch stoßen musste, war klar: Monika Köppl-Turyna vom Institut EcoAustria etwa warnte davor, das Pensionssystem als Ausgleich für soziale Ungleichheiten zu nutzen, da es als Versicherungssystem nicht dafür gedacht sei. Auch zahlreiche andere Ökonomen widersprechen heftig.
Diese Idee steht als pars pro toto beispielhaft für ein politisches und intellektuelles System, das in einem falsch verstandenen

Die Gesamtfertilitätsrate, also die zu erwartende Kinderzahl pro Frau, ist 2024 mit 1,31 auf einen neuen Tiefstand gesunken.
Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas
Gerechtigkeitswahn die Parameter einer funktionierenden Gesellschaft seit Jahrzehnten zunehmend negiert. Die Folgen sind dramatisch: Der Generationenvertrag, wie wir ihn kannten, ist de facto am Ende. Der Sozialstaat steuert auf eine unaufhaltsame Krise zu, in der die Lasten immer weniger Erwerbstätige tragen müssen, während die Zahl der Empfänger kontinuierlich steigt. Weder die Politik noch die Gesellschaft scheinen bereit, die notwendigen und teils schmerzhaften Reformen in Angriff zu nehmen. Migration, die einst als Hoffnung galt, vermag die Lücke nicht zu schließen, und auch die junge Generation zeigt wenig Bereitschaft, in die alten Muster der Leistungsgesellschaft zurückzukehren. Während der Staat zunehmend in Schulden ertrinkt, nähert sich das Umlagesystem seinem Kipppunkt. Was bleibt, ist die Aussicht auf einen schleichenden Verfall eines Systems, das einst als solidarisches Fundament der Gesellschaft galt. Und auf eine Zukunft, in der jeder zunehmend auf sich selbst gestellt sein wird. �
„Die Europäische Union hat sich von den USA isoliert, sie hat sich von China isoliert mit einem Handelskrieg und sie hat sich von Russland isoliert mit der Sanktionspolitik. Wenn hier also jemand isoliert ist, dann ist es die Europäische Union.“
Viktor Orbán, ungarischer Ministerpräsident

FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm kritisiert das Mittelstandspaket als völlig unzureichend: „Die Regierung entlastet die Unternehmen nicht wirklich und lässt sie mit hohen Energiekosten und Steuern allein.“
Mittelstandspaket: Ein erster Entlastungsschritt, aber ein unzureichender! Die österreichische Bundesregierung hat mit ihrem Mittelstandspaket Maßnahmen angekündigt, um heimische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) finanziell zu entlasten und von überbordender Bürokratie zu befreien. Doch während Wirtschaftstreibende und Interessenverbände erste Fortschritte anerkennen, bleibt Kritik an der tatsächlichen Umsetzung und der langfristigen Wirkung der Maßnahmen nicht aus. Denn die wirtschaftliche Lage bleibt extrem angespannt. Seit drei Jahren steckt das Land in einer Rezession, und Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten, hoher Inflation und komplexen bürokratischen Hürden.
Der ÖVP-Wirtschaftsbund und die Neos sind zufrieden … Für WB-Generalsekretär Kurt Egger schafft das beschlossene Mittelstandspaket die Voraussetzungen für das Comeback der österreichischen Wirtschaft: „Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschafts-
minister Wolfgang Hattmannsdorfer haben von der ersten Stunde dieser Bundesregierung weg das wirtschaftliche Comeback Österreichs zu einem der zentralen Vorhaben dieser Legislaturperiode gemacht“, erklärt Egger. Von der Abschaffung der Belegausdruckpflicht unter 35 Euro und der NoVA-Befreiung für Transporter über die Erhöhung der Basispauschalierung bis zu den dringend nötigen Genehmigungsbeschleunigungen und der Bürokratiebremse würden die österreichischen Unternehmen noch viele Jahre lang profitieren. „Mit dem heutigen Tag beginnen wir, Österreich raus aus der Rezession und zurück auf die wirtschaftliche Überholspur zu bringen!“, so Egger. Die NEOS, seit wenigen Wochen ja Regierungspartei, begrüßen die Initiative ebenfalls als klares Bekenntnis zum heimischen Unternehmertum. NEOS-Standortsprecher Markus Hofer betont die Bedeutung der Maßnahmen: „Weniger Bürokratie bedeutet mehr Zeit und Geld für das eigentliche Geschäft. Eine zentrale Anlaufstelle für Deregulierung im Staatssekretariat von Sepp
Schellhorn soll sicherstellen, dass dieser Kurs beibehalten wird.“
Der Handelsverband sieht einen ersten Schritt und die FPÖ eine Themenverfehlung
Auch der Handelsverband erkennt Fortschritte, wenngleich Geschäftsführer Rainer Will betont, dass noch viele Hürden bestehen. Besonders die Abschaffung der Belegausdruckpflicht für Kleinbeträge sei ein lange geforderter Schritt, der nicht nur Bürokratie reduziere, sondern auch die Umwelt schone. Allerdings warnt Will davor, dass diese Maßnahme nicht zu einer verpflichtenden digitalen Beleglösung führen dürfe, da dies vor allem kleinere Händler technisch überfordern könnte. Nicht alle sehen in dem Mittelstandspaket eine echte Erleichterung. FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm kritisiert die Maßnahmen als unzureichend und wirft der Regierung vor, keine finanziellen Spielräume für nachhaltige Entlastungen zu schaffen. „Die Regierung bleibt beim Schuldenmachen, entlastet Unternehmen nicht wirklich und lässt sie mit hohen Energiekosten und Steuern allein.“ Besonders vermisst sie eine tiefgreifende Steuerreform sowie die Möglichkeit eines Austritts aus der Wirtschaftskammer-Pflichtmitgliedschaft.
Grüne wollen statt entlasten umweltfeindliche Subventionen stoppen Und den Grünen geht es wieder einmal um alles andere, nur nicht um die Wirtschaft. Die Bundesregierung setze mit der Steuerbefreiung der NoVA für Klein-LKW auf den falschen Weg, kritisiert etwa der grüne Budgetsprecher, Jakob Schwarz Anstatt klimaschädliche Subventionen abzubauen – eine Empfehlung namhafter Ökonomen –, werde eine zusätzliche eingeführt. Schwarz erinnert daran, dass die Abschaffung dieser Begünstigung in der letzten Legislaturperiode durch Druck der Grünen erreicht wurde. Die Maßnahme gefährde zudem die Erreichung der Klimaziele. Die Grünen fordern stattdessen eine Budgetsanierung durch Subventionsabbau, ohne Klimaschutz und Zukunfts- Foto: Gage Skidmore , STVP/Gasser

sektoren zu schwächen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es für das Gewerbe und Handwerk bis dato nur im Kurzstreckenverkehr ernstzunehmende elektrisch betriebene Alternativen zu reichenweitenstarken Verbrennerfahrzeugen gibt.
Das Mittelstandspaket bringt mit Sicherheit erste Verbesserungen für KMU, insbesondere im Bereich des Bürokratieabbaus. Doch es besteht zweifellos weiterhin großer Handlungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Steuerlast, die Energiepreise und langfristige Maßnahmen zur Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit. Denn nur was auch der exportorientierten Wirtschaft hilft, nützt langfristig auch dem Gewerbe und Handwerk sowie den Dienstleistungsunternehmen. Außerdem bleibt abzuwarten, ob die angekündigten Entlastungen auch tatsächlich jemals in der Praxis ankommen oder ob sie nicht durch neue Belastungen in anderen Bereichen neutralisiert werden.
Energiepolitik: Interessanter Schulterschluss der steirischen SPÖ mit der AK Bisher lebten die AK und die steirische SPÖ lieber in parallelen Welten. AK-Präsident Josef Pesserl und Anton Lang hatten einander nicht viel zu sagen und vermieden einen allzu intensiven Austausch. Inzwischen ist die SPÖ in der Steiermark in der Oppositionsrolle und dadurch ergeben sich gute Möglichkeiten zwischen SPÖ-Chef Max Lercher und dem AK-Präsidenten, sich die Bälle gegenseitig zuzuspielen. Als Teil der Landesregierung hätte die SPÖ die dringliche Anfrage zur Zukunft der steirischen Energiepolitik wohl stellen können und auch die von AK und SPÖ gemeinsam vorgelegten Vorschläge, wie die hohen Energiepreise gesenkt werden können, hätte die AK alleine präsentieren müssen. Denn die beiden fordern Eingriffe in den Strompreis. Außerdem müsse die Energie Steiermark zu 100 % in Landesbesitz bleiben. Max Lercher will die Dividenden sogar für Energiepreiskompensationen nutzen und nicht zur Budgetsanierung.
MIT JOHANNES TANDL
Zudem brauche es einen Plan für die Industrie, besonders im Automobilzulieferbereich. Notwendig seien außerdem Vorrangzonen für Windkraft, Photovoltaik und eine Wasserstoff-Infrastruktur. AK-Präsident Josef Pesserl betonte einmal mehr: „Strom ist ein Grundrecht und keine Handelsware. Die Politik muss endlich handeln und in die Preise eingreifen.“ Konkret fordert die SPÖ, keine Anteilsverkäufe der Energie Steiermark zuzulassen, die Entwicklung eines „Steiermark-Tarifs“ zur Kostensenkung, die Förderung lokaler Energiegemeinschaften, eine Satzungsänderung bei der Energie Steiermark, um kostengünstige Energie zu ermöglichen, sowie den Ausbau erneuerbarer Energien und Wasserstoffnetze.
Manuela Khom – die Powerfrau an der VP-Spitze
Die neue starke Frau der steirischen ÖVP, Manuela Khom, ist gebürtige Burgenländerin und hat es in wenigen Wochen geschafft, die meisten ihrer VP-internen Zweifler von sich zu überzeugen. Sie begann ihre steirische Politikkarriere als Gemeinderätin von Laßnitz bei Murau (1995–2014) und kam 2010 in den Landtag. Mit Biss und Fokus auf Gemeinden, Regionen und Frauenpower schaffte sie es an die Spitze der nicht immer einfachen ÖVP Murau. 2019 wurde sie erste Landtagspräsidentin und übernahm im Dezember 2024 nach der Wahlniederlage von Christopher Drexler nicht nur die steirische ÖVP, sondern auch das Amt des stellvertretenden Landeshauptmannes. Khom ist eine hervorragende Kommunikatorin. Die Handelsakademie-Absolventin (Eisenstadt) und ausgebildete Trainerin bringt Erfahrung und Lautstärke mit – als selbsternannte »Quotenfrau« kämpft sie für Kompetenz statt Klischees. Sie lebt in Murau und bleibt der Basis treu. Dass sie lieber anpackt, statt abzuwarten, hat sie im völlig verunglückten Landtagswahlkampf der ÖVP bewiesen, als sie als Einpeitscherin für Christopher Drexler zu retten versuchte, was nicht mehr zu retten war. Wer Khom kennt, weiß, dass sie – anders als fast alle ihre Vorgänger in der stei-
rischen ÖVP – das Zeug zum Volkstribun hat. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob sie auch die differenzierten, leisen Töne beherrscht. Mit der Personalentscheidung im Wirtschafts- und Finanzressort hat sie jedenfalls alle überrascht. Den von ihr geholten Manager und Forstexperten Willibald Ehrenhöfer hatte wirklich niemand auf der persönlichen Shortlist für diese mächtige Regierungsfunktion. Die steirischen Budgetprobleme haben es durchaus in sich – so fehlen heuer gut 900 Millionen Euro. Ehrenhöfer hat angekündigt, seinem Naturell entsprechend, wert- und nachhaltig und nicht mit dem Rasenmäher an die Budgetsanierung heranzugehen. �

Die neue starke Frau in der steirischen ÖVP, Manuela Khom ist eine hervorragende Kommunikatorin und hat – anders als ihre Vorgänger – das Zeug zum Volkstribun.

Die fortschreitende Digitalisierung stellt den Datenschutz vor immer neue Herausforderungen. Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) verankert das Recht auf Schutz personenbezogener Daten als fundamentales Grundrecht. In einer Zeit, in der Daten als »Währung« der digitalen Welt gelten, ist dieser Schutz essenziell für die Wahrung der individuellen Autonomie und der demokratischen Ordnung.
Der Wortlaut von Artikel 8 GRC formuliert drei zentrale Grundsätze: »Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.«
Diese Bestimmungen sind mehr als bloße Programmsätze – sie sind justiziabel und müssen in nationale sowie europäische Gesetzgebung einfließen. Die Umsetzung von Artikel 8 GRC hat mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine konkrete Ausgestaltung gefunden. Dennoch gibt es immer wieder Spannungsfelder, wie etwa bei »Big Data« und Künstlicher Intelligenz: Die massenhafte Analyse personenbezogener Daten wirft Fragen zur Verhältnismäßigkeit und zur informierten Einwilligung auf. Die EuGH-Rechtsprechung hat Artikel 8 GRC kontinuierlich weiterentwickelt. Entscheidungen wie »Schrems I & II« betonen, dass der Schutz personenbezogener Daten auch außerhalb der EU gewahrt bleiben muss.
Ein weiteres prägendes Urteil ist die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Google Spain (C-131/12). In diesem Urteil stellt der EuGH klar, dass Suchmaschinenbetreiber als Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten anzusehen sind. Daraus resultiert etwa auch das sogenannte »Recht auf Vergessenwerden«, wonach Einzelpersonen unter bestimmten Voraussetzungen verlangen können, dass Suchmaschineneinträge mit sensiblen oder veralteten Informationen entfernt werden.
Fazit: Artikel 8 GRC ist ein entscheidender Pfeiler der digitalen Grundrechteordnung in Europa. Die Herausforderung besteht darin, Datenschutz wirksam umzusetzen, ohne Innovation und wirtschaftliche Entwicklung unnötig zu bremsen. n
Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher hat gemeinsam mit AK-Präs. Josef Pesserl Vorschläge auf den Tisch gelegt, um die hohen Energiepreise in der Steiermark wieder zu senken.
Unter dem Motto „leistbare Energieversorgung für die Zukunft sichern“ wurden Lösungen präsentiert, die den Steirerinnen und Steirern in Zeiten steigender Preise zugutekommen sollen. „Die enorme Steigerung der Energiepreise hat große Auswirkungen auf unsere Städte und Gemeinden, die Industrie und Privathaushalte. Es ist die Aufgabe der Politik, dies wieder zu ändern, damit jene, die täglich hart arbeiten, sich das Leben wieder leisten können“, betonte Lercher.
Dividende für Entlastung Konkret soll das gemeinsam mit Hilfe des Landesenergieversorgers gelingen. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Energie Steiermark zu 100 Prozent im Eigentum des Landes steht. Lercher fordert: „Die Dividenden sollen für Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden und nicht, um Budgetlöcher zu stopfen.“ Die Energie Steiermark ist ein Motor für unser Bundesland und muss als solcher auch für die Entwicklung unseres Wirtschafts- und Industriestandortes und die Entlastung der Privathaushalte genutzt werden“, so Lercher, der Maßnahmen der blau-schwarzen Landesregierung vermisst.
Brennendes Thema Strompreis
Ergänzend wies AK-Präs. Josef Pesserl in seinen Ausführungen darauf hin, dass Strom keine Handelsware ist, sondern eine Leistung, auf die jeder Anspruch haben sollte. „Das Thema der hohen Strompreise brennt schon seit drei Jahren, ist aber nun aktueller denn je. Bei uns sprechen Familien vor, die verzweifelt sind, weil ihre Vorschreibung um 50 Prozent höher ist als im vergangenen Jahr. Zusätzlich leiden vor allem auch viele, vor allem kleine Betriebe, unter den hohen Preisen und erleiden dadurch deutliche Wettbewerbsnachteile“, erklärt Pesserl, der die Politik schon seit Jahren zum Handeln mahnt. �
Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher (r.) und AK-Präs. Josef Pesserl fordern die Senkung der Stromtarife für Haushalte und Kleinbetriebe.
Unter dem Titel „Stadt oder Stillstand“ hat die WKO Graz im Jänner eine Kampagne ins Leben gerufen, die das Ziel verfolgt, Graz unternehmerfreundlicher zu gestalten. Doch dabei bleibt es nicht bei einer reinen Werbeaktion – vielmehr handelt es sich um ein umfassendes Programm mit zahlreichen konkreten Maßnahmen und Forderungen, die von der WKO Graz aktiv vorangetrieben werden.
„Die Wahlbeteiligung bei der WKO-Wahl war insgesamt leider enttäuschend. In der Innenstadt, wo unsere Kampagne besonders präsent war, verzeichneten wir aber die höchste Beteiligung. Das bestärkt uns darin, unser Programm konsequent weiterzuverfolgen und den direkten Austausch mit unseren Mitgliedern noch intensiver zu gestalten“, erklärt RST-Leiter Viktor Larissegger.
Kontakte zu den Unternehmen
Daher werden ab April an insgesamt neun Tagen pro Woche Unternehmen in allen Grazer Bezirken besucht. Mindestens 50 Betriebe sollen persönlich kontaktiert
werden, um die Inhalte vorzustellen und, falls nötig, um weitere Aspekte zu ergänzen. Einer der fünf zentralen Schwerpunkte ist die Stadtentwicklung. Die WKO Graz fordert eine deutliche Stärkung des Citymanagements, das mehr Aufgaben im Stadtmarketing übernehmen sollte. Zudem setzt sich die WKO für flexiblere Öffnungszeiten in der Gastronomie sowie für neue Angebote in der Innenstadt ein, um Graz langfristig als attraktiven Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher zu etablieren.
Ein weiteres Kernthema ist der Bürokratieabbau. „Überspitzt gesagt, sollte alles

WKO-Regionalstellen-Obmann Bernhard Bauer wünscht sich mehr Impulse für eine unternehmerfreundlichere Gestaltung der Innenstadt.
erlaubt sein, was nicht ausdrücklich verboten ist – und nicht umgekehrt“, betont RST-Obmann Bernhard Bauer. Er kündigt eine Plattform an, die veranschaulichen soll, mit welchen absurden Regelungen sich Unternehmerinnen und Unternehmer konfrontiert sehen. „Damit wollen wir eine Debatte über Erleichterungen anstoßen und konkrete Lösungen aufzeigen“, ergänzt Bauer.









Rundgänge & Rundfahrten in der Kulturhauptstadt
ALTSTADT-RUNDGANG: bis April & Oktober bis Dezember, täglich, 14.30 Uhr
Mai bis September, täglich, 10.30 Uhr & 16.30 Uhr
INNENHÖFE & MEHR-RUNDGANG:
Mai bis Oktober, jeden Freitag, 16.00 Uhr
SCHLOSSBERG-RUNDGANG:
Mai bis Oktober, jeden Samstag, 11.00 Uhr
AUF DER ANDEREN SEITE: LEND UND GRIES
Mai bis Oktober, jeden Donnerstag, 17.00 Uhr
STADTRUNDFAHRT MIT DEM CABRIOBUS:
01.05. bis 28.09.2025, Mittwoch bis Freitag, 11.00 Uhr
Samstag, 11.00 & 13.00 Uhr I Sonntag & Feiertag, 11.00 Uhr
GEFÜHRTE RADTOUR:
Juni bis September, jeden Sonntag, 09.30 Uhr
ABEND-RUNDGANG:
Juli & August, jeden Mittwoch & Freitag, 20.30 Uhr















Kulinarische Stadtrundgänge & Stadtrundfahrten
KULINARISCHER RUNDGANG AM SAMSTAG: bis 25.10.2025, jeden Samstag, 10.30 Uhr
KULINARISCHER BIERRUNDGANG: 18.04. bis 31.10.2025, jeden Freitag, 17.00 Uhr
KULINARISCHER RUNDGANG AM SONNTAG: 04.05. bis 02.11.2025, jeden Sonntag, 10.30 Uhr
GENUSS MIT DEM CABRIOBUS – KULINARISCHE RUNDFAHRT: 04.05., 25.05., 15.06., 29.06., 06.07., 20.07., 10.08, 24.08., 07.09., 21.09., 05.10. & 19.10.2025, jeweils 13.00 Uhr
Tourismusinformation Region Graz
Herrengasse 16, 8010 Graz T +43/316/8075-0, info@graztourismus.at graztourismus.at/rundgänge
Die diesjährige Motion Expo hat wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie als Österreichs größte Mobilitäts- und Fahrzeugmesse ein Treffpunkt für Auto- und Technikbegeisterte ist. Mit über 100 Ausstellern auf mehr als 15.000 m² Ausstellungsfläche konnte die Messe Graz mit 21.000 Besuchern einen neuen Publikumsrekord verzeichnen. Neben den neuesten Fahrzeugmodellen und Mobilitätskonzepten standen vor allem Innovationen in den Bereichen E-Mobilität, Classic Cars und Freizeitfahrzeuge im Fokus. Auch Oliver Käfer von der WKO Steiermark betonte: „Wir konnten hunderte interessante Gespräche mit Mobilitätsbegeisterten führen. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass klimaneutrale eFuels die Zukunft der Mobilität sind.“










Die Sammlung von Leo Kuzmits umfasst rund 15.000 präzise präparierte und dokumentierte Exemplare von Schmetterlingen, die einzigartige Einblicke in die Fauna Ostösterreichs, Sloweniens und Kroatiens gewähren. Sie wurden im Zeitraum 1978 bis 2023 vom Hobby-Lepidopterologen in Ostösterreich, Slowenien und Kroatien gesammelt. Mit Unterstützung der Familie Hans Roth konnte das Universalmuseum Joanneum diese wertvolle Sammlung ankaufen. „Die Schmetterlingssammlung von Leo Kuzmits ist ein unschätzbarer Gewinn für unser Museum und die Forschung. Wir danken ihm für seine jahrzehntelange Arbeit und Sorgfalt, mit der er diese Sammlung aufgebaut hat“, so Marko Mele, der wissenschaftliche GF des Universalmuseums Joanneum.

Im Jahr 2024 durfte der Graz Airport rund 820.000 Passagiere betreuen; das sind um 86.000 bzw. 12 % mehr als noch im Jahr 2023. Der Wachstumstreiber war das Chartersegment, mit einem Plus von 31 %, während die Linie mit einem Zuwachs von rund 6,5 % abgeschlossen werden konnte. In der Fracht wurde mit rund 18.700 Tonnen fast das Rekordjahr 2023 erreicht. Wie vorhergesehen, laufen die ersten Monate etwas verhalten. Das liegt vor allem an der Einstellung der Amsterdam-Verbindung im vergangenen Jahr mit Ende Winterflugplan, an der schwächelnden Konjunktur sowie an den kurzfristigen Streiks in diesem Monat. Bisher wurden rund 100.000 Passagiere betreut, was einem leichten Rückgang entspricht. Der Trend des Vorjahres, starke Nachfrage im Urlaubsverkehr, rückläufige Linie, setzt sich dagegen weiter fort.
Frauengeschichte im Universalmuseum
Interventionen, Themenführungen und vieles mehr bietet das Programm im Universalmuseum Joanneum im März. Im Rahmen des „Frauenmonats“ geht das Museum für Geschichte den Spuren einer Frau in den Multimedialen Sammlungen nach, die als Fotografin oder im Zusammenhang mit Fotografie tätig war. Das Unternehmen ‚Foto Gorkiewicz‘ zählte über zwei Generationen zu den wichtigsten im Bezirk Weiz. In einem Videointerview erinnert sich Gundela Gorkiewicz an die Rolle der Frau im Fotobetrieb, zu sehen im Museum für Geschichte von 6. bis 30. März. Die Frage „What if Women Ruled the World?“ wird im Kunsthaus Graz gestellt. Dieser Frage geht der Film „Two Minutes to Mignight“ in der aktuellen Ausstellung „Poetics of Power“ nach.


Die Coffee Bar „COR“ in der Krenngasse 36 hat ihre Türen geöffnet und ist bereits zu einem Treffpunkt für Kaffeeliebhaber geworden. Der Fokus liegt auf Specialty Coffee, der aus kleinen, ausgewählten Röstereien bezogen wird. Ob klassischer Espresso, cremiger Flat White oder erfrischender Cold Brew – hier erlebt man Kaffee in seiner besten Form. Besonders hervorzuheben ist das gemütliche Ambiente, das durch ein exquisites Sortiment an hausgemachten Lebensmitteln, geliefert von der eigenen Bio Landwirtschaft, abgerundet wird – nachhaltig, regional und mit höchster Qualität. Der idyllische Außenbereich lädt zum entspannten Verweilen ein. Ob für den ersten Kaffee am Morgen, eine kurze Auszeit oder einen genussvollen Nachmittag.

Corinna Engelhardt-Nowitzki, wissenschaftliche GF der FH
Welche Bedeutung haben Veranstaltungen wie „Female Future“ jüngst an der FH Joanneum in Kapfenberg, um bei jungen Frauen Interesse an technischen Studien zu wecken? Noch nie zuvor war eine Generation von Frauen so selbstbestimmt und einflussreich wie heute. Frauen und Mädchen aller Altersgruppen gestalten die Zukunft mit Selbstbewusstsein und Entschlossenheit. Als Hochschule und Gemeinschaft sind wir stolz darauf, ein Ort zu sein, an dem Frauen ihre Potenziale frei entfalten und wegweisende Impulse setzen können.
Für welche neuen Studienrichtungen ist im kommenden Herbst der Start an den Standorten der FH Joanneum vorgesehen?
An der FH Joanneum in Graz gibt es in diesem Herbst einige neue Studienrichtungen in den Bereichen E-Health, Management und Informatik, die sich stark mit AI oder Big Data befassen. An der FH Joanneum in Kapfenberg wird das Bachelorstudium Umweltmanagement neu als berufsbegleitende Variante angeboten. Ebenfalls neu ist dort das Masterstudium European Green Transformation. Und wir freuen uns schon sehr, ab Herbst in der Kapfenberger Innenstadt einen zusätzlichen Standort für das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege anzubieten. An der FH Joanneum Bad Gleichenberg gibt es als Masterstudium die neue Studienrichtung E-Sports Business und Management.
Welche Rolle spielen "Soziale Medien" bei der aktiven Bewerbung Ihrer Studienangebote? "Soziale Medien" spielen eine bedeutende Rolle, da wir über unsere erfolgreichen Kanäle wie Instagram oder TikTok die Generation Z optimal erreichen und mit ihnen auch interagieren können.

Von Martin Walpot und Johannes Tandl mit Fotos von Erwin Scheriau
Das Büro von Rektor Peter Riedler befindet sich direkt neben der Aula im Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität. Im Gegensatz zur historischen Umgebung strahlt es keine altehrwürdige Atmosphäre, sondern eine ruhige, aber durchaus produktive Energie aus; wahrscheinlich das richtige Arbeitsumfeld, um Österreichs zweitgrößte Universität mit 29.000 Studierenden und 4.700 Mitarbeitern zu managen.


Mit knapp 29.000 Studierenden und 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die 1585 gegründete Grazer Karl-Franzens-Universität nicht nur die zweitgrößte, sondern auch die zweitälteste Universität des Landes.
Eigene Größe und eigene Geschichte sind schon wichtig, ebenso die neun Nobelpreisträger, welche die Uni Graz bisher hervorgebracht hat. Doch der Anforderungskatalog heimischer Universitäten wird immer umfassender: Sinkende Studierendenzahlen, knappe Forschungbudgets und das internationale Wetteifern um Sichtbarkeit stehen den zunehmenden Herausforderungen in Forschung und Lehre gegenüber – angefangen bei der gesellschaftlichen Wissenschaftsskepsis über rechtliche und ethische Rahmenbedingungen innerhalb der zunehmenden Digitalisierung und Nutzung von KI bis hin zu neuen, attraktiven Studienangeboten.
Wir haben Rektor Peter Riedler nach seiner Strategie für die kommenden Jahre gefragt. Er spricht sich vor allem für offenere Diskurse aus.

Die Akademisierung ist nicht reiner Selbstzweck, sondern sie sichert die Qualität der Ausbildung.
Peter Riedler
Herr Rektor, was sind die größten Probleme, mit denen die Universität Graz derzeit konfrontiert ist?
Ich würde hier zwischen Herausforderungen und Problemen unterscheiden. Als Universität ist es herausfordernd, sich national und international zu positionieren und kontinuierlich Spitzenleistungen zu erbringen. Dies ist uns bisher tatsächlich vielfach gut gelungen. Gleichzeitig müssen wir mit einem breiten Angebot an Studienfächern für Studierende interessant bleiben. Auf dem Weg dorthin gibt es Probleme – wie jenes der Finanzierung: Obwohl wir budgetär zurzeit gut ausgestattet sind, ist indirekt mit den Forschungsgeldern die Entwicklung der Studierendenzahlen verbunden. Diese Zahlen sind für uns wiederum Grundlage für unsere Weiterfinanzierung.
In puncto Budget haben Sie vergangenes Jahr eine Steigerung von knapp 30 Prozent bewilligt bekommen. Wofür werden Sie die dazugewonnenen Mittel einsetzen?
Dreißig Prozent Budgetsteigerung sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen großartig und ein schöner Erfolg der alten Regierung mit dem ehemaligen Bildungsminister Martin Polaschek. Allerdings bewegen sich unsere Kostensteigerungen in einer ähnlichen Größenordnung. Aller Voraussicht nach bekommen wir für die kommende Dreijahresperiode eine über der Inflationsrate liegende Erhöhung der Budgets, um unsere Forschungsbereiche dort auszubauen, wo sie erfolgreich sind.
Ihr Anteil an Drittmitteln für Forschung ist mit 36,8 Millionen Euro im Jahr 2023 verglichen mit etwa einer technischen Universität eher gering. Wie wollen Sie diesen Drittmittelanteil erhöhen? Dieser Anteil ist deutlich gestiegen. Inzwischen liegen wir bei über 50 Millionen Euro.
Ist das viel für eine nicht technische Universität? Für eine allgemeine Universität ist das eine ordentliche Summe, aber noch nicht genug. Es st wichtig zu betonen, dass wir als Forschungsuniversität mit einer Breite an Fächern als Ausbildungsuniversität wahrgenommen werden wollen – gerade aufgrund der überall in Mitteleuropa insbesondere in den Geisteswissenschaften sinkenden Studierendenzahlen. Aus diesem Grund entwickeln wir uns laufend weiter und schärfen unser Profil.
Verfolgen Sie eine bestimmte Strategie, um sich etwa als eine der drei größten Unis in Österreich zu positionieren, oder fokussieren Sie sich gezielt auf Studierende aus dem Ausland, die nach Österreich kommen wollen?
Das Wichtigste ist, die drei Aufgaben zu erledigen, die wir als Bildungs- und Forschungseinrichtung erfüllen müssen. Im Wesentlichen sind das erstens die Forschung, zweitens ein attraktives Studienangebot in der Lehre und drittens ein gesellschaftsrelevanter
und gesellschaftsfördernder Bildungsauftrag. Auf Forschungsseite feiern wir schöne Erfolge: Ein Auszeichnungskriterium sind unsere 17 ERC-Grants. Dabei handelt es sich um europäische Förderinstrumente, die durch unsere Wissenschaftler eingeworben wurden. Dazu kommen drei sogenannte »Cluster of Excellence« -Beteiligungen, eine sogar im »Lead«.
Welche Cluster sind das?
Der Cluster »Metage« beschäftigt sich mit dem Altern und altersbedingten Erkrankungen. Der »Knowledge in Crisis«-Cluster sieht Wissen als ultimative menschliche Ressource und will ein neues Verständnis heutiger Wissenskrisen schaffen. Und der dritte Cluster, »Circular Bioengineering«, setzt sich zum Ziel, Produktkreisläufe nachhaltig zu verbessern. In diesen interdisziplinären Forschungsnetzwerken sind wir als eine von mehreren Universitäten federführend tätig, weltweit sichtbar und lukrieren nicht zuletzt zusätzliche Fördermittel.
Sie haben vorher von drei Aufgaben der Universität gesprochen … Unsere zweite Aufgabe ist, ein breites Studienangebot zu schaffen. Das verstehen wir als »forschungsgeleitete Lehre«: Damit ist nicht das Herunterbeten von vorhandenem Wissen gemeint, sondern die ständige Weiterentwicklung der Lehre und eine zielgerichtete Wissenschaftskommunikation. Dritte Aufgabe: der gesellschaftliche Auftrag, der eine Beteiligung, Weiterentwicklung und Diskussion gesellschaftlicher Prozesse umfasst.
Vielerorts spricht man von einer »Überakademisierung« der Bevölkerung. Wie sehen Sie das?
Das muss man differenzierter betrachten. Die Akademisierung ist nicht reiner Selbstzweck, sondern sie sichert die Qualität der Ausbildung. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Wir bieten »Elementarpädagogik« als Masterstudium und über »Uni4Life« mit »Elementar+« eine Ausbildung für Quereinsteiger an – als Antwort auf den enormen Fachkräftemangel in Österreich. Wir sind österreichweit damit die einzigen und auf diesem Gebiet europaweit Vorreiter. Ich bin davon überzeugt, dass gerade das, was man in den ersten Lebensjahren vermittelt bekommt, eine Grundlage für ein späteres erfolgreiches Leben darstellt. Bei der frühkindlichen Bildungsinvestition ist Österreich sicher nicht das Vorzeigeland. Dieser Bereich wird unter Betreuung eingeordnet und weniger als Ausbildung gesehen. Klar kann man jetzt sagen: Die Akademisierung führt zu vielen überqualifizierten Mitarbeitern, die dementsprechend viel kosten. Im Umkehrschluss werden erschreckend niedrige Gehälter beispielsweise an Frauen und Männer ausbezahlt, die sich mit unseren Kindern in der für sie vielleicht prägendsten Lebensphase beschäftigen. Andere Länder schaffen den kulturellen Wandel. Im nordeuropäischen Raum werden Berufe in Pflege oder Pädagogik höher bewertet und entsprechend entlohnt.

Schon welche Ausbildung man sich leisten kann, ist hierzulande vor allem eine Frage des Gehalts ... Wofür bin ich bereit, als Staat oder als Privatperson Geld auszugeben? Man muss die Bildung an sich als Wert sehen. Eine fundierte Ausbildung, eine Interessensentwicklung von Personen und Gesellschaften spiegelt sich letztlich in demokratischen Prozessen und Debatten wider.
Sind die Auswirkungen der zunehmenden Wissenschaftsskepsis für Sie spürbar? Welche Verantwortung trägt die Universität Graz, um faktenbasierte Debatten zu fördern? Die Skepsis spüren wir in der öffentlichen und medialen Auseinandersetzung. In Zeiten der Regierungsbildung ist zu diesem Thema zwischen und auf den Zeilen viel zu lesen. Gleichzeitig bewegen auch wir als Universität uns in einer akademischen Blase und müssen unser Handeln reflektieren. Es ist notwendiger denn je, Wissen in einer breiten Form, mit Seriosität und Glaubwürdigkeit, nach außen in die Gesellschaft zu tragen. Unsere Aufgabe ist es, eine Plattform für faktenbasierte Diskussionen zu bieten. Diskussionen, die auf Wissen und fundierten Erkenntnissen beruhen und stets den geistigen Hintergrund wahren, der an unserer Universität tief in humanistischen Werten verwurzelt ist. Der Wissenschaftskommunikation, die weder trivial noch belehrend zu sein hat, kommt eine zentrale Rolle zu. Ein Teil dieser Kommunikation erfolgt an der Universität Graz indirekt durch die Lehrerausbildung. Jemand, der eine universitäre Ausbildung durchläuft, arbeitet faktenbasiert und wissenschaftsorientiert. Dieses Wissen geht an die Schüler über. Einen anderen Teil kommunizieren wir dank einer breit auf-
Sichern. Schützen. Erhalten.
gestellten Öffentlichkeitsarbeit multimedial an unsere Studierenden und an die Allgemeinheit.
Sie haben angesprochen, dass die Gesellschaft zunehmend polarisiert ist. Gibt es konkrete Initiativen oder Veranstaltungen, die aktiv zum Dialog mit anderen Meinungen beitragen, Stichwort »Cancel Culture«, und dazu, Barrieren bei den Bildungschancen zu überwinden?
Wenn Sie durch die Universität gehen und die Studierenden sehen, werden Sie erkennen: Das ist kein Querschnitt der Bevölkerung, der hier studiert. Das ist uns nicht nur im universitären Sektor bewusst, sondern allgemein: In Österreich wird Bildung nach wie vor zu einem großen Prozentsatz vererbt. Folglich erreichen wir einen großen Bevölkerungsanteil nur schwer. Da kommen wir schnell zum Thema Integration: In den letzten 20 bis 30 Jahren versäumte Europa, viele Menschen besser zu integrieren und ihnen den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. Als Universität und offene Institution haben wir beispielsweise für einen besseren Dialog das Uni-Vibes-Fest ins Leben gerufen: Dahinter steckt der Gedanke, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Universität ein offener Ort ist, an dem Menschen aus allen sozialen und beruflichen Hintergründen willkommen sind. Die Universität Graz soll als Teil der Stadt wahrgenommen werden. Und weil Sie die Cancel Culture angesprochen haben: Natürlich gibt es die stärker politisch aktiven Gruppen, aber die großen Auseinandersetzungen, wie sie derzeit im Ausland, etwa am Beispiel Israel, passieren, sehen wir bei uns nicht. Vieles spielt sich in einer virtuellen Welt ab – und wird möglicherweise gar nicht über unsere Studierenden an die Universität getragen.
Wir sichern unser Trinkwasser.
Wir schützen vor Hochwasser.
Wir erhalten saubere Gewässer.
Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at


Sichern. Schützen. Erhalten.
Wir sichern unser Trinkwasser.
Wir schützen vor Hochwasser.
Wir erhalten saubere Gewässer.
Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Die Digitalisierung wurde von der Pandemie beschleunigt. Welche Rolle spielen digitale Lehr- und Lernkonzepte an der Universität Graz? In der Covid-Zeit haben wir alle Erfahrungen mit digitalen Lehrveranstaltungen gemacht. Ich sehe darin Vorteile: Digitale Formate verbessern die Studierbarkeit, indem man Studierenden, die aufgrund ihres Standortes oder ihrer Berufstätigkeit nicht vor Ort sind, in einem gewissen Umfang remote eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen ermöglicht. Den Lehrenden steht es grundsätzlich frei, bis zu 30 Prozent der Lerninhalte digital anzubieten.
Ihre Studierenden nutzen Künstliche Intelligenz (KI) mit Sicherheit umfassend. Welche Auswirkungen durch KI und andere Technologien sehen sie mittelfristig auf die universitäre Lehre zukommen? Die Entwicklungen schreiten voran. Anstatt ablehnend zu reagieren, müssen wir mit den vorhandenen Systemen arbeiten und sie für unsere Zwecke weiterentwickeln. Sonst verlieren wir den Anschluss. In der Lehre ist KI derzeitig noch wenig präsent. Das ist etwas, das wir in unserem »Idea Lab« sukzessive ausbauen: KI-Themen insbesondere im Zusammenhang mit Social Media, stehen dabei im Vordergrund. Diese Anwendungsseite umfasst sowohl wissenschaftliche Forschung als auch organisatorische Verwaltungsarbeit. So haben wir als erste Universität in Österreich unseren Mitarbeitern Uni-GPT zur Verfügung gestellt: Sie sollen den Umgang mit KI erlernen und verstehen, was man damit tun kann – sowohl für die eigene Arbeit als auch für den Umgang mit den Studierenden.
Und wie verhält es sich etwa mit rechtlichen und ethischen Herausforderungen durch die KI?
Als Universität gestalten wir die Weiterentwicklung des Rechts aktiv mit, das sehen wir in unserer Verantwortung. Im Zuge dessen haben wir den Profilbereich »Smart Regulation« entwickelt: Die Universität Graz widmet sich Forschungsthemen, die in Zusammenhang mit intelligenter Regulierung von technologischen, sozialen und ökonomischen Innovationen stehen. Rund 50 unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 19 Instituten beschäftigen sich darin auch mit der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen in der Nutzung neuer Technologien. Diese Fragestellungen lassen sich direkt auf verschiedene Fachrichtungen wie das Studium der Rechtswissenschaften oder die Betriebswirtschaftslehre übertragen.
Wird es in Zukunft noch Juristen brauchen, wenn Fälle bereits von der KI übernommen werden?
Eine tiefere Auseinandersetzung mit einem Fall, ein fundiertes Hintergrundwissen und eine tatsächliche Weiterentwicklung des Rechts kann zum jetzigen Zeitpunkt schwer von einer KI erwartet werden. Trotzdem werden Juristen nach einer abgeschlossenen Ausbildung mit der Verwendung von KI in ihrem Berufsalltag umgehen lernen müssen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber neben all diesen Digitalisierungsthemen bemerken wir eine verstärkte Sehnsucht bei den Studierenden, physisch wieder vor Ort am Campus zu lernen und sich auszutauschen. Das zeigt sich in der hohen Auslastung der Lernplätze in der Bibliothek und an den Instituten.
Man geht davon aus, dass manche Berufe langfristig von der KI komplett ersetzt werden. In welchen Studienrichtungen bemerken Sie schon den Wandel?

Recht

Ihr Schutz vor faulen Tricks, Fallen im Internet und Reiseärger.
Wenn Sie sich über den Tisch gezogen fühlen oder Fragen zu Konsumentenrechten, Betriebskostenabrechnungen, Gewährleistungen und Kontogebühren haben – wir beraten Sie gerne.
Peter Riedler wurde 1969 in Graz geboren. Nach der Matura 1987 an einem neusprachlichen Gymnasium begann er, Rechtswissenschaften an der Universität Graz zu studieren. Nach dem Studium folgten Studienaufenthalte an der University of Wales, College of Cardiff sowie ein postgraduales Studium der John Hopkins University (Internationale Wirtschaft und europäische Politik) in Bologna. 1999 promovierte er mit einer Dissertation im Bereich Völkerrecht und Europarecht an der Uni Graz. Berufliche Stationen führten ihn an das Europäische Parlament in Brüssel. Von 2002 bis 2007 war er in Wien im Kabinett von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel Berater für Finanzen, Wirtschaft und Forschung. Anschließend übte er die Funktion als Director of Public Affairs bei der AVL List in Graz aus. 2011 wurde er Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung der Universität Graz. Nach dem Wechsel von Martin Polaschek in die Politik als Bildungsminister der Bundesregierung Nehammer wurde Peter Riedler 2021 interimistisch geschäftsführender Rektor. Am 23. Juni 2022 wurde er vom Universitätsrat zum Rektor der Karl-Franzens-Universität für eine vierjährige Funktionsperiode ab 1. Oktober 2022 gewählt und im Jänner 2025 für weitere vier Jahre bestätigt. Riedler ist u. a. Planungsvorstand des Wirtschaftsforschungsinstituts »EcoAustria« und Mitglied des österreichischen Fiskalrats. Peter Riedler ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Studierende entscheiden sich offenbar sehr kurzfristig, was sie wo studieren wollen.
Peter Riedler
Bei der Ausbildung zum Dolmetscherberuf. Derzeit gehen die Studierendenzahlen erheblich zurück. Das hat mitunter mehrere Gründe. Ein Gedanke der Studierenden, nehme ich an, wird sein: »Klassische Übersetzungen kann ja jeder schon mit dem Handy durchführen.« Das ist für mich ein gutes Beispiel, in welche Richtung es geht. Übersetzung ist nicht gleich Übersetzung! Es geht darum, das Studium so weiterzuentwickeln, dass man die kulturellen Hintergründe erfasst. Der Mehrwert drückt sich schließlich darin aus, was der Mensch in eine Sprache einbringt. Zwar gelingt uns das im neuen Curriculum recht gut. Die großen Studierendenzahlen wie vor 20 Jahren werden wir damit wahrscheinlich nicht erreichen.
Wie wichtig sind Studierendenzahlen für internationale Rankings? Österreichische Universitäten sind meist hinten gelistet. Was sind die Gründe? Wie will die Universität Graz vorrücken?
Bei Rankings geht es schnell in die Defensive. Wenn wir gut abschneiden, betonen wir, wie wichtig das ist. Schneiden wir jedoch schlecht ab, tendieren wir dazu, das als unwichtig abzutun. Dabei spielen Faktoren eine Rolle, die für uns schwer erreichbar sind; denken Sie an das Budget oder die Studierendenzahlen – und in weiten Teilen das Image. Besonders, wenn Namen wie Harvard, MIT oder Cambridge fallen, werden wir überstrahlt. Rankings wie das Shanghai Ranking messen die Anzahl der Nobelpreisträger. In einigen Bereichen schneiden wir jedoch gut ab: Zuletzt im »Times Higher Education Ranking«, in dem verschiedene Fachbereiche verglichen werden – weltweit Platz 200 ist eine gute Leistung. Die meisten Rankings fokussieren sich allerdings auf die Top 3 oder Top 100. Nicht zu vergessen: das Leiden-Ranking. Darin geht es primär um die Zitierung von Publikationen. Eine Zeit lang waren wir sehr erfolgreich und belegten bei den 750 bestgereihten Universitäten den 150 Platz; im europäischen Vergleich landeten wir auf Platz 65, und in Österreich waren wir sogar auf Platz eins.
Um die Internationalisierung anzusprechen: Gibt es Zielmärkte der Universität Graz, etwa bei den Studierenden, die angeworben werden?
Das größte Potenzial kommt aus Südosteuropa. Unser Image, die geografische Nähe sowie unser deutsch- und englischsprachiges Angebot kommen uns zugute. Interessanterweise entscheiden sich etwa viele Studierende aus Bangladesch für das englischsprachige Computational Social Systems Masterstudium, das wir gemeinsam mit der Technischen Universität Graz durchführen. Das technische
Studium ist im doppelten Sinn interdisziplinär: Es ermöglicht, zwei Themenfelder an zwei Universitäten zu studieren. Man kann aus den Bereichen BWL, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften wählen – stets mit dem Schwerpunkt Informatik. Dennoch: Wirklich steuern, wer bei uns studieren soll, können wir kaum. Studierende entscheiden sich offenbar sehr kurzfristig, was sie wo studieren wollen. Als Universität können zukünftig weiterhin gut sichtbar sein und den Forschungsnachwuchs aktiv über Messen, Veranstaltungen und Forschungsaufenthalte ansprechen.
Welche politischen Maßnahmen würden Sie sich wünschen, um die Hochschullandschaft in Österreich zukunftsfähiger zu gestalten?
Angesichts der Universitätslandschaft müssen Bildungsinstitutionen einem klaren, langfristigen und nachhaltigen Auftrag folgen, den man nicht mit zusätzlicher Konkurrez, wie weiteren Bildungsangeboten und Institutionen angreifen sollte. Ich wäre froh, wenn unsere Rolle im Bildungssystem als wichtige Nahtstelle zwischen Forschung und Lehre mehr Wertschätzung erfährt: Nicht zuletzt sind die topausgebildeten Absolventen der Grazer Universitäten wirtschaftlich und politisch ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Graz – im In- und Ausland.
Wie kann man sich den Wissenstransfer ihrer Forschungsergebnisse in die Wirtschaft vorstellen?
Die Universität Graz ist derzeit in Summe an einem Christian-Doppler-Labor, einem Ludwig-Boltzmann-Institut und als Gesellschafterin an fünf Comet-Kompetenzzentren beteiligt. Letztere sind eine wichtige Verbindungsstelle für den anwendungsorientierten Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft. Neben diesen Beteiligungen investierten wir 2012 mehr als 12 Millionen Euro in unseren Unicorn Startup & Innovation Hub: Seither konnten wir zahlreiche universitäre Startups und Spinoffs mit Infrastruktur auf 4.000 Quadratmeter unterstützen sowie mit Innovationprojekten und regelmäßigen Events. Außerdem erhalten sie Zugang zu unserem Netzwerk an Unternehmen am Standort und darüber hinaus, um potenzielle Investoren zu erreichen. Ich traue mich zu sagen, dass wir als Allgemeine Universität im österreichischen Vergleich bei Start-ups und Ausgründungen ganz vorne mitspielen: Mit »Innophore« und »Longevity Labs« haben wir zwei Beispiele erfolgreiche Unternehmen aus dem Umfeld der Universität Graz. Für uns als Universität und für Graz als Forschungs- und Technologiestandort, ist das ein Gewinn.
Herr Riedler, vielen Dank für das Gespräch.

Dürfen (Teilzeit-)Beschäftigte – aus welchem Grund auch immer – zeitgleich einem weiteren (Teilzeit-)Job nachgehen? Oftmals finden sich Konkurrenzverbote oder Nebenbeschäftigungsverbote in Arbeitsverträgen, die regeln, ob eine Nebenbeschäftigung während eines aufrechten Dienstverhältnisses erlaubt ist oder nicht. Mittlerweile seit März 2024 haben Arbeitnehmer ein gesetzliches Recht auf Mehrfachbeschäftigung. Das bedeutet, sie dürfen Arbeitsverhältnisse auch mit anderen Arbeitgebern eingehen. Allfällige gegenteilige Vereinbarungen in bestehenden Arbeitsverträgen sind daher grundsätzlich ungültig. Davon zu unterscheiden und weiterhin gültig sind aber nach wie vor Vereinbarungen, wonach beabsichtigte Nebenbeschäftigungen vorab zu melden sind.
Der Arbeitgeber kann im Einzelfall die Unterlassung der weiteren Beschäftigung verlangen (gegebenenfalls einklagen), wenn sie mit Arbeitszeitbestimmungen nicht vereinbar – zusammengerechnet mehr als 12 Arbeitsstunden pro Tag oder mehr als 60 Arbeitsstunden pro Woche – oder der Verwendung im bestehenden Arbeitsverhältnis abträglich wäre. Was zum Beispiel bei Interessenkonflikten, möglicher Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen oder Konkurrenz im selben Gewerbe der Fall sein könnte. Das Recht auf Mehrfachbeschäftigung betrifft nur echte Arbeitsverhältnisse. Nach wie vor kann sich der Arbeitgeber daher die Zustimmung zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit wirksam vorbehalten.
Österreichs Wirtschaft schrumpfte 2024 um 1,2 Prozent, nach dem Rückgang von 2023 von minus 1 Prozent ist das ein weiterer Dämpfer. Auch die WIFO-Unternehmensumfragen deuten auf keinen baldigen Aufschwung hin. Die Industrieproduktion ging weiter zurück, und die Erwartungen bleiben gedämpft. Zumindest die Bauwirtschaft dürfte sich auf niedrigem Niveau vorerst stabilisiert haben. Zuwächse gibt es im Tourismus und im Handel.
In den USA wächst die Wirtschaft weiterhin robust, aber die Unsicherheit nahm durch wirtschaftspolitische Entscheidungen der neuen Regierung zu. Das BIP wuchs im IV. Quartal 2024 um 0,6 %. Die Inflation stieg im Januar 2025 auf 3,0 %, was die Konsumlaune der privaten Haushalte bremst.
Die schwache Konjunktur im Euro-Raum belastet auch die österreichische Industrie. Obwohl die Produktion seit Anfang 2023 rückläufig ist, beschleunigte sich der Abwärtstrend Ende 2024. Unternehmensumfragen deuten auf eine Verlangsamung des Rückgangs in den kommenden Monaten hin. Die Zolldrohung der USA verschärft die Situation zusätzlich.
Im Bauwesen hingegen dürfte die Talsohle erreicht sein. Mehr Hypothekarkredite und ein günstigeres Zinsumfeld verbessern die Bedingungen für Bauinvestitionen. Auch die Konsumnachfrage stabilisierte sich im IV. Quartal 2024 und nahm im 2. Halbjahr wieder zu. Die Neuzulassungen von Pkw stiegen ebenfalls kräftig. Das Verbrauchervertrauen bleibt jedoch schwach, belastet durch Ängste vor Arbeitsplatzverlusten und Unternehmensinsolvenzen.
Der heimische Tourismus floriert weiterhin. Nach einem Nächtigungsrekord im Sommer 2024 wird auch für die Wintersaison ein neuer Höchststand erwartet. Zwar kann der Tourismus den Produktionsausfall in der Industrie nicht ausgleichen, aber er dämpft den wirtschaftlichen Abschwung.
Die Inflationsrate stieg Anfang 2025 auf 3,2 %, bedingt durch das Auslaufen der Strompreisbremse, höhere Brennstoffpreise und den schwachen Euro. Im Februar 2025 erreichte sie 3,3 %.
Trotz der wirtschaftlichen Flaute zeigt sich der Arbeitsmarkt relativ robust. Die Arbeitslosenquote stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr, stagnierte jedoch in den letzten Monaten. Laut einer Schätzung des BMAW war die Zahl der unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse im Februar 2025 höher als im Vormonat, jedoch langsamer gewachsen als zu Jahresbeginn.

VON JOHANNES TANDL
Nach dem Ausscheiden von Barbara Eibinger-Miedl – sie wurde Staatssekretärin im Finanzministerium – wurde vor wenigen Tagen Willibald Ehrenhöfer als neuer Wirtschafts- und Finanzlandesrat in der Landesregierung angelobt. Er übernimmt auch die Agenden Arbeit sowie Wissenschaft und Forschung.
Die überraschende Bestellung Ehrenhöfers ging auf eine Initiative der neuen ÖVP-Chefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom zurück. Ehrenhöfer war zuletzt Geschäftsführer des Forstbetriebs von Franz Mayr-Melnhof-Saurau. Für Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom bringt der Quereinsteiger die nötige Expertise und Kompetenz mit, um das steirische Regierungsteam zu verstärken. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen sei seine Erfahrung in der Führung eines großen Unternehmens von unschätzbarem Wert. Ehrenhöfer sei vernetzt und kenne die Herausforderungen seines Ressorts. Ehrenhöfer betonte, dass die Steiermark vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehe, das Land aber trotzdem den Anspruch, international vorne mitzumischen, aufrechterhalten müsse. „Wir müssen unser Wissen und unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, um den Forschungs- und Technologiestandort zu stärken. Die Arbeit ist ein zentraler gesellschaftlicher Wert und ich
werde sicherstellen, dass unser Budget stets effizient eingesetzt wird. Dabei ist es wichtig, klare Prioritäten zu setzen.“
Er betonte auch, dass die Steiermark sowohl eine solide Grundlage als auch die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, brauche. „Mit Kompromissen und viel Engagement werden wir die Steiermark als lebenswerten Wirtschafts- und Arbeitsstandort weiter ausbauen.“ �
Willibald Ehrenhöfer ist 53 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Edelsbach bei Feldbach. Er ist verheiratet und Vater dreier Söhne. Nach der Matura an der HTL Weiz studierte er Forst- und Holzwirtschaft an der Universität für Bodenkultur. Er war von 2002 bis 2004 Forstreferent in der Steirischen Landwirtschaftskammer und leitete seit 2012 für Franz Mayr-Melnhof-Saurau den größten Forstbetrieb Österreichs.

Willibald Ehrenhöfer ist neuer Wirtschafts-, Finanz-, und Wissenschaftslandesrat. Der Quereinsteiger war Chef des größten privaten österreichischen Forstbetriebs und kommt aus dem Netzwerk von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom.

Innungsmeister Michael Stvarnik (m.) freut sich, dass seine Innung von Rudolf Pichler, GF der Bureau Veritas Austria GmbH (2.v.r), im Beisein von WKO-Präs. Josef Herk (2.v.l.) und Innungs-GF Klaus Gallob (l.) sowie Referent Johannes Lackner (r.) als erste ISO-zertifizierte Innung des Landes ausgezeichnet wurde.
Nach mehr als einjähriger Vorbereitungszeit ist die steirische Landesinnung Bau die erste Landesinnung Österreichs, die nach ISO 9001 zertifiziert ist. Das Qualitätsmanagement-System ist Ende Februar 2025 in Kraft getreten.
Damit stellt die Landesinnung Bau sicher, dass die Interessenvertretung für die Mitgliedsbetriebe auf höchstem Niveau erbracht wird und die Kooperation mit den Behörden und Institutionen effizient und transparent erfolgt.
Aufgaben effizienter abwickeln Von Serviceleistungen bis zu den Abläufen der Ausschuss- und Vorstandssitzungen: Die Tätigkeiten, Prozesse und Abläufe sind in einem knapp 50-seitigen Managementhandbuch dokumentiert, das für alle Mitarbeiter verbindlich anzuwenden ist. „Die Zertifizierung ist ein Meilenstein für unsere Innung und wird wesentlich dazu beitragen, unsere vielfältigen Aufgaben noch besser abzuwickeln“, so Landesinnungsmeister Michael Stvarnik. „Damit unterstreichen wir unseren Qualitätsanspruch und sichern den sparsamen und effizienten Umgang mit den Beiträgen unserer Mitgliedsbetriebe. Die steirische Bauinnung war schon immer Vorreiter in den Agenden der Bauwirtschaft und wird dies auch weiterhin sein. Die Zertifizierung bringt dieses Selbstverständnis deutlich sichtbar zum Ausdruck“, so Stvarnik.
Qualitätsmanagement in der Praxis
Das entscheidende Audit am 24. Februar 2025 hat der Innung ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Positiv hervorgehoben wurden der aktive Zugang, die Orientierung an der gelebten Praxis der Anforderungen und Ziele der Landesinnung Bau sowie die Einbindung aller Mitarbeiter:innen in den Aufbau und in die Umsetzung. „Die Zertifizierung gibt dem Team der Landesinnung Bau eine konkrete, klar dokumentierte Orientierung im Umgang mit den zahlreichen Aufgabenstellungen, die mit dem Innungsmanagement verbunden sind“, so Innungs-GF Klaus Gallob. �
Mit 59,1 Prozent der Stimmen stellt der Wirtschaftsbund (WB) weiterhin die mit Abstand stärkste Fraktion in der WKO Steiermark. Auf Platz zwei folgt die Freiheitliche Wirtschaft mit 16,6 Prozent, gefolgt vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) mit 9,8 Prozent, den UNOS mit 7,2 Prozent und der Grünen Wirtschaft mit 7,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 27,6 Prozent.
WB hält Mehrheit bei niedriger Wahlbeteiligung 30.155 Stimmen wurden bei der steirischen Wirtschaftskammerwahl 2025 abgegeben, das entspricht bei 109.307 Wahlrechten einer Wahlbeteiligung von 27,6 Prozent. In absoluten Zahlen ist das ein Minus von 6.464 Stimmen gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2020, wo die Beteiligung – aufgrund der geringeren Zahl von Mitgliedern − 38 Prozent betrug. Bei der heute erfolgten Auszählung entfielen 17.425 Stimmen auf den Wirtschaftsbund, der damit seine Mehrheit mit 59,1 Prozent klar verteidigt. Im Vergleich zur letzten Wahl stellt das ein Minus von 8.101 Stimmen dar. Trotzdem ist die Fraktion des amtierenden WKO-Steiermark-Präsidenten, Josef Herk, mit 687 von 1.116 möglichen Gesamtmandaten weiterhin die mit Abstand stärkste Fraktion. Die zweitplatzierte Freiheitliche Wirtschaft konnte 4.905 Stimmen bzw. 16,6 Prozent auf sich vereinen, ein Plus von 2.367 Stimmen gegenüber 2020. Leicht Stimmen verloren hat der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband, dieser kommt auf 2.897 Stimmen bzw. 9,8 Prozent. Auf Platz vier folgen die UNOS, sie konnten 2.124 Stimmen bzw. 7,2 Prozent erreichen. Die Grüne Wirtschaft erzielte 2.106 Stimmen (7,1 Prozent), sonstige Namenslisten kamen auf 42 Stimmen. �

Bereits seit Anfang 2023 befindet sich die österreichische Wirtschaftsleistung im Abschwung. Rückläufige Investitionen und Exporte, gepaart mit einem stagnierenden Konsum, prägten die vergangenen beiden Jahre – 2025 dürfte das dritte Jahr in Folge werden. Ein risikobewusstes Geschäftsmodell mit stabiler Rücklagen- und Eigenkapitalsituation, in Kombination mit einer breit aufgestellten Strategie, erlaubt es der Hypo Vorarlberg, selbst in der aktuell herausfordernden Situation als starker und verlässlicher Partner für ihre Kundinnen und Kunden zu agieren – auch am Standort Graz.
Eine steirische Erfolgsgeschichte Vor mittlerweile über 20 Jahren hat die Hypo Vorarlberg den Schritt nach Graz gewagt und sich mit ihrer Filiale am Joanneumring erfolgreich etabliert. Heute trägt das 20-köpfige Grazer Team rund um Regionaldirektor Ernst Albegger einen beachtlichen Teil zum Gesamterfolg der Hypo Vorarlberg bei. Mit einer Bündelung der Stärken in den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung sowie Immobilien- und Unternehmensfinanzierung steht bei der Hypo Vorarlberg in Graz die Qualität der persönlichen Beratung mit ganzheitlichen Lösungen für das private und geschäftliche Gesamtportfolio ihrer Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.
Nachhaltiges Wirtschaften im Fokus Dank ihres achtsamen Wachstums und ihrer unternehmerischen Ambitionen zählt die Hypo Vorarlberg heute zu den erfolgreichsten Regionalbanken Österreichs. „Die Zahlen – allen voran das Zins- und Provisionsergebnis als wichtigste Ertragsbasis – machen darüber hinaus deutlich, dass die Hypo Vorarlberg voraussichtlich auch für das Geschäftsjahr 2024 ein gutes Ergebnis vor Steuern ausweisen wird. Während trotz der eingeleiteten Zinswende der Zinsüber-

schuss auf sehr hohem Niveau nahezu dem Vorjahreswert entspricht, konnte insbesondere der Provisionsertrag im Vorjahresvergleich gesteigert werden“, zeigt sich Ernst Albegger, Regionaldirektor Steiermark der Hypo Vorarlberg in Graz, zuversichtlich.
Operative Herausforderungen
Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, stellen auch die Unternehmenskundinnen und -kunden der Bank vor erhebliche Hürden. „In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass wir unseren Kundinnen und Kunden als starker Partner auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen und ihnen helfen, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern“, ergänzt Daniel Gerhold, Stellvertretender Regionaldirektor der Hypo Vorarlberg in Graz.
Auch die Finanzierung von Immobilien war im vergangenen Jahr durchaus schwierig: Stichwort KIM-V und Zinsniveau. Die in jüngster Vergangenheit gesunkenen Zinsen kommen den Kundinnen und Kunden der Bank jedoch entgegen und es zeichnet sich eine Entspannung ab.
Der Kapitalmarkt blieb von den Herausforderungen der Unternehmerinnen und

Unternehmer sowie Häuslbauer relativ unberührt. Im Jahr 2024 verzeichneten die Aktienmärkte weltweit eine bemerkenswerte Entwicklung. „So erreichte beispielsweise der US-amerikanische Dow Jones ein neues Rekordhoch, was auch die Vermögenswerte der Kundinnen und Kunden der Hypo Vorarlberg entsprechend steigen ließ“, so Gerhard Vollmann, Leiter Private Banking der Hypo Vorarlberg in Graz.
Ausblick
Für das Jahr 2025 erwartet die Hypo Vorarlberg bei weiterhin sinkenden Leitzinsen eine vorsichtige wirtschaftliche Belebung im Marktgebiet und damit einen gewissen Rückenwind für die Unternehmen, was sich in Folge in einer steigenden Investitionstätigkeit zeigen könnte. Bei den Kreditvergaben an Private geht die Bank durch den Wegfall der KIM-Verordnung per Juni 2025 wieder von einer leicht steigenden Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen aus, wobei die Vergaberegeln nach wie vor streng bleiben. Was mit Sicherheit wieder zu einer höheren Nachfrage bei Wohnbaufinanzierungen führen wird, sind die gesunkenen Zinsen. Die ersten Monate des Geschäftsjahres 2025 sind gut verlaufen und das Zins- und Provisionsergebnis trägt weiterhin stark zum Ergebnis der Bank bei.

Wie man sich vor digitalen Bedrohungen schützt, stand im Mittelpunkt der dritten Ausgabe von Digital Mornings, die am 26. Februar im Frontend by Axtesys stattfand. Fast 40 interessierte Teilnehmer folgten der Einladung von axtesys und M.I.T e-Solutions. Die Veranstaltung bot einen spannenden Einblick in die Welt der Cybersicherheit, gefolgt von einem entspannten Vernetzungsfrühstück. Im Mittelpunkt stand das Expertengespräch mit Raschin Tavakoli (Nullfaktor), Lorenz Moser und Martin Leitgeb von Axtesys. „IT-Sicherheit ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Es geht darum, Risiken frühzeitig zu erkennen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen“, betonte Tavakoli in seinem Vortrag.

präsentiert
Seit fast 20 Jahren macht das Rockarchiv Steiermark die Geschichte steirischer Rock- und Popmusik online zugänglich. Ab sofort präsentiert es sich in neuem, zeitgemäßem Erscheinungsbild. Begleitend dazu erscheint der Ausstellungskatalog Pop 1900 – 2000. Am 28. Februar wurde das neue Rockarchiv mit Gästen und viel Musik im Museum für Geschichte gefeiert. Dessen Inhalte haben David Reumüller und Musikikone Johnny Silver präsentiert − und dabei auch in alten Zeiten geschmökert: „1984 wurde dann auf einmal so viel produziert, darunter auch Live Is Life von Opus, Motorboot von KGB oder Willst du eine Banane? von Fezzz. Beim Open-Air-Konzert Opus & Friends 1985 waren dann plötzlich 25.000 Leute in Graz“, so David Reumüller.


Das ORF-Funkhausgelände in Graz St. Peter mit seinem Teich ist ein beliebter Park. Damit Wasserqualität und Gelegegürtel erhalten bleiben, hat der Verein Blühen & Summen, unterstützt von Pro Mente Steiermark, Pflegemaßnahmen durchgeführt. Um eine drohende Verlandung zu verhindern, sind Teile des Schilfgürtels auf mechanische Art und Weise umweltschonend dezimiert worden. Für Entsorgung und Kompostierung von mehr als 15 Kubikmeter organischem Material sorgte Saubermacher, der seine Tochterfirma Servus damit beauftragte. Segen, Binsen, Rohrkolben oder Iris säumen den Uferbereich. Amphibien, Reptilien, Vögel und weitere Teichbewohner finden hier ihren Lebensraum. Auch blühendes Leben im und außerhalb des Teiches kann nun wieder einziehen.

Im Rahmen eines Hearings hat der Aufsichtsrat der Energie Graz Josef Landschützer einstimmig als neuen GF des Unternehmens empfohlen. Die Generalversammlung hat ihn mit dieser Funktion ab 1. April 2025 betraut. Landschützer tritt damit die Nachfolge von Werner Ressi an, der in den Vorstand der Energie Steiermark wechselt. Der gebürtige Admonter sieht in der Transformation der Energiewirtschaft und der Ökologisierung der Fernwärme zentrale Herausforderungen für die kommenden Jahre. Landschützer führt das Energieunternehmen, das im Eigentum der Holding Graz und der Energie Steiermark steht, künftig mit Boris Papousek und wird speziell seine Erfahrung aus dem Vertrieb und der Ökologisierung der Wärmeversorgung einbringen.
Fotos
In der Steiermark startet am 22. März 2025 zum 17. Mal die größte Umweltaktion des Bundeslandes: „Der große steirische Frühjahrsputz“. Bis zum 10. Mai sind Bewohner, Vereine, Schulen und Gemeinden aufgerufen, achtlos weggeworfenen Müll aus der Natur zu entfernen.
Vergangenes Jahr beteiligten sich über 73.000 Menschen, die rund 177.000 kg Abfall sammelten. Auch 2025 wird eine breite Beteiligung erwartet: Bereits 39.812 Personen aus 220 Gemeinden haben sich angemeldet. Ziel der Aktion ist nicht nur das Sammeln von achtlos entsorgtem Müll, sondern auch die Bewusstseinsbildung für die Themen Müllvermeidung, Recycling und Umweltschutz. Die Initiative wird vom Lebensressort, der WKO, den Abfallwirtschaftsverbänden und dem ORF Steiermark unterstützt.
Ein wachsendes Problem: Littering Leider wird immer noch viel Müll einfach in der Natur entsorgt: Plastikflaschen, Dosen oder sogar Sperrmüll wie Autoreifen und Haushaltsgeräte verschmutzen öffentliche Flächen und gefährden die Umwelt. „Littering ist nicht nur eine optische Beeinträchtigung, sondern verursacht hohe Kosten und belastet Natur, Tiere und Menschen erheblich“, betont Nachhaltigkeitslandesrätin Simone Schmiedtbauer. Daher setzt die Initiative neben der Müllsammlung auch auf Prävention: Schulprojekte und mediale Kampagnen sollen Kinder und Erwachsene für einen bewussteren Umgang mit Abfällen sensibilisieren.
Mitmachen und gewinnen
Besonders für Schulen und Kindergärten gibt es zahlreiche Anreize zur Teilnahme. Es winken auch attraktive Preise: Unter allen Teilnehmern werden Hotelaufenthalte, Ballonfahrten und Fahrräder verlost. Zudem gibt es Sonderpreise für kreative Volksschulprojekte, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. Auch die sozialen Medien spielen eine Rolle: Auf der Facebook-Seite des Frühjahrsputzes können Teilnehmer ihre Erfahrungen, Fotos und Videos teilen. Die Aktion endet mit einem feierlichen Abschluss am 10. Mai im Ressourcenpark Sulmtal-Koralm.

(v.l.) ORF-Landesdirektor Gerhard Koch, LRin Simone Schmiedtbauer, Referatsleiterin Ingrid Winter, WKO-Fachgruppen-Obfrau Daniela Müller-Mezin und Abfall-Dachverband-GF Christian

Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit und Kultur.
Die Rektorin der Med Uni Graz sagte kürzlich: „Wir können nicht jedes kleine Spital erhalten.“ Ist das nicht auch Ihr Standpunkt? Egal wo jemand lebt, die Gesundheitsversorgung darf keinen Unterschied machen! Damit die Steirer vom medizinischen Fortschritt profitieren, braucht es Spezialisierungen. Im LKH Hochsteiermark sind etwa in Leoben alle Fächer gebündelt, die zur Behandlung komplexer Notfälle notwendig sind. Im Gegenzug bauen wir Bruck zu einem Herz-Lungen-Zentrum aus und errichten eine neue Psychiatrie.
Warum fordern Sie von der Bundesregierung fixe Medizinstudienplätze für die Steiermark?
Wir brauchen nicht nur mehr Pflegepersonal, sondern auch mehr Ärzte! Daher fordere ich von der Bundesregierung 20 Medizinstudienplätze, die Studierenden vorbehalten sein sollen, die sich verpflichten, nach dem Studium im steirischen Gesundheitswesen zu arbeiten.
Die Kulturszene spricht von Umfärbung und Kürzungen. Was ist an diesen Vorwürfen dran?
Ich bekenne mich zur Vielfalt und Offenheit in Kunst und Kultur, denn Politik darf niemals die Deutungshoheit über die Inhalte von Kunst und Kultur haben. Die budgetäre Situation ist leider sehr angespannt. Dass Einsparungen unabhängig von parteipolitischen Mehrheitsverhältnissen sind, zeigt sich in Graz: Die Koalition aus Kommunisten, Grünen und SPÖ hat das Kulturbudget um 1,8 Millionen Euro gekürzt. Als Kulturlandesrat werde ich aber um jeden einzelnen Cent für die Kulturschaffenden kämpfen!
Von Peter Sichrovsky

Es geht um die selbstdefinierte Anständigkeit. Auf der Social-Media-Seite »Bluesky« sammelt sich zum Beispiel das anständige Österreich. Nachdem es das unanständige »X«, vormals Twitter, mit der Absicht verlassen hatte, sich mit Anständigkeit zu umgeben, und nicht das durch Musk ins rechte Eck verschobene X-Netzwerk weiter zu unterstützen.
Einer, der sich in der mit Sonnenschein erwärmten Bluesky-Umgebung voller Freude über die neue Anständigkeit äußerte – ehemals »Journalist des Jahres« –, hinterließ seinem mitlesenden Fanclub die euphorische Botschaft, wie die Atmosphäre sich unterscheide von den aggressiven, teils rechtsextremen Kommentaren auf X zu dort auf Bluesky. Es sei so wunderschön hier – so anständig eben – mit all den freundlichen Kommentaren, der begeisterten Zustimmung und gemeinsamen Angriffe gegen gemeinsame Feinde – all das würde die bösartige X-Stimmung aufs Angenehmste ersetzen. Vor lauter Anständigkeit scheint das einst kritische Element der Gesellschaft in die
Endlich eine anständige Regierung
heile Welt der Biedermeier zu flüchten. Jetzt fehlt nur noch der Wandschrank aus Teakholz im Wohnzimmer, davor die Sitzgarnitur, gegenüber die Bücherwand, vollgestopft mit nicht gelesenen Werken, die Wandmalerei ersetzend, das Wochenendhaus im Grünen, die ÖBB-Jahreskarte und das Elektrorad. Das einst progressiv-revolutionäre, jetzt aber nur noch anständig-intellektuelle Segment sehnt sich nach Ruhe, nach Harmonie mit Natur und Mensch, ungestört und unbehelligt von störender Unanständigkeit.
Wir haben sogar eine anständige Regierung. Der FPÖ-Kanzler durch Selbstaufgabe verhindert und die SPÖ in der Koalition, mehr Anständigkeit geht kaum noch. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen zu träumen gewagt. Es wird auch entsprechend gefeiert. Der kurzzeitig unanständige ÖVP-Chef führt jetzt ein anständiges Regierungsteam. Ehemals regierungskritische Journalistinnen und Journalisten loben die neue Regierung, alles sachkundige Fachleute, als hätte eine Gruppe von Nobelpreisträgern entschlossen, sich dem heimischen Wahlvolk zur Verfügung zu stellen.
Man übt sich in Nachsicht. Während das abgebrochene Studium des FPÖ-Chefs, der fehlende akademische Titel des Exkanzlers Kurz von höhnischen Kommentaren begleitet wurde, wird die fehlende Bildung des SPÖ-Vizekanzlers, der nicht einmal die HTL schaffte und wahrscheinlich der erste maturalose Vizekanzler in Österreichs politischer Geschichte ist, großzügig übergangen.
Medien konzentrieren sich mehr und mehr auf die Moral. Der kritisch-intellektuelle Niveaujournalismus verbeißt sich in die einen und verbeugt sich vor den anderen – täglich, wöchentlich wiederholend mit oft austauschbaren Phrasen. Reportagen und Kommentare werden reduziert auf Lob und Tadel. Damit wir Leser, in der Schulbank sitzend, lernen, worüber wir froh sein sollten, dass es nicht passierte, und uns freuen dürfen, dass es geschah. Die tatsachenorientierte Reportage ist Geschichte, viel zu aufwendig. Hintergründe zu recherchieren, dauert
Tage. Ein Kommentar zur Lage der Nation ist in einer Stunde druckreif. Die eigene Meinung ersetzt die Wirklichkeit. Manche Zeitungen, Magazine lesen sich wie zusammengeheftete Leserbriefseiten. Die Ermahnung zur Empörung darf in den belehrenden Beiträgen nicht fehlen. Täglich werden wir an die Schandtaten des US-Präsidenten Trump erinnert, an das undemokratische Verhalten von Orban und an rechtsextreme Elemente in rechtspopulistischen Parteien. Das war’s dann schon. Für Diskriminierung der Frauen in Afghanistan und im Iran, den Kindesmissbrauch durch Ehen mit Minderjährigen, die Ermordung von Christen, Zerstörung von Kirchen, explodierendem Judenhass, Attacken gegen jüdische Einrichtungen (sogar jüdische Altersheime), die brutalen Diktaturen in Nordkorea und Kuba usw. – dafür reicht es nicht. Wer als unanständig erwähnenswert ist, bestimmen wir.
Österreich ist wahrscheinlich das einzige Land in Europa, in dem das kritisch-intellektuelle, gebildete Segment der Bevölkerung vollständig von ausländischen Zeitungen abhängig ist. Ohne Medien wie die NZZ, die SZ, die Welt, die Zeit, die NYT oder die Londoner Times und andere würden wir wie die Bewohner eines entlegenen Alpendorfes leben, in das das Internet noch nicht vorgedrungen ist. n
Sie erreichen den Autor unter peter.sichrovsky@wmedia.at
Das amerikanische Volk murrt. Der Eierpreis explodiert. Der neue US-Präsident hatte billigere Eier versprochen. Die Türkei soll Millionen liefern. Der US-Vizepräsident wird bei einem Konzert im Kennedy Center lautstark ausgebuht. Die Kulturschaffenden fühlen sich nicht wertgeschätzt und angegriffen. Frankreich will die Freiheitsstatue zurück; ein Geschenk an die Amerikaner vor knapp 140 Jahren. Europa scheint den Glauben an die amerikanische Freundschaft verloren zu haben. Ein Gefühl einer tiefen Unruhe beherrscht den Westen. Einige machen sich schon auf die Suche nach neuen Grundlagen für ein Europa in einer veränderten Welt. In Österreich ist man fassungslos. Die Meinungen sind gespalten. Gräben sollen zugeschüttet werden. Der Bundespräsident schlägt im verunsicherten Land einen »typisch österreichischen« Kompromiss vor. »Beim Reden und beim Bier kommen die Leut’ z’samm’«, meinte der neue Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung. Die Regierungsmitglieder verhalten sich beim ersten Interview im ORF im Stil einer neuen politischen Kultur der Nachdenklichkeit, die sogar einen Armin Wolf kurz stutzig machte. Ich, österreichischer Staatsbürger und ein Sohn der Republik Österreich, will mich nicht durch die Ankündigung eines »goldenen Zeitalters« blenden, durch Bitcoins und das Internetportal X nicht verwirren lassen. Es gibt unsere große europäische Geistesgeschichte, mit Athen, Rom und Wien ältere Städte als Las Vegas und San Francisco. Große Gedanken sind auch in den Stücken von Wilhelm Shakespeare und Peter Handke wie in den Filmen von Hollywood zu finden. Unsere Religionen haben dieselben Gründer und ihre Glaubenssätze müssen von uns allen auf ihre Wahrheit und Gültigkeit geprüft werden. Wir teilen dieselben Hoffnungen im alten Europa wie die Menschen im neuen Land der Auswanderer.
Trump und Vance und die Sehnsucht nach einem anderen Leben Man will anders leben und vieles nicht mehr mitmachen. Die Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand und Alltag hat in Amerika dazu geführt, dass derzeit ein Geschäftsmann und ein zum katholischen Glauben konvertierter Landsmann an die Spitze der USA gewählt wurden, die auf die Geschicke der Welt Einfluss nehmen. Was glauben und denken die beiden, deren Vorfahren ja auch einmal Europäer waren? Über Trump glauben die meisten schon alles zu wissen, ihn zu kennen und viele haben über ihn schon ein vernichtendes Urteil gefällt. Man hat vielleicht den Film über ihn gesehen und liest die Kommentare in den Medien. Die europäische politische Elite hat den US-Vizepräsidenten JD Vance durch seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar d. J. kennengelernt. Diese hat den Anwesenden die Sprache verschlagen, er kritisierte vor allem die angeblich in Europa bedrohte Meinungsfreiheit. Aber auch in Blick zurück in die Jahre, in denen das Kind Donald in der Familie Trump aufgewachsen ist, ist aufschlussreich. Dort ist der Pfarrer Norman Vincent Paele (1898–1993) im Hause seiner Eltern gern gesehener Gast gewesen und hat Donald, so wird berichtet, sehr beeindruckt. Paele hat den Bestseller »Die Kraft des positiven Denkens« geschrieben. Diese Lektüre soll als viel gehörter Ratschlag das Jammern beenden. Er hat auch die bemerkenswerte Aussage gemacht: »Ich weiß, dass ich mit Gottes Hilfe sogar Staubsauger verkaufen könnte.« So ein Satz würde einem europäischen Geistlichen wohl kaum über die Lippen kommen. Das passt auch zu dem Satz, der Trump in den Mund gelegt wird: »Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!« Trump hat nach seinem Besuch bei Papst Franziskus in Rom 2017 erklärt, dass er sich vorgenommen hat, zu einem »Präsident des Friedens« zu werden. Er scheint überzeugt zu sein, dass man auch durch »Deals« Waffenruhen herbeiführen kann, dass man sich mit dem Gegner nur über Geschäfte, Ländereien und Bodenschätze einig zu werden brauche. Er hat nach dem Attentatsversuch gegen ihn im Juli 2024 gesagt: »Gott allein hat das Undenkbare verhindert.« So interpretieren viele Anhänger Trumps dessen Überleben nach dem Attentatsversuch als göttliches Zeichen. Auch Präsident Ronald Reagan berief sich nach dem Attentat von 1981 auf Gott. Dieser habe ihm einen »Weckruf« geschickt, wird Reagan zitiert. Wenige Wochen nach dem Anschlag schrieb der kalte Krieger Reagan an den sowjetischen Staatschef Leonid Breschnew über sein Verlangen nach »konstruktivem Dialog«, um den Frieden zu sichern.
Dieser Essay ist der dritte in einer Reihe, in der über den Niedergang und die Wiederauferstehung des Christentums nachgedacht wurde.

Christian Wabl, geboren 1948 in Graz, Studium der Kunst und Lehramt Deutsch an der Universität von Amsterdam sowie Studien in den Sprachwissenschaften, Hebräisch und Philosophie. Er ist Mitbegründer mehrerer Alternativschulen und arbeitete lange bildungspolitisch in der Grünen Akademie Steiermark.
Ein Geschäftsmann, ein Katholik und der amerikanische Glaube an das Gold und an Gott
Die Verbindung von Geschäft und Glauben, eines Geschäftsmannes und eines zum Katholizismus konvertierten Senators, kommt in dem Duo Trump und Vance zum Ausdruck. Die Freiheitsstatue ist nicht mehr das leuchtende Monument, das die aus Europa Verfolgten und Flüchtenden einmal begrüßt hat.
Trump und Vance nennen sich Christen, so wie Millionen Menschen in den USA, Russland, der Ukraine und ganz Europa. J. D. Vance hat, ähnlich wie Donald Trump, ein für amerikanische Verhältnisse ungewöhnliche Beziehung zum Glauben. Er konvertierte 2019 und ließ sich taufen. In einem Interview erklärte er, dass seine Hinwendung zum Katholizismus früher stattgefunden hätte, wenn es da nicht die Krise um sexualisierte Gewalt durch Geistliche gegeben hätte. Im selben Interview verriet Vance auch, er habe als Student eine »wütende Atheisten-Phase« gehabt. Vance ist der erste konvertierte Katholik, der US-Vizepräsident wurde, und er ist sich der Bedeutung dessen auch sehr bewusst. In seinem Buch beschreibt er, wie es dazu kam. Vor seiner Wahl in den Senat im Jahr 2022 war Vance Risikokapitalgeber und Autor des Bestsellers »Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis«. Er schreibt seine Familiengeschichte, sein Aufwachsen in Middletown, Ohio, und über die allgemeinen Probleme, mit denen sich weiße Amerikanerinnen und Amerikaner aus der Arbeiterklasse konfrontiert sehen. Olaf Scholz hat es gelesen und war laut eigener Aussage »zu Tränen gerührt«. Die regierenden politischen, geschäftlichen, moralischen und religiösen Grundsätze, die Weltbilder der erfolgreichen und reichen Geschäftsleute, die jetzt in Washington das Sagen haben, müssen an den christlichen und humanistischen gemessen und mit diesen verglichen werden. Aber auch unsere eigenen Vorstellungen können nicht nur mehr im Stillen aufrecht gehalten werden.
Der Streit um Moral und Geld Immer wieder werden Diskussionen im Kaffeehaus oder am Küchentisch frustriert abgebrochen und es wird erklärt, dass man ohnmächtig sei und all das Reden ohnehin keinen Sinn hätte. Dieser Meinung bin ich nicht. Ich höre mir gern die Argumente und Überzeugungen meiner Mitmenschen an und finde es wichtig und sinnvoll, miteinander eingehend und grundsätzlich zu reden, um gemeinsame Grundlagen zu finden, die die Ohnmacht und Verwirrung beenden helfen. Die Vertreter der EU haben ihre militärische Antwort schon bekanntgegeben. Mir geht es hier nicht um die militärischen oder wirtschaftspolitischen Aspekte. Die Reden und Ankündigungen des Vizepräsidenten JD Vance auf der Sicherheitskonferenz und die von Trump vor dem amerikanischen Kongress haben einen neuen Ton angeschlagen. Viele meiner Nachbarn, Freunde, Freundinnen und Bekannte sind darüber entsetzt und fassungslos. Reden könnte helfen, die Fassung wieder zu finden. Die Politik des Geschäftsmannes Trump und seine Haltung gegenüber dem Staat und der Demokratie, die auf Säulen wie Gewaltentrennung und einer unabhängigen Justiz baut, sowie Europa gegenüber wird als bedrohlich angesehen. Die Verbindung von Geschäft und Glauben, eines Geschäftsmannes und eines zum Katholizismus konvertierten Senators, kommt in dem Duo Trump und Vance zum Ausdruck. Die Freiheitsstatue ist nicht mehr das leuchtende Monument, das die aus Europa Verfolgten und Flüchtenden einmal begrüßt hat. Bei einer der heißen Diskussionen über die gegenwärtigen Kriege wurde eine bekennende Christin gefragt, was Jesus zur Ursache der Kriege sagen würde. Sie antwortete, Christus würde sie auf den Mangel an Mitgefühl zurückführen. Auf die Frage, woher denn dieser Mangel käme, begann sie mit den Worten: »Ich wollte hier in diesem Kreis eigentlich gar nichts sagen. Ich bin ja als gläubige Christin verstummt, weil ich so oft wegen meines Glaubens beleidigt worden bin. Viele Agnostiker, Atheisten und bekennende Liberale werden leicht aggressiv und haben eine kalte Mauer aufgebaut. Sie fühlen sich durch meine Meinung angegriffen, schlagen verbal gleich zu, reagieren gereizt und machen mich Andersdenkende lächerlich. Ich kann kaum über das reden, was mir wertvoll ist.« Was wahr oder falsch, gut oder böse ist, ist so umstritten. Diese Auseinandersetzung beherrscht jede Diskussion zwischen Konservativ und Progressiv, Links und Rechts. Da nicht mehr so leicht auszumachen ist, welche Werte welcher Gruppe zuzuschreiben sind, herrscht Verwirrung. Viele Auseinandersetzungen haben ja religiöse Ursprünge.
Die alte Geschichte des Streits Es sind alte Richtungskämpfe innerhalb des Christentums, die auch zu den Vertreibungen geführt haben. Die Machtkämpfe zwischen Staat und Kirche, die, wie in Frankreich zu einer strengen Trennung von Staat und Kirche geführt haben, setzten sich zwischen den Parteien mit unterschiedlicher Ideologie fort. Der Laizismus hat den Glauben zur reinen Privatsache gemacht. Jetzt kämpft jeder für seinen eigenen Glauben, jeder hat seinen eigenen Gott. Reichwerden wollen und Religion waren im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kein Gegensatz, im Gegenteil. Die Reichen befinden sich im Zustand der Gnade Gottes. Diesen Glauben sah einer der Soziologen, Max Weber, als eine wesentliche Grundlage und Ursache für das Aufkommen des Kapitalismus an. Die katholische Kirche hat die Reichen zur Caritas aufgefordert. Papst Franziskus hat die Ergebnisse und Folgen des Neoliberalismus mit den Worten »Diese Wirtschaft tötet« gegeißelt und seine Auswirkungen beklagt, aber keine Antwort auf die neuen Be-
dingungen geben können. So blieb ihr der moralische Anspruch, das Beten und Bitten. Mit den wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen haben sich die Religionen nicht auseinandergesetzt und den Geschäftsleuten und Börsianern überlassen. Es gibt in den Schriften des Alten Testaments nur einen einzigen Vorschlag, der die Schuldenlast alle sieben Jahre durch Erlass beenden soll. Das Geld war ein Tabu und das Streben nach Geld und Reichtum wurde von der katholischen Kirche geächtet. Meine tiefreligiöse Großtante, die Nonne war, hatte das Wort »Geld« nicht aussprechen können, ohne es zu »Sch****geld« zu erweitern. Im Gegensatz dazu die Protestanten, die Reichtum als eine Gnade und Segen betrachteten. Das hat Amerika geprägt, das hat den Reichen auch in den Augen der Gläubigen Glanz und Anerkennung verschafft. Der Glaube an menschliche und moralische Werte ist auch in den USA Gegenstand der politischen Auseinandersetzung und sind wichtige Gründe, ob man sich als Liberaler oder Erzkonservativer versteht und wie man wählt. Für die Wahlentscheidung ist der Kurs der Aktien, von dem 62 Prozent der Amerikaner abhängen und der Preis der Eier von großer Bedeutung. Es geht nicht nur darum, um Nächstenliebe und Erbarmen zu bitten, wie das Mariann Budde, Bischöfin der Episkopalkirche von Washington, beim traditionellen Gottesdienst nach der Inauguration Donals Trumps tat, oder bei der Gesetzgebung von Abtreibung, Sterbehilfe und Flüchtlingsleid sowie bei der Betreuung und Pflege der Ärmsten der Armen mitzureden. Die Normen und Regeln des täglichen Lebens des Produzierens und Konsumierens müssen auch mit hohen moralischen Grundsätzen rechnen. Preise von Lebensmitteln und beim Wohnen, ein würdiges Leben ermöglichen, damit niemand andauernde Angst vor einem Absturz haben muss, der in den USA besonders hart sein kann. Wie kann ein christlicher Glaubenssatz ein Marktgesetz beeinflussen?
Wie? Die Hoffnung wechselt die Seite? In einer weltweiten Umfrage im Auftrag der Denkfabrik »European Councel on Foreign Relations« herrscht in vielen Ländern angesichts der Rückkehr Trumps ins Weiße Haus die Hoffnung auf ein anderes Leben. Es ist etwas Einschneidendes geschehen: »Die Hoffnung hat die Seiten gewechselt«, schreibt Heinrich Welfing in der Wochenzeitung »Die Zeit«. Und weiter betont er: »Auch deshalb lagen Biden und Harris so daneben, als sie die Präsidentschaftswahl zu einer Abstimmung über die Demokratie stilisierten. Kann sein, dass Trump in kürzester Zeit alle Hoffnungen zunichtemacht. Eher müssten seine Gegner und Kritiker dringend darüber nachdenken, wie sie selbst wieder Hoffnung stiften können.« Hoffnung? Hoffnung auf ein anderes Leben? Hoffnung auf Frieden? War und ist der nicht unsere Sache? Haben wir dafür nicht zu Hunderttausenden demonstriert? Ich bekenne, ich glaube und hoffe, dass Frieden möglich ist. »You may say I am a dreamer but I am not the only one« (John Lennon). Aber wir wollen und sollen nicht nur singen: »All we are saying is give peace a chance!« Der alte Spruch: »Si vis pacem para bellum (»Wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten«) darf nicht mehr gelten. »Wenn du den Frieden willst, arbeite für Gerechtigkeit!«, wie der Theologe Paul Michael Zulehner immer wieder sagt, sollte auch das politische Wirken bestimmen. Um die existenziellen Krisen strukturell meistern zu können, dazu bedarf es eingehender gemeinsamer Nachdenklichkeit darüber, was und wie unsere Träume zu konkreten Gesetzen führen, unsere wertvollsten christlichen und humanistischen Grundsätze politisch umgesetzt werden. Begeisterung für einen europäischen Traum, der die ganze Welt miteinschließt und das »America first!« alt aussehen lässt. Das kann damit beginnen, dass Geschäft und Glaube nicht isoliert betrachtet werden. Die Quellen des Geldes nicht nur die Reichen ausschöpfen und den Grund der Macht des Geldes, an die alle glauben, einfach verstanden wird. Dann muss man nicht nach San Francisco, Las Vegas oder Hollywood reisen, um das Glück für alle zu finden, von dem in der amerikanischen Verfassung (»Pursuit of Happiness«) geschrieben steht.
Amerika wählt. Europa wählt. Demokratisch gewählte Führer erschüttern die Gesellschaft, die Welt und das Bild von ihr. Das würde nicht möglich sein, stünde dieses auf festerem Boden. Ein Europa sollte sich nicht mehr vom Glanz der Traumfabrik Hollywood blenden, sondern von tief verankerten menschlichen Werten leiten lassen. Europa mit seiner großen Tradition, mit den Grundannahmen von Philosophie und Religion kennt und untersucht, mit den alten Werten des Christentums und Humanismus, ist gefragt und aufgerufen, zu einer neuen Form des demokratischen Zusammenlebens und Wirtschaftens zu finden. Ich träume nicht von einem Zeitalter voller Gold oder davon, im mächtigsten und größten Land der Welt zu leben, sondern von einem menschlichen Maß, der Heiligkeit des Lebens und Würde der Menschen. Ich glaube an unsere griechischen, jüdischen, christlichen Wurzeln, und die Menschenrechte und hoffe, dass wir über all das ruhig reden und leben können. n
Ich träume nicht von einem Zeitalter voller Gold oder davon, im mächtigsten und größten Land der Welt zu leben, sondern von einem menschlichen Maß, der Heiligkeit des Lebens und Würde der Menschen.

Heide Pock-Springer wurde am 5. Oktober 1944 in Graz geboren und übernahm vor 56 Jahren von ihrer Tante Maria Pelko deren Hutgeschäft am Grazer Bischofplatz. Sie war eine der letzten Lehrenden an der Berufsschule für Modisten und Hutmacher, heute umfasst ihr Angebot auch klassische Herrenhüte oder Schirmmützen, die als Flatcaps wieder in Mode gekommen sind.
Fazitbegegnung
Volker Schögler trifft auf Heide Pock-Springer
Es war wohl im Jahr 1977, als wir die Grazer Innenstadt durchstreiften, um für unsere Maturaballtombola Sachspenden zu ergattern. Auf dieser »Schnorrertour« fielen wir in jugendlicher Unverschämtheit in jedes Geschäftlokal ein, das nicht geschlossen hatte, um zu nehmen, was wir kriegten. Zwischen halb eins und halb drei war es damals aber eng –eine einheitliche Mittagspause bremste den Lauf der Stadt. Gerade Günthers Mutter hatte ihren Laden in der Bindergasse geöffnet, aber was sollten wir ausgerechnet beim Friseur – für alle Langhaarigen in den Neunzehnsiebzigern ein Feindbild. Nur Weinstuben, wie die vom alten Hammer in der Stempfergasse oder Schnapsbuden, wie die Haring am Mehlplatz hatten geöffnet, aber das interessierte uns nicht. Und die, die es interessierte, erinnern sich heute nicht mehr daran. Da fiel mir zum ersten Mal dieses Geschäft am Bischofplatz 5 auf: klein, einfach und ehrlich präsentierte es in der einzigen Auslage – genauso wie heute noch – nicht mehr und nicht weniger als ausschließlich das, was es anbot: Hüte, genauer Damenhüte. Der Kenner weiß natürlich: Da steckt keine Hutmacherin dahinter (die macht Herrenhüte), sondern eine Modistin (vormals Putzmacherin genannt). Über mehrere Jahrzehnte war das Maria Pelko, und so heißt das Geschäft noch immer »Hutmode Pelko«. Wie die »Süd-Ost-Tagespost« 1987 anläßlich ihres Todes in einem Nachruf vermerkt, gehörte sie zum »Inventar der Grazer Stempfergasse«. Dies kann ihre Nichte Heide Pock-Springer (80) bestätigen, die 1969 das Geschäft übernommen hat und somit heuer das 56. Jahr ihr Gewerbe ausübt: »Meine Tante war ja – zumindest zeitweise –bis 1985 im Geschäft, da war sie schon 92 Jahre alt. Modistin ist so ein wunderbarer Beruf, dass man einfach nicht aufhören kann. Wie man auch bei mir sieht.« Schon als Vierjährige ging Pock-Springer gern zu ihrer Tante in den Laden und stets wurde sie jeweils im Frühjahr und im Herbst mit einem neuen Hut bedacht. So war das damals: Man trug Hut, für jede Garderobe einen eigenen. Ein Hut prägt den Gesamteindruck. Viele konnten sich keinen neuen Mantel
leisten, aber ein neuer oder der alte, von der Modistin umgearbeitete Hut putzte auch die alte Garderobe wieder auf, daher auch der Ausdruck »Putzmacherin«. Heute können sich die meisten einen neuen Mantel leisten und der Hut kam langsam aus der Mode. Die wirtschaftliche Situation des Modistengewerbes hängt stark von Modetrends ab. In den Neunzehnachtzigerjahren entwickelte sich wieder ein »Trend zum Hut«, der einen leichten Umsatzaufschwung nach sich zog. Doch nicht zuletzt Billigimportwaren trugen dazu bei, dass sich kaum jemand mehr für den Modistenberuf entscheidet. Die gut zwei Dutzend Modistinnen in Graz sind ohne Nachfolger in Pension gegangen, die Berufsschule für Modisten und Hutmacher in Graz/St. Peter, wo Heide Pock-Springer noch bis 1995 den Fachunterrricht abgehalten hatte, ist auch schon längst Geschichte.
Interessant und handwerklich anspruchsvoll ist der Beruf allemal. Ausgangs- und Rohmaterial für die Herstellung eines Hutes ist in der Regel der sogenannte Stumpen, der über eine Art Model, den »Kopf« aus Holzgeflecht und Gips, gestülpt und anschließend geformt und bearbeitet wird. Woraus dieser Stumpen besteht, wäre eine Millionenshow-Frage beim Assinger oder beim Jauch wert: So er nicht aus Wollfilz ist, setzt er sich aus Hasen-, Biber- beziehungsweise Nutriahaaren plus Wasser und Dampf zusammen. Hätten Sie’s gewusst? Da das Hutgeschäft ein Saisongeschäft ist, macht Heide Pock-Springer regelmäßig den Laden für einige Wochen dicht und frönt ihrer Leidenschaft, dem Reisen. Jordanien, Namibia, China, sogar Australien hat sie bereits heimgesucht. Am liebsten ist die Mutter dreier erwachsener Kinder aber mit ihrem Partner im Wohnmobil unterwegs.
Ohne Nachfolger wird das Hutgeschäft Pelko das werden, was es seit dem Jahr 1919 geschrieben hat: Geschichte. Und in keiner Maturaballtombola wird je wieder ein ähnlich anmutiger Preis verlost werden, wie 1977 im Schoßbergrestaurant bei den Lichtenfelsern: Sie wissen, was es war, und er war pastelllindgrün. n
ICarola Payer im Gespräch mit der am Karolinischen Institut in Stockholm tätigen Wissenschafterin
Miriam Berreiter
n einer Welt, in der viele ihren Job auch als bloße Notwendigkeit betrachten oder ihre Talente und Fähigkeiten in dem gewählten Berufsbild gar nicht einsetzen können, gibt es Menschen, die ihren Beruf als echte Berufung verstehen und diese auch ausleben wollen. Ein solcher Fall ist Miriam Berreiter, eine Wissenschaftlerin am renommierten Karolinischen Institut ( Karolinska Institutet ) in Stockholm. Ihr beruflicher Weg ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Leidenschaft und Hingabe zu einem erfüllten Berufsleben führen können. Miriam erklärt mit Glitzern in den Augen und einer Körpersprache, die aus jeder Pore Faszination sprießen lässt, wie sie all ihre Eigenschaften, Talente und Fähigkeiten in ihrem Berufsfeld ausleben kann. Miriam Berreiter: »Meine Mutter sagt, ich war immer ein unkompliziertes Kind, super sozial, kompromissbereit und immer in Bewegung. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, was mich definitiv in meiner Bodenständigkeit geprägt hat. Ich war immer neugierig! Ich wollte wissen, wie Dinge funktionieren, warum Mechanismen so sind, wie sie sind, und habe nie aufgehört zu fragen!«

Dr. Carola Payer betreibt in Graz die »Payer und Partner Coaching Company«. Sie ist Businesscoach, Unternehmensberaterin und Autorin. payerundpartner.at
Vom Studium zur Wissenschaft. Ein unerwarteter Weg Miriams Weg in die Wissenschaft war nicht geplant, sondern entwickelte sich mehr durch Zufall. Sie begann nach einer ursprünglich im Sportbereich geplanten Zukunft ihr Studium mit einem klaren Fokus auf Biochemie. Doch der Bereich der evolutionären Genetik, in dem sie heute tätig ist, spielte zunächst keine Rolle in ihren Überlegungen. Miriam Berreiter: »Ich habe mich für PhD-Stellen beworben, die Bioinformatik beinhalteten, weil ich es nicht konnte und es lernen wollte«, erklärt sie. Es war eine wissenschaftliche Ausschreibung, die sie auf eine Stelle am Karolinska-Institut aufmerksam machte – und plötzlich fand sie sich in Stockholm wieder. Ihre Faszination für die Forschung kam nicht von einem einzelnen Erlebnis, sondern entstand durch eine tiefe Neugier und das Bedürfnis, Zusammenhänge zu verstehen. Miriam Berreiter: »Wissenschaft ist eine Mischung aus Detektivarbeit, Kreativität und harter Arbeit«, erklärt sie. Was sie an ihrer Arbeit besonders reizt, ist die Möglichkeit, größere Zusammenhänge zu erkennen und durch ihre Erkenntnisse alltägliche Phänomene zu erklären. Dabei ist ihre Liebe zum Detail ebenso wichtig wie ihre Fähigkeit, das große Ganze zu betrachten.
Job oder Berufung
Die Frage, die sich vielen Menschen in ihrem beruflichen Leben stellt, lautet: Ist das, was ich tue, nur ein Job oder meine wahre Berufung? Miriam unterscheidet klar zwischen den beiden Begriffen: »Ein Job ist etwas, das man macht, um seine Miete oder seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Eine Berufung ist etwas, das man tut, weil es einen erfüllt, weil man daran glaubt und es aus Leidenschaft macht«, sagt sie. Für sie selbst ist ihre Forschung eine wahre Berufung: »Niemand macht einen PhD,
»Wissenschaft ist eine Mischung aus Detektivarbeit, Kreativität und harter Arbeit.«
MIRIAM BERREITER
um reich zu werden. Forschung ist oft mühsam und voller Rückschläge – ohne echte Begeisterung wäre es schwer, langfristig motiviert zu bleiben«, betont sie. Miriam selbst beschreibt sich als jemand, der sich mit Begeisterung in Themen vertiefen kann, die sie interessieren. Ihre analytische Denkweise, ihre Neugier und ihre Ausdauer treiben sie in ihrer Forschung an. Diese Eigenschaften sind essenziell, um in einem Beruf wirklich Erfolg zu haben und vor allem langfristig motiviert zu bleiben. »Ich kann mich komplett in ein Thema reinfuchsen – wenn mich etwas interessiert, vergesse ich Zeit und Raum«, beschreibt sie ihre Arbeitsweise. Diese Hingabe ist ein Schlüsselmerkmal von Menschen, die ihre Arbeit als Berufung betrachten. Vorbilder waren für Miriam ihr Professor für Organische Chemie. Miriam Berreiter: »Er war ein riesiges Vorbild. Seine Begeisterung für sein Fach war einfach ansteckend, und man hat ihm einfach abgekauft, dass er liebt, was er macht.« Weiters gibt es unter den Vorbildern noch einen Künstler aus Hamburg, der eigentlich Jura studiert und sogar praktiziert hat, dann aber alles für die Malerei aufgegeben hat. Miriam Berreiter: »Ich finde es super motivierend und faszinierend, wenn jemand aus seiner Komfortzone heraustritt und macht, was er liebt, weil er an sich glaubt.«

Die Bedeutung der Berufung für ein erfülltes Leben Warum ist es aus Miriams Sicht so wichtig, dass man seine Arbeit als Berufung versteht? Die Antwort darauf ist einfach: Leidenschaft für das, was man tut, ist der Motor für ein erfülltes Berufsleben. »Freiheit ist für mich ein großes Thema. Die Freiheit, das zu tun, was mich wirklich interessiert, neue Dinge zu lernen und mich weiterzuentwickeln«, erklärt sie. Diese Freiheit, die sie in ihrer Arbeit als Wissenschaftlerin erlebt, ist etwas, das sie als essenziell für ihr Wohlbefinden empfindet. Nur wer mit Begeisterung und Überzeugung bei der Sache ist, kann auf lange Sicht erfolgreich sein und dabei auch persönliche Erfüllung finden. Miriam hebt hervor, dass es für die Forschung, aber auch für viele andere Berufe entscheidend ist, Neugier und Ausdauer mitzubringen. »Kritisches Denken und Teamfähigkeit sind ebenso wichtig wie die Fähigkeit, Zusammenhänge schnell zu erfassen«, erklärt sie. Ihre Arbeit im internationalen Kontext, insbesondere am Karolinska-Institut, erfordert häufig die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachgruppen. Diese interdisziplinäre Herangehensweise ermöglicht es, den eigenen Horizont ständig zu erweitern und neue Perspektiven zu gewinnen.
Berufung zur Wissenschaft. Welche Eigenschaften es braucht Wenn es darum geht, welche Eigenschaften jemand mitbringen sollte, der eine Karriere in der Wissenschaft anstrebt, nennt Miriam vor allem zwei Aspekte: Neugier und Durchhaltevermögen. Ohne Neugier geht es in der Forschung nicht weiter, denn nur wer die Frage stellt, warum etwas passiert, kann die Mechanismen dahinter verstehen. Doch genauso wichtig ist das Durchhaltevermögen, da die Wissenschaft oft mit Rückschlägen und Misserfolgen konfrontiert ist. »Frustrationstoleranz ist entscheidend, weil nicht immer alles auf Anhieb funktioniert«, sagt sie. Durchhaltevermögen allein reicht jedoch nicht aus. Es erfordert auch die Fähigkeit, sich in neue und manchmal komplexe Themen einzuarbeiten und dabei sowohl pragmatisch als auch kreativ zu bleiben. Miriam beschreibt sich als jemanden, der sowohl analytisch denken kann als auch eine große Begeisterung für kreative Lösungen mitbringt. Diese Balance ist für die Forschung genauso wichtig wie die Fähigkeit zur Teamarbeit, die in der heutigen Wissenschaft unerlässlich ist.
Der Blick in die Zukunft Miriam bleibt offen für die Zukunft. »Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was in fünf oder zehn Jahren kommt. Ich möchte meinen PhD fertigstellen und gute Forschung veröffentlichen – aber was danach kommt, lasse ich offen«, sagt sie. Diese Flexibilität ist für sie wichtig, um weiterhin neue Möglichkeiten zu erkunden und sich weiterzuentwickeln. »Ich halte mir alle Türen offen und wäre auch offen, mal den Kontinent zu wechseln«, fügt sie hinzu. Die Geschichte von Miriam zeigt, dass es sich lohnt, die eigene Leidenschaft zu finden und der Arbeit mit Hingabe nachzugehen – so entsteht eine Karriere, die weit über das bloße Geldverdienen hinausgeht. Sie lebt den Traum vieler: Eine Arbeit zu finden, die einen erfüllt, die einen fordert und die man aus tiefster Überzeugung tut. Daneben achtet sie aber auch noch genug Zeit für sich selbst, für Hobbys zu haben. Das Gefühl, in einem starren System festzustecken, würde ihr Bewegungsdrang nicht aushalten! n
Die Wahlreden waren meist aus den untersten Rhetorikschubladln und das Deutsch bei weitem nicht auf Maturaniveau



Liebe Steirer und Innen! Es grüßt euch herzlichst Sepp Oberdengler zu seiner aktuellen Rundschau im Fazit. Überall in der Steiermork, außer Graz, sind in den Gemeinden die politischen Messer g’wetzt worden und die Hackln ganz tiaf g’flogen. Es wurde, wie es Tradition ist, ganz tief in den Mistkübeln der Vernaderung gestierlt und manch Gemeinheit zu Tage befördert, auf der der eine oder andere Kandidat ausg’rutscht ist. Politik, Business as usual, wie wir Steirer sag’n.
Es wor eine Sponnung im Lond wie beim Derby Sturm gegen den GAK. Wer wird g’winnen? Werden die Schwarzen und Roten die Schützengräben halten oder die Blauen das Ruder, nach EU, Nationalrats- und Landtagswahl auch in den Gemeinden herumreißen? Es ging um alles, vor allem um uns, hat ma g’lesen. Um uns! Diesmal hoben wir a Glaserl Honig, Schnopskarten, longe, dicke Zündhölz’ln, Feuerzeuge oder Leinensackerln in verschiedensten Farben als Wahlgeschenke kriagt. Die teils KI-generierten Wohlbroschüren homa a studiert. Jeder hat meist dos Gleiche g’schrieb’n, nur irgendwie onderst, und viele neue G’sichter haben uns angrinst. Die Wahlreden waren meist aus den untersten Rhetorikschubladln und das Deutsch bei weitem nicht auf Level B2, wie neuerdings von den Migranten gefordert, also Maturaniveau. Sondern grod noch Level A1 oder A2. Laut dieser neuen Vurschrift, wos Migraten für die Einbürgerung als Österreicher können müssn, müssten 90 Prozent von uns Deutschnachhilfeunterricht kriegen, um Österreicher bleiben zu dürfen. Der betriebene Wahlaufwond jedenfalls wor enorm und hot sicha ah Schweinegöld aus der Parteienförderung, also unserm Steuergöld, kost.
Aber mia hom’s ja!
Mir föhlt dos Frühstückssackerl der Rot’n am Sonntag vor der Wahl, hat der olte Lippenbauer enttäuscht im Wirtshaus g’sagt, zwei Semmerln, Butter und Marmelad, gratis, das war wos Pipifeines, aber diesmol: Nix. G’wöhlt hob i sie eh nie, locht er, aber die frischen Semmerln, mhm.
Erinnerts euch noch an die kleine Floschn Kernöl vom neuen schwarzen Bürgermeisterkandidaten, bei seiner erschten Wahl, locht der Karli. Aber seit er haushoch g’wonnen hat, gibts nur noch dicke, longe, grüne Zündhölzln. Na, na, heuer gibt’s von ihm sogar an Honig, sagt der Lippnbauer, weil es für ihn wieda um wos geht. I wöhl immer den Gleichen, sagt da Karli. Gemeinderatswohln san Persönlichkeitswohln, das haben meine Eltern schon imma g’sagt. Ein so ein Blödsinn, schimpft der Ferdl dazwischen, der blaue Tsunami wird über Euch und alles drüber rauschn, da werds ihr die Augen aufreißen!
Loss die net auslochn, sagt der Lippenbauer heimtückisch grinsend, mei Vota wor rot und die Mutta schwarz. Bis auf einige Kommunisten, die ausg’storben san, und die poar Grünen gibt es bei uns kaum wos Gscheits. Seit 1956 gibt es die Freiheitliche Partei Österreichs, brüllt nun der blaue Ferdl und wir werden euch jetzt auch in da Gemeinde die Wadl firi richten, Punkt um. Wir sind die Nummer 1 in Österreich und sonst niemand! Er springt auf und geht.
Alle lachen und der Lippenbauer prostet ihm hinterher.
Was hat er denn, fragt der Karli. Unsicha is er halt, sagt der Lippenbauer und grinst, unsicher san sie olle trotz ihrer Siege, seit ihr Gott-Oberster kurz vorm Zül den Schwonz einzogn hot. Liebe Steirer und Innen, mit diesem Auszug eines Wirtshausgesprächs kurz vor der Wahl, sag i Pfiat Gott.
Es heißt, Volkes Mund tut Wahrheit kund, aber ich halt mich da raus. Als ehemaliger Vizebürgermeister hat man mich aus dem Gemeinderat gemobbt und seitdem misch ich mich nicht mehr ein, sondern beobachte nur noch. Ich hoffe, ihr hobts so g’wöhlt, wie ihr wählen wolltets, denn das Volk verdient immer die Politiker, die es kriagt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Euer Sepp Oberdengler.
PS. Aufpassen! Der Teif’l schloft net!
Wir möchten uns bei allen Sponsoren und Partnern für die Unterstützung unserer Geburtstagsfeier herzlich bedanken! Wir freuen uns, dank Ihrer Mithilfe einen gemütlichen Abend mit unseren Kunden und Freunden feiern und auf 21 erfolgreiche, gemeinsame Jahre zurückblicken zu können. Auf viele weitere Fazit-Feiern!
Ein herzliches „Dankeschön“ vom gesamten Fazitteam!












Landesprämierung



Natursäfte: Traubensaft rot







Genuss lässt besondere Momente entstehen

Das Leben steckt voller Gelegenheiten, um mit besonderem Biergenuss anzustoßen. Jahr für Jahr überzeugt das Reininghaus Jahrgangspils mit den individuellen Aromen des Leutschacher Jahrgangshopfens. So einmalig wie der Anlass. So einzigartig wie der Moment!


Landessieger
Landesprämierung
Natursäfte: Traubensaft rot


Ein Gastkommentar von Ernst Brandl

Mann traut es sich so kurz nach dem Weltfrauentag ja fast nicht auszusprechen. Das Urteil der Feministinnen über unsere deutsche Muttersprache, dass nämlich Frauen im Deutschen nur »mitgemeint« seien, und Deutsch eine »männlich« konstruierte Sprache ist, in der Frauen »unsichtbar« sind, ist ein krasses Fehlurteil.Wenn man schon den Unterschied zwischen grammatikalischen und biologischen Geschlecht negieren will, so wie es offenbar Feministinnen tun, so sollte »frau« mal im Duden nachzählen. Die deutsche Sprache ist nämlich (grammatikalisch) weiblich!
45 Prozent der Hauptwörter sind im Deutschen weiblich, nur knapp 33 Prozent verlangen einen männlichen Artikel.
Auch, dass man bei Begriffen wie etwa Bürger, Wähler oder Dummkopf vorrangig an Männer denkt, ist nicht erwiesen. Und, dass »Binnen-I«, Gender-Unterstrich und Genderstern zur »Geschlechtergerechtigkeit« beitragen, ja gar patriarchalische Gesellschaftsstrukturen auflösen, das glauben nur stramme und Genderei-Sprachaktivist*innen. Kurzum: In Sachen deutscher
Wer auf korrekte
Muttersprache pocht, muss kein rechter Macho sein
Sprache ist die feministische Sprachwissenschaft leider auf einen Holzweg. Dass die Genderei die deutsche Sprache »gerechter« mache, und das Frauen in der deutschen Sprache nur »mitgemeint« sind, ist ein gut erzähltes feministisches »Geschichtl« – die Sprachwirklichkeit beschreibt das nicht. Heutzutage gilt man ja in manchen akademischen Milieus ja schon als Rechter, wenn man auf eine korrekte Grammatik pocht und die Genderei, die uns täglich und unerwünscht von öffentlich-rechtlichen Medien, Bildungseinrichtungen, Ämtern und Behörden vorgebetet wird, ablehnt. Man soll nicht müde werden es zu sagen: Gendersternchen, Binnen-I & Co sind grammatikalisch und sprachlich ein grober Unfug. Und der belehrende, besserwisserische Gestus des »geschlechtersensiblen Sprechens« ist eine Zumutung für mündige Bürger. Gendersprache verleugnet die sprachwissenschaftlich belegte Eignung und Bestimmung des generischen Maskulinums zum inklusiven und geschlechterneutralen Formulieren. Seine Gleichsetzung mit biologischer Männlichkeit ist eine bewusste und instrumentalisierte Fehlinterpretation.
Dass Frauen in der deutschen Sprache nur »mitgemeint« seien, ist schlichtweg eine feministische Schutzbehauptung. Eine sexistische noch dazu. Gendern zementiert nachgerade eine sublime Sexualisierung der Sprache und der Geschlechterdifferenzen. Die Genderei schreibt eine reaktionäre Erzählung weiter fort – nämlich von der Frau als ewigem Opfer, und die Erzählung vom Mann als ewigem Täter. Geht es noch anachronistischer? Feministische Kampfparolen aus den Neunzehnsiebzigerjahren wirken heute – im Hinblick auf die Geschlechterwirklichkeit – wie aus der Zeit gefallen. Es ist geradezu abwegig, unsere Muttersprache als »männlich« zu »verleumden«.
Dass die Genderei vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt wird ist Faktum und wird durch zahlreiche Studien und Umfragen von namhaften Zeitungen und Institutionen untermauert. Erst jüngst zitierte das Magazin »Schwulissimo« eine Studie der
Wochenzeitung »Die Zeit«, wonach junge Menschen (18 bis 24 jährige) zu 89 Prozent nichts von der Genderei halten. Dabei definieren sich 22 Prozent dieser Altersstufe und Generation als Teil der »LGBTQ+-Community« – also als homosexuell, beziehungsweise divers, so Schwulissimo ergänzend. Der Großteil der Menschen –laut einer aktuellen Krone-Umfrage in Österreich sind 71 Prozent der Österreicher gegen die Genderei in den Medien – sprechen noch immer ganz normales Deutsch ohne Schluckauf mit »*«. Beim Bäcker, in der Trafik oder im Sportverein, ob unter Freunden, in der Arbeit, oder beim Wirt ums Eck: kennen Sie jemanden der im Alltag gendert?
Obwohl der Großteil der Bevölkerung dem Gendern nichts abgewinnen kann, gendert eine selbsternannte Elite in den Medien, Unis, Behörden und Parteien munter weiter. Widerstand gegen diesen Genderunfug zeugt weder vom verzweifelten Festhalten am Patriarchat, noch von Deutschtümelei, wohl aber von Sorge um unsere kulturelle (Sprach)Identität. Eigentlich sollte jeder Sprachnutzer seine Muttersprache als Kulturgut wertschätzen und vor Gendersprache schützen. Vor diesem linken Klamauk, den »woke Lebensart« und das »Politestablishment« uns aufzudrängen versucht. n
Ernst Brandl, geboren 1967, ist Obmann des Vereins »IG-Muttersprache« in Graz. ig-muttersprache.at
Sie erreichen den Autor unter redaktion@wmedia.at
Das vergangene Jahr brachte wirtschaftliche Herausforderungen, die sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirkten. In der Steiermark stieg die Zahl der Arbeitslosen 2024 um 12,3 % auf 35.646. Dennoch gab es durchschnittlich 12.414 offene Stellen – ein Rückgang von 17,3 % gegenüber 2023, aber immer noch der vierthöchste Wert.

Der Fachkräftemangel bleibt ein großes Problem, wie die WKO-Analyse zeigt: Trotz Wirtschaftsflaute verharrte der Stellenandrang 2024 auf niedrigem Niveau und 43 Berufe gelten weiterhin als Mangelberufe.
Rückgang durch Pensionierungswelle
Dazu kommt, dass eine massive Pensionierungswelle bevorsteht. Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der über 50-jährigen unselbstständig Beschäftigten in der Steiermark von 69.000 auf 158.000 mehr als verdoppelt, während die Zahl der unter 25-Jährigen von 72.000 auf 61.500 sank. Trotz erwarteten Zuzugs prognostiziert Statistik Austria einen weiteren Rückgang der Erwerbsbevölkerung (15 bis 64 Jahre). WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk warnt: „Wir befinden uns in einem demografischen Wandel. Der Mangel an qualifiziertem Personal könnte künftige wirtschaftliche Erholungen erheblich bremsen.“
Das WKO-Fachkräfteradar für 2024 verdeutlicht, wie sehr Unternehmen unter diesem Wandel leiden. Die Stellenandrangsziffer – das Verhältnis von Arbeitslosen pro offener Stelle – stieg von 1,53 auf 2,03. Doch von einer Entspannung kann keine Rede sein, sagt Johannes Absenger vom Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS): „2019 lag dieser Wert trotz besserer Konjunktur bei 2,34. Das zeigt, wie stark der demografische Wandel wirkt.“ Werte unter 1,5 deuten laut Experten auf einen Mangel hin. Laut Fachkräfteradar liegen 2024 in der Steiermark trotz anhaltender Krise 43 Berufe unter diesem Wert. Herk ergänzt: „Viele Betriebe halten an ihrem Personal fest, weil sie wissen, dass es schwer wird, neue Fachkräfte zu finden, wenn die Wirtschaft wieder anzieht.“
WKO Steiermark Präsident Josef Herk: „Es braucht stärkere Anreize für längere Erwerbstätigkeit, denn mehr Arbeiten muss sich auch lohnen.“
Betroffen von einem ausgeprägten Mangel an Bewerbern sind vor allem Berufe im gewerblich-technischen Bereich, insbesondere bei ausgebildeten Diplomingenieuren, z. B. in der Metall- und Elektrotechnik, sowie Fachkräfte im Installations- und Baugewerbe sowie im medizinischen und Pflegebereich.
Herk: „Leistung muss sich lohnen“ Angesichts dieser Herausforderungen fordert Herk rasches Handeln: „Wir haben eine hohe Beschäftigungsquote, doch die Arbeitszeit sinkt. Teilzeit ist weiter auf dem Vormarsch.“ In den letzten 20 Jahren sank die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit von fast 34 auf rund 30 Stunden. Herk plädiert für qualifizierten Zuzug und Anreize für längere Erwerbstätigkeit. „Mehr Arbeit muss sich lohnen“, betont er. Dazu fordert er: steuerliche Anreize für Vollzeitbeschäftigung, flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung, Steuerbefreiung von Überstunden und Anreize für längeres Arbeiten im Alter (20-%-Flat-Tax auf Pensions-Zuverdienste und Überstunden).
Angesichts der steigenden Lebenserwartung hält Herk ein höheres Pensionsalter für unausweichlich: „Wir leben immer länger, gehen aber früher in Pension als in den 70er-Jahren – das ist nicht tragbar.“ Derzeit liegt das tatsächliche Pensionsantrittsalter in Österreich bei 62,2 Jahren für Männer und 60,2 für Frauen. In Deutschland sind 74,6 % der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig –in Österreich nur 57,3 %. Herk fordert daher eine schrittweise Angleichung des faktischen an das gesetzliche Pensionsalter und langfristig eine Anpassung an die höhere Lebenserwartung. „Das mag unpopulär sein, aber eine ehrliche Regierung muss den Menschen reinen Wein einschenken.“

Das Center of Science Activities des Universalmuseums Joanneum verbindet die Themen Technik und Naturwissenschaften. Mit Metamotion wurde ein neuer Bereich im Themenraum „Technik und Mobilität“ eingerichtet, der auf Zukunftsszenarien der Mobilität fokussiert. Anhand eines KI-Prototypen werden die Besucher dazu eingeladen, sich über mögliche Formen der Mobilität in der Zukunft Gedanken zu machen. Seit 2019 eröffnet das CoSA als Gemeinschaftsprojekt von FRida & freD – Das Grazer Kindermuseum und dem UMJ Einblicke in Forschung, Naturwissenschaften und Technologie am Puls der Zeit. UMJ-GF Marko Mele hebt hervor, dass das CoSA ein Ort des Experimentierens ist und gezielt dafür genutzt werden soll, neue Technologien zu erproben.

Kulinarische Workshops in Italien
GenussReisen.IT ist eine Plattform für alle, die die Kulinarik Italiens hautnah und authentisch erleben wollen, sei es im Rahmen von Tages-Genuss-Workshops oder auch bei spannenden Touren. Perfekt für alle, die auf der Suche nach echten, kulinarischen Geheimtipps sind, spannende Verkostungen von Olivenöl, Wein oder Käse erleben möchten. Christina Dow und Markus Mosser bringen die Gäste in lockerer Atmosphäre zu den schönsten Plätzen und zelebrieren Italien auf authentische Art und Weise. Die Hauptregionen der Genussreisen sind Triest, Friaul, Venedig, Apulien und Sizilien, sagt Dow: „Wir stehen aber gerne für exklusive Anfragen zur Verfügung und gestalten unsere kulinarischen Touren ganz nach Kundenwünschen.“
Das steirische Unternehmen Grünewald Fruchtsaft GmbH mit Sitz in Stainz hat mit Claudia Schenner-Klivinyi von Sinnwin den geförderten Einführungs- und Verbesserungsprozess für die „Zertifizierung Beruf und Familie“ absolviert und die Auszeichnung offiziell verliehen bekommen. In Workshops wurden unter Mitwirkung von Geschäftsführung, Führungskräften und Mitarbeitern Vereinbarkeitsressourcen bewusstgemacht und Verbesserungspotenziale erhoben sowie Maßnahmen abgeleitet. Schenner-Klivinyi: „Mit dieser Zertifizierung sprechen Unternehmen als Arbeitgeber eine breitere Personengruppe als künftige Mitarbeiter an, bzw. halten bestehende Mitarbeiter langfristig, und wirken so dem Fachkräftemangel besser entgegen.“

Im Jahr 1989 wurde in Österreich Gewalt in der Erziehung verboten. „Trotzdem gehört das Thema Gewalt in der Familie leider nicht der Vergangenheit an. Diese kommt dabei in allen Altersstufen, Kulturen und sozialen Bevölkerungsgruppen vor“, weiß StR. Kurt Hohensinner. Vor diesem Hintergrund wurde von der Stadt Graz die Kampagne „Mutmacher“ entwickelt und umgesetzt. Mit kleinen, kuscheligen „Mutmachern“ sollen Kinder ermutigt werden, über erlebte Gewalt zu reden und Erwachsene für den Kinderschutz sensibilisiert werden. Damit geht das Erfolgsprojekt heuer in seine 6. Auflage. „Das Projekt ist heute wichtiger denn je“, betont Hohensinner, „ein Blick in die Zahlen zeigt, dass diese nach wie vor besorgniserregend sind.“

Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Mit über 307.000 Beratungen in arbeitsund sozialrechtlichen Fragen, Konsumentenschutz, Bildung und Steuern konnte die AK insgesamt 89,3 Mio. Euro für ihre Mitglieder sichern.
„Unsere erfahrenen Experten beraten schnell und kompetent“, sagt AK-Dir. Johann Scheuch. Umfassende Beratungen, Förderungen oder Serviceangebote in Bereichen wie Arbeits- und Sozialrecht sind Grundpfeiler der Arbeiterkammerleistungen. Allein im vergangenen Jahr wurden täglich bis zu 1.250 Beratungen in der Steiermark geleistet, und in Summe 89,3 Mio. Euro für die AK-Mitglieder erwirkt. „Geld, das sonst verloren gewesen wäre“, so Scheuch und AK-Präs. Josef Pesserl ergänzt: „Es geht nicht nur um Information und Schutz, es geht auch darum, dass die Beschäftigten das bekommen, was ihnen zusteht.“
Erstattungen in vielen Bereichen Besonders im Arbeitsrecht war die Unterstützung gefragt: 14,9 Mio. Euro wurden für Beschäftigte erstritten, wobei die häufigsten Streitpunkte laufende Löhne und Gehälter waren. Das Gastgewerbe bleibt nach wie vor die problematischste Branche. Im Sozialrecht machte die AK 39,3 Mio. Euro geltend, vor allem durch erstrittene Pensionsleistungen. Ein weiterer Schwerpunkt war die Insolvenzberatung: Der „Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer“ (ISA) sicherte 22,6 Mio. Euro für 3.526 Betroffene über den Insolvenz-Entgelt-Fonds.
Auch der Konsumentenschutz erwies sich als wichtiger Bestandteil der AK-Arbeit: 1,4 Mio. Euro konnten durch rechtliche Interventionen und Gerichtsverfahren für Mitglieder zurückgeholt werden. Insbesondere im Wohnrecht und bei Mietfragen sind die Problemfälle stark angestiegen. Ein weiterer Erfolg zeigte sich im Steuerbereich: Durch die Unterstützung der AK-Experten haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 11,1 Mio. Euro an Lohnsteuer zurückerhalten.

AK-Direktor Johann Scheuch (l.) und AK-Präsident Josef Pesserl präsentierten die AK-Leistungsbilanz 2024.

Kurz im Gespräch mit
Christa Zengerer, GF ACstyria Mobilitätscluster
Welche Impulse versprechen Sie sich von den Kontakten zur indischen Automobilindustrie?
Die indische Automobilindustrie ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte und bietet enorme Chancen. Im Rahmen der Delegationsreise konnten wir Kontakte zu führenden Unternehmen wie Mahindra, TATA Motors, Baja Auto Limited oder Hyundai Motor India Limited knüpfen. Unsere langjährigen Partnerunternehmen AVL, Dewetron oder TCM International konnten Kooperationen weiter vertiefen. Besonders spannend ist das hohe Innovationspotenzial indischer Unternehmen, das in Kombination mit der österreichischen Automobilzulieferindustrie vielversprechende Synergien ermöglicht. Unser Ziel ist es, den bilateralen Austausch weiter auszubauen und langfristige Partnerschaften für unsere Mitglieder zu fördern.
Wie interessant ist Indien als Markt bzw. als verlängerte Werkbank für österreichische Hersteller?
Indien ist sowohl als Absatzmarkt als auch als Fertigungsstandort interessant. Österreichische Unternehmen, die hier aktiv werden, profitieren von Wachstumspotenzial, Innovationskraft und attraktiven Produktionsbedingungen, insbesondere in Bereichen wie E-Mobilität, Softwareentwicklung und Hochtechnologie-Fahrzeugkomponenten.
Welche Rolle spielen dort heute nachhaltige Mobilität bzw. alternative Antriebskonzepte?
Indien hat die Weichen für eine nachhaltige Mobilitätswende gestellt. Die starke staatliche Förderung, das Marktwachstum und die Innovationskraft machen den Subkontinent zu einem hochinteressanten Markt für österreichische Unternehmen im Bereich Elektromobilität, Batterietechnologie und alternative Antriebe.
Bereits zum 74. Mal ging der Steirische Bauernbundball über die Bühne und auch in diesem Jahr verwandelten rund 16.000 begeisterte Besucher die Stadthalle in den größten Ballsaal Europas.
Schon beim flotten Auftanzen der Jugend in der Stadthalle, der von Dancing-Star Willi Gabalier mit den Landwirtschaftlichen Fachschulen organisiert wurde, und der beeindruckenden Polonaise in der Halle A, für die Claudia und Lisa Eichler mit der Landjugend Weiz verantwortlich zeichneten, wurde einem schnell klar, dass dieser Ball wiederum ein voller Erfolg werden würde.
Kulinarik und Brauchtum Besonderen Wert legten die Veranstalter auch diesmal wieder auf Kulinarik und Brauchtum. Mit einer eigens angefertigten Schmankerlstraße, bei der es Bestes von den heimischen Landwirten zu verkosten gab, konnten die Ballbesucher ausgezeichnete Qualität genießen. Frei nach dem Motto „Gesellig wird‘s sein mit Steirischem Wein“ wurde heuer ein kulinarischer Schwerpunkt auf die edlen Tröpfchen der Steirischen Weinbauern gelegt. So gab es heuer gleich sieben Ballweine. Die „Die Glorreichen Sieben“ waren Sauvignon Blanc vom Weingut Tschermonegg; Muskateller vom Weingut Kollerhof; Junker vom Weingut Assigal; Burgunder Sekt vom Weingut Potzinger aus Gabersdorf; Rieden Burgunder vom Weinhof Platzer; Schilcher

Mit großer Begeisterung legte sich die Landjugend Weiz bei der Polonaise ins Zeug.
vom Schilcherweingut Friedrich und Rotwein vom Weingut Riegelnegg.
Musikalische Highlights
Einen großen Stellwert nimmt auch das Brauchtum am Ball ein, hier vor allem das offene Volkstanzen, das Schuhplattln und die Volksmusik. Temperamentvoller Tanz, zünftige Tracht und liebevoll gepflegte Tradition gehen hier Hand in Hand mit exzellentem Wein und geselliger Atmosphäre. Die Menge zum Tanzen brachten auch so einige musikalische Höhepunkte: Besonderes Highlight war Superstar Melissa Naschenweng, die eine Stunde lang auf Bühne ihre Fitness unter Beweis stellte und mit ihrer Harmonika Vollgas gab. Aber auch Marc Pircher, Die Lauser oder die Edlseer sorgten für beste Stimmung. Weiters heizten Die Pagger-Buam, Die Fürsten, Egon 7, Smash, Die Südsteirer, Die Hafendorfer, Franky Leitner die DJ´s Deckard, Fago, DJMNS, Maxx Duke und Peter Wurzinger der Menge so richtig ein.
Prominente am Tanzboden
Beim heiteren Treiben am Ball sah man wieder viele prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport. Das Tanzbein schwangen unter ande -
rem: Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, LH-Stv.in Manuela Khom, die Landesräte Simone Schmiedtbauer und Barbara Eibinger-Miedl, ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll, der zweite LTPräs. Christopher Drexler, Bauernbundpräsident Georg Strasser, LK-Präsident Franz Titschenbacher, WK-Präsident Josef Herk, viele Abgeordnete aus Landtag, Nationalrat, und Bundesrat, Grawe-GenDir. Klaus Scheitegel, Raiffeisen-Gen-Dir. Martin Schaller, oder die Farmfluencer und Landwirte Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits.
„Ich möchte mich bei allen Besucherinnen und Besuchern bedanken, dass sie den Steirischen Bauernbundball wieder zu diesem großen Ereignis werden ließen. Die heimische Landwirtschaft konnte hier eine Leistungsschau ihrer Produkte zum Besten geben und punktete mit ihren Produkten. Stadt und Land wächst zusammen“, freute sich Bauernbund-Direktor Franz Tonner und fügte hinzu: „Ohne unsere vielen Sponsoren, angeführt von unserem Hauptsponsor Grawe, könnten wir den Ball in dieser Größenordnung niemals bewältigen, ihnen gebührt ein großer Dank.“

„Gesellig beinand“ am Bauernbundball (v.li.) BM Norbert
und

GRAWE MyMEd bietet individuell anpassbaren Schutz, der in allen Lebensphasen Sicherheit gibt.
In einer Welt, in der die Anforderungen an unser Gesundheitssystem stetig steigen, wird eine private Gesundheitsvorsorge immer wichtiger. Der Wunsch nach hochwertiger medizinischer Betreuung und individueller Absicherung wächst stetig.
Genau hier setzt GRAWE MyMED an: Mit dieser innovativen Gesundheitsversicherung bietet die Grazer Wechselseitige Versicherung einen individuell anpassbaren Schutz, der unsere Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen Sicherheit bietet. Denn die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Damit bietet die Versicherung die ideale Antwort auf die steigende Nachfrage nach persönlicher Gesundheitsvorsorge.
Verschiedene Tarifoptionen
GRAWE MyMED stellt ein maßgeschneidertes Versicherungspaket bereit, das auf alle individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Dies ist durch verschiedene Tarifoptionen möglich: MyMEDclinic übernimmt Sonderklassenleistungen in Krankenhäusern und Kliniken. MyMEDdoc ermöglicht die freie Arztwahl und erstattet Kosten für Heilbehelfe. MyMEDcomplete kombiniert die Vorteile der Wahlarzt- und Sonderklassen-Versicherung und bietet umfassenden Schutz.
Flexible Erweiterung
Mit den MyMED Add-ons kann die Gesundheitsversicherung flexibel erweitert werden – beispielsweise durch eine Krankenhaustagegeld-Versicherung oder eine Auslandsreisekrankenversicherung. So passt sich GRAWE MyMED optimal an die individuellen Bedürfnisse an.
GRAWE MyMED steht für eine transparente, leistbare und zuverlässige Gesundheitsversicherung, die in entscheidenden Momenten schnell und unkompliziert unterstützt. Ob Sonderklasse, Wahlarzt oder Zusatzleistungen – Sie gestalten Ihren Gesundheitsschutz ganz nach Ihren Wünschen.
Mehr erfahren Sie unter: www.grawe.at/mymed
Bereits ab12. 4. 2025 Flüge nach Palma de Mallorca
Im Sommer zu 30 Zielen direkt ab Graz fliegen und mehr als 190 weitere Destinationen über Drehkreuze erreichen.
Im Sommer zu 30 Zielen direkt ab Graz fliegen und mehr als 190 weitere Destinationen über Drehkreuze erreichen.
alle Destinationen finden Sie hier graz-airport.at Bereits ab12. 4. 2025 Flüge nach Palma de Mallorca
alle Destinationen finden Sie hier

Unter dem Motto „Wild & Walzer“ findet am 26. April 2025 in der Grazer Seifenfabrik der erste Grazer Jägerball statt, ein neues Highlight für alle Jäger und Naturliebhaber. Die Veranstalterin Karin Marg verbindet Tradition mit moderner Unterhaltung. Die Highlights sind der VIP-Bereich, Gourmet-Catering von Toni Legenstein, Kulinarik von Christof Widakovich, zünftige Tanzmusik, Ehrungen und die Mitternachtseinlage mit Gernot Pachernigg. Dazu gibt’s Tombola, Jagakirtag und Aftershowparty. Karten sind ab sofort unter www.grazer-jaegerball.at erhältlich. Der reguläre Kartenpreis beträgt 90 Euro, Mitglieder der Steirischen Jagd erhalten jedoch einen exklusiven Rabatt und zahlen mit dem Code „Jagd25“ nur 59 Euro pro Karte.
Die Zahl der Firmenpleiten in der Steiermark bleibt hoch. Laut KSV 1870 gab es im ersten Quartal 2025 187 Insolvenzen (+2,2 % zu 2024). Besonders betroffen sind Handel (36 Fälle), Bau (31) und Gastronomie (30). Die Passiva sanken um 32,4 % auf 50 Mio. Euro. 55 Verfahren (-6,8 %) wurden mangels Kostendeckung nicht eröffnet, während die Zahl der eröffneten Verfahren um 6,5 % stieg. „Diese bedeuten Transparenz und Sanierungschancen“, so René Jonke, KSV1870: „Die steirische Wirtschaft geht weiterhin am Stock. Sie benötigt dringender denn je frischen Sauerstoff, um wieder in Schwung zu kommen.“ Für 2025 werden 700 bis 750 Insolvenzen erwartet. Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt – staatliche Förderungen liefen aus, Energiekosten stiegen. Ohne wirtschaftliche Impulse wird sich der Insolvenztrend kaum ändern.

Großer Countdown bei der Siegergala: Die Gewinner des Innovationspreises Vifzack 2025 der Landwirtschaftskammer heißen Verena Schöllauf und Bernhard Moitzi aus Obdach mit ihrem Projekt „Großraum-Iglu mit innovativen Milchpfaden“. Der großartige zweite Platz geht an Stefan Lendl aus Floing mit „Vollhydraulischer 6-Ballengabel und der Latschelei“. Den beeindruckenden dritten Platz erreichte Familie Niederl aus Kirchbach mit ihrer Kulinarik-Innovation „Reiswurst by Urbi & Fuchs“. „Die heimische Landwirtschaft bringt Innovationen am laufenden Band hervor. Damit treiben die steirischen Bäuerinnen und Bauern den Fortschritt auf ihren Höfen voran und machen ihre Betriebe zukunftsfit“, unterstreicht Präsident Franz Titschenbacher.
Der SPÖ-Vertreter Arsim Gjergji im Grazer Gemeinderat hat einen Antrag eingebracht, der die Einführung eines E-Bike-Sharing-Systems fordert. Vorbild ist das erfolgreiche Modell aus Salzburg, wo bis Frühjahr 2026 insgesamt 63 Stationen mit E-Bikes entstehen sollen.

Arsim Gjergji (li.) hat ein umfassendes Konzept für ein E-BikeSharing vorgelegt, um den öffentlichen Verkehr zu stärken und Umweltbelastungen in Graz zu reduzieren.
Sein Konzept sieht langfristig 100 Standorte und 1.000 E-Bikes vor, verteilt auf Innenstadt, Hauptverkehrsachsen, Bahnhöfe und Universitäten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration des Systems in den öffentlichen Verkehr. Nutzer mit Klimaticket fahren die ersten 30 Minuten kostenlos. Die Aktion soll den öffentlichen Verkehr stärken, den motorisierten Individualverkehr reduzieren und den Modal Split nachhaltig verbessern sowie den motorisierten Individualverkehr in Graz sowie in den Umlandgemeinden zu reduzieren.
Umweltfreundliche Alternative Gjergji betont die Vorteile für Graz: Pendler, Studierende und Bewohner könnten vom Auto auf eine umweltfreundliche Alternative umsteigen. Bereits im Mai 2024 hatte er ein Leihfahrrad-System vorgeschlagen, das an Verkehrsknotenpunkten umgesetzt werden sollte. Die Stadtverkehrsplanung lehnte jedoch ab und setzte auf Lastenfahrräder, da viele Grazer private Räder besitzen. Diese Entscheidung hält Gjergji für kurzsichtig, da Leihsysteme in anderen Städten erfolgreich zeigen, wie sanfte Mobilität funktioniert. „Es ist Zeit, die ablehnende Haltung zu überdenken“, erklärt er.
Der Antrag sieht eine Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark und dem Verkehrsverbund vor. Eine Machbarkeitsprüfung soll klären, wie ein gemeinsames System umgesetzt werden kann. Neben der Verkehrsberuhigung könnte es die Lebensqualität steigern und Graz als Vorreiter in der umweltfreundlichen Mobilität etablieren. Die Stadt steht vor der Chance, ihre Verkehrsinfrastruktur zukunftssicher zu gestalten und den Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
Der Flughafen Graz konnte im Jahr 2024 ein deutliches Plus verzeichnen. Mit rund 820.000 Passagieren stieg die Passagierzahl im Vergleich zum Vorjahr um 12 %. Insbesondere das Chartersegment zeigte mit einem Wachstum von 31 % eine starke Entwicklung, während der Linienverkehr mit einem moderaten Plus von 6,5 % abschloss.
Herausforderungen und neue Impulse
Die ersten Monate des Jahres 2025 verliefen verhalten. Der Wegfall der Amsterdam-Verbindung, eine schwächelnde Konjunktur sowie kurzfristige Streiks führten zu einem leichten Rückgang der Passagierzahlen. Ein positives Zeichen setzt der Frachtbereich: In den ersten zwei Monaten 2025 konnte ein Wachstum von 6,7 % verzeichnet werden, im Februar sogar ein Plus von fast 15 %. Der Sommerflugplan 2025 umfasst 33 Destinationen in 14 Ländern, darunter beliebte Bade- und Städtereiseziele sowie die Umsteigeflughäfen Frankfurt, München, Wien, Zürich und Düsseldorf. Antalya bleibt mit bis zu acht wöchentlichen Flügen die wichtigste touristische Destination. Neu im Programm sind Sonderflüge nach Malta, Palermo und Riga.
Investitionen in Infrastruktur
Der Flughafen Graz setzt verstärkt auf nachhaltige Maßnahmen. Eine neue PV-Anlage auf dem Parkhaus produziert seit Dezember 2024 Strom, zudem wurden elektrische Bodenstromanschlüsse für Flugzeuge installiert und alternative Kraftstoffe wie HVO-100 eingeführt, die den CO2-Ausstoß um 85 % senken. Um den Komfort für Reisende zu verbessern, wurden Sitzbänke mit integrierten Steckdosen im Terminal installiert sowie moderne Anzeigetafeln in der Ankunftshalle eingeführt. Neben infrastrukturellen Neuerungen erfreuen sich Serviceangebote hoher Beliebtheit, wie ein Self-Service-Corner in der Ankunftshalle und E-Tankstellen auf dem neuen Parkplatz P5. Trotz der Herausforderungen setzt der Graz Airport auf Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit und bleibt damit ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur der Region. �

Der Flughafen Graz setzt auf breites Angebote und mehr Service.

betriebsservice-stmk.at
Das Betriebsservice richtet sich an alle Betriebe und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.
Abgestimmt auf Ihren Betrieb, Ihre Anforderungen und Bedürfnisse berät Sie das NEBA Betriebsservice gezielt über die Möglichkeiten der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und welchen Nutzen Sie daraus erzielen können! NEBA ist eine Initiative des Sozialministeriumservice.
Die Stadt Graz treibt die Modernisierung ihrer Bildungslandschaft voran: Das Büro Markus Pernthaler Architekt ZT GmbH hat den Architekturwettbewerb zur Modernisierung der VS Bertha von Suttner und der NMS Albert Schweitzer für sich entscheiden können.
Die Ergebnisse wurden am 6. März im Grazer Rathaus von Vize-Bgm.in Judith Schwentner, Bildungs-StR. Kurt Hohensinner, Finanz-StR. Manfred Eber, Stadtbau-Dir. Bertram Werle, dem Leiter der Abteilung für Bildung und Integration, Günter Fürntratt, sowie dem Siegerarchitekten Markus Pernthaler vorgestellt.
Aufwertung des Bildungsstandortes
Der Siegerentwurf setzte sich unter 37 europaweiten Einreichungen durch und überzeugte durch eine klare und funktionale Struktur: „Die bestehende Volksschule wird durch einen neuen, längsgestreckten Bau entlang der Lagergasse ersetzt. Ein Verbindungsbau trennt die Grünflächen sinnvoll und schafft differenzierte Bereiche“, lobte die Jury unter Vorsitz von Sandra Gnigler. Besonders positiv bewertet wurde die klare Adressbildung durch die gemeinsame Eingangszone. „Die Zugänge sind gut strukturiert, die Erdgeschoßgestaltung ermöglicht eine flexible Nutzung“, so die Jury weiter. Auch der Turnsaaltrakt wurde innovativ integriert. Er „schwebt“ über der Aula, ist von beiden Schulen barrierefrei erreichbar und schafft durch Lufträume spannende Sichtbeziehungen. Ein weiteres Highlight ist die Maximierung der Sport- und Freizeitflächen. „Durch die Nutzung der Dachflächen wird das knappe Platzangebot optimal genutzt“, betonte die Jury. So können zusätzliche Bewegungszonen geschaffen werden. Bildungs-StR. Hohensinner ergänzt: „Mit unserem Schulausbauprogramm schaffen wir Raum für bessere Bildungschancen für unsere Kinder. Das Projekt VS Bertha v. Suttner/NMS Albert Schweitzer wertet den Bildungsstandort in Gries massiv auf und wird zukünftig auch das städtische Schulzahnambulatorium beheimaten. �


Am 28. Februar 2025 öffnete die Knapp Unternehmenszentrale ihre Türen für rund 100 Nachwuchstalente aus ganz Österreich. Bereits zum 13. Mal fand der renommierte Programmier-Wettbewerb statt, bei dem Schüler und Schülerinnen bzw. Studenten und Studentinnen ihre Coding-Skills mit einer anspruchsvollen Aufgabe aus der automatisierten Lagerlogistik unter Beweis stellten. Die Gewinner der beiden Kategorien freuten sich über je 1.000 Euro Preisgeld.
Der Knapp Coding Contest hat sich als bedeutender Event für IT-Talente etabliert. Neben wertvoller Praxiserfahrung erhalten die Teilnehmer die Chance auf attraktive Preisgelder und begehrte Praktikumsplätze. „Der Contest ermöglicht jungen Talenten, ihre Fähigkeiten praxisnah zu testen und weiterzuentwickeln. Die Begeisterung und Kreativität der Teilnehmer beeindrucken uns jedes Jahr aufs Neue“, erklärt Ingo Spörk, Vice President Human Resources bei Knapp. Nach Infos für die Teilnehmer über IT-Karrierewege bei Knapp startete die Challenge: Innerhalb von 2,5 Stunden galt es, eine Kundenbestell-Optimierung für ein zweistufiges Kommissioniersystem zu programmieren. Effizienz war gefragt, um Wege zu verkürzen und die Lösungen laufend zu verbessern.
And the winner is ...
Nach dem Wettbewerb bot die Beer & Burger-Bar eine entspannte Atmosphäre, bevor die Sieger gekürt wurden. Die Gewinner des 13. Knapp Coding Contest sind Matthias Bergmann von der TU Graz und Felix Reimüller von der HTL Villach, die sich das begehrte Preisgeld von je 1.000 Euro holten. Für die HTL Rennweg aus Wien zahlte es sich besonders aus: Luka Pacar und Fabian Ha wurden in der Kategorie Schüler hinter Felix Reimüller von der HTL Villach Zweiter und Dritter. Die HTL Rennweg aus Wien wurde erneut als beste Institution ausgezeichnet. Bei den Studenten belegten Georg Hoffmann (FH Joanneum) und Paul Graf (TU Graz) die weiteren Podestplätze. �

Das AMS Steiermark fördert Frauen beim Einstieg in Handwerk und Technik. So fand Lisa Maria Eder über eine arbeitsplatznahe Ausbildung den Weg in die Informationstechnologie.
„Mir wurde bewusst, wie viel in der IT dahintersteckt und dass ich genau dort arbeiten möchte“, erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau Lisa Maria Eder. Die 21-Jährige aus Paldau bei Feldbach wird seit Juli 2024 über eine arbeitsplatznahe Ausbildung bei ro-quadrat zur Informationstechnologin qualifiziert: Gefördert von Land und AMS Steiermark, bietet dieses Modell arbeitsuchenden Personen Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, andererseits gibt sie Unternehmen die Chance, dringend benötigtes Fachpersonal gezielt im eigenen Betrieb zu qualifizieren.
Eder hat eine klare Botschaft für andere junge Frauen, die mit einer technischen Ausbildung liebäugeln: „Lasst euch nichts einreden, geht euren Weg!“ Auch ihr Chef Roman Cech wünscht sich mehr Frauen in der IT: „Die Arbeitsweise von Frauen ist oft anders als die von Männern. Es braucht für diesen Beruf analytisch-logisches Denken und Ordnungsliebe. Frauen können das mindestens genauso gut.“ „Gemeinsam schulen wir Ihre künftigen Fachkräfte!“, betont der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. „Betriebe mit Interesse an einer arbeitsplatznahen Ausbildung nehmen am besten Kontakt mit dem Service für Unternehmen ihrer regionalen AMS-Geschäftsstelle auf.“
Mehr Infos: gemeinsamausbilden.ams.at
Erfolgreicher Wechsel in IT: Lisa Maria Eder


Gemeinsam in die Zukunft - Jerich Trans, Müllex und die FOCUSON Group setzen auf generationsübergreifende Zusammenarbeit. (V.l.n.r.: Vorne: Max & Daniela Müller-Mezin, Martin Jost | Hinten: Felix & Niki Müller-Mezin)
Industrieprozesse effizienter gestalten– wie gelingt das? Drei Unternehmen zeigen, dass durch Kooperation und Erfahrung passgenaue Lösungen für Logistik, Qualitätssicherung und Entsorgung entstehen.
Reibungslose Abläufe und minimaler Koordinationsaufwand –ein Vorteil, den Jerich Trans, Müllex und die FOCUSON Group durch gebündelte Stärken bieten. Seit vier Jahrzehnten sind Jerich Trans & Müllex feste Größen in Logistik und Entsorgung, während FOCUSON mit Industrial- & Consulting Services Prozesse in der Automotive-, produzierenden Industrie und im Handel optimiert. Die Vernetzung dieser Kompetenzen schafft zukünftig neue, durchgängige, kundenorientierte Lösungen.
Mit dem Einstieg von Felix Müller-Mezin bei Jerich Trans & FOCUSON wird der Generationenwechsel weitergeführt, den sein Bruder Niki vor mehr als 3 Jahren bei Müllex eingeläutet hat. Gemeinsam mit Martin Jost, Geschäftsführer der FOCUSON Group, sowie den Eigentümern und Geschäftsführern Daniela und Max Müller-Mezin, entsteht ein starkes Netzwerk, das klassische Unternehmensgrenzen überwindet.
Gemeinsam stärker: Mehrwert für Kunden und Region „Effizienz erfordert abgestimmte Lösungen. Aus einer Hand optimieren wir Logistik, Qualitätssicherung und Abfallmanagement – damit sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, so Max Müller-Mezin über die gemeinsame Vision.
Als familiengeführte Unternehmen setzen Jerich Trans, Müllex und die FOCUSON Group auf Verlässlichkeit, Innovation und generationenübergreifende Partnerschaften. Diese Allianz stärkt sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen als auch die regionale Wirtschaft.



Inspirationen
Von 27. März bis 1. April flimmert in Graz die 28. Ausgabe der Diagonale über die Leinwände. Neben Österreich- und Weltpremieren wartet auf die 30.000 Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm, das zu – unerwarteten – Begegnungen und Diskurs einlädt. Die Steiermärkische Sparkasse ist erneut Hauptsponsorin und Kulturpartnerin. „Filme zeigen uns Wirklichkeitsentwürfe und laden uns ein, über unsere Zukunft nachzudenken. Die Zukunft stellen auch wir als Steiermärkische Sparkasse anlässlich unseres 200-jährigen Jubiläums in den Fokus. Inspirationen holen wir uns dabei unter anderem bei der Diagonale, die 2025 erneut beweist, welche Strahlkraft heimisches Filmschaffen haben kann“, sagt Vorstandsmitglied Georg Bucher.

Wer macht sich mit uns auf die Reise?

AMS Kärnten und AMS Steiermark verstärken Zusammenarbeit
Mit Inbetriebnahme der Koralmbahn werden sich die Arbeitsmärkte in den Regionen verändern. Das eröffnet neue Chancen – für Arbeitsuchende wie Unternehmen. Ein erstes Vernetzungstreffen von AMS Kärnten und AMS Steiermark in Wolfsberg bildete den Auftakt für eine engere Zusammenarbeit hinweg. Die AMS-Kärnten-GF Peter Wedenig und AMS-Steiermark-GF KarlHeinz Snobe stimmen überein: „Es ist das Gebot der Stunde, diese Arbeitsmärkte ganzheitlich zu betrachten. Gemeinsam planen wir, Ideen für zu entwickeln und umzusetzen – von der Anpassung der Vermittlung bis zu gemeinsamen Bildungsmaßnahmen und Qualifizierungen. Wir sind überzeugt: Hier werden neue Chancen für unsere Kunden – Arbeitsuchende und Unternehmen – entstehen.“
Verpasse nicht deine Chance! Bewirb dich jetzt für das Social & Green Business-Gründungsprogramm und starte deine Reise als Entrepreneur! Du willst als Unternehmer durchstarten und gleichzeitig die Welt verändern? Dann bewirb dich bis 30. März für unser kostenfreies Gründungsprogramm im Wert von 15.000 Euro, das dich für zwölf Monate im Aufbau deines wirkungsorientierten und nachhaltigen Start-ups begleitet! Dich erwarten 1:1 Coachings durch Experten, ein Büroarbeitsplatz im Unicorn Start-up & Innovation Hub, 50 Stunden Fachworkshops zu Unternehmensentwicklung & Impactanalyse und Sichtbarkeit eures Start-ups bei Events und auf Social Media sowie die große steirische Social Business Community! Infos: www.socialbusinesshub.at/angebote/ impact-gruendungsprogramm
Andreas Steinegger ist neuer LK-Präsident
Mit überwältigender Mehrheit hat das Bauernparlament Andreas Steinegger zum neuen Präsidenten der steirischen Landwirtschaftskammer gewählt. Er folgt Franz Titschenbacher, der zwölf Jahre diese Spitzenposition innehatte. Mit Maria Pein als Vizepräsidentin bildet Steinegger nun das neue Präsidium. Er werde eine starke und überlegte Stimme für die steirischen Landwirte sein, erklärte er in einer ersten Reaktion. „Ich werde mich mit voller Kraft und klarer Sprache für die Anliegen der Bäuerinnen, Bauern und bäuerlichen Jugend einsetzen“, unterstrich Steinegger, der seine neue Aufgabe mit Respekt und Freude ausüben will. Er erhielt 97,4 Prozent der abgegebenen Stimmen, und dankte für das große entgegengebrachte Vertrauen.


Vom 20. August bis 31. Oktober 2025 wird ein Pavillon der Steiermark-Schau vor dem Leobener Neuen Rathaus zu sehen sein. Die mobile Ausstellung verweist auf die Hauptausstellung im Schloss Eggenberg in Graz und thematisiert die Parallelen zwischen der barocken Welt des 17. Jahrhunderts und aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Bgm. Kurt Wallner sagt: „Es macht mich stolz, dass Leoben als zweitgrößte Stadt des Bundeslandes Teil der Steiermark-Schau 2025 ist. Der Pavillon wird von August bis November spannende Einblicke in Geschichte und Gegenwart bieten – mit historischen Fakten, künstlerischen Perspektiven und Impulsen zum Nachdenken. Ich lade alle ein, diese kulturelle Entdeckungsreise mit uns zu erleben.“


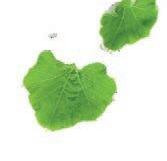





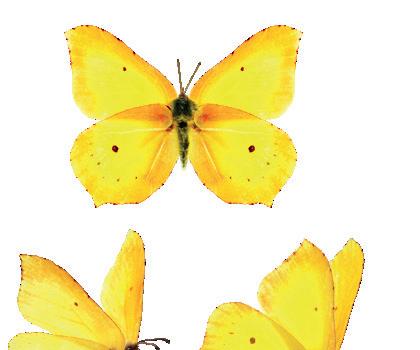
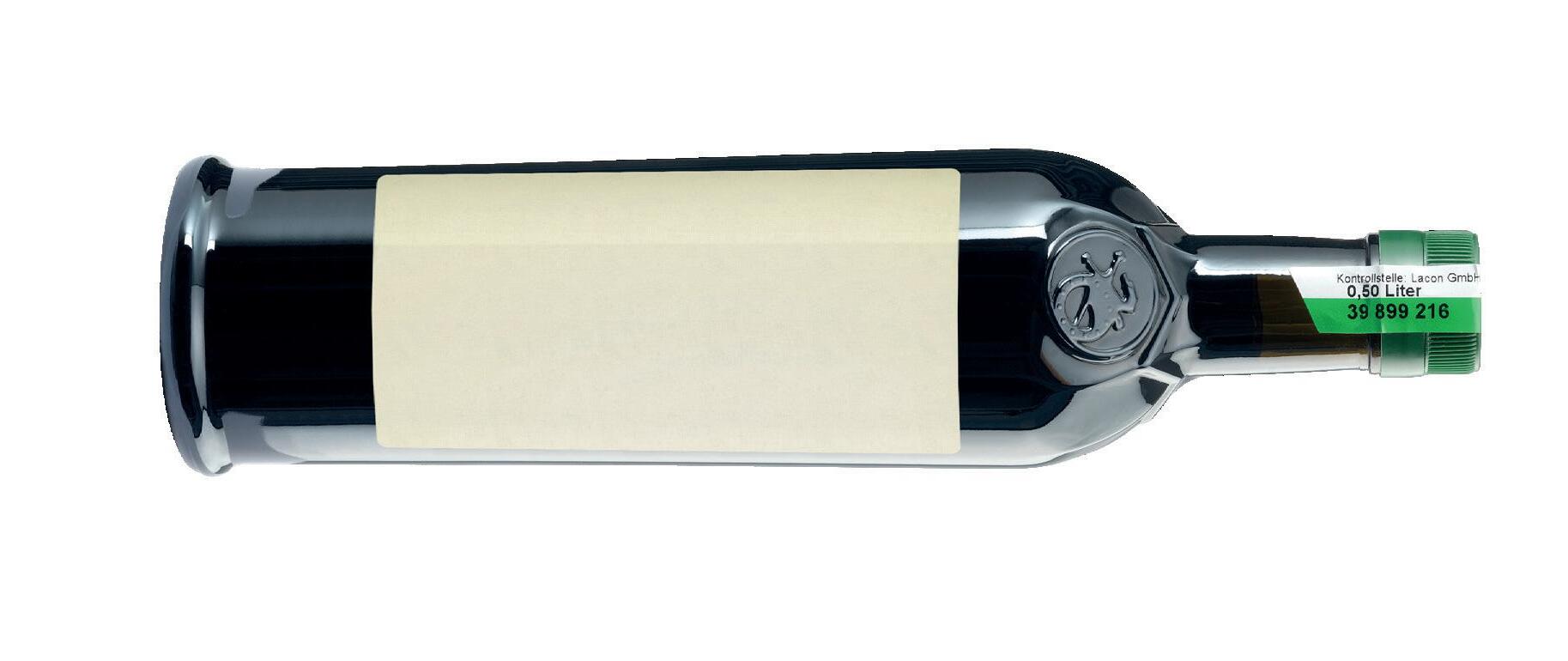
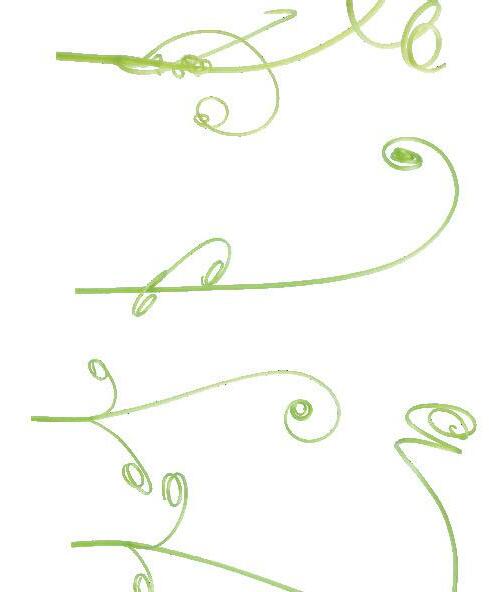













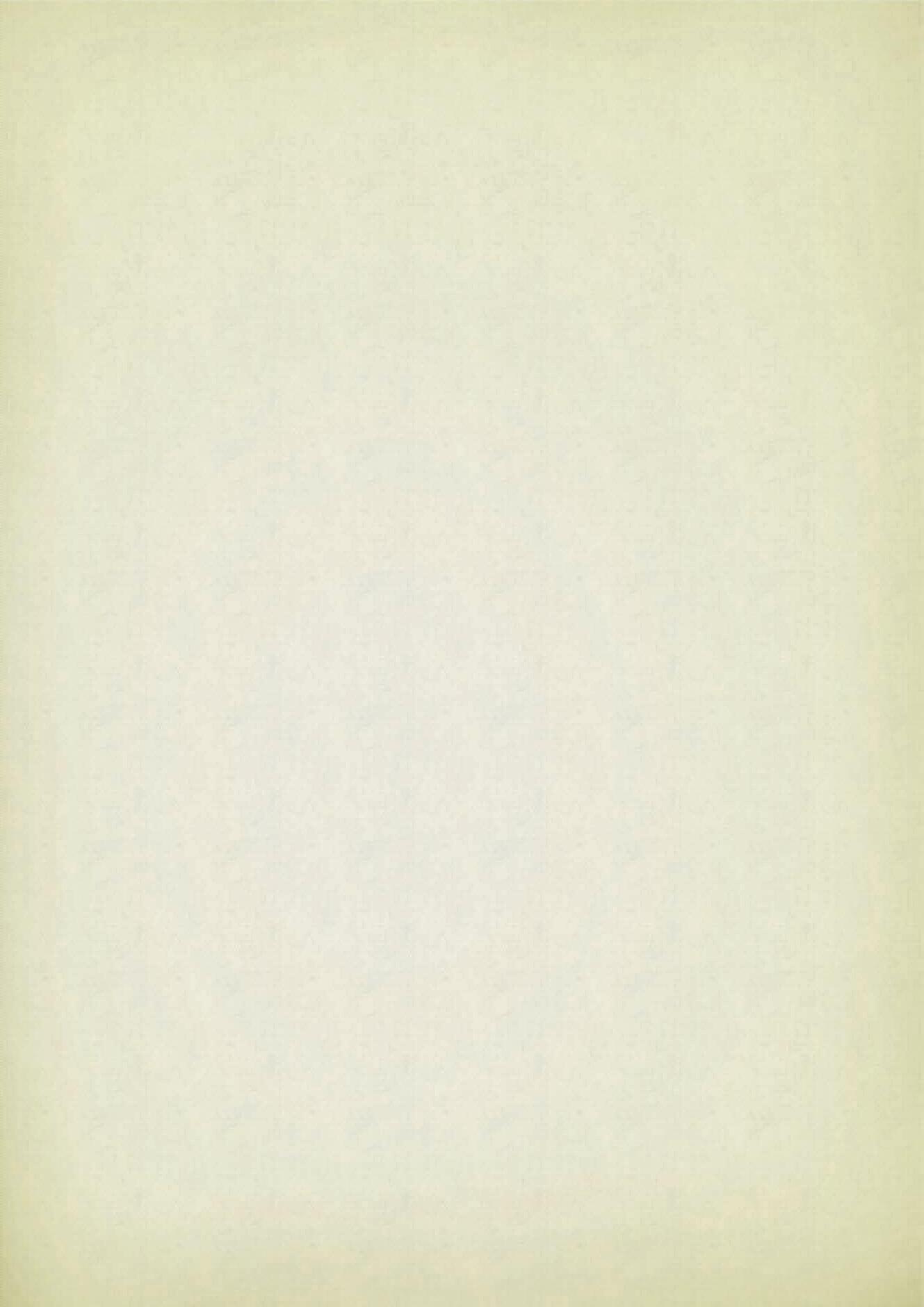








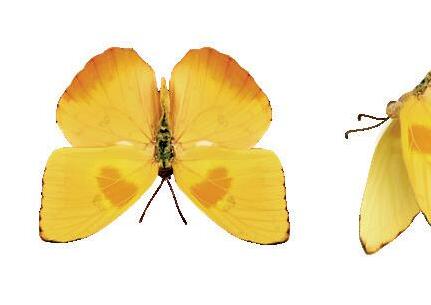



Die Automobilbranche bildete Thema des ersten Teils der Reihe Forum Joanneum Research, der am 25. Februar in Graz über die Bühne ging.
In Fachvorträgen beleuchteten hochkarätige Experten die Zukunft der Branche. Die Themen reichten vom Transport und der Speicherung von Energie über Software und künstliche Intelligenz bis hin zur Lebenszyklusanalyse.
Zukunftsfaktoren E-Fuels und KI
Eine der Herausforderungen ist der stark steigende Bedarf an Energie für Mobilität und Industrie, betont CTO Robert Fischer von der AVL List GmbH. Die heimische Erzeugung an erneuerbarer Energie wird nicht ausreichen. Fischer ist deshalb überzeugt: „Der Import wird in Zukunft hauptsächlich in chemisch gebundener Form erfolgen.“ Jost Bernasch, GF der Virtual Vehicle Research GmbH, sieht die Software und Deep Learning als Schlüsselindikator technologischer Entwicklungen und ist überzeugt, dass in zehn Jahren vollautonome, vernetzte Fahrzeuge unterwegs sein werden.
Reichweite und Lebenszyklusanalyse
Stefan Koller, Managing Director der VARTA Innovation GmbH, gab Einblicke in die Batteriezellenforschung: Die Reichweite lasse sich auf kurze Sicht nicht beliebig erhöhen: „Wir haben eine Verbesserung der Energiedichte um 25 % erreicht und gehen davon aus, dass noch mehr möglich sein wird.“ Gerfried Jungmeier von Joanneum Research Life stellte das Konzept der dynamischen Lebenszyklusanalyse vor, die das Kreislaufwirtschaftspotenzial bewertet. Schlüsselfaktoren sind Treibhausgasemissionen und Primärenergie. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus eines Fahrzeugs betrachtet. Vollkommene Klimaneutralität sei nur in Kombination mit Systemen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture & Storage) erreichbar, so Jungmajer. JR-Direktor Heinz Mayer führte durch die Veranstaltung und die Diskussion, in der die Rahmenbedingungen für Industrie, Forschung, Innovationen und Investoren in Europa thematisiert wurden. �


FW-Landesobmann Thomas Kainz: „Danke an alle, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Jetzt beginnt die Arbeit!“
Die Wirtschaftskammerwahl 2025 ist geschlagen – und die Freiheitliche Wirtschaft Steiermark kann mit Stolz auf ein historisches Ergebnis blicken! Erstmals ist die FW in allen 72 Fachgruppen angetreten und hat damit ein starkes Zeichen für eine echte wirtschaftliche Erneuerung gesetzt. Das Vertrauen der Wähler ist sichtbar, so Landesobmann Thomas Kainz: „Die Zeit für eine mutige Veränderung ist jetzt! Noch nie war der Zuspruch für die Freiheitliche Wirtschaft so groß – wir haben unser bestes Ergebnis in der Geschichte der FW Steiermark erreicht!“
Ein klares Zeichen für Veränderung
Die massiven Verluste des Wirtschaftsbundes beweisen: Immer mehr Unternehmer haben genug von der verfehlten Politik von Schwarz-Grün. Statt echter Entlastung und Reformen gab es in den letzten Jahren vor allem neue Bürokratie, Belastungen und eine Politik, die an der Realität der Wirtschaftstreibenden vorbeigeht.
Dieses Wahlergebnis ist eine unmissverständliche Botschaft: Die Wirtschaft braucht keine ideologisch getriebenen Experimente wie den Green Deal, sondern einen echten New Deal – einen wirtschaftlichen Neustart, der Investitionen, Unternehmergeist und Wettbewerbsfähigkeit wieder in den Mittelpunkt stellt.
Jetzt zählt entschlossenes Handeln!
Unser Erfolg ist kein Selbstzweck, sondern eine Verpflichtung, so Kainz. Jede Verzögerung kostet Arbeitsplätze und Wohlstand – wir müssen jetzt handeln! Die überbordenden Strukturen der Wirtschaftskammer müssen entschlackt, die Bürokratie abgebaut und die Zwangsbeiträge überdacht werden. Unternehmer brauchen eine Kammer, die sie unterstützt, nicht belastet.
Natürlich bleibt es unter dieser Bundesregierung schwierig, echte Reformen durchzusetzen. Aber wir versprechen: Die Freiheitliche Wirtschaft wird nicht nachlassen! Dieses historische Ergebnis zeigt klar: Der Stillstand muss enden – es ist Zeit für einen wirtschaftlichen Neustart! �

Saubermacher-Gründer Hans Roth (3. v. li) und Bgm. Bilall Kasami (2. v. re) mit Mitarbeitern der Abfallentsorgung der Stadt Tetovo
Die Umsetzung einer ökologischen Abfallwirtschaft ist das Ziel der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) von Saubermacher in Tetovo, die nun ihr einjähriges Bestehen feiert. Zum Jubiläum lud der Umweltpionier mit Advantage Austria zu einer Bilanz beim „Austrian-Macedonian Environmental Forum“.
Im Zentrum der Tagung standen erfolgreiche Meilensteine der Zusammenarbeit. Zudem gab es Ausblicke auf weitere geplante Aktivitäten und Pilotprojekte. Die Faktoren aktive Bewusstseinsbildung, Know-how für Entsorgung und Logistik aus Österreich sowie ein stabiler Gebührenhaushalt tragen zum Erfolg bei. Während die Ausgestaltung der Abfallwirtschaft in öffentlicher Hand bleibt, erfolgt die Umsetzung mit dem langjährigen Know-how des privaten Partners. Um die Kostentransparenz für die Stadt und ihre Bevölkerung zu erhöhen, hat Saubermacher ein digitales Rechnungsmanagement und Bezahlsystem eingeführt.
Professionell geschultes Personal Über 34.000 Tonnen an Siedlungsabfällen hat Saubermacher im vergangenen Jahr im Gemeindegebiet Tetovo in Nordmazedonien gesammelt und damit den Grundstein für die korrekte Entsorgung gelegt.
In den kommenden 15 Jahren wollen die beiden Partner durch gezielte Synergien die Abfall- und Ressourcenwirtschaft auf ein stabiles Niveau heben. Einige Maßnahmen konnten im ersten Jahr erfolgreich umgesetzt werden. An stark frequentierten Orten wurden über 500 neue Abfallbehälter aufgestellt. 100 geschulte Mitarbeiter kümmern sich mit 19 Müll-LKW um die Abholung und Entsorgung. Bgm. Bilall Kasami freut sich: „Wir haben damit neue Maßstäbe in Bezug auf das Abfallmanagement in Tetovo gesetzt. Heute ist unsere Stadt sauberer und die Lebensqualität hat sich deutlich verbessert.“
Aktive Bewusstseinsbildung
Der wohl wichtigste Schritt ist die aktive Bewusstseinsbildung in einer der größten Städte Nordmazedoniens. Dazu wurden sowohl Social-Media- als auch Flyer-Kampagnen gestartet. Hans Roth, Saubermacher-Gründer: „Unser Ziel ist es, Abfallentsorgung und Recycling in Tetovo weiter
voranzutreiben. Die Wertstoffe sollen sortiert und bestmöglich wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Insgesamt sehe ich es als unsere Verantwortung und Pflicht, unser langjähriges Wissen weiterzugeben und andere Länder in ihren Umweltbestrebungen zu unterstützen.“
Zudem unterstützte das Unternehmen die Umweltaktion „Generalka Weekend“ der vom Steirer Hannes Jäckl ins Leben gerufenen Organisation „Man and Mountain“. Im Rahmen der Aktion beteiligten sich zahlreiche Freiwillige an der Reinigung der Natur im Nationalpark Shar Mountain. Saubermacher übernahm kostenlos den Abtransport sowie die fachgerechte Entsorgung von zwölf Tonnen Abfall. Im Rahmen der Maßnahmen wurden außerdem neun Dörfer im Nationalpark erstmals an die Müllabfuhr angeschlossen. Auch heuer ist Saubermacher als offizieller Partner der „Generalka Weekend“ im Einsatz.
Binder+Co gilt als Synonym für innovative Aufbereitung in der Rohstoff- und Recyclingindustrie. Weltweit erfolgreich eingesetztes Know-how, ein hochqualifiziertes Mitarbeiterteam und wegbereitende Technologien sind unsere Stärke. Das macht uns zum Weltmarktführer in der Altglasaufbereitung und in der Siebtechnik für schwierige Aufgabenstellungen. Binder+Co - ein kompetenter Partner in über 100 Ländern. www.binder-co.at


In den vergangenen Jahren hat sich auf den Höfen eine junge weibliche Szene etabliert, die über Online-Plattformen Einblicke in die Landwirtschaft gibt. Die jungen Trendsetterinnen tragen ihr Leben und Wirtschaften auf dem Hof in die Welt, teilen ihre Kompetenz und wertvolle Netzwerke auf. LK-Vize-Präs. Maria Pein zeigt sich beeindruckt: „Die Farmfluencerinnen ermutigen ihre Berufskolleginnen selbstbewusste und innovative Wege zu gehen.“ Und weiter: „Die Landwirtschaft und die Gesellschaft brauchen diese Frauen mehr als notwendig. Durch ihre deutliche Sichtbarkeit, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit zum Empowerment nehmen die Farmfluencerinnen eine wichtige Rolle ein und sind daher auch in der Kommunalpolitik sehr gefragt.“


Für die Expo 2025, die im japanischen Ôsaka stattfindet, wurden vom Land Steiermark zwei steirische Künstler-Positionen beauftragt, die auf unterschiedlichste Art in einen Dialog mit dem Ôsaka-Paravent im Schloss Eggenberg treten. Während das Künstlerduo Marleen Leitner und Michael Schitnig, bekannt als Studio Asynchrome, eine digitale Arbeit geschaffen hat, zeigt Tom Lohner eine großformatige Malerei. Sein „Steirischer Paravent“ zeigt eine sinnliche, malerische Hommage an die Steiermark –eine visuelle Erzählung voller Symbolik und vielschichtiger Details. Im Juni werden die Werke im Österreich-Pavillon auf der Expo zu sehen sein, vorab werden sie bis Ende März im Volkskundemuseum am Paulustor präsentiert.
Als verantwortungsvolles Unternehmen setzt die Generali ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität. Mit geförderten Jobtickets und Fahrrädern, elektrifizierter Flotte sowie der Möglichkeit, remote zu arbeiten, schafft die Generali für ihre Mitarbeiter einen klaren Mehrwert – sowohl in puncto Flexibilität als auch Nachhaltigkeit. „Wir haben viele Schritte gesetzt, wie unsere Mitarbeiter in ihrem beruflichen wie privaten Umfeld die Umwelt schonen können. Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasen. Deswegen ist eine umweltfreundliche Mobilität ein zentraler Hebel, um einen wirkungsvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft zu leisten“, ist Generali-CEO Gregor Pilgram überzeugt.
Bereits zum dritten Mal wurde der „Tag der steirischen Öffis“ zum Anlass genommen, um auf den öffentlichen Verkehr in der Steiermark aufmerksam zu machen. Peter Gspaltl, GF im Verkehrsverbund Steiermark, zog mit LR.in Claudia Holzer Bilanz und präsentiert die Entwicklungen und Meilensteine des vergangenen Jahres. „Am Tag der steirischen Öffis feiern wir gemeinsam die Erfolge, die ohne die Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie den 35 Verkehrsunternehmen nicht möglich gewesen wären. Wir blicken aber auch in die Zukunft des ÖV und wollen noch mehr Menschen vom Umstieg auf die Öffis überzeugen. Danke an alle, die mit uns diesen Weg in eine klimafreundliche und leistbare Mobilität in der Steiermark gehen“, so Gspaltl.


Saubermacher unterstützte
Das größte Schach-Open Österreichs fand vor kurzem in Graz statt. Die 440 Teilnehmenden aus 50 Nationen kamen aus allen Teilen der Welt. 13 Großmeister hatten sich eingefunden und führten die Startrangliste an. Austragungsort des Turniers waren wieder die WKO und das WIFI. Bei der Eröffnung fanden sich namhafte Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur ein. Saubermacher-Gründer Hans Roth unterstützte das Turnier, das sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt Graz entwickelt. Vor allem die Schachjugend liegt Roth am Herzen, weshalb er dieses Turnier fördert. Insgesamt über 5.000 Nächtigungen konnten dadurch verbucht werden, da viele der Teilnehmenden mit ihrer Familie angereist waren.




Die BKS Bank lud am 23. Februar zur Eröffnung ihrer neu gestalteten Filiale in Mattersburg. Mit dem Umbau setzt sie ein klares Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung und Innovation. BKS Bank Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász, die Leiter der Direktion Wien-Niederösterreich-Burgenland Peter Angerer und Norbert Arbesleitner sowie Filialleiter Nesad Residovic konnten zahlreiche Gäste begrüßen. „Mit der modernisierten Filiale in Mattersburg leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur Belebung des innerstädtischen Bereichs. Bestehendes wurde in ein modernes, zukunftsfähiges Konzept gegossen, das den Bedürfnissen unserer Kunden sowie einer nachhaltigen regionalen Entwicklung gleichermaßen gerecht wird“, erklärte Nikolaus Juhász.

126 Unternehmen wurden von der ÖGVS – Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherschutz in den vergangenen Monaten getestet. Die BKS Bank überzeugte durch exzellentes Filialservice mit Herz und wurde dafür mit dem Service-Award ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die uns zum wiederholten Mal bestätigt, dass unser hoher Qualitätsanspruch, den wir tagtäglich leben, goldrichtig ist und Früchte trägt. Wir unterstützen unsere Kunden bei allen Fragen rund ums Bankgeschäft und sind darüber hinaus auch ein verlässlicher Ansprechpartner, wenn eine Hilfestellung in unseren SB-Zonen benötigt wird, oder auch bei der Abwicklung des digitalen Bankgeschäfts“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank.




Empfang: Tirol, Salzburg, Steiermark, Wien
in ganz Österreich


Gründungspreis
Unter dem Namen „ProtectLiB“ entwickelten Jürgen Abraham, Tobias Kopp und Chris Pichler ein patentiertes Recyclingverfahren für Batterien von Elektroautos – in Form einer kompakten Recyclinganlage. Am 12. März wurde die Erfindung mit dem österreichischen Gründungspreis „Phönix“ in der Kategorie „Spin-offs“ ausgezeichnet. Wenn ein E-Auto das Lebensende erreicht, stellen Batterien eine große Herausforderung dar. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, können jedoch auch Brände verursachen. „Wir können Lithium, Kobalt und Nickel von den flüssigen Elektrolyten trennen – und das ohne Hitze“, erklärt Kopp. Da die Reststoffe nicht mehr gefährlich sind, werden sowohl die Weiterverarbeitung als auch der Transport erheblich günstiger.


Österreichs führende Digital- und Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig sorgte am 3. März für eine spannende Diskussion im Steirischen Presseclub. Fast 40 Interessierte waren gekommen, um beim Clubabend in Kooperation mit dem PRVA Steiermark mit der Journalistin persönlich über einige der dringendsten Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Vorab stellte sie ihr aktuelles Buch „Wider die Verrohung“ vor und erzählte, wie eine „Bild“-Schlagzeile sie dazu inspirierte. Sie warnte davor, sich auf „Quatschdebatten“ statt auf wirklich wichtige Inhalte zu konzentrieren und riet zu „achtsamer Wut“. Sie zeigte auf, wie jede und jeder einzelne die Diskussionskultur im Internet ein kleines bisschen freundlicher und sachlicher machen kann.
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem Land Burgenland und Burgenland Energie Verträge über die größte Finanzierung für erneuerbare Energie in Österreich abgeschlossen. Das „Projekt Tomorrow“ soll das Burgenland bis 2030 zu einer der ersten bilanziell klimaneutralen und energieunabhängigen Regionen machen. Das Landesunternehmen entwickelte ein Wind- und Photovoltaik-Projektportfolio, das eine Leistung von rund 2.000 Megawatt bis zum Jahr 2030 verspricht. „Die hohe Energieabhängigkeit von unberechenbaren Playern führt zu hoher Unsicherheit mit Energiepreisen. Mit unserem Projekt schaffen wir nicht nur einen Wertschöpfungseffekt von rund 3,6 Mrd. Euro, sondern auch dauerhaft sichere und leistbare Energiepreise aus Wind- und Sonnenstrom für eine ganze Region“, erklärt Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie.
Steirischen
Der Steirische Tennisverband hat am 10. März in einer feierlichen Generalversammlung sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Die Veranstaltung, die in der Raiffeisen Landeszentrale stattfand, zog über 200 Mitglieder und Tennisbegeisterte an. Ein besonderes Highlight war die Wahl der Präsidentin und des Vorstands, die einstimmig angenommen wurde. Barbara Muhr wurde somit in ihre fünfte Amtsperiode als STTV-Präsidentin gewählt. Durch die 80-Jahr-Feier führte STTV-Ehrenpräsident Bruno Saurer mittels Zeitreise vom Jahr 1945 bis heute. Neben einem Rückblick auf diverse Sporthighlights der letzten acht Jahrzehnte, wurden auch mehrere herausragende Persönlichkeiten mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.


„Rückschritt“
Am 9. März luden die SPÖ Frauen Steiermark und Landesfrauenvorsitzende MEP Elisabeth Grossmann zur alljährlichen Weltfrauentags-Veranstaltung nach Gratwein-Straßengel. Unter den mehr als 300 Gästen fanden sich BM Anna Sporrer, Staatssekretär Jörg Leichtfried und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz. Die Veranstaltung stand im Zeichen des Gedenkens an die ehemalige Frauenministerin Helga Konrad. „In der Steiermark wurden unter SPÖ-Beteiligung Kinderbildung und -betreuung stetig ausgebaut. Die FPÖ-ÖVP Regierung muss diesen Weg konsequent weiterführen. Denn nur bei flächendeckendem Angebot kann von echter Wahlfreiheit die Rede sein“, so Grossmann. Der Auftritt der Künstlerin Yasmo (Yasmin Hafedh) rundete das Programm ab.
Die FH Joanneum Kapfenberg bietet ab Herbst 2025 den Bachelor „Umweltmanagement“ auch als berufsbegleitende Variante an. Neu im Studienangebot ist auch der international ausgerichtete Master „European Green Transformation“. Bewerbungen sind bereits möglich. Uwe Trattnig, Leiter des Instituts Energie-, Verkehrsund Umweltmanagement der FH Joanneum: „Europa strebt eine nachhaltige Zukunft an und hat den Europäischen Green Deal verabschiedet. Jetzt ist es an der Zeit, dass transformative Führungskräfte und Mitarbeitende in unterschiedlichen Abteilungen diese ehrgeizigen Ziele in die Tat umsetzen. Daher erweitern wir unser Studienangebot und setzen stark auf berufsbegleitende, flexible Ausbildungen zur Weiterqualifikation auf dem Arbeitsmarkt.“

Nach Fertigstellung der Neutorgasse, der Freigabe der Tegetthoffbrücke und den laufenden Gleisarbeiten in der Belgiergasse wird ab 24.5.2025 mit dem Anschluss der Schienen von der Vorbeckgasse in die Annenstraße gestartet. Da es sich bei der Verlegung der neuen Gleise um eine komplexe „Gleisanbindung“ samt Leitungsinfrastruktur handelt, dauern diese Arbeiten inkl. Schienenersatzverkehr bis 7.9.2025. Bgm.in Elke Kahr: „Nach zwei Jahren Bauzeit geht es nun in die letzte Etappe des wichtigen Straßenbahnprojektes. Bereits jetzt lässt sich feststellen, dass die Neutorgasse sehr gut angenommen wird und die Innenstadt aufwertet. Mit der Fertigstellung der Neutorlinie im Herbst wird der öffentliche Verkehr noch zuverlässiger und flotter.“


Die Steiermark-Schau setzt alle zwei Jahre gesellschaftlich bedeutende Themen aus künstlerischer und wissenschaftlicher Perspektive in Szene. In diesem Jahr wird die Schau nicht nur von einem, sondern von drei Pavillons komplettiert. Am Wiener Heldenplatz wird es die einzigartige Gelegenheit geben, alle drei Pavillons an einem Ort zu besuchen, ehe sie in der Steiermark präsentiert werden. Besucht werden kann die Ausstellung von 13. bis 30. März bei freiem Eintritt. Umgesetzt wird die Schau „Ambition & Illusion“ vom Universalmuseum Joanneum, für GF Marko Mele sind die Pavillons ein Highlight: „Das Besondere an der Steiermark-Schau ist eben diese Kombination eines fixen Hauptstandortes mit einem mobilen

Vor über 40 Vertretern der österreichischen Immobilien- und Wohnungswirtschaft, der Bauwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung erfolgte, organisiert von AEE INTEC, der LIG sowie dem ausführenden Unternehmen Strobl Bau am 25. Februar eine Live-Vorführung des neuartigen Renvelope-Sanierungssystems für großvolumige Gebäude. Nach erfolgreicher Umsetzung und Abschluss der Sanierung des Schulgebäudes und des Lehrlingsheimes, wurde nun am gleichen Areal auch das Küchen- und Wirtschaftsgebäude in Angriff genommen. AEE INTEC-GF Christian Fink betonte die Innovationskraft dieser Projekte: „Die serielle Sanierung ist ein entscheidender Hebel, um die historisch niedrigen Sanierungsraten in Österreich zu erhöhen.“

Die Montanuniversität Leoben verlieh zum 6. Mal den Wissenschaftspreis für Montanistinnen. Er würdigt herausragende Leistungen von Wissenschaftlerinnen und ist mit insgesamt 8.000 Euro dotiert. Die Auswahl erfolgt durch eine externe Jury, basierend auf Nominierungen von Professoren der Universität. Zur Preisverleihung wurde der Film „International Women’s Day“ präsentiert, der die Geschichte von Frauen in der Wissenschaft beleuchtet. Die Preisträgerinnen sind Alice Lassnig (Postdoc – Forschung zu metallischen Dünnschichten); Xiangyun Shi (Praedoc – Untersuchung von Shales und Mudstones); Magdalena Kirchmair (Master – Entwicklung von Wasserstoffpermeationsbarrieren) und Elena Dvorak (Bakkalaureat – Studie zur Abfallverwertung).
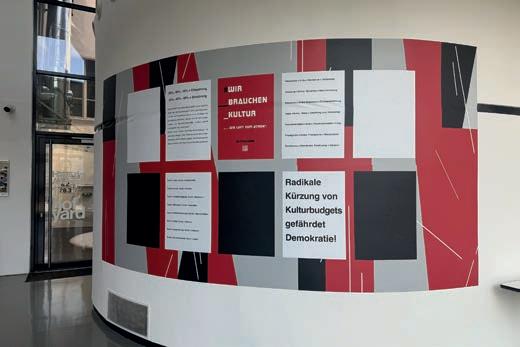
Grazer Kulturinstitutionen warnen vor den Auswirkungen von Kürzungen auf das Kulturland Steiermark. Gemeinsam appellieren sie an die Politik auf allen Ebenen, die Maßnahmen zurückzunehmen und sich langfristig zum Kulturstandort Steiermark zu bekennen. Immer mehr Kunstinstitutionen informieren über das Projekt „Wir brauchen Kultur“ von „Ausreißer − Die Wandzeitung“. Sie berichten online, über ihre Besucherzentren und über die Presse, dass Förderungen ein wichtiges Instrument der Kulturarbeit sind und wie sich Kürzungen auf das tägliche Leben auswirken werden. Den Appell und das Informationsprojekt unterstützen Kunsthaus Graz, Graz Museum, Schauspielhaus Graz, Oper Graz, Akademie Graz, Forum Stadtpark u.v.m.
Zum Weltfrauentag am 8. März startete das AMS Steiermark seine Frühjahrskampagne „Was Tom kann, kann Lisa auch!“ Präsentiert werden Frauen, die mit AMS-Unterstützung in handwerkliche und technische Berufe einsteigen – etwa über arbeitsplatznahe Ausbildungen. Bei diesem Modell können Unternehmen künftige Fachkräfte direkt im Betrieb qualifizieren. „Auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen und sein Ding durchziehen und sich selbst und auch anderen zeigen: Auch eine Frau schafft diesen Job!“, bekräftigt Alexandra Einzinger. Nach zwei abgeschlossenen Lehren im Einzelhandel und im Büro ist die 33-Jährige zweifache Mutter im Berufsleben „angekommen“ und absolviert eine Metalltechnik-Lehre beim Unternehmen Posch in Leibnitz.

Welche Macht hat die Stimme in einer Welt, in der das Schweigen zum politischen Instrument wird? „Freeing the Voices“ im Kunsthaus Graz geht dieser Frage nach und versammelt Werke, die sich auf vielfältige Weise mit der Befreiung von Stimmen auseinandersetzen. Die Schau, kuratiert von der slowenischen Kunsthistorikerin Zdenka Badovinac, präsentiert 27 künstlerische Positionen mit Fokus auf Videoinstallationen. „Ich denke, gerade nach der Covid-Pandemie ist eine Ausstellung über die Stimme von besonderer Bedeutung. Während der Pandemie haben wir fast ausschließlich ohne Stimme kommuniziert, sondern über Textmessages oder Ähnliches. Umso wichtiger ist es nun, die Stimme wieder physisch erlebbar zu machen“, so Badovinac.

Die steirischen Kürbiskernöl-Produzenten haben allen Grund zur Freude: Die Landesprämierung 2025 bescheinigt dem „Grünen Gold“ eine herausragende Qualität wie nie zuvor.
Die 100-köpfige Expertenjury testete 505 eingereichte Öle in einem viertägigen Verkostungsmarathon – mit beeindruckendem Ergebnis: 89 Prozent der Öle erhielten die höchste Auszeichnung, 57 Prozent erreichten sogar das absolute Punktemaximum. „Noch nie gab es so großartige Topqualitäten“, lobt LK-Präsident Franz Titschenbacher. Die Produzenten profitieren von gezielten Schulungen, die von Anbau über Ernte bis zur Lagerung reichen. „Diese Spitzenleistungen sind das Resultat unserer jahrelangen Qualitätsoffensiven“, so Titschenbacher weiter.
Steigende Anbauflächen
„Steirisches Kürbiskernöl wird von Jahr zu Jahr beliebter, der Absatz steigt“, freut sich Obmann Franz Labugger. Nach dem Anwachsen der Anbauflächen im Vorjahr um 26 Prozent auf 9.901 Hektar erwartet Labugger auch heuer eine weitere Ausweitung der Kürbisflächen: „Wir gehen davon aus, dass um fünf bis zehn Prozent mehr Kürbisse in der Steiermark angebaut werden.“ In Rückblick auf die Ernte 2024 betont Labugger: „Die Erntemenge lag im Schnitt, die Kürbiskernöl-Qualität ist jedoch top.“ Eine aktuelle Marktstudie unterstreicht den Erfolg: Zwei Drittel der Österreicher kennen mittlerweile die geschützte Marke „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“, die Bekanntheit ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Als wichtigste Kaufkriterien nennen Konsumenten Qualität (98 Prozent), Regionalität (91 Prozent) und die bäuerliche Herkunft (83 Prozent), erklärt Reinhold Zötsch, GF Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl: „Alle zwei Jahre führen wir eine Marktforschung durch, um die Bekanntheit der Marke und das Kaufverhalten unserer Kunden zu messen.“ Mit stabilen Preisen und steigender Nachfrage bleibt das Steirische Kürbiskernöl eine Erfolgsgeschichte – und ein kulinarischer Botschafter der Region.

Die vier Top-Platzierten Kernölproduzenten (v.li) mit LK-Präs. Franz Titschenbacher, Gabriele Kern, Anita Reiter-Haas, Josef Berghofer, Karl Friedrich und Obmann Franz Labugger

Philipp Gady, GF und Eigentümer der Gady Family
Warum wird der 116. Gady Markt erst zum Herbsttermin im September stattfinden?
Wir haben uns im Führungsteam der Gady Family dazu entschieden, uns im Frühjahr voll und ganz auf die zahlreichen Veranstaltungen zu konzentrieren. Zwei Veranstaltungshighlights sind die motionexpo 2025 und der Frühlingsmarkt in Fehring am 6. April, den wir bereits zum 35. Mal ausrichten. Die Verschiebung des 116. Gady Marktes in Lebring hat weder wirtschaftliche Gründe noch resultiert sie aus personellen Engpässen und wir freuen uns auf das Steirische Volksfest in Lebring am 6. & 7. September.
Wie beurteilen Sie die weitere technische Entwicklung in der Mobilität?
Echte Technologieoffenheit erfordert Wachstumsimpulse, insbesondere für die E-Mobilität in Österreich. Trotz des Fokus auf Elektromobilität bleibt unsere Premiummarke BMW seinen Wurzeln treu und setzt auch weiterhin auf die Entwicklung von Verbrennungsmotoren, um den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Welche Angebote bieten Sie hier für Unternehmen?
Die Branche bietet großes Potenzial, um attraktive Fuhrparkangebote mit alternativen Antriebssystemen zu schaffen. Flexible Leasingmodelle, steuerliche Anreize und die Integration von Ladelösungen sind dabei essenziell. Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge unterstützen die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Dafür braucht es Planbarkeit und stabile Rahmenbedingungen. Eine CO2-basierte Besteuerung von Verbrennern kann den Wandel unterstützen, muss jedoch mit einem Ausbau der Ladeinfrastruktur und fairen Bedingungen für Unternehmer einhergehen.
Gemeinsam mit der Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark und Raiffeisen-Immobilien Steiermark hat Raiffeisen Research den großen steirischen Immobilien-Report präsentiert. Die regional vertiefende Studie zeigt: Die Steiermark gehört zu den preisgünstigeren Pflastern in Österreich. Speziell jetzt sei für potenzielle Käufer ein guter Zeitpunkt für Eigentum, so die Experten.
Die Leistbarkeit von Wohnraum bleibt ein zentrales Thema für viele Steirer. 2025 gibt es Anlass zu vorsichtigem Optimismus. „Wir sehen die Talsohle bei den Finanzierungsvolumina durchschritten und stehen unseren Kunden mit maßgeschneiderten Wohnpaketen und Beratungen zur Seite“, betont Rainer
Stelzer. „Die Steiermark ist im Vergleich zu anderen Bundesländern ein günstigeres Pflaster. Für Käufer und Verkäufer bieten sich daher aktuell chancenreiche Zeiten am steirischen Immobilienmarkt“, analysiert Stelzer.
Große Preisrückgänge sind ausgeblieben
Die letzten zweieinhalb Jahre waren keine leichten Jahre für den Immobilienmarkt. Rückblickend kann jedoch gesagt werden: Der befürchtete deutliche Preisrückgang ist ausgeblieben. „Der Wohnimmobilienmarkt hat recht kontrolliert die Reiseflughöhe etwas verringert, ein preislicher Sturzflug ist aber ausgeblieben“, so Matthias Reith, Senior Ökonom für den Wohnimmobilienmarkt
bei Raiffeisen Research. Österreichweit verbilligte sich Wohneigentum seit dem preislichen Höhepunkt lediglich um gut 5 %. Zum Vergleich: Das seit der Pandemie erreichte Preisplus liegt damit immer noch bei 26 %.
Guter Zeitpunkt für den Kauf „Schon jetzt spüren wir eine vermehrte Nachfrage nach leistbaren Objekten, die oftmals in ländlichen Regionen abseits der Immobilien-Hotspots oder in der eigenen Heimatgemeinde liegen. Auch dank eines gewachsenen Immobilienangebots“, erklärt Raiffeisen Immobilien-GF Andreas Glettler. Der Immo-Experte prognostiziert daher: „Der Zeitpunkt für Eigentum ist jetzt sehr gut.“

8073 Feldkirchen bei Graz: Familienfreundliche 3-Zimmerwohnung in Grünruhelage 73,83 m² Nutzfläche, BJ 2007, im 2. und letzten Stock, gutes Raumkonzept, Süd-Ausrichtung, ca. 9 m² großer Süd-Balkon, Carport zum KP von 15.000,- Euro, HWB: 61,4 kWh/m2a, KP: 183.000,- Euro,
Renate Müller, M +43 664 8184132, renate.mueller@sreal.at, www.sreal.at




Ihr Immobilienverkauf in verlässlicher Hand!
Gerade jetzt umso wichtiger: Fundierte und umfassende Beratung, langjährige Marktkenntnis und Erfahrung. Persönlicher Einsatz, breite Werbewirksamkeit und gewissenhafte Unterstützung bis zur problemlosen Kaufvertragsabwicklung sind Ihnen sicher. Unsere Kunden sind für Sie Barzahler! In einem persönlichen Gespräch berate ich Sie unverbindlich und freue mich auf Ihren Anruf!
Sabine Heißenberger, 0664/85 50 199 sabine.heissenberger@rlbstmk.at www.raiffeisen-immobilien.at
Jetzt kostenlose Marktwerteinschätzung* für Ihre Immobilie!
Sie überlegen Ihre Immobilie zu verkaufen?
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine kostenlose Marktwerteinschätzung mit einem RE/MAX Experten.
Fr. Mag. (FH) Elke Raich: 0664/42 41 767, e.raich@remax-for-all.at Hr. Daniel Harg, 0664 18 73 385, d.harg@remax-for-all.at
*Gültig vom 03.03.2025 bis 30.05.2025
Kalsdorf bei Graz: Moderne 3-Zimmerwohnung mit großem Südbalkon 67,05 m² Nutzfläche, Erdgeschoss, sehr gutes Raumkonzept, große südseitige Terrasse mit ca. 22,10 m², hochwertige Einbauküche inkl. Aller E-Geräte, Fernwärme, Fußbodenheizung, Tiefgaragen-Stellplatz zum Kaufpreis von 17.000,- Euro, Kellerbabteil, HWB: 22 kWh/m2a. KP: 198.000,- Euro,
Renate Müller, M +43 664 8184132, renate.mueller@sreal.at, www.sreal.at












Der Begriff Erfolgsgeschichte trifft bei Hans Jürgen Maurer den Nagel auf den Kopf.
Von einem Köflacher Keller aus schuf der 53-Jährige einen Betrieb mit Millionenumsatz.
Heute richtet er bis nach Wien ein.
Wie hat er das geschafft?
Dass dort, wo so viel gehobelt wird, sprichwörtliche Späne fallen, muss man gerade einem Tischlermeister naturgemäß nicht erklären. Und doch ist Hans Jürgen Maurer heute nicht ganz zufrieden mit dem Zustand seines Firmensitzes in Köflach. Es ist aber nicht der Verschnitt, der in der hinteren Ecke hervorlugt und ihm ein bisschen unangenehm ist. Warum auch. Der wird ohnehin bald tatsächlich zu Spänen gehäckselt und landet dann samt dem restlichen Holzmehl in einem großen Silo, um in bester Kreislaufwirtschaftsmanier für die Heizung seiner Produktionshalle genutzt zu werden. Aber warum sagt Maurer dann »bei uns ist heute ein bisschen Chaos«? Weil heute Epicon-Tag ist. Genau genommen wird schon seit zwei Tagen an der Installation der »Epicon«, dieses imposanten und futuristischen, mehrere Meter langen Geräts, gearbeitet. Ein Gerät, das bald mithelfen wird, individuelle Möbel oder ganze exklusive Innenausstattungen anzufertigen. Neben der »alten« Pro-Master, die gerade vom heimlichen Star der Tischlerei Timea Jarabek –später mehr! –, programmiert wird, soll diese bald parallel zum Einsatz kommen. »Es fehlt nur noch die Montage des Absaugungsanschlusses«, erklärt Maurer. Epicon und »Pro-Master«
Ich bin jemand, der genau die Dinge angeht, die sich andere nicht zutrauen.
Hans Jürgen Maurer
sollen dann gemeinsam laufen. »Die Epicon ist noch einmal leistungsstärker und moderner, schauen wir mal, wie sich macht und ob wir beide brauchen«, sagt Maurer. »Mehr Power« fällt da dem gewerbefremden »Hör mal, wer da hämmert«-Freund gleich ein. Aber keine Sorge, hier geht nichts in Tim Allen’schen Übermut in Rauch auf. Hier wird bald einfach nur noch moderner und effizienter gearbeitet. Und womit denn nun genau? Mit dem neuesten CNC-Fräsen-Modell der Firma Holzher.
Erfolg nach Maß
CNC. Das steht für Computerized Numerical Control. Dabei handelt es sich um? »Werkzeugmaschinen, die durch den Einsatz von Steuerungstechnik in der Lage sind, Werkstücke mit hoher Präzision auch für komplexe Formen automatisch herzustellen«. Danke, Wikipedia. »Wir arbeiten seit Jahren damit – früher haben wir das händisch gemacht. Aber die Maschinen arbeiten auf Zehntelmillimeter genau.« Gerade liegt eine Tür auf der Pro-Master – und erhält die Ausfräsungen für die Scharniere und das Schloss. Rund 400.000 Euro ist die neue Maschine wert – Maurer kauft sie aber erst, wenn sie entspricht. Sechs Monate läuft die Testphase. Für Hersteller Holzher ist Maurer nämlich nicht nur guter Kunde, aus der Geschäftsbeziehung wurde eine Freundschaft, und weil Holzher nur ein paar Kilometer entfernt in Voitsberg daheim ist, ergeben sich da Synergien. Wenn Holzher-Kunden Maschinen im Einsatz zeigen will, schauen sie kurzerhand bei Maurer in der Werkstatt vorbei.
Gute Geschäfte
Wer Geräte, die 400.000 Euro wert sind, aufstellen lässt, muss Geschäfte führen, die sehr gut laufen. Rund zwei Millionen Euro beziffert Maurer den Umsatz seiner Tischlerei im Jahr. 14 Mitarbeiter hat er, das klingt nach gutem Deckungsbeitrag – und wahrhaftig nach einer dieser inflationär herbeigeschriebenen Erfolgsgeschichten. Und wie so viele gut zu erzählende Erfolgsgeschichten begann diese nicht in einem Industriegebiet. Auch nicht in einer Apple’schen Garage wie bei Steve Jobs in Palo Alto, Kalifornien, aber in einem Keller in der Lipizzanerheimat. »Mein Vater war gelernter Tischler, arbeitete aber als Glaser«, erinnert sich Maurer zurück. »Nebenbei hat er privat in seiner Werkstatt gearbeitet, hauptsächlich für Familie und Freunde. Ich bin also mit dem Handwerk aufgewachsen.« Später lernt er das Tischlerei-Handwerk in einer Fachschule in Villach,
nicht in Kuchl oder Mödling, wo er auch landen hätte können – auch der Wurzeln seines Vaters sei Dank. Der ist Kärntner, womit auch endlich erklärt ist, warum Maurer mehr Kärntnerisch durchblitzen lässt in seinen sympathischen Ausführungen als Weststeirisch. Kurz arbeitete er bei Tischlereien in Köflach, legte die Meisterprüfung erfolgreich ab und dann ging’s langsam hoch hinaus – mit der Selbstständigkeit. Und das trotz gerade einmal 230 Zentimeter Raumhöhe im Keller. »Wenn du anfängst und keine Mitarbeiter hast, gibt es keine Auflagen – du kannst einfach loslegen.« Die ersten Kunden kamen aus der Umgebung und dem Umfeld. Da eine Küche, dort ein Möbelstück. Heute ist der Keller von Start-up-Format übrigens nicht mehr im Familienbesitz. »Das finde ich schade, aber das hat sich leider nicht ergeben.« Steve Jobs’ Gründungsgarage gehört übrigens noch immer seiner Schwester, das Haus steht unter Denkmalschutz, aber das ist eine anderen Biografie.
»Geht nicht, gibt’s nicht« Wir bleiben in Köflach. Dort, in der Industriezeile 28, kaufte Maurer einst der Gemeinde Industriefläche ab. Gemeinsam mit seinem Vater, der seinen Job als Glaser für den Einstieg beim Unternehmer-Sohnemann aufgab. Auf dem alten Grundstück von damals steht sein Betrieb bis heute. Dass das Glück den Tüchtigen ereilt, wird ebenfalls inflationär überliefert. Hans Jürgen Maurer ist jedenfalls tüchtig, und aus einem dieser Hölzer geschnitzt, die beständig überzeugen. Durch Qualität. Und das hat ihn in die Lage gebracht, dass er mittlerweile nicht mehr selbst zum Tischlern kommt, sondern Geschäfte führt, Kunden betreut – und Aufträge manchmal gar absagen muss. Gerade kürzlich hätte er nicht abgesagt. Er hat bei einem Großauftrag in Oberösterreich mitgeboten, der ein Volumen von drei Millionen Umsatz allein bedeutet hätte. »›Geht nicht, gibt’s nicht‹, sage ich gerne. Ich weiß, das klingt abgedroschen, aber ich bin jemand, der genau die Dinge angeht, die sich andere nicht zutrauen.«
Der Duft des Holzes
Wir verlassen kurz die Produktionshalle, in der es wunderbar nach frischem Holz und Leim duftet, und begeben uns in den vorderen Bereich des Gebäudes, die Büroräumlichkeiten. Viel Sonne dringt an diesem Donnerstagnachmittag durch die großen Fenster in Maurers Büro. Die Tochter sitzt hier eigentlich auch am lang gezogenen Schreibtisch, ist an diesem Tag aber



Ohne Expansion nach Wien wären wir wohl nicht auf diesem Niveau.
Hans
Jürgen
Maurer
bereits außer Haus. Der Computer ist nicht nur Arbeitsgerät zur Planung, sondern offenbart auch Dokumentationen der Projektvielfalt des Unternehmens. »In den ersten Jahren waren wir ein klassischer Handwerksbetrieb mit wenigen Mitarbeitern«, erklärt Maurer. »Heute sind wir in einer Nische, die uns erlaubt, mit hochwertigen Projekten solide Gewinne zu erwirtschaften.« Wie es dazu kam? »Ohne Expansion nach Wien wären wir wohl nicht auf diesem Niveau. Dort gibt es eine andere Kaufkraft, die es uns erlaubt, hochwertigere Materialien anzubieten und einzusetzen.« Und so zeigt er dann ein Beispiel, das die ganze Expertise und das Know-how seiner Firma zeigt. Ein kreisrundes Wartezimmer – für einen Zahnarzt im ersten Wiener Gemeindebezirk. »3.000 Holzelemente haben wir dafür verbaut«, sagt er. »Wir setzen aber nicht nur auf Holz, sondern verwenden auch andere Materialien wie Stein, Glas oder Metall und Kunststoff.« Maurer bietet Fullservice, das schätzen die Kunden. Das Wiener Wartezimmer wurde übrigens komplett in Köflach in der Fertigungshalle aufgebaut, ehe es dann in Einzelteilen transportiert und vor Ort aufgebaut wurde. »Bei uns gibt es kein eigenes Montageteam, sondern unsere Fertiger in der Halle bauen auch vor Ort auf«, erklärt Maurer. Denn nicht nur die Logistik ist bei solchen Projekten nicht zu unterschätzen, sondern es soll ja endlich auch alles vor Ort so ausschauen, wie es am Plan erdacht wurde.
Ein Punkt fehlte für die »World Skills« Aber wie expandiert man nun vom Köflacher Keller in die oberste Liga der Inneneinrichtung? »Meine damalige Partnerin [Anmerkung: und jetzige Frau] arbeitete für Chanel und kannte eine Unternehmerin, die ein exklusives Einrichtungsgeschäft betrieb.

Über sie erhielten wir erste Aufträge für exklusive Einrichtungen, wodurch wir in Architekturbüros und Designer-Kreise kamen.« Wir, das sind eben 14 Mitarbeiter. Eine davon ist Timea Jarabek. Und nun kurz zur Vita der Frau, die noch immer mit der Pro-Master bestens beschäftigt ist: Matura in der Ortweinschule in Graz, verkürzte Lehre bei Maurer mit Schwerpunkt Produktion. »Dass sie sich damals für uns entschieden hat, war ein Glücksfall. Und lag auch daran, dass wir in der Ortweinschule am schwarzen Brett aufschlagen, wenn wir Lehrlinge suchen«, sagt Maurer stolz. »Timea ist mittlerweile in der Werkstatt und im Büro tätig und übernimmt komplette Projekte.« Star ist sie übrigens deshalb ein heimlicher, weil sie 2024 den Landeslehrlingswettbewerb gewann. Beim Bundesbewerb in Salzburg landete sie mit nur einem Punkt Rückstand auf den Sieger auf Platz zwei, sonst wär’s gar zu den »World Skills« gegangen. Timea ist bei weitem nicht der einzige Lehrling, der bei Maurer gefördert wird. »Wir haben schon 37 Lehrlinge ausgebildet«, sagt der 53-Jährige. »Zudem bringe ich an der polytechnischen Schule Jugendlichen das Tischlerhandwerk näher.« Auch sonst wird ihm nicht langweilig. Immerhin ist er Bezirksinnungsmeister und designierter stellvertretender Landesinnungsmeister der Tischler. Und eigentlich auch Sportschütze. Über einen Freund seien seine Frau und er zu dem Hobby gekommen. »Beim Schießen zählt jeder Millimeter«, sagt er – eigentlich auch eine Analogie zum Tischlerhandwerk. »Anfangs habe ich mir gedacht, ich werde nie eine Taube treffen, aber dann haben wir uns einen Trainer genommen.« Später war Maurer sogar bei internationalen Turnieren in Italien, Tschechien oder Ungarn im Einsatz. Sein Highlight: ein dritter Platz bei den Staatsmeisterschaften. »Geht nicht, gibt’s nicht« eben. n
Tischlerei und Einrichtungsstudio Maurer KG 8580 Köflach, Industriezeile 28 Telefon +43 (0) 3144 6595 tischlerei-maurer.at
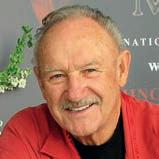
Der Erfolg eines Schauspielers ist zu 75 Prozent reines Glück. Der Rest ist einfach Ausdauer.
Eugene Allen »Gene« Hackman, 1930–2025, US-amerikanischer Schauspieler
Würdigung einer späten Legende
Im März wäre der Schriftsteller Bodo Hell 82 Jahre alt geworden. Das Literaturhaus Graz lud aus diesem Anlass zu einer Lesung mit Johannes Silberschneider. Und würdigte damit einen Mann, der zu spät zur Legende wurde.

Von Peter K. Wagner
Teigtaschen sind ein Phänomen. Kaum eine Esskultur hat es sich nehmen lassen, Teig mit regionalen Köstlichkeiten zu füllen und zu Nationalgerichten aufsteigen zu lassen. Kurze Kostprobe gefällig? Kärntner Kasnudeln, polnische Pierogi, georgische Chinkhali, italienische Ravioli sowieso – tolle Form! –, japanische Gyoza, nepalesische oder tibetanische oder indische Momos, lateinamerikanische Empanadas oder einfach, richtig, die gute alte schwäbische Maultasche. Apropos Maul. Die Maultrommel hat eine ähnlich globale Geschichte. Niemand weiß so recht, wo sie zuallererst bespielt wurde, aber ob aus Bambus, Metall oder – wie ein beliebter Tedx-Talk aus 2013 ausweist –Kreditkarte, das kleine Musikinstrument zeigt eindrucksvoll: Man kann auch mit wenigen Mitteln viel erzeugen.
Abendliche Würdigung
Ein gebürtiger Salzburger konnte das auch – mit seinen Worten. Aber auch mit der von ihm geliebten Maultrommel. Sein Name: Bodo Hell. Wer so heißt, muss Künstler werden, könnte man meinen. Und es sei an dieser Stelle vermittelt, dass es dem Autor dieser Zeilen nahezu unangenehm ist, ihn eigentlich nur deswegen kennenlernte, weil er im August des Vorjahres plötzlich nicht mehr aufzufinden war. »Sein Verschwinden hat ihn zur Legende werden lassen«, weiß auch Annette Knoch, seine Verlegerin vom Grazer Literaturverlag Droschl. Ihr Verlag war es, der gemeinsam mit dem Literaturhaus Graz zu einer abendlichen Würdigung samt grandioser Lesung Hell’scher Texte von Johannes Silberschneider in die Grazer Elisabethstraße lud. Anlass: Zwei Tage zuvor, am 15. März, wäre Hell 82 Jahre alt geworden. Hell verbrachte schon seit über 40 Jahren die Sommer nicht schreibend, sondern sich inspirieren lassend – als Senner auf der Grafenbergalm am Dachstein mit Rindern, Ziegen und Hühnern. Dort dürfte ihm widerfahren sein, worüber er schon Jahre zuvor reflektierte, wie der Litera-
turwissenschaftler Manfred Mittermayr an seinem Würdigungsabend die rund 260 Menschen im Literaturhaus erinnert: Das Gebiet rund um den Dachstein, mit all seinen Spalten und Unweglichkeiten, sei ein gefährlicher Ort. Und, so erinnert Mittermayr ebenfalls, verloren geglaubte Tiere wiederzufinden, wäre eben auch eine Aufgabe der Hell’schen Sommer(arbeits)frische gewesen.
Der schöne Gedanke
Die Moderatorin des Abends, Julia Zarbach, hatte Hell noch wenige Wochen vor seinem Verschwinden ausführlich für Ö1 interviewt und wurde dabei von ihm und seiner positiven Erzählkunst in den Bann gezogen. Sie fasst zusammen, was seine Verlegerin Knoch als den »schönen Gedanken« am Ende eines Abends zwischen Unterhaltung und andächtigen Gedenkens stand: Kann es sein, dass Bodo Hell in die Landschaft eingegangen ist, die er so geliebt hat?
In die österreichische Kulturlandschaft ist Hell ohnehin schon eingegangen. Er »hat viel gerettet, was im alpinen Raum an Sprache aufbewahrt war«, weiß Literaturexperte Mittermayr. Er sagt auch: »Hell hat Wissen verteilt, ohne zu belehren.« Er habe Texte erschaffen, die Johannes Silberschneider am liebsten weitergeschrieben hätte, und »mehrmals lesen kann, weil immer wieder neue Türen aufspringen«. Bodo Hell ist – oder wohl leider »war« – vielseitig. In seiner Kunst und seinen Interessen, er war außergewöhnlich und experimentell. Er war jedenfalls auch – ein Phänomen. n

Begabte Bäume
Von Bodo Hell mit 23 Zeichnungen von Linda Wolfsgruber Verlag Droschl 2023 droschl.com
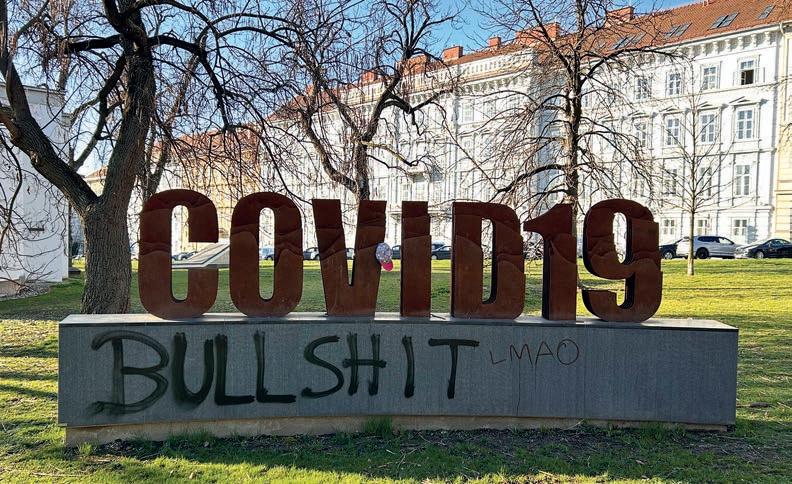
Von Peter K. Wagner wurde das Kunstwerk mit zwei Nachrichten von Unbekannten versehen. »Bullshit« steht dort mächtig in Versalien, ebenfalls etwas rissig. Und auch ein zurückhaltender gespraytes LMAO hat es auf den massiven Sockel geschafft. »Laughing my ass off«, wird damit gemeint sein. »Leck mich am O****«, wäre auch denkbar. Man könnte nun von Sachbeschädigung oder Vandalismus sprechen. In diesem Fall gilt es aber anders einzuordnen: Wer auch immer sich hier derart unkreativ austobte, dem sei gratuliert. Die Belanglosigkeit der Verschandelung ist endlich eine stimmige Vollendung – eines überraschend austauschbaren und wenig inspirierenden öffentlichen Denkmals. n
D rei Coronadenkmäler gibt es in Graz. 220 Künstler hatten einst rund 300 Projekte eingereicht. Das auffälligste und plakativste findet sich seit Juni 2023 auf der Erzherzog-Johann-Allee, auf der Wiese zwischen Burgring und Burgtor. Wetterfesten Cortenstahl verwendete Künstler Michael Schuster für den Schriftzug »COVID 19«. Die Risse bei den Buchstaben stehen auch stellvertretend für die gesellschaftliche Spaltung, die uns die Pandemie brachte. Und dieser Tage, fünf Jahre nach Ausbruch der Pandemie, in diversen Aufarbeitungsformaten präsenter sind als man sich wünschen würde. Vor kurzem
Grazer Oper
Von Michael Petrowitsch
RUnterhaltsames, ja allzu Unterhaltsames gibt es in der Grazer Oper zu hören und vor allem zu sehen. »So machen es alle (Frauen) oder Die Schule der Liebenden« fetzt dahin wie ein Springbock im Frühling. periment ein. Es startet ein Feuerwerk, eine fingierte Treueprobe mit allerhand Wahnwitz, Verkleidung und Wirrungen. Zuerst noch leichtfüßig und humorvoll, spitzt sich das Spiel immer weiter zu und führt, trotz vordergründigen Happy Ends, zu tiefgreifenden emotionalen Verletzungen sowie einem nicht umkehrbaren Erkenntnisgewinn der Paare. Betrügen und betrogen werden, belügen und belogen werden.
ichard Wagner hat sich abfällig über Mozarts Zweiakter geäußert. Beethoven auch. Zu simpel zu oberflächlich der Text, albern, kindlich soll er sein. Natürlich ist die von Da Ponte verfasste Handlung (Partnertausch, Untreue, Manipulation etc.) unmoralisch und steht eigentlich einem Bad Ischler Pudertanz skandalumwittert um nichts nach. Demensprechend hatte das Werk über Jahrzehnte aufführungsbezogene Schwierigkeiten. Dennoch haben wir hier eine Erfolgsgeschichte vor uns liegen, so erfolgreich, dass die in Kooperation mit Theater und Konzert St. Gallen entstandene Produktion uns das angehende Frühjahr versüßt.
Mozart im Hier und Jetzt
Um was geht es denn? Um zwei über beide Ohren verliebte junge Paare und eine Wette über die Treue, also um ein wahres Experiment! Regisseurin Barbara-David Brüesch transformiert Mozarts schwierigst aufzuführende Oper ins Hier und Jetzt und befragt das Stück clever auf seine Aktualität. Handy und Chats auf Visuals für das Publikum inklusive. Die musikalische Leitung übernimmt Dinis Sousa, dessen kurzfristig übernommenes Dirigat von Berlioz’ Les Troyens bei den Salzburger Festspielen 2023 für Furore sorgte.
Manipulation, gute
Alles im Leben dreht sich um (gute) Manipulation, in diesem Fall um eine gewagte These Don Alfonsos. Angeblich kann, so der Obermanipulateur, keine Frau treu sein. Ziemlich gemein, was das angezettelt wird! Die männlichen Parts, Guglielmo und Ferrando, zeigen sich höchstempört, sind sie sich doch der Beständigkeit ihrer Partnerinnen Fiordiligi und Dorabella absolut sicher. Bedenkenlos lassen sie sich auf ein Ex-
Doppelhaushälftige Bühne
Das Bühnenbild mit einer aufklappbaren Doppelhaushälfte ist eine fantastische Finte, die die komplizierten Verwirrspiele optisch umzusetzen. Ein Bravo an Alain Rappaport. Die Besetzung ist mit jungen, frechen Stimmen famos gelungen. Corina Kollers Fiordiligi überflügelt alle und überzeugt am besten. Ted Black als Ferrando, Nikita Ivasechko als Guglielmo, Sofia Vinnik als Dorabella, Ekaterina Solunya als Despina und Wilfried Zelinka als Don Alfonso leiten durch drei lustvolle Stunden. Die Chance auf einen entspannten und gleichzeitig turbulent fordernden Abend besteht noch einige Male. n


Beinah mozarteske
Anmutung


100 %
Nachhaltigkeit durch menschliche Betreuung
99,9 %
Versorgungssicherheit in der mobilen Betreuung
weniger Zeit für die Organisation durch Beratung 98,7 %
Nikita Ivasechko und Ted Black Mobilen Assistenzdienste für Menschen mit Behinderung: +43 316 677 248
Così fan tutte Von Wolfgang Amadeus Mozart Dramma giocoso in zwei Akten, KV 588 (1790)
Libretto von Lorenzo Da Ponte
Noch am 26. u. 28. 3. sowie am 2. u. 5. 4. oper-graz.com
Online einfach mehr erfahren: Jetzt Podcast anhören, viele neue Seminare und Events entdecken: scannen oder www.spia.org
Allmonatliche Finalbetrachtungen von Johannes Tandl

Kompromisse sind das Fundament jeder Zusammenarbeit. Ohne sie ist gemeinsames Führen unmöglich. In der aktuellen politischen Landschaft, sowohl in Österreich als auch international, scheint die Fähigkeit zum Kompromiss immer mehr zu schwinden. Das hat unter anderem mit dem Stil der politischen Kommunikation zu tun. Vor Wahlen suchen die Parteien nach besonders spitzen Positionen, mit denen sie Aufmerksamkeit erregen und ihr Stammpublikum zum Hingehen motivieren. Gleichzeitig machen sie sich vom politischen Mitbewerb unterscheidbar. Dabei wären die Politiker gut darin beraten, ihre Positionen nicht als definitive rote Linien zu kommunizieren. Denn ohne sein »Njet« zu einer Zusammenarbeit mit Herbert Kickl wäre Karl Nehammer wohl immer noch österreichischer Bundeskanzler. Es hätte schon gereicht, wenn die ÖVP ihren Anhängern auf gleichem Niveau wie die zugespitzten Botschaften erklärt hätte, dass Politik nur die Kunst des Machbaren bleibt und Maximalpositionen in Koalitionen nicht umsetzbar sind.
Versprochen und gebrochen. Oder die Tugend des Kompromisses
Aber weil die Parteien im Wahlkampf auch um ihre Identität kämpfen und sie ihren Wählern lieber ideologische Unbeugsamkeit als Kompromissbereitschaft signalisieren, verhärten sich die politischen Lager. Daher betrachten Wählerinnen und Wähler Einigungen abseits der Maximalposition oft als Verrat von Wahlversprechen. Politiker, die vor der Wahl Kompromisslosigkeit signalisieren, dürfen sich daher nicht wundern, wenn sie am Ende als Lügner dastehen. Aber auch die Medien tragen dazu bei, dass Kompromisse nicht mehr als tugendhaft gelten. Zu nennen sind diesbezüglich die ideologisch eindeutig verorteten Kommentatoren der quotenheischenden Krawallsender, die jeden andersdenkenden Politiker, der von seiner Maximalposition abgehen muss, des Wortbruchs bezichtigen. Dabei ist jeder Kompromiss, der auf einem fairen Prinzip basiert, ein guter Kompromiss! Nur wenn alle Beteiligten gleichermaßen Zugeständnisse machen, kann der politischer Stillstand oder ein Bruch von Koalitionen –der fast immer nur die politischen Ränder stärkt – verhindert werden.
Politik ist wie Management ein Handwerk, dass erlernt sein muss. Ein guter Politiker muss für sich in der Lage sein, das gesamtgesellschaftliche Phänomen der wachsenden Kompromissscheu zu überwinden. Schon klar, dass in Zeiten von Social Media und fragmentierten Öffentlichkeiten das Verständnis für unterschiedliche Positionen abnimmt. Aber Politiker werden von ihren Wählern eben nur für jene rote Linien nicht bestraft, die sie nicht überschreiten können, weil sie gar nicht erst gesetzt wurden. In der medialen Öffentlichkeit liefert der tatsächliche oder zumindest herbeigeredete Bruch eines Wahlversprechens immer noch ein hervorragendes Angriffsziel auf die Politik. Viele Journalisten können dem möglicherweise zu Recht nicht widerstehen. Das österreichische Verhältniswahlsystem mit der niedrigen Vierprozenthürde hat dazu geführt, dass keine Partei jemals mehr dazu in der Lage sein wird, ihre Agenda eins zu eins durchzusetzen. Eine Regierung, die aus mehreren Parteien besteht, kann nur bestehen, wenn sich alle Partner aufeinander zubewegen. Den Parteien kann man nur
raten, ihren Wählern schon vor dem Wahltag zu signalisieren, dass sie selbst im Falle eines Wahlsieges auf die Umsetzung eines großen Teils der inhaltlichen Versprechen verzichten werden müssen. Ein Wahlprogramm ist kein Koalitionsvertrag. Die drei Parteien der neuen österreichische Bundesregierung versuchen ihren Wählern zumindest jetzt darzulegen, dass sie mit Kompromissen tatsächlich viel mehr erreichen konnten, als wenn sie gar nicht erst Teil der Regierung wären. Dieser Weg ist der richtige. Denn die Bevölkerung muss täglich darin angeleitet werden, endlich zu begreifen, dass Kompromisse nicht das Ergebnis von Schwäche oder Verrat, sondern von verantwortungsvollem Regierungshandeln sind.
Noch geben die steigenden FPÖ-Umfragewerte Herbert Kickl vordergründig recht, dass er die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP durch seine Unnachgiebigkeit zum Scheitern gebracht hat. Aber der Tag wird kommen, an dem auch immer mehr FPÖ-Anhänger realisieren, dass sie durch die kompromisslose Haltung des FPÖ-Chefs, mit dem dieser die Partei in der Regierung verhindert hat, viel mehr verloren als gewonnen haben. n
Sie erreichen den Autor unter johannes.tandl@wmedia.at

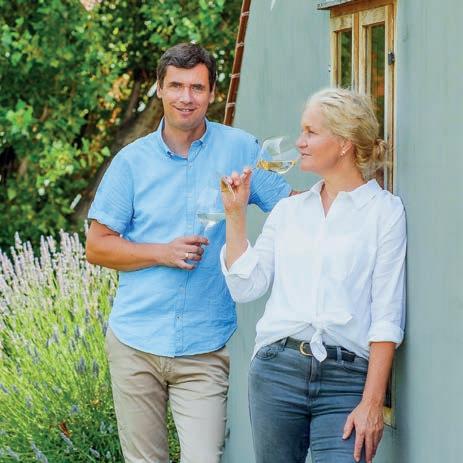

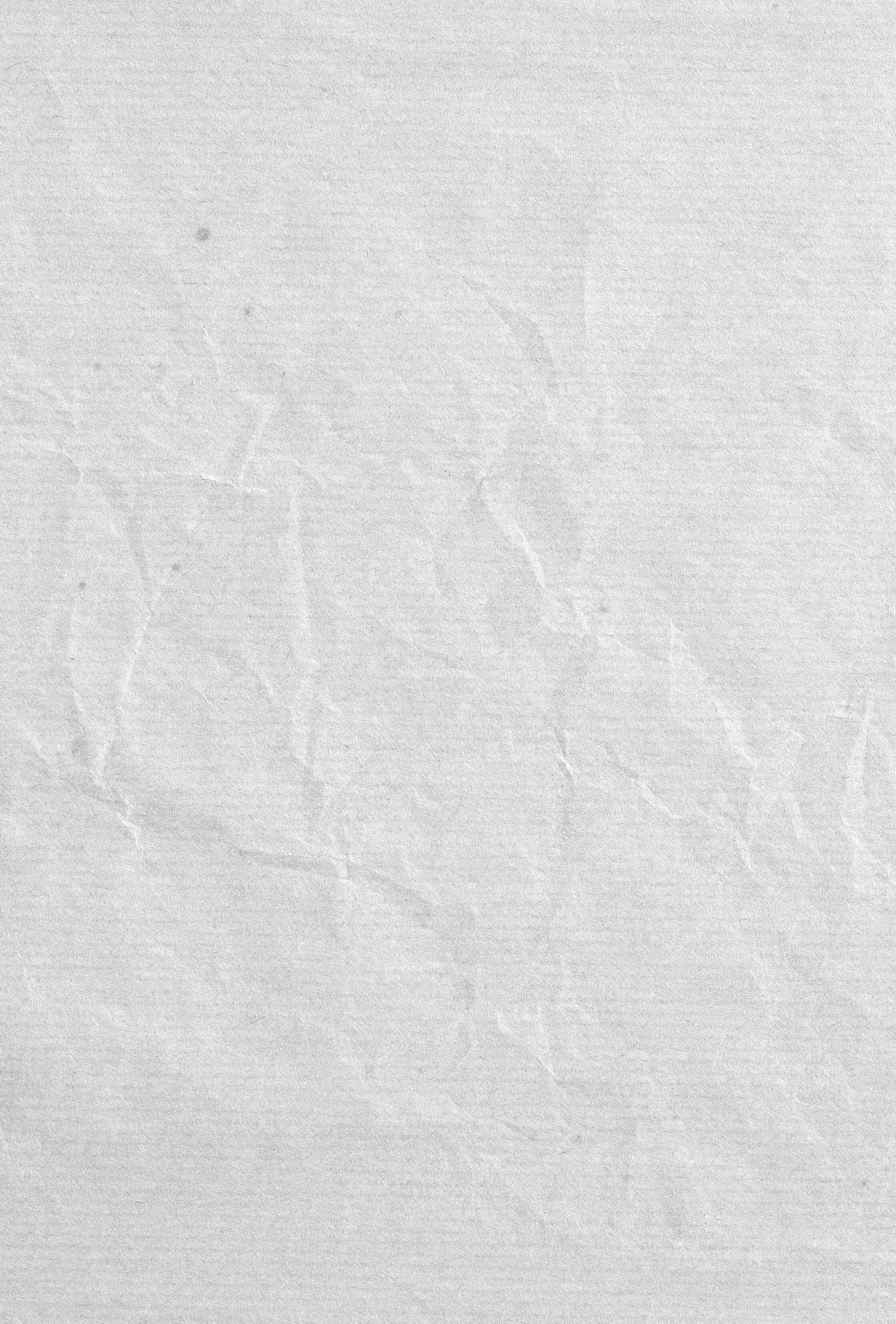

Mostls Sauerkrautmanufaktur Premstatten .. '

Gesund bleiben, wie, wann und wo ich will. Merkur Gesundheitsversicherung. Seit 1798.
Wir versichern das Wunder Mensch.

Finden wir deine Lösung: