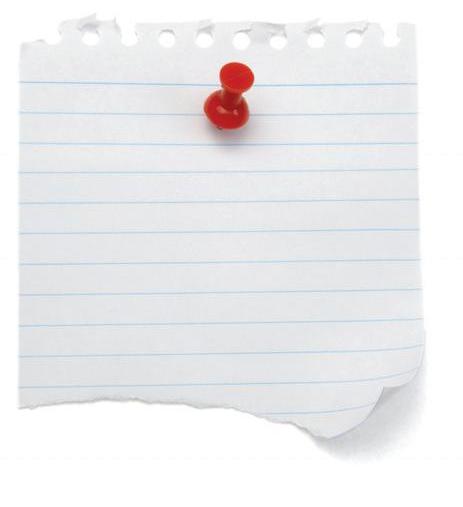
3 minute read
GASTKOLUMNE
Stellungnahme
Hannelore Faulstich-Wieland: „Jungen Frauen wird empfohlen, mehr MINT-Berufe zu ergreifen.“
Ohne die Leistungen der überwiegend weiblichen Beschäftigten wäre die Gesellschaft während der Pandemie zusammengebrochen.
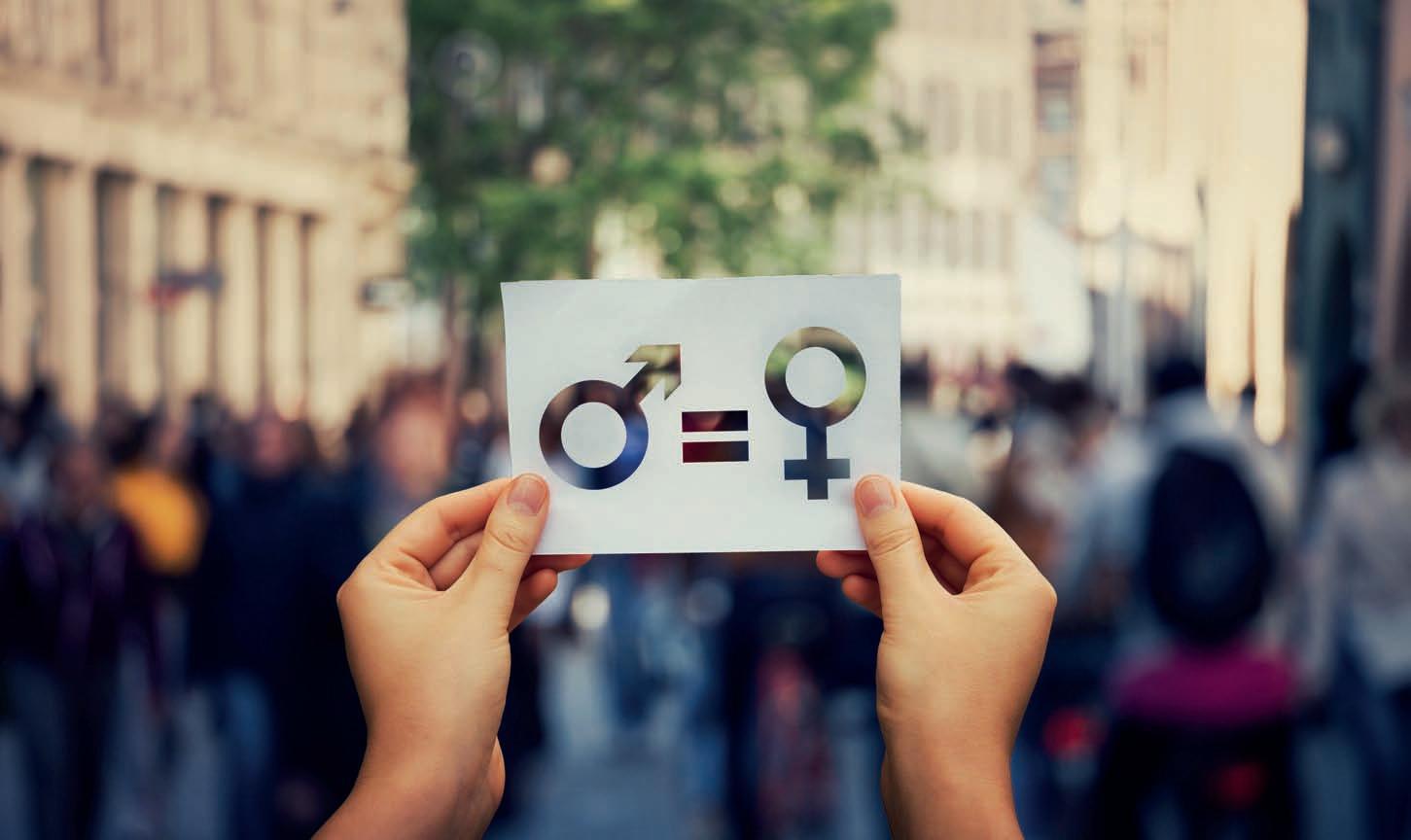
Emanzipation meint die Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit. Dies betrifft als erstes vor allem rechtliche Regelungen, die gleiche Rechte gewährleisten.
Bezogen auf das Geschlecht betraf dies z. B. das Wahlrecht für Frauen, das erst 1918 in Deutschland eingeführt wurde. Es betraf aber auch die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht, wie dies bis 1977 galt, dass verheiratete Frauen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit die Zustimmung des Ehemanns benötigten.
Emanzipation betrifft zum Zweiten strukturelle Hindernisse. Im Grundgesetz wurde zwar festgehalten, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind (§ 3 Abs. 2), aber wie die gerade genannte Regelung zeigt, war dies faktisch keineswegs so. Deshalb wurde der Paragraph ergänzt um die Verpflichtung: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Solche Nachteile und Ungleichheiten gibt es nach wie vor: So gibt es beispielsweise für Menschen, die nicht der heterosexuellen Lebensweise entsprechen, immer noch massive Ungleichheiten – z. B. bei der rechtlichen Stellung zu ihren Kindern.
Auch finden sich trotz rechtlicher Gleichstellung noch viele strukturelle Benachteiligungen – besonders deutlich am Gender Pay Gap oder an der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen zu erkennen. Hier finden wir oft den Verweis auf ein drittes Verständnis von Emanzipation, jenes nämlich, welches den aktiven Part von Akteur*innen betrifft: Man emanzipiert sich aus Abhängigkeiten. Am Beispiel von Berufswahlen lässt sich jedoch aufzeigen, dass strukturelle Benachteiligungen nicht einfach durch individuelles Verhalten überwunden werden können. Vielmehr finden wir deutliche Widersprüche im gesellschaftlichen Umgang mit sozialer Ungleichheit. Frauen sind in MINT-Berufen – also in denen, die den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zugehören – noch immer unterrepräsentiert. Sie gelten jedoch als Berufe mit guten
Verdienstmöglichkeiten. Frauen finden sich stattdessen vor allem im Dienstleistungsbereich, in sozialen und pflegerischen Berufen. Jungen Frauen wird also empfohlen, doch mehr MINT-Berufe zu ergreifen. Tatsächlich zeigt sich, dass Schülerinnen im Durchschnitt in den MINT-Fächern über ein geringeres Selbstwertgefühl verfügen – und in der Konsequenz dann damit einhergehend geringeres Interesse zeigen. Bezogen auf Computerkenntnisse können die internationalen Leistungsstudien jedoch zeigen: Mädchen verfügen trotz besserer Kenntnisse über weniger Selbstwert – d.h. sie unterschätzen sich, während Jungen sich oft überschätzen. Lehrkräfte können hier entgegenwirken – häufig aber verstärken sie durch eigene Zuschreibungen („Mädchen interessieren sich halt nicht“, „Mädchen können das nun mal weniger“) die Diskrepanzen. Dies würde ein Beitrag zur Ermöglichung individueller Emanzipation sein. Allerdings haben Auswertungen auch gezeigt, dass die Chance auf einen Ausbildungsplatz größer ist, wenn Mädchen und Jungen in ihren Domänen bleiben. D.h. hier sind vermutlich auch strukturelle ÄnderunGAST KOLUMNE gen nötig. Zudem sollte man die leicht mit der Hochschätzung von MINT-Fächern einhergehende Abwertung der sozialen Berufe hinterfragen. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass diese Berufe – seien es die Dienstleistungen im Verkauf, die Kranken- und Altenpflege oder die Erziehungsberufe – systemrelevant waren. Ohne die Leistungen der überwiegend weiblichen Beschäftigten wäre die Gesellschaft zusammengebrochen. Neben Emanzipationsbemühungen, hier mehr Männer zu beschäftigen, bedarf es gesellschaftliFOTO: FELIX_HUESCH-WALIGURA_ADOBESTOCK cher Anstrengungen, diese Berufe nicht allein mit Applaus, sondern mit angemesseneren Bezahlungen auszustatten. Ansätze dazu zeigen sich. Hier ist aber noch viel gesellschaftliche Emanzipation nötig. Schulische Berufsorientierung könnte insgesamt einen Beitrag zur Emanzipation beider Geschlechter leisten: nicht durch eine einseitige Orientierung auf MINT-Beru-
Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland: Professorin i.R. im Fachbereich Allgemeine, Interkulturelle und International Verfe, sondern durch Reflexion gesellschaftlicher Strukturen, Stärkung von fachlichen Interessen und entsprechendem Selbstwert aller Jugendlichen und damit auch Befähigleichende Erziehungswis- gung zur Vertretung ihrer Interessen als senschaft der Fakultät für künftige Arbeitnehmer*innen.
Erziehungswissenschaft Hannelore Faulstich-Wieland










