





Jan Casier ist einer der charismatischsten Tänzer des Balletts Zürich. Die Bühnenfiguren des wandlungsfähigen Belgiers bleiben einem im Gedächtnis, seien es Woyzeck, Peer Gynt oder die Fliederfee in «Dornröschen». Die Zeitschrift «tanz» kürte Jan Casier 2019 zum «Tänzer des Jahres». Gerade tanzt er in «Nussknacker und Mausekönig», ab Januar ist er im neuen Ballettabend «On the Move» zu sehen.
Mit Michael Küster spricht Jan Casier über seine Zeit beim Ballett Zürich, Lieblingsrollen und Zukunftspläne.
12 Francesco
Cavallis Barockoper «Eliogabalo» handelt
Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen –mit Emma Antrobus, Tänzerin im Ballett Zürich
Fotos Michael SieberEmma Antrobus stammt aus Australien. Nach ihrer Ausbildung in Sydney und München sowie zwei Spielzeiten im Junior Ballett tanzt sie seit der Saison 2019 / 20 im Ballett Zürich. Unter anderem war sie als Aurora in Christian Spucks «Dornröschen» und in «Angels’ Atlas» von Crystal Pite zu erleben.

Was bedeutet Tanz für Sie?
Welche Fähigkeit würden Sie gern besitzen?



Was vermissen Sie an Australien?
Bekommen Tänzerinnen kalte Füsse?
Was machen Sie gern in der Natur?

und ich ihnen auch im Pfandhaus über den Weg liefen, wohin uns unsere unvernünftige Jugend ein oder zweimal verschlug.»
Donnerstag, 12 Jan, 19.30 Uhr Opernhaus
«Nietzsche vertonen ist wie in einen Klangzusammenhang hineinsingen, in bereits bestehenden Gesang Stimme einlassen», so der Komponist Wolfgang Rihm, dessen Aria/Ariadne Gianandrea Noseda im 2. Philhar monischen Konzert dirigiert. Rihm griff für diese 2001 komponierte «Szenarie» für Sopran und Kammerorchester auf die «Klage der Ariadne» aus den Dionysos-Dithyramben von Friedrich Nietzsche zurück. Dessen dichterisches Werk inspirierte ihn – von einzelnen Liedern bis zu einer Dionysos Oper – immer wieder und regte ihn auf besondere Weise dazu an, das Verhältnis von Text und Musik zu hinterfragen. Mojca Erdmann, die 2010 auch in der Salzburger Uraufführung von Rihms Dionysos-Oper die Ariadne gesungen hat, übernimmt in diesem Konzert den Sopran Part. Die Dritte Sinfonie von Johannes Brahms ist in den Sommermonaten 1883 in Wiesbaden entstanden und wurde im darauffolgenden Dezember in Wien mit grossem Erfolg uraufgeführt. Zu den zahlreichen Bewunderern des Werks gehörte auch der Komponist Antonín Dvořák, der an seinen Verleger schrieb: «Es ist lauter Liebe, und das Herz geht einem dabei auf».
Die französische Mezzosopranistin Stéphanie d’Oustrac hat dem Zürcher Publikum schon einige spannungsgeladene Opernabende geschenkt: Mit ihrer umwerfenden Bühnenpräsenz beeindruckte sie etwa als antike Heroin Phèdre in Rameaus Hippolyte et Aricie oder als Médée in der gleichnamigen Oper von Charpentier. Bevor sie ab Februar in der Neuinszenierung von Donizettis Roberto Devereux als Sara zu erleben sein wird, gibt sie im Januar gemeinsam mit der Pianistin Carrie Ann Matheson einen Liederabend mit einem ausschliesslich französischen Programm.
Sonntag, 18 Dez, 19.30 Uhr, Opernhaus Neben Liedern und Arien von Henri Duparc, Jules Massenet, Jacques Offenbach, Georges Bizet und Pauline Viardot erklingt auch La Dame de Monte-Carlo von Francis Poulenc nach einem Text von Jean Cocteau. Poulenc schrieb dieses humoristische Mono dram über eine alte Dame, die ihren Gewinn verspielt und sich am Ende ins Meer stürzt, zwei Jahre vor seinem Tod. «Dieser Monolog gefiel mir, weil er mich zurückversetzte in die Jahre 1923 bis 1925, als ich mit den Kompo nisten Auric in Monte Carlo lebte, im kaiserlichen Schatten von Diaghilew. Ich habe oft aus nächster Nähe jene alten Wracks gesehen, die leicht befingerten Damen der Spieltische. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass Auric
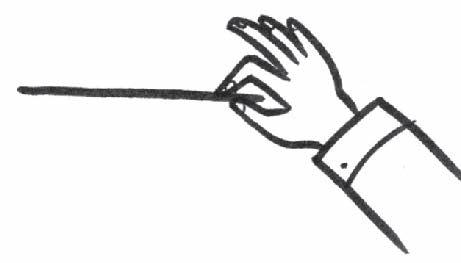
In Zürich hat seine Weltkarriere begonnen und seine entscheidende Schub kraft entwickelt – der Tenor Jonas Kaufmann war langjähriges Ensemble mitglied am Opernhaus und war hier in vielen Rollen zu erleben. Mit der Aufführungsserie von Puccinis OpernThriller Tosca kehrt er nun als Cava radossi in einer seiner Paraderollen endlich ans Opernhaus Zürich zurück. 2009 sang Kaufmann den Cavara dossi bereits in der Premiere der ToscaInszenierung von Robert Carsen, die auch als DVD erhältlich ist. Nicht minder hochkarätig ist die Titelrolle in dieser Wiederaufnahme besetzt: Die amerikanische Sopranistin Sondra Radvanovsky, die an allen grossen Opernhäusern der Welt, vor allem aber an der New Yorker Metropolitan Opera zu Hause ist, singt die Floria Tosca. Und kein Geringerer als der walisische Bariton Bryn Terfel, der die Herzen des Zürcher Publikums als Holländer, Falstaff und Sweeney Todd erobert hat, gibt den finsteren Baron Scarpia. Der aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov, der alternierend mit Kaufmann als Cavaradossi auftritt, komplettiert die spektakuläre Besetzung. Genau der richtige Dirigent für so viel Sängerprominenz ist Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda am Pult der Phil harmonia Zürich.
Vorstellungen: 15, 17, 20, 29 Dez 2022; 1, 4 Jan 2023, Opernhaus
Gianandrea Noseda hat sein Engage ment als Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich um weitere drei Jahre verlängert und wird damit Teil der Direktion von Matthias Schulz ab der Spielzeit 2025/26. Gianandrea Noseda: «Ich liebe die Art und Weise, wie dieses Opernhaus funktioniert, mit welcher Seriosität und Qualität gearbeitet wird und mit welcher Offenheit und Pro duktivität man sich begegnet. Ich freue mich sehr, meine Zusammenarbeit mit dem Opernhaus Zürich im Jahr 2025 um drei weitere Spielzeiten in Zusammenarbeit mit Matthias Schulz zu verlängern. Es wird uns allen die Möglichkeit geben, das bereits Erreichte zu vertiefen und auszubauen. Ebenso freue ich mich sehr, weiterhin die unglaublich vielseitige Philharmonia Zürich sowohl im Orchestergraben als auch auf dem Konzertpodium leiten zu können.»
Märchen auf dem Klangteppich
Die Januar Vorstellungen unseres For mats «Märchen auf dem Klangteppich» für Kinder ab vier Jahren drehen sich um eine entzückende Figur von Astrid Lindgren: Tomte Tummetott heisst der Wichtel mit der roten Mütze, der im langen schwedischen Winter über die frierenden Tiere wacht und sie auch vor dem hungrigen Fuchs Mikkel be schützt.
Vorstellungen: 7, 8, 14, 15 Jan, 15.30 Uhr Dauer: 50 Min., Besammlung Billettkasse
In der Vorweihnachtszeit findet ein Benefizkonzert zu Gunsten unserer hauseigenen Kinderkrippe «Operinos» statt. Mitglieder des Opernensembles und der Philharmonia Zürich präsentieren ein vielseitiges Programm rund um das Thema Schnee und Sternenglanz mit Werken u. a. von Giacomo Puccini, Samuel Barber, Gustaf Nordquist, Leopold Mozart, Richard Wagner, Wolfgang Ama deus Mozart, Franz Schubert und Antonín Dvořák.
Vorstellungen: 17 Dez (15 Uhr) und 18 Dez (11 Uhr), Studiobühne Karten zu CHF 30
Philharmonia
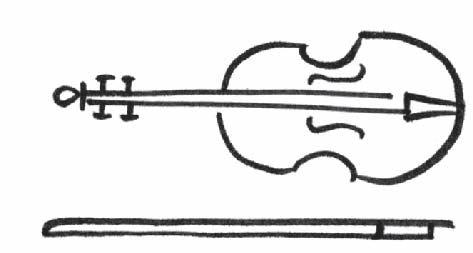
Bei Philharmonia Records ist soeben die erste gemeinsame Aufnahme der Philharmonia Zürich und ihrem Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda erschienen. Das Album enthält die Livemitschnitte der Sinfonien Nr. 7 und 8 von Antonín Dvořák, die Noseda im Jahr seines Amtsantritts mit grossem Erfolg im Opernhaus dirigiert hat. Erhältlich ist die CD ab sofort im Opernhaus Zürich und ab 6. Januar 2023 weltweit im Handel.
Nils Mönkemeyer hat sich früh in den erdigen, wandlungsfähigen Klang der Bratsche verliebt. Heute zählt er zu den international erfolgreichsten Künstlern auf diesem Instrument. Im 3. Philharmonischen Konzert interpretiert er unter der Leitung von Markus Stenz das Konzert für Viola und Orchester von Béla Bartók. Dieses nur skizzenhaft überlieferte – und von Bartóks Schüler Tibor Serly vollendete – Werk ist in Bartóks Todesjahr 1945 im New Yorker Exil entstanden. Auch Gustav Mahlers 10. Sinfonie ist bei seinem Tod 1910 als Fragment liegengeblieben. Das Adagio daraus darf in seiner emotionalen Radikalität jedoch zu den Höhepunkten in Mahlers Spätwerk gezählt werden. Bereits früh in seiner Jugend beschäftigte sich Richard Strauss auf künstlerische Weise mit dem Ende des Lebens: Seine Tondichtung Tod und Verklärung, die effektvoll von düsterem c Moll zu verklärtem C Dur führt, hat er im Alter von 25 Jahren komponiert.
Sonntag, 22 Jan, 19 Uhr, Opernhaus
Musik, Theater und Kunst – faszinieren, inspirieren, bewegen. Und fördern Dialog. Alles Gründe für Swiss Re, sich im Bereich Kultur zu engagieren, Kreativität und Leidenschaft zu unterstützen und neue, spannende Perspektiven zu eröffnen. In Zusammenarbeit mit Kultur-Institutionen und im Dialog mit Künstlern schaffen wir Neues. Und inspirieren Zukunft – gemeinsam: Together, we’re smarter.


Herr Homoki, das Opernhaus hat einen Immobilienkauf getätigt. Wie kam es dazu und was steht dahinter? Es handelt sich um unseren Orchester probenraum am Kreuzplatz. Der ist für unsere künstlerische Arbeit von zentraler Bedeutung, denn dort werden alle Werke musikalisch erarbeitet, bevor sie ins Opernhaus kommen. Dort probt unsere Philharmonia Zürich, dort finden auch Chorproben statt, und dort werden in den sogenannten Sitzproben, Orchester, Chor und Sängerensemble unter der Leitung des jeweiligen Dirigenten musikalisch zusammengeführt. Der Raum muss deshalb Platz für sehr viele Menschen bieten, alleine unser Orchester besteht ja aus über hundert Musikerinnen und Musikern. Er muss gut klingen, gut erreichbar und gut erschlossen sein, und er sollte in der Nähe des Opernhauses liegen. Das Ge bäude am Kreuzplatz erfüllt all diese Bedingungen auf geradezu ideale Weise. Die Gehdistanz zum Opernhaus beträgt nur fünf Minuten. Über viele Jahre hinweg waren wir Mieter des Gebäudes. Jetzt konnten wir es kaufen. Seit Oktober ist es in den Besitz der Opernhaus Zürich AG übergegangen. Bisherige Eigentümerin war eine Kirche, zu der wir als Mieter immer eine sehr freund schaftliche Beziehung gepflegt haben. Die Realisierung dieses Kaufes ist eine gute Nachricht für das Opernhaus, denn nun sind die Arbeitsbedingungen für unser Orchester langfristig gesichert. Nachhaltige Rahmenbedingungen für die Zukunft des Opernhauses zu schaffen, ist meinem Direktionsteam und mir ein wichtiges Anliegen. Mit dem Kauf des Orchesterprobenraums hinter lassen wir dem Haus und zukünftigen Direktionen nun ein bleibendes Erbe.
Was können Sie zur Finanzierung dieses Projekts sagen?
Wir haben diesen Kauf aus Reserven finanziert, die wir vor der CoronaPandemie aufgebaut haben. Mit dem
erworbenen Orchesterprobenraum ist die Opernhaus Zürich AG nun Eigentümerin fast aller Gebäude: Sie besitzt das Theater, den Erweiterungsbau, im Volksmund Fleischkäse genannt, die Werkstätten, die Probebühnen und das Ausstattungslager Kügeliloo. Das Einzige, was wir jetzt noch mieten, sind die Appartements für Künstlerinnen und Künstler und Büroräume in der Dufourstrasse.

Welche langfristigen Chancen eröffnet der Kauf am Kreuzplatz dem Opernhaus?
Wie gesagt, er schafft nachhaltige Stabi lität der Arbeitsbedingungen in einem weiteren wichtigen Bereich. Wir haben das Eigentümer Mieterverhältnis mit unsern Partnern von der Kirche umge dreht. Die Kirche ist jetzt für eine Dauer von maximal sieben Jahren bei uns eingemietet. Das bedeutet, dass wir da nach, über den eigentlichen Orchester probenraum hinaus, weitere Räumlich keiten in der Nähe zum Opernhaus erhalten. Das ist für uns ebenfalls sehr wichtig, weil wir ja grundsätzlich hinter den Kulissen aus allen Nähten platzen und mit schwerwiegenden Raumproble men zu kämpfen haben, was jeder schon alleine daran erkennen kann, dass wir wertvolle Dekorationen auf der Strasse im Freien lagern müssen. Eine von vielen Abteilungen, die unter unserer Raumnot stark leidet, ist beispielsweise die Theaterpädagogik. Wir haben da ein tolles Team und ein tolles Angebot, aber die Möglichkeiten, Workshops und kleine Produktionen zu zeigen, sind durch fehlende Räume stark einge schränkt. Allein die Bedürfnisse dieser Abteilung lassen erkennen, wie wertvoll dieser Immobilienkauf für das Opern haus in vielerlei Hinsicht ist.
THE






















THE ROYAL BALLET DER NUSSKNACKER do, 8. dez 2022, 20:15 uhr THE ROYAL BALLET BITTERSÜSSE SCHOKOLADE do, 19. jan 2023, 20:15 uhr
THE ROYAL OPERA DER BARBIER VON SEVILLA mi, 15. feb 2023, 20:00 uhr THE ROYAL OPERA TURANDOT mi, 22. märz 2023, 20:15 uhr
THE ROYAL BALLET CINDERELLA mi, 12. apr 2023, 20:15 uhr
THE ROYAL OPERA DIE HOCHZEIT DES FIGARO do, 27. apr 2023, 19:45 uhr
THE ROYAL BALLET DORNRÖSCHEN mi, 24. mai 2023, 20:15 uhr
THE ROYAL OPERA IL TROVATORE di, 13. juni 2023, 20:15 uhr
In unsere neue Familienoper Alice im Wunderland haben wir so viele Tricks eingebaut, dass ich sie auf dieser Seite nicht alle schildern kann. Ich habe auch kurz überlegt, ob meine Erklärungen diesen Tricks den Zauber nehmen – aber ich bin überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist: Sie werden davon bezaubert sein!
Die Zaubershow fängt damit an, dass ein Stofftier in eine Waschmaschine gesteckt wird und die Waschmaschine zu wackeln und zu schäumen anfängt. Das Wackeln macht der Schauspieler, der in der Waschmaschine versteckt ist, der Schaum kommt aus dem Schlauch einer Schaummaschine. Dann Nebel und noch mehr Schaum: Die Vorderwand der Waschmaschine platzt auf und der Schauspieler im Kaninchenkostüm krabbelt heraus. Die Drehscheibe dreht und das Kaninchen rennt gegen eine Wand, bricht hindurch und ist weg: In die Wand haben wir vorher schon ein grosses Loch gemacht, das nur mit Papier in Wandfarbe verschlossen ist und vom Kaninchen ein fach zerstört wird. Alice geht ebenfalls durch das Loch und fliegt gleichzeitig von der anderen Seite oben ins Bild: Das ist ein Double, gleiche Grösse, gleiches Kostüm, gleiches Make-up. Die Artistin hängt an zwei Seilen und kann sich so recht frei be wegen und Saltos machen. Mit unserer Obermaschinerie bewegen wir sie hin und her, hoch und runter. Während sie schwebt, fliegen Papiere vom Boden nach oben. Diese sind eine Projektion auf einen hauchdünnen, durchsichtigen Stoff, den wir zwischen Zuschauerraum und Bühne gespannt haben.

Im Hintergrund fliegt vom Boden eine Standuhr mit Pendeluhrwerk die Wand hoch. Diese Uhr ist keine Projektion, sondern wirklich vorhanden. Sie wird seitlich in einer Schiene geführt, die wie eine Säule verkleidet ist. In der Säule sind auch die Seile, mit der die Uhr hochgezogen wird – das Seil geht oben über eine Umlenkrolle und hinter dem Bühnenbild wieder zum Boden, wo sie von Technikern gezogen wird. Die gleiche Lösung haben wir für das Gemälde, das ebenfalls plötzlich anfängt an der Wand hochzufliegen. Wenn sich alles beruhigt hat, taucht das Kaninchen wieder auf und verschwindet durch eine Tür, hinter der man in einen wunderschönen Garten sehen kann. Kaum öffnet Alice diese Türe, ist dort eine zweite, kleinere Türe. Dahinter die nächste. Und die nächste und nächste… bis zu einer Türe, die so klein ist, dass Alice nicht hindurchpasst: Diese Türen sind dicht hintereinander auf einem Wagen montiert und wurden blitzschnell, nachdem das Kaninchen durch die erste Türe durch ist, dorthin gestellt. Genauso schnell verschwinden sie dann wieder, nachdem Alice einen Zaubertrank aus einer Flasche getrunken hat, die ihr von einem an einer Wand hängenden Mantel gereicht wurde. Ja, am Kleiderhaken hängt ein Regenmantel, und plötzlich kommt aus dem Ärmel eine Flasche, und dann hebt sich der Ärmel von Zauberhand und überreicht die Flasche und später noch ein Stück Kuchen und einen Regenschirm: Das geht ganz einfach, indem eine Person unsicht bar hinter der Wand steht und durch ein vom Mantel verdecktes Loch seinen Arm steckt. Ein simpler, aber genialer Effekt.
Ich bin noch nicht mal in der Pause angekommen – und schon viel zu weit unten auf dieser Seite. Der Platz reicht für die unzähligen weiteren Tricks nicht aus. Der schönste Zauber ist aber eine kleine kuschelige Wolke, die von oben hereinge schwebt kommt und aus der es auf den aufgespannten Schirm von Alice regnet. Und dass die Tafel im Schulzimmer immer dann, wenn Alice den Verkleinerungstrank getrunken hat, viel höher hängt, als wenn sie normal gross ist, hätten Sie ohne diesen Text sicher nie bemerkt.



 Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich
Am 4. Dezember hat die frühbarocke Oper «Eliogabalo» von Francesco Cavalli am Opernhaus Premiere. Sie poträtiert einen grausamen, sexgierigen römischen Herrscher, der aber auch weibliche Seiten in sich zeigte. Aus diesem Anlass haben wir mit dem Philosophen Philipp Hübl darüber gesprochen, was Männlichkeit heute ausmacht.
 Fotos Danielle Liniger
David Hansen und Yuriy Mynenko
Fotos Danielle Liniger
David Hansen und Yuriy Mynenko

Eliogabalo ist in Cavallis Oper ein tyrannischer Herrscher, der die Erfüllung seiner eigenen Lust über alles stellt, Frauen am laufenden Band vergewaltigt und ihre Ehe männer umbringen lässt. Heute würde man das als einen besonders schweren Fall von toxischer Männlichkeit bezeichnen. Längst ist «toxische Männlichkeit» ein Modebegriff, ein Mode Schlagwort geworden; was genau ist eigentlich damit gemeint?
Ursprünglich sollte damit gesagt werden, dass es Extremfor men gibt von männlicher Gewaltbereitschaft; einige wenige Männer sind Mörder und Vergewaltiger, die man in ihre Schranken weisen muss. Mittlerweile wird das Schlagwort aber häufig so verwendet, als sei der Mann an sich toxisch. Das stimmt nicht, denn die meisten Männer der Welt führen ein tugendhaftes Leben, vor allem in westlichen Industrieländern, in denen die Menschen so friedlich sind wie nie zuvor; die wenigsten Männer werden dort straffällig. Statistisch gesehen ist es allerdings so, dass fast alle Gewalttäter Männer sind, und diese Extremfälle stechen heraus. Toxisch heisst giftig, damit verbunden ist die Vorstellung, dass da etwas Giftiges, also Gefährliches lauert. Menschen als giftig zu bezeichnen, finde ich keine gute Idee.
Heute sind viele Männer verunsichert; viele der Werte, nach denen sie in ihrer Vergangenheit gelebt haben, scheinen veraltet. Wie würden Sie das traditionelle Bild von Männlichkeit beschreiben? Gehört das, was heute oft als toxisch bezeichnet wird, auch dazu? Eine faszinierende Kulturentwicklung der letzten siebzig Jahre ist die sogenannte Feminisierung. Die Werte von Frauen sind weltweit relativ ähnlich: Sie wollen Gleichberechtigung, sie bevorzugen in der Kindererziehung Liebe statt Strenge, sie fordern, dass in der Politik Frauen genauso oft wie Männer das Sagen haben und dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst, sondern mit Worten und im Einvernehmen. In feminisier ten Kulturen wie Schweden oder Finnland haben sich die Männer dem stark angenähert. Doch in männlich geprägten Kulturen – im Extremfall autokratische Kulturen in der arabischen Welt zum Beispiel, oder in China und in einigen Ländern Afrikas –, muss der Mann stark sein; es geht im Alltag um Ehre, Dominanz und Strenge. In den industriali sierten Ländern, also den besonders feminisierten Ländern Nordeuropas, sind Männer viel offener, toleranter und auch fürsorglicher.
Wenn man über Männerbilder und typisch männliche Eigenschaften nachdenkt, ist man schnell bei der Frage, was von diesen vermeintlich typisch männlichen Eigen schaften – zum Beispiel Stärke und Männlichkeit –tatsächlich genetisch bedingt, also angeboren ist, und was davon anerzogen, also soziologisch bedingt. Es gibt eine sehr starke Evidenz dafür, dass es angeborene Neigungen gibt. Die legen uns nicht zwingend fest, wir können dagegen angehen; aber es gibt weltweit Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer reden insgesamt
weniger als Frauen, sie fokussieren sich eher auf den Aussen bereich, Frauen eher auf den Innenbereich, Frauen sind deutlich mitfühlender als Männer, Männer haben ein höheres Aggressionspotential und sind sexuell viel triebhafter als Frauen. Das sind natürlich Stereotype; ein einzelner Mann, eine einzelne Frau mag nicht so sein. Es kann eine sehr aggressive Frau geben und einen gar nicht aggressiven Mann, aber als Aussagen über das statistische Mittel stimmen diese Stereotype. Der Fehler, den viele machen, und zwar auf beiden Seiten der Diskussion, ist, von statistischen Verallge meinerungen auf die Essenz zu schliessen. Essenzialismus ist die Idee: Kennst du einen, kennst du alle. Dass Männer ins gesamt häufiger gewalttätig sind, lässt nicht darauf schliessen, dass alle Männer gewalttätig sind. Aber generell gibt es durch aus Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen sind zum Beispiel weltweit verträglicher als Männer, sie wollen mehr Harmonie in der Kommunikation und in der Gesell schaft. Männern ist das nicht ganz so wichtig.
Da würden Ihnen jetzt vermutlich viele Menschen heftig widersprechen und sagen: Das Meiste von dem, was Sie beschrieben haben, ist gesellschaftlich anerzogen. Erziehung und Prägung verstärken Anlagen, ganz klar, aber die wissenschaftlichen Daten belegen die grundlegenden Unterschiede sehr deutlich. Sexualität ist das beste Beispiel. Männer haben einen stärkeren Sexualtrieb. Sie gehen zu Prostituierten, Frauen machen das so gut wie gar nicht. Männer konsumieren Pornographie, Frauen deutlich weniger. Männer denken viel häufiger an Sex, sie wollen tendenziell viele verschiedene Sexualpartnerinnen haben, Frauen dagegen sind selektiver. All das ist unabhängig von allen Kulturen, egal, ob man in China Umfragen durchführt oder in Kamerun, Mexiko oder Deutschland. Deshalb ist es relativ unwahrscheinlich, dass es sich um ein rein kulturelles Phänomen handelt. Natürlich sind genetische Neigung und Kultur eng miteinander verschränkt, sodass man schwer trennen kann. Aber vieles deutet darauf hin, dass es klare Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, die nicht nur anerzogen sind.
Ist der Mann von heute in einer Identitätskrise? Wenn Identitätskrise heisst, dass Männer unzufrieden sind, dann kann man das auf keinen Fall sagen. Vor allem in den feminisierten Gesellschaften – dazu gehört neben Schweden, Thailand und den Niederlanden inzwischen auch Deutsch land – haben die Männer eine höhere Lebenserwartung als in den anderen Ländern, sie begehen seltener Selbstmord, sie sind zufriedener, auch sexuell, sie leben länger und gesünder und sind seltener obdachlos. Wenn Männer die heutige Zeit als Krise der Männlichkeit empfinden und sagen: Früher gab es noch echte Männer, heute sind alle verweichlicht, dann ist das meistens ein Phänomen der älteren Generationen ab Mitte 40. Da waren die Vorbilder von Jean Paul Belmondo bis Sean Connery vielleicht maskuliner, und möglicherweise hadern heute einige mit diesem Kulturwandel. Aber statistisch gesehen geht es den Männern heute besser als je zuvor.
Klingt ein bisschen so, als wäre die Krise des Mannes nur herbeigeredet, oder hat das auch etwas mit «Männerbashing» zu tun – die «toxische Männlichkeit» ist ja nicht umsonst so ein beliebtes Schlagwort geworden?
Das ist die Kehrseite der Emanzipation. Frauen waren über lange Zeit stark benachteiligt, inzwischen gibt es fast so etwas wie umgekehrten Sexismus. In einer Studie wurden Leuten Untersuchungen vorgelegt, die angeblich zeigten, dass Frauen intelligenter sind als Männer; das fanden alle Probanden ganz in Ordnung. Wenn man aber behauptete, man hätte heraus gefunden, dass Männer intelligenter sind als Frauen, dann war die Reaktion häufig: Hör mir auf mit diesem sexistischen Unfug! Ausserdem gibt es ein halb ironisches, halb ernstes Männerbashing im Alltag, das nicht alle Männer immer mit Humor nehmen wollen. Und ein wachsendes Problem ist für Männer der Ausbildungs und Arbeitsmarkt, auf dem sie zusehends auf der Strecke bleiben. Männer sind in vielen Dingen extremer – sie sind sowohl bei extremen Erfolgen stärker vertreten als auch bei extremen Misserfolgen. Männer sind in den Bereichen mit hohem Prestige stark vertreten, also in Machtpositionen, aber auch in den Bereichen mit sehr wenig Prestige, also bei den Obdachlosen oder Gefängnisinsassen. Unsere Gesellschaft wandelt sich, Berufe, die körper liche Kraft erfordern, werden zunehmend weniger gebraucht, Dienstleistungsberufe hingegen häufiger, bei denen man unter anderem soziale Intelligenz und sprachliches Geschick benötigt. Darin sind Frauen besser. Auch an den Universitäten vieler Länder in Europa studieren inzwischen mehr Frauen als Männer, und in den Pisa Studien schneiden Schülerinnen in fast allen Fächern besser ab als Schüler. Das bedeutet für Männer in Zukunft: weniger gutbezahlte Jobs und weniger Anerkennung als bisher.
Trotzdem sind Männer nach wie vor sehr viel häufiger in Machtpositionen vertreten. Da gibt es verschiedene Faktoren, die man anschauen muss. Zunächst die Altersstruktur: Um mächtig zu sein, ist man typischerweise zwischen 45 und 70 Jahre alt, wie die meisten Politiker oder Topmanager, das sind die Jahrgänge 1950 75. In diesen Generationen haben viele Männer solche Karrieren angestrebt; in jüngeren Jahrgängen dünnt sich das etwas aus, und in zehn, fünfzehn Jahren wird der Anteil der Frauen in Machtpositionen deutlich grösser sein. Dazu kommt, dass Männer und Frauen – wie Untersuchungen zeigen – sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ein erfülltes Leben aussieht. Vereinfacht gesagt, will die Mehrheit der Männer primär Karriere machen, ein kleinerer Teil wünscht sich Ausgeglichenheit zwischen Familie und Karriere, und ein winziger Teil möchte sich ausschliesslich um Familie und Kinder kümmern. Bei den Frauen wollen nur etwa 20 Prozent ausschliesslich Karriere machen, die Mehrheit von etwa 60 Prozent wünscht sich Ausgeglichenheit zwischen Beruf und Familie, und der Rest will sich nur auf die Familie konzentrieren. Bei den Männern wollen aber etwa 60 Prozent Karriere machen, etwa 30 Prozent streben eine Work Family Balance
Statistisch gesehen geht es den Männern heute besser als je zuvor
an und nur 10 Prozent sehen sich als Hausmänner. In den allermeisten Fällen tritt das dann genauso ein, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und wenn Männer häufi ger Karriere machen wollen, kommen auch mehr Männer in Machtpositionen. Männer streben eher nach Anerkennung durch Geld und Macht und gehen insgesamt mehr Risiken ein. Dafür sterben sie auch sehr viel häufiger am Arbeitsplatz. Es gibt aber natürlich auch echte Diskriminierung im Berufsleben, zum Beispiel die sogenannte Motherhood Penalty, eine «Mutterschaftsstrafe»: Das bedeutet, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen, im Berufsleben zurückgeworfen oder erst gar nicht eingestellt werden. Kinderlose Frauen über 40 schneiden dagegen in vielen Bewerbungen sogar besser ab als die Männer.
Ist das nicht auch das Resultat gesellschaftlicher Prägung? Macht und Geld verschaffen Männern ja nach wie vor gesellschaftliche Anerkennung, Frauen sind gesellschaft lich eher so geprägt, dass die Familie ihnen wichtiger erscheint.
Kulturelle Erwartung und universelle Neigung sind schwer auseinanderzuhalten. Aber in verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Frauen in freien Gesellschaften eher akademische Berufe wählen, die mit sozialer Arbeit zu tun haben, mit Fürsorge, Sprache, dem Kontakt mit Menschen, und weniger Mechatronik, Tiefbau und Elektrotechnik, ob wohl die sogenannten MINT Fächer ein höheres Einkommen versprechen als die Geistes und Sozialwissenschaften. Je freier die Länder sind, desto grösser ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen, was MINT Fächer und andere Fächer betrifft. In Ländern wie Algerien, Tunesien oder der Türkei, wo weniger Gendergerechtigkeit herrscht, studieren Frauen häufiger MINT Fächer, vermutlich weil sie sozial nicht so gut abgesichert sind, Geld verdienen müssen und über ihren Beruf auch Unabhängigkeit erlangen können. Das würde darauf hinweisen, dass es nicht nur die patriarchalen Stereo type sind, denn die sind in der Türkei und Algerien deutlich stärker ausgeprägt als in Schweden oder Finnland.
Sie haben gesagt, dass insgesamt mehr Männer gewalttätig sind. Gibt es auch mehr Männer in Machtpositionen, die diese Macht ausnutzen? Ist Diktatur männlich?
Etwa 90 Prozent aller Gewaltstraftaten und fast 100 Prozent aller Vergewaltigungen werden von Männern begangen. Allerdings sind auch 80 Prozent aller Mordopfer männlich. Es geht also meistens um den Kampf zwischen Männern, so wie wir das auch von unseren nächsten Verwandten, den Affen, kennen – da sind auch die Männchen viel aggressiver. Der Kampf zwischen Männern ist fast immer ein Status kampf, und Status hat etwas mit der Funktion in der Gruppe und der Partnerschaft zu tun. Soweit ich weiss, sind bisher keine grossen Diktaturen von Frauen errichtet worden. Herrschaft durch Dominanz ist typischer für Männer. Die Neigung, zu denken, dass es bestimmte Gruppen gibt, die minderwertig sind und vernichtet werden müssen – ein
Extrembeispiel dafür ist der Nationalsozialismus –, das radikal religiöse Denken, das besagt, dass die Ungläubigen nicht so viel wert sind wie die eigene Gruppe, diese Art zu denken also ist deutlich häufiger bei Männern vertreten als bei Frauen. Frauen versuchen eher, sozialen Status durch Prestige zu erlangen, also durch Leistung, Attraktivität oder Besitz, nicht durch Gewalt oder Gewaltandrohung. Das fängt bei Männern schon auf dem Schulhof an.
Klingt ziemlich archaisch…
Von Hobbes, Freud und Norbert Elias bis in die Moderne wurde immer wieder diskutiert, wie wir überhaupt zivilisiert worden sind. Das passierte durch Gesetze, Erziehung, aber auch dadurch, dass Männer eine Art Ersatz gefunden haben für den echten Kampf, zum Beispiel Fussball, Kampfsport oder Autorennen – das ist eine sublime Form von Stammes kampf, die Regeln unterliegt und bei der es nicht mehr um Leben und Tod geht, also eine kulturell überformte, verfeinerte Art des alten Kampftriebs.
Seit Februar ist der Krieg wieder in Europa angekommen Glauben Sie, dass sich das Männerbild dadurch verändert? Das ist schwer vorherzusehen. In Deutschland, Italien und Japan – den drei Achsenmächten, die den zweiten Weltkrieg verloren haben – ist die Bereitschaft, für das eigene Land in den Krieg zu ziehen, extrem gering, ganz anders in Nor wegen oder Frankreich. Der Diskurs in Deutschland ist ausserdem sehr vom Pazifismus geprägt; es ist aber gut möglich, dass sich seit Beginn des Krieges einiges gewandelt hat. Interessanterweise hat sich zwar das Männerbild verändert, und das Stereotyp vom Mann als Kämpfer und Beschützer gilt als überholt; gleichzeitig zeigen aber Untersuchungen, dass die meisten Männer gern Beschützer sind, und auch die Mehrheit der Frauen empfinden es als attraktiv, wenn der Mann ein Kavalier ist und sich sogar um Notfall für die Familie opfern würde. Da besteht eine gewisse Spannung zwischen dem modernen Ideal und der Realität.
Zurück zur Oper. Eliogabalo verkörpert auf der einen Seite die sogenannte toxische Männlichkeit, andererseits ist er genderfluid: Er singt nicht nur im Falsett, sondern liebt auch Frauenkleider und den ständigen Rollenwechsel. Warum, glauben Sie, wirken genderfluide oder transsexuelle Menschen auf manche bedrohlich? Menschen, die sehr traditionalistisch denken, auch Menschen aus sehr religiösen Gesellschaften und Extremisten am rechten Rand der Politik haben bestimmte Vorstellungen von Reinheit und Natürlichkeit. Das Heterosexuelle gilt als rein, andere Formen wie Homosexualität, aber auch Genderfluidi tät gelten als unrein oder unnatürlich. Allerdings gibt seit es 70 Jahren eine starke progressive Wende, und alle sexuellen Identitäten und Vorlieben erfahren viel mehr Akzeptanz. Grundsätzlich wollen Menschen die Welt gern kategorisieren, und wenn etwas nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen ist, dann fordert das viele heraus; vom Fluiden, Mehrdeutigen,
Unklaren fühlen sich manche sogar verunsichert. Sehr autori täre Menschen, die solche Identitäten als unnatürlich empfinden, haben dann auch die Neigung, aggressiv zu reagieren.
Kim de l’Horizon hat den deutschen Buchpreis gewonnen, identifiziert sich als non binär, trägt gern Röcke und Lippenstift und wurde tätlich angegriffen – der Angreifer, so beschreibt es Kim de l’Horizon, hat dabei gesagt: «Normale Schwuchteln kann ich mittlerweile schlucken, aber du bist mir einfach zu viel.» Heisst das, Homosexualität ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und legalisiert – aber non binäre und transsexuelle Personen stellen für manche Menschen nach wie vor eine Bedrohung dar?
Wir waren nicht dabei, als dieser Angriff geschah, aber wir können vermuten, dass der Angreifer aus einem Milieu kommt, in dem ein traditionalistisches Denken vorherrscht, in dem Genderfluidität als unrein, widernatürlich und abstossend gilt und mit Ekel belegt ist. Solche Vorstellungen haben viel mit Erziehung zu tun. In Kulturen, in denen man sich sicher fühlt, ist man liberaler; Kulturen, in denen Mangelwirtschaft herrscht, wo Hunger, Krieg oder Infektionen drohen, da müssen Gruppen stärker zusammenhalten. Regelbrecher werden heftiger bestraft, alle Arten von Abweichungen als Bedrohung gesehen, und Vorstellungen von Reinheit sind dort auch stärker vertreten. Männer sehen Genderfluidität übrigens viel eher als Herausforderung als Frauen.
Dazu passt die Aussage des Bundesrats Ueli Maurer: «Hauptsache, mein Nachfolger ist kein Es.»
Das ist ein typisches Muster der Rechtspopulisten, um mit Provokation Aufmerksamkeit und Stimmen zu gewinnen. Dieses Manöver ist nicht nur durchschaubar, sondern auch strategisch falsch, denn selbst unter den Konservativeren in der westlichen Welt gibt es mittlerweile eine grosse Akzep tanz für Homosexuelle und für Genderfluidität. Daher setzen erfolgreiche Populisten ja so stark auf die Migrationsfrage, um Wähler zu gewinnen. So oder so: Die tolerante und liberale Mehrheit sollte viel weniger auf solche Provokationen eingehen, denn sie dienen am Ende nur der Aufmerksamkeitsmaschinerie.
Philipp Hübl ist Philosoph, Gastprofessor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste Berlin und Autor der Bücher «Die aufgeregte Gesellschaft», «BullshitResistenz», «Der Untergrund des Denkens» und «Folge dem weissen Kaninchen… in die Welt der Philosophie» sowie von Beiträgen zu gesellschaftlichen und politischen Themen, unter anderem in der ZEIT, FAZ, taz, NZZ und Republik.
Eliogabalo Oper von Francesco Cavalli
Musikalische Leitung Dmitry Sinkovsky Inszenierung
Calixto Bieito Bühnenbild
Anna-Sofia Kirsch, Calixto Bieito Kostüme
Ingo Krügler Lichtgestaltung Franck Evin Video
Adria Bieito Camì
Dramaturgie Beate Breidenbach
Eliogabalo
Yuriy Mynenko
Anicia Eritea Siobhan Stagg Giuliano Gordio Beth Taylor Flavia Gemmira Anna El-Khashem Alessandro Cesare David Hansen Atilia Macrina Sophie Junker Zotico Joel Williams Lenia
Mark Milhofer Nerbulone Daniel Giulianini Tiferne
Benjamin Molonfalean Un console
Aksel Daveyan Altro console Saveliy Andreev
Orchestra La Scintilla Statistenverein am Opernhaus Zürich
Premiere 4 Dez 2022 Weitere Vorstellungen 7, 11, 13, 16, 21, 26, 30 Dez 2022; 2, 7 Jan 2023
Unterstützt von Atto primo
In Francesco Cavallis «Eliogabalo» geht die männliche Hauptfigur für die Erfüllung ihrer sexuellen Wünsche über alle Grenzen.
Die Oper handelt von blutiger Gewalt, Gender Fluidität, Einsamkeit und Nihilismus. Der Regisseur Calixto Bieito erkennt darin einen sehr aktuellen Stoff.

Calixto, deine letzte Arbeit hier in Zürich war Monteverdis Incoronazione di Poppea, in der der römische Kaiser Nero eine zentrale Rolle spielt. Auch der Titelheld der Oper Eliogabalo hat einen römischen Kaiser als histori sches Vorbild: Varius Avitus Bassianus, genannt Elagabal, der 218 nach Christus als Vierzehnjähriger den römischen Thron bestieg und vier Jahre später ermordet wurde. Wie wichtig war für dich dieser historische Hintergrund im Zusammenhang mit Cavallis Oper?
Während der Vorbereitung war es natürlich interessant, sich mit der historischen Figur Elagabal zu beschäftigen, der als einer der grausamsten römischen Herrscher überhaupt galt –und das in einer Zeit, die an grausamen und verrückten Kaisern nicht gerade arm war. Was ihn von seinen Vorgängern und Nachfolgern unterschied, war zum einen seine Religion; er stammte ursprünglich aus Syrien, gehörte also einer ganz anderen Kultur an und war als Kind und Jugendlicher Priester eines syrischen Sonnengottes namens Elagabal, von dem er auch den Namen übernahm. Nach Rom brachte er einen religiösen Kult mit, zu dem gehörte, dass jeden Morgen Tau sende von Tieren geopfert wurden und das Blut in Strömen floss; Priester, die diesem Gott dienten, trugen Frauenkleider und haben sich in Ekstase selbst entmannt. Aber auch dass Eliogabalo in der Oper als jemand gezeigt wird, der sich selbst als Frau verkleidet, um die Frau, die er begehrt, zu ver führen, geht offenbar auf historische Tatsachen zurück: Der jugendliche Kaiser ging, so liest man, in Frauenkleidern in Bordelle und bot sich Männern als Prostituierte an; er liebte sowohl Frauen als auch Männer und hatte stets wech selnde Sexualpartner. Für Politik interessierte er sich nicht. All das war selbst den Römern zu viel, die an vielerlei Aus schweifungen gewöhnt waren.
Was interessiert dich an Cavallis Eliogabalo?
Die Freiheit seines Geistes in Kombination mit extremer Grausamkeit ergibt für mich eine faszinierende Spannung. Eliogabalo ist grausam und brutal, wirkt aber auf andere Menschen auch verführerisch. Er ist ein Hedonist, aber gleichzeitig sehr unsicher in Bezug auf sich selbst und seine Identität. Er muss sich ausprobieren; er ist unersättlich, niemals zufrieden oder befriedigt. Eine Figur, die sich schwer einordnen lässt, eine Figur voller Widersprüche, die die Regeln einer Gesellschaft gehörig durcheinanderbringt.
Ein grausamer, empathieloser Hedonist, der aber auch eine grosse Faszination ausübt auf seine Umwelt – das erinnert an eine andere bekannte Opernfigur… Ja, Eliogabalo ist in gewisser Weise ein Vorläufer von Don Giovanni. Beide sind für mich Nihilisten. Daneben hat Eliogabalo auch etwas von einer Künstlerfigur, die Grenzen austestet. Dabei geht es einerseits um die Frage, ob sich ein Genie gegenüber seinen Mitmenschen alles erlauben darf, weil er oder sie eben ein Genie ist. Zudem geht es darum, ob Kunst generell Grenzen hat, wie frei sie sein kann. Eine momentan sehr aktuelle Frage; für mich fühlt es sich zurzeit manchmal so an, als wären wir auf dem Weg zu einem neuen Puritanismus mit vielen Beschränkungen und der immer präsenten Angst, etwas falsch zu machen. Gleichzeitig emp finde ich unsere Zeit in vielem als sehr brutal. Wir leben zwischen Extremen, wie das häufig der Fall ist an der Schwelle zu gesellschaftlichen Umbrüchen. Aber ich bin kein Sozio loge. Ich beschreibe nur, was ich beobachte und empfinde.
Zurück zur Oper: Im Unterschied zu Don Giovanni ist Eliogabalo ein Mächtiger, ein tyrannischer Herrscher… …der seine Macht skrupellos ausnutzt, seine Mitmenschen auf übelste Weise manipuliert und für die Erfüllung seiner sexuellen Wünsche über Leichen geht, ja. Seinen Cousin Alessandro will er umbringen lassen, um dessen Verlobte zu besitzen. Interessanterweise gründet er einen Senat, in dem nur Frauen vertreten sind; auf den ersten Blick würde man denken: Eine Regierung nur aus Frauen, wie modern! In Wahrheit ist aber auch dies für ihn wieder nur ein Mittel zum Zweck – um nämlich leichter an Sex mit den von ihm begehrten Frauen heranzukommen. Der französische Schriftsteller Antonin Artaud nannte Eliogabalo einen Anarchisten. Er zerstört Emotionen und Menschen. Und trotzdem provoziert sein Tod am Ende der Oper auch Mitgefühl. Denn letztlich ist auch er – ebenso wie Don Gio vanni – entsetzlich einsam.
Nicht nur der Frauensenat, auch die Tatsache, dass Elio gabalo verschiedene Geschlechteridentitäten ausprobiert, scheint sehr gut in unsere Zeit zu passen… Ja, vieles in diesem fast 400 Jahre alten Stück ist erstaunlich modern. Vor einiger Zeit hat mich jemand gefragt, warum ich diese Oper überhaupt mache – sie erzähle uns doch heute nichts mehr. Das Gegenteil ist der Fall! Diktatoren wie Elio

gabalo gibt es leider nach wie vor, da muss man nicht lange suchen. Zudem leben wir in einer Zeit, in der vieles in Frage gestellt wird und wir mit vielen Unsicherheiten umgehen müssen. Die Unsicherheiten fangen in Cavallis Oper ja schon mit der Besetzung der Rollen an: Ein Tenor singt eine ältere Frau, eine Altistin singt einen jungen Mann, und Eliogabalo selbst ist mit einem Countertenor besetzt, der wie eine Frauenstimme klingt und einen Mann spielt, der sich als Frau verkleidet. Ein modernes Kaleidoskop von Identitäten, in dem sich Tragik und Komik die Waage halten. Grundsätzlich kommt mir Ambiguität sehr entgegen. Es interessiert mich nicht, mit meinen Inszenierungen eine bestimmte Message zu transportieren. Für mich ist das der grosse Unterschied zwi schen Kunst und Kultur: Kunst beschäftigt sich mit unserem Innersten, mit unseren Träumen, unserem Unterbewussten, unseren Fantasien, unserer Vorstellungskraft. Kunst lässt sich – im Gegensatz zu Kultur – nicht kontrollieren.
Wir sprachen vorhin von den blutrünstigen religiösen Riten, die der historische Elagabal nach Rom mitbrachte. Inwiefern ist davon auch etwas in Cavallis Oper eingeflossen? Spielten sie für deine Inszenierung eine Rolle? Ich komme aus einem Land, in dem der Stierkampf in der Vergangenheit eine grosse und wichtige Rolle gespielt hat; das war eine wichtige Tradition, die mittlerweile in vielen Teilen des Landes verboten ist, weil sie so ungeheuer brutal und blutig ist. Ich mag den Stierkampf nicht, ich halte das fast nicht aus, muss aber zugeben, dass er auf viele Men schen, die ich kenne, eine starke Wirkung hat – als ein Ritual, das eine grosse Schönheit ausstrahlen kann und eine merk würdige Intimität besitzt. Wir brauchen Rituale oder doch zumindest Routine in unserem Leben; das gibt uns Orientierung und Sicherheit. Natürlich müssen diese Rituale nicht so blutig sein wie ein Stierkampf. Deshalb kommt bei uns der Stier auf der Bühne auch eher als ein ironisches Zitat vor.
Die Figuren in Cavallis Oper empfinde ich als sehr modern, deshalb spielt die Oper bei uns auch in einer mehr oder weniger zeitgenössischen, aber zugleich auch zeitlosen Welt –in einer sehr reichen und mächtigen italienischen Familie vielleicht, deren Mitglieder sich hassen bis aufs Blut, sich ge genseitig manipulieren, aber auch abhängig sind voneinander. Einen ganz konkreten zeitlichen Bezug gibt es nicht. Es interessiert mich auch nicht so sehr, die Geschichte möglichst realistisch oder sozialkritisch zu erzählen; was mich viel eher interessiert, sind authentische Emotionen. Deshalb sind auch die Räume, die auf der Bühne zu sehen sein werden, nicht unbedingt realistische Orte, sondern traumartige Räume, Seelenräume, die innere Zustände der Hauptfigur zeigen, oder aber realistische Räume, die in Traumwelten kippen können.

Eliogabalo ist eine Oper von Cavalli – aber es ist zugleich auch ein Barockprojekt, ein Stück, das während der Proben erst entsteht. Womit hängt das zusammen?

Wenn wir die Oper so spielen würden, wie sie überliefert ist, würde sie etwa vier Stunden dauern. Aber nicht nur das: Die Rezitative sind zum Teil sehr lang und manchmal auch redundant, weil sie die Handlung nicht voranbringen und Dinge erzählen, die wir schon längst wissen. Die Instrumen tation kennen wir nicht, denn wie bei Monteverdi ist auch bei Cavalli keine komplette Partitur überliefert, sondern nur ein sogenannter Generalbass; die Instrumentation richtete sich damals nach den finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Theaters und muss heute in jeder Aufführung neu erfunden werden. Das Libretto ist in einer veralteten, zum Teil sehr verschlungenen Sprache verfasst und enthält viele Metaphern, die kaum jemand heute noch entschlüsseln kann, und ein grosser Teil der Komik, die zu Cavallis Zeit mit all ihren An spielungen problemlos verstanden wurde, funktioniert heute nicht mehr. Wir gehen mit dem vorhandenen Material durch aus respektvoll, aber frei um. Die Arbeit an dieser Inszenie rung ist ein sehr kreativer Prozess, den man fast als kollektive Arbeit bezeichnen könnte – wir kreieren alle gemeinsam eine Oper für heute mit barocker Musik! Dabei kommt es uns sehr entgegen, dass diese Oper so unbekannt ist und nie mand eine bestimmte Erwartung damit verknüpft. Zu Leb zeiten Cavallis wurde sie nie aufgeführt, 1999 hat man das Manuskript überhaupt erst wiederentdeckt. Das gibt uns eine grosse Freiheit. Für mich ein grosses Geschenk. Wobei ich ganz grundsätzlich der Meinung bin, dass eine Premiere das Publikum überraschen sollte. Es wäre ja auch langweilig, in der Oper oder im Theater nur das zu sehen, was man sowieso erwartet.

Möglich ist diese ungewöhnliche Inszenierungsarbeit nicht zuletzt, weil wir mit Dmitri Sinkovsky einen Dirigenten haben, der mit Barock Musik als Geiger und als Sänger viel Erfahrung hat … und sehr flexibel ist, wenn es darum geht, hier noch ein Ritornell einzubauen oder dort noch ein paar mehr RezitativTakte zu streichen. Auch unsere Sängerinnen und Sänger müssen sehr flexibel sein und diesen Weg mitgehen; ich bin sehr froh über unsere fantastische Besetzung, mit der das so problemlos möglich ist.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dmitry Sinkovsky leitete zahlreiche Ensembles, u.a. Il Giardino Armonico, Il Complesso Barocco, Il Pomo D’Oro, Musica Petropolitana und Acca demia Bizantina, das belgische Ensemble B’Rock sowie das Helsinki Baroque Orchestra. Weitere Orchester, die er musikalisch geleitet hat, sind u.a. MusicAeterna, Musica Viva und jüngst das Orchester des Mariinski Theaters. Seit 2022 ist er Chefdirigent der Nizhny Novgorod Oper in Russland.
Wir sitzen neben einem Wald von schwarzen Notenständern auf der ansonsten leeren Probebühne. Arbeitslicht, Stille – puristischer geht es kaum. Auf ein Pult hat Dmitry Sinkovsky, ein kräftiger 42-Jähriger, der die Haare hinterm Kopf zum Knoten geschnürt trägt, seine dicke Partitur gestellt, ein anderes Pult habe ich mir in die Waagrechte gebogen, als Tischchen für den Kaffee. Der ist dringend nötig. Wie sich herausstellt, hat auch der Dirigent nur vier Stunden Schlaf gehabt, allerdings nicht wegen einer Zugverbindung. Er hat bis spät in die Nacht noch Wortbedeutungen im italienischen Libretto recherchiert. Was die Protagonisten in Francesco Cavallis früher Barockoper Eliogabalo singen, ist nämlich selten ohne Hintersinn...
Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, ob er, der diese Oper musikalisch leitet, auch Geige spielen wird. Denn vor ein paar Minuten, als ein paar Schritte weiter auf der anderen Probebühne die heutige Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern und dem Regisseur Calixto Bieito endete, hat Sinkovsky noch fröhlich ein paar Akkorde angestrichen. Sein Barockinstrument hat er immer dabei. Besser gesagt, beide Instru mente, denn Countertenor ist er ja auch. «Auf jeden Fall spiele ich», meint er, «zu sammen mit Luca Pianca an der Laute. Das müssen wir machen, denn diese Musik fordert viel Improvisation. Calixto möchte auch, dass ich an einigen Stellen singe, aber das lassen wir noch offen.» Er lacht. «Keiner weiss, was in einer Woche passiert. Die Proben sind ein permanenter Prozess.»
Sicher ist nur, dass, wenn Dmitry Sinkovsky spielt oder singt, er sich auf dem selben hochprofessionellen Level bewegen wird wie die anderen Akteure auch. Das Label Glossa hat ihn als Interpreten von Beethovens Violinkonzert ebenso im Pro gramm wie mit einer CD, auf der er Lieder von Sergej Akhunov singt, geschrieben für seine Stimme und die historischen Instrumente seines Ensembles «La Voce Stru mentale». Bei Naïve erschien eine CD, auf der er Vivaldis Vier Jahreszeiten spielt und dazu noch eine Arie des Venezianers singt, fast unnötig zu sagen, dass er das Ganze auch dirigiert. Inzwischen dirigiert er auch Opern von Rossini, Verdi, Tschaikowski. Auch dazu kommen wir noch…
Was er derzeit an der Oper Zürich macht, ist Neuland für Sinkovsky – eine Oper aus dem Jahr 1667. «Das Früheste, was ich je spielte, sang, dirigierte», sagt er, auf Englisch, denn sein Deutsch findet er nicht so gut wie sein Italienisch, Serbokroatisch, Französisch und, natürlich, Russisch. «Aber Dirigieren ist bei dieser Musik nicht das Dominierende, auch wenn ich natürlich Einsätze gebe. Ich bin eher der, der es zu sammensetzt, Instrumente aussucht, kürzt. Wenn man nicht kürzt, dauert Eliogabalo dreieinhalb Stunden, es sollen aber nur etwas mehr als zwei werden. Die Rezitative sind sehr, sehr lang, manchmal endlos, es wird oft dasselbe auf immer neue Weise erzählt. Das ist leichter zu kürzen als Monteverdi, den man eigentlich gar nicht kürzen kann. Aber man muss aufpassen, kein wichtiges Material dabei zu verlieren. Es gibt unglaubliche Momente in dieser Oper, die sind… wow, echte Meisterstücke.»
Was es nicht gibt, ist eine Instrumentierung. Es gibt Instrumentalstimmen, «die kann man besetzen, wie man will. Ich will so viele Farben wie möglich. Zinken, Flöten, Dulzian, Posaune, Harfe, drei Theorben, Laute, Lirone, Cembalo, Orgel… Jede Person bekommt ihre musikalische Identität, ihr Instrument.» Das ist schon deswegen hilfreich, weil Cavalli ein dichtes Netz machtpolitischer wie sexueller Intrigen zwischen zehn Männern und Frauen komponiert hat, an der Spitze der grössenwahnsinnige Kaiser, der eigentlich alle Frauen beansprucht und vor Gewalt nicht zurückschreckt, aber natürlich trotzdem wunderschön singen darf, wie es mir Sinkovsky nun demons triert. «Oh che vaghi candori…»
Seine schlanke, fokussierte Stimme schwebt im mezzopiano durch den stillen Saal, nach «che morbide rose» bricht er ab. «That’s it, ein Arioso von acht Takten. Elio gabalo singt sie für Gemmira, die Alessandro liebt, und die weichen Rosen… das ist etwas Physisches.» «Etwas Erotisches.» «Oh yes. Ich habe bis halb vier daran gesessen, hinter diese Metaphern zu kommen. Wir sprechen heute nicht mehr in Metaphern. Wie ausdrucksvoll diese Sprache war!» Und mit der Emotion müsse man beginnen, die Technik sei nur Unterstützung. «Das habe ich von Harnoncourt gelernt. Es ist eben nicht so, dass man in die Noten guckt und sagt, ja, kenne ich, den Rhythmus», er singt ein paar punktierte Noten, «der muss so und so verziert werden», er umgibt die Töne mit 32tel-Girlanden. «Natürlich muss man wissen, wie man Verzierungen schreibt. Aber Cavalli, das ist hauptsächlich gesprochene Musik. Wie man ein Wort ausspricht, das kann alles ändern, mehr als eine Verzierung oder ein Vibrato oder kein Vibrato.»
Es macht Spass, Cavallis Geheimnisse zu erkunden, aber ich möchte auch wissen, wie eigentlich ein Musiker zu Cavalli kommt, der zuerst am Konservatorium seiner Geburtsstadt Moskau in die alte russische Schule des Geigens einstieg, virtuos, hoch romantisch, Bruch, Brahms, Tschaikowski... «Am Konservatorium war damals Alte Musik schon in Mode, Pinnock, Gardiner, Leonhardt, die Pioniere. Ich hörte das und bekam eine Gänsehaut, es war wie ein geheimer Raum. Mit zwanzig hatte ich das Glück, als Geiger zu einer erfahrenen Gruppe von Barockmusikern zu kommen, Musica Petropolitana aus St. Petersburg. Die brachten mich mit berühmten Musikern in Kontakt, mit dem Counter Michael Chance, mit Emma Kirkby. Und ich dachte, wenn ich in Zukunft Dirigent sein will, und das wollte ich, sollte ich auch singen lernen. Was will man Sängern sagen, wenn man nicht versteht, was sie tun?» Na schön, aber das muss ja nicht gleich zu einer Zweitkarriere als Counter führen. Wie hat er seine Stimme entdeckt? «Das fragen mich Sänger auch.» Er lacht, dann schmettert er ein sehr hohes «Haaa» in die Luft. «Okay.» Der frischgebackene Barockgeiger bekam Unterricht bei Marie Leonhardt, der Sänger bei Michael Chance. Der kommende Dirigent studierte in Zagreb Chorleitung und in Toulouse Orchesterleitung. Seit Februar 2022 ist Dmitry Sinkovsky Chefdirigent der Oper in Nizhny Novgorod, einer Millionenstadt 400 Kilometer östlich von Moskau. Seit ebenso langer Zeit herrscht Krieg in der Ukraine. Wie aber kommt damit der Sänger der Titelpartie klar, der Ukrainer Yuriy Mynenko? «Wir haben uns ohne jede Diskussion vom ersten Tag an verstanden. Wir machen dasselbe Ding. So sollte es sein in unserer kleinen musika lischen Gemeinschaft, die zusammenbleiben muss in jeder Art von Zeit. Ich bin der Zürcher Oper dankbar, den Vertrag eingehalten zu haben.»
Er erzählt vom Orchester in Nizhny, ein sehr junges Ensemble von 25- bis 27-Jährigen, «diese neugierigen jungen Augen sind mir mehr wert als Geld, so moti viert, die wollen arbeiten, die sind wie eine Familie. Und egal mit welcher Situation man sich befasst, immer kümmert man sich um seine Familie. Leute mit einer festen Stelle im Orchester, mit Familie und Verwandten, haben keine Wahl, woanders hin zugehen wie reisende Musiker. Die können nur die Musik verlassen und auf die Strasse gehen. Besonders als Solist und Dirigent sollte man daran denken, dass es weitaus Abhängigere gibt.» Und die lässt er nicht sitzen.
«Keiner weiss, was in einer Woche passiert», Dmitry Sinkovskys Satz zum Proben prozess passt auch zur Weltlage. Nur dass man im Theater eher mit dem Schönsten rechnet als mit dem Schlimmsten. Für den Ensembleleiter, Sänger und Geiger hat sich der Regisseur schon wieder eine neue Herausforderung einfallen lassen, ein viertes Metier. «Calixto sagte heute, hier will ich einen ballo, einen Tanz, mach was! Also werde ich heute nacht ein paar Ritornelle komponieren. Im Stil von Cavalli, oder seine Themen benutzend, mit Zink oder Geige im Stil einer Triosonate…» Es wird wohl mal wieder spät werden.
Volker HagedornAus welcher Welt kommen Sie gerade? Mein letztes Projekt vor Zürich war Antonio Vivaldis Il Giustino im Schloss Drottningholm in Stockholm. Danach fuhr ich nach Hause, nach Odessa. Von dort wieder nach Zürich zu kom men, war sehr schwierig. Wenn ich keine Spezialgenehmigung vom Minis terium für Kultur gehabt hätte, wäre es vollkommen unmöglich gewesen. Aber auch mit dieser Genehmigung sass ich zehn Tage an der Grenze fest. Für Männer im wehrfähigen Alter ist die Ukraine zurzeit ein Gefängnis. Ich bin der Meinung, die Leute, die gelernt haben, in der Armee zu kämpfen, soll ten das Land an der Front verteidigen –und wer nicht kämpfen kann oder will, sollte das Land verlassen dürfen. Ich unterstütze mein Land so gut ich kann finanziell. Aber ich bin Sänger und nicht Soldat.
Auf was freuen Sie sich in unserer Eliogabalo Produktion?
Ich freue mich sehr darauf, ganz neue Dinge auszuprobieren! Frühbarocke Musik singe ich hier zum ersten Mal, bisher habe ich vor allem Händel, Vivaldi, Mozart und viel russische Musik gesungen. Auch szenisch ist vieles für mich neu. Aber ich liebe das Theater, Oper ist für mich zuallererst Musiktheater! Dieser Eliogabalo ist eine sehr widersprüchliche Figur. Er sucht die Extreme, er will Sex mit Frauen und mit Männern, er ist unersättlich in seiner Gier. Ich mag Calixto Bieitos Ideen, seine Inter pretation, und es macht grossen Spass, das umzusetzen.
Welches Bildungserlebnis hat Sie be sonders geprägt?
Freiheit! Niemand hat mir während meiner Ausbildung Grenzen gesetzt. Ich bin davon überzeugt, dass wir Künstler uns das nehmen müssen, was uns weiterbringt. Künstler zu sein, kann einem niemand beibringen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Das ändert sich ständig, mal ist es Hard Rock, mal ukrainische Popmusik, dann wieder Oper oder klassische Instrumen talmusik. Gestern habe ich erst ACDC gehört und dann das Mozart-Requiem.
Mit welchem Künstler, welcher Künst lerin würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Mit Luciano Pavarotti! Ich habe ihn mal in St. Petersburg kennengelernt und würde gern mit ihm über seine Lebens philosophie, seine Beziehung zur Musik und seine fantastische Gesangstechnik sprechen. Oder mit Joan Sutherland. Sie war Jury-Präsidentin beim Francesco Viñas Wettbewerb in Barcelona, als ich einen Preis gewonnen habe. Mit ihr würde ich auch sehr gern einen Abend verbringen.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
Die Bibel. Wenn mehr Menschen auf der Welt die Bibel lesen und nach den Gesetzen des Neuen Testaments leben würden, gäbe es nicht so viele Kriege auf der Welt. Ich lese aber auch andere Bücher. Philosophie fasziniert mich –Nietzsche und Kant zum Beispiel.
Warum ist das Leben schön? Mein Herz blutet, weil in meinem Land Krieg herrscht und sich die Ukraine gegen einen übermächtigen Angreifer verteidigen muss. Deshalb ist mein Leben zurzeit nicht nur schön. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich trotz allem reisen und mein Land repräsentieren kann, dass ich hier mit tollen Kolleg:in nen eine Oper erarbeiten kann. Und dass in meinem Herzen immer noch Liebe ist.
Yuriy Mynenko, Countertenor aus Odessa, singt die Titelpartie in der Neuproduktion «Eliogabalo». Er ist bisher u.a. an der Staatsoper Stuttgart, am Theater an der Wien und bei den Salzburger Festspielen aufgetreten.


Das grosse Klarinettensolo im dritten Akt ist eine Oase in Puccinis «Tosca», die an sonsten von einem nervösen Grundton dominiert wird: Die Ereignisse überstür zen sich, es fallen schnelle Entscheidun gen. Wenn hingegen der zum Tode ver urteilte Cavaradossi auf der Engelsburg zu seinem Abschiedsbrief ansetzt, bleibt mit den ersten drei Tönen der Klarinette, die die Arie «E lucevan le stelle» anstimmt, die Zeit stehen. Noch eine Stunde hat Cavaradossi zu leben. All seine Sinne sind äusserst empfänglich, wie es typisch für Menschen in Extremsituationen ist. Er sieht («Und es leuchteten die Sterne»), riecht («die Erde duftete») und hört in tensiv («das Tor zum Garten knarrte, Schritte huschten über den Kies»). Cava radossi erinnert sich in diesem Moment nur an die schönen Dinge, die er mit Tosca erlebt hat, an die süssen Küsse, das sehn suchtsvolle Liebkosen. Er bereut nichts in seinem Leben. Dies alles muss ich mit der Klarinette transportieren. Wichtig ist es, die Melodie ganz fein und leise anzufan gen. Man braucht einen butterzarten Ton und ein schönes Legato, denn die Melodie darf nicht auseinanderfallen. Puccini schreibt mehrmals «rubando», es ist also teilweise sehr erwünscht, nicht streng ma thematisch zu interpretieren, sondern mit grosser Flexibilität und vielleicht mit ei nem Hauch «Italianità». Denn jede Vor stellung ist anders, jeder Sänger des Ca varadossi ist anders, und Dirigentinnen und Dirigenten geben einem unterschied liche Freiheiten. Die Stelle ist für eine A-Klarinette geschrieben, die ein etwas dunkleres Timbre als die B-Klarinette hat und natürlich sehr passend für eine nächt liche Szene ist – Puccini hatte ein unfass bar gutes Gespür für Instrumente und die Instrumentation. Für mich ist diese Arie jedes Mal wie ein Zückerchen. Ich freue mich den ganzen Tag darauf.
Rita Karin MeierUnsere Solo-Klarinettistin Rita Karin Meier über ihr Solo im 3. Akt in Puccinis Oper
Hans van Manen ist dieses Jahr 90 Jahre alt geworden, das Ballett Zürich zeigt im Januar sein Stück «On the Move». Michael Küster hat den Jahrhundert-Choreografen in Amsterdam besucht. Ein Gespräch über die Freiheit des Suchens beim Choreografieren, über Schallplattenstapel, Disneys «Fantasia», Homosexualität, Fotografie und wie man als Künstler sein Erbe regelt
 Fotos Florian Kalotay
Fotos Florian Kalotay

Hans van Manen, im Juli 2022 hat die Ballettwelt Ihren 90. Geburtstag ge feiert. Wie haben Sie selbst diesen Tag verbracht?
Das schönste Geschenk war das dreiwöchige Festival, bei dem in der Amsterdamer Oper insgesamt 19 meiner Ballette gezeigt wurden. Das Dutch National Ballett, das Nederlands Dans Theater und Introdans aus Rotterdam haben getanzt. Aber besonders gefreut hat mich, dass mit dem Ballett am Rhein, dem Wiener Staats ballett und dem Stuttgarter Ballett auch drei internationale Compagnien angereist waren. Es war ein riesiger Erfolg. Ich habe alle 13 Vorstellungen gesehen und musste mich jedes Mal verbeugen. Gott im Himmel! Es war einfach fantastisch!
Sie haben bereits vor einigen Jahren, 2014, aufgehört zu choreografieren. Wie präsent sind Ihre Stücke heute für Sie?
Ich habe in meinem Leben 150 Ballette gemacht und dachte irgendwann, es reicht. Ich wollte nicht, dass man sagt: Oh, er ist schon 90 und macht noch immer Ballette. Das Aufhören war damals wie eine Befreiung. Ich fand es herrlich, nicht mehr unter dem Druck zu stehen, zu drei Terminen im Jahr eine neue Choreografie fertig haben zu müssen. Aber die Tanzkunst interessiert mich bis heute zu hundert Prozent. Wo auch immer ein Ballett von mir aufgeführt wird, ich komme! Ich habe fünf Leute, die meine Ballette einstudieren, und jedes Mal bin ich überrascht, wie gut sie das machen. Aber ich versuche auch immer, ein paar Tage vor der Premiere selbst vor Ort zu sein, um noch mit den Tänzerinnen und Tänzern zu arbeiten. Natürlich komme ich auch nach Zürich.
Zum Ballett Zürich haben Sie eine lange Beziehung. Seit fast dreissig Jahren sind Stücke von Hans van Manen in Zürich zu sehen, darunter so berühmte Choreografien wie Metaforen, Frank Bridge Variations oder Kammerballett. Zürich war immer ein besonderer Ort für mich. Bernd Roger Bienert hat in den 90er-Jahren die ersten van Manen-Stücke gezeigt. Heinz Spoerli, mit dem ich bereits in seiner Zeit in Basel viel zusammengearbeitet habe, hat das fortgeführt, und auch mit Christian Spuck gibt es eine schöne Verbindung.
Nicht nur die jüngeren Choreografien, sondern auch viele Stücke aus den sechziger und siebziger Jahren haben sich ihre Zeitlosigkeit bewahrt. Beschäf tigt Sie der Gedanke, was aus Ihrem Werk wird, wenn Sie nicht mehr da sind? Als Choreograf hofft man natürlich, dass es einige Stücke auch über den eigenen Tod hinaus schaffen, lebendig zu bleiben, aber eine Garantie für Zeitlosigkeit gibt es nicht. Ich finde es wichtig, über den Tod nachzudenken und Vorkehrungen zu treffen – nicht nur, was die Ballette betrifft. Sonst wird es für alle furchtbar, die das dann regeln und auflösen müssen. Vor seinem Tod sollte man so viel wie möglich weggeben. Nur so hat man in der Hand, dass das im eigenen Sinne passiert. Mein künstlerisches Erbe wird von der Hans-van-Manen-Stiftung verwaltet.
Wir führen unser Gespräch auf Deutsch. Nicht nur die Sprache, sondern auch Deutschland an sich spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle. Ich bin in Nieuwer Amstel in Nordholland geboren, aber meine Mutter war Deut sche. Allerdings erinnere ich mich nicht, dass wir zu Hause Deutsch gesprochen hätten. Doch wahrscheinlich täusche ich mich, denn sonst würde ich die deutsche Sprache nicht so gut kennen. Meine internationale Karriere hat 1971 von Deutsch land aus ihren Anfang genommen. Damals ist Keep going in Düsseldorf entstanden. Schon vorher waren namhafte deutsche Tanzkritiker wie Jochen Schmidt und Horst Koegler immer wieder nach Holland gekommen, um meine Aufführungen zu rezensieren. Aber in Deutschland habe ich immer wieder gearbeitet.
Galt der Prophet nichts im eigenen Land? Das ist etwas Wahres dran. Meinen Ruf als Choreograf musste ich mir im Ausland
von Hans van Manen, Louis Stiens und Christian Spuck Premiere am 14 Jan 2023
und vor allem in Deutschland erarbeiten, ehe er nach Holland ausgestrahlt hat. Damals wie heute hat die Tanzkunst hier keinen einfachen Stand. Obwohl das Inte resse gross ist und die Ballettvorstellungen gut gefüllt sind, findet der Tanz fast überhaupt keinen Widerhall im Feuilleton.
Musik und die Tänzerinnen und Tänzer haben Sie immer wieder als die wich tigsten Quellen Ihrer Inspiration benannt.
Von der ausgewählten Musik hängt die Besetzung für eine Choreografie ab. In einer grossen Orchesterpartitur wird sie grösser sein als bei einem Klavierstück oder einem kammermusikalischen Werk. Wenn die Musik einmal feststeht, habe ich sofort eine Besetzung im Kopf, mit der ich arbeiten will. Das waren keineswegs nur meine Lieblingstänzerinnen und -tänzer, sondern ich fand es immer spannend, ihnen Leute an die Seite zu stellen, die ich in anderen Vorstellungen oder im Training gesehen hatte. Die richtige Musik zu finden, hiess in den Sechziger und Siebziger Jahren: Schallplatten, Schallplatten, Schallplatten! Ich habe mich damals quer durch das Repertoire gehört.
In einem Film haben Sie von einem Plattengeschäft erzählt…
Das war wirklich einmalig. Dort musste ich nur das Genre sagen, zum Beispiel Streichorchester aus dieser oder jener Zeit, und schon kamen sie mit einem Stapel Platten oder CDs, die ich mit nach Hause nehmen und daraus in Ruhe eine Auswahl treffen konnte. Wenn ich die passende Musik gefunden habe, nehme ich für mich eine Einteilung vor und lege fest, wo es einen Pas de deux gibt oder wo drei, vier oder sechs Leute tanzen. Ich habe eine Vorstellung von Anfang und Ende, weil das dramaturgisch sehr wichtig ist. Auch bei einem Buch sind ja die ersten Zeilen die wichtigsten! Aber ansonsten weiss ich nichts im Voraus. Alles ent steht mit dem Beginn der Arbeit im Studio. Ich kenne die Einteilung der Tänze rinnen und Tänzer und lasse mich ansonsten von der Musik leiten. Sie weist mir den Weg. Ich improvisiere viel, und dabei steht man natürlich ziemlich nackt da. Deshalb liebe ich risikofreudige Tänzerinnen und Tänzer. Wenn sie gar zu vor sichtig sind, werde ich auch vorsichtig. Sie müssen sich hineinwerfen. Sie machen geniale Fehler, und dann rufe ich: Das bleibt so! Da wird nie geschrien. Es geht alles sanft und ohne Druck, und so muss es auch laufen. Wir hatten immer Spass mit den Choreografien. Wenn ich meinte: «Das kann man ja nicht anschauen. Das sieht aus wie Balanchine.», fragte ein Tänzer gleich zurück: «Welcher Balanchine?»
Und dann stellten wir fest, dass es doch eine Eigenständigkeit hatte, und wir haben die Sequenz behalten.
George Balanchine galt und gilt vielen Tanzschaffenden als eine Art Überfigur. Was hat er am Anfang Ihres Weges als Choreograf bedeutet, und was bedeutet er heute?
Als ich das erste Mal Balanchine sah, fand ich das unglaublich. Und das ist bis heute so geblieben. Bei einigen meiner Stücke spürt man, dass er mich inspiriert hat, aber ich glaube, sie sehen trotzdem nicht aus wie von Balanchine. Strawinsky und Picasso hassten das Wort «Inspiration», für sie war es ein Modewort. Halb im Scherz sage ich deshalb lieber: Ich stehle, wo immer ich kann. Man «stiehlt» und stellt fest: Mit diesem Element kann ich auch dieses oder jenes tun. Stehlen ja, imitieren nein! Das muss man sich bei jedem Stück sagen.
Wo sagen Sie denn heute: «Das habe ich von Balanchine gelernt.»?
Von Balanchine lernt man zuallererst Musikalität! Zu beobachten, wo und warum sich die Choreografie ändert, das ist fantastisch anzusehen. Die Art, wie er mit Wiederholungen umgeht. Auch was die Ausnutzung des Bühnenraums angeht, habe ich viel von ihm gelernt. In welchem Verhältnis stehen Horizontale und Vertikale, wann verwende ich die Diagonale, die ja die längste Form von Wiederholung ist,
die man in einer Choreografie machen kann. Es war mir immer wichtig, den zur Verfügung stehenden Raum voll auszunutzen. Wenn man Architekt ist, gebraucht man das ganze Haus und nicht nur die erste Etage.
Jetzt haben Sie viele Begriffe aus der Geometrie und Architektur verwendet. Wahrscheinlich können Sie es schon nicht mehr hören, aber Ihr Beiname «Mondriaan des Tanzes» kommt ja nicht von ungefähr… Es ist ein grosses Kompliment, und es ehrt mich, wenn man das beim Betrachten meiner Stücke so empfindet. Ich messe dem aber keine so grosse Bedeutung bei. Mein ganzes Leben habe ich mich für Bildende Kunst interessiert, vor allem für die Werke des Konstruktivismus. Da kommt man an Mondriaan natürlich nicht vorbei. Auch in Zeiten, in denen ich kein Geld hatte, habe ich Bilder gekauft und dann in Monatsraten abbezahlt. Die Herzensbeziehung war dabei immer das Wichtigste. Es gibt diesen magischen Moment, wo du merkst: Ich muss und soll das haben. Und dann muss man kaufen.

Ihr Weg zum Tanz führte über einen Umweg. Sie sind zunächst bei dem grossen holländischen Maskenbildner Herman Michels in die Lehre gegangen. Es war kurz nach Kriegsende, und die Schulen waren geschlossen. Meine Mutter, die wusste, dass ich tanzen wollte, hat mich durch Vermittlung einer Freundin bei Michels untergebracht, damit ich überhaupt etwas machen konnte. Michels war der beste Maskenbildner in Holland für Film, Bühne und Oper. In den fünf Jahren bei ihm habe ich alles an Balletteindrücken aufgesogen, was möglich war. Als ich 18 war, sagte ich zu ihm, dass ich aufhören wolle, um im Ballett von Sonia Gaskell zu tanzen. Er meinte, ich solle nur noch an einem Tag in der Woche für ihn arbeiten und könne mein Salär trotzdem behalten. Das habe ich noch ein halbes Jahr ge macht, mich dann aber ganz dem Tanz gewidmet. Ich war sicher nicht der Idealtyp für Schwanensee oder Giselle, aber ich war ein Virtuose und konnte unglaublich gut drehen. Zehn Pirouetten waren für mich normal. Nach einer kurzen Zeit bei Sonia Gaskell bin ich ins Opernballett gewechselt und 1958 schliesslich für ein Jahr nach Paris zu Roland Petit gegangen. Paris war eine Enttäuschung, die grosse Ballettgeschichte schien dort vorbei, und so sind Gérard Lemaître und ich schon nach einem Jahr nach Holland zurückgekehrt, wo wir uns dem gerade gegründeten Nederlands Dans Theater angeschlossen haben. Ich wurde zunächst als Tänzer und Choreograf engagiert, ein halbes später war ich Künstlerischer Leiter. Nach zehn Jahren reichte es mir, von da an habe ich nur noch als Choreograf gearbeitet und bin ohne alle administrativen Verpflichtungen sehr gut gefahren.
Amsterdam ist immer der Mittelpunkt Ihres Lebens gewesen. Warum haben Sie dieser Stadt ein Leben lang die Treue gehalten? Ich wollte immer nur in Amsterdam leben, denn hier kann man anonym bleiben. Die Konkurrenz in einer Stadt wie New York hätte ich nicht ausgehalten. In Holland konnte ich immer machen, was ich machen wollte. Das Nederlands Dans Theater und das Holländische Nationalballett waren die beiden Pole meiner Arbeit Jede der beiden Compagnien hat – bedingt durch die unterschiedliche TanzTechnik – ihr völlig eigenes Profil, und entsprechend unterschiedlich choreografiert man dann auch.
Ihr Schaffen ist mittlerweile auch zum Forschungsgegenstand geworden. Kluge Köpfe haben Ihr Werk in Perioden eingeteilt. Da ist die Rede von der Frühzeit, der Zeit der beginnenden Reife, der romantischen Periode, der Phase der kleinformatigen Duos... Können Sie das nachvollziehen?
Das Leben stellt sich in der Rückschau nicht in solchen Schubladen, sondern eher als ein grosser Kosmos dar. Man merkt oft erst viel später, was wichtig für einen war. Der Jazz zum Beispiel. Mein Bruder war Jazz-Pianist, und das hat mich sehr beeinflusst. In den 50er-Jahren habe ich, inspiriert von Jerome Robbins, JazzBallette gemacht. Aber auch zu Popmusik habe ich choreografiert, in Twice von 1970 zum Beispiel Sex Machine von James Brown. Das haben wir in London bei einem Gala-Abend des Royal Ballet aufgeführt. Später war das überall ein Er folg, nur dort nicht. Aber hinterher bekam ich einen Brief von James Brown. Er fände es toll, dass Sex Machine endlich den Weg nach Covent Garden gefunden hätte. Nach diesem Brief war die Welt für mich wieder in Ordnung.

Schon 1987 hat der Tanzkritiker Jochen Schmidt seiner Hans van Manen Monografie den Titel Der Zeitgenosse als Klassiker gegeben… Ein fantastischer Titel, oder?
Sie fühlen sich damit also richtig beschrieben? Jochen Schmidt hat das Spannungsverhältnis von Klassizität und Moderne in meinen Stücken gesehen. In der tänzerischen Ausbildung steht der klassische Tanz oft am Anfang. Aber dann kommen die unterschiedlichsten Eindrücke hinzu und
«Ich wollte immer nur in Amsterdam leben, denn hier kann man anonym bleiben.»
hinterlassen ihre Spuren. 1952 habe ich durch Martha Graham erfahren, was es heisst, den Boden in einer Choreografie zu benutzen. So etwas hatte ich noch nicht gesehen! Heute habe ich oft den Eindruck, dass die Choreografen fast zu viel mit dem Boden arbeiten. Da sieht man fast gar keinen Tanz mehr, und die Beine werden nicht mehr gebraucht.
Genauso wichtig wie die Beine sind in Ihren Choreografien die Augen und der Blick… Das stimmt. Für die Beziehung zweier Tänzer in einem Pas de deux ist die Blick richtung unverzichtbar. Bei mir ist sie immer einchoreografiert. Wohin schaut man? Wie schaut man einander an? Man darf nie in den Saal schauen, nach dem Motto «Guckt mal, wie fantastisch ich tanze!» Ausgestellte Virtuosität finde ich schrecklich Wenn man in die Gasse schaut, stellt sich die Frage: Geht man? Geht man noch nicht? Geht man im Guten? Geht man im Bösen? Blicke sind ein Seismograph für die Beziehung und ausschlaggebend für alles, was sich choreografisch ereignet.
Lassen Sie uns noch einmal auf die Musik zurückkommen. Welche Qualität muss Musik haben, damit Sie choreografische Ideen bei Ihnen freisetzt? Ich merke immer wieder, wie wichtig der Rhythmus ist. Erst der Rhythmus lässt tanzen. Musik muss mich so anfassen, dass ich gar nicht anders kann, als dazu zu choreografieren. Ich finde manche Stücke fantastisch, aber weiss von Anfang an, dass es nicht einfach wird. Aber dieses Risiko muss man eingehen. Ohne Risiko ist alles uninteressant. In vielen Choreografien, die ich sehe, wird die Musik als Wallpaper, als Tapete, benutzt. Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass es sich bei Ballett um illustrierte Musik handelt. Mir war immer wichtig, sich nicht auf den äusseren Ablauf zu verlassen, sondern die Innenspannung der Musik zu erfassen und ergründen. Ich finde es toll, wenn Musik es mir nicht einfach macht und sie mich zwingt. Das ist herrlich. Ich will auch gezwungen werden. Es gibt Choreo grafen, die Schritte geradezu mühelos aus dem Ärmel schütteln. In den meisten Fällen gelingt mir das nicht. Ich muss über jeden Schritt nachdenken.
Sie haben fast nie zu Musik choreografiert, die ausdrücklich für den Tanz komponiert wurde. Eine Ausnahme war 1974 Strawinskys Le Sacre du printemps beim Holländischen Nationalballet. Was war das für eine Erfahrung?
Ich muss 14 gewesen sein, als ich Walt Disneys Zeichentrickfilm Fantasia gesehen habe. Da traten die Dinosaurier zu Sacre-Klängen auf! Ich bin damals sicher zehn Mal ins Kino gegangen, weil ich die Musik so fantastisch fand. Aber ehrlich gesagt, war ich mit meinem Sacre nie zufrieden. Ich habe damals mit einem Pas de deux in der Mitte begonnen, weil zwei Solisten gerade für eine Probe frei waren. Das hätte ich nicht tun sollen. Man muss von Anfang an anfangen und weiterchoreo grafieren bis zum Ende. Wenn man hier ein Stückchen und da ein Stückchen macht, gerät die Dramaturgie in Gefahr, und man verliert die Geschichte aus den Augen.
Trotzdem sind Sie zu Strawinsky immer wieder zurückgekehrt. Weil er ein musikalischer Seelenverwandter ist?
Weil er mich aufgeregt hat! Wir sprachen über den Konstruktivismus, der steckt ja auch in dieser Musik. Bei Strawinsky ändert sich die musikalische Struktur jede Minute. Man kann fast die Uhr danach stellen.
Gibt es Musik, bei der Sie denken: Das hätte ich gern noch choreografiert? Ich kann Musik inzwischen gut ohne jeden Gedanken an Choreografie geniessen. Ich höre etwas und denke mir: Was für ein fantastisches Stück Musik! Erst gestern gab es im Fernsehen ein Gustav-Mahler-Adagio in einer Fassung für Klarinette, Cello und Klavier. Vor ein paar Jahren hätte mich das wahrscheinlich inspiriert. Kammermusik ist einfach herrlich!
«Blicke sind ein Seismograph für die Beziehung und ausschlaggebend für alles, was sich choreografisch ereignet.»
Was sollten Tänzerinnen und Tänzer begriffen haben, wenn sie Ihre Stücke tanzen?
Dass man mit Schritten noch ganz andere Sachen machen kann, als man normaler weise tut. Ich hab immer versucht, die herkömmlichen klassischen Schritte zu verändern. Man kann sie länger oder kürzer machen, und mit der erlernten Technik lässt sich das Spektrum tänzerischen Ausdrucks immer wieder erweitern. Dieser Kreis ist noch lange nicht ausgeschritten. Aber es geht mir, wie gesagt, nie um die Technik an sich. Das Wichtigste im Pas de deux ist die Beziehung zwischen zwei Menschen. Deshalb wollte ich immer Menschen auf der Bühne sehen. Tänzer, die Menschen sind und nicht nur Tänzer.
Sie haben in Ihren Stücken die unterschiedlichsten Paarkonstellationen zusammengebracht. 1965 war in Metaforen der erste Männer Pas de deux der Tanzgeschichte zu sehen. Trotzdem waren Ihre Ballette nie eine Selbstfeier der Homosexualität… Warum sollten sie das auch sein? Ich habe die Homosexualität immer sehr einfach und als etwas völlig Normales gesehen. Ich wusste seit meinem 10. Lebensjahr, dass ich homosexuell bin und habe das ab 15 auch offen gelebt. Dennoch bin ich mir im Klaren, dass das in vielen Teilen der Welt auch heute nicht selbstverständlich ist und verfolge den Umgang der Politik mit diesem Thema sehr bewusst.
Mit Ihrem Partner Henk sind Sie seit 51 Jahren zusammen. Was ist das Rezept für diese lange Beziehung?
Das funktioniert, weil wir nicht zusammenwohnen. Wir sehen einander fast jeden Tag, wir essen zusammen. Aber abends geht jeder zu sich nach Hause, denn es gibt immer noch Dinge, die man alleine tut. Vielleicht läuft im Fernsehen ein Stück, das ihn nicht interessiert, und ich will es sehen? Wenn man einander totale Freiheit gibt und sich jeder trotzdem für den anderen verantwortlich fühlt, kann man es lange miteinander aushalten. Auf Reisen sind wir immer im selben Hotelzimmer. Gerade erst hatten wir in Paris wieder so viel Spass zusammen. Wir gehen da jedes Mal zu Armani, und die wollen dann immer, dass wir alles anziehen. Das tun wir auch. Aber wir sagen dann zehn Mal Nein und einmal Ja.
Armani ist Ihr Lieblingsdesigner?
Ja, aber auch Ralph Lauren mag ich sehr. Und halten Sie mich für verrückt, aber oft kaufe ich auch die idiotischsten Schuhe bei Dolce & Gabbana. Aber ich trage sie nie, weil ich finde, dass es Kunstwerke sind!
In Ihren Stücken steckt neben einer grossen Klarheit, Eleganz und Menschlichkeit oft auch sehr viel Humor. Schuhe bzw. Absätze haben Sie sogar auch in der Choreografie zum Thema gemacht… Wann immer ich irgendwo auf einer Terrasse sitze, beobachte ich, wie die Leute laufen. Es gibt so wenig Menschen, die das gut können. Und die Absätze sind bei fast allen furchtbar. Bei den Frauen sind sie oft so hoch, dass sie die Beine nicht strecken können. Zu den Premieren in Russland kamen die Damen oft in Sport schuhen und brachten ihre High Heels in einem Beutel mit, um sie im allerletzten Moment anzuziehen. Das fand ich grossartig. In Twilight von 1972 stand meine Ballerina Alexandra Radius auf hochhackigen Spitzenpumps. Was im Leben etwas Normales ist, bringt eine klassische Tänzerin auf der Bühne in eine eigenartige Position. Sie tanzt weder auf Spitze noch auf flacher Sohle, sondern in einem Zwischenbereich. Der Schuh scheint nicht nur ihre Motionen, sondern auch ihre Emotionen einzuschränken. Die Musik von John Cage für präpariertes Klavier fand ihre Entsprechung in dieser Choreografie für «präparierte Füsse». Aber Ab sätze können auch eine Waffe sein. Dagegen wirken nackte Füsse fast wie ein Friedensangebot.
Unser Gespräch wäre unvollständig, wenn wir nicht auch über den Fotografen Hans van Manen sprechen würden. Fotos wie Stretching, Sword oder Bacchanten sind geradezu ikonografische Kunstwerke, die in namhaften Museen ausgestellt sind. Woher kam der Impuls zum Fotografieren?
Das hatte mit den vielen Malern zu tun, mit denen ich befreundet war. Sie wollten immer, dass ich meine Meinung zu ihren Kunstwerken äussere, weil ich angeblich «den richtigen Blick» hätte. Irgendwann fanden sie, ich müsse fotografieren. 1972 habe ich mit der Kleinbildkamera zunächst in Farbe begonnen. Dann habe ich noch ein Studium angefangen und mit der Hasselblad in schwarz-weiss und im Negativformat 6x6 das fotografiert, was mich als Choreograf interessiert – den menschlichen Leib. Während es in der Choreografie um den Ablauf von Bewegung geht, hat mich beim Fotografieren der Stillstand interessiert, das Verhältnis von Körper, Raum und Licht und ihrer zweidimensionalen Abbildung. Neben dem Choreografieren war das eine anstrengende Sache. Fast jede Nacht stand ich bis drei Uhr morgens im Labor. Ich musste mich irgendwann entscheiden und fand die Choreografie am Ende doch wichtiger für mich. 1991 habe ich mit dem Fotogra fieren aufgehört und seither auch nie wieder eine Kamera angefasst. Aber ich kaufe nach wie vor Fotografien und interessiere mich sehr dafür. Gerade bin ich sehr glücklich mit den Close-Ups, die mein Freund, der holländische Fotograf Erwin Olaf, von einigen meiner Choreografien gemacht hat. Sie wurden in Amsterdam und Paris in Ausstellungen gezeigt und auch als Bildband veröffentlicht.
Das Ballett Zürich tanzt jetzt Ihre Choreografie On the Move aus dem Jahr 1972. Was ist das für ein Stück?
On the move habe ich seinerzeit für das Nederlands Dans Theater choreografiert. Mit insgesamt vierzehn Tänzerinnen und Tänzern war das für mich eine relativ grosse Besetzung. Ein befreundeter Kritiker hatte mir das Erste Violinkonzert von Sergej Prokofjew empfohlen. Ich habe es gehört und fand es am Anfang alles andere als einfach. Besonders die Wiederholungen in der Partitur haben mich da mals beschäftigt. Müsste ich da in der Choreografie nicht etwas anderes machen? Aber ich habe mich dann doch für eine choreografische Wiederholung entschieden, und wenn das toll getanzt wird, ist das absolut richtig. Heute bin ich zufrieden, dass ich das Stück gemacht habe.
Was muss denn zusammenkommen, damit Hans van Manen zufrieden ist? Man muss einfach guten Gewissens draufschauen können. Zu vielen meiner Ballette stehe ich bis zum heutigen Tag. Aber es gibt auch welche, über die die Zeit ihr Urteil gefällt hat. Henk und ich sind all meine Stücke durchgegangen, und bei etwa 40 Prozent fanden wir: Weg damit! Wenn Henk zögerlich war, habe ich gesagt: Du kannst es aufführen lassen, wenn ich es nicht mehr sehen muss. Also nicht, solange ich lebe!
Wir haben während unseres Gesprächs köstlich gegessen und guten Wein ge nossen, und Sie haben sich dabei ein paar kleine Zigaretten gedreht… Das muss sein! Ich rauche seit 70 Jahren aus Passion. Erst kürzlich habe ich mich wieder durchchecken lassen, und die Ärztin rief mich am nächsten Tag an: «Spreche ich mit dem 18-jährigen Hans van Manen?» Ich fragte: «Alles in Ordnung?» «Alles in Ordnung!» Ich rauche nicht Lunge, sondern ein bisschen durch die Nase. Ich inhaliere nicht total, das habe ich nie getan. Aber ich rauche mit Henk noch immer fast jeden Tag einen Joint. «Prima!», sagen die Ärzte.

Im Herbst 2018, ich erinnere mich gut, hatte ich das Glück, zum ersten Mal in Zü rich zu arbeiten. In meinem Stück Wounded habe ich mich seinerzeit mit dem Tanzen junger Menschen in den Medien der Unterhaltungsindustrie auseinandergesetzt. Mit den Tänzerinnen und Tänzern des Junior Balletts war das eine wunderbare Erfahrung. Seither ist viel passiert. Inzwischen tanze ich nicht mehr im Stuttgarter Ballett, das seit 2011 meine künstlerische Heimat gewesen ist. Das Choreografieren ist für mich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, und diesen Weg will ich jetzt – ohne Engagement im Rücken – noch konsequenter beschreiten. Im Erforschen der eigenen Körperlichkeit beim Tanzen habe ich in jüngster Zeit eine grosse Bereiche rung durch meinen Partner Shaked Heller erfahren, der ebenfalls tanzt und choreo grafiert. Schon für 2020 war eine Zusammenarbeit mit dem Ballett Zürich geplant, aber wie so viele andere Projekte ist sie der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Umso schöner, dass es jetzt doch noch dazu kommt!
In den letzten zehn Jahren war ich damit beschäftigt, eine eigene Bewegungs sprache zu finden. Im Kontakt mit den Tänzerinnen und Tänzern hoffe ich, hier in Zürich noch einmal auf neue Ideen zu kommen und diese Sprache weiter auszubauen. Der künstlerische Austausch und das Einbinden der an einer Produktion beteiligten Personen ist mir sehr wichtig. Dabei interessiert mich das Feedback der Tänzerinnen und Tänzer sehr. Ich selbst hätte als Tänzer oft gern mehr zu entstehenden Projekten beigetragen, als einem Choreografen lediglich meine tänzerischen Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. William Forsythe hat schon in den 80er-Jahren vorgemacht, wie das gehen kann: Gemeinschaftschoreografien, die an die Leute gebunden sind, die sie kreiert und erfunden haben.
Hier in Zürich wollte ich nicht einfach eine abstrakte Choreografie abliefern. Mein neues Stück für das Ballett Zürich entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Bühnenbildnerin Bettina Katja Lange. Da sie aus dem Bereich der visuellen, digitalen Medienkunst kommt und bisher nur wenig mit Tanz zu tun hatte, gehen wir gemein sam durch einen bereichernden Arbeitsprozess. Das Konzept zum Stück ist im inten siven Austausch mit ihr entstanden. Bis auf die Musikwahl gab es keine konkreten Vorgaben. Wir wollten autonom arbeiten, uns im Austausch mit dem Sounddesigner Mike Utz gegenseitig inspirieren und so die Bedeutungsebenen des Stücks ständig hinterfragen und erweitern. Ich bin sehr glücklich über diesen Austausch, nachdem die Pandemie uns noch einmal deutlich vor Augen geführt hat, welch grossen Wert gemeinschaftliches Arbeiten hat und wie viel bereichernder das ist als der einseitige Egotrip.
Mit der Philharmonia Zürich steht für den Ballettabend On the move ein Spitzen orchester zur Verfügung. Auf der Suche nach einer Musik, die Tänzer und Musiker gleichermassen herausfordert, bin ich irgendwann auf Claude Debussy und Maurice Ravel gestossen. In vielen ihrer Kompositionen haben sie Naturereignisse zum Thema gemacht. Mich hat interessiert, wie sie Natur in ihren Stücken spiegeln und wie sich die Sicht auf Natur, aber auch die Naturerfahrung in den letzten 100 Jahren gewan delt haben. Wenn wir Stücke wie Nuages oder Une barque sur l’océan heute hören, stellt sich oft der Gedanke an eine Idylle ein, die es so nicht mehr gibt und vielleicht auch nie gegeben hat. Es ist eine Natur, die mit der Realität nichts zu tun hat und die
Choreografien von Hans van Manen, Louis Stiens und Christian Spuck Premiere am 14 Jan 2023

für mich nach einem Gegenpol verlangt. Natur in Reinform ist für uns heute kaum noch erlebbar. Fast immer treten wir in eine von Menschen, von Technologie über formte Natur. Ich habe mir angeschaut, was andere Choreografen zu diesen Kom positionen gemacht haben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Musik zu bestimmten Stereotypen verleitet. Als Choreograf gerät man schnell in Versuchung, nur noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Das möchte ich vermeiden. Für mich war relativ schnell klar, dass ich das Ganze in irgendeiner Form brechen muss.

Das dreidimensionale Bühnenbildobjekt, das Bettina Katja Lange entwickelt hat, wirkt deshalb wie ein Überbleibsel von Natur nach dem menschlichen Eingriff. Es erinnert noch an verschiedene Naturszenarien – eine Welle, einen Berg oder auch einen Lufthauch, aber es ist bereits ein Kommentar. Was passiert mit dem menschli chen Körper in dieser Umgebung? Wie natürlich, aber auch wie künstlich können sich Tänzerinnen und Tänzer darin bewegen?
Die Debussy- und Ravel-Kompositionen kontrastieren wir mit Tonaufnahmen, die wir mit unserem Sounddesigner Michael Utz am Uetliberg gemacht haben: das Rauschen des Windes ist zu hören, bewegtes Gestein, ein Flugzeug, das über den Berg fliegt. Entstanden ist eine Klangcollage aus Feldaufnahmen, die uns zufällige Bruch stücke und Ausschnitte aus der Natur präsentiert, denen aber nichts Idyllisches mehr anhaftet. Gemeinsam mit den Orchesterkompositionen entsteht eine Soundlandschaft,
die in einen Dialog mit dem Bühnenbild und der Choreografie treten soll. In der Interaktion mit den Tänzerinnen und Tänzern wird in diesem Kosmos eine besondere Dramatik entstehen.
Für einen Choreografen ist es ein grosses Plus, wenn er im Studio selbst vorma chen kann, was ihm in seiner Choreografie vorschwebt. Im Studio können wir im Moment nur in einem sehr vereinfachten Probensetting arbeiten. Deshalb bin ich nach Probenschluss gerade jeden Abend noch allein im und auf dem Originalbühnen bild unterwegs, um auszuprobieren, welche Bewegungs- und Schrittabläufe in diesem Setting möglich und praktikabel sind. Dabei ich habe ich mir schon jede Menge blaue Flecken geholt, die ich meinen Tänzerinnen und Tänzern in den Bühnenproben gern ersparen will.
Zufällig ist es das Werk eines Schweizer Autors, das mich während der Entstehung dieses Stückes begleitet. In seinem 1934 erschienenen Roman Derborence erzählt Charles Ferdinand Ramuz von einem Bergsturz, der ein ganzes Dorf unter sich be gräbt. Dass sich vor diesem Hintergrund im Roman eine Liebe entwickelt, die Natur also nicht nur ihre zerstörerische Kraft entfaltet, sondern weiter schöpferisch bleibt, hat etwas sehr Hoffnungsvolles.
 Notiert von Michael Küster
Notiert von Michael Küster
Choreografien von Hans van Manen, Louis Stiens und Christian Spuck Premiere am 14 Jan 2023
Christian, On the Move heisst der neue Abend des Balletts Zürich mit Choreo grafien von Hans van Manen, Louis Stiens und von dir. Wie ist dieser Abend zustande gekommen?
Hans van Manen hatte ich bereits 2020 mit seinem Kleinen Requiem engagiert. Dieses Projekt ist leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Deshalb war es mir wich tig, ihn wieder einzuladen – auch vor dem Hintergrund seines 90. Geburtstages. Aber wir haben uns für ein anderes Stück von ihm entschieden, weil es eine grössere Besetzung hat und so mehr Tänzerinnen und Tänzer in den Genuss kommen, Hans van Manen zu tanzen. Ähnlich ist es mit Louis Stiens, der bereits sehr erfolg reich für das Junior Ballett choreografiert hatte und nun – wie lange vereinbart –die Chance erhält, mit der Hauptcompagnie zu arbeiten. On the move ist nicht nur ein grossartiges Werk von Hans van Manen. Der Titel hat eine schöne Doppel deutigkeit, denn beim Ballett Zürich wird sich – bedingt durch den Wechsel in der Direktion – in den nächsten Monaten einiges in Bewegung setzen. Nicht nur die Tänzerinnen und Tänzer, auch die Institution wird sich weiterbewegen.
Was verbindet die drei Choreografien?
Es ist, wie ich finde, ein repräsentatives Kaleidoskop wegweisender Musik des 20. Jahrhunderts. Impressionistische Musik von Ravel und Debussy verbindet sich mit Prokofjews Erstem Violinkonzert und György Ligetis eindrücklicher Orchester studie Lontano. Es ist eine schöne Gelegenheit, noch einmal die grossartige Zu sammenarbeit des Balletts Zürich mit der Philharmonia Zürich zu feiern.
Lontano ist dein letztes Stück für das Ballett Zürich. Nach grossen abendfüllenden Produktionen kehrst du zur kleinen Form zurück?
Für mich war das grosse Abschiedsstück bereits unsere Monteverdi-Produktion in der vorigen Saison. Es war mein Wunsch, eine Brücke zur neuen künstlerischen Leitung des Balletts Zürich zu bauen. So wird meine Nachfolgerin Cathy Marston mit ihrem Ballett The Cellist die dritte Premiere dieser Saison bestreiten. Ich geniesse es gerade, noch einmal im Studio kreativ zu sein und zum Schluss diesen kleinen Einakter zu choreografieren.
Ihren Titel Lontano hat deine Choreografie von einem berühmten Stück des ungarischen Komponisten György Ligeti. 1967 wurde es bei den Donau eschinger Musiktagen uraufgeführt. Was ist das Besondere an dieser Musik? György Ligeti fasziniert mich seit langem, weil er sich als Komponist immer wieder neu erfunden hat. Seine frühen Werke sind sehr melodiös und eingängig. Später ändert sich seine Kompositionstechnik. Seine Musik entwickelt sich nicht mit Hilfe der gewohnten formgebenden Stilmittel, wie motivisch-thematischer Arbeit, Kadenzierungen und traditionellen Formprinzipien. Die Atmosphäre entsteht viel mehr auf eine völlig neue Weise: Aus einem einzigen Ton im äussersten Pianissimo entwickelt das in Einzelstimmen geteilte Orchester kanonartig immer dichtere polyphone Strukturen, die sich gegenseitig überlagern. Obwohl diese Klangflächen fast stehend wirken, hat das Ganze eine relativ grosse Dynamik und scheint sich fortzubewegen. Man hat das Gefühl, man sei selbst in Bewegung.
Choreografisch klingt der Begriff «Klangfläche» nach einer besonderen Herausforderung. Wo kann man auf diesen Klangflächen choreografisch andocken? Die Klangflächen haben ein faszinierendes Eigenleben. Es gibt feinste Mikrostruk turen, in denen unglaublich viel passiert und die man beim Choreografieren sehr gut erfassen kann. Ich gehe aber gerade einen anderen Weg. Ich choreografiere relativ grosse Gruppensequenzen, die wir erst sehr spät auf die Musik setzen werden. Ich möchte, dass sich Musik und Choreografie erst relativ spät begegnen. Vielleicht ergeben sich dadurch ja ganz neue Möglichkeiten der Verbindung, mit denen man von Vorstellung zu Vorstellung spielen kann. Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Zürich haben seit Produktionen wie Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern oder Monteverdi ein sehr geschultes Ohr und haben im Um gang mit sehr komplexen Formen von Musik viele Erfahrungen gesammelt, die ihnen jetzt auch bei Ligeti zugutekommen.
Sowohl On the move als Lontano tragen nicht nur den Gedanken des Sich Ent fernens, sondern auch den Aspekt des Abschieds in sich. Was für einen Niederschlag findet das in deiner Choreografie?
Es ist ein Abschied, ein Sich-Auflösen in ganz vielen Aspekten. Dabei geht es gar nicht um mich: Das Ensemble in seiner aktuellen Zusammensetzung löst sich auf und wird sich von dem entfernen, was bis jetzt das Ballett Zürich war. Ich sehe das durchaus positiv. Jedes Ding hat seine Zeit. Dass es dann weitergeht und sich etwas Neues entwickelt, ist grossartig. In meinem kurzen Stück möchte ich dem ein bisschen nachspüren. Es wird eine Art Abschiedspostkarte.
Alle Mitglieder des Balletts Zürich sind an dieser Abschiedspostkarte beteiligt und hinterlassen eine tänzerische Signatur. Wie machst du diese Vielzahl von starken Einzelpersönlichkeiten und starken Charakteren für die Choreografie nutzbar?
Angesichts eines im Moment sehr dichten Probenplans gibt es die Vereinbarung, dass ich immer nur die Tänzerinnen und Tänzer bekomme, die gerade frei sind und nicht in anderen Proben stecken. Ich darf sie genau zwei Mal haben und muss bei diesen beiden Proben von jeweils einer Stunde alle Szenen entwerfen. Das macht viel Spass, weil man sich trotz dieser Einschränkung ganz frei bewegen kann und die Tänzerinnen und Tänzer ihrerseits ganz viel Kreativität in die Proben mitbringen. Dass ich die einzelnen Tänzerinnen und Tänzer nach einer langen Zu sammenarbeit inzwischen gut kenne, ist ein Vorteil. Ich weiss, wo ihre besonderen Stärken liegen. Bei diesem letzten Stück will ich mich nicht mehr unter Druck setzen. Wie das Ganze am Ende aussehen wird, weiss ich noch nicht, aber dieses Arbeiten ohne Druck geniesse ich gerade sehr.
Dem Stück von Ligeti hast du weitere Kompositionen an die Seite gestellt. Welche sind das, und was waren deine Überlegungen dabei?
Das zweite Orchesterstück stammt von dem Amerikaner John Zorn. Es ist eine Fassung des hebräischen Gebets Kol Nidre, das an den höchsten jüdischen Feier tagen gebetet wird und bei dem man sich von allem Gewesenen loszulösen und reinzumachen sucht. Den Gedanken, sich zu reinigen und alles aufzuarbeiten, bevor man geht, fand ich sehr wichtig. Zu den zwei Orchesterstücken kommen noch zwei Einspielungen der Pianistin Alice Sara Ott – ein Chopin-Stück und eine Eigenkomposition von ihr. In diesem Lullaby to Eternity reflektiert sie über das Lacrymosa aus Mozarts Requiem. Jeder Abschied ist mit einer Form von Trauer ver bunden, deshalb berühren mich die beiden Takte, in denen man das MozartRequiem erkennen kann, sehr.
Das Gespräch führte Michael Küster.

On the Move
Ballettabend
Choreografie
Hans van Manen Musik
Sergej Prokofjew Bühnenbild und Kostüme Keso Dekker
Lichtgestaltung Joop Caboort Choreografische Einstudierung Ken Ossola
Tal
Choreografie
Louis Stiens Musik
Claude Debussy, Maurice Ravel Bühnenbild Bettina Katja Lange Kostüme
Louis Stiens Soundcollagen Michael Utz
Lichtgestaltung Martin Gebhardt Dramaturgie Michael Küster Choreografische Assistenz Shaked Heller

Lontano
Choreografie
Christian Spuck Musik
György Ligeti, John Zorn, Frédéric Chopin, Alice Sara Ott Bühnenbild Rufus Didwiszus Kostüme Emma Ryott
Lichtgestaltung Martin Gebhardt Dramaturgie Michael Küster
Ballett Zürich, Junior Ballett Philharmonia Zürich Musikalische Leitung Alevtina Ioffe
Premiere 14 Jan 2023
Weitere Vorstellungen 15, 21, 22, 27, 28, 29 Jan; 2, 4, 11 Feb 2023


«Amore e morte» – Liebe und Tod – sollte «La traviata» ursprünglich heissen, und tatsächlich sind es diese beiden Pole, zwischen denen sich die tragische Geschichte Violettas abspielt; die Liebe, von der sie träumt, bleibt Utopie.

Mit Nadezhda Pavlova, Omer Kobiljak, George Petean u.a. Vorstellungen: 23, 26, 31 Dez 2022; 6, 8, 11, 15 Jan 2023


Wie wird eigentlich eine Inszenierung festgehalten?
Die Regiebücher sind hier wahre Kunstwerke. Minutiös tragen die Regieassistenten und Regieassistentinnen auf jeder Seite des Klavierauszugs ein, was die Darstellenden auf der Bühne zu tun haben –jeder Gang, jeder Gesichtsausdruck, jede Haltung muss in den Noten genau notiert werden. Nur so kann eine In szenierung auch Jahre später wieder rekonstruiert werden. Das vorliegende Beispiel stammt aus Charles Gounods Oper «Faust». Es ist die be rühmte Arie Mephistos vom goldenen Kalb. Die Spielleiterin Claudia Blersch hat über die Szene «Verzauberung» ge schrieben. Auf einer einzigen Seite Musik geschieht hier ziemlich viel: Mit Einsatz des Orchesters fährt ein Vorhang herunter und ein Podium nach oben (siehe Pfeile), im fünften Takt geht ein Schein werferlicht für Mephisto an («Verfolger»). Dieser taucht auf einer kleinen Bühne mit Zigarre im Mund auf und ver teilt während seines Strophenlieds Geld an Tänzer. Genau so soll das in jeder Vorstellung ablaufen – und das klappt in den meisten Fällen auch.

«Salome» von Richard Strauss –das sind hundert pausenlose Minuten geballte Musikdrama tik, die Regisseur Andreas Homoki mit expressiver Perso nenregie in Szene gesetzt hat.

Im Zentrum steht das atembe raubende Porträt einer jungen Frau, die ausbrechen will aus einer klaustrophobischen Welt.
Mit Elena Stikhina, Kostas Smoriginas, John Daszak, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke u. a. Vorstellungen: 13, 17, 20, 26, 29 Jan; 3 Feb 2023
 Priester in Sarastros Reich
Priester in Sarastros Reich
so unglücklich, dass der Tod für mich ein Glück ist.
Wollt ihr mich nur ein ganz klein wenig lieben, dann gibt sich so ein Mädchen wie ich schon zufrieden.
Aber der Richtige, wenn’s einen gibt für mich auf dieser Welt, der wird einmal dasteh’n, da vor mir und wird mich anschaun und ich ihn, und keine Zweifel werden sein und keine Fragen, und selig, selig werd ich sein und gehorsam wie ein Kind.
Unbeständig in Herz und Wesen, so will auch ich lieben und stets die Männer wechseln.
Lucia di Lammermoor Scarpia Arabella Fiorilla Cio-Cio-SanEin Opernhaus wäre keine Kunstinstitution, würde es sich nicht kritisch in seinen Inhalten, Darstellungsformen und Denk weisen hinterfragen. Zu dieser Selbstreflexion gehört die Wahrnehmung, was der Gesellschaft gerade unter den Nägeln brennt. Und da schlägt neben den tiefgreifenden weltpolitischen Krisen gerade eine Debatte hohe Wellen, in der es um ein mangelndes oder übertriebenes Bewusstsein für Diskriminierung, Gendergerechtigkeit, Diversität und kulturelle Aneignung in den Künsten geht. Kaum einem dürfte sie verborgen geblieben sein, als in den boulevardesken, polemischen Zuspitzungen das Indianerkostüm von Winnetou oder die Dreadlocks weisser Reggaemusiker infrage ge stellt und auf der Gegenseite mit roten Köpfen vehement verteidigt wurden, wobei die mediale Empörung über die ruchlosen Attacken der sogenannten Cancel Culture meist heftiger ausfiel als der mitunter eher nichtige Anlass. Die Opernhäuser bleiben von diesen Diskussionen nicht unberührt. Wir führen sie seit längerer Zeit im Haus, wenn es bei spielsweise darum geht, ob man die «Zigeuner», die in vielen Opern vorkommen, noch so nennen soll, ohne die Diskriminierung, die dem Begriff innewohnt, kenntlich zu machen; ob «Turandot» noch in einem exotischen MärchenChina spielen kann,
ob Klischee Darstellungen in den Opern Türken, Frauen oder Religionszugehörig keiten herabsetzen; oder wie der Notar Don Curzio in Mozarts «Figaro» stot tern kann, ohne dass das Pub likum über eine Behinderung lacht. Wir finden es wichtig, diese Diskussionen nicht nur intern zu führen. Wir wollen sie auch nach aussen tragen, Argumente transparent ma chen und Positionen deut lich werden lassen. Deshalb starten wir an dieser Stelle eine mehrteilige Debatte unter der, zugegeben, etwas pointierten Fragestellung: Wie toxisch ist das Opernrepertoire? Wir wollen sie ohne den populisti schen Pulverdampf führen, der die Themen an anderer Stelle so ungut vernebelt, mit der gebotenen Differenzierung, die die komplexe Kunstform Oper verdient. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Frauenbild im Opernrepertoire. Fragen nach verstecktem Rassismus, Diskriminierung oder kultureller Aneignung werden folgen. Stimmen von aussen werden zu Wort kom men, aber auch Beteiligte aus dem Betrieb – und Einschätzungen unserer Besucherinnen und Be sucher sind erwünscht. Schreiben Sie uns Ihre Mei nung, wenn Sie mögen.
Claus Spahninfo@opernhaus.ch
Stichwort: Debatte
Die deutsche Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken hat sich intensiv mit der Kunstform Oper befasst und plädiert aus feministischer Sicht für einen differenzierten Blick auf die ewige Opferrolle der Frau auf der Opernbühne
Frau Vinken, das Thema unseres Gesprächs sind die Frauenbilder, die das traditionelle Opernrepertoire vermittelt. Haben Sie als reflektierte, feministische Frau ein Problem mit der Art, wie weibliche Figuren auf der Opernbühne erscheinen? Ehrlich gesagt: Nein. Es kommt natür lich darauf an, welche Oper ich an schaue. Wenn beispielsweise in der Zau berflöte die Chöre der Priester kommen, ginge ich am liebsten raus. So viel selbstgerechter Quatsch im dröhnenden Bass geht mir auf die Nerven. Das will ich nicht hören.
Sie meinen Sarastros männerbündi sche Priestergemeinschaft, die frauen feindliche Sätze sagt wie «Hütet euch vor Weibertücken» oder «Ein Weib tut wenig, plaudert viel.»
Ja. Wobei diese Art von Frauenfeind lichkeit sich ja selbst entlarvt. Die Priester sind überzeugt davon, den richtigen Weg zu kennen, und wissen alles besser. Sie sind machtgeil, verteufeln die Königin der Nacht und putschen gegen sie. Im Interesse ihrer illegitimen Machtergreifung konstruieren sie sich ein völlig zwangsneurotisches Ordnungssystem. Da denkt man doch: Okay, sonst noch was? Frauenfeindlichkeit, die so ausgestellt ist, desavouiert sich selbst.
Aber Mozarts Zauberflöte ist die meistgespielte Oper.
Und sie hat wahnsinnig ironische und lustige Momente. Sie ist buntscheckig,
es gibt diese faszinierende Figur der Königin der Nacht als Antimutter. Klischees werden ironisch verkehrt oder durch Übererfüllung entlarvt, Genderklischees auf den Kopf gestellt. Das ist grossartig.
Sie sagen, Sie haben kein Problem mit dem Frauenbild, das die Oper propagiert, obwohl die weiblichen Opernfiguren immerzu betrogen, verschachert, besiegt, getötet und als Scheiternde vorgeführt werden. Wie passt das zusammen?
Wir leben in einer Kultur, in der in der Tragödie die Heldin oder der Held am Ende stirbt. In der Kunst geht es nicht darum, zu zeigen, wie jemand ein besonders erfolgreiches, glückliches Leben führt. Figuren werden auf dem Theater zu Helden, indem sie ihr Leben lassen. Es gibt wenige, die alt und glücklich werden – ausser vielleicht in Märchen, und von diesen Helden, die zufrieden leben bis ans Ende ihrer
Tage, erfährt man ja nichts mehr. Nein, Literatur, Theater und Oper erzählen von den Verlierern, während Ge schichtsschreibung von den Gewinnern erzählt. Denken wir an die Aeneis von Vergil: Das ist eine Geschichte der Ge winner – das Römische Reich wird ge gründet. Aber die Grösse der Aeneis liegt nicht im kommenden Triumph des römischen Reiches. Sie liegt in der Tragödie des Untergangs von Troja, in der Schilderung des Untergangs der Dido, der die Tränen der Leserinnen und Leser seit über zweitausend Jahre fliessen lässt. Wir freuen uns nicht mit den Gewinnern. Wir leiden mit der verlassenen, tragischen, Selbstmord be gehenden Dido. Die Grösse von Opern liegt darin, die Perspektive der Unter legenen einzunehmen. Aber ich verstehe natürlich, worauf Ihre Frage abzielt. Das ist ja der klassische Vorwurf, dass die Oper einen Kult des Frauenopfers zelebriert. Nicht schon wieder eine tote Frau auf der Bühne, lautet der Ein spruch vor allem gegen die Werke des 19. Jahrhunderts. Aber man muss schon genau hinhören. Das 19. Jahr hundert war vielleicht, was die Gleich heit der Geschlechter angeht, das schlimmste aller Jahrhunderte. Aber gerade die Oper erzählt doch von der Unerträglichkeit der bürgerlichen Ehevorstellungen und der patriarchalen Kleinfamilie; sie propagiert nicht die Werte des Patriarchats, sondern sie prangert sie an. Patriarchalische Männlichkeit erleidet doch einen katastrophalen Schiffbruch auf der Opernbühne.
«Die Grösse von Opern liegt darin, die Perspektive der Unterlegenen einzunehmen.»
Das ausgestellte weibliche Opfer bestätigt also nicht die männliche Überlegenheit?
Die Frage nach der Funktion des Op fers ist eine zentrale für fast alles in der Kunst. Was ist ein Opfer? Wir leben in einer christlich geprägten Tradition, die auf einem Opferkult gründet: Ein junger Mann von 33 Jahren wird durch das Kreuz hingerichtet und vollendet durch dieses Liebesopfer die Erlösung der Menschheit. Vor diesem Hinter grund ist das Opfer – auch – ein Privi leg. Spätestens im 19. Jahrhundert sind wir in einer Opferkrise: Man hat den Eindruck, dass wir nicht erlöst sind, dass die Erlösung neu passieren muss. In der Oper wird das Liebesopfer Christi neu interpretiert und umbesetzt. Das Privileg des Opfers wird dabei, typisch Romantik, fast nur noch Frauen eingeräumt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Man kann also sagen: Die Opernhäuser sind Kathedralen der Moderne, aber ihr Erlöser ist weiblich.
Und was bedeutet das für die männ lichen Figuren in der Oper? Wie gesagt: Die patriarchalische Gesell schaft wird blossgestellt. Nehmen wir Verdis La traviata: Der Repräsen tant des Patriarchats, Giorgio Germont, der Vater von Violettas Geliebtem Alfredo, sieht am Ende, dass er sich im Geiste des Patriarchats an der Liebe vergangen hat. Er erkennt seine Schuld, er erkennt die Grösse des sublimen Lie besverzichts der Violetta. An ihrem Sterbebett weist der Sohn dem Vater die Leidende: Schau, was du getan hast. Ecce homo. Das ist doch eine Bankrotterklärung des Patriarchats, das unfä hig ist, zu erkennen, was Liebe ist. Ge rettet wird Germont allein durch seine Bekehrung: Er erkennt, dass die Liebe der Violetta haushoch über der Ehre der Familie steht. Das lässt Verdi uns hören. Gerade bei ihm erwächst aus der Liebesfähigkeit der Frauen im Moment ihres Todes eine unglaubliche Verände rungskraft, die viel stärker ist als die ver meintliche Macht der Männer. Das spüren wir auch bei Gilda in Rigoletto. Von ihr könnte man bei oberflächlicher
Betrachtung denken: Das ist halt ein dummes Ding, das an den Falschen ge raten ist. Aber sie hat die Kraft, für den Herzog von Mantua in den Tod zu gehen, obwohl sie ihn als nichtswür dig erkannt hat. Das ist eine unglaubliche Liebeskraft. Und was für eine er bärmliche Figur gibt demgegenüber der Herzog ab? Die Grösse von Gildas Lie besopfer macht ihn nicht nur lächerlich, sondern infam. Nichts hat er verstanden. Er verlässt die Bühne, indem er «La donna è mobile» trällert, eine der be rühmtesten Tenorarien der Opernge schichte. Er diffamiert darin die Frauen, ohne einen Schimmer davon zu haben, was für Verheerungen er angerichtet hat. Ich finde, die Figur des Herzogs zeigt auch, welche subtile Form von Verach tung viele Opernkomponisten der Stimmlage des Tenors entgegenbringen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe. Natürlich fallen wir alle auf die Schönheit der Tenor stimme herein. Aber eigentlich sollten wir lieber dreimal hinhören, bevor wir der Verführungskraft erliegen, denn das Versprechen der Stimme wird oft durch die Figur entzaubert wie beim Herzog oder bei Pinkerton, dem Tenor in Puccinis Madama Butterfly: Der gibt sich vom ersten Ton an als aufge blasener Typ und imperialistischer Sexprofiteur zu erkennen.
Nicht immer werden die Frauen zu heroisch überhöhten Opferfiguren. Eine Stereotypie des Weiblichen in Opern ist beispielsweise, dass die
Frau kapriziös und «flatterhaft» ist, wie das so schön in den italienischen Libretti heisst. Sie kann nicht treu sein, ist leicht verführbar, wird von ihren Emotionen immerzu hin und her gerissen. Letztlich wird ihr die Fähigkeit abgesprochen, ernsthaft zu lieben. Was ist dazu aus feministischer Sicht zu sagen?
Das ist ja genau das, was der Herzog im Rigoletto singt: «La donna è mobile», die Frau ist launenhaft und wie eine Feder im Wind, mal liebt sie den und bald einen anderen. Das ist männliche Selbstlegitimation im Sinne von: Hänge dein Herz nicht an eine; tue einfach, was dir gefällt. Dieses Motiv stammt aus Vergils Aeneis. Merkur steigt vom Him mel herab und sagt: Aeneas, du Idiot, wie kannst du dein Reich einer Frau opfern. Auf das Herz einer Frau kann man niemals bauen. In diesem Fall ist das allerübelste Nachrede, weil die Frau – Dido nämlich – treu bis in den Tod ist. Und genau so ist es ja auch im Rigo letto: Was der Herzog singt, ist übelste Verleumdung, die dem Publikum als ebensolche vor Ohren steht: Die angeblich flatterhafte Frau ist gerade ohne mit der Wimper zu zucken für den Her zog, der selbst der Inbegriff der Flatter haftigkeit ist, in den Tod gegangen. Die mit Abstand interessanteste Oper in diesem Zusammenhang ist für mich Così fan tutte von Mozart, denn darin wird das Thema der weiblichen Flatter haftigkeit in aller Konsequenz durchgeführt und auf den Punkt gebracht. Klar ist von vornherein, dass Männer sowieso zu ernsthafter Liebe unfähig, also flatterhaft, sind – così fan tutti.
Kein Mensch nimmt je etwas anderes an. Die Männer wetten auf die Treue ihrer Bräute und beweisen sich gegenseitig, verkleidet in gekreuzten Paarkonstellationen, dass sie irren. Die Männer setzen auf ihre Einmaligkeit und Unersetzlich keit. Indem sie triumphierend behaup ten: Meine Braut betrügt mich niemals, wird klar, dass für die Männer die Liebe nichts anderes ist als eine narzisstische Spiegelung. Ist meine Braut mir treu, bin ich der Grösste. Das ist doch brüllend komisch. Mozart entlarvt gnadenlos den männlichen Narzissmus und fährt den
«Die patriarchale Männlichkeit erleidet doch einen katastrophalen Schiffbruch auf der Opernbühne.»
idealistischen Glauben an die Einzigartigkeit von Individuum und Liebe ge gen die Wand. Klar ist das auch erschütternd.
Fiordiligi immerhin, die Standhafte, liebt den «falschen« Mann wirklich, wenn sie ihre Gefühle im zweiten Akt zulässt.
Genau. Sie erliegt der Illusion der au thentischen Liebe in ihrer ganzen Schönheit, das macht die Grösse der Figur aus. Das ist ja das Raffinierte an dieser Oper, dass sie total desillusio nierend ist, die Illusion aber nochmal in ihrer vollen Pracht aufblühen lässt. Am Ende aber steht die Erkenntnis: Die menschlichen Leidenschaften sind nicht einzigartig und unteilbar, das Individuum ist austauschbar. Und das ist bitte mit Heiterkeit und ohne Bitterkeit zu ertragen.
Ich stelle nochmal eine andere Rolle zur Diskussion, die den Frauen in Opern gerne zugewiesen wird. Sie sind die Trophäe, die die Männer sich durch Prüfungen erringen müs sen wie Max im Freischütz, oder sie werden als Siegerpokal bei Wett bewerben ausgelobt wie in Wagners Meistersingern. In der polemischen Draufsicht ist das ein Frauenverständ nis, das im 21. Jahrhundert natürlich keinen Platz mehr haben dürfte.
Ich muss da nochmal grundsätzlich werden: Kunst hat doch nicht die Aufgabe, Rollenmodelle für fairen Um gang und ein gelungenes Leben zu liefern. Opern funktionieren doch nicht nach dem Prinzip: «How to marry the right guy», «how to be successful» etc. Ästhetische Gegenstände bewegen sich jenseits von Exempla und unmittel barer Anwendbarkeit auf das wirkliche Leben. Sie eröffnen uns Möglichkeiten von Erkenntnis, und diese Erkenntnisse zeigen uns die Wirklichkeit in einem neuen Licht. Selbsterkenntnis, Wirklich keitserkenntnis, auch wenn das weh tut: Darin liegt die Funktion von Kunst.
Der aktivistische Ansatz in den aktuellen Cancel Culture Debatten funktioniert aber nach der Devise:
Die überständige Kunst wiederholt Stereotypen, bestätigt sie dadurch und muss deshalb weg. Und ich finde: Die Stereotypien werden gezeigt – das heisst wir können sie überhaupt als Stereotype erkennen –und entlarvt. Affirmiert, sagen wir, Gustave Flauberts Roman Madame Bovary die patriarchale Ehe, von der er handelt? Bricht er den Stab über die Ehebrecherin, die sich am Ende vergif tet? Wer den Roman so liest, hat nichts verstanden. Anstatt Opern oder Texte zu canceln, sollten wir den Mut haben, uns ihren gefährlichen Kräften auszusetzen, ihren Kränkungen, ihren Zer setzungsenergien, dem Unzeitgemässen, das ihnen innewohnt, aber natürlich auch ihrer Schönheit – und dann wahr nehmen, was sie uns zu sagen haben. So lange wir durch die Lektüre oder einen Opernbesuch eine Erfahrung ma chen, die wir ohne das Kunstwerk nicht machen würden, sind die Werke lebendig. Wenn das nicht mehr passiert, sind sie tot. Das kommt natürlich auch vor. Der Kanon relevanter Werke muss sich immer wieder neu bilden. Die Menschen jeder Gesellschaft müssen ihn für sich und ihre Zeit neu interpretieren. Der Kanon ist das, was wir hier und jetzt aus ihm machen.
Unser Gespräch hat eine überraschende Entwicklung genommen. Sie als kritisch feministische Beobachterin der Oper halten flammende Verteidigungsreden auf die Kunstform,
während ich als Vertreter aus dem Betrieb mich herausgefordert fühle, die problematischen Aspekte ins Feld zu führen. Es ist ja klar, warum Sie so fragen. Die Oper steht unter Legitimationsdruck. Sie pflegt ein tradiertes Repertoire, dem vorgeworfen wird, frauenfeindlich, rassistisch, imperialistisch kolonial und elitär zu sein. Ich teile dieses Urteil nicht. Die Opern propagieren dieses Verhalten nicht; sie halten uns den Spiegel vor. Die Leute fragen kritisch: Ist die Oper noch zeitgemäss? Und ich muss sagen, ich finde sie wahnsinnig zeitgemäss. Wie kein anderes Genre sprengt sie Genderkorsetts. Wie in keiner anderen Kunstgattung – ausser der Mode – zeigt sie Geschlechterrollen nicht als Ausdruck von Natur, sondern spielt mit ihnen und behandelt sie ironisch. Das ist doch fantastisch. Man muss nur Mozarts Le nozze di Figaro und den Crossdresser Cherubino hören und sehen, um zu verstehen, was ich meine. Auch was die Stimmen angeht, verunmöglicht sie die Naturalisierung der Geschlechter: Männer singen in der Barockoper in Sopran und Altlage. Insofern – und das ist nur ein Beispiel –ist die Oper für mich eine sehr aktuelle Kunstform. Man muss auch mal überlegen: Was wäre denn die «zeitgemässe» Alternative für die Oper? Sie ist als Kunstform von einer Komplexität und einem Reichtum, der schwer zu über treffen ist. Fantastische Stimmen, Diven, Orchester, Chöre, packende Stoffe, alles gegen den Strich gebürstet – wer kann schon mit solchen Pfunden wu chern? Das sollte man bei den aktuellen Debatten auch sehen oder besser gesagt hören. Solche Kunstkraft findet man nicht einfach auf der Strasse.
Barbara Vinken ist Professorin für Allgemeine Literaturwissenschaft und Romanische Philologie an der LudwigMaximilians-Universität in München. Im März erscheint ihr Buch «Diva: Eine etwas andere Opernverführerin» im Klett-Cotta-Verlag.
«Die Leute fragen kritisch: Ist die Oper noch zeitgemäss? Ich muss sagen, ich finde sie wahnsinnig zeitgemäss.»
Die Regisseurin Tatjana Gürbaca nimmt das Opernrepertoire aus der Sicht einer inszenierenden Frau wahr. Sie findet, dass die alten Stoffe sehr wohl noch Spannendes über unsere heutige Zeit zu erzählen haben, fordert aber dringend neue Werke
Tatjana, wie viel männliche Hegemonie steckt in unserem Opernreper toire?
Sehr viel natürlich. Die meisten Werke, die wir spielen, wurden von männlichen Librettisten geschrieben, von männli chen Komponisten vertont und bis vor noch nicht allzu langer Zeit fast aus schliesslich von männlichen Regisseu ren und männlichen Dirigenten aufge führt. Daraus ist eine Aufführungstradi tion der Werke erwachsen, die sich in den Köpfen des Publikums festgesetzt hat. Es gibt eine kollektive Prägung: Man glaubt, zu wissen wie das Werk auf der Bühne zu klingen und auszusehen hat, in welcher aktuellen Inszenierung man es auch immer gerade sieht und hört. Das spüre ich als Regisseurin auch an mir selbst. Wenn ich ein Stück neu lese, tue ich das mitunter mit einem Filter, der nicht aus mir kommt, sondern durch die Aufführungstradition geprägt ist. Und diese Aufführungstradition ist natürlich eine männlich geprägte, etwa im Blick auf weibliche Figuren. Ich versuche diesen Filter auszuschalten, wenn ich eine neue Produktion vorbe reite. Karl Kraus hat mal gesagt, in der Kunst kommt es nicht so sehr dar auf an, was man bringt, sondern auf das, was man umbringt. An dem Satz ist, insbesondere was das Regieführen angeht, etwas Wahres dran. Es geht immer auch darum, Sehgewohnheiten im eigenen Kopf abzuschaffen und sich einem musikalischen Text so unverstellt wie möglich zu nähern.
An die Welt der Oper wird in letzter Zeit vermehrt ein Unbehagen herangetragen, dass die Geschichten, die in den Stücken erzählt werden, nicht mehr genug mit unserem Leben im 21. Jahrhundert zu tun haben. Spürst du dieses Unbehagen auch, etwa im Hinblick auf die Bilder, die die Oper von Frauen entwirft?
Ich spüre das nicht nur, was Frauenbilder angeht. Das gibt es auch bei vielen anderen Aspekten, etwa welche Rolle die Masse in der Oper spielt. Wir leben ja heute in einer völlig anderen Gesellschaft, die eher von der totalen Vereinzelung geprägt ist. Es ist nicht nur das Frauenbild, bei dem man das Ge fühl haben kann, dass es aus der Zeit ge fallen ist. Das heisst aber für mich nicht, dass man mit diesen historischen Stoffen nichts Spannendes mehr über unsere heutige Zeit erzählen kann. Allerdings brauchen wir auch dringend neue Stücke für das Opernrepertoire. Das kann man gar nicht oft genug sagen.
Mit ihnen und durch sie können wir dann auch wieder unbefangener auf alte Stücke schauen.
Es gibt ein Buch der französischen Schriftstellerin und Feministin Catherine Clément aus den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, in dem vielleicht zum ersten Mal grundsätzlich das Frauenbild in der Oper kritisch thematisiert wurde…
O Gott, dieses Buch. Darüber habe ich mich wahnsinnig geärgert. Ich fand das völlig pseudofeministisch, wenn da rin anklagend behauptet wird: Wir ge hen doch alle nur in die Oper, um Frau sterben zu sehen, und ziehen daraus auch noch Genuss. Ich finde das keine feministische Haltung, wenn man klagt: Die armen Frauen sind immer nur Opfer. Es stimmt auch nicht, das ist viel zu einseitig. Man tut weder den Frauen noch der Welt etwas Gutes, wenn man in Schwarzweiss Schemata denkt, Män ner generell kriminalisiert und Frauen grundsätzlich zu Opfern erklärt. Gerade was die Oper angeht, greift die OpferArgumentation auch viel zu kurz. Es gibt ja nicht nur Stücke, in denen Frauen sterben. Und nicht jeder Frauentod sieht gleich aus. Lucia di Lammermoor beispielsweise stirbt nicht einfach. Sie wird vorher wahnsinnig und ist in ihrer berühmten Wahnsinnsarie kraftvoller als andere Figuren zusammen, mit ihren Koloraturen nimmt sie sich Raum und erobert ihre Freiheit zurück. Ausserdem wird sie zur Täterin, genau wie Tosca. So viele Frauen, die in Opern einfach
«Ich finde es keine feministische Haltung, zu klagen: Die armen Frauen sind immer nur Opfer»
nur unglücklich und einsam sterben, kommen im Opernrepertoire gar nicht vor. Ich habe mal gemeinsam mit einigen Kollegen einen Abend gemacht, der hiess: «Der schöne Tod». Darin haben wir ausschliesslich weibliche Sterbearien inszeniert. Ich habe im Vor feld dazu eine grosse Tabelle mit allen weiblichen Toden in Opern erstellt und musste feststellen, dass mein eigenes Bild ziemlich schief war. Ich dachte zum Beispiel, es gebe viele weibliche Figu ren, die an Schwindsucht sterben. Es gibt aber tatsächlich nur zwei, nämlich Mimì in der Bohème und Violetta in La traviata, mehr nicht. Man muss sich die einzelnen Geschichten schon im Detail anschauen, bevor man generali siert. Ich finde auch, dass sich das Problem anderswo viel dringlicher stellt: Ich halte zum Beispiel den Tatort nicht mehr aus. Ich mag mir nicht mehr je den Sonntagabend eine schöne Frauen leiche anschauen. Das nervt mich wahn sinnig. Auch wie die Frauen kategori siert werden: Da gibt es das Bild von der jungen, meist liebenden Frau, die sexy ist und zum Opfer wird, und dem wird die freudlose, desillusionierte, sich meistens schon in den Wechseljahren befindende, kluge Kommissarin gegen übergestellt. Beim Tatort wäre dringend eine kritische Überprüfung der Weiblichkeitsklischees fällig.
Ich habe das Clément Buch erwähnt, weil ich dich auf ein Bild anspre chen wollte, das die Autorin darin entwirft, nämlich dass die Oper ein Männerhaus sei, gemeint ist das durchaus in einem ethnologischen, tribalistischen Sinn. Clément ist ja eine Schülerin des grossen franzö sischen Ethnologen Claude LéviStrauss.
Ich finde es komisch, dass sie das so schreibt. Es gab doch immer ein weibli ches Publikum, das mit Genuss in die Oper gegangen ist. Es war vielleicht so gar in den vergangenen Jahrhunderten einer der wenigen Orte, an dem es auch für Frauen selbstverständlich war, öffentlich zu erscheinen – im Zuschauerraum und auf der Bühne! Die Geschichten betreffen Männer und
Frauen gleichermassen und sind absolut nicht nur zum Genuss der Männer geschrieben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es immer mehr weibliche Regisseure gibt. Die alten Geschichten müssen nicht zuletzt wegen der männli chen Aufführungstradition auch von Frauen erzählt werden. Aber – ich sage es nochmal – wir brauchen in der Oper auch dringend neue, zeitgemässere Rollenmodelle.
Du sagst, Frauen müssen die Ge schichten erzählen. Gibt es denn den sogenannten weiblichen Blick auf Stücke? Und repräsentierst du ihn mit deinen Regiearbeiten?
Ich wehre mich immer ein bisschen da gegen, wenn ich darauf reduziert werde. Ich bin ja noch vieles anderes als nur Frau. Aber natürlich bin ich auch weiblich, und das macht gewiss meinen Blick auf die Stücke aus – aber eben nicht nur.
Was macht den weiblichen Blick auf eine Figur wie beispielsweise Cio CioSan in Giacomo Puccinis Madama Butterfly aus?
Das finde ich ein schwieriges Beispiel, denn auf Madama Butterfly trifft meiner Meinung nach der Begriff des Toxischen tatsächlich zu. Ich habe schon zwei Angebote bekommen, die Oper zu inszenieren, aber jedes Mal abgelehnt, weil ich keine Antwort auf die Frage habe, wie man mit diesem Stoff umgehen könnte. Es geht in
Madama Butterfly für mich nicht nur um das Bild der passiven, immerzu wartenden und völlig auf einen Mann fixierten Frau. Da ist auch dieses exotische, vom Kolonialismus bedrohte Japan, das eine Ungleichheit auf mehreren Ebenen schafft, der sich diese sehr junge Frau völlig ausliefert. Alles opfert sie nur für diese völlig fehlgeleitete Liebe. Das ist einfach nur schrecklich. Man kommt auch kaum an den ganzen Asien Klischees vorbei. Ich habe keine Idee, wie man daraus etwas Spannendes machen könnte. Das ist eine ganz ungute Geschichte.
Bei dem Komponisten Puccini kommt hinzu, dass er im richtigen Leben einen nicht gerade sympathischen Umgang mit Frauen pflegte und man manchmal das Gefühl nicht los wird, er lebe in den Opern seine privaten Männerfantasien aus. Ist das ein Pro blem?
Das Leben der Komponisten muss man ausblenden, sonst kann man gar keine Oper mehr inszenieren. Wagner war auch unsympathisch.
Findest du, man sollte Madama Butterfly canceln und ganz aus den Spielplänen nehmen?
Wenn ich damit nichts anfangen kann, heisst das ja nicht, dass niemand sonst eine tolle Idee dafür haben kann. Wäre ich Intendantin, müsste allerdings schon ein Regie Team mit einem überzeugenden Konzept kommen, bevor ich es in den Spielplan nähme.
Kann der weibliche Blick eine Figur wie Arabella von Richard Strauss retten? Sie sehnt sich nach dem einzi gen für sie bestimmten Traummann, dem «Richtigen», der dann auch in der Person von Mandryka tatsächlich erscheint. «Und er wird mich an schau’n und ich ihn», singt sie. «Und selig, selig werd ich sein und gehor sam wie ein Kind.» Bei einer solchen weiblichen Unterwerfungsgeste muss doch jede moderne Frau vor Empörung an die Decke gehen. Die moderne Frau geht in dieser Oper auch schon vorher an die Decke.
«Ich mag mir nicht mehr jeden Sonntag eine schöne Frauenleiche im Tatort ansehen. Das nervt mich wahnsinnig»
Deshalb finde ich das Stück ja so grossartig. Es erzählt die ganze Zeit davon, wie die beiden Schwestern Arabella und Zdenka versuchen, ihren Eltern zu entkommen, die turbokapitalistisch versuchen, ihre Töchter meistbietend zu verscherbeln. Die Oper erzählt die Tragödie des Menschen in einer reinen Geldwelt. Arabella wünscht sich etwas anderes vom Leben als das, war ihr die Eltern vorleben. Sie wünscht sich etwas Schlichteres und Ursprünglicheres.
Und das ist die Vorstellung vom Gat ten als Überfigur und Wundermann und die Frau davor auf den Knien?
Du hast die Oper ja inszeniert. Lässt sich dieses reaktionäre Bild von einer Paarbeziehung durch Interpretation umwerten und retten?
Nein, das muss man auch nicht. Man kann aber erzählen, dass es ein allzu naiver Traum ist, den Arabella da träumt, und dass das Leben nicht so rosig wird, wie sie sich das vielleicht gedacht hat. Man darf die Geschichte halt nicht als ungebrochenes Happyend erzählen. Die Musik legt das auch nicht nahe. Sie ist am Ende seltsam fragil. Wie auf Eis. In meiner Inszenierung erstarrt das Glück von Mandryka und Arabella in einer Art Bewegungslosigkeit. Arabella erscheint in einem schwarzen Kleid mit diesem Glas Wasser, das Hoffmannsthal ins Libretto geschrieben hat. Ab jetzt wird nur noch Wasser getrunken –das finde ich ja schon mal eine Ansage. Und darüber hinaus wissen wir ja nicht, wie glücklich die beiden jetzt zusammenleben und ob ihr Beziehungskon zept funktioniert.
Das Frauenbild, das durch die Stücke nahelegt wird, ist also das eine, die Inszenierung auf der Bühne aber etwas anderes.
Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Interpretation in der Oper alles ist. Die Werke gibt es ja nur, wenn wir sie realisieren. Die Partitur ist ja nicht das Werk, sondern das Aufführungsmaterial, das wir lesen und interpretieren und auf die Bühne bringen müssen.
Lastet nicht ein grosser Druck auf der Regie, wenn sie immerzu gegen das Unzeitgemässe und die Stereotypien der Stoffe aninszenieren muss? Klar liegt da ein grosser Druck auf uns Regisseurinnen und Regisseuren. Nicht nur weil wir mit jedem Stück so umgehen müssen, dass es für uns heute relevant ist, sondern vor allem auch weil unser Repertoire so klein ist und wir deshalb meist schon zehn andere Interpretationen des Stücks kennen. Man muss sich jedes Mal kritisch fragen: Muss dieses Werk gespielt werden? Und wenn ja, warum will ich es auf die Bühne bringen? Es kann ja sein, dass ich schon eine Interpretation kenne, von der ich überzeugt bin, dass sie zu dem Stück alles erzählt und auf den Punkt gebracht hat. Wenn man keinen starken inneren Impuls spürt, eine Oper neu zu erzählen, sollte man es lieber lassen. Ich bin inzwischen ganz gut im Neinsagen. Wir können die Stücke nicht wie am Fliessband ausspucken. Dann ist es keine Kunst mehr, sondern nur noch Handwerk und Routine. Und das Publikum spürt sehr genau, ob etwas eine Dringlichkeit hat.
Ist es nicht inzwischen auch ein Problem, dass die Regiekniffe, mit denen man beispielsweise ein weibli ches Rollenklischee ins Gegenteil wenden kann, selbst Gefahr laufen, zu Klischees zu gerinnen? Natürlich. Man hat schnell vor Augen, was starke Regisseurinnen und Re gisseure mit prägenden Handschriften in der Vergangenheit aus einer Szene gemacht haben oder machen würden. Von solchen Vorprägungen muss man sich freimachen. Es war ja schon immer so, dass die Künstler sich aus einer Tra dition erstmal herausschaufeln mussten, um einen freien Blick zu bekommen. Das war bei den Malern der Renaissance bestimmt auch nicht viel anders.
Sollten wir in der Oper mehr Mut haben, die Werke zu überschreiben, neu zu montieren oder mit anderen zu verschränken, um dem Problem des Veralteten zu entgehen?
Am Ende rechtfertigt der gelungene Theaterabend alles. Der muss es erweisen. Wenn er spannend konzipiert ist und mich packt und berührt, ist alles erlaubt. Aber in der Oper ist es viel schwieriger als im Schauspiel, in das Material einzugreifen. Da braucht es kompositorische Expertise und starke Begründungen dafür, den musikalischen Text zu verändern. Ich finde, es muss im Opernrepertoire von heute alles geben – alte Stücke, neue Stücke und die Möglichkeit, mit alten Stücken anders umzugehen.
Wie stehen die Opernhäuser im Ver gleich zu den Schauspielbühnen da? Dass die Schauspielhäuser oft näher an der Gegenwart sind, wissen wir ja alle. Sie spielen mehr neue Stücke und sind viel offener in der Form. Obwohl man auch dort eine gewisse Not spürt, neue dramatische Stoffe zu finden. Es herrscht ja gerade die Tendenz, jeden halbwegs aufsehenerregenden Roman sofort als TheaterAdaption auf die Bühne zu bringen.
Sitzt ein veraltetes Denken, was beispielsweise Frauenbilder angeht, nicht nur in den Werken, sondern auch in Leitungsetagen der Opern häuser?
Ich spüre da, ehrlich gesagt, im Mo ment eine gewisse Schieflage. Die Theater und Opernhäuser führen die Debatten über zeitgemässe weibliche Rollenbilder, männliche Dominanz, Diversität, Genderoffenheit oder kultu relle Aneignung mit grosser Leiden schaft, weil es zu ihrem Selbstverständ nis gehört, sich grundsätzlich Gedanken zu machen und sich selbst infrage zu stellen. Sie stehen im Moment im Fokus. Aber die Themen müssen natürlich auch in allen anderen Bereichen der Ge sellschaft diskutiert und bearbeitet werden. Veraltetes Denken nistet nicht nur im Repertoire der Opernhäuser, sondern auch in Banken, Universitäten, Fernsehanstalten, Krankenhäusern und Supermärkten. Überall.
Das Gespräch führte Claus Spahn





Wenn sich im Dunkeln die kalten Hände von Rodolfo und Mimì treffen, beginnt eine der herzzerreissendsten Liebesgeschichten der Opernliteratur. Wir zeigen Giacomo Puccinis «La bohème» in der bildstarken Inszenierung des Norwegers Ole Anders Tandberg.


Mit Olga Kulchynska, Kang Wang, Rebeca Olvera und Konstantin Shushakov u. a. Vorstellungen: 9, 11, 14, 18, 22, 28 Dez 2022
Fotos: T + T, Toni Suter





1 Do Die Entführung aus dem Serail
20.00 Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
2 Fr Nussknacker und Mausekönig 19.00 Ballett von Christian Spuck
3 Sa Familienworkshop
La bohème
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Nussknacker und Mausekönig 19.00 Ballett von Christian Spuck
So
11.15 Brunchkonzert Spiegelsaal
Familienworkshop
La bohème
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
19.00 Oper von Francesco Cavalli Premiere
5 Mo Die sieben Todsünden
12.00 Lunchkonzert Spiegelsaal
Liederabend Juan Diego Floréz 19.00 Vincenzo Scalera, Klavier
Di
19.00 Ballett von Christian Spuck
open space stimme 19.00 Chor-Workshop für alle ab 16 Jahren Dienstags
open space tanz 19.00 Tanz-Workshop für alle ab 16 Jahren Mittwochs
7 Mi
Eliogabalo
19.30 Oper von Francesco Cavalli
8 Do Nussknacker
19.00 Ballett von Christian Spuck
9 Fr La bohème
19.00 Oper von Giacomo Puccini
1O Sa Musikgeschichten
Die Operntode meiner Mutter
15.30 Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Nussknacker und Mausekönig 19.00 Ballett von Christian Spuck

11 So Eliogabalo
13.00 Oper von Francesco Cavalli
Musikgeschichten
Die Operntode meiner Mutter 15.30 Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
La bohème 20.00 Oper von Giacomo Puccini
13 Di Eliogabalo 19.00 Oper von Francesco Cavalli
14 Mi La bohème 19.00 Oper von Giacomo Puccini
15 Do Tosca 19.00 Oper von Giacomo Puccini
16 Fr Eliogabalo 19.30 Oper von Francesco Cavalli
17 Sa Musikgeschichten
Die Operntode meiner Mutter 15.30 Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Tosca 19.30 Oper von Giacomo Puccini
18 So La bohème 14.00 Oper von Giacomo Puccini
Rihm Brahms 19.30 Philharmonisches Konzert
2O Di Tosca 19.00 Oper von Giacomo Puccini
21 Mi Eliogabalo 20.00 Oper von Francesco Cavalli
22 Do La bohème 19.00 Oper von Giacomo Puccini
23 Fr La traviata 19.00 Oper von Giuseppe Verdi AMAG Volksvorstellung
13.00 Oper von Giuseppe Verdi
15.00 Für Kinder ab 5 Jahren Studiobühne
20.00 Oper von Francesco Cavalli AMAG Volksvorstellung
Mi
15.00 Für Kinder ab 5 Jahren Studiobühne
19.00 Oper von Giacomo Puccini AMAG Volksvorstellung
19.00 Oper von Giacomo Puccini
15.00 Für Kinder ab 5 Jahren Studiobühne
19.00 Oper von Francesco Cavalli
11.00 Märchenoper von Pierangelo Valtinoni ab 7 Jahren Hauptbühne Opernhaus
Hexe
15.00 Für Kinder ab 5 Jahren Studiobühne
18.00 Oper von Giuseppe Verdi
14.00 Märchenoper von Pierangelo Valtinoni ab 7 Jahren
20.00 Oper von Giacomo Puccini AMAG Volksvorstellung
14.00 Märchenoper von Pierangelo Valtinoni ab 7 Jahren
20.00 Oper von Francesco Cavalli
4 Mi Tosca
19.00 Oper von Giacomo Puccini
6 Fr La traviata 19.00 Oper von Giuseppe Verdi
7 Sa Märchen auf dem Klangteppich Tomte Tummetott
15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
Eliogabalo
19.00 Oper von Francesco Cavalli
8 So Einführungsmatinee
11.15 Bernhard Theater
Alice im Wunderland
14.00 Märchenoper von Pierangelo Valtinoni ab 7 Jahren Hauptbühne Opernhaus
Märchen auf dem Klangteppich Tomte Tummetott
15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
La traviata 20.00 Oper von Giuseppe Verdi
1O Di open space stimme 19.00 Chor-Workshop für alle ab 16 Jahren Dienstags
11 Mi La traviata 19.00 Oper von Giuseppe Verdi open space tanz 19.00 Tanz-Workshop für alle ab 16 Jahren Mittwochs
12 Do Liederabend Stéphanie d’Oustrac 19.30 Carrie-Ann Matheson, Klavier
13 Fr Salome 19.00 Oper von Richard Strauss
14 Sa Märchen auf dem Klangteppich Tomte Tummetott
15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
19.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen, Premiere
15 So Triosonaten 11.15 Brunchkonzert Spiegelsaal
14.00 Oper von Giuseppe Verdi
15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
20.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
Mo
12.00 Lunchkonzert Spiegelsaal
17 Di
19.00 Oper von Richard Strauss
19.00 Märchenoper von Pierangelo Valtinoni ab 7 Jahren
2O Fr Salome
19.00 Oper von Richard Strauss AMAG Volksvorstellung
21 Sa On the Move
19.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
22 So
Roberto Devereux 11.15 Bernhard Theater
14.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
19.00 3. Philharmonisches Konzert
19.00 Oper von Richard Strauss
19.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
28 Sa On the Move
19.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
14.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen AMAG Volksvorstellung
20.00 Oper von Richard Strauss
1 Mi Liederabend Javier Camarena 19.00 Ángel Rodríguez, Klavier
19.00 Tanz-Workshop für alle ab 16 Jahren Mittwochs
19.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manens
Fr
19.00 Oper von Richard Strauss
4 Sa Märchen auf dem Klangteppich
Was macht man mit einer Idee? 15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
19.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
5 So Klavierquartette I
11.15 Brunchkonzert Spiegelsaal
Ballette entdecken On the Move 14.30 Workshop für Kinder von 7 bis 12 Jahren Treffpunkt Billettkasse
Märchen auf dem Klangteppich Was macht man mit einer Idee? 15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
19.00 Oper von Gaetano Donizetti Premiere
6 Mo Märchen auf dem Klangteppich Was macht man mit einer Idee? 10.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
Klavierquartette I
12.00 Lunchkonzert Spiegelsaal
Märchen auf dem Klangteppich Was macht man mit einer Idee? 14.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
7 Di Märchen auf dem Klangteppich Was macht man mit einer Idee?
10.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
Märchen auf dem Klangteppich
Was macht man mit einer Idee?
14.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
open space stimme
19.00 Chor-Workshop für alle ab 16 Jahren Dienstags
8 Mi Märchen auf dem Klangteppich
Was macht man mit einer Idee?
10.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
19.00 Oper von Gaetano Donizetti
19.00 Oper von Pjotr Tschaikowski AMAG Volksvorstellung
11 Sa On the Move
20.00 Choreografien von Christian Spuck, Louis Stiens und Hans van Manen
12 So Rachmaninow zum 150. Geburtstag
11.15 4. Philharmonisches Konzert / Rachmaninow-Zyklus 1 Gianandrea Noseda, Musikalische Leitung
Einführungsmatinee Siegfried
11.15 Bernhard Theater
Roberto Devereux
19.00 Oper von Gaetano Donizetti
Führung Opernhaus 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29 Jan; 5, 11, 12, 18, 25 Feb 2023
Guided Tour Opera House 8, 14, 22, 29 Jan; 5, 12, 19, 26 Feb 2023
Führung Bühnentechnik 6 Jan; 3 Feb 2023
Führung Kostümabteilung 24 Feb 2023
Führung Maskenbildnerei 14 Jan 2023
Tickets für die Führungen sind im Vorverkauf erhältlich
Unter opernhaus.ch/fuer-alle gibt es Angebote für jeden Geldbeutel
Das Kalendarium mit Preisangaben finden Sie auf der Website
Magazin des Opernhauses Zürich Falkenstrasse 1, 8008 Zürich www.opernhaus.ch T + 41 44 268 64 00
Andreas Homoki
Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda Ballettdirektor Christian Spuck Verantwortlich Claus Spahn Sabine Turner Redaktion Beate Breidenbach Kathrin Brunner Fabio Dietsche Michael Küster Claus Spahn Gestaltung Carole Bolli Sandi Gazic Fotografie Danielle Liniger Florian Kalotay Bildredaktion
Christian Güntlisberger Anzeigen Linda Fiasconaro Schriftkonzept und Logo Studio Geissbühler Druck Multicolor Print AG Illustrationen Anita Allemann
MAG, das OpernhausMagazin, erscheint zehnmal pro Saison und liegt zur kostenlosen Mitnahme im Opernhaus aus. Sie können das OpernhausMagazin abonnieren: zum Preis von CHF 38 bei einer inländischen Adresse und CHF 55 bei einer ausländischen Adresse senden wir Ihnen jede Ausgabe druckfrisch zu. Bestellungen unter: T +41 44 268 66 66 oder tickets@opernhaus.ch.
Unsere Vorstellungen werden ermöglicht dank der Subvention des Kantons Zürich sowie den Beiträgen der Kantone Luzern, Uri, Zug und Aargau im Rahmen der interkantonalen Kulturlastenvereinbarung und den Kantonen Nidwalden, Obwalden und Schwyz.
Produktionssponsoren
AMAG
Atto primo Clariant Foundation Freunde der Oper Zürich Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Projektsponsoren
René und Susanne Braginsky-Stiftung Freunde des Balletts Zürich Ernst Göhner Stiftung Hans Imholz-Stiftung Max Kohler Stiftung Kühne-Stiftung
Marion Mathys Stiftung Ringier AG
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung Hans und Edith Sulzer-Oravecz-Stiftung Swiss Life Swiss Re Zürcher Kantonalbank
Gönnerinnen und Gönner Josef und Pirkko Ackermann Alfons’ Blumenmarkt
Familie Thomas Bär Bergos Privatbank Margot Bodmer
Maximilian Eisen, Baar Elektro Compagnoni AG Stiftung Melinda Esterházy de Galantha Fitnessparks Migros Zürich Egon-und-Ingrid-Hug-Stiftung Walter B. Kielholz Stiftung KPMG AG Landis & Gyr Stiftung
Stiftung LYRA zur Förderung hochbegabter, junger Musiker und Musikerinnen Fondation Les Mûrons
Neue Zürcher Zeitung AG
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
StockArt – Stiftung für Musik Else von Sick Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung Elisabeth Weber-Stiftung
Förderinnen und Förderer CORAL STUDIO SA
Theodor und Constantin Davidoff Stiftung Dr. Samuel Ehrhardt
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Garmin Switzerland
Richards Foundation Luzius R. Sprüngli Madlen und Thomas von Stockar
Sie dürfen auch an sich denken. Gerade mit Teilzeit pensum riskiert man Lücken in der Vorsorge. Mit einer Finanzplanung sichern Sie sich für später ab. credit-suisse.com/privatebanking
Richtig vorsorgen bei Teilzeit
