davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass
Literatur

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass
Literatur
Christina Hug Azad Şîmmo
Lena Bühlmann
Andrea Keller
Migmar Dolma
Hansjörg Schneider















Ein Ortswechsel, ein neuer Blick auf vertraute Welten: Das sind Momente, die durchatmen lassen. Und so stehen wir bei Christoph Simon mit Alpenkräutertee auf einem Berg und haben eine kleine Erleuchtung. Bei Azad Şîmmo weitet sich dann der Blick auf die Region Avaşîn in Südkurdistan. Sehnsucht steckt in diesem Text, das Recht auf Heimat. Aufmerksam geworden sind wir auf den Text beim Projekt Weiter Schreiben Schweiz, das Literatur von Autor*innen fördert, die aus Kriegs- und Krisengebieten geflüchtet sind und in ihren Heimatländern nicht mehr veröffentlichen können.
Ralf Schlatter wird dafür in einem Buchclub im britischen Bristol gelesen. Anfang Jahr hat er kurzerhand beschlossen, für einen kleinen Leseabend hinzureisen: Stoff für eine true story! Es blitzt das Thema Grenzen auf und die Bedeutung des Passes, mit dem ein Schweizer bei der Grenzkontrolle wedeln kann. Oder eben nicht.
«Durchatmen» ist das Thema dieses Hefts. Mir wurde bei der Lektüre bewusst, wie sehr das Atmen alles strukturiert. Nicht nur die Yoga-
stunde, sondern auch die Erzählungen dieser Ausgabe. Das Atmen formt die Zeit, die Texte.
Es dehnt die Zeit bei Lena Bühlmann im Zimmer mit der Fliege. Es peitscht sie hoch und bremst sie wieder ab bei Andrea Keller auf der Autobahn nach Mels im Sarganserland.
Bei Christina Hug wird das Nicht-mehr-atmenKönnen zum Moment der Erkenntnis, während Migmar Dolma zeigt, dass man sich Durchatmen erst mal leisten können muss. Und in Hansjörg Schneiders Erzählung schafft die Familie im Zweiten Weltkrieg Momente des Durchatmens, während die Kriegsflugzeuge über dem Wohnzimmer vorbeifliegen.
Wir bedanken uns bei Christoph Simon, Ralf Schlatter, Christina Hug, Azad Şîmmo, Lena Bühlmann, Migmar Dolma, Andrea Keller, Hansjörg Schneider und dem Diogenes Verlag für die Texte und die schöne Zusammenarbeit.

Illustrationen

Melanie Grauer arbeitet als freischaffende Illustratorin in Zürich. Ihre Arbeiten erscheinen in Schweizer Magazinen. Für diese Ausgabe erschuf sie eine surreale Welt, in der sie sich von den Farben leiten liess.
5 Christoph Simon Kater streicheln
6 Ralf Schlatter Bristol, einfach
10 Christina Hug Ventolin
13 Azad Şîmmo AvaŞîn
14 Lena Bühlmann Die Fliege
15 Migmar Dolma Durchatmen
18 Andrea Keller Delirium furiosum
22 Hansjörg Schneider Gefüllter Kabis
27 Rätsel
28 SurPlus Positive Firmen
29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren
30 Internationales Verkäufer*innen-Porträt «Jetzt schauen die Leute zu mir auf»









TEXT CHRISTOPH SIMON
«Siebzig Trillionen Sterne, wenn du mal hochschaust und grob durchzählst», sagte Regula und schaute in den Nachthimmel.
Wir hatten uns um die Feuerstelle versammelt, auf tausendzweihundert Meter über Meer. Ich zählte weder die Sterne, noch zählte ich, wie viele Trauben Lorenzo und ich im Laufe der Versammlung verköstigten. Chardonnay, Chasselas, Petite Arvine, präventiv ein Aspirin. Regula leerte in der gleichen Zeit einen Landfrauenhydrant voll Alpenkräutertee.
Ich weiss nicht, welche Rebsorte schuld war, dass ich am nächsten Morgen in der Berghütte eher nachdenklich erwachte. Ich bin auch sonst eher der nachdenkliche Typ, aber an jenem Morgen brauchte ich besonders lange, um herauszufinden, wo ich bin, wer ich bin und wer die anderen sind. Ich spürte sofort: Heute darf ich mir die Tagesziele nicht zu hoch stecken. Heute müssen sie ohne Anlauf zu schaffen sein.
Im Schlaf-T-Shirt und in den Schlaf-Boxershorts schwebte ich im Energiesparmodus durch die Berghütte wie ein Hollywood-Star durch die Entzugsklinik.
Verkatert ist man ist ja unerhört empfindlich. Alles ist zu laut. Zu hell. Zu schnell.
In der Küche der Hütte traf ich Lorenzo, der eine ähnliche Hochsensibilität ausstrahlte. Vorsichtig schlürfte er Lindenblütentee und inhalierte die linden Dämpfe.
Ich zuckte zusammen, als Regula fragte: «WILLST DU EIN BIRCHERMÜESLI?»
«Für mich ist noch grad alles gut, merci.»
«ALLES KLAR BEI DIR?»
Ihre Worte rasten durch meinen Kopf wie Geschosse.
«Alles bestens, Regula. Was steht an?»
Der Kater ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man sich so benehmen will, als habe man keinen. Man leugnet seinen Zustand, bekämpft ihn, wehrt sich. Man hat Pflichten! Business! Beil nehmen und Holz vor die Hütte! Man spürt den Gruppendruck, muss den immer souveränen Bergfreund markieren.
So hart bin ich nicht mehr mit mir. Training und Geduld haben in mir drin einen Schutzwall gegen überrissene Erwartungen geformt. Ich sehe einen Kater als ein ergebnisoffenes Time-Out. Den rollenden Blitz im Schädel – ich nehme ihn wahr, spüre ihn, heisse den Schmerz willkommen. So bin ich eben. Manchmal schlage ich mir mit dem Hammer auf den Daumen, weil es so schön ist, wenn der Schmerz nachlässt.
Lassen Sie sich auf einen Kater ein wie eine ausgesperrte Katze auf einen Platzregen! Ignorieren Sie die innere Stimme, die Sie beschimpft: «Wer saufen kann, kann auch arbeiten! Du Memme, schau dich an, die Tränensäcke, die matten Gesichtszüge, du siehst ja aus wie ein ausgepresster Alpenkräuterteebeutel!»
Wenn es Ihnen gelingt, bei den Selbstvorwürfen wegzuhören; wenn es Ihnen gelingt, dem Zustand nicht auszuweichen und nicht schon wieder vergnügt auf Car-Reisen gehen zu wollen, dann verwandelt sich der Kater von einer negativen in eine positive Erfahrung. Sicher wärs umgekehrt praktischer. Zuerst den Kater, und dann müssen wir viel saufen, um ihn loszuwerden.
Aber: Akzeptieren Sie ihn! Akzeptieren Sie ihn wie Durchzug, wie unbezahlte Rechnungen, wie unerledigte Mails und all die anderen kleinen Garstigkeiten, die unseren Tagen Struktur geben. Ich nahm das Beil in die Hand, aber es war noch zu schwer. Ich sank auf den Boden, lehnte mich an den Hackklotz und nahm Kontakt auf zum Löwenzahn vor mir. Ich ging völlig in diesem Gewächs auf. Ich erkannte die Welt in diesem Löwenzahn, also auch mich im Löwenzahn, im Blatt, im Kopf und sogar im hohlen Stängel erkannte ich mich – es klingt vielleicht gespürig und soft, aber das Gespürige und Softe, das ich erlebte, basierte auf einem harten, realistischen, alpinen Erfahrungsuntergrund.
Kurz: Ich erlebte etwas Allumfassendes, das meine Grosseltern vielleicht einen Traum im Mittagsschlaf genannt hätten, und das Buddha damals auf dem indischen Subkontinent unter dem Feigenbaum nicht ganz unbescheiden als Erleuchtung deklariert hatte. Als er eins wurde mit allem – wer weiss, vielleicht auch mit einem Beil in der Hand, während seine Kumpels vom Wanderverein ungeduldig auf das gespaltene Holz zum Einfeuern gewartet haben.
Mit der heiteren Gelassenheit eines Menschen, der spürt, dass das Aspirin endlich wirkt, nahm ich wahr, wie der Schmerz in meinem Kopf schrumpfte und schmolz wie eine Schneeflocke auf dem Asphalt. Die Kraft kehrte in mein Leben zurück. Bald würde ich wieder Bäume ausreissen können. Kleine Bäume zumindest. Löwenzahnbäumchen.
Trinken, um sich zu berauschen, ist voll okay. Ich trinke für den nächsten Morgen: Schmerz, Blume, Zen. Es ist natürlich kein Problem, wenn ein Kater nichts für Sie ist. Das Leben kann sicher auch ohne Kater ganz wunderbar sein.
«Regula, mir ist beim Hackklotz Buddha erschienen.»
«So?»
Ich dachte, Regula werde sich von mir jetzt eine Lebensberatung abholen wollen, aber das war ein Denkfehler.
Regula steckte sich einen gehäuften Löffel Birchermüesli in den Mund und schaute streng über den Rand ihrer Sonnenbrille. Siebzig Trillionen Sterne, wenn man in den Nachthimmel schaut und grob durchzählt.
Regula schaute hoch und fragte mich: «Christoph, hat dein Dasein irgendeine Bedeutung?»
«Aber sicher, Regula. Mich haben Ausserirdische auf diesem Planeten gesät. Damit jemand winkt, wenn sie das nächste Mal vorbeifahren.»

CHRISTOPH SIMON, geboren 1972 im Emmental, aufgewachsen im Berner Oberland, lebt heute in Bern. Zuletzt erschienen: «Die Dinge daheim» (Prosa), «und das nach vier milliarden jahren evolution» (Gedichte), «Der Suboptimist» (kleine Romane). Zurzeit ist er mit seinem Solo-Kabarettprogramm «Strolch» in den Kleintheatern der Schweiz unterwegs.
TEXT RALF SCHLATTER
Es begann alles mit einer Mail, zu mir ins Postfach geflattert am 20. September letzten Jahres: «Hallo Herr Schlatter, ich lebe in Bristol, England, und ich unterrichte Deutsch in der Erwachsenenbildung. In unserem diesjährigen Buchklub lesen wir Ihr ‹43 586: Ein Schweizer Decamerone›. Gibt es auch eine Lesung oder Ausschnitte davon im Internet? Es wäre schön, Teile von Ihnen vorgelesen zu hören. Mit freundlichen Grüssen, Christel Stöcker-Danby». Ich war freudigst überrascht, keine Frage, geschmeichelt, gerührt. Mein Buch im fernen Bristol! Ich schrieb umgehend zurück, ich las Ausschnitte ein per Handy, schickte sie nach England, ich schlug einen ZoomCall vor, sie schickte mir die Daten, ich schaute in meine Agenda, sah ein paar freie Tage rund um den Buchklub-Abend vom Donnerstag, 8. Februar, und ich dachte: Warum nicht? Warum nicht nach Bristol fahren, dort aus meinem Buch vorlesen, einen lustigen Abend haben mit den deutsch lernenden Brit*innen und dann noch drei Tage London anhängen? Gesagt, gebucht. Los am Mittwoch, 7. Februar, Zug nach Paris, Zug nach London, Zug nach Bristol, Unterkunft in Bristol, Unterkunft in London, Zug zurück. Die Reise nahte. Und eigenartig: Ich hatte ein seltsames Gefühl. Das passiert mir eigentlich nie vor einer Reise. Ich war nicht bei der Sache beim Packen. Ich fragte mich, was ich denn soll, dort, so allein. Ich schlief kaum, in der Nacht zuvor. Ich ging zu spät aus dem Haus, das Tram fuhr mir vor der Nase weg, und ich sprintete mit meiner Rolltasche bis zur nächsten Haltestelle. Im TGV, mit Kaffee und Schoggigipfel, kam ich dann zur Ruhe, der Reisemodus setzte ein, ich schickte mich gerne drein. Wird schon seinen Sinn haben. Mal wieder aus dem Land hinaus. Abhauen. Das Weite suchen. Das schöne britische Englisch hören. Und hey: Mein Buch in Bristol!
In Paris wechselte ich den Bahnhof, von der Gare de Lyon nach Paris-Nord, folgte den Schildern zum Eurostar, es hatte wider Erwarten keine Schlange, das geht ja alles wie am Schnürchen, dachte ich, scannte den Strichcode auf meinem Ticket und kam zum französischen Grenzposten, sprich: einer Dame hinter Glas in ihrem Kabäuschen drin. «Votre passeport, s’il vous plaît», sagte sie. Ich legte meine Identitätskarte vor sie hin. «Vous n’avez pas de passeport?», sagte sie. Nein, sagte ich, das sei meine Identitätskarte. «Vous avez besoin d’un passeport», sagte sie. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich da das erste Mal leer schluckte. Und mir das Blut aus dem Kopf ging. Ein Reflex, der wohl aus unserer Vergangenheit stammt, wenn Gefahr droht, wenn der Körper das Blut braucht, um sich zu wehren oder zu flüchten. Vor dem Kabäuschen der französischen Grenzbeamtin natürlich, wie soll ich
sagen, grenzwertig, item. Mein Pass sei zuhause, sagte ich, mit tapferem Lächeln, aber ich hätte hier ja meine Identitätskarte. Mit der Identitätskarte, sagte die Dame, könne ich Frankreich gerne verlassen, aber England leider nicht betreten, und lächelte mit einer Art fatalistischem Mitleid zurück. Mir schwindelte. Ich hatte doch in meiner schlaflosen Nacht noch die Bedingungen gegoogelt, hatte mich auf der Eurostar-Plattform registriert, hatte mich informiert, ob und wie ich Wasser transportieren darf, hatte die Liste der gefährlichen Güter gelesen. Und hatte im Kopf, ich hätte gelesen, dass für Schweizer*innen die ID genüge. Jetzt hatte ich sehr wenig Blut in diesem Kopf und betrat mit leicht zitternden Beinen die EU-Aussengrenze. Sie war rund fünf Meter breit. Es folgte das nächste Kabäuschen. Ich stellte mich, noch immer tapfer lächelnd, vor den englischen Grenzbeamten. «Your passport please», sagte er. Der sei zuhause, in der Schweiz, sagte ich, aber ich hätte meine Identitätskarte. Ob ich in England lebe, fragte er. Nein, sagte ich. Was ich in England vorhabe, sagte er. Ich sei Schriftsteller, sagte ich, mit einem Anflug von trotzigem Stolz, und hätte in Bristol eine Lesung. Das schien ihn in keinster Weise zu beeindrucken. «You need your passport», sagte er. Aber ich hätte gelesen –, sagte ich, aber da war es ihm bereits zu blöd geworden. Und er schaute mir ziemlich gerade in die Augen und sagte den Satz, den ich so schnell nicht mehr vergessen werde: «You’re not travelling to England today, Sir.» Kawumm. Dann verliess er das Kabäuschen und stellte sich neben mich. «Would you please come with me, Sir», sagte er. Mein blutleerer Kopf produzierte daraufhin eine im Nachhinein gesehen sehr lustige Kapriole. Ich könne zuhause anrufen, sagte ich, und meine Frau könne den Pass fotografieren. Im vollen Ernst. Und in anschwellender Panik. Dann folgte der vielleicht krasseste Moment der ganzen Geschichte: Der Grenzbeamte hielt mich eine Spur zu fest am Oberarm und führte mich in Gegenrichtung der Warteschlange aus dem Zollbereich hinaus. So also fühlt sich das an, dachte ich. Und wollte mir gar nicht erst ausmalen, was die Leute in der Schlange dachten: Haben sie einen erwischt. So sehen die also aus, mittlerweile. Würde man ihm auch nicht geben. So harmlos, wie der daherkommt. Krasser Job, Grenzbeamter. Dann stand ich wieder da, wo ich vor gerade mal fünf Minuten noch gutgelaunt und zielstrebig durchgegangen war. Und langsam stieg das Blut wieder in den Kopf und die Gewissheit sickerte ins Bewusstsein. «You’re not travelling to England today, Sir.» Reise fürs Erste zu Ende. Schluss, aus, Amen. Dann erst einmal: Zusammenbruch.
Im Nachhinein ja alles halb so wild. Im Augenblick aber: Katastrophe. Quasi Schlagbaum an den Kopf. Grenzerfahrung. Pushback. Nächste Kopfkapriole: Und das geschieht mir. Mir, einem unbescholtenen Schweizer Schriftsteller. Max Frisch fällt mir ein, oder war es Peter Bichsel, wie er die Schweizer*innen beschreibt, die an der Grenze mit ihrem roten Pass wedeln und sich für etwas Besseres halten. Aber dafür müsste ich ihn ja erst einmal haben. Anruf aufs Handy meiner Liebsten, mit tränenerstickter Stimme, auf die Combox: Bin in Paris. Komme nicht weiter. Habe meinen Pass nicht dabei. Sehr kurz darauf ihr Rückruf. Das muss wohl krass dahergekommen sein, auf der Combox. Tröstende Worte. Verbale Notfalltropfen, Tempo-Taschentuch. Alles gut. Sag, wenn ich irgendetwas tun kann. Dann, erstaunlich schnell, Rückkehr in die reale Welt. Und man kann gegen diese Mobiltelefone haben, was man will, aber manchmal sind sie schon unheimlich praktisch. So stehe ich also mitten in Paris, mitten in der Gare du Nord, mitten in den Leuten, mit einem Tempo-Taschentuch-grossen Gerät und buche, nacheinander: Zugfahrt Paris–Basel. Zugfahrt Basel–Paris. Hotel Paris. Zugfahrt Paris–London am nächsten Morgen. So geht das, würde Maloney sagen. Und klar, so geht das nur, wenn Geld keine Rolle spielt. Und das spielte es für mich in dem Moment für einmal nicht. Ich wollte in Bristol sein, am nächsten Tag, für die Lesung, um 16 Uhr. On time. Und so geht das auch nur, wenn man jemanden hat, der extra mit dem Pass von Zürich nach Basel fährt.
Ich fuhr am 7. Februar also dreimal die Strecke Basel–Paris. Nahm in Basel den Pass entgegen, war um halb zwölf abends wieder in Paris, schlief in einem Hotel nahe der Gare du Nord und stand am nächsten Morgen wieder vor den Zollkabäuschen. Mit dem Pass in der Hand und einem ziemlich mulmigen Gefühl im Magen. Es waren andere Beamte, und es ging kein Alarm los. Und ich trank
dann, im Warteraum des Eurostar, erstmal einen starken Kaffee. Und atmete ganz tief durch.
(Doch das war erst der Anfang dieser Reise. Im Märchen sind es ja auch immer drei Prüfungen, die der Held, die Heldin, überstehen muss. Ausserhalb von London-Paddington hatte es einen Personenunfall gegeben, «all trains suspended», ich musste nochmal den Bahnhof wechseln und mit einem Regionalzug alles umfahren, um in Reading den Schnellzug nach Bristol zu erwischen. In Reading wiederum, auf dem Bahnsteig, hiess es auf der Anzeige «This train may be disrupted due to heavy rain flooding the railway». Er kam dann, mit Verspätung, tuckerte durch überflutete Felder und kam um halb vier in Bristol an. Ein älteres Paar aus dem Buchklub holte mich ab und fuhr im Regen durch den Abendverkehr. Um fünf vor vier waren wir da. Ich zog mich rasch um, putzte die Zähne, und um punkt vier Uhr begann ich meine Lesung mit dem Satz: «Es gibt im Deutschen eine Redewendung: Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen.» Und was soll ich hier noch erzählen, es wurde ein grandioser Abend. Genau deswegen.)

RALF SCHLATTER, geboren 1971, lebt als Autor und Kabarettist in Zürich. Seit 2000 ist er mit Anna-Katharina Rickert als «schön&gut» unterwegs, mit poetischem und politischem Kabarett, ausgezeichnet mit dem Salzburger Stier, dem Schweizer Kabarettpreis Cornichon und dem Schweizer Kleinkunstpreis. Als Autor hat er u.a. die Romane «Federseel», «Steingrubers Jahr», «Muttertag» und «43 586 – Ein Schweizer Decamerone» publiziert.
Ausschreibung vom 17. Juni bis 6. September 2024
Gefördert werden Projekte und Angebote mit 3’000 bis 30’000 Franken, die sich insbesondere an finanziell benachteiligte junge Menschen richten.


















Es gibt Momente im Leben, da scheint die Welt um dich herum stillzustehen. Wenn sie sich weiterdreht, wie wird es sein – und ist das wichtig?
Es ist Sabines Geburtstag, der neunundfünfzigste, und sie wollte ihn unbedingt auf dem Boot feiern. «Wieso nicht nächstes Jahr», hatte Koni gefragt, «wieso nicht den runden, mit etwas Vorlauf, damit es sich alle einrichten können?» Aber abergläubisch, wie sie ist – oder einfach leidgeprüft –, ist sich Sabine sicher, wenn sie sich das vornimmt, dann passiert irgendwas Schlimmes. «Jetzt habe ich endlich mal einen guten Mann, ein gutes Leben und die Möglichkeit, das auf einem Boot an einem idyllischen Ort zu feiern. Was soll ich da noch zuwarten?»
Also sind sie jetzt hier, im kleinen Rahmen, nur die Familie. Konis zwei Töchter, Leonie und Anouk, seine Enkelin Luna und Sabines Tochter Mathilde. Und die hat ihren unmöglichen neuen Freund Marvin mitgeschleppt, diesen mit überteuerter Funktionskleidung getarnten Höhlenbewohner. Schon der Name, Marvin, um Himmels willen, wer nennt sein Kind so? Zirkusclowns?
Egal. Es ist ein herrlicher Frühsommernachmittag an der Loire. Die bunten Girlanden tanzen an der Reling im Wind, auf dem Tisch stehen sechs liebevoll verpackte Geschenke neben dem weiss glasierten Gugelhupf. Die neun kleinen roten und fünf grossen blauen Kerzen darauf flackern fröhlich, während die Festgesellschaft laut und falsch Joyeux Anniversaire johlt – alle ausser der kleinen Luna, die ein paar Meter entfernt auf dem Deck liegt und den Katzengesang engelsgleich verschläft. Sabines grüne Augen glänzen, als sie nach dem launigen Ständchen tief Luft holt, um die Kerzen auszublasen. Und genau da fängt es an.
TEXT CHRISTINA HUG
Was auch immer die Reaktion auslöst – ein Partikel in der Atmosphäre, von den Uferpflanzen oder vom Rauch der Kerzen, das unbewusste solidarische Luftholen vor dem Ausblasen – Konis Bronchien ziehen sich plötzlich zu. Von einer Sekunde auf die andere kommt nur noch ein Bruchteil der Luft durch. Sabine bläst mit theatralischem Gestus, die anderen feuern sie an; Koni dreht sich ab und versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Er fokussiert auf seine Atmung. Ruhig, langsam, durch die geschlossenen Lippen auspusten – manchmal reicht das schon, damit es nicht schlimmer wird. Dieses Mal nicht.
Sein Schnaufen wird schneller und flacher, fängt leise an zu pfeifen. «Was ist denn los, hast du dich verschluckt?», fragt Marvin. Er tritt neben Koni und haut ihm mit der flachen Hand auf den Rücken, einmal, zweimal. Koni versucht, den Trottel abzuwimmeln, aber Marvin holt selbstvergessen schon zum dritten Mal aus. «Hör auf, das ist ein Asthmaanfall!», ruft Leonie. Jetzt haben es auch die anderen gemerkt. «Ah, eine Folge der Corona-Impfung», sagt Marvin. Zum Glück kann Koni gerade nicht sprechen, sonst würde er dem Hohlkopf jetzt was Wüstes geigen. Anouk starrt Marvin ungläubig an. «Papa hat seit seiner Kindheit Asthma, du Globi.» Betont ruhig fragt Leonie, ob Koni einen Asthmaspray dabei habe. Hat er natürlich nicht. Koni schüttelt den Kopf. Das Pfeifen in seinem Hals wird zum Keuchen. «Asthmaspray!», ruft Sabine, und reisst sich damit aus ihrer Schockstarre. Sie spurtet zum anderen Ende des Decks, die Stufe hinunter und sucht im Haufen von Rucksäcken und Handtaschen hektisch nach ihrem Hippiebeutel.
Koni ist viel zu nonchalant in diesen Dingen, das weiss er ja. Die Anfälle kommen selten – machmal zweimal im Jahr, manchmal zwei Jahre lang gar nicht –,
aber sie kehren zuverlässig wieder, und schön sind sie nicht. Meist kommt irgendwann der Moment, an dem er denkt, so, das war es jetzt also. Aber er lebt schliesslich noch, oder?
Koni hat die Dinge immer mehr oder weniger auf sich zukommen lassen. Darauf vertraut, dass es kommt, wie es kommen muss – was es in der Regel auch tut. Wenn das Leben Überraschungen für ihn bereithielt, dann fast immer gute. Wieso sollte er auf seine alten Tage hin die Strategie ändern? Leonie, in ihrer typischen Art –warmherzig, aber unzimperlich – nennt ihn deswegen einen Fatalisten. Koni selbst sieht sich eher als Impulskäufer auf dem Flohmarkt des Alltags. Und sind das nicht alle irgendwie? Die andern, die Hyperambitionierten, waren Koni schon immer unsympathisch. Ausserdem gleicht Sabine mit ihrer überbordenden Fürsorglichkeit seine Nachlässigkeit seit nun bald zwei Jahren mehr als aus. Seit er einmal in ihrer Gegenwart einen Anfall hatte, trägt sie in ihrem Beutel immer eine Ventolinpumpe mit sich herum.
«Dann halt von einer anderen Impfung – Masern vielleicht», schwabuliert Marvin. Mathilde macht ein gequältes Gesicht. Ha, merkst du es auch langsam? Anouk ignoriert die beiden. Aus ihren Hosentaschen zieht sie ein Sackmesser und einen Kugelschreiber hervor und hält Koni beides unter die Nase. «Papa, gell, du weisst, ich habe beim Luftröhrenschnitt besonders gut aufgepasst, extra wegen dir.» Sie schaut ihn herausfordernd an. Koni muss grinsen, der ganzen beschissenen Situation zum Trotz. «Untersteh dich», presst er unter Keuchen hervor. Mathilde wird kreideweiss. «Asthma kommt von Impfungen, das habe ich im Internet gelesen!», sagt Marvin. «Jetzt halt die Schnauze, du Arschloch!», blafft Anouk ihn an. Er sucht scho-









ckiert Hilfe bei Mathilde, doch die meint nur: «Im Internet? Wirklich, Marvin, halt die Schnauze.»
«Da ist er!», ruft Sabine. Sie zieht den Spray aus ihrem Beutel, springt auf, bleibt mit dem Fuss mal wieder an der Stufe hängen und schlägt längs hin. Der Zerstäuber schlittert quer übers Deck und unter der Reling hindurch ins Nirvana. Sabine heult auf. Marvin zieht sich heldenhaft das T-Shirt über den Kopf und springt dem Teil hinterher. Halleluja. Wenn Koni jetzt erstickt, dann wenigstens nicht vor diesem Vollpfosten. «Ich hole meinen», sagt Leonie und verschwindet unter Deck. Die friedlich schlummernde Luna macht nach wie vor keinen Wank.
Koni fängt an zu röcheln. Es fühlt sich an, als würde ein Elefant auf seiner Brust sitzen. Als wären seine Lungen zusammengepresst und leer. Dabei weiss er, dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist. Sie sind zu voll, voller verbrauchter Luft. Ertrinken ohne Wasser. Sein Gesichtsfeld fängt von den Rändern her an zu flackern.
«Meine Güte, Papa, was für eine saudumme Art zu sterben», sagt Anouk. Sie
klappt ihr Sackmesser auf und beginnt, den Kugelschreiber auseinanderzuschrauben. Jesses, wenn er hier wirklich umkippt, zieht sie die Operation noch durch. Links von Anouk wird Mathilde immer bleicher, rechts von ihr wimmert die tränenüberströmte Sabine seinen Namen, bis schliesslich das Rauschen in seinen Ohren alles andere übertönt. Sein Gesichtsfeld wird kleiner und dunkler. Wo ist eigentlich Leonie hin, fragt sich Koni.
Sein suchender Blick bleibt an Luna hängen, die immer noch seelenruhig daliegt und schläft, verschwitzt unter der späten Nachmittagssonne, den roten Nuggi im Mund. Ein friedliches Bild. Kein schlechtes Schlussbild, wenn es das nun endgültig war. Er bedauert nur, dass er mit seinem Ableben ganz jämmerlich Sabines Geburtstag versaut. Erst recht, wenn Anouk dann auch noch ein Blutbad anrichtet.
Leonie taucht in der Luke auf, ein Ventolinpümpchen in der Hand. «Ich hab ihn!», ruft sie. Und da, wie durch ein Wunder, machen Konis Bronchien wieder auf. Einfach so, genauso schnell, wie sie sich vorher zusammengezogen haben. Der
Druck auf der Lunge ist weg und er atmet ein, neue, frische, wunderbare Luft. Zwei Atemzüge, drei, und um ihn herum atmen die vier Frauen hörbar auf.
Luna öffnet die Augen. «Grosspapi, können wir jetzt ausblasen?»
«Aber sowas von», sagt Koni. «Ausblasen und Kuchen essen, los!»
Es gibt Momente im Leben, da scheint die Welt stillzustehen – und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es vorher war. Aber das da eben, da ist sich Koni ziemlich sicher, war keiner von denen.

CHRISTINA HUG , geboren 1983, versucht die Schriftstellerei mit ihrem Teilzeitjob in einem Kulturbetrieb unter einen Hut zu bringen – mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Ihr Roman «Unser Haus» ist letztes Jahr im Zytglogge Verlag erschienen.













































TEXT AZAD ŞÎMMO
Losgerissen vom Wind schroffer Berge
Kommst du und stösst auf die Herzen
Streifst um den Saum des Heimatlandes
Wie das Wehen der Hoffnung, brüllend und grob
Und zugleich auch so zart, so lieblich
Ich will deine Stimme heute hören
Ich will dein Leben heute sammeln
Frühlingsblume der Rebellen, Avaşîn
Brausende Stimme der Hoffnung, Avaşîn
Adlerfelsen erwachen mit einem Dröhnen
Wie eine Bruchstelle zitternd und aufgewühlt
Langsam füllt sich des Herzens Lichtbündel
Prüft den sich Nähernden, ob er als Freund erscheint
Ach, ausgeschlossen, ganz ausgeschlossen
Ich klage wegen der Himmel, die den Hochmut gross werden liessen
Im klaren Wasser schimmern deine Augen grünlich
Doch weine nicht, Avaşîn
Werde ruhig und birg dich im Schoss der Nächte
Lebenslang bin ich der Wächter deiner Rosengärten
Nie soll der Hauch des Verrats dich treffen
Dessen Fluch so viele Herzen bluten lässt, Avaşîn
Mit dem Blick, der das Zagros-Gebirge beherrscht
Erhebt sich langsam die Sehnsucht von Botan
Nach Morgen hin weiten sich die Horizonte des Dschudi
Längst hat der Ararat mein Erinnern geprägt
Bist du nicht oftmals zur Auferstehung geschleppt worden
Was man Vergangenheit nennt, geht so nicht verloren
Deine Geduld wird geschliffen, gehärtet Lebenslust ist dir in der Kehle gewachsen
In deinem Grübchen liegt das Lächeln des schönsten Landes Ist das etwa nicht der Zustand, den du erreicht hast Sag es doch Bleib so Bleib immer so, Avaşîn
Avaşîn ist eine Region in Südkurdistan entlang der türkisch-irakischen Grenze. Dieser Text und seine Fortsetzung erschienen erstmals bei Weiter Schreiben Schweiz.

AZAD ŞÎMMO stammt aus einer kurdischen und alevitischen Familie in der Türkei. Er hat Soziologie studiert. Sein erster Gedichtband wurde 2015 veröffentlicht. Es folgten 2017 ein weiteres Lyrikbuch und 2019 ein Roman.
Sein Gedichtband «Avaşîn» erschien 2022.
Aus dem Türkischen von BARBARA YURTDAŞ
TEXT LENA BÜHLMANN
Davor:
Sie liegt auf der nackten Matratze, die Matratze auf dem Boden, ohne Lattenrost, ohne Bettgestell. Atmet ein, atmet aus. Ein, aus. Ein, aus. Der Brustkorb sich hebend, der Brustkorb sich senkend. Ein. Und aus. Ein – die Lunge dehnt sich, das Zwerchfell zieht sich zusammen – und aus – Blut wird vom Herz durch den Körper gepumpt, in die Füsse, in den Kopf. Sie atmet ein, flach auf dem Rücken liegend, die Hände auf dem Bauch gefaltet. Atmet aus. Am Fenster summt eine Fliege –in unregelmässigen Abständen fliegt sie gegen die Scheibe. Atmet ein. Von ihrer Position auf der Matratze aus kann sie die Fliege nicht sehen. Hört bloss ihr Summen und das unregelmässige dumpfe Aufprallen. Atmet aus, atmet ein. Blut in den Ohren, Blut in den Fingerspitzen. Atmet aus. Das Sonnenlicht, das durch die halb geschlossenen Rollläden dringt, malt weisse Striche an die Wand. Sie atmet ein. In der Ecke links von der Tür steht ein kleiner Tisch mit drei Stühlen, sie sind alle etwas schräg und aus altem Holz. Atmet aus. Atmet ein. Auch der Tisch ist aus Holz und kahl, bis auf ein leeres Marmeladenglas, in dem ein Blumenstrauss vertrocknet. Atmet aus. Neben der Matratze, ebenfalls auf dem Boden, ein voller Aschenbecher. Atmet ein. Die letzte Zigarette steckt, nur zur Hälfte geraucht und noch immer leicht glühend, zwischen dem rechten Mittel- und Zeigefinger. Atmet aus, sie atmet ein. Direkt über der Matratze, auf der Höhe ihres Gesichts, ein dunkler, kreuzförmiger Fleck an der Decke. Sie atmet aus. Sie atmet – ein wenig Asche fällt von der Zigarette auf die Matratze – ein, atmet – die Fliege stösst gegen das Fenster, die Blumen vertrocknen, Blut in den Ohren, Blut in den Fingerspitzen –aus. Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne und die weissen Streifen an der Wand verschwinden.
Sie atmet ein –
Danach:
Im Zimmer ist es ruhig und dunkel. Niemand atmet – bloss die gelegentlichen Geräusche der Fliege, die gegen die Fensterscheibe stösst, stören die Stille. Neben der nackten Matratze in der Ecke liegen die Scherben des Aschenbechers – rundherum ist der Boden grau. Niemand atmet, die Fliege stösst gegen die Fensterscheibe. Vier kahle Wände, eine nackte Matratze, ein kahler Tisch. Niemand atmet. Auf dem Tisch liegen die vertrockneten Köpfe der Blumen, ihre Stiele noch immer in dem leeren Marmeladenglas. Die Fliege stösst gegen die Fensterscheibe. Summt. Ein Stuhl ist umgekippt, liegt verloren auf dem Boden. Niemand atmet, die Fliege stösst gegen die Scheibe. Auf der Matratze ein kalter Zigarettenstummel. Niemand atmet.
Ein letztes Mal stösst die Fliege gegen die Scheibe, fällt dann auf das Sims, den Rücken, die zarten Flügel. Zappelt einige Male mit den dünnen Beinchen, bevor auch das letzte Geräusch im Zimmer erstirbt und es endgültig still wird.

LENA BÜHLMANN, geboren 2004 in Zürich, studiert literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel, schreibt Prosatexte und Lyrik und befasst sich momentan in ihrem Schreiben mit der Kindheit und dem Erwachsenwerden.
TEXT MIGMAR DOLMA
Jedes Mal, wenn ich meine zum Durchatmen zu kommen, wenn ich tief einatme und dann tief auszuatmen gedenke, wenn ich meine Augen schliesse und diese Yoga-Frauen imitiere, die die ganze Zeit tief ein- und ausatmen, immer genau dann, wenn ich gerade eingeatmet habe und kurz bevor ich zum Ausatmen komme, passiert das, was eben jedes Mal passiert: das Leben, nicht mein Leben, einfach das Leben. So wie zum Beispiel heute Nachmittag an meinem freien Tag. An meinem freien Tag atme ich tief ein, und noch bevor ich tief ausatmen kann, klingelt es an der Tür und der Postbote bittet mich darum, den Zahlungsbefehl entgegenzunehmen. Ich unterschreibe und schliesse die Tür. Ich bücke mich über mein iPhone, google das Betreibungsamt und checke schnell die Öffnungszeiten ab. Dass ich auszuatmen gedachte, habe ich schon lange vergessen, stattdessen versteift sich mein Nacken. Dann renne ich zur Bushaltestelle, um noch fünf Minuten vor 16 Uhr vor dem Amt zu stehen. Wer macht eigentlich solche Öffnungszeiten? Wahrscheinlich Menschen, die die ganze Zeit tief ein- und ausatmen. Ich stehe vor dem Zimmer und drücke auf die Klingel, dann leuchtet der kleine Schalter grün, ich höre ein Surren und ich gehe rein. Dort steht eine Frau hinter dem Schalter, sie sieht aus, als würde sie bald in Rente gehen, nicht weil sie älter ist, sondern weil sie mich so anschaut, als würde sie diesen Job schon viel zu lange machen. Seufzend nimmt sie den Zahlungsbefehl entgegen und klärt mich dann darüber auf, dass ich zweihundert Franken sechzig zu zahlen hätte innert zwanzig Tagen, und falls dies nicht geschehe, dann komme der nächste Zahlungsbefehl, dann wird es noch teurer, jeden Tag, da fallen Zinsen an, wissen Sie, jeden Tag, an dem Sie nicht bezahlen. Deshalb wäre es das Beste, Sie würden gleich jetzt bezahlen, aha, okay, Sie können jetzt nicht zahlen, okay gut, ja dann unterschreiben Sie doch hier, bitte. Ich unterschreibe, ohne zu wissen, was ich unterschreibe, und ich gehe aus dem Büro raus. Vor dem Eingang bleibe ich auf der Treppe stehen und Kinder rennen an mir vorbei. Sie tragen Taschen auf den Schultern, die grösser sind als sie selbst. Unterhalb des Betreibungsamtes ist die Musikschule der Gemeinde. Ich muss bei ihrem Anblick lächeln und mein Atem wird langsamer, stetiger und ich erinnere mich nun daran, dass ich heute tief ausatmen wollte. Ich schliesse die Augen und atme tief ein, und bevor ich tief ausatme, erinnere ich mich daran, dass Guiliano in dreissig Minuten nachhause kommen wird und der Kühlschrank leer steht. Zuhause habe ich noch eine Packung Spaghetti, die Tomatensauce und der Reibkäse werden mich nicht mehr als zehn Franken kosten, gestern hatte ich noch
neunundvierzig auf dem Konto, damit kann ich diese Woche überleben. Verdammt, heute ist doch mein freier Tag, und doch ist es jedes Mal dasselbe.
Irgendwann gehe ich zur Schuldenberatung. Vor mir sitzt ein junger Schuldenberater, er ist Sozialarbeiter und erstellt ein Budget mit mir und bringt mir bei, wie man Einnahmen und Ausgaben auflistet. Bei ihm fühle ich mich wie ein Kind, vielleicht, weil er zu mir spricht, als wäre er mein Vater. Seine Stimme ist sanftmütig. Er ist bestimmt jemand, der Yoga macht, auf jeden Fall atmet er tief ein und aus, jeden Tag, das merkt man. Er erklärt mir, dass ich bei den Ausgaben strenger sein muss, vor allem bei meinem Sohn. Seine Hobbys seien zu teuer.
«Ich kaufe meinem Sohn die teuren Fussballschuhe, die er sich wünscht, ich gehe an jeden Match, auch wenn ich kein Geld mehr habe für Benzin, ich kaufe ihm das Originaltrikot von seinem Lieblingsclub FC Barcelona, nicht weil ich eine verantwortungslose Mutter bin, vielmehr weil ich eine verantwortungsvolle Mutter bin, weil ich meinen Sohn liebe, weil er nie das Gefühl haben soll, dass er weniger sei, weil wir weniger haben, aber das können Menschen wie Sie vielleicht nicht verstehen. Ich sehe Ihnen ja an, dass Sie in einem schönen Haus aufgewachsen sind, dass Sie Eltern hatten, beide Eltern, die Sie geliebt haben, wahrscheinlich Ihr Studium finanziert haben, und deshalb können Sie mir trotz Ihrem Studium und trotz dieser sanftmütigen Stimme nicht helfen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Yoga machen, tief ein- und ausatmen, durchatmen. Ich gehöre zu den Menschen, die noch atmen, keine Angst, sonst wäre ich ja schon lange tot.»
Aber ich sage nichts, ich möchte nicht, dass er sich schlecht fühlt, er macht schliesslich nur seinen Job. Bevor ich sein Büro verlasse, sagt er zu mir:
«Vergessen Sie nicht, tief ein- und auszuatmen, wenn Sie gestresst sind. Sie werden es schaffen.»

MIGMAR DOLMA lebt, liest und schreibt in Zürich. Momentan arbeitet sie an ihrem ersten Roman, der, wie dieser Text hier, von Frauen aus der Unterschicht handelt. Sie hat unter anderem Kolumnen für die WOZ geschrieben.












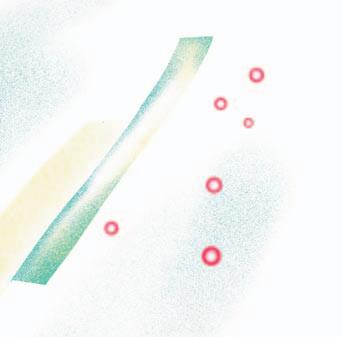





Ja, wir rauschen. Wir rauschen mit hohem Tempo, rauschen am Gebäude vorbei, das da steht, am Wegrand, wortwörtlich zu Grunde geht. Eben dem Boden entgegen. Und wir rauschen. Rauschen mit hohem Tempo an so manchem vorbei, das wir uns gern mal genauer anschauen würden, worüber wir gern mal tiefer nachdenken würden, in aller, aller Ruhe.
Einfach mal runter vom Gas, die nächste Ausfahrt nehmen, anhalten.
Einfach mal aufstehen bei der nächsten Zugstation, obwohl wir doch weitermüssten. Aussteigen.
Ein paar Schritte gehen. Und dann da sein – und staunen.
Es gibt die Legende, dass bei der Einführung der Eisenbahn Ärzte besorgt gewesen seien und gewarnt hätten: Dieses hohe Tempo könne den Mitreisenden schaden – ja sogar für die, die von aussen draufschauen auf so einen vorbeirasenden Zug, gefährlich werden. Was drohe, sei eine Art Delirium furiosum; man könne hirnwütig werden, tobsüchtig, verrückt. – Das Tempo der frühen Passagierzüge: 30 Kilometer pro Stunde. Das sind 500 Meter in der Minute. Das sind 8,3 Meter in der Sekunde. Und, ja, tatsächlich gab es Klagen von Reisenden, wurde gezittert, traten Ermüdung, Erschöpfung, nervöse Reizbarkeit und Verdauungsstörungen auf. Diese Symptome waren aber wohl viel mehr auf die Aufregung, das Geruckel, die Erschütterungen und das laute Dröhnen zurückzuführen denn auf das Tempo an sich.
TEXT ANDREA KELLER
Heute sind wir mit weitaus wuchtigeren Geschwindigkeiten und zugleich bequemer unterwegs, mit Polsterung und allem Pipapo, das uns der Fortschritt als bunte Blüten ins Leben treibt. Am Häuschen in Mels fahren die Züge derzeit mit maximal 140 Kilometern pro Stunde vorbei. Die Autos, bei freier Fahrbahn und gesetzeskonform: mit 120 km/h. Das sind 2 Kilometer in der Minute. 33,33 Meter in der Sekunde. – Zack! Und so rasen wir, rasen wir weiter. Müssen wir auch. Denn: Zeit ist Geld. Ein knappes Gut.
Tick-tack.
Tick-tack.
Zeit ist Geld? Ein knappes Gut? – Wann haben wir eigentlich damit begonnen, über Zeit wie über einen materiellen Gegenstand, eine ökonomische Ressource zu reden? Und was macht das mit uns, wenn wir ständig Zeit sparen, Zeit gewinnen, Zeit gut und klug investieren wollen, eben um Himmels willen keine Minute vertrödeln, vergeuden, verschwenden? Derartige Redeweisen haben sich längst in unseren Alltag eingesponnen wie dünne, reissfeste Fäden, die unser Bild und Verständnis, ja sogar unser subjektives Erleben von Zeit zusammenzurren.
Tatsache ist: Wenn wir beispielsweise im Stau stehen, verlieren wir keine Zeit. Nicht im eigentlichen Sinne. «Es sind lediglich Taktungen von Ereignissen gestört», schreibt der Autor Norman Sieroka in seiner «Philosophie der Zeit». Dann, wenn man beispielsweise aufgrund des Staus nicht mehr rechtzeitig zum geplanten Geschäftstermin kommt. Wir können also zu spät kommen, klar, und das mag
unangenehme Konsequenzen haben. Aber Zeit verlieren? Zeit? Ob wir nun im Stau stehen oder gerade einen wichtigen Vertrag abschliessen, lässt die Zeit an sich doch völlig unberührt. Nur uns nicht! Uns regt es auf, ausgebremst zu sein auf diesem Weg von A nach B. Und so droht bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern die Stunde tatsächlich ein Delirium furiosum, die Tobsucht – nicht, weil uns das viel zu schnell wäre, im Gegenteil: Es ist uns zu langsam geworden. Noch schlimmer ist’s, wenn die Fahrt ganz ins Stocken gerät. Hätten wir in solchen Momenten nicht noch das Smartphone zur Ablenkung, etwas Musik im Radio, könnten wir komplett den Verstand verlieren.
Eine Minute ist eine Minute ist eine Minute.
Jetzt einfach mal tief runteratmen in den Bauch.
Den Hosenknopf öffnen, den Bauch sich weiten lassen, richtig weiten lassen.
Wie so ein dicker, runder Babybauch. Ausatmen.
Eine Minute ist eine Minute ist eine Minute.
Es gibt die Zahlen, die Fakten, die physikalische Zeit, wie sie mit Uhren gemessen wird. Das ist die sogenannte Weltzeit. Und es gibt das Gefühl, das subjektive Erleben von Zeit. Das ist die Eigenzeit. Letztere kann mehr oder weniger synchron mit der Weltzeit sein. Und es gibt auch noch die geologische Zeit, die Tiefenzeit. Das sollten wir uns ruhig hin und wieder vor Augen
führen: dass es mehrere Formen gibt, nicht nur eine einzige.
Die Weltzeit, übrigens, hat erst im Zuge der Industrialisierung an Wichtigkeit, an Präsenz gewonnen. Früher haben sich die Menschen nach dem Stand der Sonne, dem Tageslicht, ausgerichtet, wurde bewusst mit den Jahreszeiten gelebt. Dadurch pflegte man vielmehr eine zyklische denn lineare Vorstellung. Mit den Fabriken und dem zunehmend kapitalistisch geprägten Denken, das nur die Richtung «nach vorne» kennt, hin zum «Höher-schnellerweiter» und «Mehr-mehr-mehr», wurde es hektischer, hechelnder. Denn plötzlich gaben die Gerätschaften, die Laufbänder, den Takt vor. Im selben Atemzug stieg die Zahl öffentlicher Uhren an: Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hielten nicht nur Fabrikuhren, sondern auch Rathausuhren und Bahnhofsuhren Einzug im Leben. Damit die Fahrpläne tatsächlich funktionierten, mussten die damals regional unterschiedlichen Zeiten aufeinander abgestimmt werden. Bis ins Jahr 1886 war’s in Genf noch 11:55, wenn die Uhren in Bern schon 12:00 geschlagen hatten.
Als Charlie Chaplin in den 1930er-Jahren seinen Film «Moderne Zeiten» drehte, thematisierte er diese Beschleunigung des Lebens und die Fremdbestimmung des Menschen durch die Maschinen. Der Soziologe Hartmut Rosa denkt Chaplins Systemkritik konsequent weiter, wenn er die moderne Gesellschaft als eine definiert, deren stetiger Steigerungszwang in der Zeitdimension zu einer ununterbrochenen Beschleunigung unseres Lebens führt. Ebendiese Beschleunigung, so Rosa, bedrohe die Selbstbestimmung des Menschen. Und vielleicht, so möchte man anfügen, noch viel mehr als das, nämlich unsere Zukunft, erst recht die unserer Kinder und Kindeskinder. Denn da sind und rasen wir nun, wir Rastlosen, mit unserem kapitalistisch geprägten Fortschrittsglauben, dem Dogma des fortwährenden Wachstums und dem vielbeklagten Stress, dem Paradoxon, überall Zeit sparen zu wollen und zugleich festgetackert an unseren digitalen Geräten, in drückender, «swipender», also wischender Unruhe. Viele von uns sind bereit, tagtäglich mehrere Stunden in virtuellen Gefilden


zu verbringen – vereinzelt mit Klugem, sehr oft auch mit Nonsens gespiesen –, während all die Wahrhaftig- und Wirklichkeiten um uns herum und in uns drin Aufmerksamkeit und Hingabe verdient hätten. Das ist der eigentliche, dramatische Verlust. Nicht derjenige der Zeit, sondern derjenige der Aufmerksamkeit für Wesentliches. Zumal da draussen nicht nur dieses Gebäude im Sarganserland, sondern gerade so einiges in die Knie geht, in sich zusammenbricht … Da draussen – und in uns drin?
Wie lange wollen wir noch so weitermachen? Wann nehmen wir unseren Bleifuss vom Gaspedal, halten ihn einfach mal in der Luft, ziehen vielleicht sogar am Schnürsenkel, unseren Schuh aus, unsere Socke, betrachten die Zehen. Jeden einzelnen davon.
Der erste ist der dicke Zeh, der Zweite trinkt gern Früchtetee, der Dritte riecht nach Stinkekas, der Vierte hat am Wackeln Spass und die kleine Nummer fünf macht fleissig Löcher in die Strümpf.






Teamgeist beginnt mit Dir. Jetzt weiterbilden in Management und Führung: bfh.ch/management-gesundheit-sozialwesen g









Mit Entspannung könnte tatsächlich schon einiges erreicht werden. Doch noch effektiver wäre es, den Fuss nun rüberwandern zu lassen, einfach rüber zur Bremse, ihn da abzusenken – nicht allzu langsam, aber sachte, aber sicher.
Klimakrise. Artensterben.
Klimasterben. Artenkrise.
Was haben wir denn davon, so zu tun, als wäre das alles kein Problem – und wenn doch, so zumindest nicht unseres?
Klar, es ist einfach zu viel. Zu komplex. Zu unangenehm. Belastend. Und es bringt ja auch niemandem was, wenn wir alle heulend zusammenbrechen. Wer soll denn dann unsere Jobs erledigen, die Maschine am Laufen halten? Wir müssen morgen auch wieder aufstehen, funktionieren. Ein zu genaues Hinschauen wäre entsprechend riskant, wäre hochgefährlich. Es könnte uns aus der Fassung bringen, aus dem Takt. – Gott bewahre!
Aber was, wenn es gut wäre, das einzig Richtige sogar, endlich aus dem Takt zu geraten? Weil dieser Takt, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, längst nicht mehr dazu einlädt, im Einklang mit dem Leben zu tanzen, sondern nur noch dumpf hämmert und es bei dieser ohrenbetäubenden Hämmerei kaum mehr möglich ist, auch nur einen einzigen vernünftigen, einen sorgfältigen Gedanken zu fassen? Wir sogar taub werden für den eigenen Herzschlag? Sich unsere Muskulatur versteift? Es immer herausfordernder wird, sich im Alltag befreit und fliessend zu erleben, auch mal der Stille zu lauschen, einem einzelnen Regentropfen zuzusehen, der im Zickzack das Fensterglas hinabwandert, mit sich und der Mitwelt in die Tiefe zu gehen?
Einatmen. Ausatmen.
Also was, wenn wir beim genaueren Hinschauen Faszinierendes entdecken? Was, wenn wir dabei Neues über uns selbst erfahren, auch Uraltes über unser Dasein, die
Welt? Was, wenn wir uns danach befreiter, erfüllter und verbundener fühlen – weil wir das Leben wieder mehr schätzen, unsere Beziehung zur eigenen Existenz und der von anderen vertiefen und näher beim Zyklischen sind? Zurück bei der Bauchatmung. Näher bei Mutter Natur! Ja, was dann?
Ach, Mensch! Wir rauschen. Wir rauschen mit hohem Tempo, rauschen am Gebäude vorbei, das da steht, am Wegrand, wortwörtlich zu Grunde geht. Eben dem Boden entgegen. Und wir rauschen. Rauschen mit hohem Tempo an so manchem vorbei, das wir uns gern mal genauer anschauen würden, worüber wir gern mal tiefer nachdenken würden, in aller, aller Ruhe. Ausatmen. Einfach mal runter vom Gas, die nächste Ausfahrt nehmen, anhalten. Einfach mal aufstehen, bei der nächsten Zugstation, obwohl wir doch weitermüssten. Aussteigen. Ein paar Schritte gehen. Und dann da sein – den Zerfall anstaunen, versuchen, in ihm, im Zerfall, nicht nur eine Bedrohung und visuelle Frechheit zu sehen, sondern etwas Natür-



liches, Versöhnliches, Ästhetisches. Poesie! – Das poème im problème. Die Vergänglichkeit in ihrer teils harten, aber eben auch zarten Tragik, die uns berührt; irgendwo tief in uns drin berührt. An einem Ort und auf eine Art und Weise, der bzw. die sich nicht klar fassen und beschreiben lassen ... In jenem inneren Raum, zu dem nur Ahnungen, Intuition, Gefühle und Gedichte vordringen, wir uns der Welt verbunden fühlen, uns als der Welt «eingeboren» erleben.
Einatmen.
Ausatmen.
Und hier stehen wir nun. Halten uns bei den Händen, atmen tief ein, die Bäuche runden sich, atmen aus, lange aus. Endlich Stille. Nicht da draussen, nein, in uns drin.
Mit einem Hauch von Melancholie hören und schauen wir uns dieses Gebäude an,

gemeinsam, auch eine jede, ein jeder für sich. Atmen wieder ein, atmen aus, lange aus, hören und schauen in uns rein.
Und dahinter, im Rücken: die Raserei. Das Delirium furiosum.
Jetzt, wo es dunkler wird, tanzen Schatten im vorbeihuschenden Licht, von den Autos, den Autos, vom Zug. Und über dem eingefallenen Dach flirren die Sterne.
Und über dem nachtschwarzen Berg glimmert der Mond.
Er, der Mond, einst als Erdtrabant aus Staubwolken gebildet, leuchtet uns den Weg zur Höhle im hinteren Teil des Steinbruchs, zu dem das Gebäude gehört. Wir folgen seiner Einladung, entfernen uns vom Häuschen, gehen ein paar Schritte, den Hügel hoch. Gehen ohne Schuhe. Gehen ohne Socken. Barfuss über den kalten, kantigen Untergrund.

Wir halten an, bücken uns – greifen uns je einen der vielen Steine, um ihn zu befühlen, berühren ihn sogar mit der Zungenspitze. Ziehen die Zunge zurück in den Mund, um sie zu schmecken, diese Welt, die es schon unendlich lange vor dem Menschen gegeben hat. Und die auch noch sein wird, wenn wir längst wieder gegangen sind.
Aber noch sind wir hier. Für einen wunderbaren Moment aus dem Takt geraten.

ANDREA KELLER , geboren 1981, (be-)wirkt als Kreativ-Komplizin: mit Texten und Publikationen, Workshops im Kreativen, Biografischen und naturverbundenen Schreiben sowie Kunst-, Kultur- und Literatur-Initiativen. Der Beitrag «Delirium furiosum» entstand im Zuge des Projektes «Oh, Darling, du zerfällst mir sehr». Er ist in ungekürzter Form im gleichnamigen Buch zu finden (Hrsg.: Studio Narrativ).
Draussen irgendwo ist Krieg. Das hört man aus dem Radio, wenn sich die gellende, knarrende Stimme überschlägt und das Heil-Gebrüll böser Männer einsetzt. Das sieht man auf der Brücke vorn, wenn der Landsturm seine Übungen abhält und schwere Betonblöcke auf die Fahrbahn schiebt, um eventuell auftauchende Panzer zu stoppen. Man merkt das auch am Gesicht des Vaters, wenn er die Nachrichten vom Landessender Beromünster hört, die ihn erschrecken.
Am Abend, wenn es schon eindunkelt, heult die Sirene auf, die vorn auf dem Dach der Färberei steht. Sie steigert sich zum aggressiven Schrei, ebbt ab, so dass man sie kaum mehr hört, nimmt neuen Anlauf und reisst die Stille auf, dass einem fast das Trommelfell platzt. Fliegeralarm. Bald wird man das dunkle Brummen der Bomber hören.
Die Mutter ruft uns Kinder in die Stube. Sie schliesst die Fensterläden, mit ruhigen, traurigen Bewegungen. Sie zündet eine Kerze an und löscht das elektrische Licht. Wir sitzen um den Tisch, und Mutter fängt an, unser Lieblingsmärchen von den sieben Brüdern zu erzählen, die am Brunnen Taufwasser holen mussten für ihr neugeborenes Schwesterlein, die den Krug aber unterwegs vor lauter Pressieren ausschütteten, was ihren Vater so erzürnte, dass er sie zu Raben verfluchte.
Oben hört man jetzt das Brummen, von weit her, es nähert sich langsam, fast unmerklich. Über unser Hausdach fliegen indessen die sieben Raben in die Berge hinein zu den Zwergen. Das Brummen der Bomber ist direkt über uns, allerdings, ohne uns zu gefährden, wie Mutter behauptet, denn nicht wir sind das Ziel, sondern andere Leute nördlich des Rheins. Da macht sich das Schwesterlein auf den Weg, um ihre Rabenbrüder zu suchen. Sie nimmt nichts mit sich als ein Ringlein von den Eltern zum Andenken, einen Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. Sie findet den Glasberg, in dem die Herren Raben wohnen, und das Brummen am Himmel oben verzieht sich Richtung Jura.
Da das treue Schwesterlein das Hinkelbeinchen, das ihr der Morgenstern gab, verloren hat, schneidet sie sich den kleinen Finger ab, steckt ihn in das Türschloss, öffnet und erlöst so ihre verwunschenen Brüder. Jetzt heult die
Sirene aufs Neue auf, diesmal, ohne zu schwanken, das ist der Endalarm. Die Bomber sind weg. Mutter öffnet die Fensterläden, Nachtluft weht herein, kühl und friedlich.
Am andern Morgen rennen wir in den Garten hinaus, um die glitzernden Metallstreifen zu suchen, die manchmal aus den Rümpfen der Flugzeuge flattern. Damit, das wissen wir, wollen die Piloten den Radar verwirren, und damit können wir im Kindergarten gross angeben.
Diesmal haben wir kein Glück, der Wind hat die Silberstreifen wohl weggetragen. Wir suchen zwischen den Kartoffelstauden und Lauchstengeln, auf dem Kraut der Karotten und den blanken Kohlköpfen. Wir finden nur kleine grüne Raupen, die wir mit den Fingern zerquetschen, weil es die Raupen des Kohlweisslings sind, der ein gemeiner Schädling ist. Die fingerlangen, grasgrünen, rotbetupften Raupen im Rüeblikraut hingegen lassen wir leben, denn aus ihnen wächst der schönste Sommervogel der Gegend, der gelb-schwarz gemusterte Segler, der Schwalbenschwanz.
Der ganze Garten ist voll Gemüse. Wir sind nahezu Selbstversorger. Wir essen Kartoffeln, Bohnen (grüne und gedörrte), Salat, Rüebli und Kohl, Äpfel und Zwetschgen (gedörrte und eingemachte), alles aus dem Garten, denn dafür braucht es keine Rationierungsmarken.
Was es braucht, ist Mist. Also tragen wir alle Abfälle (Plastik gibt es noch nicht) in die hinterste Ecke und warten, bis sie vermodert sind. Im November, wenn der Garten abgeräumt ist, schleppen wir den Kompost im Zuber auf die Beete und verteilen ihn sorgfältig. Er wird mit dem Regen und Schmelzwasser in den Boden eindringen und ihn düngen, so dass wieder schlanke Karotten und kräftige Kabisstorzen herauswachsen können.
Kabis, die stolze Kugel meiner Jugend. Red keinen Kabis, schimpfte zwar Vater, wenn wir Blödsinn erzählten. Das ist Kabis, das hiess so viel wie: So ein Quatsch. Der Prophet gilt eben nichts im Vaterlande.
Das Wort «Kabis» kommt von caputia, und das kommt von caput, was so viel heisst wie Kopf, Haupt. Das Kabishaupt, die Kugel, die vollendete Form. Redet mehr Kabis, Leute, macht Kabis. Esst Kabis.
Es gibt verschiedene Arten davon. Weisskohl, das ist der gewöhnliche, zu Unrecht verachtete. Rotkohl, der ist
wunderschön gezeichnet, wenn man ihn aufschneidet. Wirsing, den nannten wir den gerippelten Kabis. Blumenkohl, das empfindsame Mädchen. Rosenkohl, das ist der abgehärteste, dem vermag selbst der härteste Frost nichts anzuhaben.
Wenn wir im Herbst den Garten abräumten, grub der Vater eine Grube, und wir legten das Wintergemüse hinein. Rüebli neben Rüebli, Sellerie neben Sellerie, Endivie neben Endivie, caputia neben caputia. Drauf kam eine dicke Schicht Laub. Dann liessen wir es schneien.
Es schneite halbmeterhoch, und am Morgen glänzte das Sonnenlicht wie Silber. Drei schwere Pferde zogen den Schneepflug an unserem Haus vorbei, am Wegrand türmte sich ein unüberwindlicher Walm. Wir gingen mit unseren Schlitten über die Brücke die Auffahrt hinauf zum Tenn, wir glitten bäuchlings hinunter. Zwischendurch schauten wir ins Tenn hinein, wo die elektrische Dreschmaschine rumorte. Die war schon eindrücklich, und die Männer, welche die Garben hineinschoben, trugen Gummimasken gegen den Staub.
Wenn Mutter eine Gemüsesuppe kochen wollte oder Kohl mit Kümmel und Speck, schickte sie mich in den Garten. Ich räumte den Schnee weg, schob das Laub zur Seite und sah vor mir die wohlverwahrten Vitaminkrieger liegen, unbeschadet von der Kälte, wartend auf gesundheitspendenden Einsatz.
Das habe ich immer gern gemacht, auch wenn mir der Kuhnagel in die Finger schlich, denn das hat mich mit meiner Familie verbunden, mit den Grossvätern, den Urgrossvätern, die hatten das auch schon gemacht. Ich holte also einen Lauchstengel, eine Sellerieknolle, drei Karotten und einen Kabiskopf heraus, legte alles ins Löcherbecken und trug es in die Küche. Dort begann Mutter, das Gemüse zu rüsten, schabte mit dem Schälmesser die Rüebli blank, zog die äusserste Hülle vom Lauch, so dass der grünlich-weisse Schaft zum Vorschein kam, zerschnitt den
Kohl und legte eine Hälfte für später zur Seite. Sie tat das mit ruhigen, langsamen Bewegungen, und sie fragte mich dabei, was ich einmal werden wolle. Naturforscher, sagte ich, ich will erforschen, warum der Kabis nicht erfriert.
Damals, es war kurz nach dem Krieg, begann die grosse Veränderung der Essgewohnheiten, die über Fenchel und Brokkoli, von welcherlei komischem Gewächs hierzulande noch kein Mensch etwas gehört hatte, hinführte bis zu Kiwi und Mango.
Eines Tages wurden auf der anderen Seite des Baches die ersten Baustangen in die Wiese gesteckt. Nach einem Jahr standen dort drei Mehrfamilienhäuser, vierstöckig, acht Wohnungen unter demselben Dach. Gärten besassen die Leute, die dort einzogen, keine, die assen das Gemüse aus der Büchse. Nelly, die mit den abstehenden Kabisohren, behauptete, das sei ungesund, mit Büchsengemüse könne man nicht alt werden.
Ich habe damals den ersten Kaugummi gesehen. Er lag vor mir auf den Bsetzisteinen im Städtchen, eingepackt in grünes Stanniol, was ihm ein edles Aussehen gab. Er musste wohl jemandem aus der Hand gerutscht sein. Ich hob ihn auf und brachte ihn Fräulein Kunz, unserer Lehrerin. Sie hatte uns vor Kaugummi eindringlich gewarnt, das sei amerikanisches Teufelszeug und mache die Zähne kaputt.
Da ich ein braver Bub sein wollte, habe ich das geglaubt. Fräulein Kunz hat mich gelobt. Vermutlich hat sie den Kaugummi in den Mülleimer geworfen, oder sie hat sich ein Herz gefasst und selber ausprobiert, wie es ist, wenn man Gummi kaut.
Dann ist Nelly mit neuartigen Schuhen aufgetaucht. Die hatten Speckgummisohlen. Das waren Sohlen nicht aus Leder, in das Vater die Eisennägel hineinschlug, damit sie länger hielten. Sondern es waren Sohlen aus zwei Zentimeter dickem knallgelbem Gummi, an der Unterseite grob gerippt. Damit könne sie schneller rennen als jeder











Bub, behauptete sie, denn der Gummi federe und spicke sie bei jedem Schritt nach vorn. Wir haben es gleich ausprobiert und ein Wettrennen gemacht, ich sah nur noch ihren Rücken, die flatternden Zöpfe.
Onkel Emil, der eine kleine Garage aufgebaut hatte samt Zapfsäule, aus der er das Benzin heraushebelte wie aus einer Wasserpumpe, brachte uns zwölf Büchsen Thon. Das war zartes, hellrosa Fischfleisch, schön gefasert, schwimmend in Öl. Wir assen, schmatzten, tunkten mit Brot die letzten Tropfen auf. Das gibt uns Kraft, hat Vater behauptet.
Die Sirene haben wir nie mehr gehört. Sie stand noch immer auf dem Färbereidach, bedrohlich und hässlich, und ich hab Fräulein Kunz gefragt, wie diese kleine Maschine denn ihren schrecklichen Ton herstelle. Sie hat geantwortet, das sei eine blöde Frage, denn Sirenen würden hinfort nicht mehr benötigt.
Unsere Essgewohnheiten aber blieben bestehen. Kartoffeln, Salat, Gemüse. Birnenschnitze, Zwetschgenmus. Die Hurde im Keller voll Äpfel, die letzten waren die Bohnäpfel, die blieben bis ins Frühjahr frisch. Dann der erste Rhabarber, der rötlich aus der kalten Erde stiess.
Am Sonntag gab es das Sonntagsessen. Wir sassen in unseren Sonntagskleidern um den sonntäglich gedeckten Tisch und assen eines unserer Kaninchen auf, dem Vater das Fell über die Ohren gezogen hatte.
Wir löffelten Fleischsuppe und schielten nach dem Markbein, das auf Vaters Teller lag. Oder wir erhielten ein Stück vom gespickten Rindsbraten, aber nur an besonderen Festtagen.
Das festlichste Angebot aus Mutters Küche aber war und blieb der gefüllte Kabis. Er stand zwar offiziell nicht so hoch im Kurs wie Schweins- und Rindsbraten, da der Kohl aus unserem Garten stammte und das Hackfleisch billig zu haben war. Aber unter Mutters Händen, das haben wir Kinder gemerkt, wurde der Kabis zum Kunstwerk. Sie hat als Erstes ein Kopftuch über ihr eigenes Haupt gelegt, damit kein Haar herunterfiel. Dann hat sie den Kohl entblättert, sorgfältig Blatt um Blatt abgetrennt und auseinandergelegt, bis nur noch das gelbliche Herz da war. Das hat sie beiseitegelegt für die Suppe. Sie hat die Blätter gewaschen, damit weder Raupe noch Schnecke, noch Käfer, noch sonst ein gemeiner Schädling sich einschleichen konnte. Sie hat die dicken Storzen flachgeschnitten und die Blätter in Salzwasser kurz abgekocht. Dann hat sie eine Schüssel in der Grösse des ursprünglichen Kabiskopfes mit den Blättern ausgekleidet, und zwar so, dass die grossen äusseren Blätter mit den Storzen den Schüsselrand überlappten.
Nun hat sie sich an die Fleischfüllung gemacht. Ein Pfund Gehacktes, vermischt mit Zwiebel und Peterli, mit einem in heisser Milch eingeweichten Stück Weissbrot. Salz und Muskat, Pfeffer hatten wir keinen, der galt als obszön. Dieses Gemisch hat sie mit einer Gabel zerdrückt und geknetet, als wäre sie ein spielendes Kind. Geredet hat sie nicht dabei, es galt die volle Konzentration. Mit einem Löffel hat sie diesen Brei in die Mitte der wartenden Kabisblätter gelegt und geschaut, dass sich kein Blatt von der Stelle wegbewegt hat, die sie ihm zugedacht hatte. Die restlichen Blätter, die kleineren, hat sie
darübergelegt und die Storzen darübergedrückt. Diesen Kopf hat sie in eine Pfanne gestürzt, so dass alles an seiner Stelle blieb und festhielt, eine vollendete, wohlgeformte Kugel. Den Sud der Kohlblätter hat sie dazugegossen und alles eine Stunde lang schmoren lassen.
So ist das auf den Tisch gekommen, herrlich duftend, saftig, kräftig, nicht nur für Nase und Gaumen eine Wonne, auch fürs Auge ein Glück. Ein Stück Schönheit mitten auf unserem Tisch. Sie war jedes Mal stolz auf ihr Werk, das haben wir alle gesehen, wir waren stolz auf sie.
Das Kunstwerk ist dann sehr schnell zerstört und einverleibt worden, Eat-Art der klassischen, ländlichen Art. Mutter hat das Brotmesser angesetzt (es war unser schärfstes) und die Kugel von der Mitte aus in mehrere, sternförmig auslaufende Teile aufgeschnitten. Jedem von uns hat sie einen Schnitz auf den Teller gelegt und Sauce darübergegossen. Als Beilage hat es immer Salzkartoffeln gegeben, die man mit der Gabel im Sud zerdrücken konnte. So haben wir uns die Sonnenkugel, die aus unserem Garten kam, den Vollmond, der über unser Dach hinging, einverleibt.
Seit rund vier Jahrzehnten wohne ich vorwiegend in Städten. Ich ernähre mich ohne Bedacht, ich esse, was mir am bequemsten erreichbar ist. Einen Gemüsegarten besitze ich nicht, Kohlweisslinge bevölkern höchstens noch meine Träume. Kochen halte ich längst nicht mehr für eine Frauenarbeit, ich kann es auch. Aber einen gefüllten Kabis habe ich noch nie gemacht. Es fehlt mir die Geduld dazu, es fehlt mir die Genauigkeit, die Hingabe.
Im Moment lebe ich in einem Quartier, in dem viele Leute aus der Türkei wohnen. Es gibt türkische Läden, und die bieten mächtige Kabisköpfe an.
Fünf Kilo schwer sind die wohl, mit fast weissen Blättern. Mächtige Häupter aus der türkischen Heimat, die in der Lage sind, eine ganze Sippe mit Grossmutter und Onkel und alter, zahnloser Base und Kindern und Enkelinnen und Neffen zu ernähren.
Ich habe mich schon mehrmals ertappt, wenn ich daran vorbeiging, wie ich überlegt habe, einen solchen Kohlkopf zu kaufen und heimzutragen in Erwartung einer grossen Familie. Nur, was soll ich damit in meiner Dreizimmerwohnung?
Dieser Text erschien im Band «Die Eule über dem Rhein» im Diogenes Verlag Zürich 2021.

HANSJÖRG SCHNEIDER, geboren 1938 in Aarau, arbeitete als Lehrer und als Journalist. Mit seinen Theaterstücken, darunter «Sennentuntschi» und «Der liebe Augustin», war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine «Hunkeler»-Krimis führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel.

























Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.
Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich. Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang





Surprise verlost in Kooperation mit Toggenburger Naturseifen 8× tolle Preise im Gesamtwert von über CHF 150.–. Finden Sie das Lösungswort und schicken Sie es zusammen mit Ihrer Postadresse an info@surprise.ngo (Betreff «Rätsel 579») oder an Surprise, Münzgasse 16, 4051 Basel. Tipp: Das gesuchte Wort kommt in einem der Texte dieser Ausgabe vor. Einsendeschluss ist der 29. August 2024. Wir wünschen viel Spass beim Rätseln und viel Glück!
Die Gewinner*innen werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Ihre Adressdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und ausschliesslich von Surprise für Marketingzwecke verwendet.


Die Toggenburger Naturseifen sind Julia, Astrid und Angela Nigg: Ein kleines Familienunternehmen, das seit bald 20 Jahren kaltgerührte Naturseifen und weitere naturkosmetische Produkte herstellt.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Anyweb AG, Zürich
Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich
Gemeinnützige Frauen Aarau
Gemeinnütziger Frauenverein Nidau
Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti
Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
Beat Hübscher - Schreiner, Zürich
KMS AG, Kriens
Brother (Schweiz) AG, Dättwil
Coop Genossenschaft www.wuillemin-beratung.ch
Stoll Immobilientreuhand AG movaplan GmbH, Baden
Maya Recordings, Oberstammheim
Madlen Blösch, Geld & so, Basel onlineKarma.ch / Marketing mit Wirkung Scherrer + Partner GmbH www.dp-immobilienberatung.ch
Kaiser Software GmbH, Bern
Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Heller IT + Treuhand GmbH, Tenniken
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Bodyalarm GmbH – time for a massage Fäh & Stalder GmbH, Muttenz Hypnose Punkt, Jegenstorf
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung. Kontakt:
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?
Eine von vielen Geschichten
Josiane Graner, Juristin, wurde in ihrem Leben von schweren Schicksalsschlägen getroffen. Sie kämpft und steht immer wieder auf. Ein Geschäftsprojekt, das sich zum Flop entwickelte, führte sie 2010 zu Surprise. Ihr Geschäftspartner hatte sich ins Ausland abgesetzt und sie mit dem Schuldenberg allein gelassen. Um ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten, verkauft Josiane Graner in Basel das Strassenmagazin. Zudem ist sie für den Aboversand zuständig. Dank des SurPlus-Programms erhält sie ein ÖVAbonnement und Ferientaggeld. Diese Zusatzunterstützung verschafft der langjährigen Surprise-Verkäuferin etwas mehr Flexibilität im knappen Budget.
Das Programm Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus
Unterstützen Sie das SurPlus-Programm mit einer nachhaltigen Spende
Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.
Spendenkonto:
Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
· ½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
· 1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!
#575: «Nachwuchsautor» «Habegger fasziniert»
Im Surprise habe ich mit gesteigertem Interesse den Artikel über Urs Habegger und sein Buch – Am Rande mittendrin –gelesen. Seine Haltung gegenüber sich selbst und seinen Mitmenschen fasziniert. Ebenso ein Gespräch mit Habegger in einer SRF2-Kultursendung. Und jetzt das Lesen seines Buches. Ich bin beeindruckt.
NELLI METTLER, Cham
#Stadtrundgänge Bern mit Roger Meier «Es sollte eine Pflicht sein»
Roger Meier hat den Mitarbeitenden vom ewb die Augen und gleichzeitig das Herz geöffnet. Es ist schier unglaublich, was er alles erlebt hat und wie er gekämpft hat, um mindestens einigermassen erträgliche Lebensbedingungen zu haben. Die Geschichten sind berührend und zeigen, dass es Leben fernab von Luxus und Liebe gibt. Es sollte für alle Berner*innem Pflicht sein, eure Touren zu besuchen. Macht bitte weiter und erzählt Geschichten wie die von Roger Meier weitere x-1000-mal, denn Bern und die Welt haben das nötiger denn je.
DANIEL STAUFFENEGGER, Bern
Impressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe: Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea), Sara Winter Sayilir (win) T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Lena Bühlmann, Paula Carson, Migmar Dolma, Melanie Grauer, Christina Hug, Andrea Keller, Ralf Schlatter, Hansjörg Schneider, Paul Shawdover, Azad Şîmmo, Christoph Simon
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage 24 600
Abonnemente CHF 250.–, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt. IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
#576: Aufgelesen «Unsinnig»
Achtzig Straftaten von rechts gegen Geflüchtete. In welchem Zeitraum, das darf der*die Leser*in nicht erfahren. Wie kann er*sie sich dann ein Bild machen?
Achtzig Straftaten, in welchem Zeitraum auch immer, das ist zu viel. Sechzig wäre besser. Vierzig wäre normal. Wird jetzt jedem klar, dass dieser Artikel unsinnig ist?
Fazit: Eine einzige Straftat ist schon zu viel.
FARINA HIROSHIGE, Basel
#Stadtrundgänge Zürich mit Hans-Peter Meier «Eloquent erzählt»
Es war sehr informativ, gefallen haben mir auch die historischen Verknüpfungen beispielsweise zu der Seegfrörni und dem Bunker auf der Strecke. Alles wurde sehr eloquent erzählt, mal witzig, mal informativ und sehr authentisch.
RAHEL EL-MAAWI, Zürich
Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.
25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)
Gönner-Abo für CHF 320.–
Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)
Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–
Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.
Bestellen
Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90
Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel
Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo
Internationales Verkäufer*innen-Porträt
«Ich bin in Jamaika geboren, meine Familiemitglieder waren alle Sklaven, was uns sehr geprägt hat. Tante Gloria ist die Matriarchin unserer Grossfamilie, sie führt einen Stammbaum mit allen Vorfahren. Zugleich sammelt sie die Geschichten unserer Familienmitglieder, die voller Mut und Hoffnung sind. Ich spreche immer noch regelmässig mit meiner Tante – sie ist inzwischen fast neunzig –, was mir sehr wichtig ist, weil das die Verbindung zu unserer gemeinsamen Vergangenheit stärkt.
Aufgewachsen bin ich in Toronto, wo ich auch zur Schule ging. Schon früh habe ich einen subtilen Rassismus wahrgenommen, den ich allerdings immer mit – ebenfalls rassistischen –Witzen gekontert habe. Das war meine Strategie, damit umzugehen. Ich war erst bei den Pfadfindern und dann beim Militär, bevor ich eine Reihe von Jobs hatte. Allerdings fühlte ich mich nie richtig wohl. Ich begann, die Leute um mich herum zu meiden und mich allmählich zu entfremden.
Und so habe ich mich nach einem alternativen Lebensstil umgeschaut. Auf diesem Weg zog ich Mitte der 1990er-Jahre von Toronto nach Vancouver, wo es deutlich wärmer ist. Hier nahm ich mal diesen, mal jenen Job an. Nachdem ich ein Jahrzehnt dort gelebt hatte, ohne wirklich weiterzukommen, verlor ich den Mut – und fiel durch alle Maschen.
Bekannte von mir, die meisten von ihnen sind ebenfalls Schwarz, redeten mir ein, ich solle mich nicht gehen lassen, mir eine ordentliche Arbeit suchen und nicht auf dem Rücken anderer leben. Sie wurden für mich zu Vorbildern, denn sie schauten nicht nur zu sich, sondern öffneten viele Türen auch für andere Schwarze. Zu jener Zeit begann ich für gemeinnützige Organisationen zu arbeiten. Bis heute versuche auch ich, einen positiven Einfluss auf die junge Schwarze Generation auszuüben und sie zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen.
Seit nunmehr sechs Jahren verkaufe ich die Strassenzeitung Megaphone. Ich bin sehr froh um die Mitarbeiter*innen und die Art und Weise, wie sie mich mit Respekt und Anstand behandeln; sie anerkennen die Arbeit, die ich leiste, was mir sehr wichtig ist. Die Menschen hinter Megaphone kümmern sich wirklich sehr um ihre Verkäufer*innen und deren Wohlbefinden. Das hat sich in vielerlei Hinsicht positiv auf mich ausgewirkt. Früher habe ich in der Gesellschaft nicht viel gezählt, ich wurde schief angesehen. Jetzt schauen die Leute zu mir auf, denn sie wissen, dass ich zuverlässig bin und hart arbeite – und auch, dass mir die Gemeinschaft am Herzen liegt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass sich die Leute die Mühe machen, mit mir über alles zu reden: über das Leben, die Arbeit oder auch über mich selbst, wenn es mir einmal nicht so gut geht.
Einer der Gründe, wieso ich gerne in Kanada lebe, besteht darin, dass die Kanadier*innen einen ausgeprägten Gemein-


Der gebürtige Jamaikaner Paul Shawdover, 46, verkauft in Vancouver die Strassenzeitung Megaphone und hat im Laufe seines Lebens gelernt, auf die Geschichte und Tradition seiner Vorfahren stolz zu sein.
schaftssinn haben und hart daran arbeiten, die rassistischen Spannungen abzubauen, mit denen wir Schwarze hier konfrontiert sind. Heute bin ich stolz darauf, ein Schwarzer jamaikanischer Kanadier zu sein. Ich schätze die Werte und die Tradition, die ich meinen Vorfahren verdanke, sowie den Lebensstil, den ich mir inzwischen erarbeitet habe –und natürlich all die wunderbaren Menschen, die ich bisher getroffen habe und mich positiv beeinflusst haben. Ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie mich nach Kanada gebracht hat. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich in Jamaika geblieben wäre.
Und dann ist da noch dieser entzückende Kater, sein Name ist Megalove. Er bringt jeden Tag Freude in mein Leben und schenkt mir ein glückliches Lächeln, das ich mit anderen teilen kann.»
Aufgezeichnet von PAUL SHAWDOVER
Mit freundlicher Genehmigung von MEGAPHONE / INTERNATIONAL NETWORK OF STREET PAPERS
BETEILIGTE CAFÉS
IN AARAU Naturama Aargau, Feerstr. 17 | the green corner, Rain 27 IN ALSTÄTTEN Familien- und Begegnungszentrum Reburg, Rathausplatz 1 Zwischennutzung Gärtnerei, Schöntalstr. 5a IN ARLESHEIM Café Einzigartig, Ermittagestr. 2 IN BAAR Elefant, Dorfstr. 1 IN BACHENBÜLACH Kafi Linde, Bachstr. 10 IN BASEL Bäckerei KULT, Riehentorstr. 18 & Elsässerstr. 43 | BackwarenOutlet, Güterstr. 120 | Barista Bar Basel, Schneidergasse 16 | Bioladen Feigenbaum, Wielandplatz 8 | Bohemia, Dornacherstr. 255 | Café Spalentor, Missionsstr. 1 | Didi Offensiv, Erasmusplatz 12 | Eiscafé Acero, Mörsbergerstr. 2 Elisabethen, Elisabethenstr. 14 | FAZ Gundeli, Dornacherstr. 192 | Flore, Klybeckstr. 5 | frühling, Klybeckstr. 69 | Haltestelle, Gempenstr. 5 | HausBAR Markthalle, Steinentorberg 20 | KLARA, Clarastr. 13 | L’Ultimo Bacio Gundeli, Güterstr. 199 | Oetlinger Buvette, Unterer Rheinweg | Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen, Im Rheinacker 15 | Quartiertreff Kleinhüningen, Kleinhüningerstr. 205 | Quartiertreff Lola, Lothringerstr. 63 | Shöp, Gärtnerstr. 46 | Tellplatz 3, Tellplatz 3 Treffpunkt Breite, Zürcherstr. 149 | Wirth’s Huus, Colmarerstr. 10 IN BERN Äss-Bar, Marktgasse 19 | Becanto, Bethlehemstr. 183 | Boulderbad Muubeeri, Maulbeerstrasse 14 | Brasserie Lorraine, Quartiergasse 17 | Burgunderbar, Speichergasse 15 | Café Kairo, Dammweg 43 | Café Paulus, Freiestr. 20 | DOCK8, Holligerhof 8 | Dreigänger, Waldeggstr. 27 | Generationenhaus, Bahnhofplatz 2 | Hallers brasserie, Hallerstr. 33 | Kinderkiosk, Monbijoupark | Lehrerzimmer, Waisenhausplatz 30 | LoLa, Lorrainestr. 23 | Löscher, Viktoriastr. 70 | Luna Lena, Scheibenstr. 39 | MARTA, Kramgasse 8 | MondiaL, Eymattstr. 2b Phil’s Coffee to go, Standstr. 34 | Rösterei, Güterstr. 6 | Sous le Pont, Neubrückstr. 8 | Treffpunkt Azzurro, Lindenrain 5 | Tscharni, Waldmannstr. 17a IN BIEL Äss-Bar, Rue du Marché 27 | Genusskrämerei, Rathausgässli 4 | Inizio, Freiestrasse 2 | Treffpunkt Perron bleu, Florastrasse 32 IN BURGDORF Bohnenrad, Bahnhofplatz & Kronenplatz | KafiFritz, mobiles Kaffee-Dreirad | Specht, Hofstatt 5 IN CHUR Loë, Loestr. 161 IN DIETIKON Mis Kaffi, Bremgartnerstr. 3a IN FRAUENFELD Be You Café, Lindenstr. 8 IN HAUSEN AM ALBIS Café Palaver, Törlenmatt 1 IN LENZBURG Chlistadt Kafi, Aavorstadt 40 | feines Kleines, Rathausgasse 18 IN LIESTAL Bistro im Jurtensommer, Rheinstr. 20b IN LUZERN Arlecchino, Habsburgerstr. 23 | Bistro Vogelgärtli, Sempacherstr. 10 | Blend Teehaus, Furrengasse 7 | Jazzkantine zum Graben, Grabenstr. 8 | Markt Wärchbrogg, Alpenquai 4 & Baselstr. 66 | Meyer Kulturbeiz & Mairübe, Bundesplatz 3 Netzwerk Neubad, Bireggstr. 36 | Pastarazzi, Hirschengraben 13 | Rest. Wärchbrogg, Alpenquai 4 | Sommerbad Volière, Inseliquai IN MÜNCHENSTEIN Bücher- und Musikbörse, Emil-Frey-Str. 159 IN NIEDERDORF Märtkaffi am Fritigmärt IN OBERRIEDEN Strandbad Oberrieden, Seestr. 47 IN OBERWIL IM SIMMENTAL Gasthaus Rossberg, Rossberg 557 IN SCHAFFHAUSEN Kammgarn-Beiz, Baumgartenstr. 19 IN SISSACH Cheesmeyer, Hauptstrasse 55 IN STEFFISBURG Offenes Höchhus, Höchhusweg 17 IN STEIN AM RHEIN Raum 18, Kaltenbacherstr. 18 IN ST. GALLEN S’Kafi, Langgasse 11 IN SUHR Alter Konsum, Bachstrasse 72 IN UEKEN Marco’s Dorfladen, Hauptstr. 26 IN UETIKON AM SEE Fridies Cafi-Bar, Weingartenstrasse 1 IN USTER al gusto, Zürichstrasse 30 Kafi Domino, Gerbestrasse 8 IN WIL Caritas Markt, Ob. Bahnhofstr. 27 IN WINTERTHUR Bistro Sein, Industriestr. 1 IN ZOLLIKOFEN Café Mondial, Bernstrasse 178 IN ZUG Bauhütte, Kirchenstr. 9 | Podium 41, Chamerstr. 41 IN ZÜRICH Barista Bar Sihlpost, Kasernenstrasse 97 | Bistro Karl der Grosse, Kirchgasse 14 | Café Noir, Neugasse 33 | Café Zähringer, Zähringerplatz 11 | Cevi Zürich, Sihlstr. 33 | das GLEIS, Zollstr. 121 | Flussbad Unterer Letten, Wasserwerkstr. 141 | Freud, Schaffhauserstr. 118 | GZ Bachwiesen, Bachwiesenstr. 40 | GZ Wipkingen, Breitensteinstr. 19a | GZ Witikon, Witikonerstr. 405 jenseits im Viadukt, Viaduktstr. 65 | Kiosk Sihlhölzlipark, Manessestr. 51 | Kleinwäscherei, Neue Hard 12 | Kumo6, Bucheggplatz 4a | Quartiertr. Enge, Gablerstr. 20 | Quartierzentr. Schütze, Heinrichstr. 238 | Sport Bar Cafeteria, Kanzleistr. 76 | Täglichbrot, Friesenbergplatz 5 | Zum guten Heinrich Bistro, Birmensdorferstr. 431
Weitere Informationen: surprise.ngo/cafesurprise

Der Verkauf des Strassenmagazins Surprise ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, einer
Arbeit nachzugehen und den sozialen Anschluss wiederzufinden.
Alle

Ein
Strassenmagazin kostet Franken.
Die Hälfte davon geht an den*die Verkäufer*in, die andere Hälfte an den Verein Surprise.

Das Heft erscheint alle 2 Wochen. Ältere Ausgaben werden nicht verkauft.
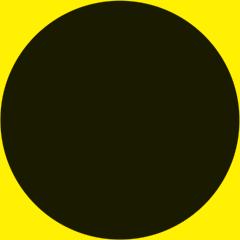
Verkäufer*innen tragen gut sichtbar einen Verkaufspass mit einer persönlichen Verkaufsnummer. Diese ist identisch mit der Nummer auf dem Magazin.


























info@surprise.ngo





































