
Literatur
Sebastian Steffen
Nelio Biedermann
Ingo Petz
Yael Inokai
Alice Grünfelder
Milena Moser
Dmitrij Gawrisch

Dreiecksgespann, eine Nachbarschaft und ein Schacht voller Geld Nach einer wahren Begebenheit







Literatur
Sebastian Steffen
Nelio Biedermann
Ingo Petz
Yael Inokai
Alice Grünfelder
Milena Moser
Dmitrij Gawrisch

Dreiecksgespann, eine Nachbarschaft und ein Schacht voller Geld Nach einer wahren Begebenheit





Im letzten Heft haben wir durchgeatmet. Jetzt hauen wir ab. Das kann heissen: einfach verschwinden. Oder sich aus etwas befreien. Mutig sein. Es kann aber auch heissen: unter Druck stehen. Abhauen müssen, um sich zu retten. Um zu überleben.
Dies und noch viel mehr spielen die Autor*innen durch, die wir für diese Ausgabe nach ihren Geschichten gefragt haben. Und so geht es bei Sebastian Steffen ums Eingeengtsein im Paarhaushalt (ein Beziehungsgeknorze ist das, in dem sich zwei aneinander, aber ebenso an den klassischen Mann-Frau-Rollen reiben).
Bei Alice Grünfelder geht es ums Abhauen aus Verhältnissen, die einen erdrücken, und bei Ingo Petz um ein Lebensgefühl, das wir vielleicht alle irgendwie kennen, dem der Autor in seinem Leben aber offensichtlich immer konsequent nachgegangen ist.
Dann, zweimal Abhauen aus seinem Leben. Bei Dmitrij Gawrisch stossen wir auf eine fast schon Max Frisch’sche Flucht vor der eigenen
Identität, bei Nelio Biedermann wird es existenzialistisch: Und die Frage steht im Raum (am Strand, bei den Möwen), wer mehr Recht dazu hat, sich davonzustehlen – der ungestüme Junge oder der angeschlagene Alte.
Bei Milena Moser geht es ums Ausbrechen aus der Mutterrolle und einem pfannenfertigen Leben. Und bei Yael Inokai um zwei, die abgehauen sind und die die Vergangenheit doch nicht loslässt.
Illustriert wurde alles von Nando von Arb, der letztes Jahr die Graphic Novel «Fürchten lernen» herausgebracht hat. Und ja, auch vor der Furcht sollte man einfach so abhauen können.
Wir bedanken uns herzlich bei Sebastian Steffen, Nelio Biedermann, Ingo Petz, Yael Inokai, Alice Grünfelder, Milena Moser und Dmitrij Gawrisch für die Texte und die schöne Zusammenarbeit.

Illustrationen

Nando von Arb lebt in Zürich. Für seinen Comic «Drei Väter» (2019) erhielt er den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis, für «Fürchten lernen» (2023) den Max-und-Moritz-Preis und die kulturelle Auszeichnung der Stadt Zürich.
5 Sebastian Steffen Abhauen
8 Nelio Biedermann Anton und der Existenzialist
10 Ingo Petz Im Kartoffelkeller der Sehnsucht
12 Yael Inokai Der Anständige
18 Alice Grünfelder Ein Unstern klebt am Himmel
20 Milena Moser Nicht wirklich. Nicht ganz.
23 Dmitrij Gawrisch In Montana wachsen keine Sukkulenten
27 Rätsel
28 SurPlus Positive Firmen
29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren
30 Internationales Verkäufer*innen-Porträt «Ich habe viel gelernt»

Sie atmet tief aus und ein.
Manchmal schnarcht sie heute nicht.
Es ist ein oder zwei Uhr.
TEXT SEBASTIAN STEFFEN
Ich denke daran, wie ich ihr morgen sagen werde, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, und sie wird sagen:
«Ich habe auch nicht gut geschlafen.»
«Von wegen.»
«Du hast geschlafen, als ich um eins auf die Toilette ging!»
Und ich werde sagen, dass ich nur so getan habe, als würde ich schlafen, damit sie nicht anfange, mit mir zu reden.
«Wenn das so ist, sollten wir in Zukunft vielleicht in separaten Zimmern nächtigen, in separaten Häusern, in einer separaten Stadt, vielleicht kannst du dann ja besser schlafen.»
Und ich werde abwinken:
«Nur ein Witz.»
Und sie wird mir diesen Blick schenken: «Stirb.»
So oder so ähnlich wird das ablaufen.
Oder nein, wir streiten uns wegen dem Haushalt.
Ein Klassiker:
Sie kommt mit dem Staubsauger im Schlepptau daher:
«Wir müssen putzen.»
Während ich gerade lese, zum Beispiel Effi Briest.
«Ernsthaft?»
Werde ich sie fragen.
«Ich lese gerade Effi Briest.»
«Ja, schau dir doch mal den Boden an, der sieht aus wie Sau!»
«Letzte Woche habe ich die ganze Wohnung geputzt, sogar das WC.»
«WC? Du hast in deinem ganzen Leben noch kein WC geputzt!»
Was überhaupt nicht stimmt.
Auf der Arbeit muss ich ständig WCs putzen!
Rosa Lappen: Waschbecken.
Gelber Lappen:
WC.
Den Boden mit Javelwasser.
Ich weiss genau, wie Putzen geht!
Ich putze genauso oft wie sie.
Vielleicht sogar mehr.
Bloss merke ich mir, im Gegensatz zu ihr, nicht jeden Handgriff, den ich fürs Kollektiv mache.
Überhaupt typisch! Immer wenn ich etwas mache, was nichts mit ihr oder der Wohnung zu tun hat, dieselbe Szene.
Und so werde ich ihr das auch ins Gesicht sagen:
«Du erdrückst mich!»
«Ich erdrücke dich? Deine Welt ist so simpel. Ich möchte vielleicht auch einfach mal nichts machen und ein bisschen lesen. Nur kann ich mich im Gegensatz zu dir in so einem Chaos einfach nicht entspannen!»
Spätestens jetzt werde ich richtig laut:
«Du willst also, dass ich putze?»
Und sie wird noch lauter:
«Ja, verdammt!»
Also reisse ich ihr den Staubsauger aus der Hand.
Logisch!
Und sie nennt mich verhaltensgestört.
Verhaltensgestört?
Ich, der ich einfach friedlich mit meiner Lektüre den Morgen verbringen wollte, bin jetzt also der Verhaltensgestörte?
Jaja …
Aber jetzt muss sie selber damit klarkommen, dass sie mir den Fontane verdorben hat.
Ich werde also putzen.
Gründlich, sogar die Fugen.
Das WC.
Den Flur.
Das Wohnzimmer.
Und sie?
Sie macht nichts!
Steht auf dem Balkon, raucht eine Zigarette und blättert in meinem Fontane herum.
Ich schwöre, das wird das letzte Mal sein, dass sie mich derart manipulieren wird!
Aber ich bleibe ruhig.
Respektive: Ich werde ruhig bleiben.
Überhaupt! Lange wütend bin ich nie.
Ist doch schön, wenn alles so sauber glänzt.
Und schon aus taktischen Gründen ist es klüger, wenn sie mich die ganze Arbeit alleine machen lässt.
Dann muss sie für den Rest des Tages nett zu mir sein und zweitens:
Das nächste Mal ist sie dran!
Ich mache keinen Strich.
Hebe höchstens die Füsse, den Fontane auf den Knien, während sie den Boden unter mir wischt.
Jawohl!
Aber zuerst, quasi als finales Martyrium, gehe ich nach dem Putzen zu ihr und frage sie, ob sie auch Hunger hat.
«Aber nicht schon wieder Pizza?!»
«Wer redet von Pizza?»
«Ich kenne dich.»
«Habe ich gesagt Pizza?»
«Ich kenne dich: Käse, Fleisch, Tomatensauce, wo bleibt das Gemüse?»
Und ich völlig perplex, dass sie anscheinend bereits damit gerechnet haben wird, dass ich, nach dem ganzen Scheiss, den ich diesen Morgen wegen ihr durchgemacht haben werde, dass ich jetzt auch noch für sie koche:
«Dann koch doch selber du …»
«Aber Schatz.»
Wird sie jetzt sagen:
«Schatz, wir können doch nicht immer alles wegwerfen, denk mal an Greta.»
Scheisse ja, Greta, natürlich hat sie recht!
Wir haben noch Lachs, der bald abläuft, Rahm, der bald abläuft, Lauch.
Ja, dann gibt es halt Nudeln. Gott, wird das lecker.
Mein Vater war Koch.
Ich weiss genau, wie Kochen geht. Handgelenk mal Pi, Weisswein, und wenn alles schiefgeht Tabasco, Aromat und Maggi. Doch sie wird in ihrem Teller herumstochern wie ein verwöhntes Kind.
«Alles gut?»
«Alles gut!»
«Dann ist ja gut»
«Die Sauce ist super Schatz, nur die Nudeln sind etwas zu al dente.»
Im Ernst.
Dabei war sie es doch!
Sie wollte unbedingt diese Nudeln haben.
Diese Marktnudeln.
Dieser überteuerte, nach Karton riechende Bärlauchdreck.
Und von wegen Bio:
Kupfer macht den Boden kaputt.
Von wegen artgerecht: Was ist mit dem biozertifizierten Bauernhof, von dem ich dieser Tage gelesen habe? Kühe auf engstem Raum bis zu den Knien im Dreck stehend, aber nichts passiert, der Typ vom Kontrollamt lässt sich einfach einen Schnaps zahlen, und alles ist gut!
Aber ich bleibe ruhig.
Respektive ich werde ruhig bleiben.
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung.
Eine ehrliche Rückmeldung ist Gold wert und aus einer schlechten Kritik lernst du mehr als aus einer guten.
Ausserdem hat sie mir vorhin während gut 17 Minuten den Rücken gekrault.
Gott, ich kenne niemanden, der so gut kraulen kann wie sie.
Fast wie früher die Mama.
«Ich hab dich gern!»
«Und ich dich.»
«Du bist mein Lieblingsmensch.»
«Und du meiner.»
«Ich glaube nicht, dass du mich so sehr liebst wie ich dich.»
«Ich liebe dich immer einmal mehr als du mich.»
«Das ist gar nicht möglich.»
«Oh doch.»
«Gut, dann liebe ich dich immer zweimal mehr als du mich.»
«Und ich dich dreimal.»
«Viermal.»
«Einhundertmal Spiegel.»
«Ok. Und ich liebe dich immer EinhundertMillionenmal mehr als du mich. Doppelspiegel und Bäm!»
«Gute Nacht.»
«Gute Nacht.»
Und plötzlich hatten wir Streit.
Es ging um den Tisch von meinem Opa.
Familienerbstück.
Man kann doch nicht immer alles wegwerfen, nur weil es angeblich die Wohnung verdunkelt. Überhaupt.
Der Tisch kann nichts dafür, dass sie in diese Wohnung ziehen wollte.
Wir hatten so eine super Wohnung.
Mitten im Zentrum, nette Nachbarn.
Es lag nicht am fehlenden Zimmer.
So macht sie das jedes Mal.
Zuerst mein Bücherregal.
Die Bongos.
Das Sofa.
Der Gummibaum und jetzt auch noch der Tisch von meinem Opa.
«Was kommt als Nächstes?»
Habe ich sie gefragt.
«Die Gitarre? Der Kaktus? Oder machst du endlich Nägel mit Köpfen und trennst dich direkt?»
So habe ich sie das gefragt.
Doch anstelle mir wie üblich zu sagen, dass ich nicht immer alles so persönlich nehmen soll, war es plötzlich still.
Mucksmäuschenstill.
Unangenehm still.
Und als ich schon beinahe bereit gewesen wäre einzuknicken, in der Sache mit dem Tisch, redete sie plötzlich von der Öffnung unserer Beziehung.
Als hätte unsere Beziehung nen Deckel …
Keine fünf Minuten vorm Einschlafen.
Sie fühle sich so leer, so festgefahren. Vielleicht sei sie einfach noch zu jung für ein derart ernsthaftes Leben:
«Du nicht auch?»
Sagt es, schläft ein, und wie sie jetzt zwei Stunden später auf Toilette geht, liege ich immer noch wach.
Die Spülung, sie trampelt ins Wohnzimmer, überall Licht.
Lässt den Fernseher an.
Und ich liege wach.
Schon seit Stunden.
Schon seit Stunden spiele ich mit dem Gedanken, aufzustehen und fernzusehen, doch ich tat es nicht, weil ich sie nicht wecken wollte.
Egal, ich bleibe ruhig.
Und wenn sie zurückkommt, schlafe ich wie ein Stein. Ha! Das wird sie fertigmachen: «Schläfst du?»
Keine Antwort. «Schatz?»
Vergiss es!
Ich werde unerbittlich sein.
Keine so einfache Aufgabe, wenn du schon so lange zusammen bist wie wir zwei, acht Jahre …
Nach acht Jahren will sie jetzt also einfach den Deckel heben und schauen, wie viel Platz es noch hat.
Warum auch nicht?
Mir fallen da schon ein paar Namen ein, Haare und Beine. Nicht dass ich mit ihr über so etwas reden würde, viel zu heikel. Entweder bist du dir hoch und heilig oder xbeliebig, und solange wir im gleichen Bett schlafen, bekommt sie auch nichts anderes von mir zu hören.
Gut! Los!
Einschlafen!
Jetzt!
Du schaffst das.
Konzentration.
Augen zu.
OzeanAtmung: 123. 321.
Denke an früher.
Auf dem Scheunendach hast du gesessen. Rund unter dir das Flachland.
Der Jura.
Weisst du noch?
Du hast dich gefragt, ob man sich auch so fühlt, wenn man vor dem Meer steht: unbedeutend, klein und doch zentral.
Zentral unbedeutend, so richtig winzig.
Die Wellen kommen auf dich zu.
Gehen wieder weg.
Ziehen sich zurück.
Und schon schläfst du.
Du schläfst!
Du träumst!
Du träumst von Tropfen. Tropfen, die auf dich tropfen. Genau.
Oder Schneeflocken. Schafwolle.
Samt Schafen und Weihnachtssternen.
Du schwebst im Raum, rund um die Möbel. Schwerelos.
Wie im Weltall.
Planeten.
Der Mond.
Eine Motorsäge …
Sie ist zurück.
Wälzt sich über die Matratze wie eine Irre.
«Schläfst du?»
«Nein.»
«Schon die ganze Nacht kann ich nicht schlafen.»
«Ich auch nicht.»
«Vorhin hast du geschlafen, als ich auf die Toilette ging.»
«Ich habe nur so getan!»
«Aber sicher doch.»
«Doch, ich habe nur so getan.»
«Du hast flach geatmet.»
«Ja, und?»
«Das kannst du nicht vortäuschen!»
«Glaub mir, ich kann es!»
«Schon komisch, dass du nach so einem Streit einfach einschläfst!»
«Ich bin nicht Derjenige, der eingeschlafen ist!»
«Das ist doch lächerlich.»
«Du bist lächerlich!»
«Und du kindisch.»
Gleich wird sie mir sagen, dass es Dinge gäbe, welche man ausdiskutieren müsse.
Dabei geht es doch gar nicht darum, was sie gesagt hat, sondern wie sie es gesagt hat.
Ganz beiläufig.
Schieb mir mal das Salz rüber Schatz ich will unsere Beziehung würzen.
Klar doch!
Warum auch nicht.
Diskutieren wir das Ganze aus.
«An wen hast du dabei gedacht? Jemanden Bestimmtes?
Oder einfach grundsätzlich? Wie wäre es mit dem Nachbarn?
Oder dem vom Yoga?»
Sie tut, als würde sie schlafen.
Von wegen!
Da kann sie noch lange flach atmen.
Unglaubwürdig!
«Der vom Yoga?»
Keine Antwort.
Der vom Yoga also.
Ich wusste es.

SEBASTIAN STEFFEN, Jahrgang 1984, geboren und aufgewachsen im Kanton Bern, lebt in Biel. Arbeit als Möchtegern-Spengler, Ziegenhirt, Landschaftsgärtner, Betreuer und Unterstützungslehrperson. Studium am Schweizerischen Literaturinstitut. Im Verlag die brotsuppe sind erschienen: «leg di aschtändig a» (2018) und «Aschtronaut unger em Miuchglasdach | Astronaut unter dem Milchglasdach» (2019). 2024 zählt Steffen zu den Preisträger*innen des Literaturpreises des Kantons Bern für sein Buch «i wett i chönt franzöisch» (Verlag Der gesunde Menschenversand, 2023).

TEXT NELIO BIEDERMANN
Anton und der Junge begegneten sich zum ersten Mal während eines Strandspaziergangs einige Tage nach Antons Ankunft in Labnitz. Der Junge sass auf einer Sandsteinklippe über dem Strand und warf Steine nach den Möwen, die in der Luft zu kleben schienen. Anton blieb unten am Strand stehen und blickte, die Hand über die Augen gelegt, zu dem Jungen und den Möwen hinauf. «Scheissviecher!», rief der Junge. «Schweben den ganzen Tag in der Luft, nur um sich über uns lustig zu machen.»
Der Junge hatte schwarzes, lockiges Haar, feine Gesichtszüge und eine schlaksige Figur. Er trug eine schwarze Anzugshose, die ihm um die schmalen Knöchel schlug, das schwarze Sakko hatte er sich über die Schulter gelegt. Als er in einem Anfall sinnloser Wut aufsprang, um einen weiteren Stein nach einer Möwe zu schleudern, flatterte die dünne schwarze Krawatte im Wind. Er lachte auf einmal und liess eine grosse Zahnlücke aufblitzen.
«Tut mir leid, ich habe mich gar nicht vorgestellt.»
Er verbeugte sich ironisch und sagte: «Ich bin Existenzialist, in leicht abgewandelter Form. Ich glaube nicht, dass wir zur Freiheit verdammt sind, aber ich glaube, dass wir die Wahl haben zwischen dem Leben, das uns gegeben ist, und dem Suizid. Ansonsten höre ich gerne Punk und klaue hin und wieder Bücher verstorbener Autoren.»
«Freut mich», sagte Anton. «Ich habe Krebs, bin Witwer und möchte, bevor ich sterbe, noch in die Weltgeschichte eingehen.»
«Wie lang gibt man dir noch?»
Der Junge kam die Böschung hinuntergeklettert.
«Bis zum Sommer, wenn ich Glück habe.»
«Und wieso bist du dann hier? Das ist so etwa der letzte Ort, an dem man landen möchte.»
Anton blickte sich um. In der Ferne verloren sich die auf und abtauchenden Dünen im Nebel, der über dem Meer aufstieg und langsam über das Festland kroch.
«Mir gefällt es hier. Es ist ein guter Ort zum Malen.»
«Ach so, das erklärt alles. Im Winter bleiben nur die Melancholiker und Alkoholiker im Städtchen.»
Anton lachte. Der Junge gefiel ihm. Er nahm kein Blatt vor den Mund, war aber trotzdem sympathisch.
«Darf ich fragen, wie alt du bist?»
Sie standen sich immer noch gegenüber, der Junge war grösser als er, mindestens einen Kopf.
«Fragen darf man immer. Aber ich werde dir nicht antworten. Ich will nicht auf mein Alter reduziert werden.»
Er hob eine Muschel vom Boden auf, drehte sie interessiert in der Hand – und schleuderte sie plötzlich nach einer Möwe, die mit ausgebreiteten Schwingen über ihnen schwebte. Die Möwe, genauso überrascht wie Anton, wurde am Flügel getroffen und flog kreischend davon.

«Ausserdem ist es sowieso irrelevant, wie alt ich bin.» Der Junge klopfte sich den feuchten Sand an der Hose ab. «Ich werde auch bald sterben.»
Anton sah ihn erstaunt an. Der Junge hatte es mit einer Beiläufigkeit und Gleichgültigkeit gesagt, als hätte er von einem Fremden gesprochen.
«Jetzt schau doch nicht so», meinte der Junge grinsend. «Es ist gut so. Ich habe mich gegen das gegebene Leben entschieden. Es ödet mich an.»
Anton verstand nicht, was der Junge da sagte; es leuchtete ihm ganz und gar nicht ein. Er wusste nicht, was er ihm antworten sollte.
«Komm, wir gehen zu Tonis Fischbude, dann erklär ich’s dir. Ich lad dich ein.»
Und so kam es, dass sich Anton zwanzig Minuten später über vor Öl triefendem Fisch von einem Jungen erklären liess, weshalb das Leben nicht lebenswert sei.
«Also, fangen wir bei den simplen Dingen an», sagte der Junge, den Mund voller Fisch. «Die Menschen lesen nicht mehr, sondern ziehen sich lieber Scheisse im Fernsehen rein; im Meer schwimmen bald keine Fische mehr; man muss sich rechtfertigen, wenn man auf einen Baum klettert, um dem Himmel näher zu sein; es gibt von allem eine Kopie: von Stars, Tempelanlagen, dem Eiffelturm, ausgestorbenen Tieren, einfach von allem; man muss arbeiten, bis man umfällt, damit man sich die Klinik leisten kann, wenn es so weit ist, oder man ist arbeitslos; es gibt Flugzeugessen, Massentourismus, Männer, die sich im Internet als Frauen ausgeben, und Möwen.» Er wischte sich den Mund mit einer dünnen Papierserviette ab.
«Und da wären wir noch nicht mal bei den wirklich schlimmen Dingen wie Diktatoren, Atomwaffen, Terroranschlägen, Hungersnöten, Rassisten und Nazis, Vergewaltigungen, Kriegen, Klimawandel und Armut angekommen.»
Er knüllte die Serviette zusammen und warf sie mit der vollgesogenen Zeitung in den Mülleimer. Anton war zu erschlagen, um etwas zu erwidern. Eine Weile blickten sie beide schweigend aus dem beschlagenen Fenster der kleinen Fischbude. Das Dünengras schien wie immer vor etwas davonzulaufen, sich ins Landesinnere zu retten, während die Wellen ununterbrochen gegen das Ufer anrannten.
Irgendwann sagte Anton: «Aber es gibt auch Butterbrote, Frauenküsse und Männerumarmungen, Vogelgezwitscher, Kinderhände, Worte, um über die Liebe zu sprechen, Zimmerpflanzen, Blitzableiter, Giraffen und Elefanten, Traumfänger; Nektarinen, Mammutbäume, Sonnenstrahlen und Weihnachtsbeleuchtung, Musik, Pflaster und den Friedensnobelpreis.»
Der Text ist ein leicht überarbeitetes Kapitel aus dem Roman «Anton will bleiben», der 2023 im Arisverlag erschienen ist.

NELIO BIEDERMANN ist 2003 am Zürichsee geboren. Seine literarische Maturarbeit wurde als eine der besten fünf des Kantons Zürich ausgezeichnet. 2023 erschien sein Debütroman «Anton will bleiben». Nebenbei studiert er Germanistik und Filmwissenschaft.
Das Taschenbuch von «Anton will bleiben» wird bei rororo und sein nächster Roman im Herbst 2025 bei Rowohlt Berlin erscheinen.
TEXT INGO PETZ
Meine Geburt war ein ordentliches Schlamassel. Zwölf Stunden dauerte es, bis ich doch noch in dieser Welt gelandet bin. Mit Saugglocke musste man mich dem Schoss meiner Mutter entreissen. Bis heute trage ich davon eine Narbe am Kopf, wo keine Haare wachsen. Eine kahle Stelle – lange verdeckt unter dem vollen Deckhaar –, die von Zeit zu Zeit juckt und kribbelt. Ich bin also nicht fröhlich und frisch ins Leben geflutscht, sondern wurde ins Leben gezerrt. Eh ein Unding, dass man nicht gefragt wird, ob man geboren werden will, um diesen Slalom aus Lernerei, Arbeiterei und Sterberei mitzumachen. Ich hatte wohl eine Ahnung davon, was mich auf dieser Welt erwarten würde, wenn man einmal die sogenannte unbeschwerte Zeit der Kindheit hinter sich gelassen hat. Für manche ist, da muss man ehrlich sein, auch schon die Kindheit ein Martyrium. Deswegen mein intuitiver Unwille, mit fröhlichem Hurra in die Welt zu fallen, die man sich dann auch noch erarbeiten muss, um irgendwie in ihr klarzukommen. Das alles hatte zur Folge, dass ich mich ständig fremd fühle, nicht dazugehörig, als hätte man mich eben irgendwo reingeworfen, ohne dass ich es gewollt hatte. Die Folge daraus: Ich muss ständig weg, ausbrechen, abhauen. In jungen Jahren war dieser Drang noch viel stärker. In einer Schleife aus festen Ritualen und immer wiederkehrenden Abläufen vor sich hin zu machen: für mich eine Horrorvorstellung. Zwei, drei Tage an einem Ort zu sein und dieselben Dinge zu tun, empfand ich in meinen Zwanzigern schon als Haft-artige Existenz. Bis heute fremdel ich schnell mit Alltäglichem und nicht selten auch mit meiner Umgebung. Menschen, die mit Genugtuung davon sprechen, dass sie glücklich sind, weil sie ihr ganzes Leben an einem Ort mit mehr oder weniger denselben Menschen verbringen, betrachte ich mit Skepsis und Unverständnis. Deren Geburten müssen wie ein Spaziergang ins Licht gewesen sein.
Deswegen ist das richtige, das wirkliche Abhauen, das wahre Raus-aus-allem für die allermeisten keine leichte Angelegenheit. Man sagt das mal so schnell: Ich muss mal abhauen und diesen ganzen Mist hinter mir lassen. Raus aus der Arbeit, raus aus der Wohnung, raus aus der Beziehung, raus aus dem Leben, das sich anfühlt, als sei man in einer Dauerschleife gefangen. Bei den meisten wabert das Abhauen lange als Phantomschmerz im Emotionshaushalt hin und her, dann baut sich das Abhauen zu einem Traum auf, der nachts wie dieser MegaMarshmallow aus Ghostbusters auf einem herumtrampelt, und letztlich, wenn die Zeit reif ist, formiert sich das
Sprachzentrum, das Problem wird verbalisiert, und dann kommt es zu einem eruptiven Ausbruch. Man geht in den Keller und schreit es raus ins Kartoffellager, wo die Kartoffeln braun und traurig liegen und mit ihrem stummen Blick in die Dunkelheit starren. Ich musssss rausssss, verdammte Scheisse!!! RAUUUUSSSSSS!!!!! Dabei ist die Kartoffel eigentlich kein besonders guter Zuhörer, der einem Feedback geben könnte. Meistens bleibt es bei diesem Ausbruch. Es musste halt mal raus, ohne dass man selbst gleich raus muss oder kann. Denn zum wirklichen Abhauen gehört eine Menge Mut, wirklich alles hinter sich zu lassen, alles zu kappen und in die Erinnerung zu schicken. Um das zu verhindern, hat uns die Evolution eine Art Notfallmechanismus eingebaut, der uns vor uns selbst schützt, vor allzu grossen Dummheiten, vor dem tatsächlichen Ausbruch. Schliesslich ist die Sesshaftigkeit eines der Erfolgsrezepte der Menschheit. Was wäre das für ein Chaos, wenn alle ständig abhauen würden. Eine andere, nicht zu unterschätzende Schwierigkeit des Abhauens: Man kann sein Inneres, also all das Gedenke und Gefühle, all das Beziehungsgeflecht, was man mit sich herumträgt und was einen in unterschiedliche Richtungen mit der Welt verbindet, nicht einfach so von sich trennen, es eben ab-hauen, um es im Kartoffelkeller abzustellen wie einen alten verknautschten Koffer und dann fröhlich loszumachen. Man kann zu Lebzeiten nicht aus seiner Haut fahren, wie mein alter Freund Karlheinz Deschner gesagt hat.
Abhauen ist eben kein Kurzurlaub all-inclusive, sondern eine ernste Angelegenheit, die ans Eingemachte geht. Wahrscheinlich braucht man eine Grundveranlagung, die einem in die Wiege gelegt wird, damit der Ausbruch tatsächlich losgeht. Mein eigener, mein bisher grösster richtiger Ausbruchversuch liegt über zwei Jahrzehnte zurück. All die Lernerei in der Schule, im Studium, die Arbeiterei für Studium und Leben an der Tanke, in Fabriken, bei Lokalzeitungen, in der mobilen medizinischen Hilfe, an der Uni, all das hatte mich erschöpft. Trotz meiner jungen Jahre, in denen die Energie noch verlässlich durch die Venen strömt. Die Ressortleiterin bei der Zeitung, bei der ich volontieren sollte, wollte mir, bevor ich das Volontariat antrat, etwas Gutes tun und schickte mich auf eine Pressereise nach Neuseeland. Bis dahin war ich vor allem Richtung Osteuropa unterwegs gewesen, hatte mich in Belarus verknallt, wenn man sich in solch abstrakte Gebilde wie Länder überhaupt verknallen kann. Es fühlte sich jedenfalls wie verknallen an: Herz
an, Kopf aus. Ich reiste also 29 Stunden über den Himmel ans andere Ende der Welt, blickte vor der Landung in diese tiefblaue ewige Wasserlandschaft, dann verknallte ich mich in eine Neuseeländerin. Heute glaube ich, dass ich mich verknallt habe, weil ich raus und weg wollte aus meinem alten Leben. In der Hoffnung, wirklich alles, alle Erschöpfung hinter mir lassen, abstreifen zu können wie einen zu eng geworden Anzug. Und mit dem unbeirrten Glauben, dass sich alle Fragen, die sich zu einem wirren Gewirr in mir verknäult hatten, in glasklare Antworten verwandeln würden. Dieser Drang war so stark, dass er sich langsam materialisierte. Das Leben kann ein grosser Magier sein. Damals ergab das alles Sinn, wenn es sich auch wie Unsinn anfühlte. Ich reiste zurück nach Köln, trat das Volontariat an, aber eigentlich war ich schon weg. Ich hatte es nur noch nicht begriffen. Der Phantomschmerz schwelte. Nach einem Jahr zog ich die Reissleine, kündigte das Volontariat, packte meine Bücher, Plattensammlung und Klamotten in Umzugskisten und verstaute sie bei einem Freund auf dem Dachboden. «Irgendwann hole ich das Zeugs dann mal ab», sagte ich. Dann verabschiedete ich mich von Freunden und Eltern, die wohl alle der Ansicht waren, dass ich völlig durchgeknallt war. Mein Entschluss stand unerschütterlich fest: ab nach Neuseeland, Familie gründen, Kinder kriegen, glücklich und gelassen werden, am Arsch der Welt. Es kam natürlich alles ganz anders. Ich wusch in Cafés Teller, stopfte auf Baustellen Löcher von Dächern, die nicht richtig gedeckt worden waren. Ich reiste in wilde Wälder, die nachts wie Geister schrien, dass einem das Herz schmerzte, ich fuhr an abgelegene Küsten, wo der Ozean mit seiner unbändigen Kraft aufpeitschte. Ich kroch in dunkle Hobbit-Höhlen und überlebte einen Sturm bei einem Segel-
turn vor Auckland. Ich traf Maoris, die mich für einen der ihren hielten, und Sir Edmund Hillary, der auf dem Dach der Welt in die Ewigkeit geblickt hatte. Ich hatte verstanden, dass ein Taniwha, eine Art Schutzgeist, zu Recht den Bau einer Autobahn verhindern kann, wenn sie durch eben die Heimat dieses Taniwha gebaut werden soll. Nur das mit der Liebe wollte nicht klappen. Nach fast zwei Jahren hatte ich genug vom Ende der Welt. Ich war nicht in der Lage, Neuseeland zu meiner Welt zu machen, obwohl ich mich wirklich sehr bemüht hatte. Ich war abgehauen und musste es wieder tun: abhauen, nur in die umgekehrte Richtung. Ich sehnte mich nach der alten Welt, nach Ironie, nach Kulturpessimismus, nach echten politischen Katastrophen. Zum Abschied entschied ich, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Stechmeister Jake erzählte ich meine Geschichte. «Mach was draus», sagte ich zu ihm. «Du bist der Künstler.» Er schaute mich an, brachte die Nadel auf meinem rechten Unterarm in Stellung, und dann ratterte die Nadel los, durchstach die Haut und jagte Tinte hinein. Nach drei Stunden blickte ich auf das fertige Werk: ein Haken, Hei Matau, ein bekanntes Symbol in der Mythologie der Maori. «Der wird dir Glück bringen bei deinen weiteren Reisen über den Ozean der Ungewissheit», sagte Jake nach getaner Arbeit. «Und selbst wenn du kein Land entdeckst. Der Haken wird dir immer helfen, was aus dem Wasser zu ziehen.»

INGO PETZ ist Journalist und Autor. Seit über 20 Jahren schreibt er zu Osteuropa. Seit 2020 leitet er das Belarus-Projekt bei der Medienplattform dekoder.org, die differenziertes Wissen zu Osteuropa und Inneneinsichten in belarussische, russische oder ukrainische Diskurse liefert.

TEXT YAEL INOKAI
Von unserem Fenster aus sah ich den Anständigen das erste Mal wieder. Er ging mitten unter den anderen Leuten auf der Strasse, in den gleichen, unauffälligen Kleidern, wie es hier üblich war. Man zeigte seine Herkunft ungern auf den ersten Blick; lieber triumphierte man im richtigen Moment mit Worten oder einer gut dosierten Achtlosigkeit.
Eigentlich war der Anständige von seiner Haltung und seinem Gesicht her niemand, der einem ins Auge fiel. Ich entdeckte ihn zufällig, an einem meiner Nachmittage, als ich mich mit dem Draussen anfreundete, so vom Schlafzimmer aus.
Ich lebte mit Jurek. Er hatte die Wohnung gefunden und für uns hergerichtet. Sie war ein fertiges Nest, als ich sie das erste Mal betrat.
Er hatte sie nach seinem Einzug, wo es nur seinen Koffer und die Kleider an seinem Körper gab, innerhalb von Tagen mit gebrauchten Dingen aufgefüllt. Sie verströmten eine Gemütlichkeit, die mich anfangs juckte wie ein Haar an der falschen Stelle. In der Leere zu leben hätte Jurek nicht ausgehalten. Er bevorzugte die Gesellschaft von Gegenständen, angelebt, angenutzt, wenn auch nicht von ihm.
Für Jurek wurde ich einmal am Tag zum Passanten, ging aus der Tür, dabei fühlte ich mich hier in der Wohnung gut, und draussen wusste man ja nie. Ich besuchte den Markt, der um die Ecke lag, und kaufte dort Gemüse.
Für Jurek brachte ich es in unsere Küche, schnitt ich es, briet es oder buk es im Ofen, machte Eintöpfe draus, richtete das Essen an, so dass wir assen, wie alle anderen assen, bei Tisch, bei Kerzenschein. Man sah das an Winterabenden in den Fenstern der Häuser gegenüber. Wir hätten bei Tisch nie ein böses Wort gesagt, egal, ob wir uns gegenseitig erwürgen wollten. Wir waren einander nicht selbstverständlich.
Ich hätte am liebsten jede Mahlzeit im Bett eingenommen. Das tat ich auch öfters, wenn Jurek nicht da war, obwohl wir es anders ausgemacht hatten. Danach legte ich ein paar Krümel auf dem Tisch aus. Er wischte sie später zufrieden mit der Hand auf den Boden. Manchmal sah er mich dabei an, seitwärts, unter seinem dichten Haar hindurch, als wüsste er genau Bescheid und lachte, lachte lautlos in sich hinein.
Der Anständige hatte Arbeit. Ich erkannte es an seinem Gang. Er war nicht wie ich, der schlenderte, er durchschritt diese Strasse, er hatte wo zu sein.
Auch ich hatte wo zu sein, so war es nicht. Ich hatte eine Aufgabe, Blätter sortieren, Jureks Blätterwald, der im kleinen Zimmer neben der Küche wucherte. Die Blätter waren vorsortiert, diese Mühe hätte er sich früher nie gemacht. Als ich ihn kennenlernte, war er es gewohnt, dass man ihm hinterherräumte. Nicht einmal das Besteck legte er zusammen, um zu zeigen, dass er fertig gegessen hatte. Lieber liess er den armen Kellner drei Mal an unserem Tisch vorbeigehen. Er schloss Wasserflaschen genauso wenig wie Schranktüren und malte jedes Mal beim Kochen abstrakte Gemälde an die Wand. Er spülte das Klo, immerhin, aber das mochte auch an seiner Eitelkeit liegen.
Manchmal stellte ich mir vor, dass es das Erste war, was er für diese Wohnung angeschafft hatte: Blätter. Tausende von ihnen. Leer und beschriftet. Beschriftet mit irgendwas, was den Leuten nun einmal einfiel und sie dann loswerden wollten, in die Papiertonnen warfen, wo andere Leute mit kahlen Zimmern sie wieder herausfischen konnten. Einkaufslisten zum Beispiel. Ein Blätterwald voller Einkaufslisten. Dann wurden sie schnell wieder mit Jureks eigenen Notizen überwuchert. Als gäbe es überhaupt keinen Grund, irgendwas nur zu denken, ohne es aufzuschreiben.
Ich war mir sicher, früher oder später würde ich dem Anständigen begegnen, an einem Sonntag, weil der Sonntag solche Dinge zuliess.
Der Tag bekam seine eigenen Rituale. Es war Jureks Idee. Es sollte auch in der neuen Welt einen Sonntag geben, einen Tag, der sich von den anderen unterschied, wenngleich nur marginal. Der Tag, an dem ich zwar nicht länger schlief, aber ein paar Minuten länger liegen blieb, weil es Jurek war, der das Frühstück zubereitete und nicht wie sonst ich. Ich hörte dann sein Geklapper in der Küche. Ich wartete, bis er meine Zimmertür, die immer einen Spalt offenstand, manchmal mehr, aber nie weniger, mit seinen Fingerkuppen beklopfte. Mein Zeichen: Steh auf, ich habe Frühstück gemacht. Egal, wie mir zumute war. Ein Tag, der mit einem Frühstück begann, war begonnen, angebrochen, da gab es nichts zu machen. Und von da an konnte mich die Routine einfach einfädeln.
Drei Kaffee, einer mehr als nötig. Machte den Magen sauer. Knickte die Erregung, die die ersten beiden erzeugt hatten, wieder ab. Aber es machte nichts. Wir hatten nie was Grosses vor. Wir mussten ohnehin warten, bis wir das Haus verlassen konnten. Wenn die anderen in die Kirchen gingen, in die Cafés, dann wollten wir ihnen nicht begegnen. Sie hatten ihre Rituale, wir hatten unsere. Wir wollten die Sonntage mit Ausflügen auffüllen, wie davor, aber mehr als Pläne wurden nicht daraus. Wir warteten die richtige Zeit ab, um zu einem Spaziergang aufzubrechen, bei jedem Wetter, wir waren auch schon gegen Stürme anspaziert und unter Dachlawinen hindurch. Später lasen wir und assen Reste. Ich benutzte sogar Zahnseide, bevor ich ins Bett ging, das tat ich an den anderen sechs Tagen nie.
Es war dann kein Sonntag. An einem Dienstag stand ich dem Anständigen plötzlich gegenüber. Er kaufte Milch und Eier.
«Ich habe jemanden gesehen», sagte ich am Abend zu Jurek. Wir hatten schon gegessen, schweigend, das kam öfters vor. Wir machten uns nichts daraus. Spätestens der Abwasch erlöste uns immer, füllte diese Wohnung mit Geräuschen und fegte das Ernste weg.
Jurek wurde steif in den Schultern. Nur ein bisschen, nur für den ersichtlich, der diese Schultern seit Jahren kannte und aus ihnen zu lesen gelernt hatte.
«Wie sah er aus?»
«Er trägt die Haare jetzt anders. Die Seiten kurz, die Mitte ein bisschen länger. Davor hatte er diesen tiefen Seitenscheitel. Ein Gesicht wie tausend andere. Und klein. Klein ist er.»
Jurek dachte nach. Er durchforstete seinen Kopf nach allen Beschreibungen, die ich ihm je gegeben hatte. Es war eine Abmachung von uns. Wir hatten sie getroffen, ein paar Wochen nachdem ich angekommen war. Ich hatte das erste Mal über die Zeit drüben gesprochen, über den Ort, an dem ich untergebracht worden war, während er, Jurek, diese Wohnung hier für uns herrichtete und damit geschlagen war zu warten.
Damals sagte er: «Diese Personen von drüben, von der Kaserne – sie haben hier keine Namen mehr. Wenn du an sie denkst, wenn du mir von ihnen erzählst, nenn sie jemand. Wir unterscheiden sie nach ihren Merkmalen. Eng zusammenstehende Augen, so was. Aber keine Namen. Es gibt sie hier nicht mehr.»
Wir dachten, die Personen würden Geister bleiben, und nur solche wie wir kämen, um in dieser Stadt hier neu anzufangen. Es war unsere Erde, in die wir uns umgepflanzt hatten.
«Was hat er gemacht?», fragte Jurek. Er zeigte noch immer keine Anzeichen, dass er den Anständigen aus meinen Beschreibungen wiedererkannte.
«Er hat Milch und Eier gekauft.» Eine häusliche Tätigkeit. Wahrscheinlich lebte der Anständige hier. Keiner von uns beiden sprach das aus.
«Hat er dich erkannt?»
«Nein.»
Ich konnte es Jurek nicht sagen. Konnte nicht noch einmal zulassen, dass der Anständige mich sah, und weil ich versteinert war, hatte er alle Zeit der Welt gehabt, seine Erinnerungen durchzugehen, bis er mich darin fand. «Andreas», sagte er dann, in seiner warmen, vertrauten Stimme, mit der er mich auch das allererste Mal beim Namen genannt hatte. Nur das. Es machte sofort einen Menschen aus ihm. Und dieser Mensch war höflich genug zu gehen. Er stellte seinen Einkaufskorb ab und ging.
In einem anderen Leben, es war nicht lange her, lebten Jurek und ich in der Stadt, wo wir beide geboren worden waren. Wir dachten, wir würden dort auch alt werden. Unsere Wohnung war mit unseren Dingen gefüllt, von uns angelebt und von uns angenutzt. Die Nachbarn kümmerten sich um unsere Pflanzen und unsere Post, wenn wir verreisten.
Es hatte einmal bessere Zeiten gegeben für solche wie uns. Aber ich war noch ein Kind, als sich das wieder änderte, also musste ich diese Jahre nicht vermissen. Jurek und ich hatten eine Regel: Solange wir nicht darüber sprachen, wer wir waren, war es in Ordnung, wer wir waren. Für mich stimmte das so.
Am Anfang waren es die kleinsten Irritationen. Niemandem ausser uns fielen sie auf. Oft gab es keine Worte dafür, nur eine dumpfe Übelkeit, die in unseren Mägen hockte.
Dann schlugen sie einen in unserer Strasse fast tot. Ich hielt mich daran fest, dass wir diskret waren. Jureks Schultern sagten: «Wie oft muss ich es wiederholen? Unsere Freiheit ist nur geliehen. Unsere schönen Rechte waren es auch.» Er selbst sagte nichts. Als es kippte, blieben uns ein paar Tage. Jurek hatte einen Pass für ein anderes Land. In gewisser Hinsicht war es also einfach für ihn. Die zweite Nationalangehörigkeit war ein Erbe, wie eine Augenfarbe.
«Ich bleibe hier mit dir!», beharrte er und stampfte dabei wie ein kleines trotziges Kind auf den Boden. «Soll doch das Schlimmste passieren», sagte er mit dem Mut desjenigen, dem immer noch ein Ausweg bleibt, «dann passiert es uns wenigstens zusammen.»
«Wenn du nicht gehst», sagte ich, «dann werde ich dir das nicht verzeihen.»
Wir trafen eine Vereinbarung: Sobald er drüben wäre, würde er alle Hebel in Kraft setzen, alle Beziehungen spielen lassen, damit ich nachkommen könnte. Dabei kannte er niemanden. Und unsere Liebe war kein Kästchen auf einem Formular, das man hätte ankreuzen können. Dass wir zueinander gehörten, existierte in der Sprache der Behörden nicht.
«Und eine Wohnung besorgst du uns.» Er war einverstanden. Er versprach es mir sogar, obwohl er genau wusste, dass ich Versprechen jedweder Art ablehnte.
Wir packten ihm einen kleinen Koffer. Er nahm nichts Sentimentales mit, für den Fall, dass sie reinschauen wollten. Sie wollten nicht. Da hätte er am liebsten kehrtgemacht, ein paar Fotos von den Wänden gerissen, meinen benutzten Rasierer eingepackt, mir einen Nagel abgeschnitten und in die Geldbörse getan. Sie gaben ihm den Pass zurück, er steckte ihn in die Jackentasche. Er sagte noch Danke.
Zwei Tage später brachte man mich in die alte Kaserne, die sie für ihre Zwecke umgebaut hatten. Noch war alles im Rohzustand, aber sie hatten Grosses vor. Sie zeigten mir Entwürfe. «Für solche wie dich», sagten sie.
Ich besass kaum etwas von Wert, keinen besonderen Beruf, kein einnehmendes Talent, keine Informationen. Also spielten sie einfach ein bisschen mit mir.
In meiner ersten Nacht fasste ich einen Entschluss: Ich bleibe hier. Mit all meinen Gedanken. In diesem winzigen Zimmer mit seinen eingezogenen Wänden. Die tastete ich ab, damit ich jeden Knubbel und jede Einkerbung kennenlernen konnte.
Dabei hatten sie in den Filmen und Büchern immer gesagt: Wenn es zu schlimm wird, dann lass deinen Körper hier und hau ab, katapultiere dich mit deinem Kopf an einen anderen Ort.
Nicht ich. Ich würde mein Bestes gaben, damit nichts anderes von diesem Ort infiziert werden würde, kein Gedanke, kein Mensch. Sollte ich irgendwann rauskommen, dann würde ich nämlich einfach gehen können.
In den schlimmsten Momenten funktionierte es. Viel besser, als ich je vermutet hätte. Schwierig wurde es nur, wenn man mich ein paar Tage in Ruhe liess. Wenn ich über diese Zeit nichts hörte und niemanden sah, keinen Gegenstand hatte, mit dem ich mich irgendwie beschäftigen konnte, sondern es nur das Warten gab, dass sie wieder durch diese Tür kamen und welche Ideen sie mitbrachten. Dann sah ich Jureks Gesicht vor mir. «Geh weg!», schrie ich ihn an. Aber in der Stille waren die Erinnerungen wie Regen, wie unaufhörlicher Regen, der in diesen Raum prasselte und ihn langsam, aber sicher flutete.
Irgendwas, stelle ich fest. Ich brauche irgendwas. Sonst überlebe ich es nicht.
Wie weit war es zu Jurek?
Ich versuchte die Kilometerzahl zu berechnen. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass er wirklich in der Stadt angekommen war. Aber das war nicht wichtig. Nicht für diesen Raum. Hier gab es sowieso keine andere Option als die Gewissheit, dass er dort war und dass es ihm gut ging.
Wie würde ich zu ihm kommen? Wie viele Schritte, wie viele Züge, Busse, Bahnen?
Ich begann die Reise in kleine Teile zu trennen.
Ich fing an: Ich mache eine Reise. Ich packe in meinen Koffer. Ich habe nur begrenzten Platz zur Verfügung, ich muss also sorg-
fältig abwägen, was mit kann und was nicht. Jedes Mal, wenn ich etwas von der Liste streiche, muss ich von vorne beginnen.
Wieder und wieder fing ich an: Ich mache eine Reise.
Als Erstes am Morgen: Ich mache eine Reise. Ich packe in meinen Koffer.
Und so brachte ich mich zum Einschlafen: Ich mache eine Reise. Ich packe in meinen Koffer.
«Andreas?» Der Anständige sprach meinen Rücken an, als ich am Markt mein Gemüse einpackte. Es war nur eine Woche her, seit wir uns begegnet waren und er seinen Einkaufskorb abgestellt hatte und gegangen war. Nur sieben Tage falsche Sicherheit, dass er mich in Ruhe lassen würde, andere Wege wählen würde, damit wir uns nie wieder begegneten. Eine Woche die wahnwitzige Idee, er könnte ein Geist werden.
«Erschrecken Sie sich nicht», sagte er. Das tat ich auch nicht. Nicht im eigentlichen Sinne. Ich blieb einfach stehen.
Er atmete schwer. Er suchte nach den richtigen Worten. Ich spürte sein Zögern, sein Abwägen, ob er weitersprechen konnte. «Sie leben hier», sagte er. Er hatte mein Einkaufen also genauso interpretiert wie ich seins. Ich antwortete ihm nichts. Ich hatte mich ja ganz leer gemacht, um hier stehen bleiben zu können und nicht zusammenzufallen.
«Ich werde Sie nicht behelligen.» Er war dabei, Anlauf zu holen. Er wollte etwas von mir. Ich kannte diese Stimme doch.
«Ich möchte Sie nur um etwas bitten. Wenn Sie mich lassen. Sehen Sie, ich habe Familie. Zwei Töchter. Meine Jüngste ist vor
So wenig Buchstaben und so viel Welt
13/6 –8/9/24
Unterstützt von: strauhof

drei Wochen zur Welt gekommen. Sie heisst Carina. Wir sind wegen der Kinder hierhergekommen.» Ein Zittern in seiner Stimme. «Und wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, ich weiss, es ist viel verlangt … wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, möchte ich Sie um Verzeihung bitten.»
Er studierte meinen Rücken. Das hatte er gelernt. Es war nicht Liebe, die es ihn gelehrt hatte. Aber seit meiner Zeit in der Kaserne wusste ich ohnehin, dass fast alle Werkzeuge, die man zum Lieben nutzt, auch für das Gegenteil verwendet werden können.
Er hatte nun also gesagt, was er sagen wollte. Mein Rücken antwortete ihm: «Ich habe es gehört. Du musst jetzt gehen.»
Und das tat er.
Drei Wochen verliess ich danach das Haus nicht. Ich verbrachte meine Tage im Schlafzimmer, bei geöffnetem Fenster, der Trubel der Strasse hielt mich bei Verstand. Jurek wartete. Er übernahm das Einkaufen, das Zubereiten der Mahlzeiten, er kannte das schon. Ich war ein fehleranfälliges Uhrwerk. So hatte er mich zurückbekommen. Wenn es still wurde in der Nacht, weil die Betrunkenen ausblieben, machte ich das Radio an.
Ich war mir damals sicher gewesen, sollte ich Jurek je wiedersehen, ich würde ihn nicht mehr loslassen. Ich würde meine Nase in seinen Nacken graben, wo sie ihren liebsten Platz hatte. Ich würde mich mit der Hand in seinen Haaren verfangen. Ich würde ihn festhalten, auch in der Nacht, seinen Körper von meinem umschlossen, wo er hingehörte. Alles wäre gut.
Aber als er vor mir stand, nach all dieser Zeit, konnte ich ihn nicht umarmen. Als er dann bloss die Hand nach mir ausstreckte, sagte: «Komm, ich zeige dir unser neues Zuhause», rührte ich mich erst, als er die Hand wieder fallen liess.
Manchmal küssten wir uns, beim Geschirrspülen, wenn wir uns für einen Spaziergang bereitmachten, ohne nachzudenken. Wie schön er war, dachte ich dann.
Damals in der Kaserne hatte er mir eine Decke gebracht. «Wohin verreisen Sie, Andreas?», fragte er und breitete sie über meinem frierenden Körper aus. Das war mein erster Moment mit ihm. Ich hatte mich in meine Schleife geflüchtet: Ich mache eine Reise. Ich packe in meinen Koffer. Als er mir seine Frage stellte, mit seiner warmen Stimme diesen winzigen Raum füllte, verstummte ich.
«Schon gut.» Er zog die Decke über meine Schultern. «Ich wollte Sie nicht stören.»
«Sprich mit mir», sagte Jurek. An der Wand über der Küchenzeile waren Schlieren von seinem Kochen. Wenn er ratlos wurde, kam seine alte Unordnung zurück. Er musste in dem Jahr ohne mich in einem heillosen Durcheinander gelebt haben, bis der Anruf kam, bis er meine Stimme hörte: «Jurek … bist du das? Hier ist Andreas.» Er hatte nicht gleich geantwortet. Aber ich hatte ihn an seinem Atem sofort erkannt.
«Der Anständige», sagte ich, «es war der Anständige.» Ich hatte nur ein einziges Mal von ihm erzählt. Dass er manchmal gekommen war, um mir etwas zu essen zu bringen. Oder ein Buch. Dass er mir ein Bild von seiner Frau gezeigt hatte, die ihr erstes Kind erwartete. Dass er einmal ganz leise geworden war und gemeint hatte: «Andreas, wenn Sie mir ein paar Namen hätten, von anderen wie Ihnen, vielleicht kann ich dann was für Sie tun.»
Er hatte mich nie bestraft. Nicht wie die anderen. Und ich sah in Jureks Gesicht, dass er nicht ganz verstand. Der Anständige, war er denn nicht anständiger gewesen als die anderen?
Ich hatte gewartet. Nachdem ich rausgekommen war. Eine Woche, bevor ich Jurek anrief. Das wusste er nicht. Aber ich wusste es für ihn, in Momenten wie diesen, wenn er mich anschaute, fragend, weil er nicht verstand.
«Verzeihung», sagte der Anständige. Da war er wieder, mitten auf der Strasse, ich hatte mich nur kurz gebückt, um meine Schnürsenkel zu binden.
Als ich nicht aufsah, fügte er an: «bitte», und als ich noch immer nicht aufsah, mich stattdessen mit gesenktem Kopf aufrichtete und an ihm vorbeiging, als hätte niemand mit mir geredet, da wurde er lauter und schickte mir hinterher: «Ich bin doch auch ein Mensch.» Ich blieb noch immer nicht stehen. Ich ging schneller, jeder Schritt schneller als der davor, obwohl er mich nicht verfolgte, obwohl er genau da, wo er mich wiedergefunden hatte, als besässe er einen Radar, auf dem er mich immer orten könnte, auch stehen geblieben war. Aber es klebte an mir, was er gesagt hatte. Es kam mit mir in die Wohnung, in die Küche, in die Dusche, in das Bett.
Ich bin doch auch ein Mensch.
«Kannst du dir das vorstellen?», fragte Jurek. «Ihm zu verzeihen.»
«Nein.»
«Nicht für ihn. Für dich.»
«Für mich?»
«Dafür ist es doch da.»
Ich sagte nicht: «Aber wie soll ich ihm verzeihen, er ist ja immer bei mir. Er ist bei mir, wenn ich die Zähne putze, wenn ich Tomaten kaufe, wenn ich den Boden wische. Ich bin wieder in diesem Zimmer, wenn ich Post öffne, ich bin in diesem Zimmer, wenn ich die Treppe hinabsteige und zum hundertsten Mal versuche, eine Arbeit aufzunehmen, und das Banalste halte ich am wenigsten aus. Dieser Raum ist bei mir, Jurek, so wie du bei mir bist. Ja, meistens war er anständig, der Anständige von allen, aber manchmal auch nicht, es war ja er, der darüber entscheiden konnte. Er hat mir das Kopfkissen weggenommen und das halbvolle Wasserglas, er hat mich einmal getreten und gesagt, ich muss das tun, sei so gut, entschuldige, und ich hab gesagt: natürlich. Aber jetzt will ich nicht mehr. Ich will nicht meinen Frieden damit machen. Es soll einfach immer schlimm bleiben.»
Las er es aus meinen Schultern? Jurek zündete zwei Kerzen an. «Wir haben es gut hier», sagte er. Ich nickte. Er hatte recht. Gross unterschied sich unser Leben nicht von dem von früher. Wir hatten eine Wohnung. Wir hatten unsere Rituale. Wir hatten einander. Und so lange wir nicht darüber sprachen, wer wir waren, war es in Ordnung, wer wir waren.
Der Text erschien erstmals im Rahmen des ARD Radiofestivals 2020.

YAEL INOKAI, geboren in Basel, lebt als freie Autorin in Berlin. Von ihr erschienen die Romane «Mahlstrom» (2017) und zuletzt «Ein simpler Eingriff» (2022). Sie ist mit dem Clemens-Brentano-Preis und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet worden.


Raben krächzen zwischen Grau und Blau, kahl ist der Morgen.
Ihre Finger streifen an der Friedhofsmauer entlang, Graffiti, Plakate in Fetzen, Pfützen im Gehsteig, sie springt darum herum in ihren schweren Stiefeln, die manchmal zutreten müssen. Nicht oft, sonst hätte sie den Job nicht genommen.
Das Tor zum Hinterhof stösst sie mit beiden Händen auf, scharf riecht’s nach Urin, sie öffnet die Wohnungstür, zieht die Vorhänge zu, wirft sich auf die Matratze am Boden, schläft sofort ein.
Stunden später piepst das Handy, sie schlägt danach. Steht auf, Vorhänge zurück, helles Licht schiesst in ihre Augen.
Zwei Tage später streckt ihr Paolo eine Plastiktüte entgegen, sie steht draussen vor dem Club im Regen.
«Was ist damit?»
«Kannst mitnehmen. Brauchen dich hier nicht mehr.»
«Sagt wer?»
«Sag ich.»
«Schnauze, wo ist der Chef?»
«Der will dich nicht mehr sehen. So ne Schlampe kann er nicht gebrauchen, sagt er, und nun zisch ab!» Paolo zieht die Tür zu, doch sie ist schneller, schiebt den Fuss in den Spalt, rammt ihm die Faust in den Bauch, aus seinem Mund dampft Zigarettenrauch, da wird es heller, die Tür geht auf, zwei Typen kommen raus, glotzen an ihr rauf.
«Mach, dass …»
«Gruss an den Chef, soll mir mein Geld für die letzten zwei Monate noch rausrücken», ruft sie in den dunklen Raum hinein, irgendwo dort hängt er rum, ob er sie hört, keine Ahnung.
«Richten wir ihm aus, kannst sicher sein, wissen ja, wo du wohnst.»
Ihr Grinsen dazu in schiefen Gesichtern.
Holt noch im Gehen den Gürtel aus der Tüte, wickelt ihn um ihr Handgelenk, der Boxschlag von vorhin schmerzt, verrenkt?
Die Tüte mit ihren Klamotten wirft sie über den Zaun einer Voliere, dort beim Zoo, am Tag danach steckt ein Papagei seinen Kopf in den Ärmel der Security-Jacke und erstickt fast dabei.
TEXT ALICE GRÜNFELDER
Am nächsten Morgen liegt ein Tag vor ihr. Danach wie viele Morgen, wie viele Tage?
Bis es an der Tür klingelt. Sie schaut durch den Spion. «Sascha, du hier?»
«Komm schon, mach auf, bring dir Geld vom Chef.»
«Die Zeit, als ich an Märchen glaubte, ist vorbei. Also, was willst du?» Durch den Spion sieht sie, wie Sascha ein paar Riesen hin und her wedelt.
Zur Begrüssung kratzt er mit seinem Dreitagebart über ihre Wangen, riecht fein.
«Machst mir nen Kaffee?»
«Hab keinen da. Spiel gute Fee und hol welchen, ja?»
Tatsächlich, er geht. Und sie schnell unter die Dusche, bestes Parfüm aus besseren Zeiten, ihr blondes Haar mit einer Bürste rasch aufgestylt.
Während sie vor dem Herd steht, darauf wartet, dass das Wasser kocht, sucht Sascha nach Tassen, stellt Zucker und Milch auf den Tisch, hat sogar ein paar Sandwiches mitgebracht.
«Wo hast du das denn gelernt? Machst auf gemütliches Heim?» Sie kippt Wasser in die Kaffeekanne, heisse Tropfen fallen auf ihren Handrücken, sie verzieht keine Miene, setzt sich und schaut Sascha an. Der schaut sie an.
Der Kaffee ist schon lange kalt, da schauen sie sich noch immer an.
Bis Sascha zwei weisse Spuren auf den Glastisch legt. Eine zieht er sich selbst rein, die andere überlässt er ihr. Insgesamt vier. Ihre Nasen berühren sich. Ihre Zungen. Hände überall. Ihr T-Shirt reisst, weil es nicht schnell genug geht, sie stolpern, weil seine Trainingshose sich um ihre Beine schlingelt, stehen Stunden später schweissnass auf. Ein Kampf war das, denkt sie, als sie kaltes Wasser über ihren Körper laufen lässt. Und beide Sieger. Sascha drückt sich zu ihr unter die Dusche. Seine Zunge an ihrem Hals, sie zittert, bebt, reisst den Mund weit auf, Wasser rinnt in ihre Kehle. Er seift ihr den Rücken ein, wickelt sie in ein Handtuch, trägt sie zur Matratze, legt sich nackt neben sie. Schaut an die Decke. Seufzt. Dreht sich zur Seite, legt zwei Spuren auf sein Handydisplay, eine für sich, eine für sie. Tag für Tag dasselbe, Abend für Abend. Bis er geht.
«Wohin?», fragt sie aufgeschreckt. Heiss ist ihr, sie kratzt sich am Arm. «He, Geld fällt nicht vom Himmel! Kannst bei mir einsteigen.»
Als Türsteherin läuft nichts mehr. Und als Verkäuferin eh nicht. Die Lehre hat sie geschmissen, zuerst wollte der Chef was von ihr, dann die Kollegen. Sie lässt den Gedanken fallen, er fällt irgendwohin. Sascha kommt immer nur kurz und jedes Mal mit einem Geschenk, einem Ring, einem Parfüm. Zuerst Sex, danach weisser Puder. Die Sandwiches, die er mitbringt, lassen sie liegen.
Dann gibt er ihr den Stoff, sagt, sie soll in Clubs rumhängen, Leute kennenlernen. «Wozu?», fragt sie.
Sie nimmt das Zeug selber, bis der Abgesang des Lebens sie durchpulst. Hat bald kein Geld, auch keinen Hunger mehr. Eigentlich praktisch, denkt sie noch. Nur wenn Sascha kommt, nimmt er sie nicht mehr in den Arm, haut ihr eine runter, sagt, sie soll sich zusammenreissen, so geht das nicht, sie soll das Zeug verticken, nur wie soll sie so das Zeug verticken? Er schüttelt sie, bis sie sich übergibt, auf ihn draufkotzt.
Dann einmal abends, sie will nach Hause, versperren drei Typen ihr den Weg. «Her mit dem Geld!»
«Welches Geld?»
Sie treten nach ihr, schlagen ihr ins Gesicht, sie schlägt zurück, doch gegen drei kommt sie nicht an, sie liegt am Boden, einer pisst über sie rüber, sie rennen davon, schreien noch: «Gruss von Sascha. Eine Woche hast du Zeit.»
«Und Turan, wo haben Sie den kennengelernt?», fragt der Richter.
Sie weicht ihm aus, schaut aus dem Fenster, ein Unstern hängt tief über der Strasse, ein Zeppelin fliegt vorüber.
Turan holt sie raus, verspricht er ihr. Doch als Sascha von Turan erfährt, geht es erst recht los. Er passt sie ab. «Seit du mit dem Turan … seither geht alles auf Rechnung, und die ist lang. Verkauft hast du nichts, das ganze Zeugs selbst gekokst, glaubst vielleicht, ich bin hier der Krösus? 30 Riesen bis nächsten Samstag.»
« … »
«Besser, du hast das Geld. Vorgeschmack kennst du.»
Sie spuckt ihn an, duckt sich, als sie seine Faust sieht, duckt sich zu langsam, aber zieht ihren Schlagring quer über sein Gesicht und rennt los, rennt und rennt, so schnell sie kann, keiner holt sie ein, seine Kumpels geben schon nach hundert Metern auf.
Sie verdrückt sich in einen Hauseingang, Oberkörper nach vorn gebeugt, eine Haarsträhne klebt über ihrem linken Auge, sie atmet schwer, ging schon mal besser.
Sie ruft Turan an, der sagt: «Den Sascha, den machen wir fertig. Der hat dich Stück für Stück in die Scheisse geritten. Ich regle das für dich.»
«Wie, was … willst du regeln … schlägt dich … tot.» Die Wörter stolpern über ihre trockenen Lippen.
«Das mach ich vorher.»
«Wer hat das gesagt? War der Plan gar nicht von Ihnen, sondern Turan hat sie aufgestachelt?», fragt der Verteidiger.
Der Richter blickt auf, der Staatsanwalt beobachtet eine Fliege, die hinter der Gerichtsschreiberin die Wand hochkrabbelt.
«Sascha kalt machen – war das Turans Idee?», hakt ihr Verteidiger nach.
«Oder waren Sie es?», geht der Staatsanwalt dazwischen. «Und als nichts mehr ...»
«Wollt mich rächen.»
«Wie?»
«Hab gesagt, ich hätte da ein paar Frauen ...»
«Von wie vielen Frauen war die Rede?», unterbricht sie der Staatsanwalt wieder.
«Zwei, drei, weiss nicht. Hab gesagt, er soll noch was zum Koksen mitbringen.»
«Und er ist einfach gekommen, allein?»
«Hab ihm gesagt, er soll allein kommen, sonst läuft nichts.»
«Und weiter?»
«Turan hat sich auf ihn gestürzt, mit einem Messer, und ich hab aus Versehen gestochen. Wollt ihn mit dem Messer nur bedrohen. Da hat Turan ihm einen Schlag ins Gesicht und ist mit dem Messer auf den Sascha los.»
Aber Sascha ist ihnen entwischt, Turan gleich hinter ihm her, doch da war niemand mehr, nur Blut überall. Und noch am selben Abend sind sie abgehauen. In die Türkei. In so ein Kaff, wo Turan herkommt. Sei sicherer so, meinte er.
Von wegen abhauen, neues Leben, was der Turan alles versprochen hat, und dann, weg war er. Und sie allein in diesem Kaff. Doch da lief nichts. Tagelang, wochenlang nur warten.
Stoff hatte sie keinen mehr, wie sollte sie es da bloss aushalten? Hat immer wieder angerufen, den Bruder. «Jetzt auf einmal», hat er zuerst gesagt. Hätte sie nicht tun sollen, mit dem Sascha rumhängen und überhaupt, hätte auch nicht anrufen sollen, hat ihr Bruder immer wieder gesagt. Und: «Halt still. Halt aus.»
«Aber von ‹aus Versehen› war in diesen Telefonaten keine Rede», warf der Richter ein, «Sie erzählten Ihrem Bruder doch ganz stolz davon, wie sie Sascha kaltgemacht haben. Und von welcher Rache sprechen Sie eigentlich?»
«Na, dass er diese drei Typen auf mich gehetzt hat, die mich vergewaltigen wollten. Und weil er mich abhängig gemacht hat von dem Zeugs.»
«Und dann haben Sie …»
«Meine Mandantin hat gar nichts, Turan war der Haupttäter.»
«Von dem aber fehlt jede Spur.»
«Warum sind Sie dann doch wieder zurückgekommen, Sie wussten ja ... ?»
Sie zieht einen Zettel aus ihrer Jeans, faltet ihn langsam auseinander, liest vor, was sie von nun an in ihrem Leben alles anders machen will. Schaut wieder hinaus, rau und kehlig quarken die Raben, dann fliegen sie davon.

ALICE GRÜNFELDER hat ein Studium der Sinologie und Germanistik absolviert. Sie ist Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, unterrichtet seit 2010 Jugendliche und schreibt am liebsten dokufiktionale Texte. Publikationen u. a. «Wüstengängerin» (edition 8), «Wolken über Taiwan» (Hotlist der unabhängigen Verlage, 2022) und der Gesellschaftsroman «Jahrhundertsommer» (dtv).
Ausschreibung vom 17. Juni bis 6. September 2024
Gefördert werden Projekte und Angebote mit 3’000 bis 30’000 Franken, die sich insbesondere an finanziell benachteiligte junge Menschen richten.
TEXT MILENA MOSER
Ich schlüpfe in den Tramwagen, gerade als die Türen sich zu schliessen beginnen. Es ist voll, ich quetsche mich auf die Bank am Wagenende, neben ein junges Paar. Gegenüber eine Frau mit einem schulpflichtigen Mädchen. Ich allein. Ohne Kinderwagen. Ohne mein Mädchen.
Ich lächle dem Kind mir gegenüber zu, das sich schüchtern an seine Mutter drückt. Spätestens jetzt müsste das schlechte Gewissen einsetzen, ich warte darauf, ich wünsche es mir fast. Als Strafe. Aber auch als Zeichen: dass ich normal bin.
Nichts. Keine Schuldgefühle. Zum ersten Mal seit neunzehn Monaten, drei Wochen und einem Tag. Zum ersten Mal seit Yolas Geburt.
Ich lehne den Kopf an die Fensterscheibe, warte, bis die Tram losruckelt. Ich bin in den 11er gestiegen, nicht in den 2er. Die Müttergruppe trifft sich am Stauffacher. Der 11er fährt zum Hauptbahnhof, und von dort fahren Züge.
Nach Amsterdam, Hamburg, Paris, nach Milano und nach Bad Ragaz. An den Genfersee. Am Hauptbahnhof gibt es einen Burger King. Ich könnte Fritten zum Frühstück essen. Oder Schokolade, einen ganzen Truffes-Cake von Sprüngli. Oder beides. Ich könnte mir ein Buch kaufen und elf Stunden lang lesen, von hier bis nach Berlin.
Ein Buch, das nichts mit Kindern zu tun hat. Kein Ratgeber. Eine Liebesgeschichte.
Ich hatte immer nur einen Traum: den von einer richtigen Familie. Betonung auf richtig. Auf diesen Traum hab ich mein ganzes Leben ausgerichtet. Ich hab mich für Nesto entschieden, konservativ, gutaussehend, der meine Träume teilt. Nicht für Hannes, an den ich manchmal denke wie an eine Figur aus einem Disneyfilm, eine Illusion aus meiner Kindheit. Hannes wusste nicht, was er wollte. Nesto und ich, wir hatten einen Plan. Wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Er verdient genug, ich muss nicht arbeiten. Wir haben eine

schöne Wohnung mit Garten. Ich habe alles, was ich mir je gewünscht habe. Nur mich gibt es nicht mehr.
Yola schläft mit mir im grossen Bett. Sie krallt im Schlaf ihre Finger in mein Fleisch, sie zieht an meinen Haaren, sie beisst mich. Sie pinkelt mich an, sie kotzt mich voll. Es gibt keine Grenze zwischen ihr und mir. Wir sind eins. Ich gehöre ihr.
An wen erinnert mich das?
An meine eigene Mutter.
Genau. Alles, was ich nie wollte. Meine Vorstellung vom Muttersein war einfach: das Gegenteil von dem, was ich erlebt hatte.
Ich war meiner Mutter ausgeliefert. Sie hatte nur mich. Und, das würde man heute vermutlich so diagnostizieren, eine Persönlichkeitsstörung. Meine Mutter hatte viele Gesichter, ich wusste nie, welches mich erwartete. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal ausgeatmet, als ich von zuhause auszog.
Meine Tochter sollte es einmal anders haben. Sie sollte sich sicher fühlen und frei. Sie sollte ihr eigener Mensch sein dürfen.
Und ich? Bin ich noch ein eigener Mensch?
Yola und ich, Yola und ich, Yola und ich. Tagein, tagaus. Ich arrangiere uns auf Bildern und in Filmen, halte
meinen Traum für die Allgemeinheit fest. Nicht, dass es die Allgemeinheit interessiert. Es gibt zu viele wie mich, perfekte Mütter, die ihre Tage damit verbringen, mit ihren Kindern auf selbstgewobenen Decken im frisch geschnittenen Gras zu schmusen, sie mit einfachen Mitteln zu fördern, ihre erstaunlichen Fortschritte bescheiden und nebenbei zu erwähnen, und natürlich: Brot zu backen. Bin ich die Einzige, die sich unter dem Bett verkriecht und in ihren Unterarm beisst, um nicht zu schreien?
Ich bin auf jeden Fall die Einzige, die im Sommer lange Ärmel trägt. Schon als Kind hab ich mich ständig mit anderen verglichen. Wo wären meine Träume sonst hergekommen? Ich setzte mir mein perfektes Leben aus Bruchstücken zusammen, die ich bei meinen Schulkameradinnen beobachtete: die beruhigende, wenn auch nur sporadische Anwesenheit eines Vaters. Regelmässige Mahlzeiten. Gemeinsames Basteln. Singen. Und natürlich: Brot backen. Heute beobachte ich die anderen Mütter in der Gruppe mit demselben Blick: Wie machen sie es? Warum können sie es? Sie waren nicht besser vorbereitet als ich – niemand war besser vorbereitet als ich. Und doch. Wir reden nicht über solche Dinge. Wir scherzen über Missgeschicke, die in Wirklichkeit keine sind. «... und da merkte ich plötzlich, dass Oscar verschiedenfarbene Socken trug!» «... dann

hat sie beim Babykonzert im Opernhaus wieder alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es war so peinlich!»
Keine der anderen Mütter scheint etwas zu vermissen. Keine scheint sich selbst verloren zu haben. Was mache ich falsch? Was haben sie, was ich nicht habe? Sie tragen kurze Ärmel. Keine Bissspuren auf den Unterarmen.
«Da bist du ja, Annet!» Ich schaue auf. Ausgerechnet Luise. Die mag ich am wenigsten in der ganzen Gruppe. Sie arbeitet, sie ist alleinerziehend, ich weiss gar nicht, was sie bei uns macht. Sie passt nicht zu uns, und, was noch schlimmer ist, es scheint sie nicht mal zu kümmern.
Ihr Sohn Tom ist ein kleiner Rabauke. Das kommt noch dazu. Ich glaube nicht, dass er schon mal im Opernhaus war.
(Früher war ich nicht so. Das möchte ich nur festhalten. Ich war nicht so.)
«Ich hab dich gar nicht gesehen!» Luise hievt einen Buggy in den Wagen, ohne jede Hilfe. Die Umstehenden schauen nur böse, als sei es Luises Schuld, dass das Tram immer noch nicht losgefahren ist. Tom klammert sich an die Seitenstange. Er trägt ein schmuddeliges Fussballtrikot. Aus Polyester.
Luise schiebt den Buggy neben mich und drückt mit dem Fuss die Bremse runter.
Yola schläft immer noch. Sie ist im Buggy eingeschlafen, und dann hab ich sie einfach an der Tramhaltestelle stehen lassen. Es war nicht geplant. Es war nur dieser Bruchteil einer Sekunde einer Möglichkeit. Abzuhauen. Frei zu sein. Ich kann nicht beschreiben, was ich empfinde, als ich Yola sehe. Luise lässt sich nichts anmerken. Die Frau mit dem Schulkind steht auf, sie zieht das Mädchen zur vorderen Tür und Luise setzt sich mir gegenüber. Tom klettert auf ihren Schoss und beginnt, an ihren langen Haaren zu ziehen. Sie packt mit geübtem Griff seine Hände. Dann schaut sie mich an.
«Sind wir nicht im falschen Tram?» Ich antworte nicht. Sie grinst.
«Komm, wir hauen ab.»

MILENA MOSER lebt und arbeitet in San Francisco. Sie hat 24 Bücher veröffentlich, zuletzt «Mehr als ein Leben» und «Der Traum vom Fliegen». Sie bietet Schreibkurse und Beratungen an und arbeitet gerade an einem Buch über das Schreiben.

Teamgeist beginnt mit Dir. Jetzt weiterbilden in Management und Führung: bfh.ch/management-gesundheit-sozialwesen
TEXT DMITRIJ GAWRISCH
Hätte ich ahnen können, als ich an jenem drückenden Dienstagmorgen Mitte Juli durch die Bresche in der Hecke vom Garten meiner Eltern in Helges Garten schlüpfte, dass es das letzte Mal sein könnte? Und dass ich daran schuld wäre?
Seit Wochen stellte die Hitze einen Rekord nach dem anderen auf. Das Leinenhemd – in überaus passendem Babyblau –klebte schweissdurchtränkt auf meiner Haut, dabei war es noch nicht mal zehn Uhr. Wie machte er das? Kaum hatte ich den Fuss auf Helges Wildblumenwiese gesetzt, umschlang eine Frische meine Knöchel und Waden, als läge sein Garten in einer anderen Klimazone als der unsere, als alle anderen Gärten der Kolonie. Ich fand Helge auf allen vieren vor, er pflückte Sauerampfer für die Suppe, die er sich zum Mittagessen kochen wollte. Während er auf die Beine kam und die Hände an seinen abgerissenen Shorts abwischte, prägte ich mir möglichst viele Details seiner Terrasse ein, mit denen ich sein Porträt später anreichern könnte. Dinge wie das knisternde Kofferradio, das auf dem angegrauten Gartentisch stand und nur noch von Silbertape zusammengehalten wurde. Oder die Kette aus Bernstein, an der er sich die Lesebrille um den Hals hängte. Auf der Hollywoodschaukel lag das handillustrierte «Lexikon der Zugvögel» von 1897. Obwohl ich heftig den Kopf schüttelte – ich war doch nicht mehr zwölf –, liess Helge es sich nicht nehmen, ein sauberes Glas aus der Küche zu holen und mir von seiner Holunderlimonade einzuschenken, aus derselben geblümten Karaffe wie damals, vor fast fünfzehn Jahren.
Ihr halbes Berufsleben hatte meine Mutter in ihrem Bürostuhl davon geträumt, nach Feierabend und an den Wochenenden eigene Kräuter, Karotten und Radieschen zu ernten, und weil es für meinen Vater, der damals noch als Theaterkritiker ein Auskommen fand, nicht in Frage kam, ins Umland zu ziehen, pachteten sie im Sommer vor meinem Schulwechsel den knapp fünfhundert Quadratmeter grossen Garten mit einer winzigen Holzlaube darauf. Die frühere Besitzerin hatte Ulrike geheissen, hatte offensichtlich Himbeeren gemocht, die in allen Grössen und Geschmäckern in unserem neuen Garten wucherten, und war vor ein paar Jahren, murmelte der Makler, während er durch die Verträge blätterte, anscheinend irgendwie verunglückt. Helge hätte bestimmt mehr über sie zu sagen gewusst, allein schon wegen des Lochs in der Hecke, das die beiden Gärten miteinander verband, aber meine Eltern fragten nicht nach, selbst erzählte er nichts, und ich war mit der einsetzenden Pubertät mehr als ausgelastet.
Helge war ein Nachbar, wie man ihn sich wünscht. Im Frühjahr half er meiner Mutter, die Hochstämme zu schneiden und Spaliere zu bauen. Er brachte Gartengeräte vorbei, die uns fehlten, Sägen, Scheren, Schaufeln und im legendären Kirschsommer
sogar einen elektrischen Entkerner, als wir von den vier Bäumen fast eine halbe Tonne Kirschen ernteten und mein Vater eine Sehnenscheidenentzündung bekam vom Entkernen von Hand. Meine Eltern versprachen, alles spätestens nach der nächsten Fahrt in den Baumarkt zurückzubringen, aber Helge winkte ab: Er habe eh alles doppelt und dreifach. Eine Zeitlang versuchten meine Eltern, sich mit Apfelkompott oder Aprikosenmarmelade zu revanchieren, aber nach ein paar Jahren merkten sie, wie einfallslos ihr Eingemachtes im Vergleich zu Helges schmeckte, und liessen es bleiben.
Wer mich kennt, mag überrascht sein, es zu hören, aber früher war ich die Bravheit in Person, nicht mal eine Yogurette nahm ich aus der Süssigkeitenschublade, ohne dass jemand von den Erwachsenen das abgenickt hätte. Das Verbotene zog mich weder magisch noch real an. Fast ein Jahr lang ging ich am Loch in der Hecke vorüber, als wäre es gar nicht da. Hallo, rief ich dann auch mehrmals, bevor ich mich endlich getraute, den Kopf durch die Hecke zu stecken und nach meinem Fussball zu suchen, der in Helges Garten geflogen war. Ich sah ihn hinter der Jungfeige liegen und setzte an, ihn zu holen, als Helge vom Zwetschgenbaum herunterrief, ich solle doch bitte mal kurz unter meine Füsse schauen. Erst da bemerkte ich die prallroten, birnengrossen Erdbeeren, die ich gerade dabei war mit meinen Turnschuhen plattzumachen. Ich murmelte eine Entschuldigung und wollte umkehren, aber da war Helge schon runter vom Baum und gab mir meinen Ball zurück. Er tat das mit einem Lächeln, für das mir keine passendere Beschreibung einfällt als entwaffnend, augenblicklich löste sich meine Anspannung, ich lächelte sogar zurück. Helge hängte seine Säge an einen Ast und lud mich zu meinem ersten Glas Holunderlimonade ein.
Es war unser zweiter Gartensommer, meine Mutter sah ihren Salatköpfen beim Wachsen zu, mein Vater schaukelte in der Hängematte, blätterte in den Spielzeitheften und strich die Aufführungen an, die er sehen wollte, und ich ging gleich nach dem Frühstück rüber zu Helge und kehrte erst zum Abendessen wieder heim. Er erklärte mir, wo was wuchs bei ihm und wann man es wie essen könnte, ich half ihm, die Johannisbeeren abzulesen, wir schleuderten Honig und er zeigte mir die Bienenkönigin bei der Eiablage. Ich erzählte Helge von der Schule, von meinen Fussballfreunden, von der rothaarigen Hannah, die wegen ihrer zugespitzten Ohren alle nur Miss Spock nannten, sie war in meinen besten Freund verknallt und nicht in mich. Helge hörte zu, anders als meine Eltern gab er mir niemals Ratschläge oder sagte in diesem altklugen Ton, was er an meiner Stelle getan hätte. Von sich erzählte er nie. Was würde es ändern, wenn ich wüsste, wie alt er sei?, fragte er zurück, als ich doch mal was über ihn wissen wollte. Obwohl er dabei freundlich lächelte, liess ich ver-
unsichert weitere Fragen bleiben und akzeptierte, dass er ganz Gegenwart war. Nur durch Zufall erfuhr ich, dass Helge zwei erwachsene Söhne hatte, eines Tages kamen sie mit einem Transporter angefahren, um eine alte Anrichte abzuholen, die offenbar ihrer Mutter gehört hatte. Ihr Umgang kam mir kalt vor, sie gaben sich zur Begrüssung knapp die Hand und sprachen kaum, die Söhne schraubten alles auseinander, verluden die Einzelteile und brausten davon, ohne sich verabschiedet oder Helges Holunderlimonade auch nur angerührt zu haben.
Dass ich heute studieren kann und von einer Karriere als Reporter träumen, verdanke ich Helge. Es war ein paar Sommer später, am Höhepunkt der Pubertät, meine Stirn voller Pickel. Ohne mir etwas dabei zu denken, erwähnte ich, dass Schule mich anätzte, in Mathe hatte ich im Zeugnis sogar eine Drei. Was ich denn nicht verstanden hätte, wollte Helge wissen, holte aus der Laube einen karierten Block und erklärte mir, als täte er den ganzen Tag nichts anderes, wie man Vektoren multipliziert. Wieso kannst du diesen Mist?, fragte ich erstaunt. Die Sommerferien verbrachten wir damit, Holunderlimonade in uns zu schütten und den Stoff des vergangenen Schuljahres zu repetieren, und noch immer denke ich mit Genugtuung an Frau Siedlers erstaunte Visage zurück, als sie mir den ersten Test nach den Ferien mit der vollen Punktzahl zurückgab.
Mathe war nicht das Einzige, wo Helge sich wundersamerweise auskannte. Mein Vater konnte sich mit ihm über die allerneusten Theaterstücke von Anne Lepper, Esther Becker oder Katja Brunner unterhalten. Meine Mutter beriet er weiterhin im Garten, und sie gab ihm im Nachhinein immer recht, wenn sie es am Ende doch anders gemacht hatte, weil sie wieder mal auf einen Gartenblogger im Internet hereingefallen war. Helge prahlte nicht mit seinem Wissen, und wenn man im Gespräch mit ihm mal danebenlag, berichtigte er sanft, ohne sich lustig zu machen oder einem das Gefühl zu geben, dumm zu sein. Von seiner schmächtigen Statur ging eine einladende Wärme aus. Aber vielleicht wäre Harmlosigkeit auch das treffendere Wort. Ich könnte problemlos behaupten, und wäre damit aus dem Schneider, ich sei mit meiner Recherche darauf aus gewesen, unserem Helge ein Denkmal zu setzen. Aber wenn ich ehrlich bin, versprach ich mir von einem Text über ihn das sichere Eintrittsticket in den Journalismus. Wer ein so grosses Geheimnis aus seiner Vergangenheit machte, der hatte doch bestimmt Leichen im sprichwörtlichen Keller, nicht? Ich begann mich umzuhören und Fragen zu stellen, das Puzzle namens Helge Stück für Stück zusammenzusetzen. Ich verrate nicht wie, aber um ein Haar wäre es mir sogar gelungen, an seine alten Steuererklärungen heranzukommen. In seinen Garten an jenem drückenden Dienstagmorgen kam ich nur, um ihn mit meinen Entdeckungen zu konfrontieren.
Stimmt es, Helge, dass Hauenstein nicht dein wirklicher Name ist? Heisst du in Wirklichkeit nicht Friedrichsen, Helge Friedrichsen? Bist du, vor inzwischen über dreissig Jahren, als einer der führenden Biologen in Ungnade gefallen, weil du die Fachwelt für ihre überkommenen Vorstellungen von Leben und dessen Bedeutung heftig kritisiert hattest? Ist es wahr, dass du eines Morgens einfach nicht zur Arbeit am Institut, das damals deinen Namen trug, erschienen bist und nicht mehr erreichbar warst, verschwunden, untergetaucht, abgehauen, vielleicht nach Montana, munkelten galgenhumorig die ratlosen Kollegen und Doktorandinnen, in Anlehnung an den Titel deines Buches mit
Naturbeobachtungen und -beschreibungen? War dieser Schritt mit deiner Frau, Ulrike Friedrichsen, geborene Hauenstein, abgesprochen oder hast du diese Entscheidung ganz allein getroffen, woran letztlich eure Ehe zerbrochen ist? Als deine Ersparnisse aufgebraucht waren, hast du dich wenigstens ein wenig schuldig gefühlt, weil du dich egomanerweise vor allem mit deinen Ideen zur Selbstversorgung beschäftigtest, statt dir eine bezahlte Arbeit zu suchen, und deine Exfrau finanziell allein für die gemeinsamen Kinder aufkommen musste? Wessen Einfall war es, den angrenzenden Garten zu pachten und eine Bresche in die Hecke zu schlagen? Empfindest du eine Mitschuld daran, dass deine Exfrau, die sich zu dem Zeitpunkt einer Karzinombestrahlung unterzog, am Steuer einschlief und in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenprallte? Was hast du all dem hinzuzufügen?
Aber natürlich war ich zu feige, Helge diese Fragen wirklich zu stellen. Und vielleicht habe ich hie und da auch zu dick aufgetragen: Handelte es sich bei den eingekreisten Stichworten in meinem Notizbuch nicht mehrheitlich um Indizien und wilde Gerüchte, die in unserer Gartenkolonie schon seit Jahrzehnten die Runde machten? Nachdem auch das zweite Glas Holunderlimonade ausgetrunken war, zog ich meine Ausgabe von «Vielleicht nach Montana» aus dem Jutebeutel und fragte Helge, ob er das Buch seines Namensvetters kenne. Helge schüttelte den Kopf – ich glaube, es war das erste Mal, dass er eine meiner Fragen tatsächlich beantwortete – und streckte interessiert die Hand aus. Er betrachtete die schlichte weisse Schrift auf dem dunkelblauen Umschlag, dann schlug er die erste Seite auf, und ich sah, wie seine Augen von Zeile zu Zeile sprangen. Ob ich es ihm leihen könne, fragte er nach einer Weile. Die Bitte hatte ich nicht erwartet, und weil mir auf die Schnelle keine Ausrede einfiel, bejahte ich. Ich sei ja gespannt, ob ihm das eine oder andere bekannt vorkomme, schob ich noch vielsagend hinterher. Als ich eine Woche später meine Eltern im Garten besuchte –der Bewerbungsschluss für die Journalistenschule rückte näher und ich hatte immer noch kein Wort geschrieben –, wuchs da, wo früher die Lücke in der Hecke gewesen war, ein üppiger Strauch Stachelbeeren und versperrte den Durchgang. Ich könne wie alle anderen auch das Tor benutzen, wenn ich Helge besuchen wolle, verteidigte sich meine Mutter, und ausserdem sei es eine neue, besonders hitzeresistente Sorte, Helge selbst habe den Strauch vorbeigebracht und ihr geholfen, ihn zu pflanzen. Er habe übrigens noch etwas für mich dagelassen. Sie ging ins Haus und kam mit meinem Buch zurück. Das Herz klopfte mir bis zum Hals. Würde ich gleich eine Widmung vorfinden, das Eingeständnis, dass ich ihn durchschaut hatte? Aber als ich das Buch aufschlug, entdeckte ich nur ein paar weiche Bleistiftstriche, mit denen Helge schiefe Vergleiche markiert hatte. Am Rand vermerkte er, dass der Text zu viele faktische Ungereimtheiten enthalte – in Montana beispielsweise wüchsen keine Sukkulenten.

DMITRIJ GAWRISCH, geboren 1982 in Kyjiw, Ukraine, studierte Wirtschaftswissenschaften in Bern. Er schreibt Theaterstücke und Prosa und arbeitet als Redaktor beim Magazin Reportagen. Seine Patchwork-Komödie «Die Dampfnudel» ist im Herbst am Theater Winkelwiese in Zürich zu sehen.


ERLEBEN SIE BASEL, BERN UND ZÜRICH AUS EINER
NEUEN PERSPEKTIVE.
Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.
Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich. Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang
Surprise verlost in Kooperation mit Toggenburger Naturseifen 8 tolle Preise im Gesamtwert von über CHF 150.–. Finden Sie das Lösungswort und schicken Sie es zusammen mit Ihrer Postadresse an info@surprise.ngo (Betreff «Rätsel 580») oder an Surprise, Münzgasse 16, 4051 Basel. Tipp: Das gesuchte Wort kommt in einem der Texte dieser Ausgabe vor. Einsendeschluss ist der 29. August 2024. Wir wünschen viel Spass beim Rätseln und viel Glück!
Die Gewinner*innen werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Ihre Adressdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und ausschliesslich von Surprise für Marketingzwecke verwendet.


Die Toggenburger Naturseifen sind Julia, Astrid und Angela Nigg: Ein kleines Familienunternehmen, das seit bald 20 Jahren kaltgerührte Naturseifen und weitere naturkosmetische Produkte herstellt.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Automation Partner AG, Rheinau
Anyweb AG, Zürich
Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich
Gemeinnützige Frauen Aarau
Gemeinnütziger Frauenverein Nidau Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
Beat Hübscher – Schreiner, Zürich KMS AG, Kriens
Brother (Schweiz) AG, Dättwil Coop Genossenschaft www.wuillemin-beratung.ch
Stoll Immobilientreuhand AG movaplan GmbH, Baden
Maya Recordings, Oberstammheim
Madlen Blösch, Geld & so, Basel onlineKarma.ch / Marketing mit Wirkung Scherrer + Partner GmbH www.dp-immobilienberatung.ch
Kaiser Software GmbH, Bern Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Heller IT + Treuhand GmbH, Tenniken
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Bodyalarm GmbH – time for a massage Fäh & Stalder GmbH, Muttenz
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung. Kontakt:
Wie wichtig
Das Programm Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.
Eine von vielen Geschichten Negasi Garahlassie gehört unterdessen schon fast zum Winterthurer Stadtbild. Seit rund 15 Jahren ist Negasi Garahlassie als Surprise-Verkäufer tätig. Entweder verkauft der gebürtige Eritreer seine Magazine auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof Winterthur. Der Arbeitstag des 65-Jährigen beginnt frühmorgens und dauert meist so lange, bis der abendliche Pendelverkehr wieder abgenommen hat. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen ist er auf das Einkommen des Strassenmagazinverkaufs angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das SurPlus-Programm unterstützt ihn dabei: Mit Krankentaggelder, bezahlten Ferientagen und einem Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus
Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.
Spendenkonto:
Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
· ½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
· 1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90
info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!
#Stadtrund g än g e Bern mit Kathy Messerli «Geniale Sprecherin»
Kathy Messerli hat mich in den Bann genommen, von Beginn bis zum Schluss. Sie ist eine geniale Sprecherin, wirkte auf mich sehr authentisch. Danke, durfte ich sie kennenlernen!
MADELEINE BÄHLER, Meikirch
#Stadtrund g än g e Basel mit Lilian Senn «Ausgesprochen überzeugend»
Die Darstellung des persönlichen Schicksals und der Einblick ins Leben auf der Strasse waren ausgesprochen überzeugend. Der grosse Freiheitswille, die Weigerung, sich den relativ einschneidenden Regeln für Sozialhilfebeziehende zu unterziehen und die Bereitschaft zu kämpfen kamen sehr glaubhaft rüber und haben uns beeindruckt.
MARKUS SPÄTH-WALTER, Feuerthalen
Imp ressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe: Diana Frei (dif), Sara Winter Sayilir (win), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea) T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
#Stadtrund g än g e Zürich mit Sandra Brühlmann «Augenmerk auf die Frau»
Sandra Brühlmanns Wille, ihre Kraft und ihr Mut haben uns alle sehr beeindruckt. Die Geschichte, die sie mit uns geteilt hat, ist einfach nur krass. Es ist nicht selbstverständlich, aber umso berührender, dass sie ihr Leben auf der Strasse uns mitgeteilt hat. Brühlmanns authentische, ehrliche und offene Art macht die Tour und ihre Stationen lebendig. Gemischt mit den Fakten rund um Sucht, psychische Erkrankung und Obdachlosigkeit sowie dem Augenmerk auf die Frau, erhielten wir einen Einblick in grosse Not und die Wichtigkeit von sozialen Einrichtungen. Danke auch dafür, dass Sandra Brühlmann auf Wetter und Temperatur reagiert hat und wir frühzeitig an die Wärme konnten.
VALERIA BONIN, Zürich
#576: Auf g elesen
«Zu wenig Wohnungen»
Die Zeitschrift, die findet, man solle alle Flüchtlinge hereinlassen, berichtet, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es zum Lachen.
FARINA HIROSHIGE, Basel
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Emelie Asplund, Nelio Biedermann, Malin Clausson, Dmitrij Gawrisch, Alice Grünfelder, Yael Inokai, Milena Moser, Ingo Petz, Sebastian Steffen, Nando von Arb
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage 23 800
Abonnemente CHF 250.–, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt. IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.
25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)
Gönner-Abo für CHF 320.–
Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)
Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–
Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.
Bestellen
Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90
Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel
Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo
Internationales Verkäufer*innen-Porträt
Der Tag, an dem Axel Bertil Roland Schöneman geboren wurde, war in jeder Hinsicht ein stürmischer Tag: Vater Oscar brachte seine schwangere Frau im Wohnwagen ins Spital, vergass in der Aufregung aber, die Herdplatte auszuschalten. Als die Familie mit dem neugeborenen Bertil zurückkehrte, war das Fahrzeug vollständig ausgebrannt: Es hatte Feuer gefangen. Heute lacht der 66-Jährige darüber und hängt noch eine weitere ähnliche Anekdote über seinen Vater dran: «Es war Silvester, da war ich so um die zehn Jahre alt. Mein Vater war der Meinung, dass wir das neue Jahr ordentlich einläuten sollten und hatte ein grosses Feuerwerk gekauft. Doch er wusste nicht, wie man es zündet. So befestigte er die Rakete mit einer Klemme am Balkongeländer, und das war’s. Das Geländer ging in Flammen auf.»
Überhaupt spielte sein inzwischen verstorbener Vater Oscar für Bertil eine wichtige Rolle. Für viele war er ein Trinker, unzuverlässig und schwierig im Umgang. Ja, sagt Bertil, sicher habe er gerne getrunken, doch sei er auch ein liebevoller und fürsorglicher Vater gewesen. «Er verbrachte viel Zeit mit mir, dem jüngsten der vier Kinder. Er ging mit mir zu den Pfadfindern und in Fussballstadien.» Noch heute ist Bertil ein glühender Fan von BK Häken, einem Fussballverein aus Göteborg, wo Bertil seit Jahrzehnten lebt.
Schon als Kind hatte Bertil gesundheitliche Probleme. Er litt schon früh unter Panikattacken, weshalb er in der Schule oft fehlte oder sich nicht gut konzentrieren konnte. Zudem wurde bei ihm Krupp diagnostiziert, eine Infektion der oberen Atemwege, die das Atmen erschwert und mit einem heftigen Husten einhergeht. Eine Zeitlang ging es ihm besser, genauer gesagt zehn Jahre lang. «Zwischen dem 13. und 23. Lebensjahr war ich gesund, die einzige Phase in meinem Leben», sagt Bertil. «Und auch dann nur einigermassen.» Und er meint damit: Schon als Jugendlicher musste er viele Medikamente nehmen – sodass er eine Abhängigkeit entwickelte. Kam hinzu, dass mit Mitte zwanzig eine seiner Nebennieren versagte sowie eine Aorta platzte. Seine ständigen Krankheiten, sagt Bertil im Rückblick, seien der Ausschlag dafür gewesen, dass es bei ihm bachab ging. Er rutschte in die Drogen ab, verlor seinen Job als LKW-Fahrer für Musikbands, konnte die Miete nicht mehr bezahlen und wurde obdachlos. Irgendwann hörte er von der Strassenzeitung Faktum, meldete sich im Büro und begann wenig später mit dem Heftverkauf; das ist inzwischen etwas mehr als zehn Jahre her.
Die Eltern von Bertil sind längst verstorben, zu seinen Geschwistern hat er kaum noch Kontakt. Er hatte einige Liebesbeziehungen in seinem Leben, manche dauerten einige Jahre, eigene Kinder hatte Bertil nie. Sein Ersatz seien, wie er scherzhaft sagt, die Kinder seiner Schwester. Er verbringt viel Zeit mit ihnen und macht ihnen bei jeder Gelegenheit kleine Geschenke: «mit dem Trinkgeld, das ich durch den Verkauf der Strassenmagazine bekomme».

Trotz seines Gesundheitszustands schaut Bertil positiv auf sein Leben – was er eigentlich ganz normal findet. «Meine bisherige Reise war hart, doch ich habe viel gelernt und kann mich nicht beklagen.» Ihm gehe es heute vergleichsweise gut. Unter den Faktum-Verkäufer*innen habe er einige Freunde gefunden, auch freue er sich an seinen Stammkund*innen, die ihm regelmässig ein Heft abkaufen. Abends, nach der Arbeit, gehe er nach Hause und geniesse die Ruhe. Eines weiss Bertil ganz genau: «Ich will nie wieder in ein Krankenhaus!» Am liebsten würde er bei sich zuhause sterben. Was einst auf seinem Grabstein stehen wird, hat er sich bereits überlegt, es ist eine Zeile aus einem Song des schwedischen Bluesmusikers Totta Näslund: «Er hat stets sein Bestes gegeben.»
Aufgezeichnet von MALIN CLAUSSON
Mit freundlicher Genehmigung von FAKTUM / INTERNATIONAL NETWORK OF STREET PAPERS


Der Verkauf des Strassenmagazins Surprise ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, einer
Arbeit nachzugehen und den sozialen Anschluss wiederzufinden.
Alle
Ein
Strassenmagazin kostet 8 Franken.
Die Hälfte davon geht an den*die Verkäufer*in, die andere Hälfte an den Verein Surprise.
Das Heft erscheint alle 2 Wochen. Ältere Ausgaben werden nicht verkauft.
Verkäufer*innen tragen gut sichtbar einen Verkaufspass mit einer persönlichen Verkaufsnummer. Diese ist identisch mit der Nummer auf dem Magazin.
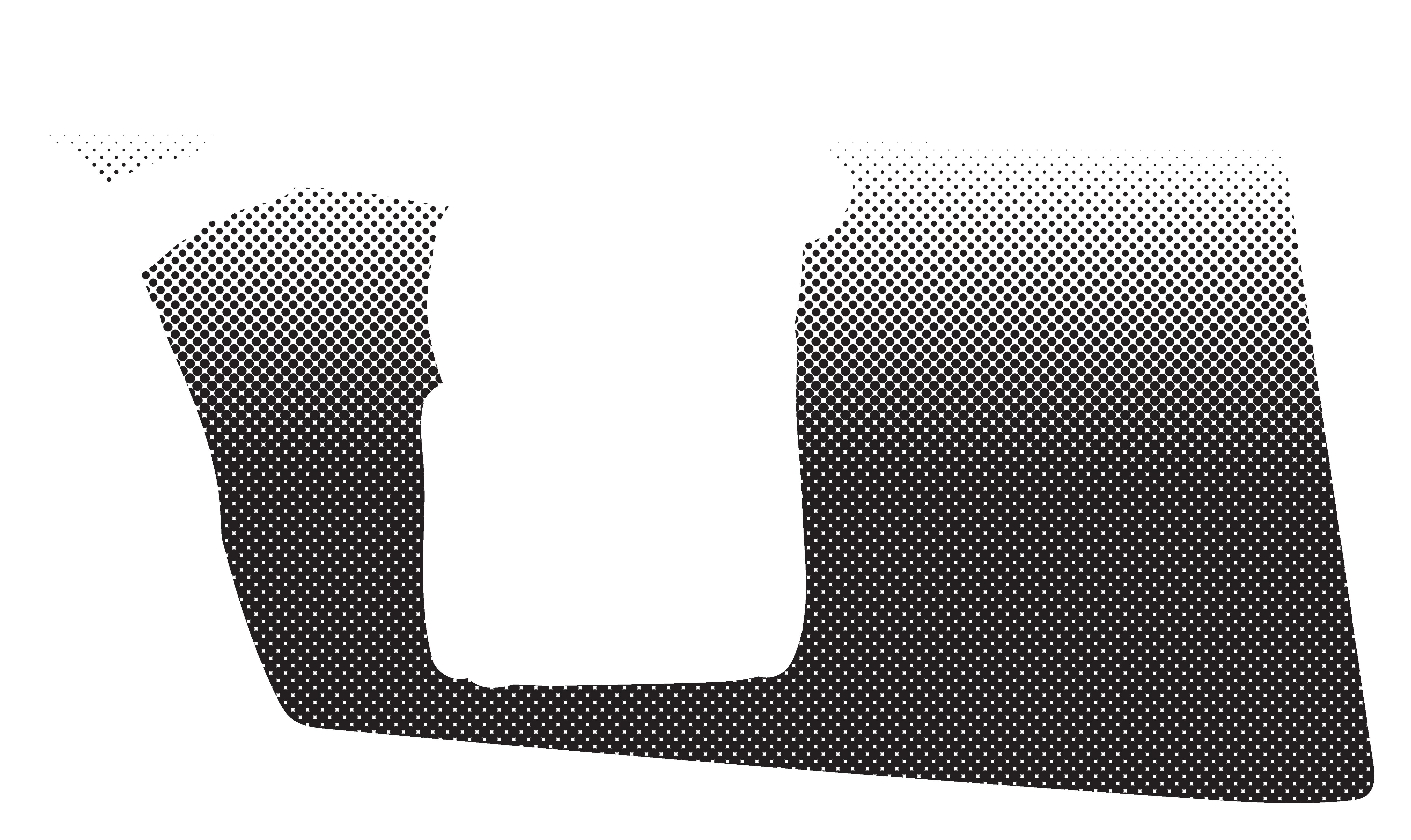
info@surprise.ngo