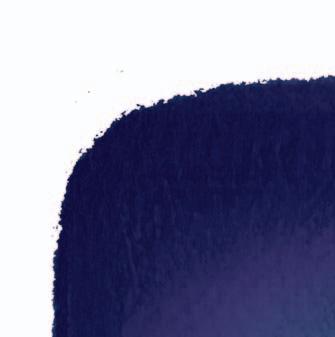Einst gefragte Bergleute, hat die Gesellschaft heute keinen Platz mehr für sie: Alte ohne familiäre Anbindung.
Seite 8
Kirgistan Im Heim
Strassenmagazin Nr. 573 19. April bis 2. Mai 2024 Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen CHF 8.–










Ermöglichen Sie Selbsthilfe.
Spenden Sie jetzt.
Spendenkonto: Verein Surprise, CH-4051 Basel
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
www.surprise.ngo





Bild: Marc Bachmann
UND GEN ARMUT UND AUSGRENZUNG
SURPRISEWIRKT SURPRISE WIRKT GEGEN ARMUT
Willkommen sein
In der Schweiz gibt es rund 1500 Pflegeheime, sie bieten Platz für über 96 000 Menschen im Alter. In Kirgistan in Zentralasien, wo auf fast fünf Mal so viel Raum wie in der Schweiz knapp sieben Millionen Menschen leben, gibt es offiziell sechs Pflegeheime.
Während in der Schweiz darüber diskutiert wird, wie die immer höheren Kosten finanziert werden können – ein Monat in einem Pflegeheim kostet über 10 000 Franken –, versucht in Kirgistan der Staat zu verhindern, dass Familien ihre Verwandten in Pflegeheime geben. Wer das tut, muss eine Strafe von umgerechnet bis zu 500 Franken bezahlen. Eines der sechs kirgisischen Pflegeheime befindet sich in der ehemaligen Bergbaustadt Sülüktü an der Grenze zu Tadschikistan. Weil ihre Kinder nach dem Ende der Sowjetunion ins Ausland gegangen sind, leben dort im Pflegeheim viele ehemalige Bergleute. Die Reportage über Migration, Armut, Einsamkeit und Korruption lesen Sie ab Seite 8.
4Aufgelesen
5Vor Gericht Kriminalität ist normal
6Verkäufer*innenkolumne Mein Sohn
7Moumouni antwortet
Was will Moumouni wirklich gefragt werden?
Der Kanton Neuenburg plant, was der Kanton Genf schon gemacht hat: eine breitflächige Regularisierung von Sans-Papiers. 2017 und 2018 haben in Genf im Rahmen der «Opération Papyrus» 2900 Sans-Papiers eine Aufenthaltsbewilligung erhalten. Nach der Abstimmung im Neuenburger Grossen Rat Ende Februar jubelte Initiant Julien Gressot (Partei der Arbeit). «Diese Abstimmung ist historisch! Neuenburg gehört nun zum kleinen Kreis der Kantone, die in dieser Frage Pionierarbeit leisten.»
Auf nationaler Ebene hätte ein solcher Vorstoss in der Schweiz kaum Chancen. Weiter sind hier Länder wie Irland und Kolumbien. Sie haben den Aufenthaltsstatus von Sans-Papiers im grossen Stil regularisiert, in Kolumbien erhielten durch das Regularisierungsprogramm 1,6 Millionen Menschen eine Aufenthaltsbewilligung. Wie das funktioniert hat, lesen Sie ab Seite 16.


Surprise 573/24 3 Editorial
5Na? Gut! Weniger Abholzung
Im Pflegeheim
Regularisierung in Irland und Kolumbien 22 Medizinische Versorgung in der Schweiz 24 Literaturfestival Gegen Ängste anschreiben 26Veranstaltungen 27Tour de Suisse Pörtner in Zofingen
Positive Firmen
Surprise Impressum Surprise abonnieren
8Kirgistan
16Sans-Papiers
28SurPlus
29Wir alle sind
30Surprise-Porträt «Ich wäre gerne wieder unabhängig» TITELBILD: DANIL USMANOV
Redaktorin
LEA STUBER
Aufgelesen
News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.


Mutter auf Zeit
Sie springen ein, wenn ein Baby oder Kleinkind nicht mehr in der Familie bleiben sollte, weil die Eltern sich nicht um ihre Kinder kümmern können, krank oder abhängig sind: die Bereitschaftspflegemütter. In der Stadt München wird diese Form der Care-Arbeit nun erstmals von der öffentlichen Hand subventioniert
Unsicherer Ort
Frühlingshaftes Treiben
Es ist das grösst e Frühlingsfest Kanadas: das Chinatown Spring Festival. Im Februar fand es zum 50sten Mal statt und läutete das aktuelle «Jahr des Drachens» ein. 200 000 Menschen nahmen an dem Spektakel teil. Die Chinatown ist ein historisches Stadtviertel von Vancouver, das in den 1880er-Jahren erstmals von Chines*innen besiedelt wurde. Heute zählt es zu den grössten Chinatowns im Land.

1 Auch shoppen war Teil der Feierlichkeiten.
2 Drachentänzer flirtet mit den jüngsten Zuschauer*innen am Rand.
3 In vollem Ornat zog die Parade durch den Stadtteil.
Vor 48 Jahren öffnete in Deutschland das erste Frauenhaus. Seither ist viel passiert, um Gewalt gegen Frauen öffentlich wie rechtlich immer mehr zu thematisieren. Dennoch haben die Straftaten in den vergangenen Jahren erneut zugenommen. Allein in Baden-Württemberg wurden vergangenes Jahr 11 479 Fälle von häuslicher Gewalt registriert, davon waren bei 70,1 Prozent weibliche Personen betroffen. Bisher gibt es dort 44 Frauenhäuser mit 835 Plätzen, weitere 600 Plätze werden benötigt.

Gewalt gegen Geflüchtete
Für das Jahr 2023 registrierte das Bundesinnenministerium 2378 mutmasslich politisch motivierte Angriffe auf Geflüchtete, darunter 313 Gewaltdelikte. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr.

4 Surprise 573/24
MEGAPHONE, VANCOUVER
BODO, BOCHUM/DORTMUND
1 2 3 BISS, MÜNCHEN TROTT-WAR, STUTTGART BILDER: LUIS JAIME SUÁREZ AHUMADA
Na? Gut!
Weniger Abholzung
Er bedeckt sechs Millionen Quadratkilometer in neun Ländern Südamerikas. Kein Regenwald der Welt ist als CO2-Speicher und im Kampf gegen die Klimakrise so wichtig wie jener im Amazonasgebiet.
Nun wurde im Amazonas-Regenwald in Brasilien Anfang Jahr so wenig abgeholzt wie seit sechs Jahren nicht mehr. Um 63 Prozent sank die Entwaldung im Januar und Februar verglichen mit Anfang 2023, wie die Umweltschutzorganisation Imazon mitteilte. Trotz dieses Rückgangs wurden in den zwei Monaten noch immer 196 Quadratkilometer abgeholzt. Das macht pro Tag durchschnittlich 327 Fussballfelder.
Unter Jair Bolsonaro, bis Ende 2022 Präsident Brasiliens, war die Abholzung verglichen mit dem Durchschnitt des vorherigen Jahrzehnts um 75 Prozent gestiegen. Als Luiz Inácio Lula da Silva 2023 das Amt übernahm, setzte er sich zum Ziel, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken sowie die Abholzung zu bekämpfen. Ziel bis 2030 ist die Nullabholzung.
Schon 2023 ist die Entwaldung in Brasilien zurückgegangen, und zwar um ganze 36 Prozent. 2022 war Brasilien noch für 43 Prozent der weltweiten Verluste an tropischen Wäldern verantwortlich, 2023 lag der Anteil laut dem World Resource Institute und der Universität von Maryland in den USA nur noch bei weniger als einem Drittel. Das sei darauf zurückzuführen, dass Lulas Regierung Gesetze und Regelungen der Bolsonaro-Zeit rückgängig gemacht, neue indigene Schutzgebiete ausgewiesen und Massnahmen gegen illegale Rodungen ausgeweitet hat. LEA
An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.


Vor Gericht
Kriminalität ist normal
Wahrscheinlich haben Sie’s mitgekriegt: Die Schweiz ist unsicherer geworden. Um 14 Prozent ist die Kriminalität gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes hervorgeht. Insgesamt wurden 522 558 Straftaten registriert. Besonders deutlich war der Anstieg mit 17,6 Prozent bei Vermögensdelikten, also Diebstählen oder Einbrüchen – sie machen rund 70 Prozent der Straftaten aus. Die übrigen 30 Prozent betreffen Gewaltstraftaten gegen Leib und Leben. Auch sie sind im Plus, 1,5 Prozent, vor allem die schweren Gewaltdelikte.
Aber was bedeuten die Zahlen? Ist die Schweiz nun ein failed Chaos-Staat? Mit einer überforderten Justiz und untätiger Politik? Dieser Eindruck entsteht zumindest bei einem Blick in die Kommentarspalten der grösseren Tageszeitungen. Einer schreibt: «Mord und Totschlag werden alltäglich», eine andere: «Alles läuft aus dem Ruder!» Volkes Seele kocht, der Grundtenor der Hunderten von Wortmeldungen zur neuen Kriminalstatistik: Wann endlich können die Schweizer*innen wieder sicher und angenehm leben? Weg mit den Samthandschuhen, hart durchgreifen, jetzt!!!
Der Umgang mit Kriminalität ist für jede Gesellschaft eine diffizile Herausforderung, denn über sie verhandeln wir laufend die Regeln unseres Zusammenlebens. Aber erst indem diese Regeln übertreten werden, werden sie überhaupt sichtbar –und genau das geschieht durch Kriminalität. Mit ihrer Reaktion darauf festigt eine
Gesellschaft umgekehrt ihre Normen. In diesem Sinne, das sagte der französische Sozialwissenschaftler Emile Durkheim, sei Kriminalität normal, ja gar notwendig für die gesellschaftliche Entwicklung.
Die alljährliche öffentliche Empörung nach der Publikation der Kriminalstatistik lässt tief blicken. Was sich immer wieder daraus ablesen lässt: Inländerkriminalität ist nicht der Rede wert. Auch nicht, dass Männer immer noch viel gewalttätiger sind als Frauen. Von den 1965 schweren Gewalttaten wurden 1834 von Männern verübt – in 1096 Fällen waren Frauen die Opfer. Bei den Zahlen zu häuslicher Gewalt (25 Tote, unverändert gegenüber 2022) oder zu Sexualstraftaten (839 Vergewaltigungen, minus 3 Prozent) fehlen Angaben zu Geschlechterverhältnissen. Offenbar besteht da kein grösseres öffentliches Interesse, genau hinzuschauen.
Ausser natürlich bei Ausländer*innen. Seit der SVP-Motion «Transparenz über die Herkunft von Kriminellen» von 2007 wird in Kriminalstatistiken auf Bundesebene neben der Straftat auch das Herkunftsland der Beschuldigten erfasst. Einigen geht das noch zu wenig weit – in vielen Beiträgen in den erwähnten Leser*innenforen wird gefordert, dass nun auch zwischen Schweizer*innen mit und ohne Migrationshintergrund unterschieden werden solle. Das zeigt, wie sehr die öffentliche Debatte um Kriminalprävention zu einer Zuwanderungsdebatte geworden ist. Wenn die – Zitat SVP – «niederträchtigen Frauenschänder» erstmal ausgeschafft und die Grenzen dicht sind, so der Lösungsansatz, haben wir auch die Kriminalität wieder im Griff. Dann gibt es nur noch inländische Vergewaltiger. Und die sind ja ganz normal.
YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.
Surprise 573/24 5
ILLUSTRATION: PRISKA WENGER
Mein Sohn
Mein Sohn ist jetzt 30 Jahre alt.
Er kam mit einem Herzproblem zur Welt. Es wurde aber nicht entdeckt, bis er sechs Jahre alt war. Es wurden ihm dann Medikamente verschrieben. Eine weitere Möglichkeit, ihn zu behandeln, konnten wir in Eritrea nicht finden. Als er 13 Jahre alt war, erhielten wir eine Chance: eine medizinische Behandlung in Italien.
Dort sagten uns die Ärzt*innen, die Krankheit sei sehr gefährlich. Sie sagten auch, das Risiko für eine Operation sei zu gross. Ich solle mit meinem Kind nach Hause zurückkehren. Die Situation hat mich erschreckt.
Ich sagte: Ich bin jetzt hierhergekommen und ich versuche diese Chance zu packen, egal wie hoch das Risiko ist. Sie schickten mich weg. Wir blieben in der Stadt, wir wohnten drei Wochen lang in einer Kirche. Dann rief das Spital doch wieder an. Ein Arzt führte zwei Stunden lang ein Gespräch mit uns und sagte, er würde es versuchen. Die Operation dauere zwischen sechs und acht Stunden, und er gebe mir sofort danach per Handzeichen Bescheid, wie es gelaufen sei.
Erfolgreiche OP: Daumen hoch. Unsicher: Er wiegt mit der Hand ab. Und wenn es chancenlos oder wenn etwas passiert sei, zeige er mir mit der Hand ein Stoppzeichen. Nach siebeneinhalb Stunden zeigte er mir den Daumen hoch. Sie sagten, mein Sohn käme auf die Warteliste für ein Spenderherz.
Ich solle nach Hause gehen und alle drei Monate zur Kontrolle kommen. Da sagte ich: Ich kann nicht zurückkehren. Ich kann nicht aus Eritrea alle drei Monate zur Kontrolle kommen.
Das war das letzte Gespräch mit dem Arzt, danach sah ich ihn nicht mehr. Ich hatte noch acht Tage Zeit, danach lief mein Visum ab. Ich ging zur Polizei und fragte, was ich tun solle. Sie sagten, der Arzt hätte mir eine entsprechende Bestätigung für eine Verlängerung geben müssen.
Ich entschied mich, in die Schweiz weiterzureisen. Ich wollte es einfach versuchen. Es ging mir nur darum, meinen Sohn zu retten. An etwas anderes dachte ich gar nicht mehr. Wo sollte ich mit meinem Kind denn hingehen? Die Schweiz war in der Nähe und ich wusste, dass sie humanitäre Hilfe leistet.
In Chiasso stellte ich ein Asylgesuch. Nach einem Monat durften wir ins Kinderspital Zürich. Hier wurde mein Sohn nochmals operiert, ihm wurde ein Implantat eingesetzt, eine Maschine, um das Herz zu unterstützen. Bis jetzt, sagen die Ärzt*innen, sehe alles gut aus.
TSEHAY BIRHANE, 57, verkauft Surprise in Pfäffikon ZH und arbeitet bei Surprise als Raumpflegerin. Ihr Sohn hat eine Lehre als Elektriker abgeschlossen. Weil sein Herzimplantat auf diesem Beruf aber zum Risiko wurde, wechselte er zu einer Verkaufslehre, die er demnächst abschliesst.
Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autoren Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Verkäufer*innenkolumne
6 Surprise 573/24
ILLUSTRATION: FABIAN MEISTER

Moumouni antwortet
Was will Moumouni wirklich gefragt werden?
Was bedeutet es, einen Raum zu betreten? Was bedeutet es, einen Raum zu betreten? von links?
mit links?
von rechts?
mit Recht?
zu Recht
von unten?
von oben herab?
Was bedeutet es, einen Raum betreten zu dürfen? zu können? zu wollen?
Was bedeutet, es im Raum zu stehen –und zu sagen: Was bedeutet, es im Raum zu stehen? Was bedeutet, es im Raum zu stehen und zu sagen: Da fehlt doch was. Was bedeutet, es im Raum zu stehen und zu sagen: Stopp. Oder: Äh äh! Oder: Nein! Was bedeutet,
es im Raum zu stehen und zu sagen: Willkommen! Was bedeutet es im Raum zu stehen und zu fragen: Was soll das denn sein? Was bedeutet es, im Raum zu stehen und zu fragen: Warum bin ich nicht hier? Was bedeutet, es im Raum zu stehen und zu fragen: Warum gibt es mich nicht?
Was bedeutet es, im Raum zu stehen und zu fragen: Warum musste ich mich erst finden? Warum musste ich mich erst suchen, bevor ich mich fand? Und: Was kuckst du? Siehst du, dass ich zurück kucke?
Kuck ma, wer kuckt hier wen an?
Kuck, wo sind wir?
Wo sind wir? Wo warn wir? Kuckuck! Hallo? Wo – sind – wir?
Warum kannte ich mich nicht?
Warum kannte ich das nicht?
Warum kennst du das nicht?
Warum wusste ich nicht, wer noch?
Warum wusste ich nichts?
Warum? Wo?
Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, und wir sind alle gleich. Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, und ihr könnt sie nicht auseinanderhalten.
Ich kenne nur die, die aussehen wie wir und sich doppelt anstrengen müssen.
Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, denen misstraut wird.
Ich kenne nur die, die aussehn wie wir –Ich kenne nur die, die aussehn wie wir und sich distanzieren sollen. Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, die nicht zur Schweiz gehören. Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, die angestarrt werden. Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, und abgeschoben werden. Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, und im Mittelmeer ertrinken.
Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, die fliehen müssen. Ich kenne nur die, die aussehen wie wir, an deren Sterben hat man sich gewöhnt. Ich kenne nur die, die aussehn wie wir, und die gibt es nicht.
Bis ich von denen gelernt hab, die es gibt. Bis ich von denen gelernt hab, die nein sagen. Bis ich von denen gelernt hab, die «Stopp» gesagt haben. Bis ich von denen gelernt hab, die «Nein» sagen werden. Bis ich von denen gelernt hab, die «Stopp» sagen werden.
Bis ich von denen gelernt hab, die werden. Bis ich von denen gelernt hab, die waren. Bis ich von denen gelernt hab: Die waren schon immer da.
Was bedeutet es, einen Raum zu betreten und zu sagen: Wir waren schon immer da!

FATIMA MOUMOUNI
denkt gerne über Räume nach. Ab dem 25. April im Rahmen der Ausstellung «Widerstände. Vom Umgang mit Rassismus in Bern» im Bernischen Historischen Museum.
Surprise 573/24 7
ILLUSTRATION: CHRISTINA BAERISWYL

Abgestellt und notdürftig versorgt
Kirgistan Im zentralasiatischen Land wohnen ältere Menschen eigentlich bei ihren Kindern. Viele Erwerbstätige haben das Land jedoch verlassen. Zurück bleiben ihre Eltern. Ein Besuch in einem Heim.
8 Surprise 573/24
TEXT EMILIA SULEK FOTOS DANIL USMANOV K IR G ISTAN Sülüktü



Früher lebten in Sülüktü 24 000 Menschen, heute noch 15 000.
Sülüktü liegt am Rand des Ferganatals, das Kirgistan sich mit Usbekistan und Tadschikistan teilt.
Rinat Sibuschev, 70 Jahre alt und ein Charmeur, trägt gern einen Hut auf dem Kopf und einen Siegelring am Finger. Mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt er auf dem Sofa, eine Hand auf der Sofalehne, die andere auf dem Knie. Fehlt nur die Zigarette in der einen Hand und der Cognac in der anderen. «Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Kann ich mir nicht leisten», er lacht rau. Und der Cognac? «Im Pflegeheim erlauben sie mir nur Bier.»
Sibuschev hat zehn Jahre im Bergwerk in Sülüktü im Südwesten Kirgistans gearbeitet, früher war sie eine der wichtigsten Bergbaustädte Zentralasiens. Ein Foto von ihm hing einst im Bergbaumuseum. Aber er war schon lange nicht mehr im Bergwerk, auch nicht im Museum. Vieles hat sich verändert. Früher mochte er Science-Fiction, im Pflegeheim gibt es jedoch nur wenige Bücher. Früher schaute er
gerne historische Filme, hier gibt es aber kein Kabelfernsehen; der Fernseher ist zu alt. Internet gibt es auch nicht. Letzteres stört Sibuschev wenig. Er hat nicht einmal ein Telefon. Und niemanden, den er anrufen könnte.
Die ehemaligen Bergarbeiter
Im Pflegeheim in Sülüktü leben mit Sibuschev insgesamt acht ehemalige Bergleute. Das ist fast die Hälfte der Bewohner*innen. Man merkt ihnen an, wie schwierig der Übergang vom relativen Wohlstand der Region zu Sowjetzeiten zum Niedergang nach der Perestroika war. Drei von ihnen sassen sogar im Gefängnis. Auch Sibuschev. «Nicht lange», er zeigt auf die fünf tätowierten Punkte auf seiner Hand. Ein Punkt steht für ein Jahr hinter Gittern. Angeblich wegen Diebstahl, genauer will er darüber nicht reden. «Der Zerfall der
UdSSR war das Schlimmste, was uns passieren konnte», sagt Sibuschev. Bergbau hatte damals strategische Bedeutung. Um Fachkräfte in so abgelegene Regionen zu locken, garantierte der sowjetische Staat attraktive Gehälter, moderne Infrastruktur und Versorgung, ähnlich derjenigen in Moskau. Zudem kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für Bergleute, auch Gesundheitsversorgung.
Heute werden von öffentlicher Hand keine Tänze mehr im Stadtpark veranstaltet. Im Bergarbeiterladen werden nur staubiger Cognac und geschmuggelte Zigaretten verkauft. Das Krankenhaus war früher eines der besten im Land. Es rühmt sich immer noch einer Sterblichkeitsrate, die angeblich bei null liegt. «Weil schwierigere Fälle woandershin gebracht werden», erklärt Sibuschev. «Selbst wegen eines entzündeten Blinddarms muss man nach Bat-
Surprise 573/24 9
Rinat Sibuschev (im gelben Hemd) mit anderen Bewohner*innen des Heimes beim Essen.

Sowjetische Mosaike im Zentrum erinnern an die glorreichen Zeiten des Bergbaus.

ken fahren.» Das ist eine halbe Tagesreise entfernt. «In meiner Jugend spielte es keine Rolle, welche Nationalität jemand hatte», erinnert sich Sibuschev. Seine Eltern kamen nach dem Zweiten Weltkrieg hierher. Aus Tatarstan, einer Autonomen Sowjetrepublik an der Wolga, im europäischen Teil der Sowjetunion, die jetzt zu Russland gehört. «Heute wird den Menschen eingeredet, dass ethnische Unterschiede ein Problem seien. Ich denke, das kommt jemandem gelegen.» Und meint damit zum Beispiel den russischen Präsidenten.
Nach dem Zerfall
Im Pflegeheim in Sülüktü leben Kirgis*innen mit Russ*innen und Tatar*innen unter einem Dach. Die Russ*innen sind in der Mehrzahl. Die meisten Bewohner*innen von Sülüktü sind irgendwann aus weit entfernten Teilen Russlands zugewandert. Auf
Sülüktü trifft der Begriff der Monostadt zu: eine Stadt, deren Wirtschaft auf einem einzigen Industriezweig beruht. Der Kohleförderung. Doch der Bergbau war abhängig von Logistik und Subventionen aus Moskau, mit dem Ende der Sowjetunion fanden sich die Menschen hier jedoch plötzlich in der unabhängigen Republik Kirgistan wieder. Und diese strebte marktwirtschaftliche Reformen an, die Privatisierung begann. Ohne Unterstützung gingen die Bergwerke bankrott. Die Ausrüstung wurde verkauft, die Leute wurden entlassen. Wer konnte, ging nach Russland. Ehen zerfielen. Kinder zogen aus, um Arbeit zu finden, in der Hoffnung, ihre Eltern eines Tages zu sich zu holen. Sülüktü schrumpfte von 24 000 auf 15 000 Einwohner*innen.
Auch Sibuschev ging nach dem Tod seiner Mutter zurück. Seine Brüder kamen zur Beerdigung und nahmen ihn mit ins

Heuten fliessen die Profite aus dem Bergbau vor allem in private Taschen.
über 2500 Kilometer entfernte Tatarstan, von wo seine Eltern einst gekommen waren. Er war über vierzig Jahre alt. «Zu spät für einen Neuanfang», sagt er. Fünf Jahre später kehrte er zurück. «Die Nostalgie hat mich gepackt.» Eine Weile arbeitete er wieder im Bergwerk als Wachmann. Dieses war nun jedoch im Besitz von Kirgisen. «Sie haben nur ihre eigenen Leute genommen. Uns wollte niemand.» Sibuschev ärgert sich, während er im lokalen Museum nach einem Foto von sich sucht. Vergeblich. «Überall nur kirgisische Gesichter. Man hat uns aus der Geschichte gestrichen.»
Sibuschev hat der Systemwandel nichts Gutes gebracht. In seiner Jugend bedeutete die Arbeit im Bergwerk soziales Prestige. Die Rente für Bergarbeiter war eine der höchsten. Diese Privilegien sind heute Geschichte. Sibuschev hat sein «Arbeitsbuch» verloren, darin war alles verzeichnet: Nun
10 Surprise 573/24

Schlechte Arbeitsbedingungen, viele Unfälle: Die Privatisierung hat Folgen.
Einst «Vereinigung der Bergarbeiter», heute Kulturzentrum.

gibt es keine Möglichkeit, die geleisteten Dienstjahre zu berechnen. Er erhält eine Rente von umgerechnet knapp 70 Franken und lebt damit unter dem Existenzminimum. Zwar zahlt die Sozialfürsorge für den Aufenthalt im Pflegeheim. Doch «jeder von uns zahlt noch drauf», sagt Sibuschev. «Ganz legal ist das nicht. Aber was wäre denn die Alternative?» Gefallen tut es ihm nicht: «Du bekommst schlechtes Essen und ein Dach über dem Kopf. In den Zimmern kannst du dich kaum zwischen den Betten hindurchquetschen. Im Winter frierst du neben dem elektrischen Heizgerät. Null Privatsphäre. Aber ich war obdachlos, ich hatte keine Wahl.»
Die Kinder im Ausland
In Kirgistan liegt das Durchschnittsalter bei knapp 24 Jahren, in der Schweiz ist es fast doppelt so hoch. Die meisten Kirgis*in-
nen im Pensionsalter leben bei ihren Familien. Der jüngste Sohn bleibt nach der Hochzeit in der Regel im Elternhaus, seine Frau und er übernehmen die Versorgung und Pflege. Kirgis*innen als Heimbewohner*innen sind also eher selten. Rosa Ohunova stammt immerhin aus der Region. Die Tochter der 60-Jährigen lebt in Isfana, eine halbe Stunde von Sülüktü entfernt. Doch der Schwiegersohn will nicht, dass Ohunova bei ihnen lebt.
Auch die anderen Heimbewohner*innen haben Kinder – sie leben im Ausland. Die Tochter von Basymov in der Türkei, der Sohn von Sibuschev in Russland. Sie haben seit Jahren keinen Kontakt. Der Staat Kirgistan versucht zu verhindern, dass Familien ihre Verwandten in Pflegeheime geben. Das Gesetz sieht dafür Geldstrafen von bis zu 500 Franken vor. Institutionelle Pflege im Alter hat in Kirgistan keine Pri-
orität, Geld wird dafür kaum zur Verfügung gestellt. Sechs Pflegeheime gibt es offiziell in Kirgistan. Das 2007 eröffnete Heim in Sülüktü ist formal eine «Einrichtung für alleinstehende ältere Menschen und Behinderte». De facto sind es jedoch Auffangorte für diejenigen, deren Kinder ins Ausland gegangen sind. In ganz Zentralasien müssen viele emigrieren, um ihre Familie zu ernähren.
Der neunzigjährige Marcel Basymov hat einst Landschaften gemalt, die trockenen Berge um Sülüktü haben ihre eigene Schönheit. Mit dem Ende der UdSSR, sagt er, versiegte seine Inspiration. «Jeder von uns könnte einen Roman über sein Leben schreiben.» Im Heim findet er es sterbenslangweilig. «Man misst die Zeit vom Frühstück bis zum Mittagessen, vom Mittagessen bis zum Abendessen.» Das Einzige, was sich verändert, ist, wer wann aufsteht. Um
Surprise 573/24 11
sieben Uhr schaut Rosa Ohunova in jedes Zimmer, um zu sehen, ob alle da sind. «Ob noch alle leben», betont Basymov, der mit Ohunova verheiratet ist. Nach dem Frühstück spielen sie Karten oder Schach. Und nach dem Mittagessen halten viele ein Nickerchen. Und schon ist es Abend. Ende des Tages.
Beim Kartenspiel ist auch Zeit zum Klagen. «Früher gab es ein Bergwerk und einen Besitzer. Heute gibt es vierzig, und jedes gehört jemand anderem», sagt ein ehemaliger Bergmann. «Sie haben Löcher in die Erde gemacht wie in einen Käse», spöttelt ein anderer. Heute würden sie sich nicht mehr unter Tage trauen. Tatsächlich sind Unfälle im Bergwerk ein häufiger Grund, warum Sülüktü in die Medien gelangt. Jedes Jahr sterben mehrere Menschen durch Erdrutsche oder Gasexplosionen. Dann kommen Arbeitsschutzkom-
missionen in die Stadt und untersuchen die Ursache, aber Sibuschev misstraut ihnen: «Sie trinken Wodka, stecken das Geld in ihre Tasche und sagen: Alles okay.»
Glaube gegen Langeweile?
Die einzige Abwechslung vom tristen Alltag gibt es samstags. Nach dem Mittagessen besuchen Zarina Turakulova und andere Mitglieder der neoprotestantischen Kirche «Quelle der Hoffnung», einer offiziell illegalen Sekte, das Heim. Sie organisieren Wettbewerbe und Tänze. Man kann Schokolade oder ein Paket Kekse gewinnen. Basymov sagt: «Letztendlich sind sie hier, um ihren Glauben zu predigen. Wir Senior*innen sind eine leichte Beute für die Missionar*innen.» Turakulova wolle ihn oft zum Beten überreden. Basymov stammt aus einer orthodoxen Familie, eigentlich ist er Atheist. «Ich verstehe kaum meine

Das Ehepaar Rosa Ohunova und Marcel Basymov vertreiben sich die Zeit mit Scherzen. Die Nachbarin lacht im Verborgenen.
Einmal die Woche versuchen junge Freikirchlerinnen, die Bewohner*innen für den Glauben zu gewinnen – auch mit Tanz.
eigene Religion, soll ich dann auch noch zu einer anderen übertreten?» Das orthodoxe Kirchengebäude in Sülüktü ist seit Jahren geschlossen, von der Moschee kommt auch niemand im Heim vorbei. Die meisten Bewohner*innen sind noch sowjetisch geprägt.
«Wenn das Wetter schön ist, kann man ein wenig Gymnastik machen. So viel, wie man kann», fügt Basymov hinzu. «Solange du dich bewegst, lebst du. Wenn du liegenbleibst, ist das der Anfang vom Ende.» Im Frühjahr 2023 erhielt das Heim eine staatliche Förderung von 12 000 Franken für einen Ausbau, es gab sogar Pläne für einen Trainingsraum. Lokale Medien berichteten darüber.
Bis heute haben die Bauarbeiten nicht begonnen. Wo, fragen sich die Einwohner*innen, ist das Geld? Die Zeitungen berichteten auch, als 2021 bei einer aus der


12 Surprise 573/24
Hauptstadt Bischkek entsandten Kontrolle abgelaufene Medikamente im Heim gefunden wurden. Die Köchinnen hatten keine Bewilligung für die Verpflegung der Bewohner*innen und die Fläche pro Person erwies sich als kleiner als die gesetzlich vorgeschriebenen 3,25 Quadratmeter. Doch es änderte sich nichts. Die Angelegenheit wurde der Staatsanwaltschaft übergeben, irgendwann wurde die damalige Direktorin entlassen.
Die Korruption
Über dem Waschbecken im Büro von Ärztin Zijnabat Safarovna hängt ein Plakat, das ans richtige Händewaschen erinnert. In der Ecke steht ein Ständer für einen Tropf, auf dem Schreibtisch liegt ein Stethoskop. Ansonsten herrscht Leere. Theoretisch bietet das Heim medizinische Versorgung, in der Praxis sind die Bewoh-


ner*innen auf Eigeninitiative angewiesen. Sibuschev zum Beispiel kauft sich seine Augentropfen selbst. Safarovna erklärt: «Als ich hier anfing, wartete das Heim bereits ein Jahr auf die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen für die Lieferung von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung. Wie soll ich sagen ...», sie wählt ihre Worte sorgfältig, «der Direktor erwartete zusätzliche Leistungen. Offensichtlich hohe, da keine Apotheke ihm diese Schmiergelder zahlen wollte.»
Safarovna wurde lange nur für eine halbe Stelle bezahlt, sollte aber den ganzen Tag bleiben. Im September ergab eine Kontrolle durch das Arbeitsministerium aus Bischkek, dass die Sportübungsleiterin –die Schwiegertochter des Direktors – als Ärztin im Heim angestellt war. Ärztin Safarovna war nur als Pflegefrau registriert. «Der Direktor hatte behauptet, es gebe
keine andere Stelle.» Die Sportübungsleiterin verlor ihren Job. Sie hatte sowieso nie sportliche Aktivitäten organisiert.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion sank der Lebensstandard in Sülüktü erheblich. Zwar lebt die Stadt noch immer von der Kohle. Früher wurde der Brennstoff mit der Bahn nach Tadschikistan transportiert, von dort weiter nach Russland. Heute wird sie auf offenen Lastwagen nach Usbekistan gefahren. Von der Eisenbahnlinie sind nur noch der Bahnhof und die Bahnhofstrasse übrig. Die Schienen wurden abgebaut und als Altmetall verwertet.
Im Winter sind die Fenster im Heim von Eisblumen bedeckt. Ähnlich wie für die Medikamente gab es auch für die Kohlelieferung ins Heim eine Ausschreibung, doch eine Lieferung folgte nie. Kein Bergbauunternehmen war bereit, dem korrupten Direktor Kohle zu liefern. Die Kohle verkauft
«Für die Behandlung ernsthafter Erkrankungen haben die Menschen kein Geld», sagt Ärztin Zijnabat Safarovna.

Surprise 573/24
Rinat Sibuschev ist enttäuscht von der nationalen Wende im lokalen Museum.
sich gut, auch ohne Bestechung. Im Herbst 2023 wurde der Direktor schliesslich entlassen. Auch die Buchhalterin ging.
Die Bewohner*innen überrascht das nicht. «Wir sind ja nicht blind. Sie behandeln uns zwar oft wie Kinder, aber wir sehen, was hier alles abläuft», sagt Sibuschev. «Es ist ein gemütlicher Job für jemanden im Ruhestand, der Direktor war ja selber schon Rentner», sagt auch Ärztin Safarovna, selbst 62 Jahre alt. «Man bekommt sein Gehalt fast für nichts. Selbst wenn es regelmässig Kontrollen gibt, bleibt genug Zeit, um sich die eigenen Taschen zu füllen.»
Alles wird beobachtet
Einmal nur wurde neben all der schlechten Presse, die das Heim bisher verursachte, auch positiv berichtet. Fotos von der Hochzeit von Rosa Ohunova und Marcel Basy-
mov erschienen in der Zeitung. Ohunova lächelt freudig auf dem Bild, Basymov wirkt eher nachdenklich. Die Stadtverwaltung schenkte dem Paar Decken und andere Dinge. Es gab eine Torte, Blumen und Tanz. Man feierte das Paar als Romeo und Julia von Sülüktü. Zwei, die beschlossen hatten, den Herbst ihres Lebens zusammen zu verbringen.
«Bin ich denn eine Art Promi?» Basymov geht der Medienrummel auf die Nerven. «Die Buchhalterin hat sich das ausgedacht. Um die Atmosphäre zu verbessern.» Die Zeitungen schrieben, er habe seiner Frau einen Ring und Ohrringe im Wert von 300 Franken geschenkt. «Woher sollte ich denn so viel Geld haben?» fragt er. Und Ohunova ergänzt: «Die Ohrringe hatte ich noch von meiner Mutter.» Ohunova ist Witwe, Basymov zweimal geschieden.
Eine, die nicht im Heim lebt, ist Nina Balakina. Im Nachthemd isst sie ein Stück ihrer Geburtstagstorte, die Gäste haben ihre Wohnung schon wieder verlassen. Es ist ihr 82ster. Ihr Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Balakina kam als Mädchen hierher, ihre Eltern wurden in Usbekistan geboren. Eigentlich stammen sie aus Russland. Heute lebt Nina Balakina alleine. Das ist nur möglich, weil ihre Tochter, Natalia, in der Wohnung nebenan lebt. Wenn die Mutter etwas braucht, klopft sie an die Wand.
Natalias zweiter Ehemann arbeitete früher im selben Schacht wie Sibuschev. Die Familie hat es nicht leicht. Ein Sohn erhängte sich. Ein anderer Sohn ist Epileptiker. «Wenn die Ärzt*innen wie in der Sowjetunion gewesen wären, hätte man ihm vielleicht besser helfen können», sagt sie.


Blick auf den selbstfinanzierten Spielplatz
hinter dem Wohnhaus der Balakinas.

14 Surprise 573/24
Natalia Balakina (rechts) mit ihrer Schwester Aleksandra, die ebenfalls vor Ort geblieben ist.
Ihr Vater hat als Ingenieur die Blocks gebaut, in denen sich ihre Wohnungen befinden. «Es fiel mir zu schwer, das alles zu verlassen», sagt sie. Heute will sie wegen ihrer Mutter und ihres Sohnes nicht wegziehen. Die meisten ihrer Bekannten aber sind weggezogen. Zurückgeblieben sind «diejenigen, die eine besondere Beziehung zu Sülüktü oder kranke Familienmitglieder haben», sagt Natalia Balakina. Ihre Schwester Aleksandra ist ebenfalls geblieben. Die dritte ging nach Russland, um ihre Ehe zu retten.
Durch die Gardine kann Natalia Balakina in den Hof sehen. Die Bewohner*innen haben einen Spielplatz für die wenigen Kinder bauen lassen. Auf einer Bank sitzt ihr erwachsener Sohn und langweilt sich. In der Stadt gibt es selbst für Kerngesunde keine Arbeit. In den Blöcken herrscht Leerstand, Tauben sind eingezogen.

Es gibt jedoch auch Bewegung in der Gegend. Wegen eines schwelenden Konflikts mit dem Nachbarland Tadschikistan hat die kirgisische Regierung Armee-Einheiten hierher verlegt, die Grenze ist nur wenige Kilometer entfernt. Und die Stadt saniert Wohnungen für die Familien der Soldaten. «Eine Sanierung der Infrastruktur wäre wichtiger», sagt Natalia Balakina. Regelmässig fällt bei ihr der Strom aus. Ihre Badewanne hat sie gefüllt, für den Fall, dass die Pumpen aussetzen, das Wasser ist trüb. «Meist haben wir gar kein Wasser.»
Postskriptum: Seit dem Sommer hat sich im Heim viel verändert. Vier Bewohner*innen sind gestorben. Die Direktion hat schon wieder gewechselt, Ärztin Zijnabat Safarovna hat gekündigt. Nun arbeitet sie
Aleksandra Balakina auf Geburtstagsbesuch bei Mutter Nina. Feierstimmung kommt jedoch auch angesichts des Enkels nicht auf.
in einer privaten Klinik. Das Heim bezeichnet sie im Rückblick als berufliches Trauma. Stundenlang spielte sie Solitär. «Fast hätte ich angefangen zu trinken. Ich dachte, ich würde verrückt.»
Rinat Sibuschev, der Charmeur, hatte Glück. «Der Junge hat es geschafft», sagt sein Freund Marcel Basymov. Sibuschev hatte sich im Krankenhaus in Batken seinen Grauen Star operieren lassen und verliebte sich in die Pflegefrau. Die 56-Jährige hatte jahrelang alleine gelebt, nachdem ihr Mann nach Russland gegangen war. Sibuschev hat Fotos von seinem neuen Zuhause geschickt. Ein Schlafsofa, ein Schrank, Kristallgläser. Die Boshaften im Heim sagen, es gehe ihm gar nicht um die Frau. Er sei nur abgehauen, damit er wieder trinken dürfe. Sibuschev selbst sagt: «Es geht sie nichts an. Ich bin ein erwachsener Mann.»


Surprise 573/24 15
Rinat Sibuschev will lieber alles hinter sich lassen.







16 Surprise 573/24
Bleiben dürfen, arbeiten können
Sans-Papiers Irland und Kolumbien haben eine grosse Zahl von Menschen ohne Aufenthaltsstatus regularisiert. Wie hat das funktioniert?
Es ist der letzte Donnerstag im Juni 2023 und Irene Jagoba bereitet sich in Irland auf ihre Reise auf die Philippinen vor. Sie wird ihre Kinder besuchen und mit ihrem Sohn seinen 18. Geburtstag feiern. Es wird der erste Geburtstag seit fünfzehn Jahren sein, den sie mit ihm verbringen kann. In der Vergangenheit konnte Jagoba nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren, denn sie lebte ohne Aufenthaltsgenehmigung in Irland. Eine Reise auf die Philippinen – und sie hätte nicht wieder einreisen und hier arbeiten können.
Jagoba hat einen Bachelor in Industriemanagement und war in der Student*innenpolitik aktiv. Sie arbeitete für die philippinische Regierung und eröffnete dann ein Geschäft für Partyartikel sowie ein Restaurant. Die Dinge liefen gut. Alles änderte sich, als ihr jüngstes Kind, ein Sohn, mit einem Herzfehler geboren wurde. Der Arzt gab ihm eine Woche zu leben. «Ich sagte mir: Mein Baby atmet und kämpft, und ich werde mit ihm kämpfen», sagt Jagoba. Ihr Kind war lange Zeit im Spital. Auf den Philippinen müssen die Menschen für die medizinische Versorgung selber aufkommen. Am Ende besass Jagoba nichts mehr.
Jagoba bat ihre Schwester, die in Irland lebte, einen Job für sie zu suchen. Sie hatte nicht vor, in Irland zu bleiben, sondern wollte nur Geld sparen, um dann nach Hause zurückzukehren und ihr Geschäft wieder aufzunehmen. Sie fand eine Stelle als Kinderbetreuerin bei einer irischen Familie. Über eine Aufenthaltsgenehmigung wollte diese nicht sprechen. Mit ihren Kindern blieb sie über Skype und Yahoo Messenger in Kontakt – trotz langen Arbeitstagen und acht Stunden Zeitverschiebung. Dann lief ihr Touristenvisum ab.
«Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus ging, hatte ich Angst. Hat man keine Papiere, hält man den Kontrolleur für einen Einwanderungsbeamten. Man springt fast aus dem Fenster, wenn jemand an die Tür klopft. Man wird in bar bezahlt und fühlt sich unsicher und verletzlich, wenn man sein Geld mit sich herumtragen muss.»
«Es ist schwer, Nein zu sagen» Einmal wurde ihre Handtasche gestohlen, mit allen Ersparnissen und wichtigen Papieren. Jagoba traute sich nicht, den Diebstahl anzuzeigen. Eine Arbeitnehmerin ohne Papiere, sagt sie, kann nicht protestieren oder sich ihrem Arbeitgeber verweigern, selbst wenn die Arbeitszeiten länger sind als erlaubt und Überstunden nicht bezahlt werden. «Man wird als Kinderbetreuerin angestellt, aber am Ende putzt man das ganze Haus, mäht den Rasen, streicht das Haus neu. Es ist schwer, Nein zu sagen, weil man seinen Job nicht verlieren will. Das ist die Erfahrung, die die meisten von uns machen», sagt Jagoba. Sie hat viele Geschichten gehört; auch solche, in denen Pflegekräfte, die bei älteren Menschen lebten, von Angehörigen sexuell missbraucht wurden.
Wenn sie krank sind, sagt Jagoba, hätten Sans-Papiers oft Angst, auf den Notfall zu gehen, weil sie nach einer Sozialversicherungsnummer gefragt würden, die viele nicht haben. «Also verarzten wir uns selbst und versuchen, mit Schmerzmitteln zurechtzukommen.» (siehe auch Zweittext S. 22)
Die Dinge begannen sich zu ändern, als Jagoba nach sieben Jahren beschloss, die Familie, bei der sie arbeitete, zu verlassen und in die Hauptstadt Dublin zu ziehen. Sie
Surprise 573/24 17
TEXT KATI PIETARINEN ILLUSTRATIONEN JONNA LUOSTARI
stiess auf das Migrants Rights Centre Ireland, eine Organisation, die Menschen ohne Papiere unterstützt, und trat dem Vorstand der Regularisierungskampagne «Justice for the Undocumented» bei.
An der ersten Veranstaltung teilzunehmen, machte Jagoba Angst. Sie bat einen Freund, sich ihr mit einem Auto anzuschliessen, damit sie bei einer Razzia schnell verschwinden könnten. Ausserdem brachte sie drei Bekannte mit, von denen sie vermutete, dass sie sich in einer ähnlichen Situation befanden, obwohl sie nie darüber gesprochen hatten. Die Veranstaltung half ihnen, sich einander zu öffnen. «Das war ein gutes Gefühl. Zusammen mit anderen Menschen fühlte ich mich stärker.»
Nach und nach begann Jagoba, öffentlich über ihre Situation zu sprechen. Sie sprach auf Veranstaltungen, gab den Medien Interviews und traf sich mit Politiker*innen. «Es ist wichtig, dass andere Sans-Papiers und die breite Öffentlichkeit hören: Ich bin deine Nachbarin, die Kundin in deinem Geschäft. Und dass auch die Regierung weiss: Wir sind hier und arbeiten schon lange hier.» Nach jedem Auftritt erhielt Jagoba Kontakte von anderen Sans-Papiers, die sich der Kampagne anschliessen wollten. Die Gruppe wuchs auf über 2500 Mitglieder.
«Wir sind wie eine grosse Familie, wir unterstützen uns gegenseitig. Auch bei der Arbeits- oder Wohnungssuche.» Alle zahlen pro Monat fünf Euro in einen Notfall-

fonds. Damit werden Mitglieder unterstützt, wenn sie ihre Stelle verlieren oder medizinische Versorgung brauchen. Mehrere Jahre lang begleitete Jagoba die Aktivist*innen der Organisationen zu Treffen mit Politiker*innen. So musste sie oft ihre eigene Arbeit absagen, wenn jemand Wichtiges einem Treffen zustimmte.
«Ein normales Leben ohne Angst»
Das war es wert. Im Dezember 2021 kündigte die irische Regierung ein Programm zur Regularisierung von Sans-Papiers an. Jagoba war klar, dass dieses für viele Menschen nicht ausreichen würde: Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, war ein Reisepass erforderlich. Bei vielen Sans-Papiers war er jedoch abgelaufen.
Auch bei Jagoba. Da es in Irland keine philippinische Botschaft gibt, musste sie einen Vertreter der philippinischen Botschaft in London darum bitten, nach Irland zu reisen, um ihr und anderen einen Pass auszustellen. Sie war eine der Ersten, die eine Regularisierung beantragten. Im März 2022 wurde sie bewilligt. «Das hat mein Leben verändert. Ich konnte nach Hause reisen, um meine Kinder zu sehen, und hierher zurückkommen, um zu arbeiten. Ich kann ein normales Leben ohne Angst führen.» Im Sommer 2023 verbrachte Jagoba drei Wochen auf den Philippinen. «Ich gehe zum ersten Mal zur Geburtstagsparty meines Sohnes, es ist sein Traum.»

Ein bewegender Spielfilm, scharfzüngig, von sarkastischem Witz und er frischender Situationskomik durchzogen. «Ein
Im Frühling 2023 forderte Felipe González Morales, damaliger UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte von Migrant*innen, die Staaten in einem Bericht auf, Sans-Papiers zu regularisieren, ihnen also eine Aufenthaltserlaubnis zu geben. Eine Regularisierung in grossem Umfang, argumentierte er, würde zur Wahrung der Menschenrechte von Migrant*innen beitragen. Und dazu, dass sie Zugang zu medizinischer Versorgung, fairer Arbeit, Bildung, angemessenem Wohnraum und Familienzusammenführung haben würden. «Es gibt nicht genügend Regularisierungsprogramme. Zu viele Menschen leben ihr ganzes Leben oder Jahrzehnte ohne Papiere. Die Regierungen sollten aktiver sein», so González Morales.
In Irland sei die Regularisierung das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Kampagnenarbeit der Zivilgesellschaft gewesen, sagt Brian Killoran, Direktor des Immigrant Council of Ireland, einer Organisation, die Migrant*innen rechtliche Unterstützung und Informationen bietet. Schätzungsweise 20 000 bis 25 000 der fünf Millionen Menschen, die in Irland leben, hatten vor dem Regularisierungsprogramm keine Papiere. Viele von ihnen arbeiten in Privathaushalten als Pflegekräfte, in der Gastronomie, in der Reinigung und in der Kinderbetreuung. Viele kommen aus Brasilien, China, Pakistan, aus den Philippinen, der Mongolei und Malawi. Killoran sagt: «Anfang der 2000er-Jahre, als es einen Arbeitskräftemangel gab, kamen Menschen aus Brasilien, um in Fleischverarbeitungsbetrieben zu arbeiten.»


Viele der Menschen, mit denen seine Organisation zu tun hatte, hatten laut Killoran wegen Arbeit, Studium oder familiären Gründen zunächst eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Doch wenn sich daran etwas ändert, jemand
18 Surprise 573/24
EIN FILM VON ALI ASGARI & ALIREZA KHATAMI IRDI SC HE VER SE
atemb eraub end mutiger Film.» 3 SAT K U LT U RZ EIT ANZEIGE
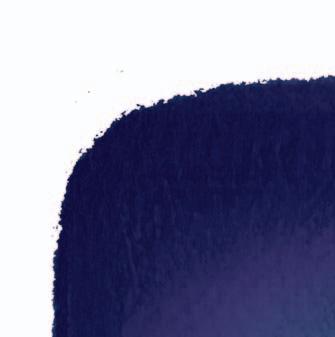







Surprise 573/24 19
etwa die Arbeit verliert, erlischt diese oftmals. «Unser Einwanderungssystem basiert auf einem Ermessensspielraum. Es gibt keine klare Regel, was in einer bestimmten Situation zu tun ist», sagt Killoran. «Darum wissen viele Menschen nicht, was sie tun sollen. Ob sie sich an die Einwanderungsbehörden wenden müssen und welche Konsequenzen das haben kann. Viele trauten sich nicht, sich zu melden, aus Angst, ausgeschafft zu werden.»
Im Lauf der Jahre, in denen sich zivilgesellschaftliche Gruppen für die Regularisierung von Sans-Papiers einsetzten, berichteten die Medien laut Killoran fast ausschliesslich positiv über das Thema. Das liegt zum einen an Irlands Geschichte. Bis in die 1990er-Jahre war Irland ein Herkunftsland vieler Migrant*innen. In den letzten zweihundert Jahren sind schätzungsweise zehn Millionen Menschen aus Irland ausgewandert, vor allem in die USA. Viele US-Amerikaner*innen, selbst die Präsidenten John F. Kennedy, Barack Obama und Joe Biden, sind irischer Abstammung. Aber nicht alle waren so erfolgreich. Je nach Schätzung leben zwischen 10 000 und 50 000 Ir*innen ohne Papiere in den USA. «In Irland kennt jede Person Sans-Papiers, die in den USA leben oder gelebt haben», sagt Killoran. Zum anderen wurde die Kampagne auch dadurch erleichtert, dass es in Irland keine bedeutende rechtsextreme Partei gibt.
Die Regularisierung war Teil des Regierungsprogramms einer Koalition aus zwei christdemokratischen Rechtsparteien und den Grünen. Von Januar bis Juli 2022 konnten Anträge gestellt werden. Das Programm regularisierte in dieser Zeit Personen, die ihre Identität nach-

weisen und die belegen konnten, dass sie seit mindestens vier Jahren in Irland lebten (Familien mit Kindern seit drei Jahren). Die Gebühr betrug 550 Euro pro Person bzw. 700 Euro pro Familie. Asylbewerber*innen, die seit mehr als zwei Jahren auf einen Asylbescheid warteten, konnten bei einem parallelen kostenlosen Programm einen Antrag auf Regularisierung stellen.
«Könnte Widerstand geben»
8311 Menschen stellten einen Antrag, 3244 davon stammten von Asylbewerber*innen. Von den bisher bearbeiteten Anträgen haben fast 70 Prozent zu einer Aufenthaltsgenehmigung geführt, die den Zugang zu Arbeit, Bildung, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen ermöglicht. Bei beiden Programmen ist etwas mehr als eine von zehn Entscheidungen negativ ausgefallen. Diejenigen, die einen negativen Bescheid erhalten haben, können ein humanitäres Visum beantragen. Letztendlich ist es aber möglich, dass sie ausgeschafft werden. Trotzdem hält Killoran das Programm insgesamt für einen grossen Erfolg. Allerdings gibt es in Irland immer noch Sans-Papiers: Solche, welche die Frist nicht eingehalten oder verpasst haben, solche, die Angst hatten, einen Antrag zu stellen, oder solche, die erst nach der Frist nach Irland kamen. Killoran fordert, dass das Regularisierungsprogramm in regelmässigen Abständen durchgeführt wird. «Das Problem ist: Politiker*innen und Beamt*innen könnten der Meinung sein, dass solche Programme mehr Migrant*innen nach Irland locken, und dadurch könnte es Widerstand geben.» Bislang wurden in Irland über 7200 Menschen regularisiert.



20 Surprise 573/24
Regularisierungsprogramme können auch viel umfassender sein. Das zeigt das Beispiel Kolumbien. «Kein anderes Land hat in so kurzer Zeit so viel für so viele Menschen getan», sagt Andrés Besserer Rayas, Doktorand an der City University of New York. In Kolumbien, einem Land mit gut fünfzig Millionen Einwohner*innen, herrschte jahrzehntelang ein Bürgerkrieg, bis 2016 ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde. Während des Krieges flohen mehr als fünf Millionen Menschen aus Kolumbien, viele davon nach Venezuela.
Wegen der sozioökonomischen und politischen Krise in Venezuela in den 2010er-Jahren drehte es: die Menschen flohen nun nach Kolumbien. Von anfänglich etwa 20 000 lebten Anfang 2020 über 1,8 Millionen Venezolaner*innen in Kolumbien. Diejenigen, welche die Grenze legal überquert hatten, erhielten eine befristete Genehmigung, die nicht in eine unbefristete umgewandelt werden konnte. Viele hatten gar keine Aufenthaltsgenehmigung, weil sie wegen des Zusammenbruchs der venezolanischen Passproduktion die Grenze nicht legal überqueren konnten.
Im Frühling 2021 kündigte der kolumbianische Präsident Iván Duque ein Regularisierungsprogramm an. Nieves Fernández Rodríguez, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), sagt dazu: «Es wurde hinter verschlossenen Türen vereinbart. Die Strategie der Regierung bestand darin, es nicht an die Spitze der politischen Agenda zu setzen.» Doch das Programm fand breite politische Unterstützung. Für den rechtskonservativen Duque war es eine Möglichkeit, sich am linkspopulistisch-sozialistischen Regime des Nachbarlands Venezuela zu rächen. Die kolumbianische Linke hingegen unterstützte das Programm aus Menschenrechtsgründen. Rodríguez zufolge war die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Politik der offenen Grenzen für Venezolaner*innen, aber viele wussten gar nichts von dem Programm.
Die Kriterien für die Regularisierung waren anfangs sehr locker: Es wurde nicht einmal ein Pass verlangt. Es genügte ein Schreiben einer oder eines kolumbianischen Bekannten, aus dem hervorging, dass die Person seit einem Jahr im Land lebt. Laut Rodríguez wurden durch das Programm 1,6 Millionen Menschen regularisiert. Derzeit können noch diejenigen Anträge stellen, welche die Grenze vor Ende Mai 2023 legal überquert haben. 2022 wechselte Kolumbien den Präsidenten, und der linke Präsident Gustavo Petro hat sich der venezolanischen Regierung wieder angenähert. Daher werde es möglicherweise keine weiteren Regularisierungen geben, sagt Rodríguez.
«Dauerhafte Aufenthaltsbewilligung beantragen»
Das Programm hat Ähnlichkeiten mit den befristeten Aufenthaltsbewilligungen, welche die EU-Länder den Ukrainer*innen gewähren, ist aber grosszügiger. Kolumbien garantiert eine zehnjährige Aufenthaltsbewilligung, die das Recht auf Arbeit, die Gründung eines Unternehmens, ein Studium, eine Rente, die Eröffnung eines Bankkontos, den Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie die Anerkennung von Diplomen beinhaltet. «Nach fünf Jahren kann, wer eine Bewilligung hat, eine dauerhafte Aufent-
«Opération Papyrus» in Neuenburg
Ende Februar hat der Neuenburger Grosse Rat ein Postulat angenommen, das eine Art «Opération Papyrus» wie in Genf einführen will. So sollen SansPapiers, die seit Langem im Kanton Neuenburg wohnen, die Möglichkeit erhalten, eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Julien Gressot von der POP (Parti ouvrier et populaire, Partei der Arbeit) sagte: «Diese Abstimmung ist historisch! Neuenburg gehört nun zum kleinen Kreis der Kantone, die in dieser Frage Pionierarbeit leisten.»
Der Text soll sich am Genfer Projekt «Opération Papyrus» orientieren, das 2017 und 2018 den Aufenthaltsstatus von 2900 Sans-Papiers regularisiert hat. Die Kriterien für eine Anerkennung waren ein Aufenthalt in Genf von zehn Jahren (für Familien mit Kindern fünf Jahre), eine erfolgreiche Integration in Bezug auf die Sprachkenntnisse, keine strafrechtliche Verurteilung und finanzielle Unabhängigkeit. LEA
haltsbewilligung beantragen. Das ist das Wichtigste: Diese Menschen werden bleiben dürfen», sagt Rodríguez.
Andrés Besserer Rayas von der City University of New York führt in Kolumbien eine ethnografische Studie mit venezolanischen Familien durch, in denen einige regularisiert sind, andere aber nicht, etwa weil sie später eingereist sind. «Ein grosser Unterschied ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung. Wenn Menschen eine Langzeiterkrankung haben und legal arbeiten, haben sie Zugang zu einer kontinuierlichen medizinischen Versorgung, die ihr Leben verändern kann», sagt Besserer Rayas.
Die Regularisierung stärkt auch die Position der Arbeitnehmer*innen auf dem Arbeitsmarkt. «In meiner Studie zeigte sich, dass diejenigen mit Papieren mit grösserer Wahrscheinlichkeit rechtliche Unterstützung erhielten. Von den Paaren, die ich beobachtet habe, hat die Person ohne Papiere viel schlechtere Bedingungen akzeptiert und ihren Arbeitgeber nicht verklagt», sagt Rayas. «Die Regularisierung war also nicht nur für die arbeitenden Venezolaner*innen von Vorteil, sondern auch für die Kolumbianer*innen, die am selben Arbeitsplatz arbeiten.» Das kolumbianische Bruttoinlandsprodukt ist in den Jahren nach dem Programm gestiegen. Dennoch erklärte der kolumbianische Aussenminister, die Integration der Venezolaner*innen sei kostspielig und werde von anderen Ländern nicht genug unterstützt.
Forscher*innen wie Besserer Rayas halten das Programm jedoch für einen Erfolg. Er sagt: «Es zeigt, dass die Existenz einer Bevölkerungsgruppe ohne Papiere in vielen anderen Ländern das Ergebnis von Politik ist.»
Aus dem Finnischen übersetzt. Mit freundlicher Genehmigung von ISO NUMERO / INSP.NGO
Surprise 573/24 21
Keine Papiere, keine Medizin
Die meisten Sans-Papiers haben keine Krankenversicherung. Ihre medizinische Versorgung unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Ein Blick nach Genf, Zürich, Bern und Basel.
Wie alle Menschen haben Sans-Papiers Zugang zu allen Gesundheitsleistungen, welche die obligatorische Krankenversicherung abdeckt. Zumindest in der Theorie. Die Voraussetzung dafür ist nämlich, dass sie krankenversichert sind. Und genau das ist die überwiegende Mehrheit der SansPapiers nicht, wie das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) 2022 in einem Bericht feststellte.
Zum einen, weil sie sich die Krankenkassenprämien – selbst mit Prämienverbilligung – oftmals nicht leisten können. Zum anderen, weil sie fürchten aufzufliegen. Zwar dürfen die Krankenkassen keine persönlichen Daten an die kantonalen Migrationsbehörden übermitteln, doch die Anmeldung ist auch so mit Hürden verbunden. Krankenkassen verlangen häufig, obwohl dies nicht obligatorisch wäre, eine Wohnsitzbestätigung oder eine gültige Aufenthaltsbewilligung. Weil Sans-Papiers weder die eine noch die andere haben, klappt die Anmeldung praktisch nur, wenn sie dabei von einer Anlaufstelle unterstützt werden.
Aber auch Sans-Papiers ohne Krankenversicherung haben gemäss Artikel 12 der Bundesverfassung Anrecht auf «medizinische Grundversorgung». Darunter verstehen viele Kantone Notfallversorgung, wichtige Behandlungen für die mittel- und langfristige Gesundheit gehören nicht dazu. Eine erste Chemotherapie kann als dringend erachtet werden, die zweite hin-
gegen nicht mehr – obwohl sie für die Heilung notwendig ist. Diese Auslegung erachtet das SKMR als «zu restriktiv».
Kanton Genf trägt die Kosten Über die Notfallversorgung hinaus geht das Angebot im Kanton Genf. Bei der CAMSCO (Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires), die dem öffentlichen Universitätsspital HUG angegliedert ist, haben Sans-Papiers ohne Krankenversicherung Zugang zur medizinischen Grundversorgung nach dem Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung. Die Kosten trägt der Kanton. Dieses Angebot soll ermöglichen, dass Sans-Papiers ohne Krankenversicherung bezüglich Zugang und Qualität der Gesundheitsversorgung gleichbehandelt werden.
Denn viele Sans-Papiers zögern die Suche nach medizinischer Hilfe so lange wie möglich hinaus. Diese Erfahrung machen Bea Schwager, Karin Jenni und Katharina Boerlin von den Anlaufstellen für Sans-Papiers in Zürich, Bern und Basel. Auch wegen der Kosten oder des fehlenden Wissens hätten viele Angst, medizinische Angebote in Anspruch zu nehmen, sagt Boerlin. Es bestehen Unsicherheiten: Wo bekommt man medizinische Hilfe? Wie kann man sie finanzieren?
Sans-Papiers arbeiten unter prekären Bedingungen und haben oft sehr lange Arbeitstage, ergänzt Boerlin. Viele von ihnen arbeiten körperlich schwer – in der Reini-
gung, in Privathaushalten, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Ihnen fehlen die Ressourcen, um auf ihre Gesundheit zu achten.
Krank zu sein, könnten sich in ihrer beruflichen Lage viele gar nicht leisten, sagt Schwager. Die meisten arbeiten im Stundenlohn. So gehen sie auch arbeiten, wenn sie sich nicht fit fühlen oder wenn ihre Rücken-, Gelenk- oder Kopfschmerzen schon chronisch geworden sind. Auch psychisch geht es Sans-Papiers im Durchschnitt eher schlecht.
In einer Studie im Rahmen der «Opération Papyrus» haben die Universität Genf und das Universitätsspital Genf untersucht, wie sich die Regularisierung auf die Gesundheit auswirkt. Demnach leiden ehemalige Sans-Papiers weniger häufig als Sans-Papiers an Mehrfacherkrankungen wie Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen sowie an Übergewicht. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstgefühle gehen mit der Regularisierung zurück. Und der Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert sich dank der Krankenversicherung, die sie nun sicher haben.
In Zürich war es nicht der Kanton, sondern die Stadt, die im September 2021 mit 4,6 Millionen Franken ein dreijähriges Pilotprojekt lancierte. Dafür hat die Stadt mit Meditrina, dem vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) betriebenen medizinischen Ambulatorium für Sans-Papiers,
22 Surprise 573/24
TEXT LEA STUBER



«Sans-Papiers sollen die gleiche medizinische Behandlung bekommen wie alle anderen auch.»
KATHARINA BOERLIN, ANLAUFSTELLE FÜR SANS-PAPIERS BASEL
eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Dort können sich Sans-Papiers gratis behandeln lassen und erhalten innerhalb des Ärzt*innennetzwerks von Meditrina spezialisierte Behandlungen zu günstigen Tarifen. Daneben betreibt die Stadt selbst das Ambulatorium Kanonengasse.
Auch ohne Krankenkasse ins Spital
Mit dem Pilotprojekt können sich Sans-Papiers, die in Zürich wohnen, in den Stadtspitälern Triemli und Waid bis zu einer Höhe von 15 000 Franken auch ohne Krankenversicherung behandeln lassen, die Kosten übernimmt die Stadt. Welche Erfahrungen die Stadt mit dem Pilotprojekt macht und ob es weitergeführt wird, dazu wollen sich die städtischen Gesundheitsdienste noch nicht äussern. Ein Evaluationsbericht soll im Sommer vorliegen.
In Bern betreibt das SRK die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers, weder der Kanton noch die Stadt unterstützen das Angebot finanziell. 2019 forderte eine Motion im Stadtrat ein Pilotprojekt nach Genfer Vorbild. Der Gemeinderat entschied sich 2022 «aufgrund des engen finanziellen Spielraums» dagegen.
Anders als in Genf, Zürich und Bern gibt es in Basel weder ein öffentliches noch ein privates Ambulatorium für Sans-Papiers. Dafür ist eine Gesundheitsberatung Teil der Anlaufstelle für Sans-Papiers: Die Gesundheitsfachperson versorgt einfache Schnittwunden oder gibt rezeptfreie Medikamente wie Schmerzmittel oder Hustensirup ab. Ernstere Beschwerden triagiert sie zu Ärzt*innen. Müssen Sans-Papiers ins Spital, gibt ihnen die Anlaufstelle ein Schreiben mit, in dem sie bestätigt, dass sie zusammen mit der betroffenen Person eine Krankenversicherung abschliessen wird, sagt Boerlin. Dank einem Nothilfefonds kann sie Gesundheitskosten (wie Franchise oder Selbstbehalt) für Personen in besonders prekären finanziellen Situationen übernehmen, für grössere Behandlungen stellt sie bei Stiftungen Einzelgesuche.
Das Anliegen der Anlaufstellen für Sans-Papiers ist klar. «Sans-Papiers sollen die gleiche medizinische Behandlung bekommen wie alle anderen auch», sagt Katharina Boerlin in Basel. Ebenso klar ist im Grunde auch die pragmatischste Lösung. «Das Beste dafür wäre eine Regularisierung», sagt Bea Schwager in Zürich.
Surprise 573/24 23
Gegen Ängste anschreiben
Literaturfestival Die diesjährigen Solothurner Literaturtage sind geprägt von der Suche nach einer literarischen Sprache angesichts weltumspannender Herausforderungen.
TEXT MONIKA BETTSCHEN
Kriege, Klimawandel, künstliche Intelligenz oder auch die Fragmentierung der Gesellschaft: Die Krisen der Gegenwart schlagen sich nicht nur im kollektiven Gemüt nieder, sondern auch in der 46. Ausgabe der Solothurner Literaturtage. Viele Werke der 74 Schweizer Autor*innen und internationalen Gäste greifen diese Themen auf und beschreiben, wie die gegenwärtigen Krisen diffuse Ängste in den Menschen hervorrufen. «Es ist ein ernstes und düsteres Werksjahr mit spürbaren Umbrüchen, aber auch eines, in dem viele Autor*innen angesichts der Schwere der Themen bestrebt sind, nach poetischen und subtilen Wegen im Umgang genau damit zu suchen. Mussten in vergangenen Jahren zuerst die Probleme benannt werden, löst man sich nun von der sprachlichen Moralkeule und erkundet literarische Ausdrucksformen, in denen Grauzonen ausgelotet, Auswege aufgezeigt und Perspektiven gewechselt werden», sagt Philine Erni, Presseverantwortliche des grössten Literaturfestivals der Schweiz.
So verdichtet sich etwa in «einsamkeit ist eine ortsbezeichnung», dem Lyrikdebüt von Julia Rüegger, diese Grundstimmung der Orientierungslosigkeit:
«brachliegende furchen auf einem viersaatenfeld die technik der erntesteigerung das lernte ich in geschichte in der siebten klasse»
In diesen Bildern umschreibt die 1994 in Basel geborene Lyrikerin prägnant, wie die industrialisierte Landwirtschaft an einem Scheideweg angelangt ist – und wie viel Unbehagen mit dieser Erkenntnis einhergeht. Oder es wird einem «schwindlig vor lauter ortsverlorenheit», wenn man an einem einsamen Sonntag auf sich selbst und auf eigene Ängste zurückgeworfen wird. «Die lyrische Suche nach Bildern, die Halt bieten, ist ein Grundmotiv meines Schreibens. Ich spüre inneren Verlust- und Orientierungsfragen nach, Wechselwirkungen zwischen mir und den mich umgebenden (Um-)Welten. Dabei versuche ich, durchlässig zu werden für Strömungen und Stimmungen angesichts einer oft dysfunktionalen, von Ungleichheit und Vereinzelung gezeichneten Gesellschaft. Und, wie eine Spiegelung davon, angesichts immer instabiler werdender Ökosysteme», sagt Rüegger. «Es sind Entwicklungen, die Angst machen. Ein Ausweg könnte sich auftun, wenn wir uns nicht immer weiter einkapseln, sondern uns im Miteinander für neue Formen der Koexistenz öffnen. Wenn wir aus Überforderung nicht erstarren, sondern weiter den Kontakt zueinander suchen, und zwar über den ‹menschlichen Rand› hinaus.»

Episodisch erzählt Nando von Arb in «Fürchten lernen», das für den Schweizer Kinderund Jugendbuchpreis 2024 nominiert ist, von ganz unterschiedlichen Ängsten. Er lädt in eine (alb-)traumhaft anmutende Welt ein und findet starke, überraschende Bilder für das, was zwischen den Zeilen liegt.

24


Der Hase, der sich in Nando von Arbs Graphic Novel «Fürchten lernen» nach einer gefühlten Ewigkeit im Computertomographen wieder aufrichtet, befindet sich gerade in einem solchen Zustand der Erstarrung. «Haben Sie etwas gefunden?», fragt er. Seit Wochen plagen ihn Bauchschmerzen – und Befürchtungen, dass es etwas Ernstes sein könnte. Während er in die Röhre geschoben wird, geht er bereits davon aus, dass sein Körper bald in ähnlicher Weise durch die Ofentür eines Krematoriums gleiten wird. «Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts», antwortet der Arzt. Doch wer denkt, der Hase könne sich nun befreit dem Leben zuwenden, irrt sich. Wenig später wird er, diesmal in Menschengestalt, den Krankenwagen rufen, weil er eine Panikattacke für einen Herzinfarkt hält.
Dieser von Ängsten gepeinigte Protagonist steht stellvertretend für Nando von Arb selbst. In 15 Kapiteln zeigt der 31-jährige Zürcher auf, was es für ihn bedeutet, unter Angststörungen zu leiden. In eindringlichen Bildern und Sprechblasen stellt er das Gefühl aufsteigender Panik dar. «Um diese unmittelbare Eigenschaft der Angst wiedergeben zu können, habe ich mich von der klassischen Comic-Struktur gelöst. Es gab kein klassisches Storyboard, sondern die Bilder sind inspiriert vom jeweils vorangehenden und nachfolgenden», sagt von Arb. «Sonst versuche ich, der Angst zu entgehen. Durch diesen Prozess musste ich mich jedoch mitten in diese Emotionen versetzen.» Fürchten lernen bedeute, die Angst akzeptieren und auch rationalisieren zu lernen, also zu unterscheiden zwischen berechtigter Angst und jener pathologischen Angst, die alles andere zu verschlingen drohe.
«Fürchten lernen» enthält zahlreiche Anknüpfungspunkte, in denen man sich selbst wiederfinden kann. Sei es aufgrund eigener Verluste oder weil die tägliche Nachrichtenflut immer neue Ängste aufkeimen lässt. «Die aktuelle Weltlage erfüllt viele Menschen mit Ratlosigkeit», sagt von Arb. «Das Unbekannte öffnet Leerstellen, und weil diese schwer auszuhalten sind, füllen viele Menschen diese mit Ängsten. Und manche, die sehr sensibel sind, finden da nicht mehr so einfach hinaus.»
Ängsten begegnet man an den Solothurner Literaturtagen etwa auch in Gianna Molinaris «Hinter der Hecke die Welt», in dem ein Dorf um seine Existenz bangt. Oder im Science-Fiction-Roman «[empfindungsfæhig]», in dem Reda El Arbi eine Welt beschreibt, die von KI-Einheiten regiert wird. Es sind Geschichten, die dazu anregen, sich eigenen Ängsten zu stellen. Gerade in instabilen Zeiten wie diesen.
«46. Solothurner Literaturtage», 10. bis 12. Mai, diverse Orte in der Stadt Solothurn. literatur.ch
25
BILDER: EDITION MODERNE
Veranstaltungen
Bern
«Wie Strassenzeitungen Leben verändern – How Street Papers Change Lives», Ausstellung, Fr, 17. Mai bis Sa, 3. Aug., Di bis Fr, 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr, Vernissage mit Beat Jans, Do, 16. Mai, 18.30 Uhr. Kornhausforum, Kornhausplatz 18. kornhausforum.ch

Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, werden Sie wissen, was ein Strassenmagazin ist. Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt entweder nicht Fuss fassen können oder ihren Platz in der Leistungsgesellschaft verloren haben, erwirtschaften mit dem Verkauf ein kleines Einkommen und finden den sozialen Anschluss wieder. Surprise ist im International Network of Streetpapers INSP mit knapp hundert Strassenzeitungen weltweit verbunden. Die Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» feiert die Idee der Strassenzeitung und schenkt der Schweiz besondere Aufmerksamkeit: Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Strassenmagazin Surprise. Die Vernissage wird mit einem Grusswort von Bundesrat Beat Jans eröffnet. Jans ist immerhin ein alter Bekannter von Surprise, er war lange Jahre Vorstandpräsident. Das Gesprächscafé zurAusstellung knüpft mit zugehörigen Fragen an: Wie lebt man mit wenig Geld in der Schweiz? (29. Mai), Wie reagiere ich, wenn ich Diskriminierung erlebe oder beobachte? (5. Juni), Wie erlebe ich den Druck der Leistungsgesellschaft? (12. Juni) DIF
St. Gallen «versammelt» und «collage – collection», Ausstellungen, bis So, 4. Aug., Di bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa und So, 12 bis 17 Uhr, open art museum, Davidstrasse 44. openartmuseum.ch

Wie, was und wozu sammeln Künstler*innen? In der Ausstellung «versammelt» geht es besonders
Schweiz «Steps», Mi, 24. Apr. bis So, 19. Mai; «Das Tanzfest», Mi, 1. bis So, 5. Mai; «Zürich tanzt», Fr, 3. bis So, 12. Mai, Tanzfestivals, ganze Schweiz / Zürich. steps.ch, dastanzfest.ch, zuerichtanzt.ch

wild zu und her, hier werden die Grenzen des landläufigen Verständnisses des Kunstschaffens gesprengt. Der St. Galler Künstler Hermann Reinfrank (1951–2023) hat mit seiner Materialsammlung ein komplexes Werk hinterlassen, in dessen Zentrum ökologische und ökonomische Kreisläufe stehen. Und zum Sammeln gehört immer auch das Ordnen. Karsten Neumann (*1963) sammelt nicht nur Plastikmüll, den er zu Assemblagen oder Leuchtobjekten umgestaltet, sondern überführt gerne auch urbane gesellschaftliche Strukturen in eine neue Ordnung. Matthias Kuk Krucker (*1979) wiederum ordnet sein ganzes Haus, die Villa Sommertal, seinem «Kukismus» unter. Und Erwin Schatzmann (*1954) betreibt in seinem Morgenland Off Space die «Schatzmanisierung» der Welt. Fast schon ungewohnt klassisch ist da die zweite Ausstellung: «collage – collection» zeigt über 50 Werke aus der Sammlung des open art museum, die aus gesammelten Dingen gestaltet sind. DIF
Es wird viel getanzt im Frühling. Das Migros-Kulturprozent Tanzfestival Steps, das Tanzfest und Zürich tanzt teilen dieselbe Vision: den Tanz einem breiten Publikum zugänglich zu machen, durchaus als Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft gedacht. Steps zeigt ein Bühnenprogramm mit zeitgenössischen Tanzproduktionen aus dem In- und Ausland. Das Tanzfest und Zürich tanzt bieten nationalen Künstler*innen eine Plattform und laden mit partizipativen Formaten das Publikum selbst zum Tanzen ein. An Seepromenaden und auf öffentlichen Plätzen und in Fussgängerzonen, zwischen Parkanlagen und Vogelgezwitscher. So macht das Kollektiv InQdrt choreografierte Bewegungskunst im öffentlichen Raum: In Kombination der sportlichen Bewegungskunst von Parkour und zeitgenössischem Tanz springen, fliegen und rollen die Künstler*innen über Treppen und Mauern. DIF
Zürich
«Fair Fashion statt Fast Fashion», So, 28. Apr., 17 Uhr; «Degrow! Handgefertigte Diazotypie-Drucke herstellen», Workshop mit dem Künstlerinnen-Duo Willimann/Arai, Sa, 25. Mai, 15 bis 19 Uhr, freier Beitrag, Maxim Theater, Ernastrasse 20. maximtheater.ch
Das Maxim Theater tut sich für die Reihe «Vernetzt handeln für die Zukunft» mit Akteur*innen zusammen, die der Klimakrise etwas entgegensetzen wollen. So zeigt David Hachfeld von Public Eye auf, wie die Fast-Fashion-Industrie
tonnenweise Kleider in der Welt herumfliegen lässt. Während der Veranstaltung lädt die Performerin Sabina Kaeser das Publikum ein, sich spielerisch miteinander zu vernetzen: Wer hat, soll Wollknäuel mitbringen. Die Künstlerinnen Willimann/Arai wiederum hacken die Diazotypie. Die Technologie ist das Vorläuferverfahren der heutigen Kopiermaschinen, designt für Maschinen. Die Künstlerinnen führen aber jeden einzelnen Schritt in Handarbeit durch und nutzen sie dafür, Slogans gegen die Wachstumsideologie zu vervielfältigen. Im Workshop lernen die Teilnehmer*innen das Druckverfahren kennen, kreieren eigene Slogans und fertigen manuell eigene Drucke an. DIF
Liestal
«Live im L’ambiente», Konzert und Essen, Mi, 8. Mai, ab 18 Uhr, Konzert 19.30 Uhr, Boxitos-ESB-Chor und Surprise Strassenchor, Eingliederungsstätte Baselland ESB, Schauenburgerstr. 16. esb-bl.ch

Die Boxitos sind eine Projektband der Eingliederungsstätte Baselland ESB, bestehend aus 18 begeisterten Musiker*innen mit und ohne Behinderung. Die ESB ist ein soziales Unternehmen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Ihr Ziel ist, Menschen darin zu stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen (mittels Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, Wohnmöglichkeiten und professioneller Begleitung und Beratung). Die Boxitos bieten einen Mix aus Pop, Rap und Worldmusic. Der Surprise Strassenchor wiederum ist ein Angebot des Verein Surprise, singend und musizierend unterwegs, um den Teilnehmer*innen soziale und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Er zeigt, feiert, nutzt das Potenzial von Menschen, die in der Leistungsgesellschaft allzu schnell durch die Maschen fallen. Zusammen spielt man nun Weltmusik: Menschliche Vielfalt sorgt für musikalische Vielfalt. Reservation unter esb@esb-bl.ch oder 061 905 14 84. DIF
26 Surprise 573/24
BILD(1):
ZVG, BILD(2): ERWIN SCHATZMANN, BILD(3): INQDRT © EGGERX, BILD(4): HEINER GRIEDER

Pörtner in Zofingen
Surprise-Standort: Bahnhof
Einwohner*innen: 12 805
Anteil Ausländer*innen in Prozent: 21,7
Sozialhilfequote in Prozent: 3,6
Berühmter Hund: Zofi, der Dackel des Reporters Ringgi aus einer Kinderbuchserie (1948 – 94), wurde nach Zofingen benannt
Die Zofinger Altstadt ist wegen ihrer Schönheit berühmt. Umgeben wird sie von Reihenhäusern bzw. einer Häuserreihe. Die einzelnen Gebäude kommen alles andere als einheitlich daher, sie kommen überhaupt nicht daher, sie stehen da, in ganz unterschiedlichen Höhen, Breiten, Baujahren und -stilen. Ob sie jemals eine Einheit bildeten und sich diese erst im Laufe der Zeit auflöste oder ob einfach ein Häuschen an das andere gebaut wurde, einer Mauer oder einem Graben entlang, liesse sich gewiss im Ortsmuseum in Erfahrung bringen.
Einen Hinweis in diese Richtung liefert die Ringmauergasse, die im Moment aufgerissen ist, es werden Rohre verlegt. Die Strassen sind mit Pflastersteinen belegt, darunter liegt zwar nicht der
Strand, aber immerhin der Sand. Es gibt auch noch Handwerker*innen, die es verstehen, diese wieder in hübschen Bogenmustern zu setzen. Das Städtchen macht auch nicht den Eindruck, als drohe Gefahr, dass die Steine ausgegraben und als Wurfgeschosse eingesetzt werden, im Zuge sozialer Unruhen etwa. Zumindest in früheren Zeiten landeten Aufrührer*innen wohl im Folterturm, der noch immer steht.
Die Altstadt wird ihrem Ruf gerecht, eine grosse Vielfalt von Häusern zu haben. Von schmal und bescheiden –ein Gebäude heisst «Zum schmalen Huus» – bis hin zu prächtigen Villen mit Umschwung ist alles zu finden. Eines der alten Häuser, das an ein Bauernhaus erinnert und gelb gestrichen ist, trägt den Namen «Tausendschön».
Andere Gebäude sind mit Malereien verziert, auch historische Inschriften gibt es zu entziffern, bei manchen hilft Latein, bei anderen Englisch, etwa bei Print Scan Copy am Pulverturm. Der namensgebende Turm dient dem lokalen Artillerieverein als Lokal. Der Wirtschaften sind viele, Gasthöfe zum Ochsen, Sternen oder Raben, dazu die zu erwartenden asiatischen und italienischen Restaurants.
Das Ladenangebot lässt kaum Wünsche offen, es findet sich eines der selten gewordenen Hut-Geschäfte, ein kleiner Platten- und ein Bierladen, daneben exotischere Angebote, wie etwa eine Bonbonwerkstatt oder das Hochzeitsgeschäft «Herzeinig». Vor einer Apotheke mit historischem Schild und ebensolcher Einrichtung lädt eine kleine Bank zur Erholung ein. Die Grossbank befindet sich in einem hübschen Gebäude und ist für einmal diskret angeschrieben, fast nicht grösser als die Tafel an einem Fenster, die von der Geburt eines Kindes kündet. Einen der Eingänge ins Städtchen bewachen zwei Löwen auf Säulen, gestiftet vom «Zofingerverein», einer Studentenverbindung. Davor verteilen die Zeugen Jehovas ihre Traktate.
Es gibt ein Kunsthaus und ein Kino, die Kultur kommt also auch nicht zu kurz. Ein Konzert mit zwei Rocksteady-Bands wird bald stattfinden. Wer durch das Städtlein schlendert, gerät mitunter in eine veritable Sackgasse, die vor einer Haustür endet. An einer Ecke kann man bereits draussen sitzen. Am frühen Nachmittag werden hier Cappuccino, Bier und Campari getrunken, Enkelkinder ausgeführt und wird die Sonne genossen. Velos mit und ohne Anhänger oder Elektroantrieb gleiten vorbei. Die Leute grüssen sich, bleiben stehen und plaudern, das Leben fliesst dahin.

STEPHAN PÖRTNER
Der Zürcher Schriftsteller Stephan Pörtner besucht Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.
Surprise 573/24 27
Tour de Suisse
Die 25 positiven Firmen
Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Coop Genossenschaft
www.wuillemin-beratung.ch
Stoll Immobilientreuhand AG
Gemeinnützige Frauen Aarau
movaplan GmbH, Baden
Maya Recordings, Oberstammheim
Madlen Blösch, Geld & so, Basel onlineKarma.ch / Marketing mit Wirkung
Scherrer + Partner GmbH
www.dp-immobilienberatung.ch
Kaiser Software GmbH, Bern Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf
Heller IT + Treuhand GmbH, Tenniken
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Bodyalarm GmbH – time for a massage
Anyweb AG, Zürich
Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich
Fäh & Stalder GmbH, Muttenz
Hypnose Punkt, Jegenstorf
Unterwegs GmbH, Aarau
Infopower GmbH, Zürich
Dipl. Steuerexperte Peter von Burg, Zürich
Büro Dudler, Raum- und Verkehrsplanung, Biel Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
www.raeber-treuhand.ch
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.
Kontakt:
Team Marketing, Fundraising & Kommunikation
SURPLUS – DAS NOTWENDIGE EXTRA
Das Programm
Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit.
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?
Eine von vielen Geschichten Negasi Garahlassie gehört unterdessen schon fast zum Winterthurer Stadtbild. Seit rund 15 Jahren ist Negasi Garahlassie als Surprise-Verkäufer tätig. Entweder verkauft der gebürtige Eritreer seine Magazine auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof Winterthur. Der Arbeitstag des 65-Jährigen beginnt frühmorgens und dauert meist so lange, bis der abendliche Pendelverkehr wieder abgenommen hat. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen ist er auf das Einkommen des Strassenmagazinverkaufs angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das SurPlus-Programm unterstützt ihn dabei: Mit Krankentaggelder, bezahlten Ferientagen und einem Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr.
Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus
Unterstützen Sie das SurPlus-Programm mit einer nachhaltigen Spende
Derzeit unterstützt Surprise 29 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.
Spendenkonto:
Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
· ½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
· 1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus
Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90
info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden
Herzlichen Dank!
+41 61 564 90 52 I marketing@surprise.ngo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AB 500.– SIND SIE DABEI!
T
#571: Leserbrief «Ich verstehe den Sinn nicht»
«Sie haben es geschafft»
Für mich sind die Begegnungen mit den Verkäufer*innen jedes Mal schön und bereichernd. Ihre Schicksale sind berührend, ihr Engagement bewundernswert. Man muss nicht jeden Artikel im Surprise mögen, um gerne und zielgerichtet Menschen zu unterstützen. Denn diese haben es geschafft, ihr Leben in geordnete Bahnen zu lenken, ihre Armut zu bekämpfen und ihr Überleben zu sichern. In Schaffhausen steuern etliche Marktbesucher*innen auf den Surprise-Verkäufer zu. Hans Rhyner gehört am Samstag zum Stadtbild, und wenn er einmal fehlt, weil er in Zürich den Stadtrundgang übernimmt, freue ich mich, Peter Conrath zu begrüssen und mit ihm einen kurzen Schwatz zu halten.
RUTH HÄMMIG, Schaffhausen
«Unterstütze ich voll»
Heute morgen, Samstag, 30. März 2024, habe ich in Reinach (Aargau) beim CoopCenter von einer Verkäuferin mit der Nummer 109872 1 Expl. Surprise Nr. 571 gekauft. Diese Möglichkeit besteht m.W. noch nicht lange (kein Jahr). Die nächste Stelle, wo Surprise angeboten wird, ist in Aarau Bahnhof. Da ich (93-jährig) nicht oft nach Aarau fahre, passt mir das Angebot hier, meinem Wohnort. Ich sehe sehr wohl Sinn in Ihrem Konzept und danke für Ihren Einsatz in diese Richtung. Ihre Anmerkung im Anschluss an den Leserbrief unterstütze ich voll.
FRED WILDI, Reinach
AG
Impressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16
CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90
Mo–Fr 9–12 Uhr
info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78
M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe: Lea Stuber (lea)
Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Sara Winter Sayilir (win)
T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Tsehay Birhane, Dina Hungerbühler, Fabian Meister, Jonna Luostari, Kati Pietarinen, Emilia Sulek, Danil Usmanov
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage
27 500
Abonnemente
CHF 250.–, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
#Strassenmagazin
«Schwere Kost, erträglich»
Ein grosses Lob an die Redaktion Ihrer Zeitschrift. Sie greifen immer wieder wichtige Themen auf und verstehen es, auch schwere Kost interessant, informativ, aber trotzdem erträglich zu gestalten.
RUTH MARBACH, ohne Ort
«Viele Diskussionen am Esstisch»
Der Kauf des Strassenmagazins gehört für mich zum Samstagseinkauf. Die ganze Familie liest jeweils die Berichte mit Interesse, und daraus sind schon viele Diskussionen am Esstisch entstanden. Kompliment für die informativen, berührenden und persönlichen Berichte.
CHRISTINE LÜTHI, Solothurn
Ich möchte Surprise abonnieren
Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.
25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)
Gönner-Abo für CHF 320.–
Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)
Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–
Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.
Bestellen
Email: info@surprise.ngo
Telefon: 061 564 90 90
Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel
Online bestellen
surprise.ngo/strassenmagazin/abo
Surprise 573/24 29
alle sind Surprise
Wir
«Ich wäre gerne wieder unabhängig»
«Ich stamme ursprünglich aus Eritrea, bin aber schon seit zehn Jahren in der Schweiz. Meine fünf Töchter und ich leben im schönen Wädenswil am Zürichsee. Dort verkaufe ich auch Surprise. Dieser Standort ist perfekt für mich, denn so kann ich über Mittag nach Hause, wenn meine Kinder von der Schule kommen. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich habe lange nach einem Job gesucht, mit dem ich die Kinderbetreuung vereinen kann.
Manchmal werde ich beim Surprise-Verkauf darauf angesprochen, wieso ich nicht ‹etwas Richtiges› oder ‹mehr› arbeite. Dann erkläre ich den Leuten, welche Herausforderungen eine alleinerziehende Frau ohne gute Bildung zu meistern hat. Wenn sie meine bewegte Lebensgeschichte hören, haben die meisten plötzlich mehr Verständnis.
Geboren bin ich in einem Dorf. Mit 15 zog ich mit meiner Tante in die eritreische Hauptstadt Asmara. Mir gefiel das Leben in der grossen Stadt. Als ich 22 Jahre alt war, kam meine älteste Tochter zur Welt. Zuerst wollte ich ihren Vater heiraten, bald merkte ich jedoch, dass er sich nicht binden wollte. Aus Liebe respektierte ich seine Haltung. Wir hatten zu Beginn eine sehr schöne Beziehung und bekamen vier weitere Töchter. Für mich war nach der Geburt meiner ersten Tochter klar, dass ich meine Kinder allein grossziehen werde. Ich führte den Kiosk von Bekannten und verdiente so genügend Geld, um eine Kinderbetreuerin anstellen zu können. Auch dieses unabhängige Leben gefiel mir.
Dann floh der Vater meiner Kinder aus Eritrea, damit er nicht in den Militärdienst musste. Ab dann begannen auch für mich die Probleme. Auch wenn wir nicht verheiratet waren, kamen die Behörden immer wieder bei mir vorbei und befragten mich zu seinem Aufenthaltsort. Da sie von mir nicht die ‹richtigen› Antworten erhielten, wurde der Kiosk meiner Bekannten von einem Tag auf den anderen geschlossen. Ich verstand dies als Warnung und floh mit meinen Töchtern in den Sudan zu ihrem Vater. Er zog jedoch bald weiter nach Deutschland. Wir versuchten über den Familiennachzug ebenfalls eine deutsche Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, dieser Prozess dauerte aber sehr lange.
Meine Töchter und ich fühlten uns im Sudan so unsicher, dass wir schlussendlich eine Flucht ohne Papiere wagten. Dies war die schwierigste und beste Entscheidung zugleich. Die Flucht selbst war ein Albtraum. In Libyen lebten wir monatelang in sogenannten ‹Löchern›, alten Häusern ohne Strom und Wasser. Das Schlimmste war aber die Fahrt über das Mittelmeer. Unser Boot wurde mit 600 Menschen gefüllt. Als plötzlich immer mehr Wasser in unsere ‹schäbige Schwimmhilfe› floss, dachten wir alle, das sei unser sicherer Tod. Wir

Selmawit Kahsay, 41, verkauft Surprise in Einsiedeln, Rüti und Wädenswil und würde gerne einen eigenen Kiosk führen.
hatten Glück – italienische Boote kamen uns zu Hilfe. Ich bin diesen Menschen bis heute unglaublich dankbar. Meine ersten Ferien verbrachte ich daher in Italien.
Ich bin froh, dass ich nun in der Schweiz leben kann. Meine Töchter können hier zur Schule und ich kann arbeiten. Zwar ist das Vereinbaren von Beruf und Familie nicht einfach, aber bis jetzt bin ich immer irgendwie über die Runden gekommen. Am liebsten würde ich auch hier einen Kiosk führen. Ich wäre gerne wieder eine unabhängige Geschäftsfrau. Bis meine Töchter erwachsen sind, muss dieser Wunsch jedoch noch warten. Ich kann es mir in der Schweiz nicht leisten, meine Kinder jeden Tag in die Kita zu schicken. Und ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit ihnen. Oft veranstalten wir sogenannte ‹Ladies-Nachmittage›. Dann machen wir uns gegenseitig aufwendige Frisuren, ziehen schöne Kleider an, singen und tanzen zu Musik aus der Heimat. Ich achte aber darauf, dass sie zuerst ihre Hausaufgaben erledigen und genügend lernen. Das ist mir sehr wichtig – denn so werden auch sie bestimmt einmal unabhängige Geschäftsfrauen.»
Aufgezeichnet
30 Surprise 573/24 Surprise-Porträt
FOTO: BODARA
von DINA HUNGERBÜHLER
LEBEN
17.05.03.08.
HOW
STRASSEN ZEITUNGEN
DAS GESAMTE PROGRAMM AUF WWW.KORNHAUSFORUM.CH EINE AUSSTELLUNG IM KORNHAUSFORUM BERN IN ZUSAMMENARBEIT MIT WIE
VERÄNDERN CHANGE LIVES





Café Surprise – eine Tasse Solidarität
Zwei bezahlen, eine spendieren
Café Surprise ist ein anonym spendierter Kaffee, damit sich auch Menschen mit kleinem Budget eine Auszeit im Alltag leisten können. Die spendierten Kaffees sind auf einer Kreidetafel ersichtlich.



Cafés

Bild: Ole Hopp
Liste unter +41 61 564 90 90.
Beteiligte
oder bestelle die aktuelle
o og
Achte aufdieses L