davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass
Fotoessay


davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass
Fotoessay


Ausser dem Gefängnis kannte Helmut nicht viel. 45 Jahre verbrachte er in Haft.
Seite 20
Der Verkauf des Strassenmagazins Surprise ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, einer
Arbeit nachzugehen und den sozialen Anschluss wiederzufinden.
Alle

Ein
Strassenmagazin kostet Franken.
Die Hälfte davon geht an den*die Verkäufer*in, die andere Hälfte an den Verein Surprise.
Das Heft erscheint alle 2 Wochen. Ältere Ausgaben werden nicht verkauft.
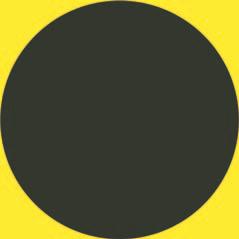
Verkäufer*innen tragen gut sichtbar einen Verkaufspass mit einer persönlichen Verkaufsnummer. Diese ist identisch mit der Nummer auf dem Magazin.







info@surprise.ngo







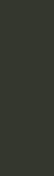











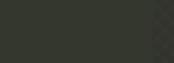

Wie viele Wohnungen haben Sie besichtigt, bevor Sie die Zusage für diejenige bekommen haben, in der Sie jetzt leben? Eine Handvoll? Ein gutes Dutzend? Vielleicht auch mehr? «Insgesamt habe ich mich auf 257 Wohnungen beworben und bin nur bei acht zur Besichtigung eingeladen worden.»
Das erlebte eine Person, die vorher obdachlos gewesen war. So geht es vielen wohnungslosen und obdachlosen Menschen, wie eine Studie nun zeigt.
Das Aussergewöhnliche an dieser Studie ist, wer sie initiiert hat: Arnd Liesendahl und Michael Müller sind keine Wissenschaftler, sondern haben einst selber auf der Strasse gelebt. Als Liesendahl sich dann wieder eine Wohnung suchen wollte, erfuhr er viel Ablehnung, hörte immer wieder Ausreden. Und so sagte er sich: Es muss etwas passieren. Im Interview ab Seite 16 erfahren Sie mehr über die Diskriminierungen, die wohnungslose Menschen bei der Wohnungssuche erleben, und über ihren Umgang damit.
4 Aufgelesen
5 Stichwort Diskriminierung
5 Vor Gericht All in!
6 Verkäufer*innenkolumne Vom Winde verweht
7 Moumouni antwortet Spielen wir in 100 Jahren eine Rolle?
8 Existenzminimum «Arm sein ist anstrengend»
14 Strategien an der Armutsgrenze
16 Obdachlosigkeit Diskriminiert bei der Wohnungssuche
20 Fotoessay Der Gefängnisalltag als Normalfall
Wie Menschen, die wenig Geld haben, mit ihrer Situation umgehen, dafür interessiert sich die Soziologin Eva Nadai. Sie und ihr Team befragen vierzig Haushalte, die Sozialhilfe beziehen, die von AHV oder IV leben, sowie Working-Poor-Haushalte. «Man möchte den eigenen Lebensplan soweit es geht selber realisieren, ohne sich in Abhängigkeiten zu begeben und sich alles vorschreiben zu lassen», stellt Nadai fest. Dazu passt, dass viele auch Online-Netzwerke nutzen, wo Dinge günstig verkauft, gratis abgegeben oder gegen anderes getauscht werden. Mehr dazu ab Seite 8.
Einen Tausch, wenn man so will, gingen auch Helmut M. und Christian Werner ein. Sieben Jahre lang begleitete der Fotograf Werner den Langzeitgefangenen Helmut M. und wurde auch sein Vollzugshelfer.
Seine Bilder finden Sie ab Seite 20.

24 Theater Verborgene Verflechtungen
25 Theater Wo die Fäden zusammenlaufen

26 Veranstaltungen
27 Tour de Suisse Pörtner in Bremgarten bei Bern
28 SurPlus Positive Firmen
29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren
30 Surprise-Porträt «Alles unter einen Hut bringen»
Aufgelesen
News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.
Einsamkeit und Isolation – ob im Falle von psychischer Erkrankung, Erfahrung als intergeschlechtliche Person oder Care-Arbeit, die weitgehend unbeachtet und unbezahlt verrichtet wird. Das sind die Themen des Kollektivs «Stripotetke», das sich während der Corona-Pandemie gegründet hat und aus elf Comiczeichnerinnen aus Serbien besteht. Das Ziel des Projektes ist es, mit Zeichnungen Geschichten sichtbar zu machen, die sonst unbeachtet bleiben.

ANZEIGE

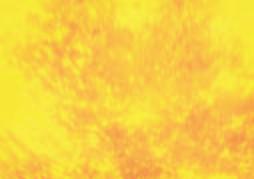



«Eine mitreissende Hymne an die Kraf t der Lichtbilder.»

Süddeutsche Zeitun g
AB 2 0. JU NI IM KIN O Sp og
Fotogtografin, Aktivistin, Humanistin


Insgesamt 14,2 der 84 Millionen Menschen in Deutschland gehören gemäss einer Studie zu den Einkommensarmen. Die Zahl stagniert auf hohem Niveau, seit dem Referenzjahr 2006 ist die Armut sogar um 42 Prozent gewachsen. Besonders das Ruhrgebiet hat mit 22,1 Prozent eine sehr hohe Armutsquote.
Rund ein Viertel der Bevölkerung von Hannover ist mindestens 65 Jahre alt, davon sind 11 Prozent arm. Im Durchschnitt können in Deutschland derzeit sogar 17,5 Prozent nicht von ihrer Rente leben.
Das Recherche-Kollektiv «topa – Tode bei Polizeieinsätzen aufklären» hat für das vergangene Jahr 43 Todesfälle bei Polizeieinsätzen in Deutschland zusammengetragen. Das Netzwerk kritisiert die mangelhafte Information, Transparenz und Aufarbeitung durch die Behörden.
Stichwort
Werde ich benachteiligt – aufgrund meines Alters oder Geschlechts, aufgrund meines Glaubens oder Gesundheitszustandes, aufgrund meiner Hautfarbe, ethnischen oder sozialen Herkunft oder etwa meiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität? Werde ich deshalb einer bestimmten kategorialen Schublade zugeordnet, in der ich als Vertreter*in dieser Schublade und nicht mehr als Individuum gesehen werde? Wird mir abgesprochen, zu der «Normalität», zu einer gesellschaftlichen Norm zu gehören? Und werde ich deshalb abgewertet und ausgegrenzt?
Diskriminierungen offenbaren tieferliegende gesellschaftliche Machtverhältnisse und Ungleichheiten. Und sie verstossen gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie gegen die Schweizer Bundesverfassung. Dort werden wir als Gesellschaft daran erinnert: Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten.
Mehr dazu erfahren Sie im Kornhausforum Bern. LEA

Besuchen Sie die Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» im Kornhausforum Bern und erfahren Sie mehr. Läuft bis am 3. August.
In der Schweiz sind wir begeisterte Zocker*innen. Mit 21 Casinos weist unser Land eine der höchsten Spielbanken-Dichten der Welt auf. Für die meisten ist das Glücksspiel harmloser Nervenkitzel – doch drei Prozent der Bevölkerung zeigen gemäss Sucht Schweiz ein problematisches Geldspielverhalten. So auch der anonyme Anzeigenerstatter, der sich 2016 bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) meldete. Er sei Pleite gegangen, im Full Ring, einem illegalen Pokerclub in einem Industriegebiet in der Zürcher Agglomeration. Bis im September 2017 gingen bei der ESBK weitere Meldungen zu nächtlichen Zockerrunden an dieser Adresse ein, bei denen jeweils 40 bis 50 Personen unbegrenzt um Cash spielten. Tatsächlich: Als die Polizei im Oktober 2017 eine Kontrolle durchführte, traf sie auf exakt diese Szene –was 2022 schliesslich zu verwaltungsrechtlichen Strafverfügungen gegen die drei Hauptverantwortlichen führte. Denn Pokerrunden mit unbegrenzten Einsätzen dürfen nur von konzessionierten Spielbanken angeboten werden. Casinos müssen ihr Personal schulen, etwa in der Früherkennung von suchtgefährdeten Spieler*innen. Selbst kleine Turniere mit geringem Einsatz benötigen eine kantonale Bewilligung. Im Fall von Full Ring machen die drei Beschuldigten geltend, nicht unter das Geldspielgesetz zu fallen. Sie stellen ihren Betrieb als privaten Hobby-Verein von Poker-Enthusiast*innen dar, in dem ohne Einsatz jährlich vier Turniere gespielt worden seien. Zugelassen sei nur gewesen, wer den Jahresbeitrag von 35 Franken bezahlt habe. Der oder die Gewinner*in des Tur-

niers konnte gratis an den gemeinsamen Reisen teilnehmen. Ziel waren internationale Pokerturniere, einmal im Jahr ging es gar nach Las Vegas.
Blöd nur, dass mehrere Zeugen klar widersprechen. Sie erklären, wie es zwar am frühen Abend jeweils Freeroll-Runden gab, bei denen ohne Einsatz gespielt wurde. Aber nach 19 Uhr habe man bei Männern mit Umhängetaschen Plaketten à 50 Franken kaufen können, die an den Tischen in Spielchips mit verschiedenen Gegenwerten umgetauscht wurden – und nach dem Spiel zurück in Bares. Dass die Polizei eine Umhängetasche mit 45 Plaketten und 2800 Franken sicherstellen konnte sowie eine feinsäuberliche Buchhaltung mit Listen der Chips sowie dem entsprechenden Gegenwert, untermauert die Aussagen.
Einer der Beschuldigten sieht ein, dass ein Anfechten der Strafverfügungen vor Gericht wohl zwecklos ist. Der zweite wehrt sich zwar, zahlt dann aber doch lieber die Busse von 6000 Franken sowie die Verfahrenskosten von immerhin rund 9000 Franken. Nur der dritte, der ehemalige Vereinspräsident, geht all in: Vor der Einzelrichterin am Bezirksgericht Bülach sagt er, er sei sich keiner strafbaren Handlungen bewusst. Und selbst wenn, sagt seine Anwältin, könne er nicht verantwortlich gemacht werden. Der Mann sei nicht rechtsgültig zum Präsidenten gewählt worden, weil er seinen Mitgliederbeitrag gar nicht gezahlt habe.
Mal sehen, was die zuständige Einzelrichterin zu dieser abenteuerlichen Erklärung meinen wird – ihren Entscheid will sie in ein, zwei Monaten bekannt geben.
YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.
Verkäufer*innenkolumne
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich köstlich amüsiert am 15. April um 18 Uhr. Sie erinnern sich? Als der Böögg stehen blieb. Also nicht angezündet werden durfte. Weil es stürmte. Riesenaufregung. Grosses Desaster. Ich hätte es ihnen von Anfang an sagen können, aber mich haben sie ja nicht gefragt.
Ich bin in Elm aufgewachsen. Im hintersten Sernftal. Wo der Föhn bläst. Und wo mein Vater Nachtwächter war. Von abends 10 Uhr bis morgens 4 Uhr war er unterwegs. 1962 bis 1970. Auf seiner Tour gab es fünf Uhren-Posten zur Kontrolle, da musste er einen Schlüssel reinstecken, zum Zeichen, dass er da war. Ein Feuerhorn hatte er dabei und einen Knüppel. Als seine Herzprobleme begannen, übernahmen wir den Job. Mein älterer Bruder und ich, unsere Mutter begleitete uns. 13, 14 Jahre alt war ich da. Für uns gab’s ein gutes Trinkgeld. Morgens musste ich dann mit dem 6-Uhr-Zug wieder los zur Schule.
Bei den Touren ging es um die Sicherheit im Dorf, aber vor allem ging es um die Angst vor dem Feuer. Wenn der Föhn ging. Ich erinnere mich gut: Einmal kamen wir an einem Restaurant

vorbei, vier Männer kamen heraus mit Brissagos und Pfeifen. Meine Mutter ermahnte sie, die Stumpen auszulöschen. Sie grinsten sie nur an und meinten, sie solle doch lieber dafür schauen, dass zuhause gekocht werde und die Hosen geflickt seien.
Das fiel mir wieder ein, als ich sie sah am Sechseläuten, die Männer auf den hohen Rössern und die Frauen am Rand, die den Männern Blumen geben dürfen, mehr nicht. Und sie hätten ja wirklich mich fragen können, wegen dem Wind. Ich ging an dem Tag wie so oft auf den Uetliberg. Leute um mich herum kommentierten das Desaster mit dem Böögg. Ich trank meinen Kaffee und lächelte still in mich hinein.
HANS RHYNER, 69, verkauft Surprise in Zug und Schaffhausen und macht Soziale Stadtrundgänge in Zürich. Auf seinen vielen Gängen auf den Zürcher Hausberg hat er schon oft erlebt, dass die Natur am Ende stärker ist als der Mensch.
Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.




Moumouni antwortet
Es gibt keine Bäume mehr, um sich zu verstecken.
Die Kinder spielen schon lange nicht mehr, und wer keine Kinder hat, argumentiert immer noch damit, ob es nicht verantwortungslos sei, Menschen in eine solche Welt zu setzen.
Letzte Woche wurden endlich die alten Autos ins All entsorgt. Es fährt eh nichts mehr. Treibstoff alle, die ganze Welt leer. Wir haben ein bisschen zu lange gewartet, auf die, die Erlösung durch technischen Fortschritt versprachen. Das fliegende Auto von den Prophet*innen der Zwanzig-zwanziger-Jahre gab es nur kurz. Schnell hatte niemand mehr Geld, das genug wert war für solche Sperenzchen.
Und dann standen die Karossen ewig herum, über Jahrzehnte. Bis sie niemand mehr sehen wollte. Endlich wurden die Denkmäler der Zerstörung im All entsorgt,
in der Hoffnung, dass ein schwarzes Loch sie nachhaltig verschluckt. Lange durfte man ja keine Denkmäler zerstören wegen der wenigen, die sie weiter anschauen wollten – warum auch immer. Doch dann gaben sich alle einen Ruck: Die Erde hat das Zeug zum Fliegen, und Ballast stört, der Schrott muss weg. Hoffnung ist das nicht.
«Der Hubschrauberflug über die Megastadt damals war so schön», sagt jemand, «ich würde diese Erfahrung nicht missen wollen.» Klar. Auch Wolkenkratzer gibt es nicht mehr. Es gibt fast gar nichts mehr, alles ist rar. «Aber dieser eine Flug von Dortmund nach München oder das andere Mal nach Wien, oder weisst du noch, als ich diese Fernbeziehung nach Hamburg hatte? All das Gefliege, das war unnötig.» Ein paar haben ihre kleinen, süssen Guilty-pleasureErinnerungen, die sie in Schuldgefühle stürzen. Es geht um Einzelmomente
statt ums Ganze. «Ja, ich weiss, die Bodenheizung war unnötig»; «Meine Güte, wäre ich doch vegan geblieben, das bereue ich bis heute»; «Ich wusste einfach nicht, dass das mit dem lange warm Duschen so schlimm ist, sonst hätte ich doch nie ...» Der Mensch – nach wie vor ein Biest ohne Bewusstsein für Verantwortung: Es weiss immer noch nicht, wer genau uns wie genau sehenden Auges in den Abgrund gewirtschaftet hat.
Alle haben poröse Lippen. Es ist trocken, der Wind bläst ständig und bekommt wenig Widerstand. Die Leute lächeln weniger. Niemand will unnötig Schleimhautfeuchtigkeit durch ein unüberlegtes flüchtiges Lächeln verlieren, so trocken ist alles. Nur «Sicherheit» ist ein Witz, und manchmal kommen die Leute zusammen und lachen gemeinsam darüber. Die meisten haben keine Lust mehr zu reden. Es war ja so viel geredet worden, und nichts ist passiert. Die meisten sind liebend gern Ausländer*innen, auf Nationalstaaten war kein Verlass. Alle sind ein bisschen enttäuscht und schockiert darüber, dass wirklich nichts passiert, wenn niemand was macht.
Es gibt keine Einfamilienhäuser mit Vorgarten mehr und keine Idylle. Die, die schlau waren, lernten schnell von denen, die schon immer keine Häuser hatten, bauten mit Gefundenem flüchtigen Unterschlupf. Eigentlich gibt es nichts mehr. Nur der Mensch und die Natur, die frostig aufgehört hat, mit ihm zu sprechen.
Sie nahm einfach wortlos alles zurück. Der Mensch parasitiert immer noch herum. Doch es gibt keine Bäume mehr, um sich zu verstecken. Es gibt nichts mehr zu verstecken, nichts mehr zu vertuschen, zu maskieren. Die nackte Wahrheit ist da, und der Mensch spielt endlich keine Rolle mehr.

FATIMA MOUMOUNI hat schon wieder vergessen, das Licht auszuschalten.
Existenzminimum Seit Jahren steigt die Armutsquote in der Schweiz an. 8,2 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, viele weitere sind armutsgefährdet. Was es im Alltag heisst, arm zu sein, erzählen drei Betroffene.
TEXT KLAUS PETRUS ILLUSTRATIONEN ANJA WICKIIn einem reichen Land arm sein: 750 000 Menschen leben hierzulande am oder unter dem Existenzminimum – für Einzelpersonen umfasst dieses Existenzminimum einen Grundbedarf von 1675 Franken sowie Wohnkosten von maximal 1465 Franken in grossen Städten und Krankenkassenprämien wie zum Beispiel in Basel-Stadt von maximal 629 Franken. So weit die Zahlen. Doch was heisst es eigentlich, in der reichen Schweiz arm zu sein?
Auf diesen Seiten kommen Menschen zu Wort, die es aus eigener Erfahrung wissen. Eine inzwischen 72-jährige Frau aus Bern zum Beispiel, deren Rente zum Leben nicht ausreicht, die bisher aber auf Ergänzungsleistungen verzichtet hat – weil sie sich schämt. Frau Krähenbühl ist keine Ausnahme, wie Studien zeigen: 230 000 Rentner*innen in der Schweiz beziehen keine Ergänzungsleistungen, obschon sie Anrecht darauf hätten. Oder ein Langzeitarbeitsloser aus Biel; er ist inzwischen ausgesteuert und lebt von der Sozialhilfe. Auch er schämt sich für seine Situation, gibt sich selber die Schuld – obschon, wie in vielen anderen Fällen auch, strukturelle Gründe wie der Arbeits- oder Wohnungsmarkt oft den Ausschlag geben, weshalb Menschen in die Armut hineingeraten.
Oder die Familie Asante-Stutz aus Winterthur; das Ehepaar ist abwechselnd berufstätig und kommt, wie
«Ich war nicht immer arm. Ich wuchs behütet auf, machte eine Lehre bei der Post, hatte eine gute Stelle. Dann lernte ich meinen Mann kennen, wir hatten drei Kinder, und als der Jüngste in die Primarschule kam, begann ich wieder Teilzeit zu arbeiten. Das tat mir gut. Irgendwann machte sich mein Mann wegen einer anderen davon und liess nie beide sagen, trotzdem auf keinen grünen Zweig. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist in der Schweiz dann armutsbetroffen, wenn sie monatlich maximal 4010 Franken zur Verfügung hat. Inflation, Mietzinserhöhungen oder stark steigende Prämien der Krankenkassen tragen dazu bei, dass es auch in der Schweiz immer mehr Working Poor wie die Familie Asante-Stutz gibt. Weil sie knapp über der Armutsgrenze leben, können sie keine Sozialhilfe beantragen.
«Arm sein ist anstrengend»
Liselotte Krähenbühl, 72, lebt in einer Sozialwohnung in der Nähe von Bern.


wieder von sich hören. Als wäre er vom Erdboden verschwunden. Und so stand ich, gerade vierzig geworden, allein mit den Kindern da.
Das war hart. Ich arbeitete viel, doch auf einen grünen Zweig kam ich nicht. Nach ein paar Jahren begann mich ein Bandscheibenvorfall zu plagen. Zuerst biss ich die Zähne zusammen und lief eine Weile krumm, aber dann musste ich mich operieren lassen und konnte wochenlang nicht arbeiten. Auf die Schmerzen folgten die Existenzängste. Und zum ersten Mal kam mir der Gedanke: Heute arm, immer arm! Zum Glück konnte ich mich wieder aufrappeln. Bis zu meinem 55. Geburtstag. Bei diesem Fest mit Familie und Freund*innen fiel ich wie aus dem Nichts in ein rabenschwarzes Loch. Eine Freundin sagte später zu mir: ‹Das musste die Erschöpfung sein.› Wie auch immer, von da an ging alles in die Brüche, aber so richtig. Inzwischen bin ich 72, ich lebe in einer Sozialsiedlung. Besuch habe ich kaum, ich möchte keine anderen Leute in meiner 1,5-Zimmer-Wohnung haben. Das wäre mir peinlich, denn es ist eng und laut hier. Darum nehme ich auch keine Einladungen an, denn ich weiss: Wer eingeladen wird, muss selber irgendwann einladen. Manchmal gehe ich mit Bekannten auf einen Kaffee, aber meistens ist das Geld knapp. Dann erfinde ich irgendwelche Ausreden – dass ich wieder einmal meinen Sohn besuchen möchte zum Beispiel oder dringend Nachbars Katzen hüten muss.
Arm sein ist anstrengend. Wie besessen schaue ich auf Preisschilder, schiele auf Aktionen und rechne den ganzen Tag rauf und runter. Es kommt mir vor, als würde ich nur in Franken und Rappen denken. Gehe ich einkaufen, weiss ich genau, an welchen Tagen was wo für wie viel zu haben ist: im Denner ein halbes Kilogramm Budget-Zwieback für 1.65 statt die normale Packung von 250 g für 3.20 oder in der Migros 6 Himbeer-Joghurts in Aktion für 2.40 statt 1 fruchtiges für 75 Rappen. Mit dem Zug oder Postauto fahre ich nur, wenn es sein muss, denn es läppert sich zusammen; auch die kurzen Strecken sind teuer geworden.
Ja, irgendwann bewegt man sich überhaupt nicht mehr nach draussen, ist nirgendwo mehr dabei. Man wird unsichtbar. Bei uns Älteren fällt das vielleicht weniger auf. Auch meine Kinder meinen, eine alte Frau wie ich sei sowieso am liebsten daheim, schaue fern oder löse Rätsel – was natürlich Blödsinn ist. Dass ich jeden Franken dreimal umdrehen muss, wissen sie nicht. Ich will ihnen keine Sorgen bereiten. Manchmal ist Geld ein Thema. Die eine Tochter fragte mich neulich, wie das sei mit der AHV und ob ich damit über die Runden komme. Einmal kam sie auf Ergänzungsleistungen zu sprechen. Da wechselte ich das Thema. Ich weiss, ich habe diese Leistungen zugute. Und ich weiss, ich bräuchte mich dafür nicht zu schämen. Ich tue es trotzdem, irgendwie kann ich mich nicht dagegen wehren. Vielleicht werde ich doch noch aufs Amt gehen und Ergänzungsleistungen beantragen. Ich fürchte mich davor – all die Formulare, all die Fragen. Manchmal gehe ich an den Hauptbahnhof, spreche die Leute möglichst dezent um Geld an. Es gibt welche, die denken, ich sei verwirrt, dann stecken sie dieser armen
Alten ein paar Franken zu. Aber ich würde mich nie irgendwo hinstellen und betteln. Ich will nicht auffallen, nur das nicht. Nicht, dass ich kein gutes Leben gehabt hätte. Aber ich habe kein gutes Alter. Bis heute habe ich dieses Gefühl, versagt zu haben.»
«Ich begann mich im Stillen selbst zu beschimpfen»
Albert Liechti (Name geändert), 63, wohnt in Biel und ist seit über zehn Jahren arbeitslos.
«Man sagte von mir, ich sei immer als Erster bei der Arbeit gewesen und hätte die anderen mit einem herzhaften ‹Guten Morgen, dann wollen wir mal!› begrüsst, was sie wohl amüsiert hat. Über zwei Jahrzehnte war ich im selben Betrieb angestellt und kümmerte mich um Buchhaltung und Bestellungen. Dafür muss man den Kopf beisammen haben, denn der kleinste Fehler hat Konsequenzen. Mir ist in all den Jahren nur einmal etwas Dummes passiert. Ich hatte eine wichtige Bestellung versäumt. Ich erinnere mich, dass ich mich zu jener Zeit irgendwie krank fühlte, ohne wirklich krank zu sein. Schon damals hatte ich Phasen, in denen sich alles um mich herum verdunkelte. Ich meine das nicht wörtlich, aber mir wurde schwer, alles war anstrengend. Dann zog ich mich für Tage zurück. Sehr viel später meinte ein Arzt, ich hätte schon seit Jahren mit Depressionen zu kämpfen gehabt.
Als der Betrieb dichtmachen musste, war das für mich, als würde mir Knall auf Fall alles weggenommen: nicht bloss die Arbeit, sondern auch ein guter Grund, morgens aufzustehen und rauszugehen, die Kollegen, die Gespräche sowie dieses Gefühl am Abend, man habe sein Tageswerk getan, und gut ist. Ich weiss, das klingt übertrieben, aber es war, als wäre mir der Sinn des Lebens verlorengegangen. Jedenfalls fiel ich in ein tiefes Loch. Damals war ich knapp über fünfzig. Wie viele Absagen ich in den nächsten zwei Jahren auf meine Bewerbungen erhalten habe, weiss ich nicht mehr, es waren bestimmt hunderte. Sowas nagt am Selbstbewusstsein. Irgendwann sagte ich mir: Was bin ich noch wert, wenn da draussen keiner mehr Verwendung für mich hat? Zwischendurch hatte ich kleinere Jobs, aber das war alles nur auf Zeit, und Respekt und Wertschätzung bekommt man da kaum. Mein Berater beim RAV meinte zwar, ich hätte mir alle Mühe gegeben. Ob das stimmte, weiss ich nicht recht. Jedenfalls wurde mein schlechtes Gewissen immer grösser, und ich erinnere mich, wie ich mich im Stillen selbst zu beschimpfen begann: ‹Du Nichtsnutz, jetzt klemm dich doch mal in den Hintern!› Aber das brachte nichts. Mit Mitte fünfzig wurde ich ausgesteuert und war nun ein Sozialfall.
Das war auch die Zeit, als die Abstände zwischen meinen Depressionen kürzer wurden. Es gab Tage, da kam ich kaum aus meiner Wohnung raus. Ich lag im Bett, sass auf der Toilette, blätterte in einem Magazin oder starrte
ins Leere. Damals suchte ich noch den Kontakt zu meinen früheren Kollegen. Einige hielten mir manchmal ein wenig Arbeit zu, Buchhaltungen und sowas. Doch ich konnte schlecht damit umgehen. Ich wusste ja, dass sie das nur aus Mitleid taten. Vielleicht hätte ich zu jener Zeit zu einem Psychiater gehen sollen, auch wegen einer IV. Bis heute denke ich, ich müsse selber damit klarkommen. Irgendwann machte ich mich rar und suchte stattdessen Kontakt zu Leuten auf der Strasse. Ich meine die, die ihre Tage am Bahnhof, an den Haltestellen, in Parks oder Kneipen verbringen. Vielleicht war das ein Fehler. Aber hier wird man wenigstens nicht die ganze Zeit gefragt, ob man endlich Arbeit hat. Niemand ruft dir zu: ‹Dem armen Schlucker noch ein Bier!› Auch kümmert sich keiner, warum ich hier gelandet bin. Das ist gut so. Die Schattenseite: Ich bin zum Trinker geworden. Manchmal, das gebe ich zu, spare ich beim Essen für ein paar Dosen Bier extra. Im Grunde ist es einfach: Ich bin jetzt 63 und schäme mich fürchterlich, dass alles so weit kommen konnte. Manchmal hasse ich mich dafür. Ich weiss, ich hätte es besser machen müssen. Am Schlimmsten ist, wenn ich den Leuten etwas vorgaukle. Neulich traf ich einen Arbeitskollegen von früher, wir redeten über dies und das, irgendwann sagte ich zu ihm: ‹Noch zwei Jährchen, dann heisst es endlich: Beine hochlegen.› Beim Abschied wünschte er mir Glück.»
Die Eheleute Asante-Stutz, 36 und 48, leben mit ihren drei Kindern in der Nähe von Winterthur, beide arbeiten in derselben Reinigungsfirma.
«Die Rechnung ist schnell gemacht: Mein Mann, 48, und ich, 36, haben drei Kinder – 3, 5 und 9 –, wir leben in einer 4-Zimmer-Wohnung und arbeiten beide Teilzeit in der Reinigung, das macht mit den Zulagen 4800 Franken im Monat. Abzüglich Miete, Nebenkosten, Krankenkasse, Kleidung, ÖV sowie einem fixen Betrag für Unvorhergesehenes bleiben uns 550 Franken für Essen und alles Weitere. Ständig ist man mit Geld beschäftigt, mit der Frage: Reicht das oder reicht es nicht? Soll ich lieber hier sparen und es stattdessen dort ausgeben? Wobei von Sparen eigentlich nicht die Rede sein kann. Ich kenne Leute, die sparen für einen Fernseher, für Ferien, eine Skiausrüstung oder gar ein Auto. Das haben wir alles nicht.
Mein Mann stammt aus Ghana, ich habe ihn im Asylzentrum kennengelernt, wo ich putzte. Es war, wie man so sagt, Liebe auf den ersten Blick. Bis unser Ältester auf die Welt kam, kam ich für alles auf. Aber es wurde immer enger. Als ich zum zweiten Mal schwanger war, erhielt mein Mann endlich seine Arbeitsbewilligung und wir dachten, jetzt seien wir abgesichert. Doch er bekam, allen Anstrengungen zum Trotz, keinen Job. Ich glaube, es ist
schwierig als Ausländer in der Schweiz, egal, wie lange du schon hier bist oder was du alles kannst. Heute arbeitet mein Mann schichtweise in derselben Reinigungsfirma wie ich.
Ich habe schon früher vieles im Brockenhaus gekauft –Geschirr, Kleider, Bücher –, das macht mir nichts aus. Das Schlimmste war für mich, beim Essen rechnen zu müssen. Der Weg zu den Tafeln war die grösste Hürde. Ich erinnere mich, wie ich mich zum ersten Mal buchstäblich dorthin geschlichen habe. Was ich dann sah – all die armen Leute, viele schon alt –, schockierte und beschämte mich. Ich fragte mich: Bin ich wirklich so schlimm dran, nehme ich nicht jemandem das Essen weg, der es noch nötiger hätte? Es ist ja nicht so, dass wir unter dem Existenzminimum leben und Sozialhilfe beziehen. Und doch. Irgendwie verstehe ich nicht, wie man die ganze Zeit arbeiten muss und trotzdem arm sein kann.
Früher oder später legt man sich ein Doppelleben zu. Ich versuche niemanden anzulügen, es ist eher so, dass ich über gewisse Dinge einfach nicht rede. Unser Umfeld ist selber nicht auf Rosen gebettet, aber Ferien liegen bei den meisten trotzdem drin oder Wanderungen mit den Kindern. Da können wir nicht mitreden. Das macht mich traurig. Eine Freundin von mir weiss Bescheid, sie ist die Einzige. Als sie von unserer Situation erfuhr, war sie entrüstet, seither will sie mir immer Geld geben oder Rechnungen für mich bezahlen. Das ist mir peinlich, und eigentlich bereue ich es inzwischen, mit ihr darüber geredet zu haben. Ansonsten weiss niemand in unserem Bekanntenkreis, dass wir das Essen bei den Tafeln abholen und neuerdings auch die Kleider von Hilfsorganisationen bekommen. Schliesslich ist alles teurer geworden. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer kommen wird. Manchmal träume ich davon, dass mir die Zähne ausfallen. Ich wüsste nicht, wie ich mir neue leisten könnte.
Hauptsache, die Kinder kriegen nichts davon mit –oder wenigstens nicht allzu viel. Mir ist wichtig, dass die Wohnung ordentlich ist und einladend, so können sie andere Kinder heimbringen, ihnen ihr Zimmer zeigen. Und dass sie ihr Spielzeug haben, normale Kleidung und so. Ich möchte nicht, dass sie auffallen, dass man ihnen ansieht, wie wenig wir haben. Man würde sie ausschliessen. Das ist meine grösste Angst. Wenig Geld haben ist das eine; nicht dazugehören ist schlimmer.»
Die Porträts von Klaus Petrus sowie die Illustrationen von Anja Wicki sind erstmals erschienen in der Publikation «Existenzminimum», herausgegeben von der Christoph Merian Stiftung CMS, Basel 2024. Der Band enthält u.a. Beiträge aus Politik, Ethik und Sozialforschung und kann hier bestellt werden: cms-basel.ch/publikationen/soziales

Working Poor oder Menschen, die Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen beziehen, versuchen mit dem wenigen Geld, das sie zur Verfügung haben, möglichst viel abzudecken. Was das für Strategien sind, untersucht die Soziologin Eva Nadai.
INTERVIEW KLAUS PETRUS
Eva Nadai, wer unter dem Existenzminimum lebt, muss jeden Franken zweimal umdrehen. Sie interessieren sich für die, wie Sie das nennen, «Existenzsicherungsstrategien», mit denen Armutsbetroffene mit ihrer Situation umgehen. Geht es um alltägliche Güter, kommen mir als Erstes Aktionen oder Billiglinien von Discountern in den Sinn.
Eva Nadai: Tatsächlich halten sich viele an solche Sonderangebote. Was allerdings oft als Belastung empfunden wird. Ich erinnere mich an eine Person, die im Rahmen unserer Untersuchungen sagte, sie kaufe nicht ein, worauf sie Lust habe, sondern was Aktion sei. Eine andere meinte, sie würde mit Blick nach unten durch die Läden laufen – weil sich dort, in den unteren Regalen, die günstigen Produkte befinden. Noch problematischer sind in diesem Zusammenhang Hilfswerke wie «Tischlein deck dich» und andere Lebensmittelabgaben. Zwar erhalten die Personen die Waren dort umsonst, doch haben sie überhaupt keine Möglichkeit zu wählen, sie bekommen das, was das Hilfswerk ihnen anbietet. Wer solche Angebote in Anspruch nehmen muss, hat meiner Erfahrung nach noch mehr Probleme mit der Stigmatisierung von «arm» oder «bedürftig» sein.
Ist diese Stigmatisierung in reichen Ländern wie der Schweiz ausgeprägter – weil der Druck grösser ist, es schaffen zu müssen? Die Stigmatisierung von Armen hat es schon immer gegeben, auch im Mittelalter waren arme Leute keine sozial angesehene Klasse. Allerdings glaube ich, dass sie in dem Masse zunimmt, wie die Arbeit für eine Gesellschaft an Bedeutung gewinnt. Dann greifen quasi-biblische Grundsätze wie: «Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!» Und ja, Arbeit spielt in Gesellschaften wie der unsrigen eine ausserordentliche Rolle. Entsprechend gehören Teilzeitjobs, Arbeit mit besonders geringem Lohn, Langzeitarbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit aufgrund von Gesundheitsproblemen zu den häufigsten Ursachen für Armut.
Hilfswerke wie Caritas versuchen der Stigmatisierung entgegenzuwirken, indem sie in ihren Märkten die Waren nicht gratis abgeben, sondern zu tieferen Preisen verkaufen. Auf diese Weise ebnen sie den Unterschied ein zwischen Supermärkten und rein karitativen Projekten, die bisweilen etwas Bevormundendes haben.
Das ist korrekt. Zugleich erwähnen Sie einen wichtigen Punkt, nämlich die Sache mit der Bevormundung. Es ist nicht so, dass Angebote wie der Caritas-Markt völlig niederschwellig wären. Wer davon profitieren will, muss – wenn auch pauschaler als bei
der staatlichen Sozialhilfe – seine oder ihre finanzielle Situation offenlegen. Bis zu einem gewissen Grad ist dies unvermeidlich, wenn es um Hilfsangebote geht. Doch nicht wenige empfinden das als einschränkend, als paternalistisch auch. Davon abgesehen, dass viele Menschen bemängeln, das Angebot in Caritas-Märkten sei – jetzt im Vergleich zu Billigdiscountern – limitiert und auch nicht sonderlich günstig, stören sie sich eben auch daran, dass sie solchen Hilfswerken gegenüber Auskunft über ihre finanzielle Situation geben müssen. Um an dieser Stelle Missverständnissen vorzubeugen: Natürlich tun Hilfswerke viel, um Menschen, die arm sind, zu helfen, und gerade sie sind für sie wichtig, wenn es darum geht, fehlende situationsbedingte Leistungen der Sozialhilfe durch punktuelle Unterstützungsangebote zu ersetzen. Hier geht es aber um etwas anderes, nämlich um Bevormundung und Kontrolle. Das ist überhaupt ein Punkt, der mir während unserer Forschungen aufgefallen ist: Armutsbetroffene sind gegenüber etwa dem Caritas-Markt und den Lebensmittelabgaben viel kritischer eingestellt als die Öffentlichkeit oder die Medien.
Wenn ich Sie richtig verstehe, reden Sie jetzt von Autonomie. Ist die Ablehnung von Kontrolle nicht generell ein wichtiger Faktor – also auch dann, wenn es um staatliche Hilfe geht? Das stimmt. Es gibt Untersuchungen zu den Ergänzungsleistungen und warum sie von vielen Senior*innen nicht bezogen werden, obschon diese ein Anrecht darauf hätten. Und ein wichtiger Grund besteht eben darin, dass man sich gegenüber dem Staat nicht immerzu rechtfertigen und bis ins Letzte kontrollieren lassen möchte. Ähnliches beobachten wir bei Working Poor, die auf Sozialhilfe verzichten. Sicher spielen hier noch weitere Gründe hinein wie bürokratische Hürden, die zu überwinden sind. Was ich meine, ist allerdings eine aktive Haltung: Man möchte den eigenen Lebensplan soweit es geht selber realisieren, ohne sich in Abhängigkeiten zu begeben und sich alles vorschreiben zu lassen – lieber nimmt man materielle Einschränkungen in Kauf.
Ich dachte bisher, dass Scham der entscheidende Grund sei, weshalb Menschen auf Hilfe verzichten, die ihnen zusteht. Natürlich spielt Scham eine wichtige Rolle, und ich würde auch nicht behaupten wollen, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Scham und der Angst vor dem Autonomieverlust. Hinter dem Gefühl von Betroffenen, sie würden vom Staat oder gewissen Hilfswerken bevormundet und in die Rolle der Bedürftigen gedrängt, kann man durchaus Beschämungsmechanismen
vermuten. Jedoch möchte ich davor warnen, die ganze Problematik von vornherein auf Scham zu reduzieren und davon auszugehen, dass sich Armutsbetroffene ob ihrer Situation schämen.
Tatsächlich fällt mir immer wieder auf, dass Menschen, die unter dem Existenzminimum leben, sich selber nicht als arm bezeichnen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja. Dahinter steht die Tendenz der Betroffenen, sich von Menschen abzugrenzen, denen es – zumindest in ihrer Wahrnehmung – noch schlechter geht. Eine der Befragten brachte es so auf den Punkt: «Ich habe wenigstens noch ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und anzuziehen, also bin ich nicht arm.» Andere, vor allem Migrant*innen, vergleichen ihre jetzige Situation mit derjenigen in ihrer Heimat, wo die Leute mit noch weniger durchkommen müssen. Wieder andere sagen, sie könnten immerhin noch zu sich selber schauen – und verbinden das nicht nur mit ihrer ökonomischen Situation, sondern auch damit, dass sie, im Gegensatz zu anderen, ihr Leben noch im Griff haben und nicht vollends von Dritten abhängig sind.
Und doch gibt es harte Fakten und Zahlen, an denen Armut gemessen wird: Hierzulande liegt das Existenzminimum bei monatlich 2284 Franken für eine Einzelperson und bei 4010 Franken für eine vierköpfige Familie. Reicht das? Gemäss den Richtlinien der SKOS, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, soll die Sozialhilfe das soziale Existenzminimum decken und «eine bescheidene und menschenwürdige Lebensführung mit sozialer Teilhabe» ermöglichen. In unseren Untersuchungen haben uns Leute gesagt, dass sie aufgrund der Ausgaben fürs Essen auf anderes verzichten müssten, wie zum Beispiel auf Hobbys, Ausflüge, Besuche im Restaurant oder im Museum. Andere sparen beim Essen, um Ausgaben decken zu können, welche die soziale und kulturelle Teilhabe betreffen. Um auf Ihre Frage zu antworten: Diese Beispiele zeigen, dass mit den heutigen Beiträgen ein soziales Existenzminimum nicht gewährleistet ist.
Sie haben die soziale Teilhabe genannt – und damit alles, was dazu gehört, damit sich Menschen als Teil der Gesellschaft fühlen können. Mir scheint, dass dieser Aspekt in der öffentlichen Wahrnehmung oft vergessen wird und man stattdessen denkt: Wer eine Wohnung hat, Kleider und Essen, ist nicht arm. Das stimmt, und deshalb möchte ich betonen, dass soziale Teilhabe kein Luxus ist, sondern zum Existenzminimum gehört. In
der Realität müssen sich Armutsbetroffene aber leider oft an Hilfswerke wenden, um die Ausgaben für soziale Teilhabe zu decken. Manche versuchen von sich aus oder mit Unterstützung von Organisationen zusätzliche Gelder einzuwerben, mit denen sie zum Beispiel ihren Kindern Hobbys finanzieren können. Auch das ist eine Existenzsicherungsstrategie – allerdings keine unproblematische, denn dadurch werden zusätzliche Ungleichheiten geschaffen. Sich auf diese Weise Unterstützung zu holen, ist mit Aufwand verbunden, und nicht alle sind dazu in der Lage: Es fehlt ihnen an Kraft oder Zeit, sie haben die nötigen Beziehungen nicht oder die Sprachkenntnisse reichen nicht aus.
Was wären andere Strategien?
Während unserer Forschung haben die von uns Befragten immer wieder von Peer-to-Peer-Netzwerken erzählt. Sie bestehen aus Privatpersonen, die günstig Gegenstände verkaufen, sie gratis abgeben oder gegen andere Sachen tauschen. Natürlich heisst das nicht, dass man auf diesem Weg alle Produkte bekommt, die man benötigt, und Hilfswerke somit überflüssig werden – zumindest gegenwärtig nicht. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist diese Strategie dennoch interessant: Der Austausch findet häufig online statt, was bedeutet, dass die Personen anonym bleiben oder zumindest nicht als «Arme» oder «Bedürftige» auffallen. Zudem können sie aus dem Angebot selber auswählen und sind nicht vom Warenpaket abhängig, das ihnen ein Hilfswerk vorsetzt. Mit anderen Worten: Existenzsicherungsstrategien wie diese sind nicht der Stigmatisierung ausgesetzt, es können überdies nahezu alle daran teilnehmen, und die Autonomie der Betroffenen wird gewahrt.
FOTO:

ZVG EVA NADAI, 64, ist Professorin an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Ihr Forschungsprojekt über «Existenzsicherungsstrategien von Armutsbetroffenen» läuft noch. Die Stichprobe umfasst vierzig Haushalte –elf Haushalte, die Sozialhilfe beziehen, dreizehn Haushalte, die von AHV oder IV mit oder ohne Ergänzungsleistungen leben, sowie sechzehn Working-Poor-Haushalte. Die Haushalte werden über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren dreimal befragt; zusätzlich werden Daten zu Einnahmen und Ausgaben erhoben. Nadai hat mit anderen Autor*innen in der «Zeitschrift für Sozialhilfe» (4/2023) über die Studie berichtet.

«Suche
Perspektiven eingestellt.»

«Ich wurde gefragt, ob ich wohnfähig sei, ob ich behindert sei, wie man nur in einem Obdachlosenheim landen kann.»



«Insgesamt habe ich mich auf 257 Wohnungen beworben und bin nur bei acht zur Besichtigung eingeladen worden. Insgesamte Suche fast zwei Jahre.»
«Wenn ich ein Telefon hätte, das wäre gut. Eins mit Internet. Ist ja alles nur noch online heute.»




«Die
Obdachlosigkeit Einst hatte er selbst keine Wohnung, nun hat Arnd Liesendahl wissenschaftlich untersucht, was wohnungslose Menschen bei der Wohnungssuche erleben. Das Ergebnis: Sie werden dabei klar diskriminiert.
Arnd Liesendahl, Sie haben selbst Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit gemacht. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit?
Arnd Liesendahl: Ich habe fünf Jahre in Köln auf der Strasse gelebt – und danach drei Jahre in der stationären Einrichtung der Wohnhilfen Oberberg in Gummersbach. Die Gründe dafür liegen in einer schweren Depression. Ich habe in dieser Zeit auf der Strasse aber nie meine Routine verloren, ich habe weiter funktioniert. Das war vor allem für ein ganz entscheidendes Thema wichtig: die Sauberkeit. Ich habe keine Drogen genommen und bin auch nicht alkoholabhängig geworden. Als ich dann aber den Weg in die Therapie gefunden habe, hat der Arzt gesagt: «Noch zwei Jahre, und Sie hätten das nicht überlebt.» Für mich ging es also wirklich ums Überleben. Als ich dann nach einem langen Weg so weit war, mich auf Wohnungssuche zu begeben, begegnete mir blanke Diskriminierung. Das hat mich sehr geärgert. Und die ständige Ablehnung verändert einen. Sie macht krank, knackst die Psyche an. Im vergangenen Jahr haben Michael Müller und ich eine Wohngemeinschaft gegrün-
INTERVIEW THERESA DEMSKI
det. Zuvor hatten wir im Umkreis von etwa achtzig Kilometern nach einer Wohnung gesucht. Wir haben mehr als dreissig Wohnungen besichtigt, manchmal zwei am Tag. Das war eine Odyssee. Wir haben alles erlebt: verbale, ganz klar formulierte Ablehnung genauso wie Ausreden.
Nun liegen die Ergebnisse Ihrer Studie vor. Was bedeutet diese Veröffentlichung für Sie persönlich?
Weil ich selbst als Wohnungsloser auf Wohnungssuche war, kenne ich die Wut und die Enttäuschung, wenn einem Vermieter*innen oder Makler*innen zu verstehen geben, dass sie nicht an wohnungslose Menschen vermieten wollen. Ich kenne dieses Gefühl, das dann zurückbleibt. Und ich fand: Es muss etwas passieren. Es war an der Zeit, über die Erfahrungen zu berichten, die wohnungslose Menschen bei der Wohnungssuche machen. Wir sind es leid, dass über dieses Thema nicht gesprochen wird. Jetzt wird darüber gesprochen.
Wie ist es zu der Studie gekommen?
Mein Kollege Michael Müller und ich haben
uns über die Wohnhilfe kennengelernt. Ich hatte dann die Idee, einen Fragebogen zu entwerfen, um andere wohnungslose Menschen nach ihren Erfahrungen zu fragen. Gemeinsam haben wir die Umfrage entworfen. Damals habe ich mich schon ehrenamtlich bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe im Sprecherrat der Facharbeitsgruppe Partizipation engagiert. Als ich dann mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule Düsseldorf in einem Gespräch zusammensass, in dem es um ein Digitalisierungsprojekt ging, brachte er die Zusammenarbeit mit einer Hochschule ins Gespräch. Diese Umfrage ist nun in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf und den Professor*innen Christoph Gille und Anne van Rießen entstanden. Es ist die erste Umfrage, die sich mit dem Thema der Diskriminierung am Wohnungsmarkt in Deutschland beschäftigt.
Wie sind Sie bei der Umfrage vorgegangen? Aus unseren neun Fragen wurden 26 Fragen, die sich an Menschen richten, die Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit und

«Ich bräuchte einen Job. Aber ohne festen Wohnsitz findet man keine Arbeit.»


Diskriminierung am Wohnungsmarkt gemacht haben. Auch Menschen mit Behinderung haben wir in diesem Zusammenhang befragt. Es geht im Fragebogen auch darum, welche Barrieren bei der Wohnungssuche aufgetaucht sind – von einer fehlenden Postadresse bis hin zu Kautionszahlungen, von der Schufa-Auskunft (vergleichbar mit dem Betreibungsregister in der Schweiz, Anm. d. Red.) bis hin zur Angabe über Krankheiten. Wir haben auch nach Nachweisen gefragt, die es erschweren, eine Wohnung zu finden. Die Menschen, die wir gefragt haben, haben auch ganz konkret von Situationen berichtet, in denen sie während der Wohnungssuche diskriminiert wurden: Manchmal sagen einem die Makler*innen oder Vermieter*innen ins Gesicht, dass sie nicht an Wohnungslose vermieten. Manchmal erfinden sie bereits am Telefon Ausreden. Und wir wollten erfahren, ob sich Menschen, die bei der Wohnungssuche diskriminiert worden sind, dann an vorhandene Beschwerdestellen gewendet haben. Insgesamt haben wir rund 500 Personen erreicht und konnten davon 291 Befragun-
«Sobald bekannt wurde, dass ich Leistungen vom Jobcenter erhalte, wurden die Gespräche abgebrochen.»

«Wenn ich zu einer Besichtigung erscheine, dann mit Schlips und Kragen.»

ARND LIESENDAHL war früher obdachlos. Mit Michael Müller, früher wohnungslos, hat er in Deutschland eine partizipative Studie zur Diskriminierung wohnungsloser Menschen am Wohnungsmarkt initiiert. Sie führten sie mit der Hochschule Düsseldorf durch, unterstützt von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sowie der Diakonie Rheinland-WestfalenLippe. «Für diejenigen, die am dringendsten eine Wohnung suchen, versagt der Wohnungsmarkt», sagen Liesendahl und Müller. Zu finden ist die Studie unter diskriminierungneindanke.de.

«Wenn ich sage, ich habe die Wohnung verloren, weil ich in Haft war, dann sagen die Leute: Nee, dann tut mir das leid.»


gen verwerten. Eine riesige Resonanz hatten wir auf eine Plakataktion, mit der wir zum Mitmachen aufgerufen haben. Daraufhin gab es viele Befragungen, die faceto-face stattgefunden haben. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgte dann durch die Hochschule Düsseldorf.
Welche Erkenntnisse haben Sie durch die Studie gewonnen?
Die wesentliche Erkenntnis ist für mich keine Überraschung, auch wenn ich die Höhe des Prozentsatzes dann doch nicht erwartet hatte: Mehr als 70 Prozent der Befragten haben angegeben, schon einmal bei der Wohnungssuche diskriminiert worden zu sein. Davon 75 Prozent aufgrund von Wohnungslosigkeit. Wir sind bei den Berichten der Befragten offener Diskriminierung begegnet, die wir in der Studie so auch wortgetreu wiedergeben (siehe Zitate in Sprechblasen).
Was kann diese Studie nun verändern?
Ich hoffe, Makler*innen, private Vermieter*innen und Immobiliengesellschaften können aufgeweckt werden. Wir haben oft erlebt, dass gesagt wird: «Nein, bei uns gibt
«Vermieter, die Mieterlass gegen sexuelle Handlungen in Aussicht stellen.»

es keine Diskriminierung. Alle werden gleichbehandelt.» Es gibt sie aber doch. Und das muss sich ändern. Wir wünschen uns auch, dass wohnungslose und wohnungsuchende Menschen erfahren, dass sie Diskriminierung nicht einfach hinnehmen müssen. Es gibt Beschwerdestellen.
Und sind mit der Studie auch politische Forderungen verbunden?
Eindeutig ja. Dabei geht es uns einerseits um die generelle Wohnungssituation: Wo es zu wenig Wohnraum auf dem Markt gibt, werden wohnungslose Menschen immer im Nachteil sein. Weitere Diskriminierungsmerkmale, die wir festgestellt haben, sind zu wenig Geld der Wohnungsuchenden sowie Rassismus. Ganz oben auf der Liste der Benachteiligten am Wohnungsmarkt stehen Menschen mit Behinderungen. Im Moment sind diese Menschen nicht nur die Letzten in der Schlange, sondern die Wohnungstüren gehen auch dann nicht auf, wenn niemand anderes in der Schlange steht. Wir brauchen deswegen andererseits Extra-Zugänge für bestimmte Gruppen: Quoten- oder Ausnahmeregelungen, Übernahmegarantien durch Jobcenter (ver-
gleichbar mit der RAV in der Schweiz, Anm. d. Red.) und Sozialämter. Ausserdem benötigen wir flächendeckend geschulte Sozialmakler*innen und Immobilienfachkräfte, die die Situation dieser Personen kennen und Zugänge zu Wohnungen vermitteln können. Und das Bild Wohnungsloser und Obdachloser in der Öffentlichkeit muss sich verändern. Zum Positiven. Seit Jahren gibt es keine Besserung der prekären Situation, im Gegenteil: Hilfesuchende werden immer stärker in ein schlechtes Bild gerückt. Mein Fazit ist: Menschen sollten für Menschen da sein. Es wird Zeit, dass die Gesellschaft erkennt: Jeder wohnungslose und obdachlose Mensch hat seine eigene Geschichte. Wir fordern ein Ende stupider Vorverurteilungen.
Dieses Interview ist zuerst auf der Website der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe erschienen. Die Zitate stammen von Befragten der Studie.
Fotoessay 45 Jahre seines Lebens als Erwachsener hat Helmut M. in Gefängnissen verbracht. Der Fotograf Christian Werner hat ihn zuletzt begleitet – als Vollzugshelfer und als Freund.


So viele Jahre hinter Mauern, weg von der Welt, und so oft die Frage, an sich selbst und an Christian Werner, den Fotografen und Vertrauten: «Wie wird es sein, wenn ich entlassen werde? Komme ich überhaupt noch zurecht?»

«Das Gefängnis ist Helmuts Leben», schreibt Fotograf Christian Werner nach seinem ersten Besuch in der Haftanstalt Bremen. Das ist am 24. Februar 2014, und Werner ahnt damals nicht, dass er den Mann, den man als Berufsverbrecher bezeichnen könnte, sieben Jahre lang begleiten wird. Bis zu Helmut M.s Tod werden sich die beiden Männer nicht mehr aus den Augen verlieren. Aus Prozessakten und Zeitungsartikeln erfährt der Fotograf mehr über Helmut M.s Vergangenheit, über Einbrüche, bewaffnete Überfälle, Diebstähle, immer wieder Fluchtversuche. 45 Jahre Knast kommen bei Helmut M. zusammen.
Irgendwann willigt Christian Werner ein, Helmut M.s Vollzugshelfer zu werden und begleitet ihn auf seinem ersten Freigang. Scheinbar banale Dinge wie eine Autofahrt überfordern Helmut M., er wird nervös und kleinlaut. Doch er geniesst Torte und Currywurst und zeigt bei zufälligen Begegnungen seinen ganzen Charme. Einen weiteren Freigang nutzt Helmut M. dafür, abzuhauen. «Er flieht aus Angst vor der Entlassung, weil er weiss, dass er wieder gefasst wird und dann den Rest der Haftstrafe verbüssen muss», sagt ein Mitarbeiter der Haftanstalt zu Fotograf Werner.
In den letzten Jahren seines Lebens leidet Helmut M. an einer Krebserkrankung. Er kommt aus dem Gefängnis frei, lebt in Pflegeheimen. Werner fährt immer wieder zu ihm. Am 7. Februar 2022 stirbt Helmut M. im Alter von 70 Jahren.


FOTO: ZVG

CHRISTIAN WERNER, 44, studierte Dokumentarfotografie in Hannover und arbeitet seit 2011 freiberuflich als Fotograf mit Schwerpunkt auf sozialen Problemen und gesellschaftlichem Alltag. Er lebt in Nürnberg und fotografiert u.a. für die Nürnberger Strassenzeitung Straßenkreuzer.
Mit freundlicher Genehmigung von STRASSENKREUZER / INSP.NGO
Hintergründe beim WDR: Fotograf Christian Werner hat (zusammen mit Stefanie Grube) ein Radiofeature über Helmut M. gemacht. «Helmut – Oder: Wie resozialisiert man einen Langzeithäftling?». radiofeature.wdr.de

Theater Das Festival Belluard Bollwerk zeigt dieses Jahr, wie stark eine zunehmend vernetzte Weltgemeinschaft die Biografien einzelner Menschen beeinflusst.
TEXT MONIKA BETTSCHEN

1 Der Tod eines Pfarrers vietnamesischer Herkunft ist Ausgangspunkt von «Fremde Seelen».
2 «Empathic Chamber» erforscht den Wunsch nach Gemeinsamkeit.
3 Die Performance «The Search for Power» geht den Störungen des Stromnetzes im Libanon nach.
Leben zum Trotz. Entgegen aller Widrigkeiten. Das Risiko auf sich nehmen, sich wenigstens die Möglichkeit auf ein besseres Leben zu erkämpfen. Das ist gemeint, wenn im diesjährigen Programmheft des Festivals Belluard Bollwerk im Vorwort von einer «Lebenswut» die Rede ist. «Nicht alle Menschen erhalten die gleichen Voraussetzungen für ein würdevolles Leben. Ungleichheiten und Spaltungen treiben Gesellschaften auseinander und Menschen in die Flucht», sagt die Medienverantwortliche Emma Isolini. Heutige Biografien sind oft geprägt von Zäsuren und Neuanfängen, zum Beispiel als Folgen von Vereinzelung, Migration oder Krieg. Und die Regisseurin Eva-Maria Bertschy formuliert


es so: «In einer globalisierten Welt gibt es immer mehr Menschen, die ein Gefühl von Fremdsein in sich tragen.»
Ihre dokumentarische Performance «Fremde Seelen» wird das diesjährige Belluard Bollwerk eröffnen. Sie handelt von einem aus Vietnam stammenden Pfarrer, der sich im Dorf, in dem Bertschys Mutter lebte, Anfang der 2000er-Jahre das Leben nahm. «Als dieser Mann in den 90er-Jahren in den Freiburger Voralpen ankam, traf er auf eine aussterbende Kirchgemeinde, weil immer weniger junge Menschen die Messe besuchten. Und die dem asiatischen Pfarrer mit subtilem Misstrauen begegnete», sagt Eva-Maria Bertschy. Sie führte eine dokumentarische Recherche durch,
indem sie Gespräche mit Menschen aus seinem und aus ihrem eigenen Umfeld führte. Obwohl «Fremde Seelen» an eine Ermittlung erinnert, stehen keine Vorwürfe oder Schuldigen im Mittelpunkt, sondern die unsichtbaren Hürden, die einem Menschen das Ankommen in einem neuen Land erschweren können. Auf der Bühne treffen die Schauspielerin Carol Schuler und der Musiker Kojack Kossakamvwe auf fiktive und echte Figuren: auf Nang, eine katholische Ordensschwester aus Vietnam, auf Eva-Maria Bertschys Mutter, auf einen Pfarrer und auf einen Kirchgemeinderat. Diese verschiedenen Ebenen zeichnen von der Fluchtgeschichte bis zu unterschwelligen Rassismuserfahrungen jene Einflüsse nach, die auf diesen Mann eingewirkt haben könnten. «Als Auswärtiger musste er sich oft erklären und kannte die sozialen Codes nicht, um einen Zugang zu dieser Dorfgemeinschaft zu finden. Aber natürlich ist das alleine nicht der Grund, weshalb er seinem Leben ein Ende setzte», sagt Bertschy. «Bei der Arbeit an diesem Stück bin ich auf Hannah Arendts Essay ‹Wir Flüchtlinge› aus dem Jahr 1943 gestossen. Sie beschreibt darin, dass viele Geflüchtete oft Jahre nach ihrer Flucht Suizid begehen. Es geht dabei um den Bruch, den ein Mensch durch die traumatische Erfahrung der Flucht erfährt, um ein daraus erwachsendes Fremdsein und eine Art Scham darüber, dass man sich nirgendwo zugehörig fühlt.» In diesem Sinn thematisiert «Fremde Seelen» auch die Überforderung mit der Migrationsthematik auf beiden Seiten. So wird klar, dass dieses Dorf stellvertretend für viele Orte in Europa steht, wo Menschen aus anderen Erdteilen Zuflucht suchen.
Verbindende Ähnlichkeiten
Welche Faktoren begünstigen ein Gefühl von Gemeinsamkeit, welche unterbinden es? Bachelor-Studierende des Contemporary Dance der Westschweizer Hochschule La Manufacture arbeiten in der Produktion «Empathic Chamber» (Choreografie: Yasmine Hugonnet und Radouan Mriziga) mit der Imitation von Gesten und finden damit Bilder für den Wunsch der Menschen, bei anderen verbindende Ähnlichkeiten zu entdecken.
Wohingegen das libanesische Künstler*innenpaar Tania El Khoury und Ziad Abu-Rish (der auch Historiker ist) im Rahmen der Performance «The Search for Power» jenen spaltenden Machtdynamiken nachspürt, die verantwortlich sind für die wiederkehrenden Stromausfälle im Land. Eine Recherche in Archiven im Libanon, aber auch in ehemaligen Kolonialmächten wie Belgien, Frankreich oder Grossbritannien brachte buchstäblich Licht ins Dunkel: Nicht die mangelhaften öffentlichen Dienste sind dafür primär die Ursache. Die Gründe reichen zurück in die Zeit der Staatenbildung vor über hundert Jahren. In eine Zeit, als Elektrizität ein gewaltiges Business war, von dem sich Politiker ebenso ihr Stück vom Kuchen sichern wollten wie Konzerne –vergleichbar mit den Machtspielen rund um die Öl- und Gasförderung: «The Search for Power» verdeutlicht, wie eng die Stromversorgung eines Landes mit wirtschaftlichen Interessen verkabelt ist und wie sie dadurch zu einem entscheidenden geopolitischen Hebel werden kann.
Theater Der szenische Spaziergang «Leute machen Kleider» offenbart, wie eng die Geschichte des Zürcher Kreis 5 mit der Baumwolle verwoben ist.
Textilfabrikgebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert prägen das Bild des Zürcher Stadtkreis 5 entlang der Limmat. Ebenso befindet sich hier eine bunte Vielfalt an Kleiderläden. Mit dem theatralen Spaziergang «Leute machen Kleider» greift das Kollektiv Theater Amalgam für das Sogar Theater beide Fäden auf, indem es das historische Gestern mit dem lebendigen Quartierleben der Gegenwart verknüpft. Live gespielte Szenen an Originalschauplätzen beleuchten die Anfänge des industriellen Baumwolldrucks in Zürich und damit auch den Beginn der globalisierten Wirtschaft, wobei man mehrere fiktive Figuren kennenlernt: zwei Textilarbeiterinnen, eine Fabrikantentochter – und einen Studenten in Jeans, der während der Globuskrawalle, die 1968 zum Auftakt der Jugendbewegung wurden, verhaftet wird. Ergänzend dazu erzählen Geschäftsinhaber*innen aus dem Kreis 5 via Kopfhörer, wie sie in die Textilbranche gekommen sind, was ihnen Kleider bedeuten oder auch, wie sie über Nachhaltigkeit denken. Hier geht es etwa um Upcycling, Secondhand oder wie Menschen mit ihrer Kleidung die eigene Kultur und Persönlichkeit unterstreichen. «Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass in der Stadt Zürich und der Schweiz ohne die Baumwolle vieles ganz anders wäre», sagt Eleni Haupt vom Kollektiv Theater Amalgam, dem auch Dagny Gioulami und Claudio Schenardi angehören. «Die Industrialisierung der Textilbranche stiess den Maschinenbau an und später, wegen der benötigten Färbemittel, auch die Chemiebranche. Das dabei erwirtschaftete Vermögen musste angelegt werden, was schliesslich auch dem Bankenwesen einen Schub verlieh», sagt Haupt. Es sind Zusammenhänge, aus denen ein grosser Teil des Wohlstandes hierzulande hervorging. «Nach dem Niedergang der Textilproduktion blieben diese Strukturen im Hintergrund weiter bestehen: So konnte sich die Schweiz erfolgreich als Drehscheibe für Baumwolle, später auch für andere Rohstoffe, positionieren.»
«Leute machen Kleider» thematisiert auch die Schattenseiten des Baumwollhandels, namentlich die Verstrickungen mit dem Sklav*innenhandel und dem Kolonialismus. Auf dem Spaziergang erfährt das Publikum von den Anfängen der Globalisierung und den Auswüchsen der oft ausbeuterischen Textilproduktion. Auch bieten die Porträts mehrerer Kleiderläden des Quartiers eine lustvolle Auseinandersetzung mit dem Thema. So laufen auf dem Rundgang die Fäden der Geschichte mit denen vieler kleiner Geschichten zusammen. MONIKA BETTSCHEN
«Festival Belluard Bollwerk», Mi, 26. Juni bis Sa, 6. Juli, Festivalzentrum Derrière-les-Remparts 14, Fribourg. belluard.ch
«Leute machen Kleider», Do, 13. bis Fr, 28. Juni, wochentags 19 Uhr, Sa oder So 15 / 11 Uhr, Sogar Theater, Josefstrasse 106, Zürich. sogar.ch
Bern «Widerstände. Vom Umgang mit Rassismus in Bern», Ausstellung, bis Juni 2025, Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Bernisches Historisches Museum, Helvetiaplatz 5. bhm.ch

Wir erinnern uns: Ein Wandbild in einem Berner Quartierschulhaus löste 2019 eine Kontroverse um Rassismus und das koloniale Erbe der Stadt Bern aus. Die Debatte intensivierte sich im Sommer 2020 angesichts der weltweiten Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung: Behörden, Medien, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Privatpersonen rangen um den geeigneten Umgang mit den rassistischen Motiven des Wandbilds. Die Stadt Bern schrieb dann einen Wettbewerb zur Kontextualisierung des Bildes aus und erklärte die Eingabe des Vereins «Das Wandbild muss weg!» zum Siegerprojekt. Der Vorschlag des Vereins war (eigentlich sagt es sein Name schon, aber die konkrete Ausgestaltung ist natürlich vielschichtiger gedacht): Das Wandbild muss – eben – weg. Aber: Es soll im Bernischen Historischen Museum seinen Platz finden, damit dieses der erhitzten Debatte Ruhe und die nötige Tiefe geben und das Wandbild als koloniales Erbe der Schweiz kontextualisieren kann. Was es jetzt auf vielfältige, aktuelle und gescheite Weise tut. DIF
Winterthur «lauschig – wOrte im Freien», Literaturreihe, diverse Veranstaltungsorte im Freien, Tickets bei der Tourist Information im Bahnhof Winterthur, online oder telefonisch unter 0900 320 320 (CHF 1/Min). lauschig.ch

Die bewährte Openair-Literaturreihe in Winterthur vereint Literatur und Natur mit musikalischer Begleitung zu einem Gesamterlebnis. Blumenwiesen und Waldwege werden zur Bühne. Und so erlebt
St. Gallen
«Burning Down the House. Rethinking Family», Ausstellung, bis So, 8. Sept., Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Do bis 20 Uhr, Kunstmuseum
St. Gallen, Museumstrasse 32. kunstmuseumsg.ch
Die Familie im engeren Sinn wird in der zeitgenössischen Kunst eher selten zum Thema. Während feministische Künstler*innen ihre Rollen als Frau, Mutter und Betreuungsperson beleuchten, bleibt es um die Familie seltsam still. Sie ist zwar ein etabliertes Genre in der Fotografie, und das Familienporträt hat eine lange Tradition in der Malerei – eine kritische Bearbeitung hat bisher jedoch kaum stattgefunden. Das will das Kunstmuseum St. Gallen ändern. Was bedeutet familiäres Zusammenleben jenseits der Modellwelt aus der Werbung? Was heisst Zusammenleben in der Familie? Wie ist die Familie im Gesellschaftssystem

man im Rosengarten einen Spoken-Word-Abend mit Lisa Christ, Jane Mumford und Jazzsänger Andreas Schaerer (27. Juni), im Rychenbergpark Erfolgsregisseurin und -autorin Doris Dörrie und Sängerin Franziska Welti (3. Juli), im Adlergarten Filmemacherin Alice Schmid und Historiker Wilfried Meichtry mit Geigerin Eva Wey (22. Aug.) und im Park des Berufsschulhauses Wiesental die beiden Autor*innen Dana Grigorcea und Mikael Krogerus mit Harfenistin Selina Cuonz (1. Sept.). Oder man geht spazieren, mit dem Lyriker Thilo Krause etwa (23. Juni), dem Nachtfalterexperten Thomas Kissling (19. Juli), den Krimiautor*innen Sandra Hughes und Joachim B. Schmidt (22. Aug.) oder dem Winterthurer Autor Yusuf Yesilöz (8. Sept.). In Winterthur wird aber auch waldgebadet, selber geschrieben – und gepicknickt: Picknicktasche mitsamt Decke zwei Tage vorher online buchen. DIF
um Rassismus und Menschenhandel. Patrizierfamilien wurden durch den Handel mit Waren und versklavten Menschen reich. Auf dem Stadtrundgang werden die Verstrickungen mit der kolonialen Vergangenheit sorgfältig entflochten, indem Fragen wie diese historisch beleuchtet werden: Sollte Basel die Benin-Bronzen zurückgeben? Inwiefern sind Werbungen von Hilfswerken rassistisch? Was hat das Bild der Schweizer Hausfrau mit dem Kolonialismus zu tun? (Der Rundgang enthält Treppen. Wenn Sie den Rundgang rollstuhlgängig besuchen möchten, melden Sie sich beim Verein Frauenstadtrundgang für eine angepasste Variante.) DIF
Bern
«Frag die Redaktion!», Publikumsdiskussion, Mi, 19. Juni, 18.30 bis 20 Uhr, Galerie, 2. OG, Kornhausforum, Kornhausplatz 18. kornhausforum.ch
verankert? Antworten geben die Arbeiten von Pionierkünstlerinnen wie Louise Bourgeois, Mary Kelly, Bobby Baker und PINK de Thierry im Dialog mit Werken einer jüngeren Generation, zum Beispiel von Rhea Dillon, Kyoko Idetsu und Lebohang Kganye. DIF
Basel
«Verstrickt, Verborgen, Vergessen», Stadtrundgang, Mi, 19. Juni, Mi, 10. Juli, Sa, 24. Aug., Mi, 25. Sept., So, 20. Okt.; wochentags 18 Uhr, Sa/So 14 Uhr, Treffpunkt Basler Münster, Pisoni-Brunnen. Anmeldung erwünscht: online oder unter Tel. 061 207 46 85 (Di und Do vormittags).
frauenstadtrundgang-basel.ch
«Wie Basels Kolonialgeschichte die Gegenwart prägt», lautet der Untertitel dieses Stadtrundgangs, es geht
An diesem Abend können Sie Lea Stuber und Sara Winter Sayilir, Co-Leiterinnen der Redaktion Surprise, alle Fragen stellen, die Sie schon immer interessiert haben. Sie können hier auch endlich erfahren, wer hinter den Kürzeln lea und win steckt. Während kp sicher auch vor Ort anzutreffen sein wird, bin ich selber (dif) in den Ferien, weswegen ich Ihnen hier dafür schon mal ein paar Anregungen mit auf den Weg nach Bern geben möchte. Das sind nämlich die Fragen, die mir an so einer Veranstaltung auf der Zunge brennen würden: «Kennt ihr eure Verkäufer*innen eigentlich persönlich?», «Gibt es einen Unterschied, ob man für eine Tageszeitung oder für ein Strassenmagazin schreibt?» und «Ich war kürzlich in England und habe mir dort eine Strassenzeitung mit Taylor Swift auf dem Cover gekauft, könnt ihr nicht auch mal sowas bringen?» Aber nun hoffen wir, dass Ihnen noch viel schlauere Fragen in den Sinn kommen. Und sonst, wie gesagt, gehen Sie einfach gucken, wie win und lea in echt ausschauen, Sie sehen sie sonst ja immer nur als Illustration unter dem Editorial. DIF



Tour de Suisse
Surprise-Standort: Migros
Einwohner*innen: 4 404
Sozialhilfequote in Prozent: 1,3
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 10,1
Schloss Bremgarten: im 16. Jahrhundert erbaut, heute in Privatbesitz
Der erste Eindruck von Bremgarten –erreicht von Bern her auf Empfehlung des viel zu früh verstorbenen Endo Anaconda der schönen grünen Aare folgend – ist grün und steil. Bald ist die Station Schloss erreicht, ein solches ist aber auf den ersten Blick nicht zu sehen, dafür gibt es eine Kirche und eine Ritterstrasse. Die Aussicht auf Fluss und Hügellandschaft ist nahezu spektakulär, einzig die mächtige Autobahnbrücke zerschneidet das Panorama. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, für die genau das die Hauptattraktion darstellt. Auch das Schulhaus besteht aus zusammengefügten alten und modernen Gebäudeteilen.
Weiter oben liegt der Grossverteiler, in dem sich auch eine Drogerie und eine Bäckerei befinden, in der man sich nicht nur verpflegen, sondern auch Postge-
schäfte erledigen kann, allerdings nicht ganz alle, wie eine Kundin vertröstet werden muss. Im hinteren Teil ist eine Art Lounge, ein Sofa mit einem Büchergestell, aus dem sich bedienen kann, wer ein Buch zurücklässt. Hier wartet ein Mann, wie er sagt, auf seine Angetraute. Während er wartet, setzt sich eine der Angestellten zu ihm, die endlich Zeit findet, selber etwas zu essen. Das Restaurant, das sich unter demselben Dach befindet, wird umgebaut und soll im zweiten Quartal 2024 wiedereröffnet werden.
Die Strasse mit dem schönen Namen Freudenreichstrasse führt durch verschiedene Einfamilienhaussiedlungen, auf deren Dächern auffällig bzw. vorbildlich viele Solarpanels angebracht sind. Es gibt auch Wiesen und blühende Bäume. Auf dem Elektrizitäts-
kasten ist ein Graffiti gegen die Polizei angebracht, etwas verloren wirkend zwischen diesen Häusern mit Minipools und Bienenstöcken in den Gärten.
Gleich nebeneinander liegen das Altersheim und die Sportanlagen, mit Fussball- und Tennisplätzen. Hier trainiert unter anderem der FC Goldstern. Es gibt einen kleinen Künstlerplatz, auf dem drei Plastiken ausgestellt sind, verantwortlich ist NöF, Nutzung öffentlicher Flächen. Aussicht auf die Kunst haben die Schweine, Ziegen und Hühner in den Gehegen des «Kleintierpärkli». Auf einem Plakat bedankt sich ein Gnadenhof für Katzen für die geleistete Unterstützung durch die Bevölkerung. Doch auch der Kunst steht weiterer Platz zur Verfügung, der kleine Kunstraum Diamant ist geöffnet und zeigt eine Ausstellung mit dem Titel «Books to survive»; auch Konzerte finden statt, für kommenden Samstag ist eines angekündigt.
Ebenfalls eine Art Bühne aus rotem Holz steht vor dem Grossverteiler und der Niederlassung eines Feuerlöscherherstellers. Daneben gibt es eine kleine Fläche zur Förderung der Biodiversität, wie ein Schild der Kommission für Natur und Landschaft erklärt. Weiter stehen da noch ein paar Hochbeete, die von Familien und Firmen betreut werden. Das Häuschen mit dem Wassertank ist mit Sonnenblumen bemalt, damit schon etwas blüht, bis die Pflanzen so weit sind.
Im Café nimmt das Warten ein Ende, die Angetraute erscheint und die beiden verlassen das Lokal.

STEPHAN PÖRTNER
Der Zürcher
Schriftsteller Stephan Pörtner besucht
Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.
Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti
Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
Beat Hübscher – Schreiner, Zürich
KMS AG, Kriens
Brother (Schweiz) AG, Dättwil Coop Genossenschaft www.wuillemin-beratung.ch
Stoll Immobilientreuhand AG Gemeinnützige Frauen Aarau movaplan GmbH, Baden
Maya Recordings, Oberstammheim
Madlen Blösch, Geld & so, Basel onlineKarma.ch / Marketing mit Wirkung
Scherrer + Partner GmbH www.dp-immobilienberatung.ch
Kaiser Software GmbH, Bern
Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Heller IT + Treuhand GmbH, Tenniken
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Bodyalarm GmbH – time for a massage Anyweb AG, Zürich
Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich Fäh & Stalder GmbH, Muttenz
Hypnose Punkt, Jegenstorf Unterwegs GmbH, Aarau
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei. Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung. Kontakt:
Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.
Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.
Einer von ihnen ist Negussie Weldai
«In meinem Alter und mit meiner Fluchtgeschichte habe ich schlechte Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt. Darum bin ich froh, bei Surprise eine Festanstellung gefunden zu haben. Hier verantworte ich etwa die Heftausgabe oder übernehme diverse Übersetzungsarbeiten. Mit dieser Anstellung ging ein grosser Wunsch in Erfüllung: Meinen Lebensunterhalt wieder selbst und ohne fremde Hilfe verdienen zu können.»

Schaffen Sie echte Chancen und unterstützen Sie das unabhängige Förderprogramm «Chancenarbeitsplatz» mit einer Spende.
Mit einer Spende von 5000 Franken stellen Sie die Sozial- und Fachbegleitung einer Person für ein Jahr lang sicher.
Unterstützungsmöglichkeiten:
1 Jahr CHF 5000.–
½ Jahr CHF 2500.–
¼ Jahr CHF 1250.–
1 Monat CHF 420.–Oder mit einem Betrag Ihrer Wahl.
Spendenkonto:
Surprise, 4051 Basel
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Vermerk: Chance Oder Einzahlungsschein bestellen: +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo oder surprise.ngo/spenden
Herzlichen Dank fürIhrenwichtigen Beitrag!
#Stadtrundgang Zürich, an Georges Meier «Nicht nur die Schoggiseiten» Ich war, und bin es immer noch, sehr berührt von dir und deiner Lebensgeschichte. Danke dafür. Du hast aufgezeigt, wie sich ein herausforderndes Leben ändern kann, und zwar in beide Richtungen. Ich ziehe den Hut vor den Schritten, die du gegangen bist, um in dein Leben zurückzufinden. Respekt! Diese Stadtführungen bieten Geschichten, die unter die Haut gehen und für einmal nicht nur die «Schoggiseiten» einer Stadt zeigen. Wenn wir eine respektvolle Gesellschaft sein wollen, ist dies ein Weg, ich kann es jeder*m empfehlen, dabei zu sein! Etwas über Menschen erfahren zu dürfen, die einen steinigen Weg zurückgelegt haben und den Abzweiger ins Leben wieder gefunden haben, ist bewegend. Ich komme gerne wieder.
LISA, ohne Ort
Impressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78
M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Lea Stuber (lea)
Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Sara Winter Sayilir (win)
T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Theresa Demski, Ruben Hollinger, Fabian Meister, Alisa Müller, Hans Rhyner, Christian Werner, Anja Wicki
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage 24 900
Abonnemente CHF 250.–, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
#572: Verkäufer*innen-Kolumne «Autoren sind keine Toren»
Auf Seite 6 von Ausgabe 572 steht unten: «Diese Texte ... und dem Autoren Ralf Schlatter erarbeitet.» Der korrekte Dativ lautet «dem Autor», Grund siehe Überschrift (gilt auch für Redaktoren). Aber sonst: Bitte weiter so!
DANIEL GOLDSTEIN, ohne Ort
#575: Hat Kapitalismus auch was Schönes? «Unseren Alltag neu würdigen»
Ein grosses Kompliment an Fatima Moumouni zu ihrem Artikel! Sie verschafft uns einen Blick ins heutige Kuba, der uns einige Aspekte unseres kapitalistischen Alltags neu würdigen lässt, gewürzt mit real existierendem «Sexotismus». Die Schlusspointe mit «Respekt» hat mich berührt.
ANDRÉ LOMBARD, Thun
Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.
25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)
Gönner-Abo für CHF 320.–
Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)
Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–
Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.
Bestellen
Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90
Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel
Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo
«Ich habe vor gut einem Jahr mit dem Verkaufen von Surprise beim Coop Trimbach angefangen, weil ich mir etwas dazuverdienen wollte. Seit ich vor zwei Jahren mit meiner Familie aus Deutschland in die Region Olten gezogen bin, hat es zuerst mit Jobs über das Temporärbüro geklappt. In Trimbach konnte ich vorübergehend im Lager eines Armaturenherstellers arbeiten, bei einem Bekleidungsunternehmen in Olten habe ich im Lager und im Laden ausgeholfen.
In den vergangenen Monaten hat sich einiges verändert. Mein Mann und ich haben uns getrennt, ich wohne nun mit den beiden Söhnen in einer Nachbargemeinde von Solothurn, er nicht weit davon entfernt. So können die Buben nach der Schule auch gut einmal alleine zu ihm gehen, zum Beispiel wenn ich Surprise verkaufe. Trimbach ist mein Verkaufsort geblieben, weil ich dort Leute kenne, aber auch, weil in Solothurn gerade kein Platz frei ist. Dazu kommt, dass ich nicht weiss, wie lange ich noch Surprise verkaufe. Mein Ziel ist ganz klar, eine feste Arbeitsstelle zu finden.
Am liebsten würde ich wieder in der Pflege arbeiten, dort, wo ich am meisten Erfahrung habe. Doch das ist hier in der Schweiz nicht einfach, denn ich habe meine Berufserfahrungen in Spanien und Deutschland gesammelt und den Pflegekurs in Rumänien absolviert. Das kommt daher, dass es in meinem Leben schon viel Hin und Her gab. Ich wurde als Tochter rumänischer Eltern, die nach dem Ende des Ceaușescu-Regimes ihr Land verliessen, in Deutschland geboren. Drei Jahre nach meiner Geburt zog es sie nach Rumänien zurück. Dort war die Wirtschaftslage jedoch so schlecht, dass sie sich weitere drei Jahre später entschieden, ihr Glück in Spanien zu versuchen.
In Madrid fanden meine Eltern Arbeit, und ich ging zur Schule. Wir hatten ein gutes Leben, doch dann erkrankte mein Vater an Krebs und starb 2003. Meine Mutter und ich durchlebten eine schwierige Zeit, blieben aber in Spanien. Nach dem Ende der Schulzeit fing ich an, in Altersheimen und Privathaushalten als Pflege- und Betreuungshilfe zu arbeiten. Der Kontakt und die Arbeit mit den älteren Menschen – von leichter Pflege über einkaufen und den Haushalt machen – gefällt mir sehr. Deshalb habe ich später in Deutschland auch in diesem Bereich gearbeitet.
Nach Deutschland gezogen sind meine Mutter, mein damaliger Freund und späterer Ehemann und ich 2010 wegen der grossen Wirtschaftskrise in Spanien. Das

Anișoara Ion, 33, verkauft Surprise beim Coop in Trimbach, sie sucht in erster Linie aber einen festen Job.
war eine gute Entscheidung, denn die Krise dauerte danach noch lange. Wir wohnten und arbeiteten in der Nähe von Freiburg im Breisgau, unsere beiden Söhne sind dort zur Welt gekommen. Während der Corona-Zeit kamen wir auf die Idee, in die nahe gelegene Schweiz zu ziehen; dort würden wir höhere Löhne als in Deutschland haben und uns mehr als immer nur das Nötigste leisten können.
Hier sind wir dann auf dem Boden der Realität gelandet. Wir haben erst hier gemerkt, dass nicht nur die Löhne höher sind, sondern auch die Lebenskosten. Meine Mutter hat daraufhin entschieden, nach Rumänien zurückzukehren und dort von ihrer Rente zu leben. Wir hingegen wollen hier bleiben.
Im Moment versuche ich, alles unter einen Hut zu bringen. Surprise verkaufen, eine feste Arbeit finden, mich informieren, welche Kurse und Ausbildungen nötig sind, damit ich hier in die Pflege- und Betreuungsarbeit einsteigen könnte – und das Wichtigste: gut zu den Kindern schauen. Ihnen würde ich gerne den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Der ältere Sohn hat kürzlich erzählt, er möchte ein Schokoladenmuseum in Zürich besuchen, der jüngere will wie seine Kollegen den Europapark in Rust besuchen. Ich selbst würde gerne mit den beiden in die Ferien fahren, meine Mutter in Rumänien und meine frühere Heimat Spanien besuchen. Doch bis es so weit ist, brauchen wir wahrscheinlich noch viel Geduld.»
Aufgezeichnet von ISABEL MOSIMANN









NEUEN PERSPEKTIVE.

Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.






Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich. Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang


17.05.03.08.