Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Migration


Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Migration

Bundesrat Beat Jans im Interview mit der Schweizer Studentin Kewanit Layne, die sich um die aufgeheizte Migrationsdebatte sorgt.
Seite 8

Die wichtigsten Kulturmagazine der Schweiz bieten im Kulturpool und im Kulturpool plus die Möglichkeit, zu günstigen Konditionen das kulturaffine Publikum gezielt anzusprechen. erreicht 377






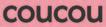






Editorial
Als Donald Trump Anfang November die Wahl zum US-Präsidenten gewann, kündigte er als Erstes an, die Sache mit der Migration aus Mexiko ein für allemal zu klären. Derweil kam aus Polen die Nachricht, man werde nach Bedarf das Asylrecht aussetzen; Italien lagert Asylverfahren nach Albanien aus und Finnland weist an der russischen Grenze Asylsuchende ab.
Und die Schweiz? Nicht nur die rechten, auch die liberalen und bürgerlichen Parteien wähnen unser Land in einer «Asylkrise», die es mit Vorstössen abzuwenden gilt, welche alle der Abschottung dienen. Wieder einmal ist von einem «Flüchtlingsstrom» die Rede, der die EU-Länder und die Schweiz zu fluten droht. Das mag für viele übertrieben klingen –aber nicht für jene, die vom Ton wie von den Konsequenzen solcher Diskussion direkt betroffen sind
Zu ihnen gehört Kewanit Layne, Tochter einer eritreischen Surprise-Verkäuferin. Sie sagt: «Die aufgeheizte Stimmung gegen Geflüchtete
4 Aufgelesen
5 Na? Gut! Über Stärken reden hilft
5 Vor Gericht Mäusi weiss von nichts
6 Verkäufer*innenkolumne Wie eine zweite Heimat
7 Die Sozialzahl Kritik an der SKOS
8 Migration Interview mit Beat Jans
14 Orte der Begegnung Der Coiffeursalon
16 Demenz Betroffenen begegnen

19 Interview mit dem Fotografen
Felix Groteloh
macht mir Angst. Wie fühlen Sie sich?» Diese Frage richtet die 20-Jährige an uns alle, im Speziellen aber an Beat Jans, den Kewanit Layne im Bundeshaus getroffen hat. Der SP-Bundesrat Jans wird wegen seiner Migrationspolitik heftig kritisiert. Im Gespräch redet er von konkreten politischen Lösungen, doch bald entwickelt es sich zu einem eher ungewöhnlichen Interview: Kewanit Layne spricht mit dem Bundesrat über die Macht der Vorurteile, sie will wissen, was sie als Einzelne, aber auch, was die Gesellschaft als Ganzes dagegen tun kann, wie viel Glaubwürdigkeit in der Politik zählt, welche Werte für Jans gelten und wie lange es dauern wird, bis jemand wie sie, ein Mensch mit Fluchterfahrung, in den Bundesrat gewählt wird. Die Antworten darauf lesen Sie ab Seite 8.
20 Verein Surprise: Innovation bei Sozialen Stadtrundgängen
22 Theater «Hierarchien abbauen»
24 Kino Dem Sog der Sucht entkommen
25 Buch Aus der Wirklichkeit geschnitten
26 Veranstaltungen
PETRUS Redaktor

27 Tour de Suisse Pörtner in Belp
28 SurPlus Positive Firmen
29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren
30 Surprise-Porträt Das Wünschen verlernt
Aufgelesen
News aus den 100 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.



Die Region ist beispielhaft für Subsistenz-Landwirtschaft, ausgezeichnet von der UN als «global wichtiges System des landwirtschaftlichen Kulturerbes».
In Österreich leiden gemäss der Österreichischen Gesundheitskasse 99000 Menschen an Long Covid. Das Gesundheitssystem, heisst es von offizieller Seite, tappe hinsichtlich Ursachen und Verlauf immer noch weitgehend im Dunkeln – und finanziert den Betroffenen keine Hilfestellungen. Die meisten Patient*innen müssen Therapien und Medikamente selber bezahlen, die Beträge liegen zwischen 2000 und 5500 Euro.
Rund um das Dorf Covas do Barroso im Norden Portugals liegt das grösste Vorkommen von Lithium in Westeuropa. Das britische Unternehmen Savannah will hier den Rohstoff für 500 000 Autobatterien aus dem Boden holen. Schon jetzt ähnelt das Gebiet einem Schweizer Käse, es ist von den Probebohrungen durchlöchert. Seit 2017 ist das Vorhaben bekannt, doch die Bevölkerung wehrt sich und versperrte von November bis Juni sieben Monate lang den Arbeitern von Savannah die Zufahrt. In Schichten, jeden Tag von 8 bis 17 Uhr, fahren Dorfbewohner*innen und Aktivist*innen gemeinsam in den Wald. Die Polizei wird informiert, nimmt die Personalien auf. Und dann sitzt man den Rest des Tages dort, Aktivist*innen auf der einen Seite, Arbeiter*innen auf der anderen. Zum Zeitvertreib wurde Karten gespielt und auf der schon geebneten Bohrplattform wurden im Frühjahr dann sogar Gemüse und Kartoffeln gepflanzt. Dieses Jahr findet das einwöchige Camp bereits zum vierten Mal statt. Laut den Veranstaltenden sind knapp 500 Personen aus Portugal, Frankreich, Spanien und Deutschland in das Dorf gekommen.

Ohne Atmung geht gar nichts. Dabei handelt es sich – vielleicht mit Ausnahme von Komplikationen und gewissen Meditationstechniken –um einen weitgehend unbewussten Vorgang, der über das verlängerte Rückenmark gesteuert wird. Gemäss Untersuchungen der Ruhr-Universität Bochum müssen täglich mehr als 10000 Liter Luft ihren Weg durch unsere Nase in die Lungen finden. Auch spannend: Bei dieser Arbeit wechseln sich unsere Nasenlöcher alle 30 Minuten ab; gesteuert wird diese Arbeitsteilung vom Hypothalamus.

Häufig werden die Stärken sozioökonomisch benachteiligter Menschen vergessen. Etwa, wenn Studierende aus der Arbeiterklasse ihr Studium aus finanziellen Gründen mit Arbeit verbinden und zudem ihren Weg an der Uni ohne akademischen Hintergrund in ihrer Familie finden müssen. Stattdessen werden sie noch als «sozial schwach» bezeichnet. Dabei ist es das soziale System, das sie nicht adäquat unterstützt.
Ein internationales Team um die Psychologin Christina Bauer von der Universität Wien hat untersucht, wie gesellschaftliche Narrative das Selbstbild und die Leistung von sozioökonomisch schwächer gestellten Studierenden beeinflussen können. In einem Langzeitexperiment wurden ihnen umgekehrte Narrative präsentiert. Dazu haben die Wissenschaftler*innen einen Text entwickelt, der die Stärken von sozial benachteiligten Menschen hervorhebt – Durchhaltevermögen, Problemlösungsfähigkeiten und Stärke im Umgang mit Herausforderungen. Die Studierenden, denen der Text vorgelegt wurde, wurden dazu angeregt, über ihre eigenen Stärken nachzudenken, die sie im Umgang mit erlebten Herausforderungen gezeigt haben.
Das Resultat: Die Übung hat ihr Selbstbewusstsein erhöht. Sie schrieben bessere Noten. Bauer sagt: «Sich selbst als stark statt schwach zu sehen, ist für jede*n von uns wichtig, um an uns glauben und unsere Leistung zeigen zu können. (…) Narrative können stigmatisierend wirken und ungewollt weiter zu Benachteiligung beitragen. Ausserdem lenken sie von den eigentlichen Problemen ab.» LEA
An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

«VERSTEHEN SIE MICH?», fragt die Einzelrichterin die 77-jährige Beschuldigte, die an einem Tisch vor ihr sitzt. «Eifach bitz lüter, bitte!», ruft diese zurück. Und, auf Nachfrage der Richterin: Jaja, sie kenne den Strafbefehl des Statthalteramts Hinwil vom letzten Januar. Es wirft der Frau vor, «erneut» gegen das Jagdgesetz verstossen zu haben.
Die Beschuldigte wuchs im Zürcher Oberland auf, beruflich servierte sie, putzte viel und bügelte in einer Wäscherei. Schliesslich absolvierte die Frau einen Pflegekurs und arbeitete bis zur Rente in einem Altersheim. Heute verwaltet sie ihre eigene Liegenschaft, ein 10-Familienhaus. Sie lebt allein, mit vielen Tieren, vor allem Katzen. Vorbestraft ist sie nicht – allerdings akzeptierte die Rentnerin im Juli 2023 einen identischen Strafbefehl und eine Busse von 250 Franken. Denn: 2020 hatte sie einen verletzten Mäusebussard aufgenommen, gepflegt, gefüttert, gar einen Gärtner beauftragt, einen Abflugmast für ihn zu bauen. Pech für sie, dass im Kanton Zürich ausgerechnet 2023 ein neues Jagdgesetz in Kraft trat – das alte stammte aus dem Jahr 1929. Nun galt ein Fütterungsverbot für Wildtiere, eben auch für Greifvögel wie «Mäusi», wie die Frau ihren Vogel nennt. Mies für sie: Ihr Nachbar zeigte sie an. Noch mieser: Er tat es erneut. Im Dezember 2023 schickte er dem Jagdaufseher ein angebliches Beweisfoto. Dieses Mal akzeptierte die Rentnerin nichts. Sie machte kein Aussage, zeigte umgekehrt den Nachbarn

an und zog den zweiten Strafbefehl umgehend weiter, weshalb nun die Bezirksrichterin über die Sache zu entscheiden hat.
«Sie sollen 6. Dezember 2023 Wildvögel mit Fleisch gefüttert haben», hält ihr die Richterin vor. «Ist nicht wahr!», fährt ihr die Rentnerin ins Wort. Nach der ersten Anzeige habe sie kein Fleisch mehr verfüttert, nur noch Körner, morgens und abends je ein Kilo. Die Richterin zeigt ihr das Bild. «Sieht aus, als wär’s Mäusi», sagt dazu die Seniorin. Aber das auf dem Tisch seien Körner, keine Pouletstückli. Das aber behaupten Jagdaufseher und Polizei, die der Frau einen Kontrollbesuch abstatteten.
Blöd für die Behörden: Eigene Tatortfotos machten sie nicht. Noch blöder: Nicht einmal das Datum der Kontrolle ist klar, wie die Anwältin der Rentnerin sagt. Der Jagdaufseher will am 6. Dezember dagewesen sein, die Polizei am 8. Zudem sei das Foto des Nachbarn wohl illegal entstanden, eine Gegenanzeige wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten laufe. Ohnehin sei darauf nicht ersichtlich, was der Mäusebussard frisst. Überdies sei Mäusi nicht irgendein Wildvogel. Er habe die Scheu abgelegt und komme nun regelmässig bei der Frau vorbei. «Mäusi weiss nichts vom neuen Jagdgesetz.» Die Frau sei freizusprechen und zu entschädigen.
Damit findet sie Gehör. Die Richterin spricht die Rentnerin frei. Das Bild tauge nicht als Beweis. Die Behördenaussagen überzeugten nicht, es sei zweifelhaft, ob der Jagdaufseher überhaupt vor Ort war. Die Richterin schliesst mit Ausführungen zum neuen Jagdgesetz: Die massvolle Fütterung von Sing- und Wasservögeln sowie Eichhörnchen sei weiterhin erlaubt. Allerdings sei das bei zwei Kilo zweifelhaft.
YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.


Verkäufer*innenkolumne


Angefangen hat es 1996, da durfte ich als Teenager mal eine Woche zu einer netten Familie in Tschechien. Das war für mich etwas vom Schönsten. Damals musste man noch den Pass zeigen, um nach Tschechien zu kommen, dafür gab es noch den Eurocity «Karlstein/ Karlštejn» von Dortmund via Nürnberg nach Prag. Jetzt reicht die Identitätskarte, falls überhaupt eine Grenzkontrolle kommt, und es gibt kombinierte Fahrkarten, die grenzüberschreitend sowohl in Bayern als auch in Böhmen, heute Tschechien, gültig sind.
Die Gastfreundschaft ist kaum irgendwo so hoch wie in Tschechien. Nur mit der Sprache könnte man vielleicht ein Problem haben, denn Tschechisch hat sieben grammatikalische Fälle, sogar Personennamen ändern sich von Fall zu Fall. Hinzu kommen Wörter ohne Vokal. Der Hals z.B. heisst auf Tschechisch «krk». Ganz schwierig ist im Tschechisch das ř, diesen Buchstaben
können so gut wie alle Nichttschechen nicht richtig aussprechen. Aber irgendwie klappt die Kommunikation auch mit Reisenden wie mir immer, ziemlich viele Tschech*innen können Deutsch, manche auch Englisch. Nur ist für Deutschsprachige zu beachten: Das Land heisst «Tschechien» und nicht «Tschechei», sonst gibt es Rüffel – der Begriff ist belastet: Er gehörte zum NS-Sprachgebrauch.
Was mir auch sehr gefällt an diesem Land ist, dass es ein sehr dichtes Eisenbahnnetz gibt und es somit leicht zu bereisen ist: Jedes Mal eine schöne Erfahrung. Das Land ist quasi in der Mitte von Europa und hat sehr grosse Unterschiede zwischen Winterkälte und Sommerhitze. Eine Wanne zwischen den Sudeten, dem Erzgebirge und dem Böhmerwald.
Während ich gerade im Euronight von Tschechien zurückfahre, schreibe ich diesen Text und habe bereits mein nächstes «tschechisches Erlebnis»: Ich


hätte in Rybník in den Euronight einsteigen sollen, doch das ist ein Bahnhof mitten im Nichts, und ich hatte Hunger. Ich fühlte mich praktisch ausgesetzt. Da fragte ich die Angestellte der Česke Drahy – der tschechischen Bahn – ob ich mit meinem Billett einen Zug früher bis Linz fahren darf, um dort etwas zu essen. Und es ging! In Linz, Österreich, bin ich nun in den Euronight nach Zürich eingestiegen, wo mich erneut ein Zugschaffner mit tschechischem Herz und Freundlichkeit empfangen hat.
MICHAEL HOFER, 44, verkauft Surprise in Zürich Oerlikon. Mit der tschechischen Familie, bei der er vor fast 30 Jahren war, ist er nach wie vor in Kontakt.
Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autoren Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.
Wer in Armut gerät, hat Anspruch auf materielle Leistungen der Sozialhilfe. Diese setzen sich aus dem Grundbedarf, der Miete und der Krankenversicherung zusammen. Die Höhe dieser finanziellen Unterstützung hängt von der Haushaltssituation ab. Zur Berechnung des Grundbedarfs wird eine Äquivalenzskala der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) verwendet. Sie zeigt an, wie hoch der Grundbedarf bei wachsender Haushaltsgrösse ist. Aktuell erhält eine alleinstehende Person 1031 Franken zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Hygiene, Mobilität etc.), ein Zweipersonenhaushalt wird aber nicht mit dem doppelten Betrag unterstützt. Vielmehr zeigt die Äquivalenzskala einen Multiplikator von 1,53 an, weil man annimmt, dass manches in Mehrpersonenhaushalten eingespart werden kann. So braucht es unabhängig von der Haushaltsgrösse nur einen Internetanschluss. Je grösser der Haushalt, desto geringer ist deshalb der zusätzliche Betrag, um den der Grundbedarf ansteigt.
Die Äquivalenzskala der SKOS ist in die Kritik geraten. Diese beginnt schon bei der Festlegung des Grundbedarfs für eine alleinstehende Person. Indizien deuten darauf hin, dass die erwähnten 1031 Franken zu tief sind und den tatsächlichen Bedarf zur Gewährleistung eines sozialen Existenz minimums nicht decken.
Weiter wird kritisiert, dass die SKOS die Kosten von Kindern generell zu tief ansetzt. Dies zeigt ein Vergleich mit der Zürcher Kinderkosten-Tabelle, welche von Gerichten, etwa bei
Scheidungen, zur Festlegung des Kindesunterhalts herangezogen wird. Durchs Band sind die Unterstützungsleistungen für Kinder bei der SKOS tiefer. So betragen die Ausgaben gemäss Kinderkosten-Tabelle für ein Einzelkind je nach Alter 550 Franken (bis 3 Jahre), 820 Franken (4–11 Jahre) oder 1020 Franken (ab 12 Jahren), während der Grundbedarf in der Sozialhilfe sich bei einem Einzelkind ungeachtet seines Alters bei Paarhaushalten um 341 Franken, bei Alleinerziehenden um 546 Franken erhöht.
Auch bei Vergleichen mit anderen Existenzminima, etwa jenem der Ergänzungsleistungen oder des betreibungsrechtlichen Minimums, schneidet die SKOS-Äquivalenzskala schlecht ab. Nirgends werden die zusätzlichen Kosten von Kindern tiefer abgegolten als bei der Sozialhilfe. Diese Konstellation kann die Entwicklung der Kinder gefährden. Sie haben geringere Bildungschancen, weil sich armutsbetroffene Eltern weiterführende Schulen nicht leisten können. Sie haben eine schlechtere physische und psychische Gesundheit, weil sich die Armutssituation in familiären Spannungen entladen und zu psychosomatischen Krankheitsbildern führen kann. Sie haben weniger soziale Kontakte, weil es den Eltern an Geld fehlt, um Sportaktivitäten oder Ferienlager zu finanzieren. All dies trägt dazu bei, dass Kinder, die in armutsbetroffenen Familienhaushalten aufwachsen, ein hohes Risiko tragen, dass sie sich selbst als Erwachsene wieder in einer prekären Lebenslage wiederfinden. Die zu tiefe materielle Unterstützung der Sozialhilfe verstärkt dieses Risiko.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Höhe des monatlichen Grundbedarfs und der betreffenden Erhöhung für den Lebensunterhalt gemäss SKOS-Richtlinien
«Was
Migration Kewanit Layne ist als Kind aus Eritrea geflüchtet. Im Interview spricht sie mit Bundesrat Beat Jans über die aktuelle Asylpolitik, Vorurteile und die potenziell erste Bundesrätin mit Fluchterfahrung.
INTERVIEW KEWANIT LAYNE FOTOS KLAUS PETRUS
Als die 20-jährige Kewanit Layne sechs Jahre alt war, flüchtete ihre Mutter mit ihr und ihren fünf älteren Geschwistern von Eritrea in die Schweiz. Layne macht sich Sorgen um die gegenwärtige Migrationspolitik, wie sie auch vom Bundesrat vertreten wird. Zusammen mit Surprise hat sie sich in Bern auf ein Gespräch mit dem SP-Bundesrat Beat Jans getroffen. Dabei ging es nicht nur um das Schweizer Asylwesen, sondern auch um den moralischen Kompass in der politischen Arbeit, um Menschlichkeit, Irrtümer sowie um die Chance für eine Schweizerin wie Kewanit Layne, jemals Bundesrätin zu werden.
Kewanit Layne: Die aufgeheizte Stimmung gegen Geflüchtete macht mir Angst. Wie fühlen Sie sich? Beat Jans: Mir geht es gut. Als Bundesrat orientiere ich mich am Gesetz und als Mensch an der Menschlichkeit. Die Bundesverfassung ist unser politischer Leitstern, gerade in Krisenzeiten, in denen die Verunsicherung gross ist. Sie schützt die Rechte von allen Menschen, auch von Geflüchteten. Ausserdem ist die humanitäre Tradition der Schweiz eine wichtige Orientierung.
Die aktuelle Stimmung macht Ihnen also keine Angst?
Nein, ich habe keine Angst. Als ich Bundesrat wurde, war mir bewusst, dass ich auch in schwierigen Zeiten und bei schwierigen Entscheidungen hinstehen und für die Bevölkerung da sein muss.
Positionen, die noch vor kurzem als extrem galten, sind inzwischen normal. Wie nehmen Sie die Stimmung hierzulande wahr?
Die Welt verändert sich, aber nicht unsere Werte. Der Ukrainekrieg ist das beste Beispiel: In den letzten Jahren sind vier Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet und haben in Europa Aufnahme gefunden. Für unsere Gemeinden ist dies eine riesige Herausforderung. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, wenn es heisst: Wo führt das alles hin? Wie sollen wir das in Zukunft schaffen? Wir können es. Im Moment kommen weniger Menschen aus der Ukraine in die Schweiz, als wir ursprünglich an genommen haben. Und auch für die Geflüchteten haben wir in letzter Zeit etwas erreicht. So konnten wir in den Bundesasylzentren die Sicherheit stärken sowie die medizinische und psychologische Betreuung verbessern. Ich möchte dazu beitragen, dass die Stimmung sich beruhigt und wir unser Asylwesen für die Zukunft wieder krisenresistenter aufstellen können.
Mein Vater war als Erster aus Eritrea geflohen. Als die Polizei davon erfuhr, sperrte sie meine Mutter, meine fünf Geschwister und mich ein – mein ältester Bruder war damals 12 Jahre alt, ich 18 Monate. Weil ich krank wurde, kam ich ins Spital. Schliesslich sind auch wir geflohen. Ich kann nachvollziehen, wenn die Menschen solche Fluchtgeschichten nicht mehr hören wollen. Zugleich bereitet es mir Sorge, denn durch diese Abstumpfung werden Geflüchtete nicht mehr als Menschen gesehen. Wie können wir als Gesellschaft die Menschlichkeit, die Ihnen, wie Sie sagen, ebenfalls wichtig ist, wieder sehen? Es braucht ein Engagement von uns allen, und das spüre ich auch immer wieder. Nicht nur bei meinen Mitarbeitenden, die sich um Geflüchtete kümmern. Sondern auch bei vielen, die sich freiwillig engagieren. Als nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine viele Menschen zu uns in die Schweiz flüchten mussten, hat die Zivilgesellschaft gezeigt, dass sie bereit ist zu helfen. Und ich sehe es natürlich auch als meine Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen, dass hinter jeder Fluchtgeschichte Menschen stehen. Fast alle verbinden damit schlimme Erfahrungen. Niemand hat sich die Entscheidung leicht gemacht, die Heimat zu

Geboren: 1964 in Basel
Aufgewachsen: in Riehen bei Basel Wohnt: in Basel Muttersprache: Schweizerdeutsch Nationalität:
Schweiz Familie: verheiratet, zwei Töchter (16 und 18) Ausbildung: Landwirt, TTL-Agrotechniker, Umweltnaturwissenschaftler Beruf: Bundesrat Chefin: die Bevölkerung
Motto: Die Bundesverfassung ist mein Leitstern. Hätte gern diese Superkraft: Hass abstellen Hobbys: Schlagzeug spielen, Hund, joggen Mag: den FC Basel, Musik, Rösti Mag nicht: NeinSager*innen, Eigentore Lieblingsband: Ramones Heldin der Kindheit: Pippi Langstrumpf
War von 2012 bis 2021 im Vorstand vom Verein Surprise, die letzten fünf Jahre als Präsident.
verlassen. Was es auch braucht, sind Menschen wie Sie. Die ihre Geschichten erzählen und vielleicht auch helfen, Vorurteile aufzubrechen, die sich verfestigt haben.
Ja, Integration muss von beiden Seiten kommen. Als jemand, die in Eritrea geboren wurde, aber auch Schweizerin ist, stosse ich allerdings an meine Grenzen, wenn ich immer wieder zu hören bekomme, wie gut ich Deutsch kann, oder wenn ich gefragt werde, wie lange ich schon in der Schweiz lebe. Das gibt mir das Gefühl, dass ich als Fremde gesehen werde und nicht wirklich als Teil der Gesellschaft. Was muss sich ändern, damit ich nicht mehr mit solchen Kommentaren und Fragen konfrontiert werde?
Sie werden mit Stereotypen konfrontiert. Das ist ein Stück weit menschlich, das sagt auch die Verhaltensforschung. Stereotype helfen den Menschen, sich in einer komplexen Welt zu orientieren. Man darf sich davon aber nicht zur Schwarzweissmalerei verleiten lassen, zur Angstmacherei oder zu simplen Lösungen. Aber ich glaube, wenn Sie als Betroffene die Geduld aufbringen, mit den Menschen zu reden,

leisten Sie einen grossen Beitrag. Im Gespräch schaffen wir Nähe und Vertrauen.
Und Sie als Bundesrat: Welchen Beitrag können Sie leisten? Auch ich persönlich setze auf Dialog. Ich möchte mit möglichst vielen Menschen im Gespräch sein. Dazu gehören auch Geflüchtete. In letzter Zeit habe ich viele Asylzentren besucht. Ich versuche aber auch mit Gemeindepräsident*innen, die am Anschlag sind, in Kontakt zu bleiben. Letztlich braucht es konkrete Lösungen, damit die Akzeptanz für das Schweizer Asylwesen bestehen bleibt.
Als es dieses Jahr Konflikte unter Eritreer*innen gab, wurde sofort verallgemeinert und es hiess, Eritreer*innen an sich seien gewalttätig. Gegen so ein Vorurteil kann ich als Einzelperson nichts ausrichten. Es gab dann Demonstrationen von Eriteer*innen. Glauben Sie, das hilft gegen diese Stereotype?
Die Menschen in der Schweiz verstehen nicht, dass verschiedene eritreische Gruppierungen sich bekämpfen, und dies zum Teil sogar gewalttätig. Das führt zu einer politischen Hektik. Ich suche hier nach Lösungen. Aber die eritreische Gemeinschaft kann nicht von der Schweiz erwarten, dass sie die Probleme in Eritrea löst.
Was würden Sie sich von den Eritreer*innen wünschen?
Den Dialog suchen, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Einerseits den Dialog mit Menschen in der Politik, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Andererseits den Dialog mit Menschen in der eritreischen Gemeinschaft. Es ist mir klar, das ist nicht einfach, gerade mit der Geschichte, die Eritrea hat.
Apropos Stereotype und Vorurteile: Sieben von zehn Migrant*innen machen sich gar nicht auf den Weg nach Europa. Sie flüchten innerhalb ihres Landes oder gehen in ein Nachbarland, etwa von Afghanistan nach Pakistan oder in den Iran. Trotzdem dominiert bei uns der Eindruck: Sie kommen in «Scharen» in den Westen, nach Europa, in die Schweiz. Wäre es nicht die Aufgabe des Bundesrates, aktiv gegen solche Vorurteile vorgehen?
In der Geschichte der Menschheit waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht. 70 Prozent der Geflüchteten bleiben im ei-
genen Land oder gehen in eine benachbarte Region. Manche Länder in Afrika oder Asien haben viel grössere Herausforderungen zu bewältigen als wir. Trotzdem muss die Schweiz einen Teil der Verantwortung wahrnehmen. Sie haben recht, es gehört zu meinen wesentlichen Aufgaben, den Diskurs zu versachlichen, einzuordnen und dabei stereotypischen, falschen Aussagen zu widersprechen. In der ausserordentlichen Session im Herbst musste ich dutzende Fragen zu Migration und Asyl beantworten.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie es als Bundesrat nie allen Menschen mit ihren unterschiedlichen Problemen, Wünschen und Hoffnungen recht machen können. Frustriert Sie das?
Ich orientiere mich an meinem Kompass, und das ist die Bundesverfassung. Es geht darum, Probleme zu lösen und das Leben der Menschen konkret zu verbessern. Frustration hilft da nicht weiter, es bringt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Stattdessen muss man zuhören, Kritik ernst nehmen und konkrete Lösungsvorschläge umsetzen. Im Kern sieht meine Asylpolitik so aus: Die Asylentscheide müssen schnell gefällt werden. Jene Menschen, die hierbleiben, müssen wir rasch integrieren. Und jene, die keinen Schutz bekommen, sollen rasch heimkehren.
Haben Sie je an Ihrem Kompass gezweifelt?
Daran habe ich, ehrlich gesagt, keine Zweifel. Was mir Kraft gibt, sind die Menschen. Für sie stehe ich jeden Morgen auf, und ihnen gilt mein Engagement.
Spüren Sie denn nie eine Diskrepanz zwischen Ihren Idealen und der Realität?
Wenn Sie sich für dieses Amt bewerben, wissen Sie, da wird Ihnen nichts geschenkt. Im Gegenteil, das ist eine wirklich harte Aufgabe, man muss sich jeden Tag allen möglichen Herausforderungen stellen. Wichtig ist, sich treu zu bleiben und offen zu sein für Lösungen und die Meinungen von anderen.
Was macht für Sie einen guten Bundesrat aus?
Dass er sich nicht abschrecken lässt von Kritik, Aufregung, Hektik. Und von Angstmacherei. Und dass er bis zu einem gewissen Grad mutig ist und bereit, einfach mal einen Weg einzuschlagen. Und wenn er

sich als falsch herausstellt, diesen Pfad auch wieder zu verlassen und einen anderen zu suchen. Entscheidend ist, dass wir aus Fehlern lernen.
Wann haben Sie zuletzt einen Fehler gemacht?
Sagen wir so: In aller Regel schaue ich nach vorne und versuche, mich nicht an früheren Fehlern festzubeissen. Aber ja, niemand ist fehlerfrei.
Ein Bundesrat hat Macht. Hat man da nicht Angst, sich zu verändern?
Man legt sich mit der Zeit schon ein bisschen eine dickere Haut zu. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Werte und meine Menschlichkeit über Bord werfe. Es ist mir zum Beispiel wichtig, wie meine Frau und meine Töchter mich in dieser Position erleben. Sie stellen viele Fragen, sie versuchen meine Entscheidungen nachzuvollziehen. Das führt zu interessanten Diskussionen.
Kann man als Bundesrat überhaupt glaubwürdig bleiben?
Ja, das kann man. Es gibt Bundesrät*innen, die bis zum Schluss glaubwürdig geblieben
Geboren: 2004 in Mendefera (Eritrea) Aufgewachsen: in Mendefera und ab 6 Jahren in Langenbruck, Füllinsdorf, Liestal (alle BL) Wohnt: in St. Gallen Muttersprache: Tigrinya Nationalität: Schweiz, Eritrea Familie: fünf ältere Geschwister Ausbildung: Matur Beruf: Studentin (Wirtschaft an der Uni St. Gallen), Nebenjob in einem Fastfood-Imbiss Chefin: ich selbst Motto: Trust in God Hätte gern diese Superkraft: teleportieren Hobbys: Volleyball, joggen Mag: Capri Sun, lustige Familientreffen Mag nicht: Pilze, zu spät kommen Lieblingssong: Someone Else, Tory Lanez Heldin der Kindheit: Barbie
Holt bei Surprise manchmal Hefte für ihre Mutter ab, eine Surprise-Verkäuferin.
sind. Sie haben ihre Werte auf eine gute Weise eingebracht, selbst aus einer Minderheit heraus. Sie blieben sich selber treu, waren offen und beweglich.
Für mich wären Sie glaubwürdig, wenn Sie bis zum Ende Ihrer Amtszeit das durchziehen können, was Sie am Anfang, bei Ihrer Wahl, versprochen haben. Können Sie das erfüllen, was glauben Sie? Am Ende wird das die Bevölkerung beurteilen müssen. Es ist auf jeden Fall ein Anspruch an mich selber, dass ich mir selber treu und glaubwürdig bleibe. Und ich habe den Eindruck, dass das überall, wo ich hinkomme, geschätzt wird. Dass ich versuche, im Bundesrat und in der Gesellschaft die Menschlichkeit zu verteidigen.
Ich bin skeptisch, dass man mich –ginge ich in die Politik – wählen würde. Ich werde nicht wirklich als Schweizerin wahrgenommen, wegen meiner Hautfarbe, wegen meiner Herkunft. Trotzdem: Welchen Rat würden Sie mir geben, wenn ich eines Tages auch Bundesrätin werden möchte? Glauben Sie, ich hätte überhaupt eine Chance?
Ja, ich fände das super, wenn jemand mit einer Fluchtgeschichte in den Bundesrat käme. Es braucht natürlich auch Glück, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Aber politisches Engagement von Menschen wie Ihnen ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Sie repräsentieren einen erheblichen Teil der Gesellschaft.
Schätzen Sie die Schweizer Bevölkerung so ein, dass sie schon parat wäre für eine Bundesrätin mit Fluchtgeschichte? Ich würde das nicht ausschliessen. Wenn es jemand ist, der die Aufgabe glaubwürdig wahrnimmt, integer ist und sich um schwierige Fragen bemüht, dann wäre das auf jeden Fall ein Mehrwert.
Im Parlament gibt es aber viel weniger Menschen mit Fluchterfahrung als in der Gesellschaft. Für Menschen mit Fluchtgeschichte ist der Weg in die Institutionen besonders weit, das stimmt. In meinem politischen Umfeld gibt es aber nicht wenige, die sich politisch engagieren, vor allem Menschen mit kurdischem Hintergrund. Sie konnten sich im kantonalen Parlament sehr erfolgreich eta-
Mit Kewanit Layne am runden Tisch – auch für Bundesrat Jans kein alltägliches Interview.
blieren und auch viel erreichen für das Verständnis in der kurdischen Frage. Es ist also nicht unmöglich.
Und was schätzen Sie, wie lange wird es dauern, bis jemand wie ich Bundesrätin wird? Wie alt sind Sie jetzt?
Ich bin zwanzig.
Als ich beschloss, in die Politik einzusteigen, dauerte es noch 25 Jahre, bis ich Bundesrat wurde.
Gut, dann sind wir in 25 Jahren so weit. Hoffentlich. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Aufgezeichnet von LEA STUBER und KLAUS PETRUS
Hintergründe im Podcast:
Simon Berginz spricht mit Kewanit Layne und Redaktorin Lea Stuber über das Interview mit Bundesrat Beat Jans. surprise.ngo/talk

Kommentar
Noch kein Jahr im Amt weht Beat Jans, dem Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), allenthalben ein rauer Wind entgegen. Was er auch tut (oder lässt) in Sachen Migrationspolitik, der SP-Bundesrat wird von rechts bis links kritisiert. Beispiel «24-Stunden-Verfahren»: Mit dieser Massnahme will Jans die Zahl angeblich aussichtsloser Asylgesuche senken. Vor allem im Visier: Leute aus den Maghreb-Staaten, jung und männlich (Surprise 572 und 586/24). Von linker Sicht schiesst sich der Bundesrat damit auf einen «altbekannten Sündenbock» ein statt dazu beizutragen, dass diese Menschen, ob in ihrer Heimat oder in der Schweiz, bessere (Arbeits-)Perspektiven bekommen. Von rechts heisst es, Jans sei nichts als ein «Ankündigungsminister»: das Verfahren dauere in Wahrheit zwölf Tage und sei wirkungslos. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) kontert, die Zahl der Migrant*innen aus dem Maghreb in Bundesasylzentren sei seitdem um 42 Prozent gesunken; woraufhin die Rechten einwerfen, von Bedeutung sei hier die Menge an Asylgesuchen, und die steige durchaus. Überhaupt stürze die Schweiz, wieder einmal, Hals über Kopf in eine «Asylkrise» – bei 30 000 Gesuchen im vergangenen Jahr, die höchste Zahl seit 2015.
Konnte sich der Bundesrat früher bei extremen Vorstössen von rechts auf die politische Mitte verlassen, scheint sich das Gewicht nun verlagert zu haben: Im September beschloss der Nationalrat, dass vorläufig Aufgenommene generell kein Recht mehr darauf haben, Familienangehörige in die Schweiz zu holen. Dafür stimmten die SVP, die FDP sowie die Mitte-Partei. Dagegen hat die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S) beantragt, die Motion abzulehnen.
Jans, das betont er auch im Gespräch mit Surprise, ist darum bemüht, die hitzige Diskussion um Migration zu versachlichen. Er setzt auf Zahlen und Fakten, sieht sich als Aufklärer, verweist etwa darauf, dass die überwiegende Mehrheit der Migrant*innen Binnenflüchtete seien – und also gar nicht auf dem Weg in die EU oder in die Schweiz (Surprise 578/24). Tatsächlich müsste, ginge es um Fakten, einiges anders eingeordnet oder wenigstens differenziert werden, zum Beispiel bei Fragen wie: Wie viele der derzeit in der Schweiz lebenden Menschen ohne CH-Pass stammen aus einem EU/EFTALand? – Antwort: 75 Prozent. Wie viele der 80 648 zwischen Januar und Juni 2024 Zugewanderten haben ein Asylgesuch gestellt? – 37,5 Prozent. Aus welchen Ländern stammen die Asylsuchenden? – über die Hälfte aus Afghanistan, der Türkei und Eritrea, vergleichsweise wenig aus den Maghreb-
Staaten, z. B. 6 Prozent aus Algerien und 1,9 Prozent aus Tunesien. Wie viele Gesuche auf Familiennachzug vorläufig Aufgenommener wurden bewilligt? – in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich gerade mal 126 jährlich; und so fort.
Bloss: Zahlen, für sich genommen, zählen wenig bis gar nichts – vor allem, wenn die Meinungen bereits gemacht sind, die Bilder in unserem Kopf von «den Migrant*innen» sich längst verfestigt haben. Da hilft das oft zitierte Selbstverständnis der Schweiz als Einwandererland wenig: Die Fremden von heute sind bekanntlich noch gefährlicher, noch schlimmer als die Fremden von gestern.
Es ist kein Zufall, dass im Gespräch zwischen Kewanit Layne und Beat Jans so viel von Stereotypen die Rede ist. Die 20-jährige Layne, vor vierzehn Jahren mit ihrer Familie aus Eritrea in die Schweiz geflüchtet, ist bis heute Vorurteilen ausgesetzt. Oft handelt es sich dabei nicht um offenen Rassismus. Die Vorurteile sind oft subtil – und mögen daher für die meisten unsichtbar sein, jedoch offensichtlich für alle, die sie erfahren. Und so fragt die Migrantin den Bundesrat: Wie können die Bilder von Geflüchteten in den Köpfen der Leute andere werden?
Konkrete politische Lösungen müssen auf den Tisch, die eine möglichst breite gesellschaftliche Akzeptanz erzielen, sagt Jans darauf und auch: Es braucht mehr Geschichten von Menschen wie Layne, die zeigen, dass hinter jeder Fluchterfahrung Menschen stehen – Geschichten, die Nähe erzeugen und Vorurteile aufbrechen.
«Ich versuche, im Bundesrat und in der Gesellschaft die Menschlichkeit zu verteidigen», sagt Jans.
Man mag das als Floskel abtun, und vielleicht gehört es tatsächlich zur Attitüde einer gewissen politischen Couleur, bei jeder Gelegenheit Menschlichkeit als Wert zu preisen. Doch das spielt keine Rolle, am Ende geht es tatsächlich um dieses: Im angeblich «anderen» einen Menschen zu sehen und nichts ausserdem. Um radikale Menschlichkeit also. Wenn auch das Bekenntnis zur radikalen Menschlichkeit nicht die Lösung aller Probleme ist, so ist es doch ein starkes Zeichen gegen eine Kultur der Entgleisungen, Verunglimpfungen und Verfolgungen von Menschen, die angeblich so anders aussehen, denken oder handeln – eine Kultur, die sich immer mehr breitmacht und, schlimmer noch, immer selbstverständlicher wird. KLAUS PETRUS




COIFFEURSALON Ich wollte schon immer mal einen coolen Kurzhaarschnitt, aber ich habe mich nie getraut. «Lange Haare stehen dir so gut», war die einhellige Meinung, und ich kam nicht dagegen an. Erst mit der sprichwörtlichen MidLife-Crisis kam der entscheidende Impuls. Meine Coiffeurin Lorraine sagt, so etwas erlebe sie ständig. Menschen kämen in den Salon und wollen «endlich etwas verändern». Meist wüssten sie jedoch nicht so genau, was das heisst, und noch weniger, wie sie dahin kommen. Ein üblicher Witz unter Coiffeur*innen lautet: «Die Länge soll so bleiben, kein Pony oder
Farbe und auch keine Highlights, aber sonst soll alles anders werden.» Lorraine sagt auch, dass es ein Moment maximaler Verunsicherung ist, mit der sich jemand Neues auf ihren Sessel setzt, und wenn sie da nicht genau die richtige Balance aus Nähe und Distanz, Professionalität und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt, dann wird es nix. Irgendwie hängt eben trotz aller Kritik an Oberflächlichkeit doch eine Menge Identität und Selbstbild an einer Frisur. Und mit jedem Kunden, mit jeder Kundin ist es anders.
Ich hatte den hippen Salon in Kleinbasel bewusst ausgewählt, nicht weil es

dort veganen Cappuccino gibt und zwei grosse Hunde herumstreunen, sondern weil ich die Hoffnung hatte, man würde sich dort am Ehesten etwas von den üblichen Konventionen wegbewegen. Ich wollte ja weg von meinem eingefahrenen Selbstbild. Lorraine und Saloninhaber Jascha entsprachen auch gar nicht meinem Klischeebild von Hairstylist*innen – bequem gekleidet, ungestylt und eher ruhig, verbreiteten sie eine ungewöhnliche Atmosphäre für einen Ort, wo es ums Äussere geht. Fast als käme man zum Café zu Freunden und bekäme nebenbei noch eine neue Frisur.
So nah wie einen Barbier oder eine Coiffeurin lässt man sonst nur Ärzte und Pflegepersonal an sich herankommen, sieht man einmal von Familie, Geliebten und engen Freunden ab. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man dazu neigt, hier sehr persönliche Dinge zu erzählen. Vielleicht überträgt man einfach die erzwungene körperliche Nähe auch auf die Gesprächsinhalte. Oder baut etwaiges Unwohlsein ab, indem man sich auch mental öffnet? So als gälte, wessen Hände meinen Kopf berühren, dem kann ich auch von meinen Sorgen berichten.
Als sie kurz nach den Pandemie-bedingten Schliessungen wieder öffnen durften, erzählt Lorraine, da gab es Menschen, die extralange bei ihnen sitzen blieben. Es bestand Redebedarf. Und zum Coiffeur zu gehen, ist eben auch ein Mittel gegen Einsamkeit. Diese Nähe auszuhalten, die sich eben auch unter anderem durch die geringe physische Distanz beim Schneiden ergibt, sei für die Coiffeur*innen nicht immer einfach, sagt Lorraine. Man findet ja nicht zu jedem einen Draht. «Und manchmal würde ich mich gern auch mal zurückziehen.» Als es dem einen Salonhund Django neulich nicht gut ging,
beispielsweise. Dazu böte der Job dann allerdings nicht den Raum. Oft sei es aber auch schön, viele Leute kämen gern und immer wieder, vielleicht auch, weil sie sich gut aufgehoben fühlten.
Ob es bei den unzähligen Barbieren, die seit dem Comeback des designten Vollbarts überall aufgemacht haben, genauso ist? Da dies reine Männerräume sind, entzieht sich dies meiner Kenntnis, aber ich wüsste zu gern, ob da auch so private Angelegenheiten ausgetauscht werden. Wenn meine Theorie stimmt, müssten sich mit einem Barbiermesser am Hals ja sogar noch intimere Gespräche ergeben –schliesslich möchte man mit jemandem, dem man sich derart ausliefert, ganz unbedingt ein Vertrauensverhältnis haben. Lorraine wirft ein, man könne beim Rasieren nicht reden wegen der Verletzungsgefahr und der abgeschnittenen Haare überall. Ich stelle mir das Schweigen der Männer vor. Trotzdem möchte ich gern wissen, wie es in diesen Barbershops so zugeht. Viele werden ja von Immigranten betrieben, und es wäre doch schön, wenn sich hier wenigstens ganz ungezwungen Männer unterschiedlicher Herkunft und Gesellschaftsschicht begegneten.

So wie neulich bei einem anderen Coiffeur meines Vertrauens in Basel. Da erzählte die Tochter italienischer Einwanderer ihrer älteren Schweizer Kundin beim Legen einer Dauerwelle, wie es in den Ferien «zuhause in Italien» war. Und wie das jetzt so ist für ihre Eltern im Alter. Zurückgehen oder hierbleiben? Sie selbst habe ja nur noch eine Art Ferienbeziehung mit Italien, klar spricht sie die Sprache, aber zuhause sei sie schon hier in der Schweiz, wo sie aufgewachsen und wo ihre Arbeit ist. Was wäre sie denn ohne ihre Kundinnen?, lächelt sie in den Spiegel der Dame zu, durch deren Haare sie gerade prüfend mit den Händen fährt. Und meint es so.
Lorraine hat mir übrigens zu einer Begegnung mit einer neuen Form meiner Selbst verholfen, wenn man so will. Über diese Frisur, die ich ohne sie nicht hätte.
In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein leiser, selbstverständlicher, informeller Austausch stattfindet.




Demenz Wie fühlt es sich an, wenn der eigene Ehemann schleichend ein anderer wird und immer weniger kann? Eine Betroffene berichtet.
TEXT FRAU NUSSBAUMER FOTOS FELIX GROTELOH



Die Bilder wie das Porträt von Herrn Nussbaumer stammen aus dem Projekt ISOMag «Hier und Jetzt» des deutschen Fotografen Felix Groteloh.
Kurz vor seinem 70. Geburtstag, im Februar 2012, nahm ein Schlaganfall meinem Mann von einem Moment auf den anderen die Sprache. Er hatte zwar kaum motorische Einschränkungen, aber mehr als einzelne Wörter und an guten Tagen zwei, drei Sätze kamen ihm nicht mehr über die Lippen. Diagnose: Aphasie. Nach einigen Jahren regelmässiger Therapie fiel seiner Logopädin dann auf, dass er sich immer weniger merken konnte. 2016, vor sieben Jahren, bestätigte die Uniklinik in Freiburg den Verdacht: beginnende Demenz.
Durch seine Sprachlosigkeit hatte sich die Krankheit fast unbemerkt in unser Leben geschlichen. Keine Mehrfachzählungen, keine wiederholten Nachfragen, keine falschen Erinnerungen haben sie verraten. Im Nachhinein betrachtet gab es eine Zeit, in der mein Mann unglücklich
wirkte. Vermutlich war es die Zeit, in der er selbst realisierte, dass etwas nicht stimmte. Für mich veränderte sich zunächst nicht viel: Leichte kognitive Probleme machten sich bemerkbar, er fing an, Dinge zu suchen, hatte manchmal Mühe, sich zu orientieren. Wir konnten noch in den Urlaub fahren, auch wenn es für mich immer anstrengender wurde. Überall musste ich für ihn mitdenken, auf alle Unwägbarkeiten vorbereitet sein. Statt häufig das Hotel zu wechseln, was ihn zunehmend überforderte, stiegen wir auf Flusskreuzfahrten um. So konnten wir viel sehen und blieben trotzdem im gewohnten Zimmer.
Mehrere Brüche
Ich hatte Glück, fand eine Tagesbetreuung, anfangs einmal, später zwei Mal pro Woche. Es brauchte etwas Zeit, aber dann fühlte er sich dort wohl. Und ich hatte die Möglichkeit, Besorgungen zu machen und Arztbesuche wahrzunehmen. Kurz, all das zu erledigen, wozu ich längere Zeit das Haus verlassen musste. 2021 wurden aber auch die kleineren Erledigungen immer schwieriger. Mein Mann machte sich ausser Haus auf die Suche nach mir, wenn ich kurz etwas organisieren musste. Er schloss die Terrassentür, als ich im Garten war, und meine Hilfestellungen empfand er wohl oft als Bevormundung und wurde aggressiv. Da ausserdem sein Bewegungsdrang zu- und seine Kontrolle abnahm, kam es immer öfter zu Stürzen. Innerhalb von neun Monaten brach er sich Oberarm, Oberschenkel, Hals- und Brustwirbel. Mehrwöchige Klinik- und Reha-Aufenthalte standen an. Meist war ich mit dabei, zog zu ihm ins Zimmer, schliesslich konnte er seine Bedürfnisse nicht selbst äussern und brauchte bei so ziemlich allem Hilfe.
Nach dem Brustwirbelbruch empfahlen mir die Ärzte in der Klinik, einen Platz im Pflegeheim zu suchen. Schon frühzeitig hatten wir ihn in zwei Heimen auf einen Warteplatz setzen lassen, doch trotzdem wehrte ich mich gegen diesen Gedanken. Nach 54 Jahren Ehe hatte ich das Gefühl, ihn im Stich zu lassen. Letztendlich waren es unsere Kinder, die mich überzeugten. Sie sahen mich am Ende meiner physischen Grenzen. Ausserdem hatten sie die Hoffnung, dass ich bei meinen Besuchen wesentlich mehr Ruhe und Gelassenheit haben würde als zu Hause im täglichen Pflegealltag.
Nach nun eineinhalb Jahren weiss ich, dass das richtig war. Da wir das Glück hatten, im Gerontologischen Zentrum in unserem Stadtteil einen Platz zu finden, kann ich ihn nun jeden Tag besuchen. Ich komme zum Abendessen, damit er das Essen nicht ganz vergisst. Was früher zehn Minuten gedauert hat, braucht heute über eine Stunde. Manchmal isst er von alleine, manchmal muss er zu jedem

Bissen animiert werden. Die Lieblingsspeise von gestern ist heute dann völlig uninteressant – oder andersherum. Ich spiele mit ihm einfache Gesellschaftsspiele, wobei immer mehr Unterstützung nötig ist. Mikado kann er noch erstaunlich gut, aber das Wichtigste dabei ist ihm inzwischen, die Stäbchen akkurat zu sortieren. Wenn ich ihm spezielle einfache Geschichten und Gedichte vorlese, freut er sich, Reime oder Sprichwörter vervollständigen zu können. Das sind inzwischen fast die einzigen Worte, die ich von ihm höre. Aber manch eine skeptische Handbewegung oder ironisches Stirnrunzeln hat er sich behalten.
Das feine Gespür bleibt
Gerne lässt er sich einmal wöchentlich im Rollstuhl zum Gottesdienst in die Krankenhauskapelle fahren. Ganz offensichtlich geniesst er die intime, ruhige Atmosphäre im kleinen Kreis der Gottesdienstbesucher und singt zumindest die erste Strophe der Lieder häufig mit.
Mein Mann hat ein feines Gespür für Stimmungen. Obwohl er sich nicht verbal äussern kann, merkt er, wenn ich nervös bin oder es mir nicht gut geht, und reagiert darauf. Ich habe gelernt, aus seinen Gesten zu lesen. Ich bin glücklich zu sehen, dass er sich über mein Kommen freut und mich – hoffentlich noch lange – erkennt. Weil ich von der «Alltagsversorgung» entlastet bin und ihn gut aufgehoben sehe, kann ich meist die zweieinhalb bis drei Stunden täglich gelassen bei ihm verbringen. Nicht immer, aber meistens habe ich dann das Gefühl, dass es ihm trotz seiner mentalen Einschränkungen gefühlsmässig gut geht.
Frau Nussbaumer ist eine der Autorinnen im ISOMag «Hier und Jetzt». Das ganze Magazin zum Leben mit Demenz ist in limitierter Auflage zu bestellen unter ISOmag@felixgroteloh.com

Für sein Fotoprojekt ging Felix Groteloh zu demenzerkrankten Personen ins Wohnheim und stellte sich der Frage: Wie Menschen würdevoll abbilden, die morgen nicht mehr wissen, wer du bist?
Wie kamen Sie darauf, ein Magazin über Menschen mit Demenz zu kreieren?
Ich hatte mal wieder Lust auf eine «freie Strecke», ein Projekt ohne Auftraggeber und ohne Vorgaben. Ich wollte etwas machen, was aus meiner Sicht von Bedeutung ist. Da fiel mir ein, dass doch ein Bekannter von mir im Diakonie-Krankenhaus als Pflege-Direktor arbeitet, Matthias Jenny. Er war für mich die Verbindung zum Gerontopsychiatrischen Pflegezentrum Landwasser in Freiburg im Breisgau, in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen und Demenz individuell betreut werden. Dies war eine Initialzündung, Zufall und die Klarheit, dass ich nichts über Themen wie Corona oder Ukraine machen wollte.
Wie war das mit den Menschen im Gerontopsychiatrischen Pflegezentrum Landwasser?
Das Interesse an Menschen treibt mich an. Ich hatte keinen genauen Fahrplan. Ich wusste nur ganz grob, dass ich in das Pflegeheim gehe, mit den Bewohner*innen spreche, ein paar Fotos schiesse und am Schluss irgendwie alles in einem Magazin präsentiere. Vor anderthalb Jahren habe ich im Pflegezentrum Landwasser dann erstmals die Bewohner*innen besucht. Menschen mit Demenz in einem geschlossenen Heim. Als ich das erste Mal da war, noch ohne Kamera, da war ich mir nicht sicher, ob das was werden kann. Ich wollte Porträts haben, reduziert auf die Person, auf Augenhöhe und ohne Photoshop.
Und wo lag da die Schwierigkeit?
Meine erste Protagonistin war Irene Hartung, eine feine ältere Dame, so aussehend wie dem Paris der 1920er-Jahre entsprungen; ein ganz toller Mensch, sehr offen und direkt – leider ist sie letztes Jahr verstorben. «Sie sind ja ein Süsser», meinte sie zu mir: «Sie bekommen jetzt ein Küssle.» Toll, dachte ich und porträtierte sie. Als ich ihr am nächsten Tag das Foto vorbeibrachte und an das gestrige Gespräch anknüpfen wollte, hat sie mich nicht mehr erkannt. Du bist mit den Menschen mit Demenz im Hier und Jetzt. Sie sind im Moment mit dir.
INTERVIEW OLIVER MATTHES

Dasselbe Setting ist für Demenzerkrankte jeden Tag neu.
Glauben Sie, so ein Magazin kann dazu beitragen, Berührungsängste gegenüber Menschen mit Demenz abzubauen? Das weiss ich nicht. Ich möchte damit ein kleines bisschen die Tür öffnen für die weniger schönen Themen im Leben, ohne dabei zu verschlimmern, zu beschönigen oder respektlos zu sein. Ich wünsche mir weniger Hemmschwellen und Vorurteile in der Gesellschaft. Mehr im Hier und Jetzt mit seinem Gegenüber zu sein. Kommunikation kann Brücken zwischen Menschen bauen und solche Hemmschwellen und Vorurteile abbauen. Die anderen wahrnehmen, so wie sie sind. Egal, ob alt, homosexuell, Ausländer*in, obdachlos, Student, Oma, Schwarz, psychisch krank oder was auch immer: Die Anderen sind gar nicht anders oder weit weg von dir. Nein, die sind ganz nah, und das alles sind wir! Wir müssen einfach nur lernen, mehr miteinander zu reden und zusammenzurücken.

Der Freiburger Fotograf FELIX GROTELOH hat nach eigenen Angaben ein Faible für Bilder mit Persönlichkeit, der sich mit freien Projekten wie den Bildern zu Demenz eine Pause von der kommerziellen Auftragsfotografie sucht. felixgroteloh.com
Gekürzt und bearbeitet von Sara Winter Sayilir. Mit freundlicher Genehmigung von FREIeBÜRGER, Freiburg / insp.org
2013 starteten die ersten Sozialen Stadtrundgänge der Schweiz in Basel. Seither haben sich das Projekt und die Mitarbeitenden immer wieder neu erfunden.
Vor elf Jahren haben erstmals drei Betroffene als Experten für Armut und Obdachlosigkeit auf Stadtrundgängen die Besucher*innengruppen über ihr Leben am Rand der Gesellschaft informiert. Mittlerweile ist eine ganze neue Generation von Basler Stadtführer*innen im Einsatz. Bei ihnen stehen auch andere Themen wie Frauenarmut, Schuldenspiralen oder Armut in Folge von Migration im Fokus. Auch wechselten soziale Institutionen ihre Standorte oder passten ihre Hilfsangebote auf neue Gruppen von armutsbetroffenen Personen wie Geflüchtete aus der Ukraine an.
Unsere Stadtführer*innen selbst konnten nicht nur neue Lebensperspektiven entwickeln, sondern auch ihre Kompetenzen erweitern: Neben den Touren sind sie heute gefragte Interviewpartner*innen für die Medien. Für das neue Angebot «Surprise macht Schule» absolvierten sie eine Ausbildung als Workshop-Leiter*innen. Gemeinsam mit der Angebotsleitung werden sie als Expert*innen und Gastdozent*innen zu Veranstaltungen an Hochschulen eingeladen, wo sie in der Ausbildung künftiger Sozialarbeiter*innen mitwirken und sich selbst zeitgleich mit neuen Forschungsergebnissen vertraut machen können.
Auf gesellschaftlicher Ebene ist das Thema «defensive Architektur» in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt. Heiko Schmitz setzte sich in einem Podcast sowie mehreren Interviews und Abschlussarbeiten von Lernenden vertieft mit unterschiedlichen Formen der baulichen Verdrängung von obdachlosen Personen im öffentlichen Raum auseinander. Zusammen mit der Angebotsleitung entwickelt er derzeit hierzu einen Stadtrundgang, der Anfang nächstes Jahr starten wird.
Es bleibt eine Herausforderung, die ständigen und vielschichtigen Veränderungen aufzugreifen. Wir stellen uns dieser Aufgabe jedoch gerne und mit viel Energie, sodass wir die Besucher*innen unserer Sozialen Stadtrundgänge stets aktuell und aus erster Hand über die Lebenswelten von armutsbetroffenen und sozial ausgegrenzten Menschen informieren können.
SYBILLE ROTER, ANGEBOTSLEITERIN






1 – Neue Frauenarmuts-Tour
Danica Graf wird nach Jahren der intensiven Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte ihre bisherige Tour «Von der Opferrolle zur Selbsthilfe» anpassen. Neu informiert sie zusammen mit der Angebotsleitung des Pilotprojekts «Halt Gewalt» über die Strukturen von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Zudem besucht sie mit den Gruppen ihre Arbeitsstelle, die Diakonische Stadtarbeit Elim, und berichtet über den Zusammenhang von Sucht, Gewalterfahrungen und Armut bei vielen ihrer Klient*innen.
2 – Armut und Migration
Nach zwei Jahren Vorbereitung startet im Januar 2024 die erste Tour mit Lucy Oyubo (rechts), einer Pädagogin aus Kenia. Auf ihrer Tour wird sie erzählen, weshalb Migrant*innen in der Schweiz ein überdurchschnittliches Armutsrisiko haben, welche Hürden sie bei der Integration erleben und warum sie sich bei der Migrant*innensession Basel gegen Rassismus engagiert. Ihre Tour startet sie im Restaurant du cœur, einem Angebot der Wärmestube Soup&Chill, in dem ihre Freundin Lucy arbeitet.
3 – Sprachliche Hürden abbauen
Tersito «Tito» Ries übersetzt derzeit seine Tour 3, die sich intensiv mit dem Thema Schulden beschäftigt, ins Englische. So kann er künftig auch Menschen, die kein Deutsch sprechen, über die Gefahren der Schuldenfalle aufklären und aufzeigen, welche Wege es gibt, um daraus wieder herauszufinden.
4 – Intensive Arbeit mit Schüler*innen
Lilian Senn und Heiko Schmitz (1. und 2. v.r. des aktuellen Teams in Basel) schätzen ihre neue Herausforderung als Workshop-Leiter*innen und die vertiefte Auseinandersetzung mit Jugendlichen. In mehrstündigen Workshops sensibilisieren sie Schulklassen für tabuisierte Themen wie Armut und Obdachlosigkeit. In konzentrierter Atmosphäre moderieren die beiden das Gespräch mit den Lernenden und ermutigen sie, auch persönliche Fragen zu stellen.
Weitere Information und Anmeldung zu den Touren: surprise.ngo/stadtrundgaenge
Theater Die aktuelle «Dreigroschenoper»-Inszenierung am Theater Basel macht klar: Auf der Bühne wird kritisch über Gesellschaft nachgedacht. Und was passiert neben der Bühne?
INTERVIEW DIANA FREI

In Antú Romero Nunes’ «Dreigroschenoper»-Inszenierung am Theater Basel stehen die Figuren in Blaumann, Schiebermütze und Brille auf der Bühne – und sehen allesamt aus wie Bertolt Brecht selber. Die Figuren und ihr Autor sind eins. Und sie machen dem Publikum denn auch gleich klar, dass es die Denkarbeit an diesem Abend schon selber machen muss: Ein Bühnenbild gibt es nicht, dafür werden die Ortsbeschreibungen und Regieanweisungen zum Sprechtext gemacht, die altbekannten Songs von Kurt Weill sind hier zum Teil nur angespielt. In einer Szene, die in Peachums Bettleragentur spielt, wird das Strassenmagazin Surprise in den Text eingewoben. Wieso, wollten wir von Jörg Pohl wissen. Er ist Teil der vierköpfi-
gen Leitung Schauspiel und spielt in Nunes’ Inszenierung den Peachum.
Jörg Pohl, Theater findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern innerhalb einer Gesellschaft. Sprechen wir im Moment übers Betteln, kommt uns in Basel auch die rassistisch aufgeheizte Bettler*innendebatte der letzten Jahre in den Sinn. Kann man die Realität tatsächlich aussen vor lassen und sich stattdessen auf ein formales Spiel mit Brechts Verfremdungseffekt konzentrieren, wenn man heute die Dreigroschenoper inszeniert?
Jörg Pohl: Es ist eine wesentliche und auch alte Frage, inwieweit das Theater auf Tagespolitik oder auf Geschehnisse reagieren soll, die mehr oder weniger vor den
«Theater soll zu menschlichen Fragen Stellung nehmen», sagt Jörg Pohl.
Türen des Theaters stattfinden. Ich bin da tatsächlich ebenfalls zwiegespalten. Natürlich soll es. Aber es ist auch unsere Aufgabe als Institution, eine bestimmte Autonomie der Kunst zu verteidigen. Wir müssen uns gegen die Anforderungen, tagesaktuell und konkret auf Geschehnisse zu reagieren, vielleicht auch ein Stück weit verwahren. Denn das, was Theater tun soll, ist: zu menschlichen Fragen Stellung zu nehmen – möglicherweise aber in einem Abstraktionsgrad, der dafür die Mechanismen hinter den Phänomenen, die uns so konkret gegenüberstehen, umso stärker kenntlich macht. Aber vielleicht müssen wir erst mal beschreiben, worum es in der Dreigroschenoper von Brecht überhaupt geht.
Bitte.
Brecht bringt in Berlin 1928 eine Oper heraus, so prächtig, wie sie sich nur Bettler erträumen können, und so billig, dass auch Bettler reingehen können. Das ist natürlich falsch und polemisch formuliert, weil die «Dreigroschenoper» auch damals schon an ein bürgerliches Publikum gerichtet war. Und was zeigt nun Brecht diesem Publikum? Seine eigene Welt. Er setzt die Welt des Bürgertums aber an die Ränder der Gesellschaft. Da treten Prostituierte und Gangster auf. Über Peachums Bettleragentur könnte man sagen, es sei ein kleinbürgerlicher Betrieb. Geführt von einem, der Sprüche, Bettelausrüstung und Bettelverkleidung an arme Leute verleiht. Weil er sagt, man kann ohne solche Tricks die Herzen der Menschen in dieser kalten Welt nicht erreichen.
In diesem Zusammenhang wurde auch Surprise in den Text eingebaut. Wieso? Da ist ein junger Mann, der bei den Peachums sozusagen sein Vorstellungsgespräch hat. Sie schlagen ihm daraufhin vor, den Schwachsinnigen – wenn wir mal diesen in seiner Zeit verhafteten Begriff benutzen – zu spielen. Einen, der immer alles vergisst, auch den Namen seines Hundes. Und dem fällt auch noch ein, dass er ja eigentlich ein Strassenmagazin verkauft, das er aber gar nicht dabei hat. Als eine weitere Möglichkeit, die man als armutsbetroffener Mensch hat, um Geld verdienen könnte. Es geht nicht darum, Strassenmagazin-Verkäufer*innen schlechtzumachen, sondern das kapitalistische System zu zeigen, das die ganze Gesellschaft durchdringt. Das Betteln wird deshalb als eine Art von Kleingewerbe mit sämtlichen zugehörigen Verkaufstricks gezeigt. Und die Armut als etwas, das man mit allen Möglichkeiten angeht, die einem im bestehenden System zur Verfügung stehen.
Theater ist offensichtlich ein Ort, der Gesellschaft verhandelt. Daher haben auch Themen wie Diversität und Inklusion, kulturelle und soziale Teilhabe im Theater oft einen hohen Stellenwert –allerdings eher in der freien Szene und an kleinen Häusern. Und nicht so sehr an Stadttheatern. Wieso?
Die freie Szene ist agiler und reagiert auf gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Tendenzen schneller. Stadttheater dagegen sind Orte, die sehr schwerfällig auf die gesellschaftlichen Veränderungen rundhe-
rum reagieren und die traditionell sehr autoritär verfasst sind, bisweilen despotisch geführt. Das hat mit ihrer Geschichte und mit den strukturellen Gegebenheiten in den Theatern zu tun. Und mit einem bestimmten Geniebegriff. Seit ein paar Jahren und Jahrzehnten ändert sich das.
Inwiefern?
Ensembles werden zunehmend diverser. Das folgt aber erst nachholend zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, die in anderen Bereichen längst Realität ist. Auch die Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist, mit flachen Hierarchien und Mitbestimmung. Stadttheater sind traditionell störrische Buden. Dazu Männer, die in von Männern geschriebenen Stücken männliche Probleme verhandeln, und das ist dann Weltliteratur. Das Theater hat da noch viel zu tun. Wir sind hier auch angetreten, um dieses Problem strukturell anzugehen. Als Viererleitung und eine Compagnie von Schauspieler*innen, die in einem Modell der Mitbestimmung arbeiten.
Auf der Website des Theater Basel steht, Sie engagieren sich «in Debatten um die Abschaffung der autoritären und veralteten Führungsstruktur im Theater». Gleichzeitig las man unlängst vom neuen Ballettdirektor, der eine missliebige
Journalistin mit Hundekot beschmierte, und vom Arbeitskampf des technischhandwerklichen Personals. Wie passt das zusammen?
Das hier ist ein Dreispartenhaus mit Oper, Ballett und Schauspiel. Wir haben in der Sparte Schauspiel ein System etabliert, das innerhalb des deutschsprachigen Stadttheaters einzigartig ist, und Arbeitsverhältnisse geschaffen, für die wir von allen möglichen Leuten, die in dem Bereich arbeiten, grosses Interesse erfahren. Was die anderen Punkte angeht, die Sie ansprechen, muss ich sagen, dass sich die hiesigen Medien auch auf manches eingeschossen heben, das Schlagzeilen generierte. Es werden aber in diesem Haus auch jenseits unserer eigenen Sparte Schauspiel Prozesse angestrengt, um die Betriebsstrukturen partizipativer zu gestalten und Hierarchien abzubauen. Sowas passiert nicht von jetzt auf gleich und löst auch nicht bestimmte innerbetriebliche Antagonismen, die überall entstehen, wo Lohnarbeit verrichtet wird.
Sie sprechen da auch vom laufenden Arbeitskampf?
Ja, und ich kann verstehen, wenn Leute die Verhältnisse verbessern wollen. Ich weiss aber auch, dass das Theater – und das ist etwas, das in dieser Debatte ein bisschen untergeht – kein profitorientierter Betrieb ist, in dem Mitarbeitende gezielt ausgebeutet werden, um Gewinne zu erwirtschaften. Wir sind von begrenzten Mitteln aus öffentlichen Subventionen abhängig. Wenn die nicht erhöht werden, gehen interne Verteilungskämpfe los, die meist auf Kosten der Kunst gehen.
«Stadtheater
FOTO: ZVG

JÖRG POHL, geboren 1979 im Ruhrgebiet, hatte nach seinem Studium an der Schauspielschule Bochum Engagements an renommierten Bühnen wie dem Schauspielhaus Zürich und dem Thalia Theater in Hamburg. Er setzt sich in der Theaterwelt für nicht-autoritäre Strukturen ein.
Sie würden sagen, Sie kommen gut voran im Bestreben, Gesellschaft nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Realität neu zu denken?
Ja, aber wir haben noch einiges zu tun hier. Wir haben noch einiges auszuprobieren und auch zu verhandeln mit der Stadtgesellschaft hier, deren Vertreterin Sie ja auch sind. Deswegen finde ich es wichtig, dass man in den Austausch über die Kunst geht.
«Die Dreigroschenoper», Regie: Antú Romero Nunes, bis So, 22. Juni 2025, Theater Basel. Blog der Basler Compagnie: theater-basel.ch/de/bcblog theater-basel.ch



Kino Nach jahrelangem Alkoholexzess kehrt eine junge Frau von London in ihre Heimat im Norden Schottlands zurück, wo sie sich der Sucht und ihren Schuldgefühlen stellt.
TEXT MONIKA BETTSCHEN
«Was habe ich gestern getan?», fragt Rona verängstigt, als sie mit Verbänden an den Händen aufwacht. Die Frage der jungen Frau Ende zwanzig ist an ihren Freund Daynin gerichtet, der zusammengesunken auf der Bettkante sitzt, ebenfalls mit einem Verband um eine Hand. «Weisst du nicht mehr?», antwortet er leise und blickt traurig ins Leere. Nein, Rona weiss nichts mehr. Nicht, wie sie auf der Feier von Daynins Beförderung einmal mehr zu viel getrunken hat. Nicht, wie sie ausfällig wurde, und auch nicht, dass sie und Daynin sich während der heftigen Auseinandersetzung an Glasscherben verletzten. Wenig später wird er Rona verlassen, weil er ihr selbstzerstörerisches Trinken nicht mehr länger aushält.
«The Outrun», bildgewaltig in London und auf den Orkneyinseln ganz im Norden Schottlands inszeniert, ist eine Literaturadaption. Die Regisseurin Nora Fingscheidt schrieb das Drehbuch zusammen mit der Buchautorin Amy Liptrot, die in der gleichnamigen Autobiografie ihren Kampf gegen die Alkoholsucht nachzeichnete. Die deutsche Filmemacherin Fingscheidt rückte bereits im Drama «Systemsprenger» und im Netflix-Thriller «The Unforgivable» Figuren in den Fokus, die Fragen nach grossen Themen wie Schuld und Verantwortung stellen. Es sind Filme, die das Verhältnis von sozialer Prägung, freier Entscheidung und gesellschaftlichen Leitplanken verhandeln. Für «The Outrun» gelang es Fingscheidt, die mehrfach Oscar-nominierte Saoirse Ronan für die Rolle der Rona zu gewinnen. Ihre Darstellung eines Menschen, der seinen Schmerz im Alkohol ertränkt und dabei
zugleich verletzlich und verletzend ist, wird getragen von einer beeindruckenden Bandbreite an Emotionen. Ganz besonders in den leiseren Szenen. Etwa, wenn Rona nach einem Entzug in London in ihre Heimat, auf die Orkneys, zurückkehrt und dort ihren Vater besucht, der an einer bipolaren Störung leidet. In einer Szene trifft sie ihn, der als Landwirt in einem Wohnwagen bei seiner Schafherde lebt, mitten am Tag schlafend an. Auf dem Tisch steht ein Glas Rotwein. Rona ringt mit sich selbst, riecht daran und taucht wie unter Zwang einen Finger hinein.
«Regelmässiger Alkoholkonsum sorgt für tiefgreifende Veränderungen unserer Nervenbahnen, die nicht mehr umkehrbar sind», hört man Rona, die einen Master in Biologie hat, an einer anderen Stelle des Films im Voiceover sagen, während sie, noch in der gemeinsamen Wohnung mit Daynin, heimlich im Badezimmer trinkt. Es ist dieser Ton der nüchternen wissenschaftlichen Information, die verdeutlicht, warum es für Betroffene so schwierig ist, die Finger von der Flasche zu lassen. Rona befindet sich am Rande eines Absturzes. Ihre Arbeit in einem Labor hat sie wegen der Sucht bereits verloren. In der Szene im Wohnwagen wird Rona schlagartig bewusst, wie schnell sie wieder in destruktive Muster zurückfallen könnte. Sie rennt nach draussen, ruft ihren Ex-Freund an und spricht ihm weinend aufs Band, dass sie verstehen könne, warum er sie verlassen habe.
«Es ist eine wahre Geschichte darüber, wie leicht man sein Leben in Stücke reissen kann, aber auch darüber, dass Heilung möglich ist», schreibt Nora Fingscheidt im Pressedossier. «Es ist



Ein Film nicht nur über Sucht, sondern auch über den langen und schmerzhaften Weg der Genesung.
nicht nur ein Film über Sucht, sondern auch über den schwierigen Prozess der Genesung, der eine ganz eigene Reise ist, Tag für Tag.» Auf ihrer Genesungsreise erlangt Rona, umgeben von der kargen Schönheit der Orkneys, allmählich ein inneres Gleichgewicht. Und es zieht sie noch weiter fort in die Abgeschiedenheit, auf die kleine Insel Papay. In der kalten Jahreszeit krachen dort gewaltige Wellen gegen die Küste. Hier erinnert sich Rona, wie ihr Vater während eines Wintersturms euphorisch die Fenster aufriss, überzeugt davon, eins mit dem Wind zu sein. Draussen tobte das Unwetter, in seinem Kopf eine manische Episode.
Auch Tochter Rona spürt eine Verbundenheit mit den Elementen: Als würde nicht nur der Alkohol nach ihr rufen, sondern auch die Natur. Die Biologin beobachtet sie auf ausgedehnten Spaziergängen am Strand die Tier- und Pflanzenwelt – und findet langsam wieder eine Verbindung zwischen sich und der Welt. An der Küste zieht sie sich die Kopfhörer ab, ein Relikt aus ihrer exzessiven Zeit in London, als sie die innere Verzweiflung auch mit monotonem Elektrosound zu betäuben versuchte. Nun ist hier das Rauschen des Meeres. Und es genügt.
Die von Wind und Wellen geformte Landschaft der Orkneys spielt im Film quasi die zweite Hauptrolle. Wodurch sich die Dreharbeiten anspruchsvoll gestalteten. «Wir mussten dreimal hinfahren, weil die Natur eine so grosse Rolle in der Geschichte spielt und wir die Geburt der Lämmer und das Nisten der Vögel einfangen wollten. All das passiert zu verschiedenen Zeiten im Jahr», erzählt Nora Fingscheidt im Dossier zum Film. Der Rhythmus der Jahreszeiten wird zur Parallele von Ronas Heilungsprozess. Ganz am Schluss folgt eine Wendung, die der Protagonistin einen besonderen Moment der Lebensfreude schenkt. Und damit auch dem Publikum.
«The Outrun», Regie: Nora Fingscheidt, mit Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Stephen Dillane u. a., Spielfilm, UK/D 2024, 118 Min. Läuft zurzeit im Kino.
Buch Das Bilderbuch «Tauchsommer» erzählt die Geschichte einer Depression auf behutsame Weise und mit fliessenden Farben.
Eltern geben Kindern Halt, Geborgenheit, sind da, wenn sie gebraucht werden. Eltern sind der sichere Hafen, von dem aus Kinder in die Welt aufbrechen. Doch es gibt viele Gründe und Abgründe, die diesen Idealfall sabotieren. Etwa, wenn ein Elternteil krank wird. So wie der Vater in der Geschichte der schwedischen Autorin Sara Stridsberg, der eines Tages plötzlich weg ist, «als hätte ihn jemand aus der Wirklichkeit herausgeschnitten».
Das kleine Mädchen in dieser Geschichte erfährt erst nach langer Zeit, wohin der Vater gegangen ist. In ein Haus mit abgeschlossenen Türen, wo man auf ihn aufpasst, «damit er nicht wegfliegt». Denn der Vater ist «so traurig, dass er nicht länger leben will». Für das Kind ist das unbegreiflich: «Wie kann man nicht länger leben wollen, wenn es doch mich gibt?» Aber darauf hat niemand eine Antwort. Doch das Kind lässt nicht locker. Auch als der Vater ihre Mutter und sie nicht mehr sehen will, nicht mehr sehen kann, fährt das Mädchen immer wieder ins Krankenhaus. Dort lernt sie Sabina kennen, eine erwachsene Patientin, die einen Badeanzug unter dem Mantel trägt. Sabina hat an der Schwimm-WM teilgenommen und will eines Tages durch den Pazifik schwimmen. Und obwohl weit und breit kein Wasser ist, schwimmen die beiden von nun an jeden Tag und warten gemeinsam. Das Mädchen auf ihren Vater, und manchmal auch auf Sabina, wenn diese in eine andere Welt abtaucht. Und als der Sommer vorbei ist, und als das Warten auf den Vater ein halbwegs gutes Ende nimmt, haben die beiden schon mehrmals die Welt umrundet. Es ist ein schwieriges, ein trauriges Thema, dem sich dieses Buch widmet. Die Depression des Vaters ist dabei nur ein Fallbeispiel, stellvertretend für diverse psychische Probleme, von denen Elternteile betroffen sein können. Und für die Verunsicherungen, mit denen Kinder leben müssen und die sie ihr Leben lang belasten.
Die Autorin Sara Stridsberg erzählt von all diesem Schweren auf eine schlichte, ehrliche, aber auch behutsame Weise. Und sie erfindet mit der Gestalt der Sabina eine märchenhafte Begleiterin, die die Last des Wartens und Bangens in eine schwebende Fantasie verwandelt. Dazu tragen auch die wunderbaren Bilder der Illustratorin Sara Lundberg bei, in deren fliessenden Farben man tief in die Geschichte eintauchen kann. Und dieser Möglichkeit ist keine Altersgrenze gesetzt.

CHRISTOPHER ZIMMER
Sara Stridsberg, Sara Lundberg: Tauchsommer. Karl Rauch Verlag 2024.
CHF 28.90
Basel
«Gerhard Glück. Das einfache Leben», Ausstellung, bis So, 9. März 2025, Di bis So, 11 bis 17 Uhr, Cartoonmuseum Basel, St. Alban-Vorstadt 28. cartoonmuseum.ch

Unterwegs in Gerhard Glücks Universum – in diesen lieblichen Grotesken –tun sich dem Publikum überall Falltüren in skurrile, manchmal absurde Situationen auf. Bevölkert werden Glücks Bilder von einem ureigenen, übersteigert durchschnittlichen Menschentyp in der zweiten Lebenshälfte, wohlbeleibt, unmodisch, die Damen im knielangen Rock, die Herren mit Brille und Krawatte. In die wohlgeordnete Welt dieser Figuren aus den 1950er-Jahren brechen feiste Putten, überlebensgrosse Schweine, St. Nikolaus und der Sensenmann ein. Aus diesen Brüchen nährt sich Glücks Humor – und die Sparte seiner Werke hat sogar einen Namen: Komische Kunst. Es geht dabei um unser Verhältnis zur Natur, um grosse und kleine Konflikte, den Kunstbetrieb oder Zwischenmenschliches. Der deutsche Cartoonist wurde dieses Jahr 80 Jahre alt, und in Basel ist nun quasi der ganze Glück der letzten Jahrzehnte zu sehen. Es kommt einiges zusammen – da sind etwa Illustrationen für das «Süddeutsche Zeitung Magazin», für das «NZZ Folio» oder das Satiremagazin «Eulenspiegel». Glück illustrierte auch Bücher von Heinz Erhardt und Joachim Ringelnatz. DIF
Schweiz «Aller Tage Abend», Kabarett, Fr/Sa, 22./23. Nov., Bern, La Cappella, 20 Uhr; Sa, 30. Nov., Konolfingen, Schloss Hünigen, 18.30 Uhr (mit Essen); Do, 19. Dez., Burgdorf, Casino Theater, 20 Uhr; Sa, 21. Dez., Lichtensteig, Chössi Theater, 20.15 Uhr schoenundgut.ch

Wir meinen, wir hätten auch schon mal auf dieses Stück hingewiesen –das kann durchaus sein: Über 180 Vorstellungen haben schön&gut in dreieinhalb Jahren auf Tournee
Bern
«Dance!», Ausstellung, bis So, 20. Juli 2025, Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Museum für Kommunikation, Helvetiastrasse 16. mfk.ch Und plötzlich wippt man mit, ohne dass man es richtig merkt. Musik bringt einen erstaunlich schnell in Bewegung, sei es im Club, auf der Bühne, auf Tik-Tok oder beim Kochen (okay, manche Menschen schneller und intensiver als andere, und das gilt für alle genannten Bereiche). Auch wer zuweilen Kinder beim Musikhören beobachtet, wird feststellen: Es steckt offensichtlich eine besondere Kraft in Rhythmen und Melodien. Gestützt wird diese Vermutung implizit durch Tanzverbote, die mancherorts auf dieser Welt grundsätzlich gelten oder gezielt verhängt werden. Die Ausstellung ergründet, warum wir tanzen, wie Tanz und Jugendkulturen miteinander verknüpft sind und weshalb Tanzen glücklich macht. Machen Sie sich also locker, das Museum für Kommunikation setzt immer darauf, dass man sich auch selber ausprobieren darf. DIF

unterdessen gespielt. Und jetzt ist dann halt mal Schluss, aller Tage Abend halt. Weil wir das Duo Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter (der Surprise bei der Erarbeitung der Verkäufer*innen-Kolumnen unterstützt, siehe Seite 6 in diesem Heft) cool und gut finden und den Regisseur des Ganzen, Roland Suter, auch, weisen wir nun noch auf die allerletzten Vorstellungen hin. Es geht um den Gemeindepräsidenten Kellenberger, der am Rotieren ist – ganz im Gegensatz zu den Windrädern, die zwar geplant sind auf der Schönmatt, aber nicht zum Laufen kommen. Denn da ist die ominöse Aktivistin, die ihm den Wind aus den Rädern nehmen will. Aber auch anderes sorgt für Irritationen. Dass der Metzgerssohn Georg Schön seit Neustem auf Tofu abfährt etwa. Wir sehen: Hier zerbrechen Weltbilder. Und sie tun es mit Wortwitz, Gesang, Geist und Fantasie. DIF
über unser Strassenmagazin und dessen Verkauf, sondern ebenso viel über die Schweizer Bevölkerung erfahren. Denn wer kommt täglich intensiver mit ihr in Kontakt als die Surprise-Verkäufer*innen. Jetzt muss man nur noch fein beobachten, alles niederschreiben und in Geschichten verpacken. Habegger hat’s getan – und tritt übrigens mit Gitarre auf. Manche Texte sind schon vertont. Die aktuellen Lesetermine sind beim Verlag auch online unter «Autoren» zu finden. DIF
Zürich
«Maschinenpoesie», Ausstellung, bis So, 12. Jan., Di bis Fr, 12 bis 18 Uhr, Do bis 22 Uhr, Sa/So 11 bis 17 Uhr, Strauhof, Augustinergasse 9. strauhof.ch
Schweiz
«Urs Habegger: Am Rande mittendrin», Lesungen, Do, 12. Dez., 17.30 Uhr, Aula Schulhaus Bach, Schaffhausen; Fr, 17. Jan., 18.30 Uhr, Lokal B102, Luzern; Mi, 22. Jan., 19.30 Uhr, Bibliothek Stäfa. elfundzehnverlag.lesestoff.ch Was mal in Rapperswil SG begonnen hat, genauer in der dortigen Bahnhofunterführung, ein paar Schritte vom Kiosk entfernt, zieht immer weitere Kreise. Urs Habeggers Lesetour weitet sich zunehmend aus. Habegger – Autor des Buchs «Am Rande mittendrin», das von seinen eigenen Begegnungen beim Surprise-Verkauf handelt –ist nicht mehr nur so rund um den Zürichsee herum, sondern bereits schweizweit unterwegs. Schaffhausen und Luzern rufen! Gehen Sie hin, Sie werden nicht nur viel
Der Strauhof fragt: «Ist KI die Zukunft der Literatur?» Und ChatGPT antwortet: «Während KI neue Möglichkeiten eröffnet, bleibt die menschliche Kreativität weiterhin entscheidend für originelle und tiefgründige Erzählungen.» Da hat sie wahrscheinlich recht, die KI, und sowas Ähnliches hätten wir Menschen wohl auch gesagt. Logisch, woher hat GPT sie auch, die schlaue Antwort, und schon hier fängt sich das Gedankenkarussell zu drehen an. Wer kupfert bei wem ab, wer denkt wen weiter, wie funktioniert das Zusammenspiel von Mensch, Maschine und Text? Das Thema Künstliche Intelligenz ist so weitläufig, dass der Fokus auf die Literatur einen speziellen Reiz hat, auch zusammen mit der Rückschau auf literarische Experimente: Denn bereits die Schreibmaschine wurde zweckentfremdet, um Bilder und visuelle Texte zu generieren: Die Ausstellung präsentiert ausgewählte Typogramme des Schriftstellers Reto Hänny (CH, *1947) und der Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt (DDR, 1932–2024), die beide in den 1970er-Jahren entgegen den Grenzen der Maschine verspielte Bildtexte kreierten. Wir sehen auch erste Versuche mit computergenerierten Gedichten, mit Hypertext-Prosa, Code Poetry und dem aktuellen Schreiben mithilfe künstlicher Intelligenz. Oder die neue Kulturtechnik des «Promptens» – das Schreiben von für Computer verständlichen Anweisungen. Und erkennen das Problem, dass Computer nicht immer das ausspucken, was man von ihnen haben wollte. DIF

Tour de Suisse
Surprise-Standorte: Gemeinde
Einwohner*innen: 11 763
Sozialhilfequote in Prozent: 2,9
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 4,3
Anzahl Kindergartenschüler*innen: 79
Ausserhalb der Region ist Belp vor allem für den Flughafen Bern-Belp bekannt, und so ziert denn auch ein Flugzeug das Stationsschild am Bahnhof, der Flughafenbus steht bereit und selbst ein Wanderweg führt dorthin. Was aber vollkommen fehlt, ist das Dröhnen der Flugzeuge, es ist auffällig ruhig hier, ganz anders als in anderen Flughafengemeinden. Das lauteste Geräusch, das zu hören ist, stammt nicht von einem Flugzeug, sondern von einem Rasenmäher, der vor einer Blocksiedlung im Einsatz ist. Sehr viel leiser erledigt der entsprechende Roboter die Arbeit auf dem kleinen Rasen vor einem Velogeschäft.
Reisen ist allgemein ein Thema hier, gleich im Bahnhof befindet sich das Reisezentrum der BLS, der Ständer davor wirbt für die Destinationen Malediven, Seychellen oder Sansibar. Auf der anderen
Seite der Geleise befindet sich ein Reisebüro, das Flüge direkt ab Belp anbietet, etwa nach Mallorca. Unter Inselfieber braucht hier also niemand unnötig zu leiden.
Umgekehrt gibt es Hotels für Fremde, die hierhergereist sind. Schöne alte Häuser mit den typischen weiten Vordächern und teils üppigen Gärten säumen die Strassen, daneben gibt es Neubauten mit gepflegten Aussenanlagen. Gegenüber einem grünen Hochhaus steht ein alter verwitterter Holzbau, in dem ein Blumenladen untergebracht ist, ein Schild führt in den Hinterhof, in dem sich Gesundheitspraxen befinden. Die Strassen heissen «Eichenweg» und «Kastanienweg», an letzterem wachsen tatsächlich Kastanienbäume, die noch relativ jung sind. Im Hof der Siedlung gleichen Namens stehen
Mofas im Velounterstand. Die sind hier keine Seltenheit, auch auf der Strasse verkehren sie, und eines ziert sogar das Schaufenster eines italienischen Restaurants. Gleich daneben befindet sich die Entsorgungsstation, an der, wie einem Anschlag zu entnehmen ist, immer wieder sonstige Abfälle deponiert werden, was laut Abfallreglement mit einer Busse bis zu 5000 Franken bestraft werden kann.
An der Litfasssäule hängen neben Plakaten für kulturelle Veranstaltungen, die Theaterstücke nach Gotthelf bis zu «Pippi Langstrumpf», das «Belp Music Festival» und diverse andere Events bewerben, immer wieder Bibelsprüche. In einer kleinen Glaspyramide vor der Kirche am Bahnhof wird das Erntedankfest angekündigt, während die hauseigene Gelateria die Saison beendet hat. Ennet der Geleise gibt es ein Kino sowie den Redaktionssitz einer Lokalzeitung, beides Institutionen, die im Gegenwind stehen.
Mitten in der Stadt liegt das Schloss, das aber nicht überdimensioniert oder protzig ist. Es beherbergt das Ortsmuseum und die Musikschule. Durch das Fenster zu sehen sind etwa Schlagzeuge, es dringt aber kein Ton nach draussen, wo ein runder, mit Bänken umgebener Brunnen steht, der ziemlich düster wirkt, ganz im Gegensatz zum Schlossgarten. Durch ein Tor, an zwei Tennisplätzen vorbei, gelangt man auf das Gelände der Schulanlage, auf der es unter anderem Pingpong-Tische gibt, von denen einer tatsächlich bespielt wird.
Das Bestattungsunternehmen befindet sich im Obergeschoss einer Schreinerei, aber dass dort auch Särge hergestellt werden, bleibt eine blosse Vermutung.

STEPHAN PÖRTNER
Der Zürcher Schriftsteller Stephan Pörtner besucht Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.
Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Hofstetter Holding AG, Bern
movaplan GmbH
hypnose-punkt.ch
Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
Restaurant Rössli Beiz Stäfa
FairSilk Social Enterprise, www.fairsilk.ch
Madlen Blösch, Geld & so, Basel
Maya Recordings, Oberstammheim
Atem-Fachschule Lika, Stilli bei Brugg
Natura GmbH, Neuheim
Scherrer + Partner GmbH
Lebensraum Interlaken, Interlaken hervorragend.ch | Grusskartenshop
Kaiser Software GmbH, Bern
Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Kiosk Badi Buus - Nicole Altorfer-Dehning
Gemeinnützige Frauen Aarau
TopPharm Apotheke Paradeplatz Zürich
Automation Partner AG, Rheinau
Anyweb AG, Zürich
Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich
Gemeinnütziger Frauenverein Nidau
Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti
Beat Hübscher - Schreiner, Zürich
KMS AG, Kriens
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei. Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.
Das Programm
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?
Eine von vielen Geschichten
Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Merima Menur kam 2016 zu Surprise –durch ihren Mann Negussie Weldai, der bereits in der Regionalstelle Bern arbeitete. Zuvor lebten sie fünf Jahre getrennt –er in der Schweiz, sie in Äthiopien. Einige Zeit nach ihrer Ankunft in der Schweiz begann Merima auch mit dem Verkauf des Surprise Strassenmagazins und besuchte einen Deutsch-Kurs, mit dem Ziel selbständiger zu werden und eine Anstellung zu finden. Dank Surplus besitzt Merima ein Libero-Abo für die Stadt Bern und kann somit leichter an ihren Verkaufsort reisen. Surplus gibt der 41-Jährigen ausserdem die Möglichkeit, sich einige bezahlte Ferientage zu gönnen. Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus
Unterstützen Sie das SurPlus-Programm mit einer nachhaltigen Spende
Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.
Spendenkonto:
Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
· ½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
· 1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!
#584: Gefährliche Zuspitzung «Richtige Idee»
Was für ein interessanter, starker Artikel! Danke. Bei folgendem Satz wurde mir sehr wohl ums Herz: «Und Flucht, als Folge von Ausgrenzung, Hass, Krieg, Terror und blanker Zerstörung, ist immer und überall ein Appell an unsere Empathie und Solidarität (und meine persönliche Meinung, an unsere Bereitschaft, solch abstrakte, blutleere Entitäten wie Nationen und Grenzen radikal zu hinterfragen oder gar abzuschaffen).» Auf diesem (kleinen) Planeten, im Vergleich zur Grösse des Universums, wäre Ihre Idee die Richtige. Aber sie bleibt womöglich eine Utopie.
ANIQUE SIDOROWICZ, ohne Ort
«Klug argumentiert»
Als ich die ersten Sätze des Artikels «Gefährliche Zuspitzung» von Klaus Petrus las, dachte ich: Jetzt bringt auch noch das Surprise einen Beitrag, der das Schicksal der Flüchtlinge verharmlost. Aber dann: so ein kluger, gut argumentierter, spannender Text, der so vieles Neues enthält und zum Nachdenken anregt! Das Beste, was ich seit langem über Migration gelesen habe, danke dafür.
ELIO AMATO, Bern
Impressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Klaus Petrus (kp)
Diana Frei (dif), Lea Stuber (lea), Sara Winter Sayilir (win) T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Pirmin Beeler, Felix Groteloh, Andreas Hauch, Michael Hofer, Kewanit Layne, Oliver Matthes, Eva Nimke, Frau Nussbaumer, Karin Peschka, Sybille Roter
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage 32 100
Abonnemente CHF 250.–, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt. IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
#585: Die Welt lesen lernen «Einblicke in eine verborgene Welt»
Bin von Diana Freis Artikel im letzten Surprise sehr beeindruckt und begeistert. Wie sie Fabian Schläfli zum Dialog gebracht hat. Dadurch hat man etwas über die Innenwelt und Umweltwahrnehmung eines Menschen mit einer Behinderung erfahren, dem Lesen und Schreiben verwehrt sind. Überraschend pragmatisch und zugleich einfallsreich agierend, hat er sich Handlungsstrategien erarbeitet, mit denen er seine Lücken kompensiert. Berührend auch seine Gedankenund Gefühlswelt zu menschlichen Beziehungen. Diana Freis sensibler sokratischer Gesprächsführungskunst ist es zu verdanken, dass wir Leser*innen Einblicke in eine für uns verborgene Welt bekommen haben.
GABRIELA WAWRINKA, Zürich
Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.
25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)
Gönner-Abo für CHF 320.–
Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)
Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–
Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.
Bestellen
Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90
Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel
Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo
Internationales Verkäufer*innen-Porträt
Mihai Usurelu ist ein freundlicher, stets lächelnder Mann, nur selten wird seine Miene ernst. Oft lacht er ein leises Lachen. Er erzählt gerne von seiner Kindheit in Rumänien, wo seine Familie auf dem Land lebte und Schweine hielt, die im Winter geschlachtet, eingebraten und in Schmalz konserviert wurden. Im Sommer sei das ein schnelles Essen gewesen nach der Feldarbeit. Usurelu ist bereits als junger Mann vom Land in die Hauptstadt Bukarest gezogen, um Geld zu verdienen. Mariana, seine Frau, kümmerte sich zuhause sich um die drei Söhne und die Tochter – auch, und dafür sei er ihr dankbar, um deren Erziehung, in die er sich nie eingemischt habe, sagt Usurelu.
Seit 2015 lebt er nun in Salzburg, seine Frau ist mit ihm gekommen, ebenso zwei seiner inzwischen erwachsenen Kinder. Erst dachten sie an Wien, aber dann seien sie mit dem Zug weitergefahren bis Salzburg, wo sie eine Wohnung fanden. Die in Rumänien gebliebenen Söhne haben keine feste Stelle, sie arbeiten als Tagelöhner, wo immer sie Arbeit finden, auf einer Baustelle, in einer Fabrik oder bei einem Bauern. Usurelus Mutter lebt immer noch im Dorf etwa 130 Kilometer nordwestlich von Bukarest, der Vater ist bereits vor zwanzig Jahren gestorben.
Aus der Armut herauszukommen ist immer schwierig, in manchen Ländern aber schwerer als anderswo. Wir sprechen über Korruption, über Chancen, über die Abwanderung jener, die ein Studium absolviert haben. Die medizinische Versorgung, sagt Usurelu, sei in Rumänien nicht gut, vor allem für jene, die ohnehin wenig haben und schon gar keine Beziehungen. Wer ins Krankenhaus müsse, der sei darauf angewiesen, dass die Verwandtschaft ihm eigene Bettwäsche sowie Essen mitbringe, sagt Usurelu. Auch er hatte jüngst Probleme mit seiner Gesundheit und ist froh, dass er in Österreich behandelt werden konnte. Natürlich sehnen sich Usurelu und seine Familie nach ihrer alten Heimat. Allerdings sei es weniger das Land Rumänien, sondern mehr einzelne Menschen – Freunde, Bekannte und natürlich die Enkelkinder. Ein- oder zweimal im Jahr sind sie auf Besuch bei ihnen, was sie sehr freut. Sie legen die eineinhalbtausend Kilometer lange Strecke jeweils mit dem Auto zurück, im Schnitt dauert die Fahrt zwölf bis dreizehn Stunden. Gerade an den rumänisch-orthodoxen Feiertagen könne es aber sein, dass man die Feiertage im Stau verbringe, wenn man nicht frühzeitig losfahre, sagt Usurelu. In dieser Zeit kämen Rumän*innen aus ganz Europa nach Hause, speziell aber aus Italien und Spanien.
Usurelu fühlt sich in Österreich im Grossen und Ganzen wohl. «Die Menschen sind sehr freundlich», sagt er. Es gebe auch welche, die ihn schlecht behandeln und

Mihai Usurelu lebt seit einigen Jahren in Salzburg und verkauft dort die Strassenzeitung Apropos. Seine Enkelkinder leben daheim in Rumänien, er sieht sie höchstens zweimal im Jahr.
ihm sagen, er solle sich anständige Arbeit suchen oder dorthin zurückgehen, wo er herkomme. Aber das seien Einzelfälle, sagt er, und er lasse sich davon nicht irritieren. Manchmal hält er diesen Sprüchen auch etwas entgegen. Dann sagt er sich: «Wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück.»
Wenn Usurelu von seiner Kindheit berichtet, wird er manchmal auch wehmütig. Zum Beispiel habe man damals einander kaum Geschichten oder Märchen erzählt, dafür habe schlicht die Zeit gefehlt, sagt er. «Und abends nach der Arbeit war man einfach zu müde.» Weshalb er selber bis heute keine Märchen kennt, die er seinen Enkelkindern in Rumänien erzählen könnte. Ob deren Eltern – also seine eigenen Kinder –das können, hofft Usurelu zwar, er hat aber seine Zweifel daran.
Was er sich für die Zukunft seiner Enkelkinder erhofft? Usurelu zögert. Dann sagt er einen Satz, der einem zu Herzen geht: «Man verlernt, sich etwas zu wünschen, wenn man weiss, dass sich der Wunsch ohnehin nicht erfüllt.»
Aufgezeichnet von KARIN PESCHKA
Mit freundlicher Genehmigung von APROPOS, SALZBURG








Zwei bezahlen, eine spendieren Achte aufdieses
Café Surprise ist ein anonym spendierter Kaffee, damit sich auch Menschen mit kleinem Budget eine Auszeit im Alltag leisten können. Die spendierten Kaffees sind auf einer Kreidetafel ersichtlich.


Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.
Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Zürich, Basel oder Bern. Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang