16 Seiten extra


16 Seiten extra

Weltweit gibt es Strassenmagazine. Weltweit setzen wir uns gegen Armut ein. Seit 30 Jahren.

15. Mai bis 15. Juni 2024
Aktionstage Behindertenrechte
Weitere Informationen: surprise.ngo/cafesurprise
Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns die Neueröffnung!
Aus dem über 125 Jahre bekannten Blindenheim ist ein neues Zentrum entstanden, das sich an Menschen mit unterschiedlichsten Begleit-, Pflege- und Betreuungsbedürfnissen im Leben orientiert. Entdecken Sie unseren Neubau «irides» – ein offenes Haus der Begegnung, das mit seinem innovativen Ambiente alle Sinne anspricht. Mit öffentlichem Bistro und Restaurant.

Samstag, 25. Mai 2024 10 bis 16 Uhr
Kohlenberggasse 20 4051 Basel
Dieses Heft ist mehr als ein Magazin –es ist viele. Anlässlich der Ausstellung im Kornhausforum in Bern, in der gezeigt wird, «wie Strassenzeitungen Leben verändern», möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe einen Eindruck davon geben, wie sie denn aussehen und worüber sie schreiben: die anderen Strassenmagazine aus dem International Network of Street Papers INSP, dem auch Surprise angehört. 16 Extraseiten haben wir uns dafür gegönnt, auf denen wir Ihnen zum selben Preis wie immer zeigen möchten, wie vielfältig wir sind.
Um sich dieses Heft zu erschliessen, müssen Sie die Ausstellung nicht besucht haben. Es wird sie auch nicht vorwegnehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein wenig Neugier auf die Idee der Strassenzeitungen. Sie steht hinter dem Schweizer Surprise, das Teil einer weltweiten, 30jährigen sozialen Bewegung gegen Armut ist. Sie steht auch hinter Kanadas L’Itinéraire, dem britischen The Big Issue, dem griechischen Shedia, Mexikos Mi Valedor und hinter The Big Issue Taiwan. Heft und Ausstellung möchten Ihnen nahebringen, was uns alle verbindet.
Zum Beispiel die Idee, dass alle rund 90 Projekte ein redaktionell unabhängiges Printmagazin produzieren, deren Erlös zu einem beachtlichen Teil (bei den meisten zu 50 Prozent) den Verkäufer*innen zugute kommt. Und dass wir einander keine Konkurrenz machen. Aber auch, dass wir einen hochwertigen Journalismus anstreben, der sich an den in der Branche
üblichen ethischen Standards orientiert. Manche werden auf Zeitungspapier gedruckt und sehen auch aus wie eine Zeitung, andere kommen in Hochglanz daher. Manche prangern soziale Missstände an, andere wollen lieber unterhalten. Gemeinsam ist uns, dass Armutsbetroffene über den Verkauf eines Strassenmagazins eine Chance auf ein Einkommen, aber auch auf gesellschaftliche Sichtbarkeit und Begegnungen haben.
Welche Menschen es sind, die sich für den Strassenverkauf entscheiden, ist in jedem lokalen Kontext etwas anders. Auch sind die Mechanismen, die Menschen aus einer Gesellschaft ausschliessen, zwar oft ähnlich, in ihrer konkreten Ausgestaltung – der Sozialgesetzgebung beispielsweise – aber wiederum nur schwer vergleichbar.
Womit man den Verkäufer*innen am besten helfen kann, wird in der Strassenzeitungswelt intensiv diskutiert. Ob online oder an Kongressen – das gemeinsame Lernen war von Anfang an Teil der Bewegung. Auch ist sehr unterschiedlich, wie eng die Verkäufer*innen ins Zeitungsmachen eingebunden sind. Surprise beispielsweise hat eine regelmässige Verkäufer*innen-Kolumne. Und die Inspiration für neue Themen kommt sowieso meist von dort, wo unsere Verkäufer*innen stehen – auf der Strasse. SARA WINTER SAYILIR Redaktorin








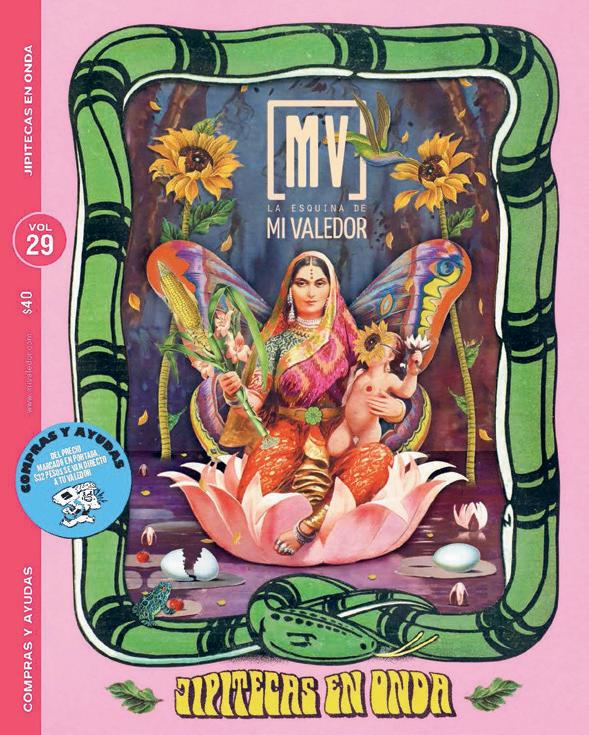

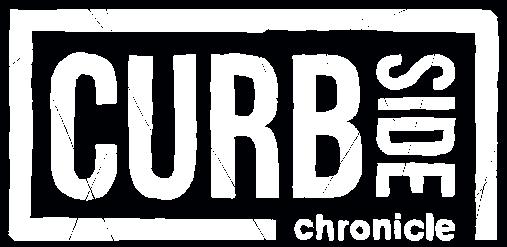



Einleitun g
Wie es ist, als Kuratorin an einem Thema zu arbeiten, das kaum jemandem in seiner ganzen Bandbreite bekannt und dennoch keine Marginalie ist: die Idee der Strassenzeitungen.
TEXT REBECKA DOMIG
Wenn man kurz die Augen schliesst und an eine Ausstellung denkt, dann vielleicht an Bilder oder an andere Objekte, die in einem Raum arrangiert wurden. Darin liegen auch die Ursprünge der modernen Museen und Ausstellungshäuser in Europa. In sogenannten Wunderkammern versammelten reiche Adelige und Kleriker ab dem 14. Jahrhundert ihre wertvollen Kunstgegenstände und seltenen Funde in repräsentativen Räumen, die sie Besucher*innen zeigen konnten. Korallen, Perlen und Bergkristalle lagerten neben getrockneten Kugelfischen, Schnitzereien aus Elfenbein, ledergebundenen Büchern, Instrumenten der Seefahrt oder Bronzestatuen. Alles, was unbekannt und anders war, erhielt besondere Aufmerksamkeit.
Spuren dieser Anfänge finden sich auch im Ausstellungmachen von heute. In der Erarbeitung einer Ausstellung zu einem Thema spiegeln sich ebenso Interesse und Wertschätzung. Man bringt zum Ausdruck, dass man dieses Thema wichtig findet und dass es sich lohnt, genauer hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Man findet etwas kostbar. Dies trifft auch auf das Thema Strassenzeitungen zu: Menschen verkaufen auf der Strasse eine eigens dafür hergestellte Zeitung oder ein Magazin und verdienen dadurch Geld. Das Konzept wirkt auf den ersten Blick simpel. Wie faszinierend, dass diese Idee aber nicht nur in Bern, Basel oder Zürich funktioniert, sondern auch in Dortmund, Skopje, Belgrad,

Ungefähr 90 000 Menschen verkaufen laut Schätzungen auf der ganzen Welt Strassenzeitungen.
Oklahoma City, Rio de Janeiro, Kapstadt, Taiwan oder Sydney! Zusammengeschlossen im Internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP sind heute 92 «Street Papers» in 35 Ländern und 25 Sprachen.
Wie ernüchternd gleichzeitig, dass es weltweit nötig ist, solche Strukturen aufzubauen, weil überall Menschen aus den sozialen Netzen herausfallen, die uns doch eigentlich genau davor schützen sollten. Der Erfolg des Konzepts zeigt aber auch, dass beim Verkauf und Kauf eines Strassenmagazins oder einer Strassenzeitung weit mehr passiert als ein einfacher Warentausch. Strassenzeitungen bieten auf lokaler Ebene leicht zugängliche Hilfsstrukturen an und sind – ähnlich wie Schwarmintelligenz– international bestens vernetzt. In der Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» geht es sowohl um den weltweiten Erfolg dieser Idee als auch um die Gründe für deren Notwendigkeit.
Es macht keinen Sinn, eine Ausstellung über Strassenzeitungen zu machen, ohne über die Menschen zu sprechen, die Tag für Tag auf der Strasse stehen und diese verkaufen. Ungefähr 90 000 Verkäufer*innen gibt es laut Schätzungen auf der ganzen Welt. Um diese Menschen soll es auch in der Ausstellung gehen. Doch hier stellt uns die Kulturpraxis des Ausstellungmachens ein Bein. Wie schon in den historischen Wunderkammern gibt das Konzept der Ausstellung bis heute vor, dass etwas «ausgestellt» oder «zur Schau gestellt» wird. Im Ausstellungsraum wird jedes Thema zum Ding und jede Lebensgeschichte zum Objekt, das von den Besucher*innen nach Lust und Laune begutachtet wird. Könnten Sie sich vorstellen, selbst zum Ausstellungsstück zu werden? Möchten Sie Ihre eigene Lebensgeschichte im Museum sehen? Was die eine Person als Anerkennung und Würdigung ihres Lebenswegs empfindet, kann für jemand anderen eine schmerzhafte Erfahrung sein.
früher die Fürsten, Kardinäle und Grafen (die männliche Form ist Absicht), die ihre Wunderkammern nach ihrer eigenen Idee der Weltordnung zusammenstellten, so sind es heute Kurator*innen, die Ausstellungen machen. Die Ausstellung ist ein Kind des Kolonialismus. Durch die Auswahl, Präsentation und Gestaltung wird eine bestimmte Leserichtung vorgegeben. Die längste Zeit galt dabei eine eurozentrische Sicht auf die Welt als neutraler Nullpunkt.

REBECKA DOMIG ist Kunsthistorikerin, freie Autorin und Kuratorin am Kornhausforum in Bern. Es versteht sich als ein niederschwelliger Ort der öffentlichen Teilhabe und kulturellen Begegnung.
Immerhin gab es in den letzten Jahren die Einsicht, dass die eigene Vorstellung nicht das Mass aller Dinge ist, und man gut daran tut, die eigene subjektive Perspektive auf die Welt zu reflektieren (und im Ausstellungskontext zu deklarieren). Das habe ich auch als Kuratorin gemerkt, die ich noch nie in existenzieller Weise von Armut betroffen war. Ich musste in den letzten Monaten an die Figur von Peter Pan denken, der seinen eigenen Schatten sucht. Wo sind meine blinden Flecken in Bezug auf dieses Thema? Welche Klischees habe ich im Kopf? Was sehe ich nicht? Das Team von Surprise (allen voran Sara Winter Sayilir) stand mir dabei wie die gute Fee Tinkerbell zur Seite und zeigte mir, wo ich meinen Schatten vergessen hatte. Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass sich auch die Strassen zeitungsprojekte mitten in einem Lernprozess in Bezug auf Dekolonialisierung und Diversifizierung befinden.
Ich denke, das Format einer thematischen Ausstellung gewinnt grundsätzlich an Tiefe und Komplexität, je mehr Autor*innen involviert sind. Nicht umsonst etablieren sich aktuell immer mehr Ausstellungsformate, in der partizipative Autorschaft geübt wird. Auch hier ist es ein bisschen wie mit dem Licht und dem Schatten. Ein Schatten verschwindet dann, wenn ein Objekt von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird.
Historisch hat das Ausstellen von Menschen eine schreckliche Geschichte, gerade in den Ländern Europas. Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, Porträts und Geschichten von Strassenzeitungsverkäufer*innen aus der ganzen Welt zu zeigen. Im Einverständnis mit den Gezeigten. Es sind wertschätzende Einblicke in Lebenswelten, die in vertrauensbasierten Situationen entstanden sind und journalistischen Standards entsprechen. Durch die Geschichten lässt sich eindrücklich nachvollziehen, wie gesellschaftliche Mechanismen dazu beitragen, dass Menschen in die Armut gedrängt werden. Im Begleitprogramm soll es weitere Momente der direkten Begegnung geben, aber auf eine Art, bei der niemand zur Schau gestellt wird.
Wer diktiert das Narrativ einer Ausstellung? Wer entscheidet, welche Themen Aufmerksamkeit erhalten, welche Dinge gezeigt werden, welche Erzählungen Raum finden? Auch in der Antwort auf diese Frage klingt etwas aus den Anfängen des Ausstellungmachens an. Waren es
In der Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» sind eine Reihe Schlaglichter und Perspektiven vertreten. Jede*r Besucher*in bringt wiederum eine eigene ergänzende Sicht auf das Thema mit. Ich hoffe, dass in der Summe eine vielstimmige Erzählung geschaffen wird. In diesem Sinn wünsche ich mir tatsächlich etwas von einer Wunderkammer. Dabei soll das Staunen aber nicht am Ende stehen, sondern den Weg freimachen für ein tieferes Verständnis unserer Welt – und für die Rolle, die Strassenzeitungen darin einnehmen.
«Wie Strassenzeitungen Leben verändern – How Street Papers change lives», Ausstellung, 17. Mai bis 3. Aug., Di bis Fr, 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr, Kornhausforum, Kornhausplatz 18, Bern, Eintritt frei.


Iso Numero StrassenmagazinVerkäufer sprechen über ihr Leben, ihre Wünsche und darüber, was Männlichkeit für sie bedeutet.
Dănut, 50 Jahre alt
«Ich bin vor etwa sechs Jahren nach Finnland gekommen. Meine Frau ist auch manchmal hier. Wir haben fünf Buben und ein Mädchen. Meine beiden erwachsenen Söhne sind auch in Finnland, die anderen in Rumänien. Diejenigen, die in Rumänien sind, haben keine Arbeit, wir schicken ihnen Geld. Das Leben dort ist schwierig. Hier verkaufe ich Iso Numero. Ich habe keine andere Arbeit gefunden: Ich spreche kein Englisch, und ich kann weder lesen noch schreiben. Meine Eltern hielten es nicht für wichtig, dass wir zur Schule gehen. Ich war nur zwei oder drei Jahre in der
Schule. Aber ich habe dafür gesorgt, dass meine eigenen Kinder zur Schule gingen, Lesen und Englisch lernten und ihren Führerschein machten. Damit sie mehr Chancen im Leben haben. Man ist schlauer, wenn man zur Schule geht.
Es ist sehr wichtig für mich, Vater zu sein, es ist eine grosse Freude. Alles, was ich im Leben tue, tue ich für meine Kinder. Als Mann bin ich das Familienoberhaupt. In unserer Kultur ist der Mann für die Versorgung der Familie zuständig, die Frau mehr für den Haushalt verantwortlich. Das Wichtigste im Leben ist für mich, dass ich gesund bleibe. Geld ist keine Garantie dafür, dass man glücklich ist.»
Traian, 67 Jahre alt
«Ich bin seit ein paar Jahren im Ruhestand. Das Leben ist viel einfacher, es gibt weniger Stress. Ich verkaufe das Strassenmagazin, um mir etwas dazuzuverdienen. Ich bin vor mehr als fünfzehn Jahren nach Finnland gekommen. Ich stamme aus Rumänien, aber ich bin kein Rom wie viele andere Verkäufer. Anfangs habe ich das Magazin hauptberuflich verkauft, dann habe ich andere Jobs angenommen. Ich habe geputzt und auf einer Baustelle gearbeitet. Ich bekam eine Krankenversicherung, und meine Frau und ich bekamen eine Wohnung. Ich habe auch einen Finnischkurs belegt, aber aufgrund meines Alters durfte ich nicht mehr studieren.
In Rumänien haben wir zwei erwachsene Töchter mit jeweils eigenen Familien. Wir helfen ihnen von hier aus. Wir telefonieren jeden Tag. Es war wunderbar, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Und es ist grossartig, dass wir ihnen das geben konnten, was sie brauchten – vor allem, als die Zeiten sehr schwierig waren und sie noch Kinder waren. Es ist die Aufgabe des Mannes, sich um die Familie zu kümmern. Natürlich verändert sich die Männlichkeit mit dem Alter. Vor und nach dem 50. Lebensjahr ist es sehr unterschiedlich. Vor allem das Interesse an Frauen ändert sich.
In der Familie liegt die Hauptverantwortung für die Lösung von Problemen beim Mann. Natürlich tragen auch die Frauen Verantwortung. Weil es in einer Familie zwei Seiten gibt, besprechen und regeln wir die Dinge gemeinsam. Die Verantwortung wiegt auch schwer. Wenn die Frau sagt, dass wir Geld brauchen, muss der Mann es besorgen. Ich zeige meine Gefühle oder meine Sorgen nicht, weil ich meine Frau nicht stressen will. Das ist schwierig.
In Rumänien hätte ich vielleicht mit meinem Schwiegersohn oder meiner Tochter reden können, aber hier habe ich eigentlich niemanden. Manchmal gehe ich in das Büro von Iso Numero, um zu reden. Für Frauen ist es einfacher, denn sie können reden und zeigen, wenn sie gestresst sind.»
Vasile, 28 Jahre alt
Natürlich ist es etwas schwieriger, ein Mann zu sein, denn das bedeutet, dass man dafür verantwortlich ist, seine Familie zu ernähren. Man ist für alles verantwortlich, was die Familie betrifft. Wenn du Geld verdienst, kannst du es nicht einfach ausgeben, denn es ist das Geld deiner Familie. Ich denke ständig an meine Kinder und daran, was sie brauchen. Mit meiner Frau kann ich reden, wenn ich Probleme habe. Mit anderen Leuten, vor allem mit Fremden, spreche ich nicht darüber, die würden mich für komisch halten.
Ich mag es, ein Mann zu sein. Wir haben mehr Freiheiten als Frauen. Ich bin rumänischer Rom, das ist Teil unserer Kultur. Zum Beispiel kann eine Frau nicht ohne ihren Ehepartner auf eine Party gehen, während ein Mann das darf. Ich selbst würde meine Frau Agripina gehen lassen, ich vertraue ihr. Aber die Leute werden reden, wenn eine Frau Zeit mit einer Gruppe von Männern verbringt. Wir erziehen unsere Kinder auf die gleiche Weise, unabhängig vom Geschlecht. Wir haben zwei Söhne. Ich hoffe, dass sie, wenn sie erwachsen sind, eine feste Arbeit finden und




1 Auf den Bildern sind von oben links ausgehend Vasile, Traian, Dănuț und Ion zu sehen.
2 «Ich zeige meine Gefühle oder meine Sorgen nicht, weil ich meine Frau nicht stressen will», sagt Traian.
3 «Ich habe meine Kinder allein erzogen. Das war schwierig, aber das heisst, ich bin ein richtiger Mann. Ein Mann mit einer linken Gehirnhälfte», sagt Mungbaba.
4 Der Kongolese Mungbaba liebt es, neue Leute kennen zu lernen. Er ist Verkäufer von Iso Numero und schreibt auch ab und zu für die Zeitschrift.
Miehelläkin on paljon tunteita, suruja ja sairastelua. Mutta en näytä niitä, koska en halua stressata vaimoani.
poikansa puhuu. Kaksi aikuista poikaani ovat myös Suomessa, muut Romaniassa. Niillä jotka ovat Romaniassa ei ole töitä, me lähetämme heille rahaa. Siellä elämä on vaikeaa, töitä ei löydä. Siellä olen tehnyt joskus keikka-aputöitä maatiloilla, mutta harvoin ja muuta ei koskaan ole löytynyt. Täällä myyn Isoa Numeroa Muita töitä en ole saanut, koska en edes tiedä miten voisin: en puhu yhtään englantia, en osaa lukea enkä kirjoittaa. Omat vanhempani eivät pitäneet tärkeänä sitä, että olisimme käyneet koulua. Olin koulussa vain pari-kolme vuotta. Koska en itse käynyt koulua, pidin huolta siitä, että omat lapseni käyvät, oppivat lukemaan ja englantia sekä saavat ajokortit. Että heillä olisi enemmän mahdollisuuksia elämässä. Ihminen on fiksumpi, jos käy kouluja. Minulle on hyvin tärkeää olla isä, se on iso ilo. Kaikki mitä teen elämässä, teen lasteni vuoksi. Miehenä olen perheen pää, ja minulla on myös enemmän velvollisuuksia. Kulttuurissamme mies on vastuussa perheen elättämisestä ja nainen enemmän kodista. Tärkeintä elämässä minulle on, että pysyisimme terveenä. Raha ei ole niin tärkeää. Se ei takaa sitä, että on onnellinen. Traian, 67 vuotta O len ollut eläkkeellä pari vuotta. Elämä on paljon helpompaa, on vähemmän stressiä. Myyn lehteä saadakseni lisätuloja. Arki on yksinkertaista: haen lehdet, myyn niitä, käyn kaupassa, menen kotiin. Suomeen tulin yli 15 vuotta sitten. Olen Romaniasta, mutta en ole romani kuten monet muut lehden myyjät. Kun Iso Numero aloitti, myin lehteä kokopäiväisesti monta vuotta ja sitten sain muita töitä.
eivät salli vaimojensa mennä mihinkään, miehiä jotka jopa pahoinpitelevät vaimojaan. Mustasukkaisuus ei ole ok. Jos joku ystäväni on mustasukkainen, eikä kestä sitä että hänen vaimonsa tanssii toisten kanssa, hänet heitetään ulos juhlista. Minä voin tanssia kaikkien kanssa, se ei ole mikään ongelma. Vaimonikin saa tanssia muiden kanssa, vaikka yöhön asti! Mungbaba, 71 vuotta
len tullut Suomeen Kongon demokraattisesta tasavallasta 90-luvulla pakolaisena. Olen filosofian tohtori, opiskelin filosofiaa ja kirjallisuutta Kongossa ja Ranskassa. Aloin myydä Isoa Numeroa pari vuotta sitten, koska olen eläkkeellä, minulla on aikaa ja rakastan ihmisten tapaamista. Ison Numeron kautta olen saanut paljon uusia ystäviä ja pääsen juttelemaan paljon ihmisten kanssa. Ennen lehden myymistä en tuntenut lainkaan näin paljon suomalaisia. Tämän takia olen oppinut ymmärtämään heitä! Mitä tarkoittaa miehenä oleminen? Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Ja nainen on luotu miehen kylkiluusta. Molemmat muistuttavat Jumalaa. Ihmisellä on kaksi erilaista muotoa, feminiininen ja maskuliininen, joiden välillä on vetovoimaa. Se vetovoima saa aikaan rakkautta. Ja sen ansiosta mies voi mennä naisen kanssa naimisiin ja muodostaa perheen. Minulla on kolme lasta. Kasvatin heidät yksin alakouluikäisistä aikuisiksi, koska vaimoni hylkäsi perheemme. Oli toki vaikeaa kasvattaa heidät aivan yksin. Mutta se tarkoittaa, että olen todellinen mies. Vastuullinen mies. Hain aikoinaan lapsilleni Suomen kansalaisuuden. Se maksoi paljon, eikä rahaa ikinä ollut tarpeeksi. Siksi minulla ei ollut varaa maksaa omaa kansalaisuushakemustani. Sen jälkeen laki muuttui, ja kielitaitovaatimukset kovenivat. Hain myöhemmin kaksi kertaa, mutta sain aina kielteisen päätöksen. Vaikka tein töitä suomeksi, en päässyt tarvittavalle taitotasolle. Uskon Jumalaan ja joulun aika on minulle tärkeää. Joulujuhla tuo perheen yhteen, silloin voi viettää aikaa yhdessä. Se mahdollistaa perheen ongelmien ratkomisen. Silloin saa rauhaa, iloa ja rakkautta. Uudelle vuodelle toivon kaikkea hyvää. Mutta olen huolissani ihmiskunnan puolesta. Kaikkialla on sotia. Toivoisin että maailmassa olisi rauha ja kaikki voisivat elää hyvin. Suomi on hyvä ja turvallinen maa, mutta politiikka täälläkin on muuttunut. ●
Kasvatin lapseni yksin. Se oli vaikeaa, mutta tarkoittaa, että olen todellinen mies. Vastuullinen mies.

Geld verdienen werden, im Gegensatz zu mir, der immer hin und her gehen muss, um Geld zu verdienen. Ich sage ihnen, dass sie eine Ausbildung machen müssen. Sie gehen in Rumänien zur Schule. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mit meiner Familie in Finnland leben. Aber die Mieten sind so teuer. Ich würde Rumänien nicht vermissen, solange die Familie zusammen ist. Zu Weihnachten fahre ich nach Hause, weil es wichtig ist und ich Weihnachten liebe. Es ist eine grosse Freude, zu sehen, wie glücklich die Kinder sind. Wir verkleiden uns als Gruppe und ziehen durch das Dorf und singen Weihnachtslieder. Die Leute geben uns Essen, Trinken und Geld. Für das nächste Jahr hoffe ich nur, dass meine Familie gesund ist. Das ist das Wichtigste, alles andere kann man ändern.»
Ion, 56 Jahre alt
«Ich bin gerne ein Mann, Gott hat mich so gemacht. Es ist die Aufgabe eines Mannes, eine Arbeit zu finden, für seine Familie und seine Kinder zu sorgen. Es ist auch die Aufgabe eines Mannes, seinen Kindern beizubringen, wie sie leben sollen: Ich bringe ihnen bei, nicht in Schwierigkeiten zu geraten und keine dummen Dinge zu tun, wie zum Beispiel zu stehlen. Ein Mann muss sich um die Familie kümmern und seiner Frau Geld geben, damit sie ihn nicht verlässt. Manchmal muss ich meiner Frau Pralinen oder etwas anderes Nettes kaufen, damit sie mich besser behandelt. Natürlich ist da ein gewisser Druck. Unsere
Situation ist kompliziert, weil meine Frau einen festen Job hat und ich nicht. Es ist schwierig, wenn ich darüber nachdenke –ich könnte ihre Arbeit leichter erledigen, als Mann hätte ich die Kraft, mehr zu tun. Jetzt ist sie gestresst und müde. Sie macht sich auch Sorgen um die Kinder, die in Rumänien sind, manche schon erwachsen. Ich spreche kein Englisch und bin nicht zur Schule gegangen, deshalb ist es schwer, einen Job zu finden. Ein paar Mal habe ich einen Job auf einer Baustelle bekommen, aber es war schwierig zu verstehen, was ich tun sollte. Ich verkaufe schon seit langem das Strassenmagazin und es gefällt mir.
Ich bin kein eifersüchtiger Mann. Natürlich kann meine Frau hingehen, wo sie will, und tun, was sie will. Genau wie ich. Es gibt Männer, die ihren Frauen nicht erlauben, irgendwohin zu gehen, Männer, die ihre Frauen sogar misshandeln. Eifersucht ist nicht in Ordnung. Wenn ein Freund von mir eifersüchtig ist und es nicht erträgt, dass seine Frau mit anderen Männern tanzt, wird er von der Party geschmissen. Ich kann mit allen tanzen, das ist kein Problem. Meine Frau kann mit anderen Leuten tanzen, sogar bis in die Nacht hinein!»
Mungbaba, 71 Jahre alt
«Ich kam in den 1990er-Jahren als Geflüchteter aus der Demokratischen Republik Kongo nach Finnland. Ich habe einen Doktortitel in Philosophie und studierte
Literatur im Kongo und in Frankreich. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Iso Numero zu verkaufen, weil ich im Ruhestand bin, Zeit habe und gerne Leute treffe. Dadurch habe ich viele neue Freund*innen gefunden und komme mit vielen Menschen ins Gespräch. Bevor ich angefangen habe, die Zeitschrift zu verkaufen, kannte ich nicht so viele Finn*innen.
Was es bedeutet, ein Mann zu sein? Gott hat Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen, die Frau aus der Rippe des Mannes. Beide ähneln Gott. Zwischen ihnen besteht eine Anziehung. Daraus entsteht die Liebe. Und sie ermöglicht es einem Mann, eine Frau zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ich habe drei Kinder. Ich habe sie vom Grundschul- bis zum Erwachsenenalter allein aufgezogen, weil meine Frau unsere Familie verlassen hat. Natürlich war es schwierig, sie ganz allein aufzuziehen. Aber das bedeutet, dass ich ein richtiger Mann bin. Ein verantwortungsvoller Mann.
Ich habe die finnische Staatsbürgerschaft für meine Kinder beantragt. Das hat viel gekostet, und es war nie genug Geld da. Deshalb konnte ich es mir nicht leisten, meinen eigenen Antrag auf die Staatsbürgerschaft auch noch zu bezahlen. Dann änderte sich das Gesetz, und die Sprachanforderungen wurden verschärft. Ich habe mich noch zweimal beworben, wurde aber abgelehnt. Obwohl ich auf Finnisch arbeitete, habe ich das erforderliche Sprachniveau nicht erreicht. Ich bin besorgt um die Menschheit. Überall gibt es Kriege. Ich wünschte, es gäbe Frieden auf der Welt und dass alle gut leben könnten. Finnland ist ein gutes und sicheres Land, aber auch hier hat sich die Politik verändert.»
Text (leicht gekürzt): Veera Vehkasalo Fotos: Laura Oja Ausgabe: Dez. 2023 / Jan. 2024
Verbreitung: Helsinki und Südfinnland
Sprache: Finnisch gegründet: 2011 Auflage: 5000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: ca. 270
più accesso a corsi di italiano, assistenza psicologica, orientamento legale e lavorativo. Insomma, per un periodo lungo resteranno in Italia senza inserirsi nella società. Tutte queste misure non creano più sicurezza e coesione nella società, ma più allarme per le situazioni di marginalità che si verranno a creare». È necessario, secondo Neri, cambiare completamente prospettiva: «Uscire dall’idea che si tratti di un fenomeno emergenziale ma considerare l’accoglienza tra i servizi sociali ordinari, così come gli enti locali forniscono servizi sociali alle fasce fragili, anche i richiedenti asilo dovrebbero poter accedere al welfare come fascia fragile». E poi prevedere sistemi di ingresso regolari. «Se fosse possibile entrare legalmente e facilmente nel territorio, si sgonfierebbe il sistema criminale del traffico di migranti: buona parte del problema si limiterebbe automaticamente».

Il sistema dei Cas non è più in grado di assorbire nuovi ingressi e circa 500 persone, pur avendo diritto a un posto, sono costrette a dormire per strada
Nei mesi invernali i flussi di migranti si affievolivano sulla rotta balcanica. Ma non è più così. «In questi anni il numero di persone presenti sulla cosiddetta rotta balcanica, di cui Trieste rappresenta la porta di ingresso a quanti vogliono andare nel Nord Europa, è sempre andato aumentando. L’ottobre 2022 ha avuto il picco massimo dell’anno, cosa che non era avvenuto negli anni precedenti. Da settembre di quest’anno i dati Unhcr ci dicono che sono circa 140 mila le persone che in questi mesi stanno percorrendo la rotta balcanica, nei vari Paesi, principalmente in Bosnia e in Serbia. Un numero molto elevato rispetto agli anni precedenti».
Marco Aliotta è responsabile dell’Ufficio progetti e membro dell’Osservatorio povertà e risorse, a Trieste, da 24 anni in Caritas. L’aumento dei transiti dei migranti è dato da diversi fattori. Il cambiamento climatico è fra questi – le continue inondazioni in Pakistan ad esempio – ma anche le guerre e l’instabilità dei Paesi come l’Afghanistan, influiscono sull’esodo. Così come la povertà crescente, ma anche la fine del Covid. «In città ci sono una serie di associazioni, reti informali e del terzo settore, che sono fuori dal sistema Cas – ovvero i centri di accoglienza straordinaria – i quali gestiscono piccoli servizi di strada e hanno evidenziato che in 18 mesi, fino a giugno 2023, ci sono stati circa 13 mila transiti sul territorio di Trieste. Si tratta quindi

e Gian Andrea curano chi arriva sulla
del
ragazzi torturati e feriti. È La sconfitta della politica»
Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi sono i fondatori dell’associazione Linea d’ombra. Hanno scelto il percorso di vita che li porta ogni giorno, dal 2018, sulla piazza del mondo. Quella Piazza Libertà, a Trieste, dove curano e accolgono migranti della rotta balcanica. «Credo che tutto abbia a che fare con il fatto di essersi sentiti amati nella vita – racconta Lorena –. Mio padre e mia madre erano due partigiani e mi hanno trasmesso il senso di giustizia e l’amore per la vita. E anche il rispetto per il dolore. Nella vita sono una psicoterapeuta, mi sono sempre occupata della presa in carico del dolore. Ritengo quest’ultimo un grande maestro di vita. Lo diceva molto bene mia madre, Maria Antonietta Moro, nel suo diario di partigiana, Tutte le anime del mio corpo, pubblicato da Iacobelli. Lei scrive che di fronte al dolore non bisogna arretrare, ma sostarvi. Le sue parole hanno rafforzato in me il bisogno di essere testimone. Quando questi ragazzi – il 99% sono giovani mandati in salvezza dalle famiglie – arrivano da noi, non chiedono nulla, sono solo spaventati. Ma i loro corpi torturati ti sollecitano, perché la vita è sacra e tu con loro vedi la vita offesa, lapidata. E il primo gesto che ti viene da fare è un gesto d’amore». I ragazzi che arrivano, che tentano il Game (il passaggio della frontiera, ndr), presentano tutti ferite profonde. «Ogni giorno in piazza assistiamo dalle 140 alle 200 persone: soprattutto afghani e pakistani. Vengono torturati dalla polizia al passaggio di alcune frontiere. Ricordo lo sguardo di uno di loro. Aveva i segni della tortura, cicatrici, fratture, le sigarette spente sul corpo. Io ho alzato gli occhi su di lui, aspettandomi rabbia. Invece ho incrociato lo sguardo di chi ti chiede: perché mi è stato fatto questo? Lo dice molto bene Simone Weil, quando scrisse
di persone che non sono entrate nel sistema Cas di cui la Caritas fa parte», spiega Aliotta. Il sistema Cas di Trieste si compone di oltre mille posti, principalmente unità abitative (800 posti). Poi ci sono i centri collettivi, sotto i 50 posti. Infine, solo 2 hub: una struttura di primissima accoglienza di 95 posti e una di 200 aperta per isolamento fiduciario nel periodo Covid, diventata una struttura di transito.
Tantissimi anche i minori non accompagnati che transitano da qui: il Friuli Venezia Giulia, che è una delle Regioni più piccole d’Italia, in questo momento è la terza per la presa in carico di minori stranieri, dopo la Sicilia e la Lombardia
ma Cas. Attualmente si calcola che oltre 500 persone in città, pur avendo fatto la domanda di
Sistema bloccato «Attualmente il sistema non sta funzionando perché sono bloccati i trasferimenti in altri territori. Lampedusa sta assorbendo gran parte dei trasferimenti delle persone cosiddette senza destinazione, ovvero i migranti che non hanno un’accoglienza dentro il sisteterno del sistema Cas con una messa a disposizione di 560 posti. «Noi di Caritas – dice Aliotta – in questo momento siamo impegnati con 478 posti nei centri di accoglienza straordinaria, 100 sono in appartamento, e il rimanente in piccole strutture di accoglienza e poi abbiamo 10 posti nel progetto Sai – Sistema di accoglienza e integrazione – che è invece un progetto più strutturato, in partecipazione con il Comune. Inoltre, sant’Egidio ha 12 posti, un’altra realtà di ispirazione cristiana 25 posti, e poi una cooperativa delle Acli mette a disposizione 35 posti. Caritas fornisce inoltre pasti alle persone che vivono in strada e che intercettiamo e a quelle che vengono rintracciate al confine. Nel periodo giugno-agosto 2023 abbiamo fornito 24 mila pasti». 25 novembre 2023 Scarp de tenis
zione internazionale a Trieste, non riescono a essere collocati nel sistema di accoglienza. E non hanno un posto dove dormire». Esiste una struttura abbandonata accanto alla stazione centrale e molti sono accampati lì: le forze dell’ordine sgomberano l’area regolarmente, ma i migranti, spesso intere famiglie, non sanno dove andare a dormire in città e tornano. Ma è una situazione precaria, con presenza di topi e senza servizi igienici. «Ultimamente la polizia sta indagando su un sistema di racket interno alla struttura, che regolerebbe gli ingressi. Perché comunque è un tetto sopra la testa». La rete strettamente ecclesiale di Trieste sta rispondendo all’in-
Scarp de’tenis Es kommen wieder mehr Geflüchtete über die Balkanroute nach Italien. Triest ist ihre erste Station. Die Stadt will helfen, stösst aber an ihre Grenzen.
Eine Weile gelangten immer weniger Geflüchtete über die Balkanroute nach Europa. Das hat sich geändert. Die Zahl der Menschen, für die Triest das Tor zur EU sein könnte, ist wieder gestiegen. Nach Angaben des Internationalen Flüchtlingswerks UNHCR sind zwischen 2021 und 2023 rund 140 000 Menschen über die Balkanroute nach Bosnien und Serbien und von dort weiter nach Italien gekommen. «Im Vergleich zu den Vorjahren ist das eine sehr hohe Zahl», sagt Marco Aliotta von Caritas Triest. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Dazu gehören Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel wie etwa die ständigen Überschwemmungen in Pakistan, aber auch Kriege sowie die Unsicherheit in Ländern wie Afghanistan, die zunehmende Armut in vielen Teilen der Welt und nicht zuletzt die ökonomischen Auswirkungen der Covid-Pandemie.
In Triest versucht man mit dieser Situation so gut wie möglich umzugehen. «Es gibt es eine Reihe von NGOs und informel-
len Netzwerken, die sich um Flüchtende kümmern – und zwar vor allem um solche, die in den offiziellen Flüchtlingszentren keinen Platz finden oder aus irgendwelchen Gründen dort nicht aufgenommen werden», sagt Aliotta. Das sind offenbar keine Einzelfälle; zwischen Sommer 2022 und Sommer 2023 waren 13 000 Menschen davon betroffen. Die offiziellen Zentren haben Platz für 1000 Personen, darüber hinaus gibt es diverse Unterkünfte mit zusätzlich rund 350 Plätzen.
«Derzeit besteht das Problem vor allem darin, dass die Flüchtenden von Triest aus nicht weiter in andere italienischen Städte überstellt werden können», so Aliotta. Dies betrifft auch hunderte Personen, die über 1 Nach Sizilien und der Lombardei werden in der Region um Triest, der kleinsten von ganz Italien, am meisten unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufgenommen.
die Insel Lampedusa nach Italien wollen und von vornherein keine Chance auf Asyl haben. Sie erhalten keinen Platz in den offiziellen Flüchtlingscamps. «Sie sind zwischen Stuhl und Bank», sagt Aliotta. «Und haben buchstäblich keinen Platz zum Schlafen.» Neben dem Hauptbahnhof von Triest gibt es ein verlassenes Gebäude, in dem viele der Geflüchteten vorübergehend Unterschlupf finden – «ohne Toiletten und mit Ratten überall», wie Aliotta ergänzt. «Aber immerhin haben sie dort ein Dach über dem Kopf.» Allerdings räumt die Polizei regelmässig das Areal, sodass die Migrant*innen – oft sind es ganze Familien – nicht wissen, wo sie in der Stadt sonst unterkommen können.
Angesichts dieser Situation versucht die Caritas das Wohnangebot für Geflüchtete auszuweiten. «Wir unterstützen die offiziellen Flüchtlingszentren, indem wir weitere Räumlichkeiten mit rund 480 Plätzen zur Verfügung stellen, 100 davon sind in Wohnungen, die über die ganze Stadt verteilt sind», erläutert Aliotta. Andere christliche Organisationen wie Sant’Egidio würden weitere 35 Plätze zur Verfügung stellen, auch Wohngenossenschaften seien an diesem Projekt beteiligt. Die Caritas liefert zudem Mahlzeiten aus, und zwar speziell für Menschen, die auf der Strasse leben, oder solche, die bei ihrem Versuch, die Grenze zu überqueren, von der Grenzpolizei aufgegriffen wurden. «Allein im Zeitraum zwischen Juni und August 2023 haben wir 24 000 Mahlzeiten ausgegeben», sagt Aliotta.
Ein weiteres Problem sieht Aliotta in der mangelnden Versorgung von minderjährigen Flüchtenden, die allein unterwegs sind und von den offziellen Flüchtlingszentren – oft infolge von Platzmangel –nicht aufgenommen werden. «Bisher gibt es ausserhalb dieser Zentren fast keine geschützten Wohnplätze für unbegleitete Minderjährige. Das ist ein Mangel in ganz Italien, und Triest ist da leider keine Ausnahme.» Inzwischen hat sich eine Wohngenossenschaft bereiterklärt, für diese Jugendlichen eine Unterkunft einzurichten. Was aber nicht ausreicht. Zudem fehlt es nicht bloss an Einrichtungen, sondern auch an Sozialarbeiter*innen, welche die Jugendlichen betreuen.
Allerdings gebe es auch positive Entwicklungen, wie Aliotta betont. «Wir haben immer mehr freiwillige Helfer*innen, viele von ihnen sind jung.» Vergangenes Jahr brachte die Caritas gemeinsam mit
anderen Organisationen über hundert Schüler*innen, Pfadfinder*innen und Interessierte aus Triest und Umgebung zusammen. «Wir organisierten Kurse und Workshops, um für die Situation der Geflüchteten zu sensiblisieren und zu fragen, wie man am besten und vor allem am effizientesten helfen kann», erzählt Aliotta. Er mache die Erfahrung, dass man sich gegenseitig mit mehr Menschlichkeit begegne, je näher man einander komme. «Immer wieder erzählen mir Leute, dass sich ihre Sichtweise auf Geflüchtete komplett änderte, sobald sie mit ihnen Kontakt hatten.» Es sei zwar anstrengend gewesen, diese Kurse zu organisieren, nicht zuletzt, weil Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund daran teilgenommen hätten. Trotzdem habe sich der Aufwand gelohnt, sagt Aliotta. «Es ist schön zu sehen, wie sich der Blick auf ein derart komplexes Phänomen wie Migration allein durch die Begegnung und den Austausch mit anderen verändern kann.»
Text: Daniela Palumbo
«So viele verletzte Jugendliche»
Die Gewalt gegen Geflüchtete an den Grenzen nimmt zu. Eine lokale Organisation kümmert sich um die Verletzten.
«Meine Eltern waren Partisan*innen und haben mir einen Sinn für Gerechtigkeit und die Liebe zum Leben vermittelt.» Die Psychotherapeutin Lorena Fornasir hat zusammen mit Gian Andrea Franchi den Verein «Linea d’ombra» gegründet, was auf Deutsch «Schattenlinie» bedeutet. Die Organisation kümmert sich in erster Linie um Geflüchtete, die auf ihrem Weg in die EU-Staaten immer wieder versuchten, Grenzen zu überqueren, und dabei von der Polizei aufgegriffen und gewaltsam zurückgeschickt wurden. «Fast alle, die zu uns kommen – 99 Prozent von ihnen sind junge Männer – haben Schlimmes erlebt, sie tragen tiefe Wunden mit sich», sagt Fornasir.
Pro Tag betreut der Verein zwischen 140 und 200 Personen vor allem aus Pa-
kistan und Afghanistan, einige von ihnen wurden von der Polizei regelrecht gefoltert. «Es gibt so viele verletzte Jugendliche», sagt Fornasir. «Ich erinnere mich an den Gesichtsausdruck eines Jungen. Er hatte Narben, Knochenbrüche und Verbrennungen von Zigaretten auf seinem Körper. Ich schaute ihn an und hätte eigentlich erwartet, dass Wut in seinen Augen ist. Stattdessen war es der Blick von jemandem, der fragt: Warum hat man mir das angetan?»
Für Fornasir hat die europäische Migrationspolitik diese Schicksale zu verantworten. «Die EU entscheidet, wann jemand die Grenzen überqueren darf oder ob überhaupt. Tote werden in Kauf genommen. Wie auch der Zusammenbruch der Beschulung und der Gesundheitsversorgung. Die Migrant*innen zu Feinden zu erklären, ist bloss ein Mittel, um sich nicht mit anderen Problemen befassen zu müssen.»
Fornasir erzählt, wie jüngst zwei Jungen im Alter von sechzehn und siebzehn Jahren ihren Verein aufgesucht hätten. «Sie zeigten mir Folteraufnahmen auf ihrem Handy, schockierend. Eine Gruppe von türkischen Kriminellen hatte sie entführt, um Geld von den Verwandten zu erpressen.» Schliesslich gelang den beiden die Flucht über die Grenze nach Bulgarien. Doch die Polizei hatte sie dabei erwischt und in die Türkei zurückgeschafft. Auf vielen Umwegen gelangten sie schliesslich nach Triest. «Ab und zu schaffen sie es doch noch», sagt Fornasir. «Neulich bekam ich einen Anruf von einem afghanischen Jungen, den wir vor einigen Monaten bei uns aufgenommen hatten, weil er sehr krank war. Nun ist er in Holland und hat einen Job. Ein anderer ist in Deutschland und arbeitet als Feuerwehrmann.»
Text: Daniela Palumbo Foto: Romano Sicilaini Ausgabe: Nov. 2023
Verbreitung: Mailand (Italien)
Sprache: Italienisch gegründet: 1994
Auflage: 20 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: 101

Der deutsche Staat sperrt jedes Jahr Tausende Menschen weg, weil sie Geldstrafen nicht zahlen können. Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas ist einer von ihnen.

Hinz&Kunzt Der deutsche Staat sperrt jedes Jahr Tausende Menschen weg, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen können. Hinz&KunztVerkäufer Thomas aus Hamburg ist einer von ihnen.
Wer Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas an diesem Donnerstag Mitte August 2023 besuchen möchte, hat einen tristen Weg vor sich. Er führt vorbei an Kleingärten, Bahnschienen und über die Autobahn A1, auf der sich der Verkehr staut. Linienbusse fahren hier nicht. Stattdessen schiebt sich ein verspiegelter Gefangenentransporter die regennasse Strasse entlang. Langsam fährt er durch das sich automatisch öffnende Tor hinter die Betonmauern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hamburg-Billwerder.
Zwei Wochen zuvor kam Thomas hier in einem ähnlichen Transporter an, nachdem er nahe der U-Bahn-Station Hoheluftbrücke in eine Personenkontrolle der Polizei geraten war. Um von A nach B zu kommen oder um sich einfach mal aufzuwärmen oder zu schlafen, ist der 56-jährige Obdachlose regelmässig mit Bus und Bahn unterwegs. Thomas lebt seit Jahren auf der Strasse. Weil er sich kein Ticket leisten kann, hat sich über die vergangenen Jahre ein beträchtlicher Schuldenberg bei verschiedenen Verkehrsunternehmen aufgetürmt. Die haben Thomas schon mehrfach wegen des «Erschleichens von Leistungen» angezeigt. In solchen Fällen entscheidet sich die Staatsanwaltschaft häufig für ein vereinfachtes Verfahren ohne Verhandlung: Sie beantragt einen Strafbefehl, den ein Gericht unterschreibt und versendet. Thomas sagt, dieser habe ihn nie erreicht. Die festgesetzten 1500 Euro Geldstrafe kann er nicht bezahlen. Deshalb wird schliess-

Wer kein Dach über dem Kopf hat wie Thomas, schläft auch mal in der S-Bahn.
Wer Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas an diesem Donnerstag Mitte August besuchen mö c hte, hat einen tristen Weg vor sich. Er führt vorbei an Kleingärten, Bahnschienen und über die Autobahn A1, auf der sich der Verkehr staut. Linienbusse fahren hier nicht. Stattdessen schiebt sich ein verspiegelter Gefangenentransporter die Straße entlang. Langsam fährt er durch das sich automatisch öffnen de Tor hinter die regennassen Betonmauern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Billwerder. Zwei Wochen zuvor kam Thomas hier in einem ähnlichen Transporter an, nachdem er nahe der U-Bahn-Station Hoheluftbrücke in eine Personenkontrolle der Polizei geraten war. Um von A nach B zu kommen oder um sich einfach ma l aufzuwärmen oder zu schlafen, ist der 56-jährige Obd achlose regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs. Thomas lebt seit Jahren auf der Straße. Weil er sich kein Ticket leisten kann, hat sich über die vergangenen Jahre ein beträchtlicher Schuldenberg bei verschiedenen Verkehrsunternehmen aufgetürmt. Die haben Thomas schon mehrfach wegen „Erschleichens von Leistungen“ angezeigt. In solchen Fällen entscheidet sich die Staatsanwaltschaft häufig für ein vereinfachtes Verfahren ohne Verhandlung: Sie beantragt einen Strafbefehl, den ein Gerich t unterschreibt und versendet. Thomas sagt, dieser habe ihn nie erreicht. Die festgesetzten 1500 Euro Geldstrafe kann er nicht bezahlen. Deshalb wird schließlich ein Haftbefehl gegen ihn
26 I Hinz&Kunzt Oktober 2023
erlassen – und vollstreckt. Seine Geldstrafe wird in Gefängnistage umgerechnet. Die sogenannten Tagessätze orientieren sich am Einkommen: Bei Thomas setzt das Gericht 30 Euro an. Das bedeutet: Die nächsten 50 Tage muss er in Haus 1, Station B, Haftraum 22 der JVA Billwerder verbringen. Als Thomas auf seinen Rollator gestützt den Besuchsraum des Gefängnisses betritt, breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. „Es ist so stinklangweilig hier!“, platzt es aus ihm heraus. Durch den Besuch hat er zumindest etwas Abwechslung von der immergleichen Routine aus Frühstück, Mittag und Abendessen, aus einer Stunde Freig ang auf dem Gefängnishof oder Gesprächen mit Mithäftlingen. Was ist das für ein Gefühl, eingesperrt zu sein, weil er sich kein Ticket leisten kann? „Das ist ein Scheißgefühl. Ganz ehrlich“, sagt Thomas. Dass er im Gefängnis einsitze, das habe er zwar letztlich selbst verbockt und er wolle niemandem dafür die Schuld geben. Trotzdem: „Mir ist völlig klar, dass es ungerecht ist, dass ich hier eingesperrt bin.“ Wer genug Geld auf dem Konto hat, könne eine Geldstrafe schließlich einfach bezahlen – für Thomas hingegen bleibt nur der Knast.
Wie viele Menschen wie Thomas ins Gefängnis müssen, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten, wird nicht erfasst. Schätzungen gehen von bundesweit mindestens 50.000 Betroffenen pro Jahr aus, rund jede:r Vierte von ihnen hat wiederholt kein Ticket für die U- oder S-Bahn gekauft. Drei von vier Menschen, die eine Ersatzfreiheits-
lich ein Haftbefehl gegen ihn erlassen – und vollstreckt. Seine Geldstrafe wird in Gefängnistage umgerechnet. Die sogenannten Tagessätze orientieren sich am Einkommen: Bei Thomas setzt das Gericht 30 Euro an. Das bedeutet: Die nächsten fünfzig Tage muss er in Haus 1, Station B, Haftraum 22 der JVA Billwerder verbringen.
Als Thomas auf seinen Rollator gestützt den Besuchsraum des Gefängnisses betritt, breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. «Es ist so stinklangweilig hier!» Durch den Besuch hat er zumindest etwas Abwechslung von der immergleichen Routine aus Frühstück, Mittagund Abendessen, aus einer Stunde Freigang auf dem Gefängnishof oder Gesprächen mit Mithäftlingen. Was ist das für ein Gefühl, eingesperrt zu sein, weil er sich kein Ticket leisten kann? «Das ist ein Scheissgefühl. Ganz ehrlich», sagt Thomas. Dass er im Gefängnis einsitze, das habe er zwar letztlich selbst verbockt, und er wolle niemandem dafür die Schuld geben. Trotzdem: «Mir ist völlig klar, dass es ungerecht ist, dass ich hier eingesperrt bin.» Wer genug Geld hat, könne eine Geldstrafe einfach bezahlen – für Thomas hingegen bleibt nur der Knast. Wie viele Menschen wie Thomas ins Gefängnis müssen, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten, wird nicht erfasst. Schätzungen gehen von bundesweit mindestens 50 000 Betroffenen pro Jahr aus, rund jede*r Vierte von ihnen hat wiederholt kein Ticket für die U- oder
strafe trifft, haben Studien zufolge keinen Job, jede:r Zweite ist langzeitarbeitslos. Bis zu 20 Prozent sind wohnungsoder obdachlos. Nicht wenige werden zufällig bei einer Polizeikontrolle gefasst. Ist die Zeit hinter Gittern auch eine Chance für Thomas? „Wie soll mir das hier helfen? Erholen kann ich mich natürlich. Aber es passiert nichts.“ Als er vor rund zehn Jahren zuletzt eine Ersatzfreiheitsstrafe in Billwerder absaß, habe er als gelernter Maler und Lackierer zumindest noch in der anstaltseigenen Lackiererei arbeiten können, erzählt Tho mas. Doch wegen seines schlechten Gesundheitszusta ndes ist der Drogenkranke, der im Gefängnis mit Methadon substituiert wird, heute nicht mehr in der Lage dazu. Zudem habe er Schlafprobleme im Knast, erzählt Thomas, bekommt nachts die Augen nicht zu und nickt tagsüber ein. „Aber ich verpasse ja sowieso nichts“, sagt er und schaut resigniert. Der Entzug der Freiheit, aller Selbstbestimmtheit – für Thomas wiegt das schwerer als der tägliche Überlebenskampf, den das Leben auf der Straße mit sich bringt. Höchstens einer besonders kalten Winternacht auf der Straße würde er die warme Zelle vorziehen. Aber den Zeitpunkt des Haftantritts aussuchen kann man sich nicht. Immerhin habe er in seinen ersten vier Wochen Gefängnis sieben Kilo zugenommen, berichtet Thomas. Und ein Mitarbeiter der Fachstelle „Übergangsmanagement“ habe ihm für die Zeit nach der Haft ein Zimmer in Aussicht gestellt. „Schauen wir mal, ob daraus etwas wird.“ Janina Elit will Menschen wie Thomas einen Weg aus dem Teufelskreis weisen. Die Sozialarbeiterin arbeitet für den Verein Integrationshilfen, im Auftrag der Stadt: Sie soll Häftlingen, die hilfebedürftig sind, die nötige Unterstützung zukommen lassen, damit sie nicht wieder im Gefängnis landen. Das Problem ist: Die Helferin kann immer seltener helfen. Wohnraum für Haftentlassene gebe es auf
„Wie soll mir das hier helfen ?“
Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas über die Zeit im Knast
dem Hamburger Wohnungsmarkt schon lange nicht mehr. Und Wohnprojekte speziell für Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, berichtet sie, sind ebenso voll belegt wie die städtischen Unterkünfte für Wohnungslose. „Im schlechtesten Fall müssen wir ans ,Pik As‘ verweisen“, sagt die Übergangsmanagerin. An eine Obdachlosen-Notunterkunft also, die nicht mehr bietet als ein Bett für die Nachtstunden. Die Sozialarbeiterin erzählt von einem Mann, den sie aus dem Gefängnis begleitet hat – und den sie nun bettelnd in der S-Bahn sieht, wenn sie von der Arbeit nach Hause fährt. Bei seiner Entlassung habe es keinen Platz zum Wohnen gegeben, berichtet Janina Elit – trotz aller Anstrengungen. Seine Verelendung macht ihr Sorgen: „Innerhalb kürzester Zeit scheint er um 15 Jahre gealtert.“ Diesem Mann könnte die Sozialarbeiterin immerhin helfen, wenn ein Platz in einer städtischen Wohnunterkunft frei würde. Bei Haftentlassenen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen sieht das anders aus: „Leute ohne Sozialleistungsansprüche entlassen wir auf die Straße.“ Wie viele Menschen in Hamburg aus dem Gefängnis (zurück) in eine Unterkunft oder auf eine Platte ziehen, wird laut Justizbehörde nicht erfasst. In Berlin liegt die Quote laut dortiger Justizverwaltung inzwischen bei

1 So bekannt wie beliebt: Hinz&Künztler Thomas auf Tour im Grindelviertel.
2 Wer kein Dach über dem Kopf hat wie Thomas, schläft auch mal in der S-Bahn.
3 «Wie soll mir das hier helfen?» Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas über die Zeit im Knast.
4 Viele Menschen haben Thomas vermisst – auch Kellnerin Sarita.
S-Bahn gekauft. Drei von vier Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe trifft, haben Studien zufolge keinen Job, jede*r Zweite ist langzeitarbeitslos. Bis zu 20 Prozent sind wohnungs- oder obdachlos. Nicht wenige werden zufällig bei einer Polizeikontrolle gefasst.
Ist die Zeit hinter Gittern auch eine Chance für Thomas? «Wie soll mir das hier helfen? Erholen kann ich mich natürlich. Aber es passiert nichts.» Als er vor rund zehn Jahren zuletzt eine Ersatzfreiheitsstrafe in Billwerder absass, habe er als gelernter Maler und Lackierer zumindest noch in der anstaltseigenen Lackiererei arbeiten können, erzählt Thomas. Doch wegen seines schlechten Gesundheitszustandes ist der Drogenkranke, der im Gefängnis mit Methadon substituiert wird, heute nicht mehr in der Lage dazu. Zudem habe er Schlafprobleme im Knast, erzählt Thomas, bekomme nachts die Augen nicht
zu und nicke tagsüber ein. «Aber ich verpasse ja sowieso nichts», sagt er und schaut resigniert.
Der Entzug der Freiheit, aller Selbstbestimmtheit – für Thomas wiegt das schwerer als der tägliche Überlebenskampf, den das Leben auf der Strasse mit sich bringt. Höchstens einer besonders kalten Winternacht auf der Strasse würde er die warme Zelle vorziehen. Aber den Zeitpunkt des Haftantritts aussuchen kann man sich nicht. Immerhin habe er in seinen ersten vier Wochen Gefängnis sieben Kilo zugenommen, berichtet Thomas. Und ein Mitarbeiter der Fachstelle «Übergangsmanagement» habe ihm für die Zeit nach der Haft ein Zimmer in Aussicht gestellt. «Schauen wir mal, ob daraus etwas wird.»
Janina Elit will Menschen wie Thomas einen Weg aus dem Teufelskreis weisen. Die Sozialarbeiterin arbeitet für den Verein Integrationshilfen, im Auftrag der Stadt Hamburg: Sie soll Häftlingen, die hilfebedürftig sind, die nötige Unterstützung zukommen lassen, damit sie nicht wieder im Gefängnis landen. Das Problem ist: Die Helferin kann immer seltener helfen. Wohnraum für Haftentlassene gebe es auf dem städtischen Wohnungsmarkt schon lange nicht mehr. Und Wohnprojekte speziell für Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, berichtet sie, sind ebenso voll belegt wie die Unterkünfte für Wohnungslose. «Im
Schwerpunkt Gefängnis
schlechtesten Fall müssen wir ans ‹Pik As› verweisen», sagt die Übergangsmanagerin. Das heisst an eine Obdachlosen-Notunterkunft, die nicht mehr bietet als ein Bett für die Nachtstunden.
Kein Platz zum Wohnen
Die Sozialarbeiterin erzählt von einem Mann, den sie aus dem Gefängnis begleitet hat – und den sie nun bettelnd in der S-Bahn sieht, wenn sie von der Arbeit nach Hause fährt. Bei seiner Entlassung habe es keinen Platz zum Wohnen gegeben, berichtet Elit – trotz aller Anstrengungen. Seine Verelendung macht ihr Sorgen: «Innerhalb kürzester Zeit scheint er um fünfzehn Jahre gealtert.»
Diesem Mann könnte die Sozialarbeiterin helfen, wenn ein Platz in einer städtischen Wohnunterkunft frei würde. Anders sieht es bei Haftentlassenen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen aus: «Leute ohne Sozialleistungsansprüche entlassen wir auf die Strasse.»
Wie viele Menschen in Hamburg aus dem Gefängnis (zurück) in eine Unterkunft oder auf eine Platte ziehen (so nennt man in Deutschland das Nächtigen auf der Strasse), wird laut Justizbehörde nicht erfasst. In Berlin liegt die Quote laut dortiger Justizverwaltung inzwischen bei 40 Prozent. Für Hamburg gehen Fachleute von rund

40 Prozent. Für Hamburg gehen Fachleute von rund einem Drittel aus. Rechnet man die vorliegenden Daten hoch, werden mindestens 1000 Menschen pro Jahr in Hamburg in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit entlassen. Übergangsmanagerin Janina Elit wünscht sich Reformen: „Die Menschen brauchen Unterstützung, nicht eine Strafe.“ Häufig fehle nicht nur die Wohnung: „Viele sind hoch verschuldet, nicht krankenversichert, nicht im Leistungsbezug, suchtkrank oder psychisch krank.“ Hier könne außerhalb des Gefängnisses viel besser geholfen werden. „Mein Wunsch wäre deshalb, dass es für Ersatzfreiheitsstrafler die Möglichkeit gäbe, die Haft abzuwenden.“ Grundsätzliche Fragen stellt auch der „Freiheitsfonds“: Die Initiative kauft Betroffene mithilfe von Spenden bundesweit aus Gefängnissen heraus und fordert, das sogenannte Erschleichen von Leistungen müsse endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Eine politische Mehrheit gibt es dafür aber (noch) nicht. Kürzlich haben sich Bundesländer und Ampel-Koalition darauf verständigt, Ersatzfreiheitsstrafen künftig neu zu berechnen. Die Folge: Betroffene werden nur noch halb so viel Zeit wie bish er im Gefängnis verbringen. Für die Haftanstalten bedeutet das eine Entlastung, für die Betroffenen nicht wirklich eine Hilfe.
Der Rechtsstaat könne es nicht akzeptieren, wenn bei den Geldstrafen fast die Hälfte der Urteile „konsequenzlos im Raum verhallt“, hatte Bundesjustizminister Marco
Buschmann (FDP) im Bundestag argumentiert. Damit bezog er sich auf Daten aus Schweden aus dem Jahr 2019. Demnach war dort 41 Prozent der Verurteilten ihre Geldstrafe erlassen worden, weil sie diese auch nach fünf Jahren nicht hatten bezahlen können. „Das kann sich der Rechtsstaat nicht leisten“, sagte Buschmann. Was er nicht sagte: Wa r um soll der Staat überhaupt weiterhin Menschen bestrafen, die in den allermeisten Fällen deshalb gegen Gesetze verstoßen, weil sie arm oder suchtkrank sind? Für Thomas hat sich nach dem Ende der Haft nichts geändert. Seine ersten Nächte verbringt er wieder auf der Straße, für einige Tage kann er in einem Notschlafzimmer des an die Drogenhilfeeinrichtung „Drob Inn“ angeschlossenen Projektes „Nox“ schlafen. Mit dem Übergangsmanager, der ihm im Gefängnis ein Zimmer in Aussicht gestellt hatte, hat er bislang nur einmal kurz telefoniert. „Ich muss mich dringend wieder bei ihm melden“, meint Thomas. Allerdings habe er in den ersten Tagen nach der Haftentlassung so viele Dinge regeln müssen: seinen Bürgergeld-Antrag beim Jobcenter, seine Methadon-Substitution beim Drob Inn und mehrere Arztbesuche. Er wisse gar nicht mehr, wo ihm der Kopf stehe. Und ohnehin sei er skeptisch, dass ihm der Übergangsmanager ein Zimmer verschaffen kann. An seinem Verkaufsplatz ist er freudig begrüßt worden. Wer mit Thomas den Grindelhof entlanggeht, muss alle paar Meter für einen Plausch stehen bleiben. Kellnerinnen kommen strahlend aus den Cafés gelaufen und umarmen
1 Eine Fahrkarte kann sich Thomas auch nach dem Knast nicht leisten. Leider.
einem Drittel aus. Rechnet man die Daten hoch, werden mindestens tausend Menschen pro Jahr in Hamburg in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit entlassen.
Übergangsmanagerin Janina Elit wünscht sich Reformen: «Die Menschen brauchen Unterstützung, nicht eine Strafe.» Häufig fehle nicht nur die Wohnung: «Viele sind hoch verschuldet, nicht krankenversichert, nicht im Leistungsbezug, suchtkrank oder psychisch krank.» Hier könne ausserhalb des Gefängnisses besser geholfen werden. «Mein Wunsch wäre, dass es für Ersatzfreiheitsstrafler die Möglichkeit gäbe, die Haft abzuwenden.»
Grundsätzliche Fragen stellt auch der Freiheitsfonds: Die Initiative kauft Betroffene mithilfe von Spenden bundesweit aus Gefängnissen heraus und fordert, das sogenannte Erschleichen von Leistungen müsse endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Eine politische Mehrheit gibt es dafür aber (noch) nicht. Kürzlich haben sich Bundesländer und Ampel-Koalition darauf verständigt, Ersatzfreiheitsstrafen künftig neu zu berechnen. Als Folge werden Betroffene nur noch halb so viel Zeit wie bisher im Gefängnis verbringen. Für die Haftanstalten bedeutet das eine Entlastung, für die Betroffenen nicht wirklich eine Hilfe.
Geld zusammengelegt und freigekauft
Der Rechtsstaat könne es nicht akzeptieren, wenn bei den Geldstrafen fast die Hälfte der Urteile «konsequenzlos im Raum verhallt», hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) im Bundestag argumentiert. Damit bezog er sich auf Daten aus Schweden aus dem Jahr 2019. Demnach war dort 41 Prozent der Verurteilten ihre Geldstrafe erlassen worden, weil sie diese auch nach fünf Jahren nicht hatten bezahlen können. «Das kann sich der Rechtsstaat nicht leisten», sagte Buschmann. Was er nicht sagte: Warum soll der Staat weiterhin Menschen bestrafen, die in den allermeisten Fällen deshalb gegen Gesetze verstossen, weil sie arm oder suchtkrank sind?
Wenige Tage nach dem Besuch im Gefängnis steht Thomas strahlend in der Hinz&Kunzt-Redaktion: Er hatte seine Stammkundin Susanne aus dem Gefängnis angerufen, um ihr zu sagen, dass sie sich nicht wundern soll, wenn sie ihn eine Weile nicht sehe. Susanne mobilisierte daraufhin andere Kund*innen von Thomas aus dem Grindelviertel. Die Gruppe aus Gastronom*innen und Anwohner*innen legte Geld zusammen und kaufte Thomas wenige Tage später aus dem Gefängnis frei. 480 Euro Geldstrafe waren da noch übrig, statt am 4. September ist Thomas schon am 19. August wieder ein freier Mann. «Ich bin Susanne und allen anderen so dankbar», sagt er.
Doch geändert hat sich für Thomas nach der Haft nichts. Seine ersten Nächte verbringt er wieder auf der Strasse, für einige Tage kann er in einem Notschlafzimmer des an eine Drogenhilfeeinrichtung angeschlossenen Projektes Nox schlafen. Mit dem Übergangsmanager, der ihm im Gefängnis ein Zimmer in Aussicht gestellt hatte, hat er bislang nur einmal kurz telefoniert. «Ich muss mich dringend wieder bei ihm melden», meint Thomas. Allerdings habe er in den ersten Tagen nach der Haftentlassung so viele Dinge regeln müssen: seinen Bürgergeld-Antrag
beim Jobcenter, seine Methadon-Substitution beim Drob Inn und Arztbesuche. Er wisse gar nicht mehr, wo ihm der Kopf stehe. Und ohnehin sei er skeptisch, dass ihm der Übergangsmanager ein Zimmer verschaffen könne. An seinem Verkaufsplatz ist er freudig begrüsst worden. Wer mit Thomas den Grindelhof entlanggeht, muss alle paar Meter für einen Plausch stehen bleiben. Kellnerinnen kommen strahlend aus den Cafés gelaufen und umarmen ihn. Man merkt, dass er hierhergehört. Mit Bus und Bahn wird er weiter unterwegs sein, notgedrungen auch ohne Fahrschein. Und immerhin: Ein Stammkunde von Thomas will ihm künftig das Deutschlandticket bezahlen. Noch lieber würde sich Thomas die Monatskarte selbst kaufen, doch ohne Bankkonto und mit seinem trotz Haft unverändert hohen Schuldenberg bei den Verkehrsbetrieben wird das schwierig. Er will trotzdem auf sie zugehen und versuchen, eine Lösung zu finden. «Ich bleibe an der Sache dran», sagt er kämpferisch. Denn noch mal im Knast zu landen, das will er mit aller Kraft verhindern: «Ich hoffe, das war mein letztes Mal.»
Auch für Hamburgs Steuerzahlende würde es sich lohnen, Thomas nicht wieder wegzusperren. 215 Euro kostet in Hamburg ein Tag Gefängnis pro Häftling. Das bedeutet: Gut 10 000 Euro kostet es, einen Menschen wie Thomas fünfzig Tage lang einzusperren, der nach dieser Zeit wie zuvor auf der Strasse lebt. Und der sich weiterhin keine Bahntickets leisten kann.
Was ein erster Schritt sein könnte, zeigt die Rheinbahn in Düsseldorf: Nach einer entsprechenden Weisung durch den Stadtrat verzichtet das kommunale Verkehrsunternehmen neuerdings auf Strafanzeigen gegen Menschen, die wiederholt ohne Fahrschein erwischt wurden. Im September hat sich der Bremer Senat dem Beispiel angeschlossen: Auch die dortigen Verkehrsbetriebe sollen angewiesen werden, künftig keine Strafanzeigen mehr wegen des Fahrens ohne Ticket zu stellen. Ein Vorbild für Hamburg? Die hiesigen Verkehrsbetriebe verweisen auf Nachfrage auf die Politik – und die hätte die Möglichkeit, Hamburg zum Vorreiter zu machen. Ein Antrag der Bürgerschaftsfraktion der Linken, der die grundsätzliche Abschaffung von Ersatzfreiheitsstrafen fordert, wurde kürzlich abgelehnt.
Text: Lukas Gilbert, Ulrich Jonas Fotos: Dmitrij Leltschuk Ausgabe: Okt. 2023
Verbreitung:
Hamburg (Deutschland)
Sprache: Deutsch gegründet: 1993
Auflage: 50 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: 500
Augustin Mode kann kreativ und mutig sein. (Vermeintliche) Geschlechtergrenzen aufzulösen sorgt aber immer noch für Aufruhr. In den letzten Jahren tut sich etwas.
Wer etwas über modische Kleidung wissen will, kann einfach mal auf die Strasse gehen. Man sieht weite Sakkos mit breiten Schultern, die von Frauen in weiten Hosen getragen werden. Ausserdem junge Männer mit lackierten Fingernägeln und Perlenketten um den Hals – nur wenige, sicher, aber immer mehr. Im Grunde können wir nicht wissen, welchem Geschlecht sich Personen zuordnen, wenn sie es uns nicht sagen.
In den letzten Jahren war «Genderless Fashion» (also «Geschlechtslose Mode»), im Fachjargon auch «Non-binary Fashion» («Nicht-binäre Mode») genannt, Thema in der Branche. Damit ist ein Kleidungsstil gemeint, der davon ausgeht, dass die Kategorien Frau und Mann auch bloss zwei Punkte in einem Universum an Geschlechtsidentitäten (Gender) sind.
Genderless Fashion kann bedeuten, dass Personen mit Kleidungscodes spielen, die allgemein als männlich oder weiblich gelten. Drag Queens und Kings und viele queere Menschen machen das schon lange vor. Seit einiger Zeit ziehen cis Männer nach. Harry Styles, britischer Sänger und

Schauspieler etwa, lässt sich in Tutu und Strumpfhosen genauso blicken wie im Anzug, liebt Pastell-Farben, enge Shirts mit Ausschnitt und war einer jener Männer, die die Perlenkette populär machten. Gewandet in ein glamouröses schwarz-weisses Rüschenkleid und ein frackähnliches Jäckchen war er 2020 als erster Mann auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen – einer der einflussreichsten Modezeitschriften der Welt. Pop-Star Janelle Monáe wiederum bedient sich gerne aus dem Fundus der gehobenen Männermode: schwarze Anzüge mit weissem Hemd und Fliege am Kragen. Für ihr modisches Herausfordern von Geschlechtergrenzen wird sie von vielen gefeiert.
Non-binary oder Genderless Fashion kann heissen, dass Modedesigner*innen auf die traditionelle Zweiteilung pfeifen und Kleidungsstücke herstellen, die keine Geschlechterlabel tragen. Damit umgehen sie, überhaupt erst in die Falle von engen Kategorien zu tappen, und versuchen, eine Art hierarchiefreie Stil-Welt zu erschaffen. Einige globale Modehäuser, in denen es
Warum gibt’s überhaupt Damenund Herren-Abteilungen? Mode kann spektakulär, kreativ und mutig sein. (Vermeintliche) Geschlechtergrenzen aufzulösen sorgt aber immer noch für Aufruhr. In den letzten Jahren tut sich etwas. Wird die Mode gleichberechtigter?
TEXT: RUTH WEISMANN FOTOS: CAROLINA FRANK
Wer etwas über modische Kleidung wissen will, kann einfach mal auf die Straße gehen. Abgesehen vom Herbst, der in Wien oft mit dunklen Farben und dicken Mänteln, Funktionsjacken und Jeans begrüßt wird (Farbe kommt vor, ist aber rar), sieht man auch weite Sakkos mit breiten Schultern, die von Frauen in weiten Hosen getragen werden. Wir sehen außerdem junge Männer mit lackierten Fingernägeln und Perlenketten um den Hals. Von den Letztgenannten gibt es nur wenige, sicher, aber immer mehr. Im Grunde können wir zwar nicht wissen, welchem Geschlecht sich Personen zuordnen, wenn sie es uns nicht sagen. Aber wie es auch sei, man merkt: Da liegt was in der Fashion-Luft. In den letzten Jahren war «Genderless Fashion» (also «Geschlechtslose Mode»), im Fachjargon auch «Nonbinary Fashion» («Nicht-binäre Mode») genannt, Thema in der Branche. Damit ist ein Kleidungsstil gemeint, der nicht für die binäre Geschlechterordnung von Mann und Frau steht, die wir alle gewöhnt sind, sondern davon ausgeht, dass die Kategorien Frau und Mann auch bloß zwei Punkte in einem Universum an Geschlechtsidentitäten (Gender) sind.
En Vogue. Genderless Fashion kann bedeuten, dass Personen mit Kleidungscodes spielen, die allgemein als männlich oder weiblich gelten. Drag Queens und Kings und viele queere Menschen machen das schon lange vor. Seit einiger Zeit ziehen Cis-Männer nach. Harry Styles, britischer Sänger und Schauspieler etwa, lässt sich in Tutu und Strumpfhosen genauso blicken wie im Anzug, liebt Pastell-Farben, enge Shirts mit Ausschnitt und war einer jener Männer, die die Perlenkette populär machten. Gewandet in ein glamouröses schwarz-weißes Rüschenkleid und frackähnliches Jäckchen war er 2020 als erster Mann auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen – einer der einflussreichsten Modezeitschrift der Welt. Pop-Star Janelle Monáe wiederum bedient sich gerne aus dem Fundus der gehobenen Männermode: schwarze Anzüge mit weißem Hemd und Fliege am Kragen. Für ihr modisches Herausfordern von Geschlechtergrenzen wird sie von vielen gefeiert. Non-binary oder Genderless Fashion auf der Ebene der Kleidung selbst kann
heißen, dass Modedesigner:innen auf die traditionelle Zweiteilung in Frauenund Männerkleidung pfeifen und Kleidungsstücke herstellen, die keine Geschlechterlabel tragen. Damit umgehen sie, überhaupt erst in die Falle von engen Kategorien zu tappen, und versuchen, eine Art hierarchiefreie Stil-Welt zu erschaffen. Einige globale Modehäuser der High-End-Industrie, in der es sonst Standard ist, Frauen- und/oder Männerkollektionen zu trennen, haben sich in den letzten Jahren mit Genderless Fashion beschäftigt. So etwa Balenciaga, deren Models verschiedener Gender bei der letzten Modeschau in schwarzen, flatternden, komplett körperverhüllenden Gewändern und in in High Heels über den Laufsteg stöckelten. Bei der italienische Marke Miu Miu hingen bei allen Models, darunter auch Männer, kurze Tennisröckchen an den Hüften, darüber bauchfreie Poloshirts im Schlabberlook. «In den vergangen Jahren hat das Thema nicht-binäre Mode während der Laufsteg-Präsentationen zugenommen», bestätigt Daniel Kalt, Modejournalist und Chefredakteur des Schaufenster, der Wochenendbeilage von Die Presse. «Oft hat sich das primär auf der Ebene des Castings ausgedrückt.» Gewisse Marken und Designer:innen hätten eine größere Sensibilität zum Thema Non-Binary und Genderless, und würden auch die Agenden der LGBTIQ+-Community aufgreifen, so Kalt. Auf Nachfrage bei den Pressestellen höre man: «Ja, wir sind Allies und stehen dem Thema nahe, aber, so habe ich das Gefühl, sie möchten nicht direkt sagen, dass sie non-binäre Mode machen. Man trifft mit der LaufstegPräsentation eine Aussage, aber gleichzeitig vermeidet man es auf dem kommerziellen Parkett, sich festzulegen», sagt Kalt. Seine Interpretation dieser Haltung: Es sind Modehäuser, die für perfekt auf Körper geschneiderte Kleidung stehen wollen und den Begriff nicht-binär scheuen würden.

Ein Teil von Modegeschichte besteht auch daraus, mittels Kleidung Statements zu setzen
Schneider:innenkunst. Nicht-binäre Marken gibt es allerdings, aber (noch) nicht viele. Das kleine Wiener Modelabel amaaena ist eines der wenigen, die sich auf nicht-binäre Mode spezialisiert haben. Designer:in Anna Menecia Antenete Hambira entwirft alle Stücke aller ihrer Kollektionen für alle. «Für mich ist wichtig, dass man Kund:innen nicht vorreglementiert. Das bedeutet Non-binary oder Genderless Fashion für mich» erklärt die gebürtige Bayerin. Sie sitzt in ihrem Atelier zwischen Nähmaschine und Kleiderständern und zeigt die letzte Kollektion aus Frotteestoffen, für die sie sich mit den Themen Empathie und Community beschäftigte. Weite Umhänge, Hosen, Taschen, Jacken, teils mit Slogans darauf. Sie selbst trägt ein weißes Ensemble aus knielanger Hose und langem Hemd, dessen Vorderseite im unteren Teil in zwei Bahnen verläuft. Beim Entwerfen von Schnittmustern sind Körperformen zentraler Bestandteil. Beine, Arme, Rumpf, ganz generell. Wieviel Platz braucht jemand im Schritt, wie viel um die Schultern oder am Oberkörper, wenn man ins Detail geht. Dass es biologische Vorgaben gebe, sei natürlich komplex, erklärt Hambira. «Es gibt schon Kleidungsstücke, wo es schwieriger ist. Aber man muss immer bedenken: Nur weil es ein biologisch männlicher Körper ist, heißt das ja nicht, dass es auch ein gender-männlicher Körper ist. Ich versuche Designlösungen zu finden, die es möglich machen, sich von diesen biologischen Unterschieden zu lösen.» Während sie den Gummizug ihrer Hose fester zurrt, erklärt sie die Entwurfsbasis ihres Outfits: «Bei dieser Kollektion habe ich die Größensysteme von Frauen und Männern
sonst Standard ist, Frauen- und/oder Männerkollektionen zu trennen, haben sich in den letzten Jahren mit Genderless Fashion beschäftigt.
«In den vergangenen Jahren hat das Thema nicht-binäre Mode während der Laufsteg-Präsentationen zugenommen», bestätigt Daniel Kalt, Modejournalist und Chefredaktor des Schaufenster, der Wochenendbeilage der österreichischen Zeitung Die Presse. «Oft hat sich das primär auf der Ebene des Castings ausgedrückt.» Gewisse Marken und Designer*innen hätten eine grössere Sensibilität und würden auch die Agenden der LGBTIQ+-Community aufgreifen, so Kalt. Aber «sie möchten nicht direkt sagen, dass sie non-binäre Mode machen. Man trifft mit der Laufsteg-Präsentation eine Aussage, aber gleichzeitig vermeidet man, sich festzulegen», sagt Kalt.
Nicht-binäre Marken gibt es (noch) nicht viele. Das kleine Wiener Modelabel amaaena ist eines der wenigen, die sich auf nicht-binäre Mode spezialisiert haben. Designer*in Anna Menecia Antenete Hambira entwirft alle Stücke ihrer Kollektionen für alle. «Für mich ist wichtig, dass man Kund*innen nicht vorreglementiert. Das bedeutet Non-binary oder Genderless Fashion für mich», erklärt die gebürtige Bayerin. Sie sitzt in ihrem Atelier zwischen Nähmaschine und Kleiderständern und zeigt die letzte Kollektion aus Frotteestoffen. Weite Umhänge, Hosen, Taschen, Jacken, teils mit Slogans darauf. Sie selbst trägt ein weisses Ensemble aus knielanger Hose und langem Hemd, dessen Vorderseite im unteren Teil in zwei Bahnen verläuft. Beim Entwerfen von Schnittmustern sind Körperformen zentraler Bestandteil. Beine, Arme, Rumpf, ganz generell. Wie viel Platz braucht jemand im Schritt, wie viel um die Schultern oder am Oberkörper, wenn man ins Detail geht. Dass es biologische Vorgaben gebe, sei natürlich komplex, erklärt Hambira. «Es gibt schon Kleidungsstücke, wo es schwieriger ist. Aber man muss immer bedenken: Nur weil es ein biologisch männlicher Körper ist, heisst das ja nicht, dass es auch ein gender-männlicher Körper ist. Ich versuche Designlösungen zu finden, die es möglich machen, sich von diesen biologischen Unterschieden zu lösen.» Während sie den Gummizug ihrer Hose fester zurrt, erklärt sie die Entwurfsbasis ihres Outfits: «Bei dieser Kollektion habe ich die Grössensysteme von Frauen und Männern zusammengenom-
3 4


1 Ein Teil von Modegeschichte besteht auch daraus, mittels Kleidung Statements zu setzen.
2 Anna Menecia Antenete Hambira (Foto l.) macht Genderless Fashion. Aus einer Kollektion (oben).
3 Faris Cuchi Gezahegn: fluides Styling
4 Durchdachte Details: goldene Knöpfe, schwarz-weisse Fingernägel.
5 Umhang und Hoodie von amaaena.
men und ein eigenes Grössensystem entwickelt. Dann muss man eine Lösung finden, um das Kleidungsstück am Körper anpassen zu können – die einfachste ist zum Beispiel ein Gummizug.»
Hambiras Entwürfe sind meist eher weit geschnitten, demnächst will sie aber auch mit dehnbaren Stoffen arbeiten, die schon von vornherein Elastizität bieten. Körper seien ohnehin alle anders, egal welchen Geschlechts, sagt Hambira. «Es ist ein sehr steifes Konzept, in das man Körper einsortiert.» In ihrer Jugend habe sie sich in «Jungs-Kleidung» am wohlsten gefühlt. Auch weil sie eine Art Schutz geboten hätten. Als sie später auch Röcke und Shirts mit Ausschnitt trug, sei ihr bewusst geworden, wie mächtig die Gendernormen sind. «Auch durch meinen Freundeskreis, in dem sich verschiedene Identitäten treffen, ist mir immer mehr bewusst geworden, wie verletzend so eine Zuweisung ist. Dass eine Person im kapitalistischen System so regle-

mentiert wird, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe will das anders machen.»
Ein Teil von Modegeschichte besteht auch daraus, dass mittels Kleidung Statements gesetzt werden, um die Verhältnisse zu verändern. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert etwa befreiten Frauen sich vom Korsett, das sie in schmale Taillen zwängte. Und als Frauen begannen, Hosen zu tragen, war das in westlichen Metropolen ein Skandal. «Damals war schon das Tragen einer Hose durch eine Frau gender-nonkonform, weil es die Gendercodes durcheinandergebracht hat», sagt Modeexperte Daniel Kalt. Hosen waren für Frauen an vielen Orten auch noch lange Zeit offiziell verboten. Kalt erinnert auch an die weiten Reformkleider, wie sie Emilia Flöge und Gustav Klimt in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts trugen, die jegliche Körperformen versteckten und damit eine Angleichung der Silhouetten hervorbrachten. Die Kleider waren Avantgarde, auf breite Resonanz stiessen sie nicht. In den 1970er-Jahren sorgte der 1938 in die USA geflohene Modemacher Rudi Gernreich mit seinem Unisex-Projekt für Furore und Skandal. Gernreich hinterfragte traditionelle Ideen von Körper und Kleidung und wollte Mode für die Zukunft machen; Mode, die von allen getragen wird. In den 1980ern war nicht nur Sängerin Grace Jones eine Ikone des androgynen Stils, sondern auch Frauen in Power-Suits – Hosenanzügen mit breiten Schultern – waren angesagt. Das Parfum CK One von Calvin
Klein war ein (Marketing-)Leuchtturm des Unisex-Trends der 1990er. Die 2000er brachten dann den «metrosexuellen» Mann hervor, mit Fussballer David Beckham als Role-Model – ein Mann, der sich gerne pflegt, auf Mode steht und seine «femininen Seiten» hervorstreicht.
Viele Annäherungen an eine Mode, die keine Geschlechtergrenzen kennt, scheiterten oft am Markt, so Daniel Kalt. «Der Modedesigner Jean-Paul Gaultier hat seit den 1990ern versucht, den Männerrock auf den Laufstegen populär zu machen. Und es gibt Thom Browne in New York, der für seinen Männerfaltenrock bekannt ist. Aber im normalen Einzelhandel spielt das kaum eine Rolle», stellt Kalt fest.
Sogar grosse Retailer wie H&M haben sich schon an genderneutralen Kollektionen versucht. Grundsätzlich gibt es inzwischen einige kleinere Labels, vor allem im angloamerikanischen und asiatischen Raum, die Kleidung unter der Überschrift «Genderless» oder «Gender neutral», wie es auch manchmal heisst, anbieten.
Anna Menecia Antenete Hambira hat mit ihrem Label ohnehin nicht vor, eine grosse Playerin auf dem Markt zu werden. Ihre Kund*innen, so sagt sie, seien nicht alle, aber viele als Frauen gelesene Personen, queere Personen, Schwarze Personen. «Die spreche ich auch bewusst an. Es geht mir überhaupt nicht darum, unsere Ästhetik wieder an die weisse Mehrheitsgesellschaft ranzubringen.» Damen- und Herren-Abteilungen mit getrenntem Sortiment sind immer noch Standard. Wenn geneigte Shopper*innen im Kindergeschäft des Vertrauens nach einer Hose für Zweijährige fragen und «Bub oder Mädchen?» als Antwort bekommen, wird klar, wie früh das Einüben der Zweiteilung der Geschlechter schon beginnt.
Faris Cuchi Gezahegn kauft Kleidung meistens in der Damen-, manchmal in der Herren-Abteilung. «Die violette Jacke, die ich hier trage, ist aus der Damen-Abteilung.» Gezahegn ist der Meinung, dass wir uns von eingelernten binären Regeln befreien sollten. Nicht nur modisch. Faris Cuchi Gezahegn definiert sich als «Femme non-binary» und ist Aktivist*in für Menschenrechte mit Fokus auf die LGBTIQ+Community, Künstler*in und Performer*in. «Ich nenne mich auch Style-Activist», so Gezahegn. «Ich nutze jede Gelegenheit, um die Dominanz der Heteronormativität zu dekonstruieren. Ich verwende Kleidung, Make-up, Schmuck und Stil auf eine Art,
die Menschen aus ihrer Komfortzone holt. Um aus der binären Dimension des Sehens auszubrechen. Weil mein Körper sich auf eine Art zeigt, wird von mir erwartet, mich auf eine bestimmte Art zu kleiden, auf eine bestimmte Art zu sein. Ich fordere diese Erwartung heraus.»
Damit macht Gezahegn klar, dass Mode und Stil immer auch politisch sind. Gezahegn trägt eine klare Message mit sich, die noch über die Frage nach Nicht-Binarität und Geschlechtsidentität hinausgeht: «Wir sollten alle körperlich selbstbestimmt sein, uns erlauben zu sein, wie auch immer wir sein wollen, und uns gegenseitig respektieren.» Faris Cuchi Gezahegn hat oft genug das Gegenteil erlebt, wurde auf der Strasse angegriffen. Anstatt sich einzuschränken, beschloss Gezahegn, zu sich selbst zu stehen. Gezahegns Lieblingsfarben sind Rot, Gelb, Grün und Violett, die sich oft in ihrer*seiner Kleidung, im Make-up und Schmuck wiederfinden. «Ich bin in Äthiopien geboren und aufgewachsen, mein Stil ist oft damit verbunden. Ich trage auch Dinge, von denen gesagt wird, sie sollen von Frauen getragen werden, oder von der königlichen Familie. Ich bin da ein Störimpuls.»
Genderless Fashion mag als Laufsteg-Trend wieder abflauen. Aber Trends sagen etwas über den Zeitgeist aus, nehmen oft auf, was abseits vom Laufsteg längst brodelt. Dass die Zukunft nicht binär ist, davon sind Faris Cuchi Gezahegn und Anna Menecia Antenete Hambira jedenfalls überzeugt.
Text: Ruth Weismann Fotos: Carolina Frank Ausgabe: 5.–18.10.2022
L'Itinéraire
Roboter: Hi! Salü, Kollege!
Verkäufer: Aber? Äh ... Wer sind Sie denn?
Roboter: Ich bin der Fortschritt, Alter.
Roboter: Vollständig automatisiert und mittels KI zum Leben erweckt. Ich werde nicht müde und kann fünfmal so viele Hefte verkaufen wie du.
Roboter: Darüber hinaus kann ich noch Artikel schreiben, das Layout machen und die Redaktion übernehmen.
Verkäufer: Aber? Aber? Das ist doch total idiotisch.
Verkäufer: Man kann doch nicht die Strassenverkäufer*innen durch Maschinen ersetzen! Es ist doch das Menschliche, das wir redaktionell umsetzen bei L’Itinéraire! Verstanden?
Roboter 2: Hey, kann ich ein Exemplar kaufen?
Roboter: Klar. Bezahlst du bar oder mit App?
Ausgabe: März 2024

Verbreitung: Wien, Niederösterreich, Burgenland (Österreich)
Sprache: Deutsch gegründet: 1995
Auflage: 14 000 Expl. erscheint: 2× monatlich Verkaufende: 480
Verbreitung: Montreal (Québec, Kanada)
Sprache: Französisch gegründet: 1994
Auflage: 8000 Expl. erscheint: 2× monatlich Verkaufende: 125


Verkäufer*innenp orträts
Ein Schuhmacher und sein Magazin «Ich denke, das wird mein letzter Job sein. Ich bin über 70, ich glaube nicht, dass noch viel kommt. Etwa 20 Jahre lang habe ich handgefertigte Schuhe hergestellt. Ich habe kein festes Gehalt bekommen, ich wurde für die Anzahl der Schuhe bezahlt, die ich gemacht habe. Das war vor etwa 40 Jahren, und die Bezahlung war anfangs noch in Ordnung, aber nach und nach wurde es schlechter. Als die aus China importierten Schuhe kamen, brach der koreanische Markt zusammen. Natürlich überlebten die grossen Fabriken, aber die kleinen mussten schliessen.
Danach habe ich acht Jahre lang als Parkplatzreiniger gearbeitet. Später habe ich dann Gebäude gereinigt. Unter den Reinigungskräften sind viele alte Leute. Manche Vorgesetzte sind auch über 70. Sie mögen es nicht, wenn du deine Arbeit gut machst, weil sie denken, dass du sie ersetzen könntest. Deshalb versuchen sie Gründe für eine Kündigung zu finden.
Etwa ein Jahr lang habe ich nicht gearbeitet. Als ich kein Einkommen hatte, zahlte ich die Miete manchmal nicht rechtzeitig. Aber ich habe die Miete nie ausgelassen. Um diese Zeit fand ich heraus, dass das Big-Issue-Büro einen neuen Verkäufer suchte. Gleich am nächsten Tag ging ich hin. Damals war ich auch mit meinen Handyrechnungen im Rückstand. Sobald ich dieses Wochenende meine ausstehende Telefonrechnung bezahlt habe, bin ich schuldenfrei. Es fühlt sich grossartig an. Ab sofort kann ich mit dem Sparen beginnen.
Wenn ich mal das Geld habe, würde ich gerne mit Bahn oder Bus durch das Land reisen. Ich wurde in Yoengju-dong, Busan, geboren – während des Koreakrieges. Ich kann mich kaum an meine Kindheit erinnern. Ich würde gerne dorthin fahren und auf das Meer und die Berge schauen.»
Hong Byung-chul verkauft The Big Issue Korea in Seoul. Text: An Deok-hee Foto: Hwagyeong Kim


«Ich mache Fortschritte»
«Mein Name ist Akash Hossain, ich komme aus Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Vor sieben Monaten kam ich nach Italien, wo ich meinen Vater in Südtirol wiedergetroffen habe. Mein Vater arbeitet schon seit Jahren hier. Dort, wo ich herkomme, gibt es keine Arbeit. Auch für mich nicht, obwohl ich gelernter Handymechaniker bin. Ich repariere alles: Apple, Samsung, Huawei … Geld konnte ich damit aber keines verdienen. Seit ich in Italien angekommen bin, versuche ich die Sprache zu lernen und eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Beides ist nicht einfach, aber mit der Sprache mache ich Fortschritte! Einfache Gespräche gehen schon ganz gut. Ich würde gerne einen Italienischkurs besu-

chen und habe mich schon in Meran, wo ich vorübergehend bei einem Freund wohnen darf, informiert. Leider ist bis Oktober kein einziger Platz mehr frei. Neben der Sprache ist es für mich schwierig, eine richtige Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Ich habe zwar schon alle Dokumente beantragt und meinen Finger auf zig Dokumente gedrückt, aber das Ganze dauert wirklich lang. Solange eine richtige Anstellung nicht möglich ist, verkaufe ich die Strassenzeitung Zebra. Mit den Einkünften kann ich die Wohnung und andere Notwendigkeiten bezahlen.»
Akash Hossain verkauft die Südtiroler Strassenzeitung Zebra in Vilpian, Terlan, Gargazon und Glurns. Text: Zebra Foto: Anna Mayr
«Die Zeitschrift ist meine finanzielle Grundlage» Mykaella Nazario wuchs in einer von Armut und Gewalt geprägten Gegend auf. «Mein Vater hat unser Haus angezündet.» Nach dem Brand lebte sie mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern ein Jahr lang in einer Notunterkunft. Mit sechzehn outete Mykaella sich als trans Frau und begann heimlich Hormone zu nehmen. Da sie keine Infos über Produkte und Dosierung hatte, führte dies zu gesundheitlichen Problemen. Im Alter von siebzehn Jahren begann sie mit Sexarbeit, um finanziell unabhängig zu sein. Sie sagt: «Eine trans Frau lebt in einer verborgenen Welt. Oder besser gesagt: sie überlebt. Ich gab eine Menge aus, um gut auszusehen. Aber ich habe gemerkt, dass ich es nicht für mich tue, sondern für die Kunden. Dann verlor ich mich in Drogen.» Als sie HIV-positiv diagnostiziert wurde, verstärkte dies den Wunsch, aus der Sexarbeit auszusteigen. Bei einer Beratungsstelle hörte sie von Traços. «Die Zeitschrift ist meine finanzielle Grundlage», sagt Mykaella. Nun hat sie ein Stipendium für eine Wirtschaftsschule bekommen. «Ich weiss, dass ich für viele praktisch ein Nichts bin. Aber für andere werde ich einmal jemand sehr Wichtiges sein.»
Mykaella Nazario ist Kulturbeauftragte der Strassenzeitung Traços in Brasilia. Text: Leonardo Lichote Foto: Dani Dacorso


«Grossen Teil der Reha finanzieren»
«Auf dem Weg zur Arbeit hatte ich letzten Sommer einen schweren Autounfall. Ich lag lange Zeit im Krankenhaus und hatte mehrere OPs. Zum Glück verlief alles gut. Meine Genesung ist noch im Gange, aber ich werde hervorragend versorgt und hoffe, dass ich bald vollständig gesund werde. Ich vermisse die Arbeit, den Verkauf des Magazins. Ich muss sagen, dass Verkaufen nicht immer einfach ist, man kann auf alle möglichen Leute treffen. Aber ich versuche immer positiv zu bleiben. Durch das Verkaufen habe ich auch neue Freund*innen gefunden, das gefällt mir am besten. Vor allem die Tatsache, dass ich zuhause etwas beitrage, freut mich. Durch den Verkauf verfüge ich über mein eigenes Geld. Es erfüllt mich auch, wenn Leute mich als Kiko von Lice v Lice («Von Angesicht zu Angesicht») erkennen. Manchmal kommen sie zu mir, um mit mir zu reden und mich zu fragen, wie es läuft.
«Was zählt ist, was in dir steckt» «Ich lebe in einer Familie, habe eine hübsche Frau und eine Plattenbauwohnung im neunten Stock. Aber es ist schwierig, auch mit der Strassenzeitung – der Krieg, die Inflation, Covid. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann zur Natur zurückkehren werden. Diese moderne Welt bringt uns um. In der heutigen ungarischen Gesellschaft hasst fast jeder jeden. Die Strassenzeitung aber gibt einem die Möglichkeit, etwas Sinnvolles zur Gesellschaft beizutragen. Wenn jemand im Jahr 380 000 Artikel in Form von 13 000 Zeitungen verkauft, dann gibt er etwas zurück. Wahrscheinlich tue ich es deshalb, um die Kluft zwischen den Schichten unserer Gesellschaft zu verringern. Wir müssen Tore finden. Und ich bin hier, um diese Lücke zu schliessen. Ich habe noch nie etwas geschrieben. Vielleicht, wenn ich mich eines Tages auf meinen Hintern setze, wenn ich in meinen eigenen 20 Quadratmetern zur Ruhe komme. Ich war lange auf der Strasse. Ich
Im Moment verbringe ich meine Zeit damit, fernzusehen und Musik zu hören. Darüber hinaus mache ich intensives Training bei einem Physiotherapeuten. Meine Mutter und mein Bruder sind meine grössten Stützen. Sie sind ständig bei mir. Natürlich standen mir auch alle meine Verwandten, Freund*innen und Kolleg*innen vom Roten Kreuz zur Seite, die mir unter anderem ein Fahrzeug für den Transport zur Verfügung stellten. Ausserdem hat mir die finanzielle Unterstützung durch Käufer*innen von Lice v Lice sehr viel bedeutet, denn die Kosten für einen Physiotherapeuten sind nicht gering. Durch den Verkauf konnte ich einen grossen Teil der Reha finanzieren, was für meine schnellere Genesung entscheidend ist. Ich danke allen!»
Kristijan «Kiko» Markovski verkauft Lice v Lice in Skopje (Nordmazedonien). Text: Magdalena Chadinoska-Kuzmanoski Foto: Tomislav Georgiev

bin immer noch als Obdachloser gemeldet. Für mich heisst das, dass man irgendwie nie wieder im Kreis der Wohnenden ankommt. Ich kann so nicht leben; Freiheit ist viel wichtiger.
Fedél Nélkül («Ohne Dach») gab mir Wertschätzung, Respekt und die Möglichkeit vorwärtszukommen. Sie beurteilen dich nicht danach, wie du aussiehst oder was du tust. Was zählt ist, was in dir steckt, wer du bist, was dein Wert ist. Viele Leute fragen, wie viel das Magazwin kostet. Auch das hat keinen Preis, es hat einen Wert, und der ist unbestimmt. (Anm. d. Red. Die Verkäufer*innen kaufen das Heft für umgerechnet 0.25 CHF pro Stück ein und geben es gegen eine nicht festgelegte Spende weiter.)
Auch die lower class kann der Gesellschaft etwas Schönes, Angenehmes, Langlebiges, Nützliches und Hochwertiges bieten. Schriften. Ziemlich gute Schriften.»
Szilárd Arszenievits verkauft Fedél Nélkül in Budapest. Text: Lilla Rothmann Foto: Gábor Csanádi
«Ich habe schon so viel Unglück überstanden»
«Ich bin in Athen geboren. 1997 verlor ich meine siebenjährige Nichte und Patentochter, meine Grossmutter und eine geliebte Cousine durch Krebs. Im Jahr darauf wurde ich selbst von Magenkrebs heimgesucht, nachdem ich mit 21 schon Brustkrebs überlebt hatte. Und dann verlor ich 2003 meinen Partner, mit dem ich 23 Jahre zusammen war, ebenfalls durch Krebs. Das hat mich gebrochen.
2012, in der Wirtschaftskrise, war ich gezwungen, meine chemische Reinigung zu schliessen. Ich hatte einen Kredit aufgenommen und schuldete überall Geld. Einen Monat später wurde ich aus meinem Haus vertrieben.
Ich schlief eine Woche lang mit meinen Hunden auf der Strasse. Ich sah hässliche Dinge. Eine Frau, die früher eine Kundin von mir war, fand mich und bot mir an, ich könnte in einem Abstellraum unterkommen. Ich fühlte mich überflüssig und dachte, ich sollte aufhören zu existieren. Ich tat etwas Verrücktes, aber zum Glück zog mich mein Hund zurück und rettete mich.
Die Zukunft macht mir Angst. Wenn etwas mit meiner Gesundheit schiefgeht, weiss ich nicht, was passieren wird. Aber ich sage mir, dass ich schon so viel Unglück überstanden habe. Ich habe Menschen, an die ich mich anlehnen kann. Shedia umarmt die Seelen der Menschen. Daran werde ich glauben, ganz gleich, was in meinem Leben passiert.»
Dimitra Piagou verkauft Shedia in Athen. Text: Eleni Kalamatianou Foto: Giorgos Vitsaropoulos

«Kommunizieren und Geduld haben»
«Es ist jetzt 15 Jahre her, dass ich angefangen habe, The Big Issue zu verkaufen. Ich weiss noch, dass die erste Zeitschrift, die ich verkaufte, Johnny Depp auf dem Cover hatte. An meinem Standplatz am Bahnhof Shinagawa gibt es viele Pendler*innen, sodass ich an Wochentagen morgens und abends viel verkaufe. Wenn ich ein paar Tage hintereinander nicht da bin, machen sich meine Stammkund*innen Sorgen um mich und fragen später: ‹Ich habe Sie in letzter Zeit nicht gesehen, ging es Ihnen nicht gut?› Früher habe ich auf dem Bau und in der Gebäudereinigung gearbeitet. Als ich arbeitslos wurde und auf der Strasse landete, fragte mich ein Bekannter, der
bereits Big-Issue-Verkäufer war, ob ich es nicht auch versuchen wolle. Am Anfang verkaufte ich nur ein paar Hefte, dann stieg die Zahl allmählich an. Mein Rekord liegt bei 83 Heften an einem Tag. In diesem Job muss man gut kommunizieren und Geduld haben. Ich schätze jedes einzelne Treffen mit den Kund*innen. Manche der alten Verkäufer*innen sind inzwischen verstorben. Aber warum über die harten Dinge reden? Ich bin jetzt Ende 60 und kann mich nicht mehr so sehr anstrengen, aber solange ich die Kraft habe, möchte ich hier weitermachen.»
Tomekuo Otsuka verkauft The Big Issue Japan am Konan-Ausgang, Bahnhof Shinagawa, Tokio. Text: Kazuhiro Yokozeki Foto: The Big Issue Japan
Brief an mein jüngeres Ich: «Gib nicht auf»
«Lynn, ich weiss, du bist erst 16 und sehr zerbrechlich, aber du musst ein paar Dinge wissen. Du bist zu Hause in Newcastle bei deiner Mutter und deinem Stiefvater traurig, genauso wie du bei deinem Vater und deiner Stiefmutter deprimiert warst, aber das Leben wird besser.

Das Leben ist nicht immer fair, vergiss das nicht. Hör jetzt auf zu kiffen. Du brauchst deine Leber für später, also trink bitte nicht weiter. Gras und Alkohol sind Depressiva, egal was andere dir sagen, also lass die Finger davon. Im Moment hasst du das Leben, weil nichts so läuft, wie du es willst. Aber gib nicht auf. Du wirst deinen Mann kennenlernen, er heisst Sean.
Du wirst mit 20 Jahren Mutter. Zwei Buben. Sei geduldiger, sei strenger. Geniesse die Elternschaft, solange du kannst: Ihre jungen Jahre werden nicht ewig dauern, auch wenn es sich so anfühlt. Sie werden dich sehr stolz machen. Geniess die Urlaube mit Onkel Bill und Tante Joan. Vertrau auf dich selbst. Nach einem Zusammenbruch, nachdem du clean geworden bist, trittst du einer Schreibgruppe bei. Dein erstes Gedicht wird in deinen Vierzigern veröffentlicht. Du wirst in Anthologien veröffentlicht, hier und in Übersee. Auch deine Acrylbilder werden bald in Ausstellungen zu sehen sein. Du hast eine Menge Geduld, also nutze sie. Sag Ja zu Sean – es werden die zehn besten Jahre deines Lebens. Irgendwann wirst du fast 48 sein und wissen, dass diese Ratschläge dir in Zukunft eine Menge Stress, Angst und Schmerz erspart hätten. Pass auf dich auf und vertraue auf dein Bauchgefühl.
In Liebe, deine Lynn xxxooo»
Lynn verkauft The Big Issue Australia in Newcastle, New South Wales. Text: Lynn Foto: Simone De Peak


«Teil von etwas Grösserem sein»
Obwohl erst 21 Jahre alt, hat Kae Wren schon ein langes Leben hinter sich. Geboren in Belarus, kam Wren mit acht Jahren in die USA. Dort wurde Wren von einer Baptistenfamilie in Tennessee adoptiert, wo «Blut dicker als Wasser ist». Dennoch ist Wren weiterhin überzeugt, dass eine echte Familie frei gewählt ist. Wrens Partnerin ist die Street-Roots-Verkäuferin Irida Wren. Als queere Menschen im konservativen Süden hielten sie sich aneinander fest. «Wir haben schon viele Schwierigkeiten zusammen durchgestanden, Obdachlosigkeit ist eine davon. Meine Partnerin war immer für mich da.»
In Portland fühlte sich Kae Wren von den queer-freundlichen Communitys angezogen, aber auch von der aktivistischen Kultur der Stadt und beteiligte sich an den
Black-Lives-Matter-Protesten. «Es war wirklich cool zu sehen, wie etwas, das in den Südstaaten nur im Fernsehen und in den Nachrichten auftaucht, für mich zum Leben wurde.» Der Aktivismus hilft Wren auch auf der persönlichen Ebene. «Er gibt mir etwas, auf das ich mich konzentrieren kann, und das Gefühl, Teil von etwas Grösserem zu sein.»
Wrens Aktivismus ist von ihrer leiblichen Mutter beeinflusst, einer linken Einwanderin aus Belarus. Als sich nach Jahren wiedertrafen, erfuhr Wren, dass die Familie jüdisch ist. Die Mutter habe gesagt: «Du hast ein Erbe, das du verteidigen musst.» Kae Wrens Grossvater ist Holocaust-Überlebender und lebt in Belarus.
Kae Wren verkauft Street Roots in Portland (USA). Text: Sasha Azizi Rosenfeld Foto: zVg

po telefonu. ‘Mami, doma sem. Gledam film. Ta teden bom doma in bom razmislil.’ ‘Boš nadaljeval v službi? Poklicala sem tja in jim povedala,
Vor zwei Tagen brachte man Luka, meinen Jüngsten, nach Ljubljana. In die geschlossene Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses. Während der Autofahrt rief er mich an und sagte, er habe keinen Ausweg mehr gesehen. In seinem Kopf war Chaos. Hätte er mehr Pillen gehabt, er hätte sie alle geschluckt. Er hatte auch Kokain genommen, aber es war nicht genug. Nicht genug, um all die Dilemmas und die Hoffnungslosigkeit zu beenden. Und dann bekam er Angst wegen der Übelkeit und hatte selbst die Hilfe gerufen, 112, aber es kam niemand, weil keine Krankenwagen verfügbar waren. Wer will sich schon mit einem Drogensüchtigen abgeben? Schliesslich kam Klemen, mein Ex-Partner. «Luka, komm, in Ljubljana wird dir geholfen.»
Fast jedes Mal, wenn Luka abstürzt, ist es so: Mein Ex-Mann rastet aus, ich weine, Vorwürfe wechseln die Seiten – wir wissen beide, dass wir in einer ausweglosen Situation stecken. Ich habe das Gefühl, dass mein Boot oben auf der Welle des Schicksals treibt und ich nicht weiss, in welche Gewässer die Wellen es tragen werden. Aber wenn es mir bestimmt ist, auf den
Felsen zu zerschellen oder auf Grund zu laufen, bin ich entschlossen, kein anderes Boot mit mir untergehen zu lassen.
Als Klemen mich am Abend anrief, sagte er, es sei ein bisschen zu glatt gelaufen, als dass Lukas Geschichte schon zu Ende sein könnte. Er bezweifelt, dass Luka sich auf eine lange Behandlungsreise begeben werde. Er habe sich nach Ljubljana fahren lassen, ohne Widerstand, er habe Angst gehabt und sich ergeben. Ich hörte zu und dachte, ich sollte Lukas Kopf streicheln, dieses grosse Kind, meine Nase in seinen Haaren vergraben, so wie früher, als sie nach Seife und Butter rochen, nach dem süssen Glück der Mutterschaft, klebrig wie Karamell.
Am nächsten Tag vereinbarte ich mit Lukas Arzt telefonisch eine Krankschreibung und rief bei Lukas Arbeit an. Luka verliess Ljubljana noch am selben Nachmittag. Er hatte sich gegen die Behandlung entschieden. Nicht alle Patient*innen wollen gesund werden, so wie auch nicht jeder, der zu Boden gestossen wird, wieder aufstehen will, denn das würde für ihn nur einen weiteren Sturz bedeuten, dieses Mal mit tödlichem Ausgang. Luka sagte, er sei nicht geisteskrank, nicht verrückt, und ging. Zuerst zu «seinen Freund*innen» für Stoff. Ihr Zuhause ist ein alter Wohnwagen. Bevor er wieder nach Radgona fuhr, kam er auch nach Hause. Zu seinem Vater. In unser früheres Zuhause. Meine Tochter erzählte mir am nächsten Tag, dass ihr Vater ihn sich wirklich «zur Brust genommen» habe. Er habe ihn angeschrien, hilflos wie er war, denn er hatte Angst um Luka, um sein Leben, denn diesmal war es knapp gewesen. Wir alle wussten das. Wir haben alle gezittert.
Aber die Autorität des Vaters war verschwunden. Wie kann man sein Kind davon überzeugen, sich nicht mehr zu vergiften? «Ich werde deine Rechnungen nicht mehr bezahlen! Dir bleibt nur noch die Behandlung in einer Therapie! Das ist dein Leben, fang an, es verantwortungsvoll zu leben!»
Luka kennt die Therapieeinrichtung, diese – in seinen Worten – kalte Heimat; das Leben dort ist asketisch, ohne Genuss, jeder muss sich mit sich selbst auseinandersetzen, und deshalb meidet er die Therapie um jeden Preis. Während er den Ausführungen seines Vaters zuhörte, habe er geschwiegen, Tränen hätten in seinen Augenwinkeln geglitzert, verborgen hinter der dicken Brille, traurig. Als er aus der Tür
ging, die seit vier Jahren nicht mehr zu seinem Zuhause führte, sei seine Schwester ihm nachgegangen. Draussen, vor dem Haus, habe sie ihn umarmt und ihm gesagt, dass sie ihn liebe.
Am nächsten Tag rief ich ihn an. Zuerst ging er nicht ans Telefon. Ich machte mir Sorgen – was, wenn er es wieder versuchte? Ich stellte ihn mir in einer winzigen Einzimmerwohnung vor, ganz allein. Schliesslich nahm Luka den Hörer ab.
«Mama, ich bin zu Hause. Ich schaue mir einen Film an. Ich werde diese Woche zu Hause sein und darüber nachdenken.»
«Wirst du weiterhin arbeiten? Ich habe dort angerufen und ihnen gesagt, dass du krankgeschrieben bist.»
«Nein. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich habe bereits meine Kündigung geschrieben.»
Meine Handflächen, die das Telefon hielten, waren schweissnass, meine Nägel schmerzten, Tränen stachen in meinen Augen, ich wollte schlafen, Nächte ohne Träume, einen neuen Morgen, ich wollte vergessen. Das Schwierigste ist, über Dinge zu sprechen, die man selbst noch nicht verstanden hat.
Text: Erazem Ausgabe: Jan. 2024
Verbreitung: Ljubljana und in ganz Slowenien Sprache: Slowenisch gegründet: 2005
Auflage: 15 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: 120
Es waren die Chinesen, die Italiener und die Engländer, die den Grundstein legten für den Fussball, wie wir ihn heute weltweit kennen. In Mesoamerika spielten die Maya sowie Angehörige der Kulturen der Olmeken und Totonaken und von Teotihuacán das Ballspiel «Pelota». Für den mexikanischen Schriftsteller Octavio Paz beinhaltet jede kultische Handlung ein spielerisches Element: «Der Ritus, der die Kontinuität der Welt und der Menschheit bewahren soll, ist eine Nachahmung des göttlichen Spiels, eine Darstellung des ursprünglichen schöpferischen Akts.»
Bei «Pelota» ist das zentrale Element ein Gummiball: Er hat einen Durchmesser von acht bis zehn Zentimetern. Das Material zu seiner Herstellung wird aus dem Olcuahuitl (Gummibaum) gewonnen, es hat eine natürliche Elastizität. Der Name «pelota de hule» leitet sich von den Wörtern «ulli» (Gummi oder Kautschuk) und

«ollin» (Bewegung) ab. Die Olmek*innen waren auch als die Bewohner*innen des Landes des Gummis bekannt. «Pelota» kommt in verschiedenen mesoamerikanischen indigenen Sprachen vor; auf Nahuatl heisst es «tlachtli» und «ullamaliztli», in Matlatzinca «nibahatzi», in Zapotec «taladzi» und in Maya «pok ta pok».
«Ullama» oder «tlachtli» bedeutet, dass man mit den Hüften oder dem Gesäss den Ball spielt. Das Spielfeld wird «tlachco» genannt, es hatte die Form eines Doppel-T, in der Mitte schmal und hinten breit. Die Mittellinie des Spielfelds wurde «tlecotl» genannt und der Steinring, durch den der Ball lief, «tlachtemalácatl». Jede Mannschaft bestand aus drei Spielern, die nur ein Leder oder «chimalli» (Schild) um die Hüften gebunden hatten, um ihre Geschlechtsorgane zu schützen. Bei Ausgrabungen wurden aber auch Figuren mit Handschuhen und Knieschonern gefunden.
Der mexikanische Archäologe Alfonso Caso (1896 –1970) wies darauf hin, dass «das Spiel darin bestand, den Ball von einem Feld zum anderen zu schicken, immer über die Linie in der Mitte, aber wenn es einer der Mannschaften gelang, den Ball durch einen der Ringe zu spielen, die in die Seitenwände eingelassen waren, gewann sie das Spiel». Bei dem Spiel handelt es sich um ein kosmisches Ritual, das Spielfeld ist ein Tempel, in dem Licht und Dunkelheit kämpfen, und der Ball steht für die Planeten, die Sonne und den Mond. In der mesoamerikanischen mathematischen Kosmologie steht die Zahl 9 für die Nacht und die Dunkelheit, genannt «Mictlan»; und die Zahl 13 für den Tag und das Licht, genannt «Tonalkalko». Es ist doch merkwürdig, dass Mexiko ausgerechnet Gastgeber der 9. (1970) und 13. (1986) Ausgabe der Fussballweltmeisterschaft war. Ein reiner Zufall?
Fussball ist auch eine universelle Sprache, ein Spiel und ein Sport – und ein Ritual, das mit dem Erzielen eines Tors im gegnerischen Feld seine Vollendung findet. Fussball ist der Mannschaftssport, der heute weltweit am meisten gespielt wird, er fördert das Sozialverhalten und die Gemeinschaft schon bei Kindern. Wegen der medialen, historischen, touristischen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Auswirkungen ist die Fussballweltmeisterschaft deshalb ein gesellschaftliches Ereignis. Tlazocamati, Danke.
Text: Javier Vizcaya (Verkäufer seit 2021)
De forma inconsciente, la práctica del futbol soccer es un idioma universal, es juego y es deporte, es un ritual que se consuma cuando cae un gol, una anotación en la cancha rival. El futbol es el deporte de equipos más jugado por todas las naciones, promueve la socialización y el compañerismo desde la infancia. Por eso los mundiales de futbol son un fenómeno sociológico tanto por su impacto mediático como histórico, turístico, político, económico, cultural y social. Tlazocamati
Fueron los chinos italianos e ingleses quienes sentaron las bases del Futbol soccer En Mesoamerica, mayas, olmecas, teotihuacanos y totonacas practicaron el juego de pelota. Para Octavio Paz, todo rito tiene un elemento lúdico. “El rito, destinado a preservar la continuidad del mundo y de los hombres, es una imitación del juego divino, una representación del acto creador original”. En el juego mesoamericano, la pelota de hule es el elemento central: tiene de 8 a 10 centímetros de diámetro, su material se extrae del olcuahuitl (árbol del hule), y su nombre deriva de las palabras ulli (hule o caucho) y ollin (movimiento); por eso tiene una elasticidad natural. Recordemos que a los olmecas se les conoció como los habitantes del país del hule. Al juego de pelota se le conoce en diferentes idiomas; en náhuatl es tlachtli y ullamaliztli; en matlatzinca, nibahatzi; en zapoteca, taladzi; y en maya, pok ta pok Ullama o tlachtli significa jugar a la pelota con las caderas o nalgas. Al campo de juego se le denomina tlachco; tenía la forma de doble T, angosto en el centro y ancho en la retaguardia. A la raya central del campo le llamaban tlecotl y al anillo de piedra por donde pasaba la pelota, tlachtemalácatl. Participaban tres jugadores por cada equipo, llevando sólo un cuero o chimalli en la cintura como protección para los órganos sexuales. Aunque también se han encontrado figurillas con guantes y rodilleras. Alfonso Caso señala que “el juego consistía en mandar la pelota de uno a otro campo, pasando siempre la raya que estaba en medio, pero si uno de los equipos lograba pasar la pelota por uno de los anillos que estaban empotrados en las paredes laterales, ganaba el juego”. Se trata de un ritual cósmico, la cancha es un templo donde la luz y la oscuridad combaten, y el balón representa a los planetas, el sol y la luna. En la cosmovisión matemática mesoamericana, el número 9 representa la noche, la oscuridad, el Mictlán; y el número 13, el día, la luz, el Tonalkalko. Curiosamente, a México le tocó organizar las ediciones 9 (1970) y 13 (1986) del mundial de futbol. ¿Será mera coincidencia?
Vizcaya (Valedor desde 2021)
Arturo Soto Col. Tlazintla, Iztacalco
Verbreitung: Mexico City (Mexiko)
Sprache: Spanisch gegründet: 2015
Auflage: 4000 Expl. erscheint: 5× jährlich Verkaufende: 35
Curbside Chronicle Angehörige indigener Gemeinschaften in Oklahoma machen sich Gedanken zum Film «Killers of the Flower Moon», der für zehn Oscars nominiert wurde.
Der Film «Killers of the Flower Moon» enthält während seiner dreieinhalbstündigen Laufzeit mindestens eine überwältigende Wahrheit. Dieser Film ist viele Dinge gleichzeitig. Dieses historische Drama – es ist aber auch eine tragische Romanze, ein düsterer Western, ein Rechtsdrama und ein Krimi – hat einem weltweiten Publikum die Widerstandskraft des Volkes der Osage gezeigt. Ausserdem ist es eine der grössten Produktionen – mit einem Budget von 200 Millionen Dollar –, die jemals im Bundesstaat Oklahoma gedreht wurden. Ein Grossteil des Films wurde in Osage County aufgenommen.
Und diesen Monat könnte er auch bei der Oscar-Verleihung als bester Film ausgezeichnet werden. Mit der Nominierung von Lily Gladstone, die als erste Indigene überhaupt für einen Academy Award nominiert war, hat der Film bereits Geschichte geschrieben. (Anm. d. Red.: Er war für zehn Oscars nominiert, unter anderem als «Bester Film» und Lily Gladstone als «Beste Darstellerin», ging dann aber leer aus.) Gladstone stammt von den Blackfeet und Nez Percé ab.
Der Fokus dieses Textes soll sein, die Sichtweise von Indigenen zu zeigen, die heute in Oklahoma leben. Aber Vorsicht! Sie sind keine homogene Gruppe. Jede Person hat ihren eigenen Hintergrund, ihre eigene Herangehensweise und ihre eigene Perspektive, aber all diese Menschen teilten eine universelle Hoffnung: dass dies die Tür zu weiteren Geschichten öffnen könnte. Die folgenden Äusserungen aus schriftlich geführten Interviews wurden bearbeitet und gekürzt.
Micah Heath, Osage Nation
«In meiner Familie wurde so gut wie nie über die ‹Reign of Terror› gesprochen, obwohl ich mehrere Vorfahren habe, die ihr zum Opfer fielen. Meine Urgrossmutter, die mich aufzuziehen half, lebte während

Der Film «Killers of the Flower Moon» zeigt, wie im frühen 20. Jahrhundert gierige Weisse in Oklahoma die gerade erst durch Öl vermögend gewordenen Osage ausbeuteten. Als Osage Headright wird die Kopfpauschale bezeichnet, die zum Empfang einer vierteljährlichen Zahlung aus dem «Osage Mineral Estate» berechtigt, der die Öl- und Gasvorkommen der Osage Nation verwaltet. «Reign of Terror» ist der Begriff für die Mordserie an über 60 Angehörigen der Osage zwischen 1910 und 1930, um an diese Headrights zu kommen. WIN
dieser Zeit und hatte ein sogenanntes Osage Headright, sprach aber nie darüber. Ich war mir der Morde vage bewusst, da ich ein paar YouTube-Videos gesehen und Artikel überflogen hatte, aber ich interessierte mich nicht besonders dafür, bis ein Todesfall in der Familie dazu führte, dass ich einen Bruchteil eines Headrights erbte. Ich fühlte mich verpflichtet, genau zu erfahren, wie ich und meine Familie in dieser ganzen Sache verortet sind. Darum tauchte ich tief in die Geschichte der Osage ein.
Am Anfang war ich ziemlich begeistert vom Filmprojekt, weil der Grossteil der Dreharbeiten in meiner Heimatstadt Pawhuska stattfand. Ich wusste, dass sie sich
Native viewers in Oklahoma reflect on seeing the film “Killers of the Flower Moon,” which has been nominated for 10 Oscars, and how its representation on the big screen made an impact.
Story by Nathan Poppe Illustrations by Abbie SearsThe film “Killers of the Flower Moon” holds at least one overwhelming truth during its three-and-a-half-hour runtime. This movie is a lot of things. The historical drama — it’s also a tragic romance, a gritty western, a legal drama and a crime thriller — has created an opportunity for a worldwide audience to learn more about the resilience of the Osage people and their deft ability to collaborate with some of Hollywood’s most revered and technical filmmakers. It is the origin story of the Federal Bureau of Investigation told through a different lens than author David Grann’s source material. It is also one of the biggest productions — with a budget of $200 million — to have ever been shot in the state of Oklahoma. Much of the movie was filmed throughout Osage County. And this month, it might also be Best Picture at the Oscars. It has already made history with its nomination for Lily Gladstone, the first Native individual from the U.S. to receive a nod for a competitive acting Academy Award. Gladstone has Blackfeet and Nez Percé heritage. Her portrayal of Mollie Kyle is in and of itself an achievement — a stirring, quiet revelation that holds its own while a storm of deceit slowly encircles her character. “Killers of the Flower Moon” is certainly not the last time you’ll see Gladstone’s name in lights. These are just some of the things. I could go on, but the focus of this story is to share the thoughts of Native viewers living in Oklahoma today. Be aware. They are not a monolithic group. Each person has their own background, practices and perspectives that are their own, but multiple individuals shared a universal hope: that this story could open the door for more stories. The following reflections have been edited and condensed for clarity from email interviews.
- 27 -

grosse Mühe gaben, die Osage adäquat zu porträtieren. Und doch wurde mir langsam unwohl. Aus ersten Kritiken wusste ich, dass der Film tadellos gemacht war und auch von Chief Standing Bear und anderen hochrangigen Osage abgesegnet worden war. Also machte ich mir keine Sorgen um Qualität oder Genauigkeit – aber ich begann mich zu fragen, was der Film mit mir persönlich machen wird. Stellen Sie sich vor, Sie wären aufgewachsen, während ein versuchter Völkermord an Ihrer ganzen Familie fast komplett verdrängt wurde, und werden dann als Erwachsener voll damit konfrontiert.
Ich fühlte mich emotional verletzlich, nicht unbedingt deprimiert oder verärgert,
aber auf jeden Fall aufgewühlt. Das sind Dinge, für die du lange brauchst, um sie zu verarbeiten, nachdem du sie gesehen hast. Die Schauspieler *innen, die Kulissen, die Kameraführung, die Musik. Alles hat den Ton perfekt getroffen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich die Ereignisse in Echtzeit auf der Leinwand abspielten. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, dass unsere Geschichte nicht sozusagen im Wilden Westen geendet hat. Ich hoffe auch, dass den Zuschauer*innen bewusst wird, dass viele von uns immer noch mit einem transgenerationalen Trauma leben. Das ist nicht vergeben und vergessen und eine alte Geschichte. Sie ist unseren Grosseltern passiert. Und sie hat mich dazu ge-
bracht, meine eigene Familie in einem anderen Licht zu betrachten, und hat für mich einiges neu in den Fokus gerückt.»
Annawake Grubbs, Osage Nation «Ich bin sehr vertraut mit der Geschichte der Osage während der ‹Reign of Terror›. Meine Urgrossmutter dritten Grades, Grace Bigheart, war die ältere Halbschwester von Mollie, Anna, Rita und Minnie (Anm. d. Red.: die als Figuren im Film vorkommen). Solange ich denken kann, hat meine Familie jedes Jahr ihre Gräber geschmückt. Ich werde nie vergessen, wie mein Grossvater an den Gräbern seiner Familienmitglieder vorbeiging und uns allen erklärte, was mit jedem Einzelnen von ihnen geschehen war. Als Kind fiel es mir schwer, die schrecklichen Dinge, die geschehen waren, zu begreifen.
Auch ich habe gemischte Gefühle in Bezug auf diese Geschichte. Da sie aus der Sicht von Ernest erzählt wird (Anm. d. Red.: gespielt von Leonardo di Caprio), kamen mir die Osage wie Aussenseiter*innen vor. Das Publikum wird zu den Figuren der Osage eher auf Distanz gehalten, und ich habe nicht das Gefühl, dass die Zuschauer*innen eine Nähe zu ihnen aufbauen können. Was die Menschen empfinden ist komplex, und für mich hat die Regie diese Komplexität durch Ernests Perspektive auch bewusst dargestellt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Ernests Emotionen tatsächlich so tiefgründig waren, wie sie dargestellt werden. Ich möchte aber unbedingt festhalten, dass Lily Gladstones Darstellung ergreifend und würdevoll ist.
Ich weiss es zu schätzen, dass sie sich für Informationen über unsere Kultur und Traditionen an meinen Stamm gewandt haben, und ich habe auch den Eindruck, dass sie den kulturellen Berater*innen wirklich zugehört haben. Ich fand es toll, dass die Figuren genau so vom Osage ins Englische wechselten, wie mir mein Grossvater diese Art zu sprechen immer erklärt hat, und es war sehr speziell für mich, das auch zu hören. Das Buch und der Film sind grossartige Beispiele dafür, dass etwas Tolles entstehen kann, wenn man sich dafür entscheidet, zuzuhören und zu lernen, bevor man spricht. Das war ein wirklich schöner Film. Obwohl ich mich manchmal unwohl gefühlt habe, habe ich ihn wirklich genossen. Ich bin so dankbar, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen können, in der ihr Volk auf grosser Bühne repräsentiert und gewürdigt wird.»
1 Lily Gladstone, links, spielt Mollie Kyle in «Killers of the Flower Moon», Regie: Martin Scorsese.
2 «Das Buch und der Film sind grossartige Beispiele dafür, dass etwas Tolles entstehen kann, wenn man sich dafür entscheidet, zuzuhören und zu lernen, bevor man spricht.» – Annawake Grubbs
3 Vier Osage-Schwestern (gespielt von JaNae Collins, Lily Gladstone, Cara Jade Myers und Jillian Dion, v.l.n.r.) wurden wegen ihrer Ölrechte in Oklahoma verfolgt.
4 «Mutige Seelen wie die im Film sind der Grund dafür, dass unsere Kulturen noch existieren.» – Kyle Impson
Micah Heath Osage Nation
My family almost
about the Reign of
I
Mark Ruedy, Seminole Nation
«Als ich jünger war, gab es zwei Arten von Darstellungen indigener Menschen: Entweder sie waren primitiv und ungehobelt oder aber absolut fertige oder faule Typen. Diese Darstellungen quälten mich als Kind und brachten mich fast dazu, die lebendige Kultur und kollektive Intelligenz meines Volkes zu verleugnen. Das alles stand in einem solchen Gegensatz zu den historischen Normen, die ihrer Darstellung zugrundegelegt wurden. Ich möchte also, dass die Menschen uns – insbesondere die Osage – ohne diese antiquierten Massstäbe und ohne Mitleid betrachten.
Alles fühlte sich gut recherchiert an und adäquat adaptiert für die Leinwand. Am Schluss macht Regisseur Martin Scorsese eine Umkehr dieser Faktentafeln, die es typischerweise am Ende von Filmen hat, die auf wahren Begebenheiten basieren –ich fand das ergreifend schön. Ich empfand ein Gefühl der Genugtuung; ich gewann einen Teil meines Lebens zurück, der nicht an eine würdige Darstellung der Ureinwohner*innen in den Medien gewöhnt

getting hit with it, fully, as an adult.
I felt emotionally raw, not depressed or upset necessarily, but definitely affected. It’s one of those things you continue to process long after you’ve seen it. The acting, sets, cinematography, music. Everything perfectly set the tone. It really did feel like I was watching the actual events play out on screen. In a broad sense, I hope people realize that our stories didn’t end in the wild west. I also hope audiences realize that many of us still live with generational trauma. This isn’t ancient history. This happened, literally, to our grandparents. It even caused me to look at my own family in a different light and brought some things into focus for me personally.
Annawake Grubbs Osage Nation
I am very familiar with the history of what happened to the Osage during the Reign of Terror. My third-great-grandmother, Grace Bigheart was the older half-sister of Mollie, Anna, Rita and Minnie. My family has annually decorated their graves for as long as I can remember. I will never forget my grandpa walking past each one of his family members’ graves explaining to all of us what happened to each one of them. As a child, it was hard to wrap my mind around the terrible things that had occurred.
I do have some complicated feelings regarding my experience, too. Because the story is told from Ernest’s point of view, the Osage people felt like outsiders to me. The audience is still held at a distance from the Osages, and I do not feel as if most viewers had a personal connection to the Osage characters. Human emotion is complex, and I do believe that the director intentionally showed that complexity
singers as they play a large drum.
“Congratulations to all Oscar nominees for ‘Killers of the Flower Moon’; we are overjoyed that the hard work put into making this film is being celebrated,” Osage Nation Principal Chief Geoffrey Standing Bear said in a statement.
“Osage Nation is especially proud that Osage composer Scott George, consultants Kenny and Vann Bighorse, and all our tribal singers are receiving this extraordinary recognition for ‘Wahzhazhe (A Song For My People).’ For us, there’s nothing better than hearing our singers around the drum. We are pleased that the Academy members recognize the strength and beauty behind this song.”
Via Brandy McDonnell, The Oklahoman
war. Lily Gladstone trug mit ihrer Rolle die Last des Leids, das zu dieser Zeit nicht nur das Volk der Osage, sondern meiner Meinung nach alle indigenen Volksgruppen zu tragen hatten. Ihre Darstellung gab einer ganzen Generation ihren Frieden zurück, die noch nie eine korrekte Darstellung ihrer Geschichte erlebt hatte.
Ich hoffe, dass diese Geschichten weitergehen. Nicht nur für mich und meine Familie, sondern auch für andere. Vor allem für diejenigen, die in Oklahoma aufwachsen. Der Bildungsstand über die Geschichte der Native Americans an den öffentlichen Schulen dieses Bundesstaates war bisher unterirdisch. Und bei dem Wind, der im Bildungswesen heute weht, sind Geschichten wie diese vielleicht das Einzige, was das Wissen ganz vor dem Verschwinden bewahrt.»
Kyle Impson, Choctaw Nation «Zu Beginn war ich mit der Geschichte des Films nicht vertraut. Mein Vater war über dreissig Jahre meines Lebens in leitender Funktion für das Bureau of Indian Affairs
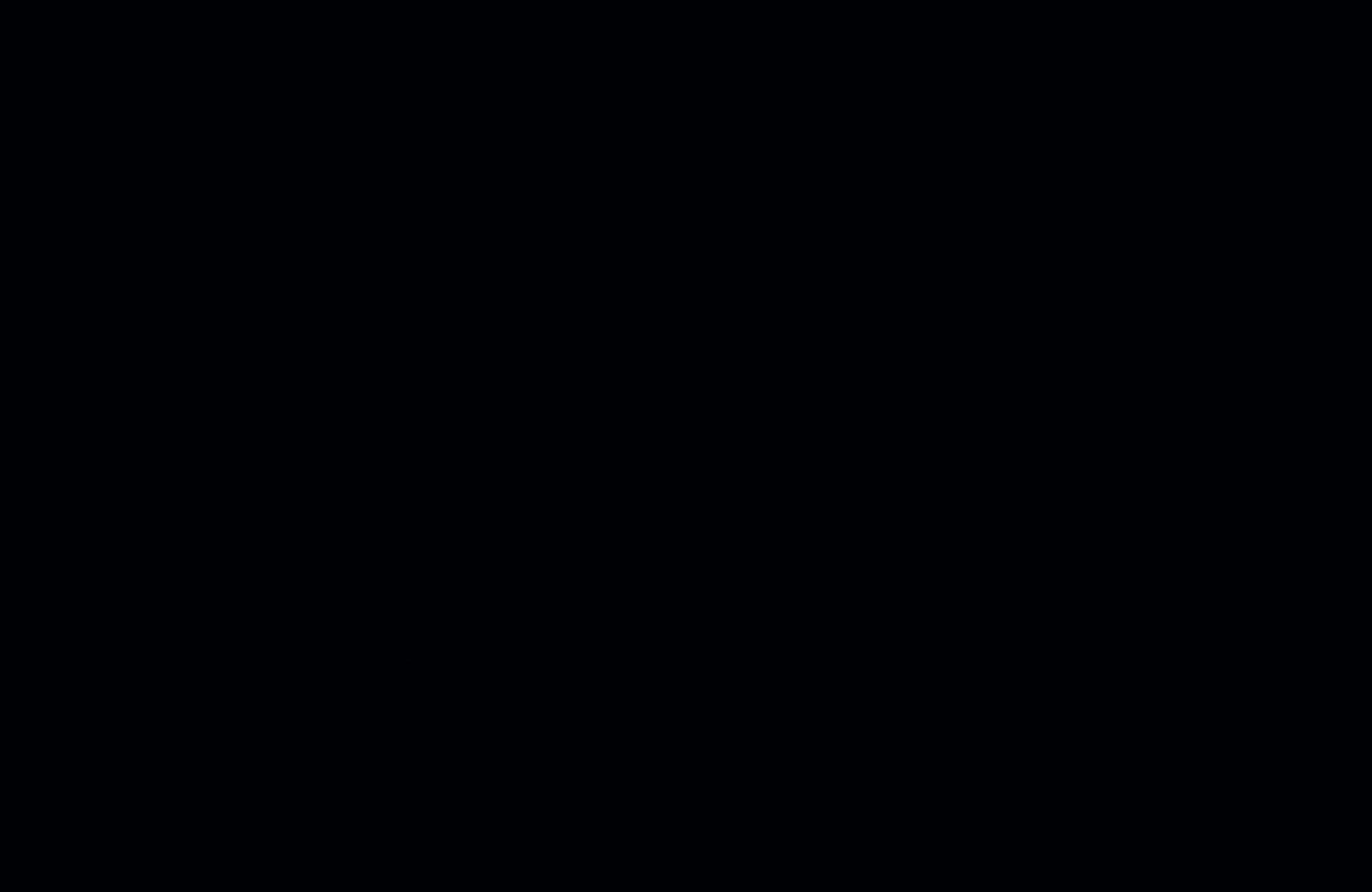

isfaction and a reclamation
it. I am so grateful that my children get to grow up in a world where their people are represented and honored in such a big way. Mark Ruedy Seminole Nation
I had looked forward to seeing the film since it was announced. Initially my expectations may have been on the lower end. However, due to recent depictions of Native people in the media — especially for my people through Sterlin Harjo’s TV show “Reservation Dogs” — they grew steadily.
Depictions of Native people when I was younger came in two varieties: primitive, crude people or beaten-down, lazy people. These depictions plagued me as a child and almost convinced me to renounce my peo-
Everything felt well researched and translated to screen. Nothing seemed half done. At the end, director Martin Scorsese did a twist on the fact panels typically found at the end of a true story film that I found hauntingly beautiful. I felt a sense of sat-
tätig (Anm. d. Red.: Behörde des US-Innenministeriums, das für die Reservate und seine Menschen zuständig ist). Die Diskussionen mit ihm über die Osage drehten sich eher um Dinge wie die Mineralienrechte und dass sie als souveräne Nation ihre Eigentumsrechte und Autorität ausüben können – gemäss dem Vertrag, der ausgehandelt wurde, als sie gewaltsam nach Oklahoma umgesiedelt wurden.
Ehrlich gesagt wurde mir schlecht, als ich den Film im Kino sah. Während einige der Leute, mit denen ich die Vorführung besuchte, sich über die Länge des Films beklagten, war ich von jeder Sekunde gefesselt und manchmal spürte ich sogar Angst. Ich fragte mich, was meine nächsten Verwandten, meine jüngsten Vorfahren, durchgemacht haben, als ihnen unser Land genommen wurde. Ein paar Mal hatte ich Tränen in den Augen und es fiel mir schwer, überhaupt etwas zu sagen, als der Film zu Ende war. Als mein Mann und ich danach im Auto sassen, habe ich geweint. Es war nicht einfach wieder mal ein Film – es war Realität. Ich spürte den
Schmerz der Figuren auf der Leinwand tief in meinem Herzen. Indigene haben eine tiefe Verbindung zueinander und zu ihrem Land.
Die amerikanischen Ureinwohner*innen werden oft vergessen. Wir sind nicht einfach eine ‹race› oder eine ‹Ethnie›. Wir sind Regierungen, souveräne Nationen. Wir wurden enteignet, getötet und assimiliert. Wir wurden gefoltert, damit wir unsere Sprache und Kultur vergessen. Mutige Seelen wie die im Film sind der Grund dafür, dass unsere Kulturen noch existieren –weil sie nicht zum Aufgeben bereit waren.
Mich lässt die Geschichte mit dem Gefühl zurück, dass ich mehr will. Mehr Filme. Mehr indigene Schauspieler*innen. Und zwar von einem Kaliber, das genauso viel Aufmerksamkeit und Bewusstsein schafft wie hier. Das ist es, was die Indigenen verdienen – auf internationalen Plattformen, immer unter Konsultation der Stämme selbst.»
Text: Nathan Poppe Illustrationen: Abbie Sears Ausgabe: März 2024

through when our lands were taken. Tears filled my eyes a couple of times, and I found it hard to talk when it was over. As my husband and I sat in the car afterwards, I cried. It wasn’t just another film — it was real. I felt the hurt of the characters on screen, deep in my heart. Tribal citizens have a deep connection with each other and with the land. I was left with a heavy heart.
First Americans are often forgotten about. We aren’t just a race or an ethnicity. We are governments of people, sovereign nations. We were taken from, killed and assimilated. We were tortured to forget our languages and culture. Brave souls like those in the movie are why our cultures still exist because they weren’t willing to give in. I’m left wanting more. More films. More First American actors. At a caliber that brings this much attention and awareness. It’s what Native people deserve — all with the consultation of the tribes and platforms of global nature.
Chris Adair Cherokee Nation
I loved seeing so many Indigenous actors. The final scene of Osage dancing was fitting. Lily Gladstone’s performance was amazing. I have seen her in “Reservation Dogs,” so I had high hopes for that. Robert De Niro and Leonardo DiCaprio are great as always. The scenes when Ernest administered insulin to Mollie were heartbreaking. I think Ernest’s conflictedness over what he was doing, at least as it pertained to Mollie, was evident and well-acted. It followed the story from the book very well. A key plot point from the book that may not be clear to those who haven’t read it is the futility and hopelessness the Osage felt as the murders continued because
- 30 -

BRAVE SOULS LIKE THOSE IN THE MOVIE ARE WHY OUR CULTURES STILL EXIST.”
Erstmals wurde ein Indigener für einen Oscar in der Kategorie «Bester Song» nominiert.
Scott George schrieb die Musik und den Text zu «Wahzhazhe (A Song For My People)», der in Scorseses Historienepos eine wichtige Rolle spielt. Der in Del City ansässige Komponist aus Oklahoma sagt am Telefon: «Dass wir es unter die Nominierten von fünf Songs geschafft haben, ist ‹wow›. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mich fühlen soll – ausser überrascht und dankbar, dass unsere Musik Anerkennung bekommt.»
George ist der erste indigene Nominierte in der Kategorie «Bester Song» und das erste Mitglied der Osage Nation, das für einen Oscar nominiert wurde. (Anm. d. Red.: Gewonnen haben Billie Eilish und Finneas O’Connell mit ihrem Song aus «Barbie».) Das Lied wurde von den Osage Tribal Singers gesungen.
«Wir sind überglücklich, dass die harte Arbeit, die in diesen Film gesteckt wurde, gewürdigt wird», sagte der Chief der Osage Nation, Geoffrey Standing Bear, in einem Statement. «Die Osage Nation ist besonders stolz darauf, dass der Osage-Komponist Scott George, die Berater Kenny und Vann Bighorse und alle unsere Stammessänger diese aussergewöhnliche Anerkennung für ‹Wahzhazhe (A Song For My People)› erhalten. Für uns gibt es nichts Schöneres, als unseren Sängerinnen und Sängern beim Trommeln zuzuhören.»
Text: Brandy McDonnell, The Oklahoman


Verbreitung: Oklahoma City (USA) Sprache: Englisch gegründet: 2013 Auflage: 14 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: 175


Tekst: Even Skyrud
Illustrasjon: Anders N. Kvammen
=Oslo Im Januar musste das soziale Café-Projekt =Kaffe in der Akersgata in Oslo seine Türen schliessen. Ein Abgesang und eine Würdigung an einen guten Ort und seine Menschen.
8.45 Uhr am ersten Freitag des Jahrs 2024. In der Akersgata 32 sitzt eine Clique an ihrem Stammtisch – dem Tisch, der am nächsten zur Theke steht und auf dem ein gelber Post-it-Zettel mit der Aufschrift «Reserved Friday Ladies» klebt. Seit =Kaffe (sprich: Erlik Café) im Juni 2017 hier seine erste und bekannteste Filiale eröffnet hat, treffen sich Camilla, Mona und Thone jeden Freitagmorgen hier, um sich über die vergangene Woche auszutauschen. Noch
Utenfor settes både snø- og kulderekorder, men bak den tunge glassdøra i Akersgata 32 i Oslo er det både lunt og folksomt. Summingen av prat mellom bordene forstyrres kun av lyden fra ei kaffekvern nå og da.
Det er januar 2024, og snart låses døra til =Kaffe-filialen for godt
Klokka er 8.45 denne første fredagen i 2024.
I Akersgata er gjengen på plass ved stambordet sitt – bordet nærmest disken, det med en gul postitlapp med «Reservert Friday ladies» på. Helt siden =Kaffe åpnet sin første filial her i juni 2017, har Camilla, Mona og Thone møttes her hver fredag for å oppdatere hverandre på uka som har gått. Om tre uker stenger =Kaffefilialen i Akersgata dørene for godt.
Barista Liza benytter pusterommene mellom kunder til å komme bort og ta del i koret. Sånn har det alltid vært her, forteller Camilla:
– Jeg har hatt utallige fine samtaler med folka bak disken her. Jeg husker spesielt de fine stundene med Christer, som døde i 2018. Han kjente jeg litt fra før, fordi han var en venn av broren min. Frank har jeg snakka masse med, og Liza her er jo helt fantastisk. Og Anniken, da. Hun var også med fra starten. Jeg har et stort hjerte for dem alle. Og for Erlik.
Kaffekos oppå bordene, bikkjer under
Det er bikkjekaldt ute og flere bikkjer inne. Rett som det er stikker noen huet inn og spør om det er lov med hund.
Det er det, og det er Liza glad for:
– Kan jeg hilse på? Å, så fin. Hvilken rase er det?
Sånn går morgenen i det smale lokalet. Friday ladies må snart være på jobb, men strekker tida så langt det går. Å snakke om at stedet snart er borte, det sitter langt inne: – Det har skjedd, ikke ofte altså, at det har vært stengt når vi kom hit på morgenen. At noen har forsovet seg eller vært sjuke eller noe. Da har vi vært nødt til å teste andre kaffebarer, men fytti katta, det blir ikke det samme, altså. Ikke atmosfæren og ikke kosen. Det er bare her det blir kaffekos. Vi mister kosen vår, men det er ikke oss det er mest synd på. Det er folka bak disken dette er verst for.
Men fytti katta, det blir ikke lett for oss heller, oppsummerer Camilla mens hun tar på skjerfet.
Friday ladies forsvinner ut døra til 18 blå grader og speilblanke fortau. Inne i varmen står nyklemte Liza igjen.
– Jeg kommer til å savne dem. Savne alt sammen, sukker Liza.
Det forbannede lokalet
I tillegg til baristaene Liza og Anniken, er også Anna på plass bak disken i dag. Hun har jobbet som miljøterapeut i Akersgata de to siste åra, og antyder at det hviler en liten forbannelse over dette lokalet.
haben sie drei Freitage, danach schliesst das Café. Barista Liza nutzt die Pausen zwischen den Kund*innen, um sich den Dreien anzuschliessen. «Das war hier schon immer so», sagt Camilla: «Ich habe unzählige tolle Gespräche mit den Leuten hinter dem Tresen geführt. Besonders gut erinnere ich mich an die guten Zeiten mit Christer, der 2018 gestorben ist. Ich kannte ihn ein bisschen von früher, weil er ein Freund meines Bruders war. Und Liza jetzt ist fantastisch. Anniken auch. Ich habe ein grosses Herz für alle von ihnen. Und für Erlik.»
Draussen ist es eiskalt. In diesem Moment kommt jemand zur Tür herein und fragt, ob Hunde erlaubt sind. Ja! Liza ist froh darüber: «Darf ich hallo sagen? Oh, wie schön. Welche Rasse ist das?» So läuft der Morgen im engen Café ab. Die Freitagsfrauen müssen bald zur Arbeit, aber sie strecken ihre Zeit so lang wie möglich. Kaum vorstellbar, dass der Laden bald weg ist: «Es ist schon vorgekommen, nicht sehr oft, dass geschlossen war, als wir am Morgen ankamen. Jemand hatte verschlafen oder war krank. Dann mussten wir andere
Cafés ausprobieren, aber es ist einfach nicht dasselbe. Nicht die Atmosphäre und nicht die Gemütlichkeit. Dies ist der einzige Ort, an dem es je gemütlich sein wird. Wir verlieren unsere Gemütlichkeit! Aber wir sind nicht diejenigen, die zu bedauern sind. Es sind die Leute hinter dem Tresen. Aber verdammt, auch für uns wird es nicht einfach», sagt Camilla, während sie sich ihren Schal umlegt.
Die Freitagsfrauen verschwinden durch die Tür, draussen sind minus 18 Grad, das Trottoir glänzt. Drinnen bleibt Liza im Warmen stehen. «Ich werde sie vermissen. Das alles vermissen.»
Neben den Baristas Liza und Anniken steht heute auch Anna hinter dem Tresen. Sie hat in den letzten zwei Jahren als Umwelttherapeutin und Teamleiterin in der Akersgata gearbeitet und vermutet, dass ein kleiner Fluch auf dem Lokal liegt. «Die Pandemie, ein Graben in der Strasse und ein Brand im Nachbarhaus sind die eine Sache, aber es gibt auch viele kleine Dinge:
Die Kaffeemühle geht regelmässig kaputt, aus der Kaffeemaschine läuft Wasser aus und so weiter.»
Sie ist die Einzige, die auch schon in anderen Cafés gearbeitet hat, und kann beurteilen, ob in der Akersgata neben dem Fluch auch noch anderes anders läuft. «Eine ganze Menge. Zum Beispiel die Kund*innen. An anderen Orten gab es immer eine Menge verärgerter Kund*innen und Beschwerden. Hier gibt es keine verärgerten Kund*innen. Und die Leute, die hier arbeiten, sind ein bisschen anders. Sie verlieren ihre Handys und Schlüssel häufiger als andere. Eine der Baristas hat in einem Monat drei Handys verloren. Das macht es schwierig, die Leute zu erreichen.»
Die Veteranin in diesem Raum ist Anniken. Bevor sie ihr Leben auf die Reihe bekam und von Oslo nach Askim zog, stand sie hier oft hinter dem Tresen. Jetzt will sie noch etwas mitarbeiten, bevor der Laden für immer schliesst. Abschied nehmen von
– Én ting er pandemien, graving i gata og brann i nabohuset, men det er mye småtteri også. Kaffekverna ryker regelmessig, kaffemaskinen lekker vann og i det hele tatt. Siden Anna er den eneste som også har jobba i andre kaffebarer, lurer vi på om det er noe mer enn forbannelsen som er annerledes her i Akersgata. – Mye. Ta kundene, for eksempel. Andre steder jeg har jobba har det alltid vært en del sure kunder og klaging. Her finnes ikke sure kunder. Det er litt spesielt. Og så er jo de som jobber her litt annerledes, da. De mister blant annet mobiler og nøkler litt oftere enn andre. Én av baristaene mista tre telefoner på én måned. Da blir det vanskelig å få tak i folk.
Alle slags folk Anniken er veteranen i rommet. Før hun fikk skikkelig orden på livet og flytta fra Oslo til Askim, var hun ofte å se bak disken her. Nå tar hun noen timer iblant og har lyst til
å få jobba litt før stedet stenger for godt. Få sagt farvel til stamgjester og venner. – Det er mye mer enn en kaffebar, det her. Ikke bare for oss bak disken, men for alle som har vanka her gjennom åra. Det er kjendiser og politikere, folk som ikke har følt seg hjemme andre plasser og pårørende av folk med rusproblemer som har vanka her for å støtte oss og Erlik. Turister og studenter. Alle slags folk fra alle plasser og klasser. Ved den digre kaffemaskinen er Anniken tilbake etter dagens tredje røykepause, og lyser opp når hun får øye på en middelaldrende, velkledd herre som trer inn i varmen. De to klemmer lenge. Liza får også en klem, før gjesten spør henne om hvordan jula i Spania har vært. «Og hvordan går det med moren din?» Anniken introduserer meg for Jan Tore, enda en trofast gjest. Og den eneste som har fått en kaffedrikk oppkalt etter seg, forteller Anniken ivrig og peker opp på tavla. Der

lærer jeg at en Jan Tore er en liten americano. Jan Tore bestiller en Jan Tore og skravler videre med de to venninnene bak disken. Når det dukker opp flere kunder, ser jeg mitt snitt til å stjele ham og høre om hans =Kaffehistorie
– Jeg har sjelden vært i sentrum uten å ta turen innom her for en americano. Da jeg var finansminister, ble dette mitt fristed. En kaffe, gode samtaler og en pust bakken. Spektrum neste Jan Tore forteller at han hvert år har vært med på Annikens feiring av nok et år som rusfri. Inntil for to år siden ble disse holdt i kjelleren her i Akersgata, men etter at Anniken flytta til Askim, har han tatt turen til Indre Østfold for å feire venninna.
– Det er fint å få lov å være med og feire noe så positivt.
Sist gang tror jeg vi var over 40 gjester. Hun har litt av et nettverk, Anniken.
– Neste gang leier vi Spektrum, kommenterer Anniken, mens hun steamer melk og lager hjerter cappuccinoer. Jan Tore smiler og ser ut til å føle seg hjemme. Smilet erstattes av en bekymret rynke når samtalen dreier inn på nærmeste fremtid. – Nyheten om stengning kom som et sjokk. Jeg skjønner jo at det har vært vanskelig å få det til å gå rundt etter pandemien og med avstenging av gaten, men jeg skulle ønske de hadde holdt ut til det nye regjeringskvartalet åpner. Det er jo en perfekt beliggenhet med tanke på alle som skal inn der. Enda en gjest har slått seg ned ved bordet vårt mens vi snakker om kaffebarens skjebne. Anita har på seg gul refleksvest og holder øye med en tralle hun har parkert utenfor. Hun rydder gater i området for søppel og pleier alltid å ta turen innom for en liten pause og en kopp å varme seg på. Som baristaene har også hun rusbakgrunn, og har fått arbeid gjennom Frelsesarmeens tilbud «Jobben». Jan Tore spør


Stammgästen und Freund*innen. «Das hier ist viel mehr als ein Café. Nicht nur für uns hinter dem Tresen, sondern für alle, die über die Jahre hierhergekommen sind. Prominente und Politiker*innen, Menschen, die sich nirgendwo sonst zuhause fühlen, Angehörige von Menschen mit Suchtproblemen, die uns und Erlik unterstützen. Tourist*innen und Student*innen. Alle Arten von Menschen aus allen Orten und Schichten.»
Anniken steht nach ihrer dritten Rauchpause wieder an der grossen Kaffeemaschine und strahlt, als sie einen gut gekleideten Herrn mittleren Alters entdeckt, der in die Wärme tritt. Die beiden umarmen sich lange. Auch Barista Liza wird umarmt, bevor der Gast sie fragt, wie Weihnachten in Spanien gewesen sei. «Und wie geht es deiner Mutter?» Anniken stellt mir den Mann als Jan Tore vor, er sei ein treuer Gast. «Und der Einzige, nach dem ein Kaffee benannt ist», erzählt Anniken aufgeregt und zeigt auf die Tafel. Dort sehe ich, dass ein Jan Tore ein kleiner Americano ist. Jan Tore bestellt einen Jan Tore und plaudert weiter
mit den beiden Freundinnen hinter dem Tresen. Als weitere Kund*innen auftauchen, erzählt er seine =Kaffe-Geschichte. «Als ich von 2020 bis 2021 Norwegens Finanzminister war, wurde dies mein Zufluchtsort. Ein Kaffee, gute Gespräche und eine Verschnaufpause. Ich war selten im Stadtzentrum, ohne hier auf einen Americano vorbeizuschauen.»
Jan Tore erzählt, dass er jedes Jahr an Annikens Festen teilgenommen hat, mit denen sie ein weiteres Jahr ohne Drogen feierte. Bis vor zwei Jahren fanden diese Jahrtage im Keller hier in der Akersgata statt, aber seit Anniken nach Askim gezogen ist, reist er zum Feiern seiner Freundin nach Østfold. «Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, über vierzig Gäste. Anniken hat ein gutes Netzwerk.» – «Nächstes Mal mieten wir einen grösseren Raum», sagt Anniken, während sie Milch aufschäumt und Herzen in Cappuccinos macht. Jan Tore lächelt. Als das Gespräch auf die nahe Zukunft kommt, weicht das Lächeln einem

«Den gang var det sprøyta i armen fem ganger om dagen, og livet var bare kaos. I dag er jeg barista, holder foredrag, og har et stort nettverk. […] Det finnes mange måter å rehabilitere seg selv på, men for meg har det å jobbe på =Kaffe vært den klart beste.»
hvor mange nasjonaliteter som er innom. På et par–tre timer har =Kaffe nå hatt besøk fra Mexico, Peru, Sveits og nå altså Nepal. Sveitserne ga en mango i driks, forteller Anniken og Lise forteller at hun selv opprinnelig er fra Lillehammer. Paret på nabobordet sier de er fra Slitu. Hver gang de er i Oslo, går de hit. – Hele verden valfarter hit, kommer det himmelfallent fra Liza ved kaffemaskinen. Det er to årsaker til at kaffebaren Akersgata gjennom sju år har blitt oppsøkt av turister og andre skuelystne. Den første var tvstjernestatusen. Et halvt års tid etter åpninga i 2017, slapp TV 2 dokumentarserien «Petter Uteligger – En ny sjanse», hvor seerne fikk være med på både bygging av kaffebar og opplæring av baristaer i Akersgata. Så, i 2020, ble =Kaffe Oslos høyest rangerte serveringssted på Google, med høyere score enn både Maaemo, Statholdergaarden og Egon. Diplomet henger fortsatt på veggen ved disken, og de ligger fortsatt blant de fem høyest rangerte i byen denne morgenen, tre ukers tid før døra låses for godt. Det har Liza akkurat sjekka på telefonen sin. Anniken spør gjengen fra Nepal hvordan de fant frem hit. Ingen blir overraska når svaret kommer. Google.
Rehab og kontor
Nå kommer også Richard inn døra. Som Anniken har også Richard vært med på eventyret Akersgata siden
dag én. Richard var den som ble aller mest oppslukt av baristakunsten. Han nerdet med håndbrygg og fancy kaffedrikker samtidig som han rørte hele Norge ved å være dønn ærlig på tvskjermen, også om det vondeste livet. Han ser ikke en dag eldre ut nå, der har setter seg langs veggen i det vesle lokalet, under fotografiene av tidligere baristaer og =Osloselgere, men friskere og gladere. Den rutete skjorta er mindre slitt enn den på tv, men ærlig er han fortsatt: – Jeg var den siste som fikk være med i den første gruppa baristaer og da også i tvserien. Tror det var noen som trakk seg, så det ble en ledig plass. De sju åra som er gått siden den gang har vært ganske ville, både privat og profesjonelt. Richard ser seg rundt i lokalet som snart er historie. Vi drikker svart kaffe. Den er mer enn godkjent. Richard tar en svær slurk og fortsetter: – Den gang var det sprøyta i armen fem ganger om dagen, og livet var bare kaos. I dag er jeg barista, holder foredrag, og har et stort nettverk. Jeg har vært tre runder på rehabilitering på Tyrili, tre runder på avdeling Voksen og to runder på Behandlingstunet på Fetsund og har prøvd det som finnes av substituttmedisiner. Det finnes mange måter å rehabilitere seg selv på, men for meg har det å jobbe på =Kaffe vært den klart beste. Richard snakker om alt han har fått til og vært med på etter at han fikk sjansen her på kaffebaren. Og ikke minst
1 «Ich war selten im Stadtzentrum, ohne hier auf einen Americano vorbeizuschauen. Als ich Finanzminister war, wurde dies mein Zufluchtsort. Ein Kaffee, gute Gespräche und eine Verschnaufpause.» – Jan Tore (von 2020 bis 2021 norwegischer Finanzminister)
2 «Damals gab es fünfmal am Tag einen Schuss in den Arm, und das Leben war nur chaotisch. Heute bin ich Barista, halte Vorträge und habe ein grosses Netzwerk. (…) Es gibt viele Möglichkeiten, einen Entzug zu machen, aber für mich war die Arbeit bei =Kaffe bei weitem die beste.» –Richard
3 «=Kaffe ist nicht wie andere Cafés. Es funktioniert eher wie ein englischer Pub, ein Treffpunkt, an dem du dich zugehörig fühlst, auch wenn du zum ersten Mal da bist.» – Lise
om alt han har lyst til å få til i framtida. Han forteller om kjæresten han bor sammen med på 25 kvadrat: – Det er jo litt trangt, derfor har jeg brukt plassen her som stue og kontor. Det er også noe vi mister. Knut Og Richard fortsetter å fortelle. Om podkasten han har lyst til å lage, om møtene med ungdomsskoleelever og hvor en ny kaffebar burde ligge, om ADHD, ruspolitikk og viktigheten av å gi folk sjansen til å delta. Folka bak disken og folka i lokalet lytter og kommer med innspill. Samtalen flyter frem og tilbake blant kjente og fremmede, og jeg tenker på noe stamkunde Lise sa tidligere på dagen: – =Kaffe er ikke som andre kaffebarer. Det er mer som en engelsk pub, et møtested hvor du føler deg inkludert selv om du er der for første gang. En som ikke er her for første gang, er Knut. Richard introduserer ham som stamkunden over alle stamkunder. Også Knut er glad i å prate. Han blir fort engasjert og har en stemme som automatisk legger seg to hakk over resten av summinga rundt bordene. Knut forteller at han ved tre anledninger har blitt bedt om å dempe seg av baristaene, og har blitt like fornærma hver gang. Men som han sier, høyt: – Hadde det vært en annen plass, så hadde jeg boikotta den. Men hit må jeg, hver dag. Her ikke noe valg! Beina mine går hit av seg sjøl hver morra!

«=Kaffe er ikke som andre kaffebarer. Det er mer som en engelsk pub, et møtested hvor du føler deg inkludert selv om du er der for første gang.»

26
besorgten Stirnrunzeln. «Die Nachricht von der Schliessung kam wie ein Schock. Ich verstehe, dass es nach der Pandemie und dem Lockdown schwierig war, über die Runden zu kommen, aber ich wünschte, sie hätten durchgehalten, bis das neue Regierungsviertel eröffnet wird. Für all die Leute, die dort einziehen werden, ist es ein perfekter Standort.»
Ein weiterer Gast hat an unserem Tisch Platz genommen. Anita trägt eine gelbe Warnweste und behält einen Wagen im Auge, den sie draussen parkiert hat. Sie arbeitet als Strassenreinigerin und kommt immer wieder für eine kurze Pause und eine Tasse Kaffee zum Aufwärmen vorbei. Wie die Baristas ist auch sie drogenabhängig und hat über ein Programm der Heilsarmee Arbeit gefunden. Jan Tore fragt interessiert nach und erfährt, dass Anita seit fünfzehn Jahren in der Strassenreinigung arbeitet und dass sie und ihre Kolleg*innen jährlich auf Oslos Strassen achtzig Tonnen Müll einsammeln. Jan Tore ist beeindruckt, und Anita ist stolz auf ihre Arbeit: «Manche Leute schämen sich, diesen Wagen zu schieben, aber ich finde das in Ordnung. Es ist ein echter Job. Stellen Sie sich vor, wie die Stadt aussehen würde, wenn wir unsere Arbeit nicht tun würden.»
Gäste aus Nepal
Jetzt sitzen wir zu viert am Tisch. Anita, Jan Tore, Lise und ich. Lise, auch eine Stammkundin, hat kurzes, graues Haar, Lachfalten und die meiste Zeit ihres Lebens im Kindergarten gearbeitet. Jetzt verbringt sie ihre Tage mit ihren Enkelkindern und reist um die Welt. Gerade als Jan Tore weitermuss, kommt Barista Anniken an den Tisch und flüstert laut: «Jetzt haben wir auch Gäste aus Nepal.» Im Laufe des Tages ist es zu einem Sport geworden, die vielen Nationalitäten zu erraten, die hier einkehren. Innerhalb weniger Stunden hat =Kaffe nun Besucher*innen aus Mexiko, Peru, der Schweiz und aus Nepal empfangen. «Die Schweizer*innen haben eine Mango als Trinkgeld gegeben», sagt Anniken. Das Paar am Nachbartisch erzählt, dass es aus Slitu kommt, einem Dorf südlich von Oslo. Jedes Mal, wenn sie in Oslo sind, kommen sie hierher. «Die ganze Welt kommt zu uns», sagt Liza an der Kaffeemaschine. Es gibt zwei Gründe, warum das Café häufig von Tourist*innen und Filmliebhaber*innen frequentiert wird. Der erste Grund: Das Café ist selbst ein TV-Star. Sechs Monate nach der Eröffnung 2017
strahlte TV 2 die Dokumentarserie «Petter Uteligger – Eine neue Chance» aus, in der die Zuschauer*innen sowohl den Bau des Cafés als auch die Ausbildung der Baristas in der Akersgata verfolgen konnten. Der zweite Grund: Im Jahr 2020 wurde =Kaffe Oslos bestbewertetes Café auf Google. Die Urkunde hängt an der Wand neben dem Tresen, und heute Morgen, drei Wochen vor der endgültigen Schliessung, ist das =Kaffe immer noch unter den fünf bestplatzierten Cafés der Stadt. Anniken fragt die Gruppe aus Nepal, wie sie den Weg hierher gefunden hat. Niemand ist überrascht, als die Antwort kommt: Google.
Einer stösst die Tür auf. Wie Anniken ist auch Richard seit Tag 1 Teil des Abenteuers in der Akersgata. Er war derjenige, der sich am meisten in die Barista-Kunst vertieft hat. Er begeisterte sich für das Handbrauen und ausgefallene Kaffeegetränke, während er ganz Norwegen berührte, indem er 2017 im Fernsehen selbst über die schlimmsten Dinge in seinem Leben sehr ehrlich gesprochen hat. Er sieht keinen Tag älter aus, als er jetzt in dem kleinen Raum an der Wand sitzt, unter den Fotos ehemaliger Baristas und =Oslo-Verkäufer*innen, eher frischer und fröhlicher. Sein kariertes Hemd ist weniger abgetragen als das im Fernsehen. Er sagt: «Die sieben Jahre, die seither vergangen sind, waren ziemlich wild, sowohl persönlich als auch beruflich.»
Richard nimmt einen grossen Schluck schwarzen Kaffee und erzählt: «Damals gab es fünfmal am Tag einen Schuss in den Arm, und das Leben war nur chaotisch. Heute bin ich ein Barista, halte Vorträge und habe ein grosses Netzwerk. Ich habe drei Rehabilitationsrunden in Tyrili, drei Runden in der Erwachsenenabteilung und zwei Runden im Behandlungszentrum in Fetsund hinter mir und habe alle verfügbaren Ersatzdrogen ausprobiert. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Entzug zu machen, aber für mich war die Arbeit bei =Kaffe bei weitem die beste.» Richard erzählt von seiner Freundin, mit der er auf 25 Quadratmetern lebt: «Es ist ein bisschen eng, deshalb habe ich den Platz hier als Wohnzimmer und Büro genutzt. Das ist auch etwas, das wir verlieren.»
Richard erzählt weiter. Über den Podcast, den er machen will, über die Treffen mit den Schüler*innen der weiterführenden
Schulen und darüber, wo bald ein neuer Coffeeshop entstehen soll, über ADHS und Drogenpolitik und darüber, wie wichtig es ist, den Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. Die Leute hinter dem Tresen und im Raum hören zu und geben Anregungen. Das Gespräch fliesst zwischen bekannten und unbekannten Leuten hin und her, und ich denke an etwas, das Stammkundin Lise früher am Tag gesagt hat: «=Kaffe ist nicht wie andere Cafés. Es funktioniert eher wie ein englischer Pub, ein Treffpunkt, an dem du dich zugehörig fühlst, auch wenn du zum ersten Mal da bist.»
Einer, der nicht zum ersten Mal hier ist, ist Knut. Richard stellt ihn als den Stammgast unter den Stammgästen vor. Auch Knut plaudert gerne. Seine Stimme ist zwei Stufen lauter als der Rest der Unterhaltung. Knut erzählt, dass er von den Baristas schon dreimal gebeten wurde, leiser zu sprechen, und das jedes Mal eine Beleidigung fand. Laut fügt er hinzu: «Wenn es ein anderer Ort gewesen wäre, hätte ich ihn boykottiert. Aber ich muss jeden Tag hierher kommen. Ich habe keine Wahl. Meine Beine laufen jeden Morgen von selbst hierher.»
Text: Even Skyrud Illustrationen: Anders Kvammen Ausgabe: Februar 2024

Verbreitung: Oslo (Norwegen)
Sprache: Norwegisch gegründet: 2005
Auflage: 10 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: ca. 250
Wir fahren mit dem Hilfebus in die Seitenstrasse hinein. Hier muss es doch sein, das alte Brauereigelände liegt riesig und zerfallen vor uns. Die finden wir hier nie. Ausserdem ist alles «verbauzaunt», kein Reinkommen, nicht auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick. Mein Kollege dreht um und parkt vorn an der Kreuzung. Ein Typ steht plötzlich neben der Beifahrertür und lächelt mich an. Er schiebt einen Kinderwagen vor und zurück, «schuckeln» hab ich früher dazu gesagt. Das ist der Mensch, der uns angerufen und von den Obdachlosen im Abriss erzählt hat. Jetzt weiss ich auch, warum er tagsüber Zeit hat – Elternzeit.
Aber jetzt brauch ich erstmal den Schlafplatz. Als er ihn mir zeigt, weiss ich, dass wir lange gebraucht hätten, um ihn zu finden. Der Verschlag ist so klein und unscheinbar, wir sind mit dem Bus zweimal direkt daran vorbeigefahren. Da drin hätte ich nie einen Menschen vermutet. Doch dann sehe ich den Rollstuhl, den ich selbst besorgt habe. Beim Näherkommen gehe ich noch ein bisschen mehr auf Arbeitsmodus, hole mein Sprüchlein heraus: «Servus, Tino aici!» («Hallo, Tino hier») und schaue um die Ecke.
Zuerst höre ich nur ihre Stimme, die etwas Unverständliches antwortet. Dann sehe ich ihr Gesicht zwischen all dem Müll, den Pfandflaschen, den Decken, den Klamotten. Sie hat eine zu grosse Mütze auf, erkennt mich und freut sich augenscheinlich. Sie tastet nach B. Von meinem Platz aus sehe ich, dass er nicht da ist, nicht neben ihr liegt. Doch sie redet mit ihm, tastet nach ihm, bis ich sie frage, wo er ist. Sie weiss es nicht. Wir reden ein bisschen, ich frage, wie es ihr geht. Weil wir uns nicht richtig anschauen können, versuche ich, sie etwas hochzuziehen, damit sie sitzen kann. Es klappt nicht. Sie fällt zurück, und ein Dunst aus Urin, Alkohol, Erbrochenem und ungewaschenem Körper wabert mir entgegen. Ich setze mich neben sie hin. Wir können uns jetzt in die Augen schauen und reden ein bisschen mehr.
Ich kann nicht anders und streichle ihr Gesicht. Ich sehe dort nur Tod, bin mir in diesem Moment ganz sicher, dass sie sterben wird – bald. Ich sehe es in ihren Augen, an ihren Lippen, auf ihren Wangen. Alles sieht nach Tod aus. Mir geht kurz durch den Kopf, dass wir ja alle sterben müssen – aber doch nicht jetzt!
Ich versuche ihr zu erklären, dass ich einen gesetzlichen Betreuer bestellen werde. Mir fällt das richtige Wort auf Rumänisch nicht ein. Ich versuche es mit «Tutore» (Vormund) und «Tribunal» (Gericht). Das kommt nicht so gut an. Sie fängt an, mich zu beschimpfen und wiederholt dabei immer wieder nur das eine Wort: «Mincinosul, mincinosul – Esti un mincinos», «Lügner, Lügner – Du bist ein Lügner.»
„Ich
Wir fahren mit dem Hilfebus in die Seitenstraße hinein. Hier muss es doch sein, das alte Brauereigelände liegt riesig und zerfallen vor uns. Die finden wir hier nie. Außerdem ist alles „verbauzaunt“, kein Reinkommen, nicht auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick. Mein Kollege dreht um und parkt vorn an der Kreuzung. Ein Typ steht plötzlich neben der Beifahrertür und lächelt mich an. Er schiebt einen Kinderwagen vor und zurück, „schuckeln“ hab ich früher dazu gesagt. Das ist der Mensch, der uns angerufen und von den Obdachlosen im Abriss erzählt hat. Jetzt weiß ich auch, warum er tagsüber Zeit hat – Elternzeit.

Aber jetzt brauch ich erstmal den Schlafplatz. Als er ihn mir zeigt, bin ich gleich sicher, dass wir lange gebraucht hätten, um ihn zu finden. Der Verschlag ist so klein und unscheinbar, wir sind mit dem Bus zweimal direkt daran vorbeigefahren. Da drin hätte ich nie einen Menschen vermutet. Doch dann sehe ich den Rollstuhl, den ich besorgt habe. Beim Näherkommen gehe ich noch ein bisschen mehr auf Arbeitsmodus, hole mein Sprüchlein heraus: „Servus, Tino aici!“ („Hallo, Tino hier“) und schaue um die Ecke. Zuerst höre ich nur ihre Stimme, die etwas Unverständliches antwortet. Dann sehe ich ihr Gesicht zwischen all dem Müll, den Pfandflaschen, den Decken, den Klamotten. Sie hat eine zu große Mütze auf, erkennt mich und freut sich augenscheinlich. Sie tastet nach B. Von meinem Platz aus sehe ich, dass er nicht da ist, nicht neben ihr liegt. Doch sie redet mit ihm, tastet nach ihm, bis ich sie frage, wo er ist. Sie weiß es nicht. Wir reden ein bisschen, ich frage, wie es ihr geht. Weil wir uns nicht richtig anschauen können, versuche ich, sie etwas hochzuziehen, damit sie sitzen kann. Es klappt nicht. Sie fällt zurück und ein Dunst aus Urin, Alkohol, Erbrochenem und ungewaschenem Körper wabert mir entgegen. Ich beachte ihn nicht, setze mich neben sie hin. Wir können uns jetzt in die Augen schauen und reden ein bisschen mehr. Ich kann nicht anders und streichle ihr Gesicht. Ich sehe dort nur Tod, bin mir in diesem Moment ganz sicher, dass sie sterben wird – bald. Ich sehe es in ihren Augen, an ihren Lippen, auf ihren Wangen. Alles sieht nach Tod aus. Mir geht kurz durch den Kopf, dass wir ja alle sterben müssen – aber nicht jetzt! Ich versuche, ihr zu erklären, dass ich einen gesetzlichen Betreuer bestellen werde. Mir fällt das richtige Wort auf Rumänisch nicht ein. Ich versuche es mit „Tutore“ („Vormund“) und „Tribunal“ (Gericht). Das kommt nicht so gut an. Sie fängt an, mich zu beschimpfen und wiederholt dabei immer wieder nur das eine Wort: „Mincinosul“ – „Mincinosul“ – „Esti un mincinos“ („Lüg-

ner – Lügner – Du bist ein Lügner“). Ich verlasse diesen unmöglichen Nichtraum, der bald zusammenfällt. Sie verfolgt mich mit ihren immer lauter werdenden Worten. Sie hat Recht. Ich bin ein Lügner. Ich habe ihr versprochen, eine Wohnung zu besorgen, Sozialhilfe zu besorgen, medizinische Behandlung, Essen und Kleidung, und ich habe fast nichts von diesen Versprechen eingehalten, obwohl ich alles mir Mögliche versucht habe. Sie liegt immer noch in ihrer eigenen Pisse, im Dreck, absolut menschen- und lebensunwürdig in einem der reichsten Länder der Welt – Ich bin ein Lügner. Irgendwie sind wir alle Lügner. <
Ich verlasse diesen Nichtraum, der bald zusammenfällt. Sie verfolgt mich mit ihren immer lauter werdenden Worten. Sie hat recht. Ich bin ein Lügner. Ich habe ihr versprochen, eine Wohnung zu besorgen, Sozialhilfe zu besorgen, medizinische Behandlung, Essen und Kleidung, und ich habe fast nichts von diesen Versprechen gehalten, obwohl ich alles mir Mögliche versucht habe. Sie liegt immer noch in ihrer eigenen Pisse, im Dreck, absolut menschen- und lebensunwürdig in einem der reichsten Länder der Welt –Ich bin ein Lügner. Irgendwie sind wir alle Lügner.
Text: Tino Neufert Ausgabe: Nov. 2023
Verbreitung: Leipzig (Deutschland) Sprache: Deutsch gegründet: 1995
Auflage: 13 000 Expl. erscheint: monatlich Verkaufende: ca. 70
TINO NEUFERT unterstützt als Sozialarbeiter beim Streetwork des Suchtzentrums Leipzig Menschen in schwierigen oder ungeklärten Wohnsituationen.
1 Menschen im ganzen Land leisten ganz nebenbei kleine Wohltaten, indem sie eine Strassenzeitung kaufen.
I was 11 when I first visited a homeless shelter with my mother, who in her own inimitable style was determined to shine a light on an overlooked, misunderstood problem.
The Big Issue had launched just two years before, offering people the opportunity to earn a legitimate income by selling a magazine to the public and providing a solution to the issues that saw a growing number of people on the streets of the nation’s capital.
In the 30-odd years since, I’ve seen countless projects in this space grow from strength to strength, including charities of which I have had the honour of being Patron. New initiatives have been launched up and down the country – some have worked, some

have not. But The Big Issue, perhaps now the most immediately recognisable of these organisations, has undeniably had an impact. Its social business model has provided a means of making a living to 105,000 vendors who have earned over £144 million.
Looking back helps us to see how far we’ve come, but problems are fixed in the present. And despite all the progress, homelessness is still seen by many as some entrenched phenomenon over which we have little power. And there are worrying signs that things might soon get worse as people feel the effects of higher prices and find it harder to make ends meet.
And although we can’t fix all of that at once, I refuse to believe that
homelessness is an irrevocable fact of life. It is an issue that can be solved, but that requires a continued focus and comprehensive support network.
Thankfully there are brilliant, compassionate people working tirelessly to support those that find themselves in that vulnerable position and to provide opportunity when it is most needed.
And people up and down the country fulfil small acts of kindness as they purchase a street magazine or make a donation to someone on the street before proceeding on with their day. I wanted to experience the other side and see what it was like to be a Big Issue vendor. My time was truly eye opening. I was lucky to join Dave

on a warm, sunny day in June. People recognised a familiar face and were happy to give me the time of day. But that isn’t the case for the vast majority of Big Issue vendors, who sell yearround – including through the bleak winter months – and are barely given a second glance by passers-by.
A hardworking, funny, joyful man, Dave is the kind of person we should all be actively encouraging and supporting. Instead, people often just ignore him. And while The Big Issue provides a mechanism by which Dave can provide for himself, earn a living and – in his words – regain some self-respect, it is reliant on us playing our part too. Because he can only succeed if we recognise him, we see him and we support him.
up and down the country fulfil small acts of kindness as they purchase a street magazine
If you’re reading this, then it’s because you’ve met someone like Dave who needed your help and you chose to offer it.
With that small act of kindness, you’ve made a difference. And I hope you continue to do that while encouraging those around you to do the same in the future – to see the person behind the red tabard, or the cardboard sign, or the empty cup.
I count myself extremely lucky to have a role that allows me to meet people from all walks of life, and to understand their full story – whatever it may be. It’s a privilege that many of us, busy with our days, don’t always afford.
The Big Issue Der britische Thronfolger Prinz William hat einen Tag lang The Big Issue auf der Strasse verkauft. Hier beschreibt er, wieso ihm die Abschaffung der Obdachlosigkeit am Herzen liegt.
Ich war elf Jahre alt, als ich zum ersten Mal mit meiner Mutter eine Obdachlosenunterkunft besuchte. The Big Issue war erst zwei Jahre zuvor gegründet worden. Es bot Menschen die Möglichkeit, durch den Verkauf der Zeitschrift ein reguläres Einkommen zu erzielen – und eine Lösung für die Probleme, die damals immer mehr Leute auf die Strasse trieben.
cause, I have always believed in using my platform to help tell those stories and to bring attention and action to those who are struggling. I plan to do that now I’m turning 40, even more than I have in the past.
So, for my part, I commit to continue doing what I can to shine a spotlight on this solvable issue not just today, but in the months and years to come.
And in the years ahead, I hope to bring George, Charlotte and Louis to see the fantastic organisations doing inspiring work to support those most in need – just as my mother did for me.
As she instinctively knew, and as I continue to try and highlight, the first step to fixing a problem is for everyone to see it for what it truly is. People
And while I may seem like one of the most unlikely advocates for this
In den über dreissig Jahren, die seitdem vergangen sind, habe ich unzählige Projekte auf diesem Gebiet entstehen sehen. Neue Initiativen wurden ins Leben gerufen – einige funktionierten, andere nicht. The Big Issue ist vielleicht die bekannteste dieser Organisationen und hat unbestritten grosse Wirkung. Ihr soziales Geschäftsmodell hat über die Jahre 105 000 Verkäufer*innen die Möglichkeit geboten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zusammen haben sie über 144 Millionen Pfund erwirtschaftet.
Trotz aller Fortschritte wird Obdachlosigkeit von vielen immer noch als Phänomen gesehen, auf das wir wenig Einfluss haben. Und es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Lage bald noch verschlimmern könnte. Obwohl wir nicht alles auf einmal lösen können, weigere ich mich zu glauben, dass Obdachlosigkeit eine unwiderrufliche Tatsache ist. Vielmehr ist es ein Problem, das gelöst werden kann, doch dies erfordert einen kontinuierlichen Fokus und ein umfassendes Netz an Unterstützung.
Zum Glück gibt es kluge, mitfühlende Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, diejenigen zu unterstützen, die sich in dieser prekären Lage befinden. Überall leisten Menschen zudem ganz nebenbei kleine Wohltaten, indem sie eine Strassenzeitung kaufen oder jemandem eine kleine Spende geben, bevor sie weiter ihren Tag leben.
Ich wollte einmal die andere Seite erfahren und sehen, wie es ist, ein Big-IssueVerkäufer zu sein. Es ist eine eindrückliche Erfahrung. Ich hatte das Glück, an einem warmen, sonnigen Tag im Juni mit Dave auf der Strasse zu stehen. Die Leute erkannten mich und freuten sich, mir ihre Zeit zu schenken. Aber das ist nicht der Fall für die grosse Mehrheit der Big-Issue-Verkäufer*innen, die das ganze Jahr über verkaufen – auch in den trüben Wintermonaten – und die von den Passant*innen kaum je mit einem zweiten Blick bedacht werden. Obwohl The Big Issue Dave die Möglichkeit bietet, für sich selbst zu sorgen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und – wie er sagt – etwas Selbstachtung zurückzugewinnen, ist er darauf angewiesen, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen. Denn er kann nur dann Erfolg haben, wenn wir ihn anerkennen, ihn sehen und ihn unterstützen.
Wenn Sie dies lesen, dann deshalb, weil Sie jemanden wie Dave getroffen haben,
der Ihre Hilfe brauchte, und Sie haben sich entschlossen, diese anzubieten. Und ich hoffe, dass Sie damit weitermachen und die Menschen in Ihrem Umfeld ermutigen, das Gleiche zu tun: unter der roten Weste, hinter dem Pappschild oder dem leeren Becher den Menschen zu sehen.
Ich habe immer daran geglaubt, dass ich meine Position dafür nutzen kann, dass auch solche Geschichten erzählt werden. Und dass ich die Aufmerksamkeit auf Menschen lenken kann, die es schwer haben, und ihnen helfen. Ich will weiterhin alles mir Mögliche tun, um dieses lösbare Problem nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Monaten und Jahren ins Rampenlicht zu rücken.
Und ich hoffe, dass ich in den kommenden Jahren auch meine Kinder George, Charlotte und Louis mitnehmen kann zu den Organisationen, die diese vorbildliche Arbeit in der Unterstützung betroffener Menschen leisten – so, wie es schon meine Mutter mit mir getan hat.
Words: Steven MacKenzie
1 Im Jahr 1993 besuchte Diana die Anlaufstelle The Passage mit ihren Söhnen William und Harry.
2 «Ich war überrascht, wie viele Leute mich in der Big-Issue-Weste erkannten. Ich kann mit einem Cap die Strasse runtergehen und niemand merkt es.» – Prinz William

Less than a week after tens of thousands packed The Mall and a global audience of hundreds of millions celebrated the Queen’s Platinum Jubilee with the royal family, only a 15-minute walk from Buckingham Palace, Prince William is standing outside a supermarket and passers-by are passing by.
He’s still wearing a bright red uniform like he had on for Trooping the Colour and watching the noisy flypast. But instead of a ceremonial military outfit and medals, it’s a Big Issue tabard and badge.
Next to him stands Dave Martin, a veteran vendor who volunteered to show the Duke of Cambridge the ropes and give a glimpse into the life of a Big Issue vendor.
Dave knows this pitch well. A decade ago, Rochester Row in Victoria was one of the places he sold magazines when he first came to The Big Issue for the opportunity to work his way off the streets. He’s adept at putting the new recruit at his ease. After donning his tabard, William is handed a bundle of magazines and briefed on how to accept cash and card payments, then the pair set off. At first, business is slow. Nobody takes much notice of the vendors –a feeling familiar to many who make their living on the streets – but Dave shares some selling tips and soon the sales start coming. A Royal Mail employee, who probably
as the vendor is increasingly identified. A
azine because “I am a bit curious so I want to know what’s going on in the world.” Not because of who was selling it? Khalid says he wasn’t really surprised when he learned it was Prince William. That’s the kind of thing you’d expect him to do. “It’s like meeting a normal person,” he adds.
Neil Kramer is charging his taxi on the opposite side of the street – a captive customer. Dave and William cross over to secure a sale. I ask Neil about their technique afterwards.
“He said, ‘Would you like to buy a Big Issue? You look like you’re a generous man.’” Was he right?
“Yeah, my wife and I do buy

The Big Issue. As they both left, I wished them luck and then pinched myself.”
A queue has started to form. There’s a group of Colombian and Ecuadorian students who can’t believe they’ve met a postcard face of London on the street; a young girl and her mother pose for a picture. “Happy Jubilee!” they shout. Lots of people want to shake hands, snap a selfie and have a chat, which William allows – only if they buy a magazine, of course.
Brian, who’s involved with the Prince’s Trust, jots down his number on the back of a Sainsbury’s receipt and William promises to look him up. As is often the case, Big Issue customers cut right across society. Some were among the throngs that joined the Jubilee celebrations the previous weekend, amazed to have their own private audience with the future king. Some have a history of homelessness themselves.
A woman and her mother introduce themselves. Later on, William shares their story.
“We met two Ukrainian refugees,” he explains. “The daughter lives here, she’s brought her mum from Kyiv. Sadly they’ve lost a number of family members and most of their property.
The grandmother is still out there.
“And then there was another gentleman who undid his shirt like Superman with a Ukrainian logo on there. He’s got his whole family over here and they’ve lost everything. From Mariupol.”
The time Dave and William spent selling goes on longer than planned, but William calls for extra magazines and won’t leave until every copy is sold.
While he’s shifting his last few, I speak to Tolu Desalu. “I’m attached to a Christian church,” she says. “What we do is go into hospitals to visit patients who don’t have family. So this is bang up my street.
“I was having a bad day so I thought I’d just go for a walk. I had no destination. I was in Waitrose and I think the security guard thought I was trying to steal something – well not steal, but he said, ‘Why don’t you go to Tesco’s, it’s a lot cheaper.’ OK. All right. Then somebody said to me Prince William’s around the corner standing outside Sainsbury’s. I thought yeah, of course…
“Life is funny,” she says. “But he’s lovely and I hope this encourages people to buy the magazine.”
Completely sold out, Dave and William call time. Together they’ve sold 32 copies. “How long would it take for you to sell those normally?” William asks. In under an hour they’ve sold what it would usually take Dave half a week to sell.

Die Kunde davon, dass Prinz William zusammen mit Verkäufer Dave Martin The Big Issue verkauft, verbreitete sich schnell.
Weniger als eine Woche nach dem weltweit von hunderten Millionen Menschen gefeierten Platinjubiläum der Queen steht Prinz William unweit des Buckingham Palace vor einem Supermarkt. Passant*innen gehen an ihm vorbei. Er trägt eine leuchtend rote Uniform. Aber statt aus feierlicher Militärkleidung und Medaillen besteht sie heute aus der Weste und dem Abzeichen von Big Issue. Neben ihm steht Dave Martin, ein langjähriger Verkäufer, der sich bereit erklärt hat, dem Herzog von Cambridge seine Arbeit zu erklären. Dave kennt den Standplatz gut. Es ist der Ort, wo er vor zehn Jahren seine ersten Big-Issue-Ausgaben verkauft hat. Dave versteht
es, den «Neueinsteiger» in Stimmung zu bringen. Nachdem er eine Weste angezogen hat, bekommt Prinz William ein Bündel Zeitschriften ausgehändigt und wird instruiert, wie er Bar- und Kartenzahlungen annehmen kann.
Das Geschäft läuft am Anfang nur schleppend. Niemand nimmt Notiz von den Verkäufern – ein Gefühl, das viele kennen, die ihren Lebensunterhalt auf der Strasse verdienen. Doch schon bald beginnen die Verkäufe zu laufen. Ein Angestellter der Royal Mail, der wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesem Verkäufer und seinen Briefmarken festgestellt hat, ist einer der ersten Kunden. Es gibt zweifelnde Blicke und kurvende Fahrradkuriere, die dem neuen Verkäufer auf die Finger schauen. Ein junger Mann namens Khalid sagt, er habe die Zeitschrift gekauft, weil «ich ein bisschen neugierig bin und wissen will, was in der Welt vor sich geht.» Nicht wegen des Verkäufers? Khalid ist nicht sehr überrascht, als er erfährt, dass dies Prinz William ist. Das sei doch erwartbar, dass er solche Dinge tue.

with a baseball cap on and nobody would pay attention. But everyone was really friendly, weren’t they? I’m conscious that I got the easy version in the summer sunshine.
DAVE: What would you have done if it was raining?
HRH: I’d have still come out, don’t worry Dave. Ever since I came here [to The Passage] with my mother, homelessness has stuck with me as an issue I want to fight for. I’ve done everything I can to raise the profile of the homeless, and I want to do a lot more.
DAVE: I’ve heard somebody’s got a birthday coming up. Are you 21 again?
HRH: I’d like to be 21 again, Dave. The big four-zero. Getting on a bit now.
DAVE: You’re still young. I’m 60.
HRH: Sixty? Are you? You don’t look a day over 50. I felt my birthday was a good opportunity. I wanted to make sure we were highlighting something that matters to me. Off the back of Everyone In [the scheme that brought all rough sleepers off the streets during the pandemic] it started to feel that actually, this issue isn’t quite as big to tackle as we think. But it feels like it’s

I was surprised how many people spotted me in a Big Issue tabard. I can walk down the street with a baseball cap on and nobody would pay attention PRINCE WILLIAM
gone back to what it was before the pandemic. We can fix it. It is possible to – I never want to say completely end homelessness, because every day something else might happen for someone – but get on top of it more than we have done.
DAVE: How would you do that?
HRH: It’s a good question. How do you bring together all the best people like The Passage, Centrepoint, Big Issue who know this area very well? How do you build something that’s got legs and can deliver support packages to allow individuals to come out the other end standing on their own two feet? That’s what I’ll be trying to do. How would you fix homelessness, if you had the power?
DAVE: Get all the homeless off the street, get them accommodation. Give them support and help to move on in their life. That’s the first thing I’d do.
HRH: Sounds like a good idea.
DAVE: A lot of day centres have closed. Would that be a good idea to open them up?
HRH: You know, I’m not the expert. But there’s no doubt about it, more support at the sharp end is needed. Rather than the firefighting going on – brilliantly done in lots of areas – it would be good to bring everyone together and have it a bit more streamlined and coordinated. Look ahead as much as we can as well and prevent homelessness, as much as curing what’s going on right now.
Neil Kramer lädt gerade sein E-Taxi an der gegenüberliegenden Strassenseite auf. Dave und Prinz William gehen hinüber, um ihm ein Heft zu verkaufen. Ich frage Neil anschliessend nach der Verkaufstaktik der beiden. «Er sagte: ‹Möchten Sie eine Big Issue kaufen? Sie sehen aus, als wären Sie ein grosszügiger Mann.›» Und, hat er Recht? «Ja, meine Frau und ich kaufen The Big Issue. Als die beiden gingen, habe ich ihnen Glück gewünscht und mich dann selbst gekniffen.» Mittlerweile hat sich eine kleine Schlange gebildet. Viele Leute wollen ein Selfie mit Prinz William machen und ein wenig plaudern, was dieser gern erlaubt – natürlich nur, wenn sie ein Heft kaufen. Eine Frau und ihre Mutter stellen sich vor. Später erzählt Prinz William ihre Geschichte. «Das waren zwei ukrainische Geflüchtete», erklärt er. «Die Tochter lebt hier und hat die Mutter aus Kyiv hierhergeholt. Leider haben sie mehrere Angehörige und den grössten Teil ihres Besitzes verloren. Die Grossmutter ist noch dort.»
Schliesslich sind Dave und William alle 32 Exemplare losgeworden. «Wie lange brauchen Sie normalerweise, um dieselbe Menge zu verkaufen?», fragt William. In weniger als einer Stunde haben sie das verkauft, wofür Dave normalerweise eine halbe Woche brauchen würde.
Text: Steven MacKenzie
«Wir können Obdachlosigkeit besser in den Griff bekommen»
In der Anlaufstelle The Passage, einem Zentrum für obdachlose und armutsbetroffene Menschen, lernen sich Dave Martin und Prinz William im Gespräch etwas besser kennen.
DAVE MARTIN Wie war es für Sie, The Big Issue zu verkaufen?
PRINZ WILLIAM Ich habe es wirklich genossen. Ich hätte noch viel mehr Stunden mit Ihnen da draussen verbringen können.
Warum haben Sie sich genau für diese Aktion heute entschieden?
Ich fand, mein Geburtstag wäre eine gute Gelegenheit, auf etwas hinzuweisen, das mir wichtig ist. Nach dem Projekt «Everyone In» (ein Programm, das während der Pandemie alle Obdachlosen von der Strasse holte, Anm. d. Red.) hatte ich das Gefühl, dass dieses Problem gar nicht so schwer zu lösen ist, wie wir denken. Ich will nicht sagen, dass wir Obdachlosigkeit vollständig beseitigen können, aber wir können das Problem besser in den Griff bekommen als bisher.
Wie zum Beispiel?
Das ist eine gute Frage. Wie bringt man all die Leute zusammen, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennen? Wie würden Sie die Obdachlosigkeit beseitigen, wenn Sie die Möglichkeiten dazu hätten?
Ich würde alle Obdachlosen von der Strasse holen und ihnen eine Unterkunft besorgen. Ihnen Unterstützung und Hilfe geben, damit sie in ihrem Leben weiterkommen. Das wäre das Erste, was ich tun würde.
Das klingt nach einer guten Idee.
Viele Tageszentren wurden geschlossen. Wäre es eine gute Idee, sie wieder zu öffnen?
Ich bin kein Experte. Aber ohne Zweifel braucht es mehr Unterstützung an der Front. Anstatt immer nur Feuerwehrübun-
gen zu machen – auch wenn viele hervorragende Arbeit leisten –, wäre es gut, alle an einen Tisch zu bringen und die Arbeit zu koordinieren. Und dann sollten wir so weit wie möglich in die Zukunft blicken und Obdachlosigkeit verhindern, während wir lösen, was hier und jetzt passiert. Darf ich fragen, wie Sie in die Situation gekommen sind, auf der Strasse zu leben?
Es fing an, als ich fünf Jahre alt war und meine Mutter starb. Ich wurde zwischen Familien und Heimen hin- und hergeschoben. Schliesslich beschloss ich, nach London zu gehen. Und landete auf der Strasse.
Und der Verkauf von The Big Issue hat Sie wieder auf die Beine gebracht?
Zu der Zeit habe ich gebettelt. Ein anderer Verkäufer sagte, ich könnte etwas viel Besseres machen, und nahm mich mit ins Büro von Big Issue. Und siehe da, jetzt mache ich das schon seit elf Jahren.
Es gibt immer noch ein gewisses Tabu in Bezug auf Obdachlosigkeit. Ich glaube, der
DAVE: There’s a lot of, excuse the pun, issues with why people become homeless. Could be family, could be a multitude of reasons. So as you say, you need to address all those problems together.
HRH: Can I ask how you found yourself in the situation where you were living on the streets?
DAVE: Well, I mean it first started when I was five and my mum died. I got pushed around different families and care hostels, that sort of thing. Then I decided to come to London. Obviously, come here and you’ll make it. And you don’t. I found myself on the street.
HRH: This is what got you back on your feet, selling The Big Issue?
DAVE: It got me off the street. Gave me respect. I was begging at the time. Another vendor said I could be doing something a lot better and took me along to the Big Issue office. Hey presto, I’ve been doing it for 11 years now.
HRH: When I speak to you or anyone who’s been living on the streets, you start to see the human and the difficulties you’ve been through. There’s still some taboo about homelessness. I think the mental health side of things frightens people. We have to tackle all this
to help humanise those who are living with homelessness. Many people would not be able to fare as well as you have to get through.
DAVE: A few people didn’t fare so well.
HRH: That’s the sad thing. Many don’t. But if there was some way of being able to talk more openly about these stories, to show people the real challenges you’ve faced, I think a lot of people would be like, OK, I can now see why people end up where they do.
DAVE: That’s right. You try to engage with people. Perhaps they don’t know how to approach you. I see some members of the public engage with the homeless and when that happens, you’ll see their face light up. They’ve got someone to talk to.
HRH: I’m fortunate enough that I get to see the best of people whenever I meet them. They give me their best side. Dave, you probably get to see the worst in people.
DAVE: Sometimes, yeah. I’m fortunate that I’ve built up my pitch over the years [Dave normally sells at Tesco in Hammersmith] and it is quite a friendly place. But I’ve heard vendors getting spat at and a lot of verbal abuse.
HRH: I’m lucky because I am who I am. Often, people are happy to talk to me.
We’ve got to push back on the normality that is popping in your wireless earphones and wandering down the street, listening to music or on a phone. In a city, you walk past hundreds of people every day and you don’t even look at them. Wouldn’t it be nice to find out a bit more about the people either side of you? That way, people would be a bit more understanding, a bit more tolerant of what everyone’s had to deal with.
Faktor psychische Gesundheit macht den Menschen Angst. Wir müssen offener über diese Geschichten sprechen. Dann würden viele Leute sagen: OK, jetzt verstehe ich, warum die Leute dort landen, wo sie sind …
Das stimmt. Vielleicht wissen die meisten nicht, wie sie auf die Betroffenen zugehen sollen. Ich sehe, wie einige Leute mit obdachlosen Menschen Kontakt suchen. Man sieht, wie sich deren Gesicht aufhellt, weil sie jemanden haben, mit dem sie reden können.
Mir zeigen sich die Menschen immer von ihrer besten Seite. Dave, Sie sehen wahrscheinlich auch die schlimmsten Seiten.
Manchmal, ja. Ich habe das Glück, dass ich meinen Standplatz über die Jahre aufgebaut habe. Aber ich habe schon gehört, dass Verkäufer*innen bespuckt und beschimpft wurden.
Wenn Sie The Big Issue verkaufen, haben die Leute das Gefühl, dass sie Sie ansprechen können. Aber wenn jemand auf der Strasse schläft, ist es etwas anderes, oder?
The Big Issue hat früher Nachtwanderungen angeboten, um zu zeigen, wo Obdachlose schlafen, und die Situation zu erklären. Wir versuchen, Verständnis zu wecken.
Menschen, die obdachlos sind, können ohne bestimmte Dinge ihr Leben nicht wieder aufbauen. Eines davon ist Respekt und Selbstachtung. Und das ist es, was The Big Issue ihnen gibt.
Das ist richtig.
Sie haben mir gesagt, Sie arbeiten sieben Tage die Woche?
Jede Woche. Dann kann ich mir hoffentlich mal an einem Wochenende ein bisschen frei nehmen. Das hängt davon ab, wie die Verkäufe laufen. [Bevor Dave nun weitermuss, hat er noch ein Geschenk für Prinz William. Vor ein paar Jahren begann er nach einem Besuch im Londoner Museum Tate Modern mit Zeichnen. Jetzt stellt er seine Werke aus und verkauft sie online. Er überreicht dem Herzog ein Postkartenset mit seinen Werken.]

DAVE: They probably get to hear about the bad stuff rather than the good stuff. “Oh, I heard this vendor did that, I better not approach them.”
HRH: When you’re selling The Big Issue, I think people feel they can approach you. But if someone’s sleeping rough on the streets, that’s a different thing isn’t it?
DAVE: The Big Issue has done Night Walks before, to take the public around where homeless people sleep to try and explain the situation. We try and get people to understand.
HRH: It’s about respect. People who are homeless can’t rebuild their life without a number of things. And one of those things is respect and self-respect. And that’s what The Big Issue gives you.
DAVE: That’s right.
HRH: It’s a good start to get yourself back on your feet where you feel like: I matter.






HRH: Did you get to see it? got pushed around different families and care hostels. Then decided to come to London. found myself on the street
DAVE: Gives you pride. Gives you something to aim for.
HRH: You’ve got something each day to know you’ve got to do – a bit of structure. Because everyone needs a little bit of structure in their life, don’t they?
DAVE: So how did you find the Jubilee?
HRH: It was a lovely weekend, thanks. It was a moment of national unity, I felt. I think it brought a lot of people together. I think it made everyone feel a bit better about themselves after a difficult couple of years.
DAVE: I saw a picture of The Mall. It was just chock-a-block with people.
HRH: Chock-a-block. Red white and blue everywhere. It was really good to see.
DAVE: The best bit I liked about the celebrations was the flypast.
DAVE:
HRH:
Renaissance, which was amazing. But then once we got into modern art, I started to get a bit dozy.
DAVE: I can introduce you to modern art.
HRH: Yours are more interesting. I like to have a story behind the artist. Before they part ways, Dave has one final question.
DAVE: When are we going to do this again? We’ll do 50 next time, at least!
HRH: Honestly, I really enjoyed it. Thank you for looking after me. When you first do it, I can see it’s daunting. You just don’t quite know what’s going to happen or how it’s going to go.




Sie sind ein guter Zeichner. Die sind eher abstrakt. Stellen sie für Sie etwas dar?
Das überlasse ich immer dem Auge des Betrachters.
Ich mag es, wenn hinter dem Künstler eine Geschichte steht.
Aufgezeichnet: The Big Issue Ausgabe: 20. Juni 2022
Verbreitung: Grossbritannien
Sprache: Englisch gegründet: 1991
Auflage: 50 000 Expl. erscheint: wöchentlich
Verkaufende: ca. 2000
1 «Ich wurde zwischen Pflegefamilien und Heimen hin- und hergeschoben Schliesslich ging ich nach London. Und landete auf der Strasse.» –
Dave Martin
2 «Obdachlosigkeit ist immer noch ein Tabu. Die Menschen ängstigen sich vor dem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Wir müssen beides angehen.» –Prinz William
3 Dave Martin und Prinz William unterhalten sich über die grossen Themen, etwa wie man Obdachlosigkeit abschafft.
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90
Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
Regionalstelle Bern
Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78
M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe: Sara Winter Sayilir (win)
Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea)
T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Chris Alefantis, Sarah Britz, Rachel Chen, Kanani Cortez, Rebecka Domig, Mike Findlay, Valentina Gianera, Lukas Gilbert, Amy Hetherington, Anders Kvammen, Dmitrij Leltschuk, Steven Mackenzie, Sanu Miku, Jean Nikolić, Josée Panet-Raymond, Nathan Poppe, Maria Portilla, Corinna Primikyriou, Bastian Pütter, Maja Ravanska, Even Skyrud, Annina Sonkoly-Domby, Arturo Soto Flores, Ettore Sutti, Juliana Valentim, Veera Vehkasalo, Ruth Weismann, Björn Wilda
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0,
70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage
28 500
Abonnemente
CHF 250.–, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt. IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.
25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)
Gönner-Abo für CHF 320.–
Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)
Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–
Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.
Bestellen
Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90
Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel
Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo
Internationales Redaktor*innen-Porträt
Ich war erst sieben Jahre alt, als ich mich zum ersten Mal traute, über meinen Traumberuf Journalistin zu sprechen. Wobei mein Traum ein Klischee war: Ich wollte die Welt verändern. Aber als Teenager war ich der Schule überdrüssig. Meine Noten waren nicht gut genug, und ich wurde früh Mutter. Nachdem ich meine Heimatstadt verlassen hatte, konnte ich mir endlich die nötige Bildung aneignen.
Mein Leben war dann eine wackelige Reise zu etwas, das der Erfüllung meines Traums ähneln könnte. Ich wurde Journalistin, als meine Söhne noch im Kleinkindalter waren. Und ich habe 20 Jahre lang als Reporterin, Rechercheurin, Kolumnistin, Redaktorin und Managerin bei einer der grössten Tageszeitungen Schwedens gearbeitet. Ich war privilegiert, etabliert und gut bezahlt.
Aber etwas fehlte. Der Journalismus, in dem ich da steckte, hatte nicht den Einfluss auf die Gesellschaft, den ich mir wünschte, weder auf lokaler noch auf globaler Ebene. Die sozialen Themen, die mir am Herzen lagen, standen in der Medienlandschaft im Schatten. Ich verlor meinen Antrieb.
Doch vor sieben Jahren wurde die Stelle als Chefredaktorin der Strassenzeitung Faktum frei. Hier fand ich eine globale Bewegung, die Menschen eine Stimme gibt, die sonst nicht gehört werden. Es ist Journalismus, der Meinung, Wissen, Menschlichkeit und nicht zuletzt Würde in die Welt bringt.
Gemeinsam schaffen wir einen einzigartigen Journalismus, bei dem wir nicht miteinander konkurrieren –stattdessen helfen wir uns gegenseitig und teilen unsere redaktionellen Inhalte, sodass sie über den INSP News Service die ganze Welt erreichen. Grosse und kleine Zeitungen unterstützen sich gegenseitig und geben marginalisierten Menschen eine Stimme, indem sie ihre Geschichten, Gedanken und Meinungen veröffentlichen.

Sarah Britz arbeitete zunächst bei einer der grössten schwedischen Tageszeitungen. Nach zwei Jahrzehnten wechselte sie zur Göteborger Strassenzeitung Faktum, wo sie seit sieben Jahren Chefredaktorin ist. Für sie die Erfüllung eines Traums: Die Art von Journalismus zu machen, wegen der sie sich für die Medienbranche zu interessieren begann.
In einem Strassenmagazin liest man von der Gesellschaft, in der man lebt, aber gleichzeitig lernen die Leser*innen auch Neues von dem, was in der Welt passiert. Wie sieht Obdachlosigkeit in Norwegen aus oder in Japan? Welche Herausforderungen gibt es für die Demokratie in Mexiko? Strassenzeitungen sorgen für Würde, Beschäftigung, Wandel und für lokales und globales Wissen – und das ist die bestmögliche Waffe für Wandel und Gerechtigkeit überhaupt.
Der Journalismus, von dem ich träumte, als ich klein war, findet jetzt statt. Er ist kein Klischee mehr. Und heute bin ich dankbar, dass ich Teil einer Bewegung mit Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt bin, die gemeinsam Veränderungen bewirken.
Dieser Text, so wie die meisten Porträts im Mittelteil des Heftes, stammt aus dem Street News Service – der gemeinsamen Austauschplattform des Internationalen Netzwerks der Strassenzeitungen und erscheint mit freundlicher Genehmigung von FAKTUM / INSP.NGO.
Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.
Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.
Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.
Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.
Eine von ihnen ist Marzeyeh Jafari
«Vor wenigen Jahren bin ich als Flüchtling in der Schweiz angekommen –und wusste zunächst nicht wohin. Ich hatte nichts und kannte niemanden.
Im Asylzentrum in Basel hörte ich zum ersten Mal von Surprise. Als ich erfuhr, dass Surprise eine neue Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiterin sucht, bewarb ich mich sofort. Heute arbeite ich Teilzeit in der Heftausgabe – jetzt kann ich mir in der Schweiz eine neue berufliche Zukunft aufbauen.»
Eine von ihnen ist Marzeyeh Jafari «Vor wenigen Jahren bin ich als Flüchtling in der Schweiz angekommen –und wusste zunächst nicht wohin. Ich hatte nichts und kannte niemanden. Im Asylzentrum in Basel hörte ich zum ersten Mal von Surprise. Als ich erfuhr, dass Surprise eine neue Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiterin sucht, bewarb ich mich sofort. Heute arbeite ich Teilzeit in der Heftausgabe – jetzt kann ich mir in der Schweiz eine neue berufliche Zukunft aufbauen.»

Scha en Sie echte Chancen und unterstützen Sie das unabhängige Förderprogramm «Chancenarbeitsplatz» mit einer Spende.
Scha en Sie echte Chancen und unterstützen Sie das unabhängige Förderprogramm «Chancenarbeitsplatz» mit einer Spende. Mit einer Spende von 5000 Franken stellen Sie die Sozial- und Fachbegleitung einer Person für ein Jahr lang sicher.
Mit einer Spende von 5000 Franken stellen Sie die Sozial- und Fachbegleitung einer Person für ein Jahr lang sicher.
Unterstützungsmöglichkeiten:
Unterstützungsmöglichkeiten:
1 Jahr CHF 5000.–½ Jahr CHF 2500.–¼ Jahr CHF 1250.–
1 Jahr CHF 5000.–
½ Jahr CHF 2500.–¼ Jahr CHF 1250.–
1 Monat CHF 420.–Oder mit einem Betrag Ihrer Wahl.
1 Monat CHF 420.–Oder mit einem Betrag Ihrer Wahl.
Spendenkonto:
Spendenkonto:
Surprise, 4051 Basel
Surprise, 4051 Basel
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Vermerk: Chance
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Vermerk: Chance
Oder Einzahlungsschein bestellen: +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo oder surprise.ngo/spenden
Oder Einzahlungsschein bestellen: +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo oder surprise.ngo/spenden
Herzlichen Dank fürIhrenwichtigen Beitrag!
Herzlichen
Dank fürIhrenwichtigen Beitrag!
Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Beat Hübscher – Schreiner, Zürich
KMS AG, Kriens
Brother (Schweiz) AG, Dättwil Coop Genossenschaft www.wuillemin-beratung.ch
Stoll Immobilientreuhand AG
Gemeinnützige Frauen Aarau
movaplan GmbH, Baden
Maya Recordings, Oberstammheim
Madlen Blösch, Geld & so, Basel onlineKarma.ch / Marketing mit Wirkung
Scherrer + Partner GmbH www.dp-immobilienberatung.ch
Kaiser Software GmbH, Bern
Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Heller IT + Treuhand GmbH, Tenniken
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Bodyalarm GmbH – time for a massage
Anyweb AG, Zürich
Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich Fäh & Stalder GmbH, Muttenz
Hypnose Punkt, Jegenstorf Unterwegs GmbH, Aarau
Infopower GmbH, Zürich
Dipl. Steuerexperte Peter von Burg, Zürich
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.
Kontakt: Clara Fasse
17.05.
03.08.