
Was ist FM 4 -Musik?
30, sucht junges Publikum



Was ist FM 4 -Musik?
30, sucht junges Publikum

Alexandra ist stolz auf ihren Job und ihren Beitrag zur Wiener Kultur. Durch ihre Arbeit sorgt sie dafür, dass das kulturelle Erbe für die Zukunft digitalisiert und den Bürger*innen zugänglich gemacht wird. Diese wichtige Aufgabe motiviert sie täglich aufs Neue.
Die Stadt Wien bietet ihr ein faszinierendes, vielfältiges und innovatives Arbeitsumfeld und das in einem krisensicheren Job mit Verantwortung und einer guten Work-Life-Balance.
Arbeite auch du an Wien und bewirb dich unter: jobs.wien.gv.at
#arbeitenanwien
Als ich auf dem Weg zum Interview mit Melissa Erhardt für die Coverstory dieser Ausgabe war, hörte ich – eh klar – FM4. Aufmerken musste ich, als direkt hintereinander »Good Luck, Babe!« von Chappell Roan, der »Guess«Remix von Charli XCX feat. Billie Eilish und dann das Talking-Heads-Cover »Girlfriend Is Better« von Girl in Red liefen. Mein erster Gedanke: sehr cool, dass drei aktuelle queere Songs von beziehungsweise mit queeren Frauen einfach so, mitten in der Kernzeit im Radio laufen. Zweiter Gedanke: Vor zwanzig Jahren hätte es vielleicht höchstens Girl in Red in die Rotation bei FM4 geschafft und vermutlich nicht mit diesem Lied. FM4-Musik hat sich verändert. Teilweise eindeutig zum Besseren: mehr FLINTA*, mehr österreichische Musik, insgesamt diverser. Teilweise aber auch in Richtungen, bei denen Fans der ersten Stunde oft schwer mitkönnen. Ich selbst hatte das Glück, mich musikalisch parallel mit FM4 zu öffnen. Vor zwanzig Jahren war Pop für mich ein Schimpfwort und Mainstream eine No-go-Area. Dieses Jahr belegen die Alben von Chappell Roan und Charli XCX Platz eins und zwei in meiner persönlichen Jahresplaylist.
Wie Melissa dann wenig später völlig richtig anmerkt, ist diese Abneigung gegenüber dem Mainstream ja nichts anderes als eine kulturelle Einstellung, die letzten Endes nur den persönlichen Horizont einengt. In unserer Coverstory haben wir uns angesehen, wie sich der musikalische Horizont von FM4 über 30 Jahre erweitert hat. Und was diese Erweiterung für all jene bedeutet, die sich bei FM4 »at home« fühlten, fühlen und fühlen sollen.
Darüber hinaus findet sich in diesem Heft ein ausgiebiges FotografieSpecial. Unsere Autorin Helene Slancar widmet sich dafür der Fotomeile Westbahnstraße und erklärt, warum sich gerade hier das Herz der Wiener Fotoszene entwickelt hat. Martin Zimmermann wiederum traf den »Esel« Lorenz Seidler zum Gespräch, um herauszufinden, was den Humor eines Esel-Fotos ausmacht. Einer fast schon in Vergessenheit geratenen Technik spürt Sandra Fleck nach: Zyanotypie ist vielen nur noch über alte Blaupausen für technische Pläne ein Begriff, kann aber einiges mehr und erlebt gerade einen Aufschwung in der DIY-Bewegung. Zu guter Letzt wirft Johanna T. Hellmich einen Blick in die schummrigen Ecken des Internets und berichtet, was Dark Academia mit Lernmotivation zu tun hat. Also rein in den karierten Sweater und ran ans Heft!

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at
Web www.thegap.at
Facebook www.facebook.com / thegapmagazin
Twitter @the_gap
Instagram thegapmag
Issuu the_gap
Herausgeber
Manuel Fronhofer, Thomas Heher
Chefredaktion
Bernhard Frena
Leitender Redakteur
Manfred Gram
Gestaltung
Markus Raffetseder
Autor*innen dieser Ausgabe
Luise Aymar, Victor Cos Ortega, Sandra Fleck, Barbara Fohringer, Johanna T. Hellmich, Kami Kleedorfer, Tobias Natter, Dominik Oswald, Helena Peter, Simon Pfeifer, Mira Schneidereit, Helene Slancar, Jana Wachtmann, Sarah Wetzlmayr, Martin Zimmermann
Kolumnist*innen
Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner
Fotograf*innen dieser Ausgabe
Sandra Fleck, Bernhard Frena, Manuel Fronhofer, Teresa Wagenhofer
Coverillustration
Lisa Arnberger / missfelidae.com
Lektorat
Jana Wachtmann
Anzeigenverkauf
Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl
Distribution
Wolfgang Grob
Druck
Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.
Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien
Geschäftsführung
Thomas Heher
Produktion & Medieninhaberin
Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien
Kontakt
The Gap c/o Comrades GmbH
Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at
Bankverbindung
Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX
Abonnement
6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at
Heftpreis
€ 0,—
Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.
Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.
014 Was ist FM4-Musik?
024 Motivierende Ästhetik
Helfen Dark Academia & Co gegen Lernfrust?
028 »Ich kann nach wie vor so blöd sein, wie ich will« Ein Gespräch mit dem Esel aka Lorenz Seidler
032 Digitale Welt, analoges Herz Die Fotomeile Westbahnstraße
036 Wenn die Sonne blau macht Zyanotypie als neue DIY-Bewegung



Fotografie Vom Motiv, durch die Linse, auf den Film, zu Papier

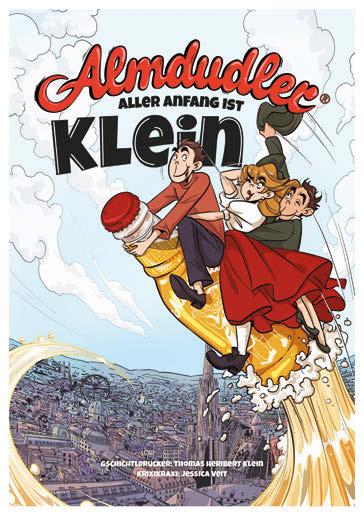
Auf Seite 7 dieser Ausgabe zeigen wir euch einen Ausschnitt aus »Aller Anfang ist Klein«, dem ersten Comic aus dem Hause Almdudler, der mit viel Humor auf die Meilensteine des Unternehmens zurückblickt. ———— Er habe das große Bedürfnis gehabt, seine Geschichte für die Nachwelt festzuhalten, sagt Thomas Heribert Klein, der gemeinsam mit seiner Schwester Michaela Eigentümer des Familienunternehmens Almdudler ist. Und mit »Aller Anfang ist Klein« ist ihm das auf sehr augenzwinkernde Art und Weise gelungen. Illustriert von Jessica Veit, erzählt der Comic in sechs Kapiteln von den persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen, den Schicksalsschlägen und Herausforderungen, die Thomas Heribert Klein geprägt haben. In der hochwertigen Printversion mit Hardcover ist der Comic im Almdudler-Webshop als »Comic-Box« um € 39,90 (mit drei Trachtenpärchen-Flaschen in spezieller »Comic-Edition«) sowie als »ComicBundle« um € 15,90 (mit Almdudler-Dose im Comicstil) erhältlich.
Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. www.almdudler.com

003 Editorial / Impressum
006 Comics aus Österreich: Kristian Ujhelji
009 Charts
022 Golden Frame
040 Prosa: Norbert Maria Kröll
042 Workstation
046 Gewinnen
047 Rezensionen
052 Termine
012 Gender Gap: Toni Patzak
060 Screen Lights: Christoph Prenner
066 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl
Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal erforscht Kristian Ujhelji, wie abstrakt das Medium sein kann. ———— Wer bei Comics an bunte Bildchen denkt, die lustige Geschichten erzählen, wird von Kristian Ujheljis trippy Bildwelten gehörig vor den Kopf gestoßen. Auf den ersten Blick wirken diese nämlich nicht nur ziemlich non-narrativ, sondern sie erschließen sich selbst geübten Comicleser*innen nicht unmittelbar. Denn ja: Das Lesen von Comics will geübt sein. Wie alle medialen Formen hat es seine Konventionen und seine Regeln, die kennengelernt und verstanden werden wollen. Ujhelji spielt mit diesen Erwartungshaltungen, bricht sie, mischt sie neu, schafft es dabei aber, auf jenem schmalen Grat zu balancieren, der Betrachter*innen fortwährend glauben lässt, doch noch Reste von Erzählungen, von klassischer Comicstruktur, von einer inneren Logik zu erhaschen.
Kristian Ujhelji hat sich neben Comics auch auf Buchgestaltung und Illustration spezialisiert. Seine Arbeiten präsentiert er unter anderem regelmäßig auf europäischen Kunstbuchmessen.
Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

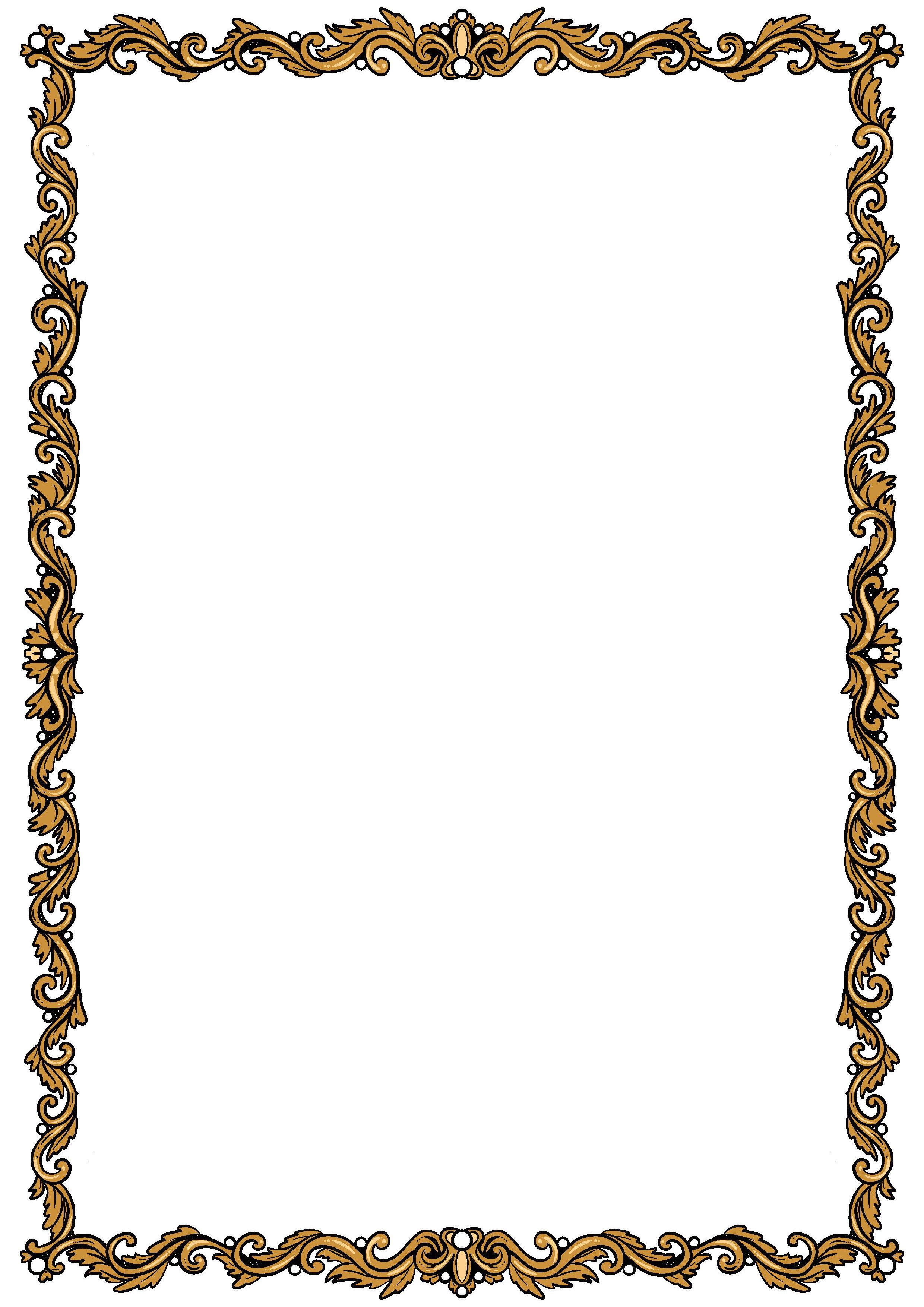
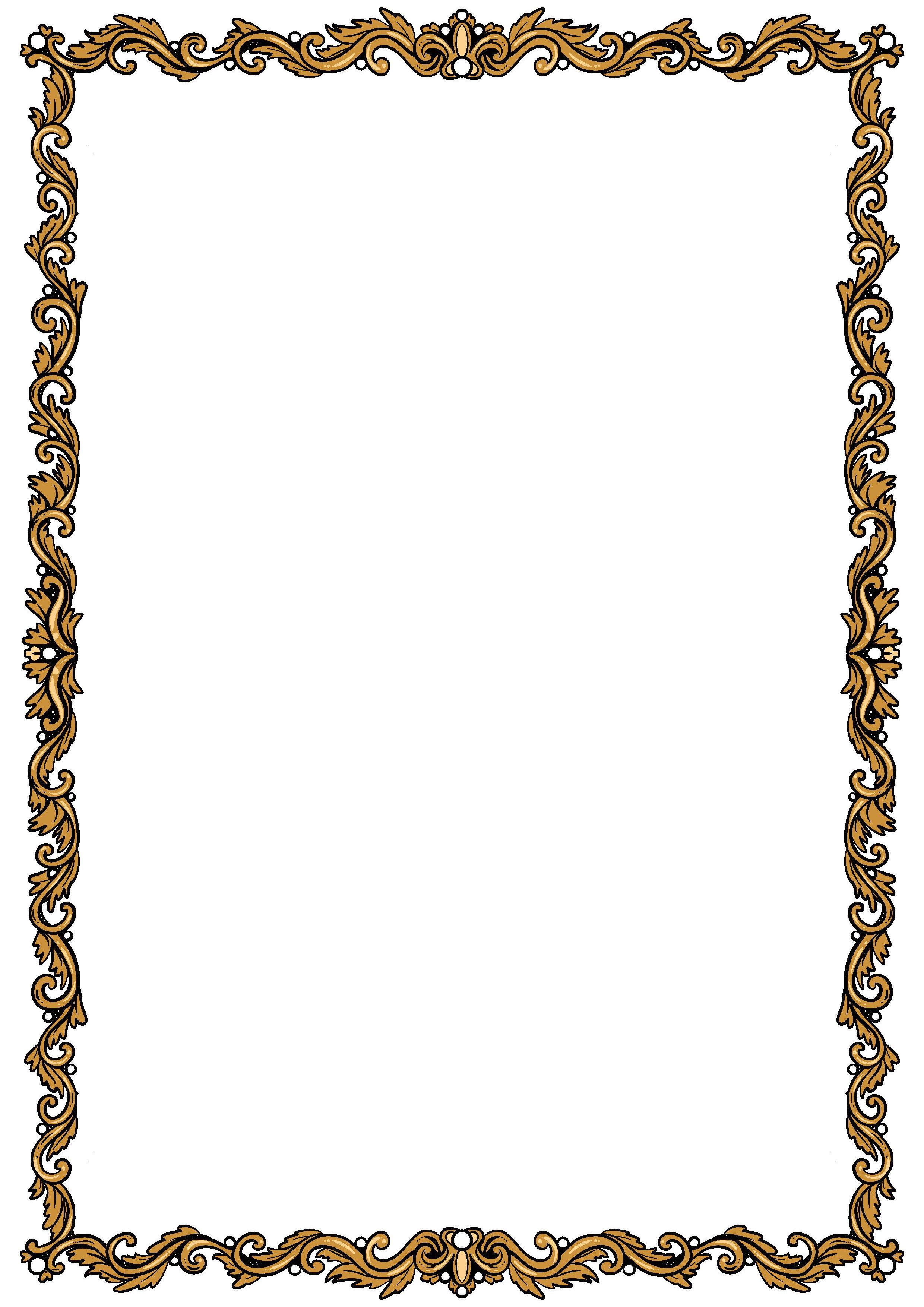
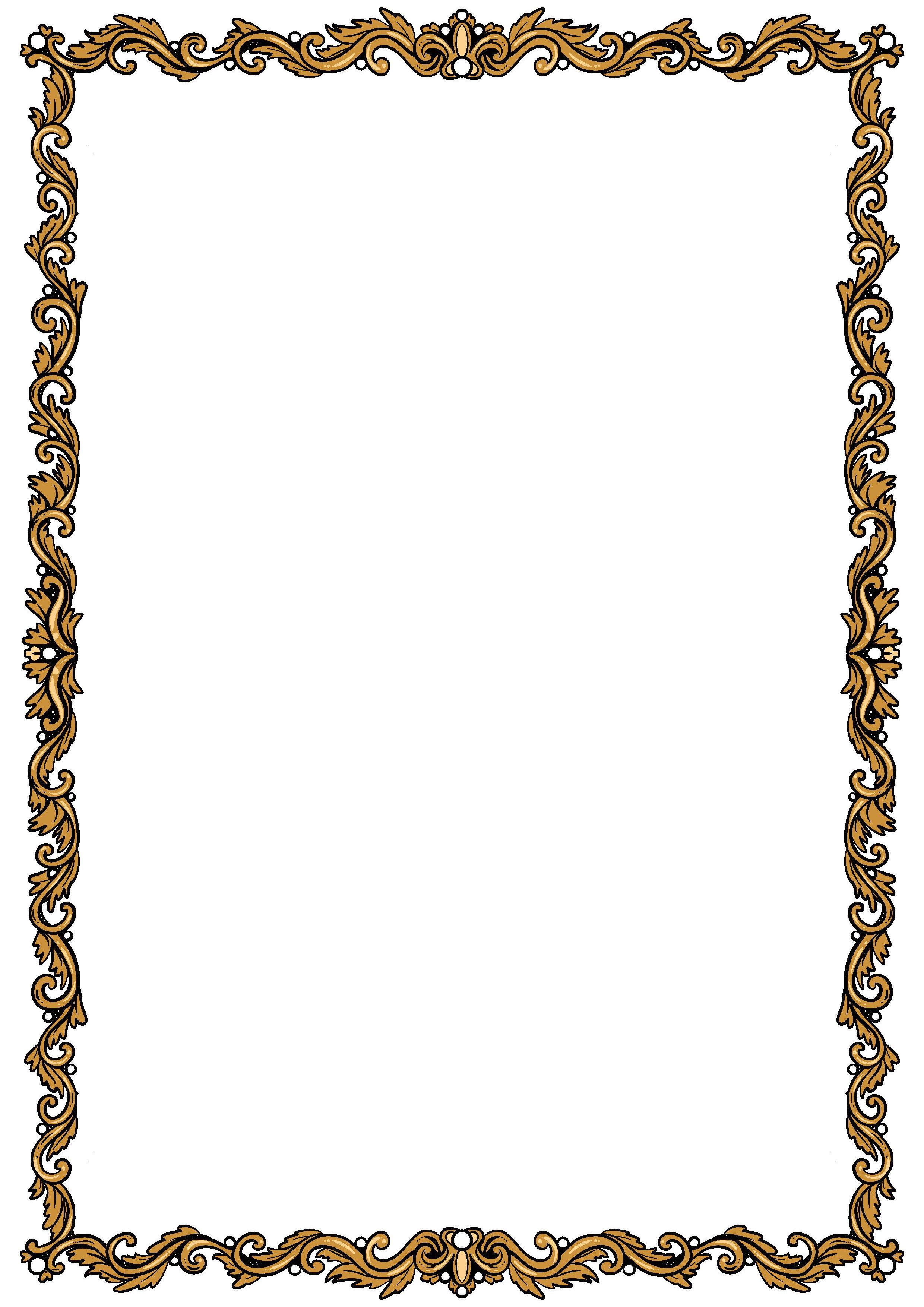
Sandra Fleck
Wenn sie nicht gerade auf die desaströsen Verhältnisse in Österreichs Journalismus aufmerksam macht, verbringt Sandra sehr viel Zeit mit ihren Lieblingsmenschen. Am ehesten trifft man sie dann bei Konzerten. Nach dem Tod der Wiener Zeitung nahm sie dieses Interesse zum Anstoß, nicht länger über Wiens Hochkultur zu schreiben, sondern kleineren musikalischen Angeboten eine Plattform zu geben. Randthemen interessieren sie generell – wie etwa in diesem Heft das in Vergessenheit geratene Verfahren der Zyanotypie.
Lisa Arnberger
Schon in der Schule bewies unsere Coverillustratorin guten Geschmack und stritt sich mit ihren Kolleg*innen um TheGapAusgaben und FM4Kalender. Ursprünglich kommt Lisa aus Attersee am Attersee, sie lebt allerdings seit vielen Jahren in Linz an der Donau – mit 150 Zimmerpflanzen und zwei MaineCoonKatzen. Letztere zeichnet sie mit Begeisterung, wenn sie nicht gerade Bandmerch, Konzertplakate und Plattencovers illustriert. Musikalisch lässt sie sich da kaum einschränken. Selbst hört sie alles – solange der Vibe passt.








6 Ausgaben um nur € 19,97
Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?
Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturschaffen aus und in Österreich begleitet?
Dann haben wir für euch das TheGapJahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.

TOP 10
Ins Herz gehende Musiker*innen-Lächler in Musikvideos
01 Talk Talk »Such a Shame«
02 Small Faces »I’m Only Dreaming« (1967, correct lip synch)
03 Queen »These Are the Days of Our Lives«
04 Shakespears Sister »Stay«
05 Weezer »Buddy Holly«
06 David Bowie »When I’m Five«
07 The Cure »In Between Days«
08 Elvis Presley »Return to Sender«
09 The Beatles »Help!«
10 Wolfgang Ambros »Zwickt’s mi« (1975, »Spotlight«)
Wärmespender
01 Ein Lächeln zu bekommen
02 Mein Kater
03 Musik
Auch nicht schlecht: Rumkugeln in heiße Schokolade schmeißen
Sylvia Benedikter betreibt seit 20 Jahren das Geschäft Recordbag in Wien, in dem sowohl Platten als auch Mode angeboten werden.

TOP 10
Pilznamen, die auch als Schimpfwörter durchgehen würden
01 Stinkender Schleimkopf (Cortinarius mussivus)
02 Wildschweinkot-Zärtling (Psathyrella berolinensis)
03 Ästiger Stachelbart (Hericium coralloides)
04 Echter Knoblauchschwindling (Mycetinis scorodonius)
05 Blutroter Hautkopf (Cortinarius sanguineus)
06 Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus)
07 Bocksdickfuß (Cortinarius camphoratus)
08 Schafeuterporling (Albatrellus ovinus)
09 Behangener Düngerling (Panaeolus papilionaceus)
10 Steifstieliger Kahlkopf (Psilocybe strictipes)
TOP 03
Darts-Check-out-Wege, die ich sehr schön finde
01 161: Triple 20 / Triple 17 / Bullseye
02 157: Triple 20 / Triple 19 / Double 20
03 122: Triple 18 / Triple 18 / Double 7 (Back-up Triple 18 / Single 18 / Bullseye)
Auch nicht schlecht www.thedictionaryofobscuresorrows.com
Seit 15 Jahren bringt Andreas Haslauer mit dem DIY-Label Epileptic Media Tapes heraus. Am 23. November wird das im Wiener Celeste gefeiert.



Dass der Haupteingang der Akademie der bildenden Künste in Wien nicht barrierefrei ist, möchte der Künstler, Student und Inklusionsaktivist Philipp Muerling ändern. Nun hat er einen Wettbewerb zu dessen Umgestaltung ausgerufen. ———— Mit seiner »StiegenPerformance« an der Prunkstiege des Akademiegebäudes am Schillerplatz hat Philipp Muerling in den letzten Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Weg zur Barrierefreiheit beim Hauptgebäude der Akademie der bildenden Künste über den Hintereingang führt: Er hievt sich dabei am Fuße der Treppe aus seinem Rollstuhl und probiert dann, sich mit der Kraft seiner Arme die Stiegen hochzuziehen. Dass die Versuche stets scheitern, beschreibt er als ein »absurdes Spektakel«, das der Situation aber angemessen sei. Muerling: »Diese Aktion verdeutlicht Ansätze der Qualen, die entstehen, wenn ein Teil der Gesellschaft ignoriert wird.«
Keine echte Inklusion
Für ihn als ersten und bislang einzigen Rollstuhlfahrer unter den an der Akademie Studierenden heißt das, dass er nicht wie alle anderen über den Haupteingang ins Gebäude gelangen kann. Aber ein barrierefreier Zutritt nur über den Hintereingang, so der Künstler, sei keine echte Inklusion, weil es deren Ziel sein müsse, Diskriminierung – etwa durch Ungleichbehandlung – zu verhindern und allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
Da Muerlings Performance und die angestoßene Diskussion noch zu keinen konkreten Maßnahmen geführt haben, hat er vor Kurzem einen Wettbewerb zur barrierefreien Erschließung des Haupteingangs ausgerufen. Unter dem Motto »Wo alle willkommen sind …« fragt dieser: »Wie kann der Haupteingang barrierefrei sein, ohne eine falsche Aufmerksamkeit zu schaffen, die Besucher*innen stigmatisiert?« Ideen können noch bis 31. Dezember 2024 eingereicht werden. Eine Jury entscheidet dann über das innovativste Projekt – mit dem Ziel, dieses im Jänner im Rahmen des »Rundgangs 2025« an der Akademie der bildenden Künste vorzustellen. Seine Umsetzung soll durch ein Crowdfunding ermöglicht werden. Manuel Fronhofer
Nähere Infos zum Wettbewerb finden sich auf Instagram (@woallewillkommensind) sowie unter www.philippmuerling.com.

Während der Herbst langsam, aber sicher in die Zielgerade einbiegt, wagen wir einen ersten Blick in den Frühling. Genauer gesagt: in den Kinofrühling – mit allem, was bisher zur nächsten Diagonale bekannt ist. ———— Seit 1998 verwandelt sich Graz dank der Diagonale alljährlich zur Filmhauptstadt Österreichs. Das »Festival des österreichischen Films« hat sich in dieser Zeit als wichtiger Treffpunkt für Branche und Publikum etabliert – mit rund 1.500 akkreditierten und mehr als 30.000 weiteren Besucher*innen. Auch 2025 wird sich die spezielle Diagonale-Atmosphäre über der steirischen Landeshauptstadt ausbreiten, zum 28. Mal. Und es gibt schon erste Details dazu.
Die Gesamtheit sozialer Verhältnisse
So ist etwa der Salzburger Dokumentarfilmemacherin Ivette Löcker eine Werkschau gewidmet. Die Diagonale-Intendant*innen Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar, die vergangenes Jahr ihren gelungenen Einstand feierten, beschreiben die 1970 in Bregenz geborene, im Lungau aufwachsende und nun in Berlin lebende Regisseurin »bei aller Dezenz ihrer Herangehensweise« als eine der »blickmächtigsten Filmemacher*innen des Landes«. In ihren Arbeiten stünden Paarwelten im Mittelpunkt, in deren Beziehungsfelder sich Löcker mit enormem Fingerspitzengefühl vorarbeite. »Der Fokus auf das Persönliche beschreibt bei ihr immer auch eine Gesamtheit sozialer Verhältnisse: In ihrem jüngsten Film ›Unsere Zeit wird kommen‹, den die Diagonale als Premiere präsentieren wird, erforscht sie die Hindernisse, die der Liebe eines österreichisch-gambischen Paares im Weg stehen«, heißt es in einer Aussendung. Im Rahmen von »Position: Ivette Löcker« werden erstmals alle Arbeiten der Filmemacherin in einer Personale gezeigt.
Ebenfalls fix ist, dass die Künstlerin Simona Obholzer – als aktuelle Gewinnerin des Diagonale-Preises für Innovatives Kino den Festivaltrailer für die Diagonale 2025 gestalten wird. Koproduziert wird dieser vom Kunsthaus Graz, das traditionellerweise auch eine Ausstellung der Künstlerin ausrichten wird.
Jana Wachtmann
Die nächste Diagonale findet von 27. März bis 1. April 2025 in Graz statt. Aktuelle Infos unter www.diagonale.at.
59Fifty mit Monogramm
der New York Yankees
»Es gibt nichts, was schöner ist als diese Mütze mit Schirm«, rappt Samy Deluxe in seinem »Cap Song«. Ja, es gibt einen eigenen »Cap Song«, und ja, die Schirmmütze ist heutzutage die mit Abstand beliebteste Kopfbedeckung und längst nicht mehr nur reiner Sonnenschutz für Sportler*innen. Aber wie kam es dazu und seit wann gibt es überhaupt Kappen?
Kopfbedeckungen sind fast so alt wie die Menschheit. Ursprünglich ein reiner Schutz gegen Wind und Wetter, wurden sie später auch Zeichen der Standeszugehörigkeit sowie Ausdruck der eigenen kulturellen Identität. Frühe Formen der Kappe lassen sich auf ungefähr 3.200 v. u. Z. datieren. Die Caps, wie wir sie heute kennen, wurden allerdings maßgeblich vom ab dem 19. Jahrhundert in den USA aufkommenden Baseballsport geprägt.
Die Strohhüte mit Visieren waren ein wichtiger Teil der Ausrüstung, um heranfliegende Bälle im Gegenlicht der Sonne nicht aus den Augen zu verlieren, und wurden erstmals 1849 von den New York Knickerbockers, besser bekannt als Knicks, getragen. Kurz darauf tauschte man das etwas unbequeme Material gegen Baumwolle und ein paar Jahre später führte das Team der Brooklyn Excelsiors schließlich den Vorläufer der heutigen Schirmkappe mit rundem Top ein, der als »Brooklyn Style Cap« bekannt wurde.
Monogramme, Maskottchen und mehr
Um 1900 kamen dann die ersten Verzierungen auf die bis dahin noch eher langweiligen Kappen: Das nach wie vor klassische Monogramm haben wir den Boston Braves zu verdanken, die Detroit Tigers stickten wiederum als erste Mannschaft ihr Maskottchen auf die Kopfbedeckung.
Im Laufe der Zeit wurde das Capdesign durch Details wie Luftlöcher, längere und stabilere Schirme sowie Latexgummieinsätze optimiert. Eine wichtige Rolle spielte dabei die 1920 von einem deutschen Auswanderer gegründete Firma New Era, die Mitte des letzten Jahrhunderts den 59FiftySchnitt erfand, der bis heute ein Standard ist. Rund um diese Zeit entwuchs die Schirmkappe auch dem Baseballfeld und fand Einzug in die Alltagsgarderobe der Menschen. Nicht mehr nur Sportteams bestickten von da an ihre Kappen,
sondern die unterschiedlichsten Brands, aber etwa auch politische Gruppierungen nutzten die kostbare Werbefläche. Anhänger*innen konnten damit einfach ihre Verbundenheit zeigen. Für Individualist*innen war die Kappe wiederum ein leicht zu personalisierendes Item.
Kultstatus einzementiert
Prominente Platzierungen wie in der TV-Serie »Magnum« mit Tom Selleck oder im Film »Top Gun« mit Tom Cruise zementierten den Kultstatus der Kappe in den 80ern. Um sich vor Paparazzi zu schützen, begannen Stars, auch abseits von Leinwand oder Bühne Caps zu tragen, was die Kappe noch stärker in den Zeitgeist einschrieb. Schlussendlich sprangen auch große Modezeitschriften auf diesen Trend auf und etablierten Schirmmützen als Unisex-Accessoire.
Seither haben Superstars wie Bruce Springsteen oder Jay-Z auf ihren Albumcovern genauso Caps getragen wie es Landwirt*innen auf ihren Traktoren tun. Für große Luxusmarken sind sie ein fixer Bestandteil jeder Kollektion und Plattformen wie Zalando verkaufen sie in allen erdenklichen Varianten. Caps sind aus unserem Alltag schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Es gibt wenig, das so sehr für den American Way of Life und die damit verbundene Coolness steht wie eine dunkelblaue NewYork-Yankees-Strapback auf dem Kopf. Ein dauerhaftes Symbol für Sportlichkeit, Bodenständigkeit, Komfort und Style.
Auch du möchtest deinen Kopf lässig vor den Elementen schützen? Entdecke jetzt unter www.zalando.at Caps in allen Styles und von diversen Marken wie New Era, ’47, Nike, Adidas und mehr.

Toni Patzak
hakt dort nach, wo es wehtut
Aktuell befinde ich mich auf einem Austauschsemester in Südafrika und komme das erste Mal in meinem Leben in den Genuss, die Blasseste in einem Hörsaal zu sein. In Österreich habe ich das noch nie geschafft, weder in der Schule noch an der Uni noch auf Partys. Nicht, dass ich jetzt meine, dass daran jemand die Schuld trägt oder dass man das umgehend ändern sollte. Es ist einfach etwas, womit ich mich schon mein ganzes Leben beschäftigen muss. Sich nicht wiederfinden zu können in den Gesichtern der Lehrer*innen, Professor*innen und Mitmenschen – das macht etwas mit einem. Erst psychologisch, dann nach und nach auch körperlich.
Diskriminierung macht krank
Wie Publikationen aus den USA seit den 1990ern zeigen, leiden Minderheiten – ganz egal, ob sexuelle, ethnische oder religiöse – unter einem sogenannten Minority-Stress. Wenn man einer Minderheit angehört, die von der Hegemonie bewusst oder unbewusst ausgegrenzt beziehungsweise diskriminiert wird, bekommt das der Körper mit.
Psychologisch manifestiert sich das etwa durch eine Häufung von Depressionen, Angstzuständen und Burn-outs in diesen Gruppen. Dabei sind die Coping-Mechanismen, auf die zurückgegriffen wird, oft genauso schädlich wie die Leiden selbst. So zeigt sich insbesondere bei marginalisierten Jugendlichen eine höhere Rate an Missbrauch von Alkohol und Drogen.
Physiologisch sorgt der über längere Zeiträume anhaltende Stress dann dafür, dass hohe Mengen des Stresshormons Cortisol ausgeschüttet werden. Auch blöd vom Körper, als Reaktion auf andauernde institutionelle und zwischenmenschliche Diskriminierung so zu reagieren wie eine Gazelle, wenn sie einen Löwen sieht. Ein dysfunktionaler Cortisolspiegel kann nämlich anstatt zu lebensrettenden Sprüngen zu Blutdruck-, Kreislauf- und Schlaf-
problemen sowie zu einem geschwächten Immunsystem führen. Eine Minderheit zu sein, ist also tatsächlich ungesund.
Was passiert aber, wenn man mehreren Minderheiten gleichzeitig angehört? So wie ich, die queer und Schwarz ist? Schon stressig genug, das Ganze, aber dazu kommt noch, dass ich auch eine Frau bin. Das ist zwar nicht unbedingt eine Minderheit, führt aber dennoch zu Diskriminierung.
Also, was haben wir bis jetzt? Erstens queer, zweitens Schwarz und drittens Frau? In welcher Reihenfolge ich das aufzähle, hängt davon ab, was mir zum größten Problem gemacht wird oder – siehe oben – was mich am ehesten umbringt. In meiner Heimat Wien müsste es jedenfalls heißen: erstens Schwarz, zweitens Frau und drittens queer.
Sexist oder doch Rassist?
Es ist keine Überraschung, dass man in Österreich noch offenen Rassismus finden kann. So passiert es mir durchaus hin und wieder, dass ich in der Bim die außergewöhnliche Aufforderung zu Ohren bekomme, doch nach Afrika zurückzugehen. Oder dass mir unverhohlen dargelegt wird, das Hitler damals recht gehabt hätte. Wenn ich kleinere Diskriminierungen erlebe, ist es manchmal jedoch schwer einzuschätzen, weswegen man mich gerade so behandelt. Weil Frau oder weil Schwarz? So weiß ich nicht, ob der Thermenwart ein Sexist oder doch ein Rassist ist, wenn er meint: »Darum müssen Sie sich nicht kümmern. Sie sind dafür für was anderes gut.« Grundsätzlich nehme ich in Österreich eher an, dass es Rassismus ist, bevor ich Sexismus vermute. Das habe ich mir irgendwann so angewöhnt: erst mal vom für mich Gefährlichsten ausgehen und mich dann weiterarbeiten. Hat am Pausenhof halbwegs gut funktioniert, tut es heute noch immer. Hier in Südafrika oder in der Interaktion mit meinen Schwarzen Verwandten dreht sich
diese Standardannahme dann ziemlich schnell um. So frage ich mich nicht, ob alle meine Onkel internalisierte Rassisten sind, wenn man mich in einer Diskussion nicht zu Wort kommen lässt oder meine Meinung verniedlicht wird. Und egal ob das jetzt komisch klingt oder nicht: Das ist verdammt erfrischend! Ich gehe durch die Straßen Pretorias und mir wird etwas Ekliges hinterhergerufen – aufgrund meines Geschlechts und nicht meiner Hautfarbe. Dafür allein lohnt es sich zu reisen. So etwas kann man zu Hause einfach nicht bekommen, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Ob ich eine Schwarze Frau bin oder eine Frau, die Schwarz ist, kommt eben darauf an, mit wem ich wo auf der Welt in Interaktion trete.
Das User*innenerlebnis einer intersektional diskriminierten Person ist komisch und nicht wirklich benutzer*innenfreundlich angelegt. Noch verwirrender ist es, wenn Sexualität dazukommt. Dann weiß man teilweise gar nicht mehr, wo die eine Diskriminierung aufhört und die andere anfängt. Was mich an der Sache aber wirklich ärgert, ist nicht, dass ich eine Reihe im Identity-Politics-Bingo ausfüllen kann, sondern dass es tatsächlich meiner Lebensqualität schadet. Dass ich und meine Mitmenschen – egal aus welcher Gruppe – tatsächlich gestresster und daher kränker sind, weil wir uns eine Welt aufgebaut haben, die davon profitiert, dass es eine In- und eine OutGroup gibt.
Natürlich hoffe ich, dass zu meinen Lebzeiten noch erhebliche Verbesserungen stattfinden werden, damit meine Kinder nicht das Gleiche mitmachen müssen wie ich. Oder zumindest, dass man mich auch in Österreich nicht mehr aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert. Sondern nur noch aufgrund meines Geschlechts.
patzak@thegap.at @tonilolasmile


Jetzt eigene
Spendenaktion starten!

Es ist so einfach, Freude zu schenken. Das wissen auch die Jungs von der Gesangskapelle Hermann , die nicht nur zu Spenden zugunsten der Kindernothilfe aufrufen, sondern sich dafür auch sportlich ordentlich ins Zeug legen.
Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die Gesangskapelle Hermann erstmals aus ihrem Proberaum in der Wiener Hermanngasse ausgezogen ist, um die Welt mit ihrem betörenden Mundartgesang zu einem glücklicheren Ort zu machen. Hunderte von Konzerten hat die Gruppe seitdem absolviert – und während sich die Hermänner oftmals um Kopf und Kragen sangen, blieb im Publikum kaum ein Auge trocken. Mit geradezu stolz vor sich her getragener Schüchternheit trällerten sie ihre ganz und gar nicht harmlosen Texte, die längst legendär sind – man höre etwa Songs wie »Knedl«, »Wegana« oder »Elektroradl«.
Kunterbunt, goschert, cool »Sehr sogar«, ihr im Herbst erschienenes fünftes Album, markiert nun den nächsten Meilenstein in der Geschichte der Vokalrabauken. Die Musik darauf kommt so kunterbunt, goschert, liebevoll und cool daher wie die Gesangskapelle selbst. Sie ist mal Hip-Hop, mal Schlager und mal großer Pop, gewandet sich schrill und dann wieder ganz bescheiden, ist unglaublich unterschiedlich und doch wie aus einem Guss. »Sehr sogar« ist Lebensfreude, bedeutet, im Moment zu sein und das Schöne zu feiern, soll Mut machen und dabei helfen, alltägliche Sorgen zumindest ein bisschen ausblenden zu können.
All das passt bestens zum sozialen Engagement der A-cappella-Boyband: 2025 wird die Gesangskapelle Hermann nämlich bereits zum dritten Mal für den guten Zweck – konkret für Kinderrechte – beim Vienna City Marathon an den Start gehen: »Wir als Gesangskapelle verbringen sehr viel und gerne Zeit miteinander, hauptsächlich allerdings im beruflichen Kon-
text. Die Teilnahme beim Vienna City Marathon ist für uns etwas Besonderes, da wir selten gemeinsam etwas unternehmen, das nichts mit Musik zu tun hat. Umso schöner ist es, dass wir uns dabei auch noch für einen guten Zweck einsetzen können.«
Für Kinder in Not aktiv werden
»Da Kinder keine eigene Lobby haben«, lassen uns die Hermänner weiters wissen, »liegt es für uns auf der Hand, Engagement für deren Rechte zu zeigen.« Ihre Teilnahme am Halbmarathon soll nun dazu aufrufen, die Kindernothilfe in ihrem Einsatz für Kinderrechte mit Spenden zu unterstützen, – und soll Vorbild sein. Denn jede*r von uns kann auf der Website der Kindernothilfe seine eigene Spendenaktion starten und für Kinder in Not aktiv werden. Egal, ob man nun Geburtstag feiert, dafür Muffins bäckt oder eben einen Halbmarathon läuft. In diesem Sinne: Do it like the Gesangskapelle!
Aktuelle Infos zur Gesangskapelle Hermann unter www.gesangskapellehermann.at, zur Kindernothilfe unter www.kindernothilfe.at. Das Album »Sehr sogar« ist bei Omdrom Music erschienen. Die nächsten Konzerttermine der Gesangskapelle Hermann lauten: 25. und 26. November sowie 6. Dezember, Wien, Theater am Spittelberg — 7. Dezember, Freistadt, LocalBühne — 19. Dezember, Bruck an der Leitha, Stadttheater — 5. Jänner, Wien, Orpheum — 24. Jänner, Hall in Tirol, Stromboli — 25. Jänner, Klagenfurt, Kammerlichtspiele — 7. Februar, Braunau, Gugg — 15. Februar, Wien, Kulisse.
Kaum ein anderes Medium hat die österreichische Jugendkultur in den letzten drei Jahrzehnten so geprägt wie Radio FM4. Nicht zuletzt aufgrund einer musikalischen Linie, die stets unverkennbar war, eben FM4-Musik. Doch mit dem Alter kommen Veränderungen. Wir haben uns angeschaut, wer heute noch bei FM4 »at home« ist und welche Musik dort auf den Playlisten landet. ———— Schnell den Kaugummi aus dem Mund genommen und neben das Mischpult geklebt, während bereits die bis heute bekannte Kennmelodie ertönt. Dann begrüßt Angelika Lang die neuen Hörer*innen mit den Worten: »Willkommen zu Hause. Das Ding heißt FM4. Das Ding ist das Radio, das ihr euch verdient habt.« Das Datum ist der 16. Jänner 1995. Die Zeit 19 Uhr. Der erste Song, den Lang gleich darauf mit den Worten »So klingt’s, wenn das FM4-Herz zu schlagen beginnt« anmoderiert ist »Sabotage« von den Beastie Boys. Eine Nummer, die zu dem Zeitpunkt ein knappes Jahr alt ist. Irgendwo zwischen Punk, Hip-Hop und Alternative angesiedelt. Keine Chartplatzierung in Österreich. Sicher nicht Mainstream, aber immanent radiotauglich.
»Musik war damals das Grundnahrungsmittel eines jeden Fans im identitätsstiftenden Popkulturuniversum«, erinnert sich Angelika Lang heute, fast 30 Jahre später. »Und wir waren Fans. Mit journalistischem Zugang

Angelika Lang, Radiomoderatorin
zwar, aber das Fundament war Hingabe, insofern also bar jeglicher Objektivität. Und weil Fantum Spezialist*innentum ist und wir im Grunde ein Mikrokosmos der Fans da draußen waren – noch dazu mit sehr durchlässigen Grenzen zu ›draußen‹ –, war das Profil und die Bandbreite von ›FM4-Musik‹ von Anfang an klar. Wer Marketingbegriffe zur Einordnung braucht: independent.«
Von diesen Anfängen ausgehend hat sich FM4 schnell eine eigene Fangemeinde erarbeitet – und die Musik war dabei immer wesentlicher Faktor. Zwischen den diversen Spezialsendungen, die Genres von Trip-Hop bis Noisecore abdecken, den Samplerreihen
»FM4 Sound Selection« und »Sunny Side Up« sowie den diversen Konzert- und Festivalformaten – Geburtstagsfest, Überraschungskonzerte, Unlimited und natürlich die Medienpartnerschaft beim Frequency – hat sich der Sender seine eigene musikalische Nische, fast sein eigenes Genre geschaffen: FM4-Musik. Der Moderator Robert Rotifer hat dafür vor vielen Jahren den Begriff »Alternative Mainstream« geprägt. Doch trifft diese Bezeichnung heute noch zu? Wie hat sich der Sender im Laufe seiner drei Jahrzehnte musikalisch verändert? Spielt FM4 heute überhaupt noch FM4-Musik?
Marcus »Makossa« Wagner-Lapierre ist seit den Anfängen zuständig für die Musikauswahl des Senders. Der 59-jährige leitet die Musikredaktion, jenes Team, das das gesamte musikalische Programm von 1 bis 22 Uhr gestaltet. Neben Makossa sind dies Andreas Ederer, Michaela Pichler, Alica Ouschan und René Froschmayer. Aber wie seine Kollegin Lisa Schneider meint: »Das letzte Wort hat natürlich Makossa. Was Airplay bekommt, muss er absegnen. Aber alle Leute schlagen ihm Sachen vor.«
Und wie sieht der Entscheidungsträger die Linie des Senders? »FM4-Musik stand früher für die Musik, die man eigentlich nur exklusiv auf FM4 hören konnte. Ich denke, dass der Begriff in der Vergangenheit eine wesentlich wichtigere Bedeutung hatte als heut-

»Musik ist die Antwort. So wie immer im Radio.«
— Lisa Schneider

zutage. In 30 Jahren hat sich viel verändert – 1995 hatte FM4 ein Alleinstellungsmerkmal, was aufgrund der Digitalisierung, Spotify etc. jetzt nicht mehr der Fall ist.«
Ein Alleinstellungsmerkmal, das FM4 jedenfalls noch hat, ist die lang andauernde – und gerade in den letzten zehn Jahren vermehrte (siehe Infografik) – Unterstützung österreichischer Musik. »Ink Music würde es ohne FM4 nicht geben«, bringt es Hannes Tschürtz, Gründer des Indie-Labels, auf den Punkt. Die diversen Labels, die sich parallel zu FM4 entwickelt haben – Siluh, Seayou, Monkey, Wohnzimmer, Las Vegas, Problembär und eben Ink – sowie die Artists, die dort groß geworden sind – Nino aus Wien, Wanda, Voodoo Jürgens, Bilderbuch etc. – seien für ihn »die Ursuppe dessen, was heute in diesem Land an Popmusik vorhanden ist«.
Das »Maschin«-Jahr
Eine entscheidende Rolle in dieser Bedeutung von FM4 für die heimische Szene spielt der »Soundpark«. Bei seinem Start 2001 als Internetplattform konzipiert, auf der österreichische Acts Profile anlegen, Songs hochladen und so erste Aufmerksamkeit generieren konnten, war der begleitende Onair-Slot denkbar undankbar: Sonntagnacht von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh. Doch spätestens seit 2013, dem »Maschin«-Jahr, ist österreichische Musik im Kern des FM4-Programms angekommen. Mit dem Umzug des Senders auf den Küniglberg vor fünf Jahren wechselte der »Soundpark« dann in die Primetime: Donnerstag von 19 bis 22 Uhr.
Und gleichzeitig legte die neue »›Soundpark‹-Mama« Lisa Schneider den Fokus ganz bewusst auf die neuen, unbekannten Namen: »Mavi Phoenix kann jeden Tag in der Morningshow zu Gast sein. Der ›Soundpark‹ ist aus einer Zeit heraus geboren, wo das noch weniger möglich war. Es ist schön, dass er jetzt fast wieder so ein bisschen zum Spezifikum wird. Weil wir beim ›Soundpark‹ dann mehr Platz haben, alle Nicht-Mavi-Phoenixe einzuladen und ihnen Raum zu geben. Allen, die noch nicht so angekommen sind.« Sie lege Wert darauf, dass es im »Soundpark« (fast) nur Premieren gebe. Die neue Musik von den Artists ums Eck. Als exklusive Plattform für österreichische Musik habe sich der »Soundpark« mittlerweile überholt. Stattdessen sei er ein »Sammel- und Herzeigebecken«, eine erste Anlaufstelle.
Mit einem Anteil von knapp über 40 Prozent an österreichischen Artists hängt der Sender mittlerweile auch interne Vorgaben aus dem ORF ab. In der Musikcharta, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk 2009
erstmals mit der Plattform SOS-Musikland ausverhandelte, verpflichtete er seine Radioschiene dazu, mindestens 30 Prozent Musik von Menschen zu spielen, »die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen/besaßen, die längere Zeit hindurch ihren Lebensmittelpunkt oder ihren Produktionsstandort in Österreich haben/hatten oder die aufgrund der bisherigen Karriere oder ihres Images als Österreicher betrachtet werden/wurden«. Das gilt allerdings über alle Sender der Flotte hinweg – Ö1, Ö3, Regionalradios und eben FM4. Was die etwas paradoxe Folge hat, dass der hohe Anteil an österreichischer Musik bei Letzterem es erlaubt, dass beispielsweise Ö3 in der Kernzeit mit nur etwa 15 Prozent österreichische Musik durchkommt.
All das sorgt dafür, dass FM4 wohl auch in absehbarer Zukunft, wie Makossa es ausdrückt, der einzige Sender sei, »der Musik aus Österreich wirklich wahrnimmt und fördert«. Auch Hannes Tschürtz betont die fortwährende Bedeutung für die Branche: »FM4 ist für die österreichische Musikszene immer noch so wichtig wie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Wenn nicht sogar wichtiger.«
Das bestätigt auch die Geschichte von Eli Preiss. Zum Senderstart von FM4 war sie noch nicht geboren. Als sie dann selbst anfing Musik zu machen, war FM4 ihre erste mediale Anlaufstelle: »Mein allererstes Interview überhaupt war mit FM4«, erzählt sie. »Das war das erste Mal, dass ich mich im Radio gehört habe. Das erste Mal, dass ich generell irgendeine Art von Support von der österreichischen Medienlandschaft bekommen habe. Ich glaube, dass mich durch FM4 viele andere Möglichkeiten erreicht haben.« Vom Sender fühlt sie sich seit diesen Anfängen gut unterstützt, von anderen Musiker*innen in der Szene höre sie Ähnliches.
Wo ist der Nachwuchs?
Doch während die Bedeutung von FM4 für die österreichische Musikindustrie nicht abzureißen scheint, zeigt sich zunehmend eine Verschiebung bei der Hörer*innenschaft. Zum Start des Vollprogramms war diese im Schnitt nämlich 26,7 Jahre alt. Im aktuellen Radiotest lag das Mittel jedoch bei 39 Jahren. Das sind zwar noch immer vier Jahre weniger als bei Ö3, langsam, aber sicher altern die FM4-Hörer*innen aber mit ihrer Homebase mit. Was ein Problem für einen Sender darstellt, der sich selbst zwar nicht als Jugendsender, aber doch als Jugendkultursender versteht und für den, so Makossa, »die Vorgabe der Konzernführung ist, breiter und jünger zu werden«. Eine Debatte die in
Wir haben uns angesehen, wie sich das Genderverhältnis in den Top 40 der FM4-Jahrescharts seit Sendestart verändert hat. Aufgefallen ist uns, dass es erst in den letzten paar Jahren größere Verschiebungen gegeben hat – diese sind dafür recht deutlich.
FLINTA* gemischt männlich
1 keine Aufzeichnungen vorhanden
2 Werte gewichtet, da nur Top 30 verfügbar
Weiters hat uns interessiert, wie viele österreichische Musiker*innen in den Top 40 der Jahrescharts vertreten waren. Hier setzt ein merklicher Trend nach oben schon früher ein und scheint sich nicht unweit der internen 40-Prozent-Quote einzupendeln – mit einem bisherigen Höchstwert von 20 Acts.
den letzten Jahren immer wieder aufgeblitzt ist. So hat der aktuelle Generaldirektor Roland Weißmann in einem Strategiepapier verlauten lassen: »In seiner Ausrichtung als Jugendradio verfehlt FM4 sein Mission Statement und ist in der erreichten Zielgruppe zu spitz positioniert.« Auch die Radiodirektorin des ORF, Ingrid Thurnher, verkündete bei ihrer ersten Pressekonferenz die Hörer*innenschaft von FM4 müsse wieder »in Richtung Jugend« erweitert werden.
»FM4 wird 30. Als Ö3 30 geworden ist, kam FM4.« — Hannes Tschürtz
Das FM4 in diesem Segment Nachholbedarf hat, zeigt sich auch bei Eli Preiss. Denn selbst für sie ist Radio – trotz aller Sympathie zu FM4 – längst kein Leitmedium mehr: »Radio im klassischen Sinne höre ich nicht wirklich. Eher nur, wenn ich speziell auf etwas hingewiesen werde«, erzählt sie. In ihrem Freund*innenkreis sei das ähnlich: »Meistens hört man Radio, wenn man im Auto ist.« Hannes Tschürtz sieht darin bis zu einem gewissen Grad eine unvermeidliche Entwicklung: »Das Publikum wächst mit, was eigentlich super ist. Du kriegst halt keine Jungen mehr nach. Das Problem haben alle Radiosender. Wie soll es auch gehen, die Klammer zwischen 20-Jährigen und 70-Jährigen zu schaffen? Die gängige Antwort ist Segmentierung. FM4 wird 30. Als Ö3 30 geworden ist, kam FM4.«
Notwendiges Gleichgewicht
Wenn es nach Melissa Erhardt geht, ist dieser Spagat aber sehr wohl zu schaffen. Die 28-Jährige ist eine der Moderator*innen der relativ neuen Sendung »FM4 Hot«, bei der über Popkultur-News und Mainstream-Releases berichtet wird, die im bisherigen Programm zu wenig Platz hatten. Aber, so Erhardt: »Das Schöne an FM4 ist, dass verschiedenste Sachen nebeneinander bestehen können. Und da ist ›FM4 Hot‹ halt der Platz, wo wir über Billie Eilish, Taylor Swift und Bad Bunny sprechen können. Aber im nächsten Moment gibt es drei Stunden österreichische Musik von Lisa Schneider.« Es brauche eben ein Gleichgewicht, dann gehe es sich auch aus, dass Charli XCX neben Verifiziert und Bibiza läuft.
»FM4 ist der einzige Sender, der Musik aus Österreich wirklich wahrnimmt und fördert.«
— Makossa
Die meistgespielten Songs aus 30 Jahren FM4
01 The Roots feat. Cody Chesnutt »The Seed (2.0)« (2002)
02 Modest Mouse »Float On« (2004)
03 M.I.A . »Paper Planes« (2007)
04 MGMT »Time to Pretend« (2007)
05 Queens of the Stone Age »Make It wit Chu« (2007)
06 Peter Bjorn and John »Young Folks« (2006)
07 Theophilus London »Wine & Chocolates (Andhim Remix)« (2012)
08 Woodkid »I Love You« (2013)
09 Alabama Shakes »Don’t Wanna Fight« (2015)
10 Snoop Lion feat. Angela Hunte »Here Comes the King« (2012)
01 Camo & Krooked »Loving You Is Easy« (2013)
02 D.Kay & Epsilon feat. Stamina MC »Barcelona« (2003)
03 Naked Lunch »Military of the Heart« (2006)
04 Leyya »Superego« (2015)
05 We Walk Walls »Curiosity Doesn’t Suit You Well« (2013)
06 Bilderbuch »Maschin« (2013)
07 Ja, Panik »Libertatia« (2014)
08 HVOB »Always Like This (Andhim Remix)« (2013)
09 Clara Luzia »Cosmic Bruise« (2015)
10 Mile Me Deaf »Digital Memory File« (2015)
Die meistgespielten Artists aus 30 Jahren FM4
001 Bilderbuch 002 Mavi Phoenix 003 Portugal. The Man 004 Wanda 005 Leyya 006 Arcade Fire 007 Alt-J 008 Jungle 009 Steaming Satellites 010 Santigold 011 James Hersey 012 Clara Luzia 013 Crystal Fighters 014 HVOB 015 Mile Me Deaf 016 Vampire Weekend 017 MGMT 018 Foals 019 Cari Cari 020 Avec 021 Caribou 022 Muse 023 Deichkind 024 Franz Ferdinand 025 Beirut 026 Farewell Dear Ghost 027 Two Door Cinema Club 028 Ogris Debris 029 Ja, Panik 030 Catastrophe & Cure 031 Roosevelt 032 Hot Chip 033 Arctic Monkeys 034 Jake Bugg 035 Tame Impala 036 K. Flay 037 Metronomy 038 Hearts Hearts 039 The Strokes 040 Florence and the Machine 041 Austra 042 M.I.A. 043 Justice 044 Beck 045 Der Nino aus Wien 046 Billie Eilish 047 Friedberg 048 Queens of the Stone Age 049 Editors 050 Tocotronic 051 Gorillaz 052 Gerard 053 Dives 054 Ezra Furman 055 Pressyes 056 Foster the People 057 Sohn 058 Kooks 059 Sharktank 060 Camo & Krooked 061 The XX 062 Get Well Soon 063 Kings of Leon 064 Miike Snow 065 Bloc Party 066 Little Dragon 067 Blur 068 Little Simz 069 My Ugly Clementine 070 Lykke Li 071 Wolf Alice 072 Left Boy 073 Feist 074 The Vaccines 075 Salute 076 Bibiza 077 Grimes 078 Interpol 079 Monsterheart 080 Kendrick Lamar 081 Phoenix 082 Chvrches 083 Giantree 084 Jamie XX 085 The Black Keys 086 Lou Asril 087 Shout Out Louds 088 TV on the Radio 089 Theophilus London 090 The National 091 Lizzo 092 Digitalism 093 Yukno 094 MP the Kid 095 M83 096 Depeche Mode 097 Bombay Bicycle Club 098 Seeed 099 Django Django 100 Beach House
Quelle: Radio FM4
Um die Zukunft des Radios bangt sie jedenfalls nicht. Vielmehr könne sie sich vorstellen, dass es bald wieder einen neuen Höhepunkt erlebt: »Es gibt da einen Tweet, in dem jemand schreibt: ›Stellt euch vor, es gäbe sowas wie Podcast und Musik, nur 24 Stunden durchgehend.‹ Und jemand antwortet darauf: ›Bro, that’s radio.‹ Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach dem Medium.«
Neu ist »Hot«
Dass auch die Senderleitung ein Potenzial darin sieht, jüngeres Publikum anzusprechen, erkennt man unter anderem am sehr prominenten Sendeplatz von »FM4 Hot«: wochentags von 13 bis 14 Uhr. Vermutlich ein Zeichen dafür, dass der Sender in Richtung Popkultur-Mainstream in den letzten Jahren durchlässiger geworden ist. »›FM4 Hot‹ ist ein guter Platz, um Neues auszutesten. Um zu schauen, was funktioniert auf FM4, was funktioniert vielleicht nicht«, so Erhardt. Und wie sieht dieses Neue bei FM4 aus? Was ist heute FM4-Musik? Für die seit zwei Jahren amtierende Senderchefin Doroteja Gradištanac ist FM4 nach wie vor »eine selbstbewusste Alternative zum Mainstream«. Man müsse allerdings offen bleiben

Hannes Tschürtz, Labelchef Ink Music
für neue Leute und Ideen. Da klingt durchaus noch etwas von Rotifers »Alternative Mainstream« durch. Auch Eli Preiss würde FM4Musik als eher alternativ bezeichnen: »Bei allen anderen Radiosendern switcht man oft zwischen den Stationen und denkt sich: ›Hä? Habe ich jetzt überhaupt gewechselt?‹ FM4 ist fresh, neu und relativ jugendlich. Radio ist ein Space, wo man immer wieder auch Neues entdecken sollte.«
Für Erhardt hingegen habe sich dieses polarisierende Denken in Alternative und Mainstream längst aufgelöst. Stattdessen zeichne sich FM4 heute durch eine bewusste Diversität aus: »Österreich ist in den letzten Jahrzehnten eine diversere Gesellschaft geworden. Und das spiegelt sich halt auch in der Musik wider.« In der Tat ist nicht nur die Art der Musik diverser geworden, sondern auch, wessen Musik gespielt wird. So wiesen die Jahrescharts beispielsweise bis 2020 durchgehend einen deutlichen Männerüberhang auf (mit absolutem Tiefpunkt 1999: null Frauen in den Top 30). In den letzten drei Jahren hat sich das jedoch sogar umgedreht. Auf
Dass sich die Musik auf FM4 verändert hat, lässt sich kaum leugnen. »Die Positionierung für FM4 ist deutlich mehr in der Mitte«, meint auch Tschürtz. Das heißt aber nicht, dass FM4 jetzt nur noch Mainstream-Pop spielt. Vielmehr sind die Grenzen durchlässiger geworden, Genres haben keine so große Bedeutung mehr, Begriffe wie Guilty Pleasure sind passé. Lisa Schneider: »FM4Musik ist eine Art von Popmusik. Viele Leute würden da vielleicht abwehrend reagieren und sagen: ›FM4 und Pop?‹ Im Jahr 2024 ist Pop halt eine ganz andere Sache, als es das vor 20 Jahren war. Trotzdem schmeckst du natürlich nach wie vor die Farbe von FM4.

»Österreich ist in den letzten Jahrzehnten eine diversere Gesellschaft geworden. Und das spiegelt sich halt auch in der Musik wider.« — Melissa Erhardt
bewusste Bestrebungen wollten das unsere Gesprächspartner*innen nicht unbedingt zurückführen. Nichtsdestotrotz: Es scheint hier ein Umdenken stattgefunden zu haben.
Die FM4-DNA
Doch wo neue Wege beschritten werden, werden manche zurückgelassen. »Man wird nie alle glücklich machen«, bestätigt Melissa Erhardt. »Mir kommt vor, dass das für viele eine Art kultureller Ausverkauf ist, wenn wir als Indie- oder Alternative-Sender auf einmal Beyoncé oder Harry Styles spielen. Wenn wir den Anspruch haben, eben das widerzuspiegeln, was gerade in der Musikkultur passiert, was gerade aktuell ist, dann müssen wir natürlich irgendwo weggehen oder uns öffnen. Bestimmte Songs, bestimmte Bands, bestimmte Genres werden aber immer in der FM4-DNA bleiben.« Lisa Schneider sieht das ähnlich: »Die Früher-war-alles-besser-Menschen verstehen, glaube ich, die Intention nicht. Wir haben ein diverses Radiopublikum und wir würden gerne diverse Sachen spielen für Menschen vom Linzer Lehrling bis zur Journalistin, die in Wien studiert. Das abzudecken ist schwierig, aber das ist genau das, was wir machen.« Wie sich das ausgeht? »Musik ist die Antwort. So wie immer im Radio«, so Schneider.
Manchmal ist sie neongelb und manchmal ist sie fast orange. Aber am Ende des Tages bleibt sie gelb.«
Wenn also »Sabotage« jener Song war, der 1995 vorgab, was von FM4-Musik zu erwarten sein wird: Welcher Song würde diesen Platz einnehmen, wenn der Sender heute on air ginge? Lisa Schneider und Melissa Erhardt haben beide denselben klaren Favoriten: »Maschin« von Bilderbuch. Makossa gibt sich hingegen ziemlich selbstsicher für einen Sender, der in diesem hypothetischen Szenario noch keine 30 Jahre Goodwill in der österreichischen Szene aufgebaut hat: »Vermutlich würden wir einen exklusiven, extra dafür produzierten Song von Verifiziert, Bibiza, Wanda oder Bilderbuch spielen.« Um dann in einem Nachsatz doch noch hinzuzufügen: »Oder, falls wir das nicht bekommen, vielleicht ›Free Yourself‹ von Jessie Ware.« Die Nummer ist zwei Jahre alt. Keine Chartplatzierung in Österreich. Sicher nicht Mainstream, aber immanent radiotauglich. So viel hat sich also auch wieder nicht geändert. Bernhard Frena, Manuel Fronhofer
Am 16. Jänner 2025 wird Radio FM4 30 Jahre alt. Das alljährliche Geburtstagsfest findet am 25. Jänner 2025 in der Ottakringer Brauerei statt. Details zum Line-up folgen in Kürze.



Lisa Großkopf »Kontakte knüpfen«, Bronze, Textil, dreiteilig, 2024; Foto: Leni Deinhardstein
Networking, das wissen alle, ist wichtig. Sehr wichtig. Es ist, wie es so schön heißt, »Teil der Arbeit«. In Lisa Großkopfs textilbehangenem Bronzeguss »Kontakte knüpfen« wird der Ausdruck wörtlich genommen. ———— Das Wohl und Wehe der Menschheit hängt zum großen Teil an unserer aller Fähigkeit – oder Unfähigkeit –, Kontakte zu knüpfen. So interpretierte ich zumindest den Spiegel-Bestseller »Sapiens«, der mir vor nicht allzu langer Zeit ohne mein Zutun unterkam und den ich, mangels alternativer Lektüre, dann auch las. Anscheinend sind wir heute hier, weil sich unsere Vorfahren, im Gegensatz zu den Neandertaler*innen, zu größeren Gruppen organisieren und damit ihre körperliche Unterlegenheit mehr als ausgleichen konnten.
»Kontakte knüpfen« ist der Titel einer Serie bronzener Abgüsse von Unterarmen, um die Freundschaftsarmbänder drapiert sind, und er verweist sprichund wortwörtlich auf die zentrale Frage der Arbeit. Diese betrifft den Wert eines wichtigen Teils jeden künstlerischen Schaffens, nämlich den Aufbau und die Pflege von Beziehungen. Die handgeknüpften Armbänder zeigen die aktive Zuwendung oder gar Mühe an, die nötig ist, um Kontakte zu »knüpfen«.
Die Textilarbeiten erzählen von der Teilnahme an verschiedenen ArtistResidencies und den Bekanntschaften, die sich dabei ergaben. Das waren mal mehr, mal weniger, wie die unterschiedliche Menge an Bändern pro Bronzearm anzeigt. Auch die Länge der Abgüsse richtet sich nach dieser Zahl. Eine Hierarchie scheint zu entstehen. Mehr Armbänder, mehr Kontakte – ist gleich mehr Erfolg? Die emporgereckten Gliedmaßen ähneln Trophäen. Gleichzeitig wird die Technik des Bronzegießens völlig anders wertgeschätzt als jene des Knüpfens von Textilien, das traditionell eher dem Kunsthandwerk zugeschrieben wird. Das wirft zusätzlich die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Kunsthandwerk auf. Ist Knüpfen Kunst? Ist Networking Kunst?
Ihre Website eröffnet Lisa Großkopf mit den Worten des Kunstkritikers David Gibson: »Not having a website is like not having a phone number. You have to have it. At least get a blog and put some pictures up. Every artist needs a website.« Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine notwendige Bedingung dafür, als Künstler*in wahrgenommen zu werden. Aber nicht nur bei Künstler*innen bekommen diese im Hintergrund anfallenden Pflichten kaum Aufmerksamkeit. In vielen Bereichen fällt solche Art Arbeit an, in den wenigsten wird sie als solche wahrgenommen.
Victor Cos Ortega
»Kontakte knüpfen« ist Teil der Gruppenausstellung »In aller Freundschaft«, die noch bis 24. August 2025 im Dom Museum Wien zu sehen ist. Weitere Arbeiten von Lisa Großkopf können derzeit im Museum der Moderne Salzburg und im Kunsthaus Graz besichtigt werden.
In den karierten Strickpulli geschlüpft, eine Kanne Tee aufgesetzt, ein ledergebundenes Notizbuch samt Vintagefüllfeder in Griffweite – so sieht für manche der ideale Start in ein produktives Lernwochenende aus. Ästhetisierung soll zur Arbeit motivieren, Romantisierung die Produktivität steigern. Doch was ist »Ästhetik« eigentlich und was sind mögliche Schattenseiten, wenn Studieren Instagram-ready sein muss? ———— Ohne eine ganz bestimmte Atmosphäre habe sich Elli irgendwann gar nicht mehr konzentrieren können. Noch während ihrer Schulzeit sei sie in »Studytube« hineingerutscht, jene informelle Community auf Googles Videoplattform Youtube, die sich – oft in ästhetisch höchst ansprechender Form – mit allen Themen rund ums Lernen beschäftigt. Von dort habe sie auch einige ihrer Lernstrategien mitgenommen. Mit Musik, duftenden Kerzen und Tee in einer schönen Tasse habe sie es sich gemütlich gemacht: »Lernen war für mich so ein richtiger Rückzugsort.« Das alles habe ihr in der Schulzeit geholfen, Lernen nicht so sehr mit Stress zu verbinden.
Vielen dürfte das ja bestens bekannt sein: Eine Arbeit ist zu schreiben, für eine Prüfung zu lernen, irgendeine Abgabe fristgerecht abzugeben; doch sich selbst aufzuraffen, erfordert teilweise enorme Anstrengung. Besonders, wenn die Option, stattdessen die nächste Netflix-Serie zu bingen, so viel verlockender erscheint. Und dann ist die Deadline auch schon da. Inwiefern kann eine Ästhetisierung also zur Motivation beitragen?
Oxford und Cambridge im (vor)letzten Jahrhundert, verwunschene alte Gebäude, die im Nebel verschwinden, sowie Anzugshemden unter Westen – das hat es Lara angetan. Um lernen zu können, brauche es spezifische Bilder, eine bestimmte Stimmung. Lara will in diesen Bildern drinnen sein. »Ich glaube, dass mir dieses Heraufbeschwören von bestimmten Stimmungen und Einstellungen hilft, die unangenehmen Aspekte am Lernen auszublenden beziehungsweise ins Positive umzukehren.«
Kleidung, Musik, Kerzen, Tee
Auch problematische Aspekte dieser idealisierten Periode werden dabei explizit ausgeblendet. Stattdessen liegt der Fokus auf anderem: auf einem spezifischen Kleidungsstil, auf Kerzen oder einer Tasse Tee. Das Gefühl einer Feder auf Pergament wird beschworen, indem händisch in – farblich abgestimmte – Notizbücher geschrieben wird. »Ich hypnotisiere mich fast, versetze mich in einen Zustand abseits des Alltags, damit der Fokus rein auf dem Lernen liegen kann.«
Neben Youtube-Videos und PinterestBoards tragen auch Filme, Serien und Bücher zum Entstehen der angestrebten Bilder bei. Dark Academia heißt das dann beispielsweise, wenn die Inspiration aus einer romantischen Betrachtung der klassischen Mode- und Einrichtungsstile englischer Eliteuniversitäten bezogen wird. Man will selbst Protagonist*in in diesen imaginierten Welten sein, dem Alltag Spannung einhauchen.


Die Tasse Tee hilft manchen nicht nur wegen des Teeins bei der Konzentration, sondern auch durch die Atmosphäre, die sie erzeugt.
Die Dark-Academia-Ästhetik hat im Internet ein großes Following – speziell auf Instagram, Pinterest und Tumblr.
Marie kuratiert sich ein Kostüm fürs eigene Leben: »Und die Protagonistin muss jetzt halt lernen.« Sich für etwas zu motivieren, was nicht komplett aus dem Selbst herauskommt, sei schwierig. Dann helfe es, ein Outfit anzuhaben, das dieses Selbst verkörpert: »Wenn ich mich nicht stark wie ich selbst fühle, dann habe ich das Gefühl, ich verliere mich in der Arbeit.« Marie ist ständig darum bemüht, sich selbst zu framen, und denkt dabei eine gewisse Funktionalität stets mit. Diese Funktionalität wird dann ästhetisiert. In manchen Situationen gehe das wie von selbst – wie zum Beispiel bei einem schönen Herbsttag. Für andere muss diese Ästhetisierung künstlich herbeigeführt werden. Die Extreme von Funktionalität und Ästhetik sind jedoch Stresspole, dazwischen gilt es, eine Balance zu finden.

Maximilian Jablonowski,
Kulturwissenschaftler
Der Kulturwissenschaftler Maximilian Jablonowski arbeitet am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien und kennt sich mit (Alltags-)Ästhetik und Subkulturen aus. »Ästhetik ist ein Begriff, der aus der Philosophie stammt und in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes jede Form der sinnlichen Wahrnehmung bezeichnet«, erklärt er. Dabei werde der Fokus auf verschiedene Sinne gelegt, bis hin zur allgemeinen Raumwahrnehmung in der atmosphärischen Ästhetik. Später, im 17. und 18. Jahrhundert, sei Ästhetik dann zu einem Begriff der bürgerlichen Kunst geworden, die sich nicht länger in einer dienenden Rolle gegenüber der Religion verstand. »Die beiden großen Begriffe, die mit Ästhetik verbunden waren, waren Schönheit und Erhabenheit«, führt Jablonowski aus. »Das bezog sich vor allem auf Kunst und das Naturerleben.« Immer unter Einhaltung strenger Regeln.

Mit Ende des 19. Jahrhunderts habe dann Design angefangen, ein Thema zu werden. Die Form von Alltagsgegenständen habe an Relevanz gewonnen, sie seien als kunstwürdig entdeckt worden. Jablanowski: »Bei Ästhetik geht es immer um die Frage, wie sich Form und Funktion zueinander verhalten.« Ab den 70erJahren sei schließlich auch in den Wissenschaften explizit von einer »Ästhetisierung des Alltags« gesprochen worden. »Mittlerweile ist es keine Frage mehr, dass ästhetische Praktiken und Formen des ästhetischen Kategorisierens fast jeden Aspekt unseres Alltags bestimmen«, meint der Kulturwissenschaftler. In der Alltagsästhetik würde die Grenze zwischen den scheinbaren Gegensätzen des Pragmatischen und des Ästhetischen verschwimmen.
Ob Ästhetik auf Social Media nicht als eine Art visueller Darstellung verwendet werde, um Teil einer gewissen Subkultur zu sein? »Kultu-
reller Stil hat zwar etwas mit Ästhetik zu tun, ist aber nicht das Gleiche«, erläutert Jablonowski. »Heute würde man für so etwas viel häufiger den Begriff Ästhetik verwenden, da gibt es eine Art Begriffswandel. Ich glaube, dass meine Generation die letzte war, die popkulturell noch mit einem harten Begriff von Subkultur sozialisiert wurde. Meine Annahme ist, dass die Subkultur bei Leuten, die ein paar Jahre jünger sind, schon viel weniger Bedeutung hat – nicht nur ästhetisch, sondern auch sozial.« Ästhetik oder Stil?
Jablonowski bezieht sich hier auf seine Schulzeit Anfang der Nullerjahre. Heute seien subkulturelle Markierungen dynamischer, Stile ließen sich kombinieren, Musikpräferenzen schlössen sich nicht gegenseitig aus. »Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass man jetzt einen Begriff wie Ästhetik
verwendet, der weniger schubladenmäßig funktioniert. Die große These wäre, dass wir es heute weniger mit subkulturellen Stilen zu tun haben, sondern mit popkulturellen Mikroästhetiken.« Genau diese Flexibilität scheint der Begriff Ästhetik einzufangen. Eine Ästhetik durchdringt die eigene Identität nicht zwingenderweise bis in die letzte Falte.
Romantisiertes Leben
Auch die Regeln einer – hauptsächlich visuellen – Ästhetik sind weniger explizit. Ob und warum Kamala Harris »brat« ist, lässt sich schwer an klaren Regeln festmachen. Dabei wird das Wort Ästhetik ganz anders verwendet und Gen Z sowie Tiktok zugeschrieben – und es werden damit 3.000 Jahre Philosophiegeschichte außer Acht gelassen. Wenn, dann findet sich so etwas wie Richtlinien höchstens als Beispiele auf Pinterest-Boards. Wer hier etwa nach »Cottagecore« sucht, findet Bilder vom romantisierten Leben am Land, in der Natur, auf einem kleinen Hof. Gleichzeitig werden die Realitäten der Existenz auf einem Bauernhof ausgespart. Es
wenn man sich gezwungen sieht, nach dem Posten des schönen Arbeitsplatzes auch tatsächlich unmittelbar produktiv zu sein. Oder man stellt umgekehrt die Arbeit nur fürs Foto dar und danach werden Laptop und Buch schnell wieder weggeräumt – Arbeitsästhetik als Momentaufnahme. Und zuletzt wird der tägliche Kaffeehausbesuch fürs richtige Setting irgendwann eine Frage des Geldes – für manche früher als für andere.
Die sozialen Medien vermitteln gerne den Eindruck, dass so ein schönes, stilvolles, ästhetisches Lernen die einzig »richtige« Variante sei. Dabei liegt eine deutliche Gewichtung auf Konsum: Es werden bestimmte Stifte, Notizbücher, Planer gebraucht, um am effektivsten und effizientesten lernen zu können. Lara bemerkt das auch bei sich selbst: »Es wirkt fast so, als ob man durch den Konsum besser lernt. Obwohl das nicht stimmt.« Auch hier hat der Kapitalismus eben seine Krallen hineingeschlagen und lässt so schnell nicht wieder los.
Wer kann sich das »korrekte« ästhetische Arbeiten und Lernen also überhaupt leisten? Wird durch diese Ästhetisierung
»Ästhetische Praktiken und Formen des ästhetischen Kategorisierens bestimmen fast jeden Aspekt unseres Alltags.«
— Maximilian Jablonowski
geht darum, vor allem visuell und auf Fotos beziehungsweise in Videos eine gewünschte Atmosphäre zu erzeugen.
Laut Jordan Selous’ Artikel »What’s up with Our Obsession with ›Aesthetics‹?« habe es 2020 einen großen Zuwachs an verschiedenen Ästhetiken gegeben, vor allem im Bereich der Academia-Ästhetiken. In dieser Zeit des virtuellen Lernens seien Schulen, Unis und (physisches) Lernen nämlich zu etwas Begehrtem und Romantisiertem geworden. Dieses Erklärmodell leuchtet auch Maximilian Jablonowski ein. Er erinnert hier an die mitunter aufkommende Kritik an solchen Ästhetiken, eskapistisch zu sein. Wobei sich allerdings die Frage stellt: Was ist an Eskapismus so schlimm?
Die Ästhetisierung von Lernen und Arbeit trifft auch auf weitere Kritikpunkte. So kann zum Beispiel zusätzlicher Druck entstehen,
und Vermarktung von Lernen Bildung womöglich noch elitärer? Oder sind es doch nur harmlose Lernstrategien und Rituale, die Personen das Arbeiten erleichtern? Ist ein ästhetischeres Leben nicht einfach schöner? »Manchmal nervt mich diese total kuratierte Ästhetik auch. Weil ich mir dann denke, dass es doch in echt gar nicht so ist«, meint Marie. »Vielleicht wünsche ich mir, dass wir mehr Unästhetisches sehen. Aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine.«
Johanna T. Hellmich
Fast jede Social-Media-Plattform hat mittlerweile ihre eigene Study-Community wie etwa Studytube (Youtube), Studygram (Instagram), Studytok (Tiktok) oder Studyblr (Tumblr). Einen Eindruck der beschriebenen Ästhetiken vermitteln Hashtags wie #studyaesthetic, #darkacademia und #cottagecore.

Lorenz Seidler aka Esel ist seit über 20 Jahren fixer Bestandteil der Wiener Kulturszene. Er fotografiert, dokumentiert und gilt als Schnittstelle zur doch manchmal recht elitären Kunstbubble. Ein Gespräch über Fotografie, den Kunstmarkt und die Frage, wie der Esel alle seine vielfältigen Projekte und Ambitionen unter einen Hut bringt. ———— Lorenz Seidler und sein Schaffen in Worte zu fassen, fällt schwer. Wir versuchen es hier trotzdem. Seit über 20 Jahren bewegt sich der gebürtige Wiener, vielen besser bekannt unter seinem Pseudonym Esel – Eigenschreibweise »eSeL« –, geschickt durch die Kunst- und Kulturszene der Stadt. Der Esel fotografiert und dokumentiert, was das Zeug hält. Seidler transportiert – mittlerweile mit einem Team um sich – all das nach außen, was im kunstaffinen Wien passiert. Und das ist so einiges, wie er im Gespräch mit The Gap erzählt: »Als ich 1998 mit meiner Radiosendung begann, gab es vielleicht zehn coole Termine pro Woche. Jetzt gibt es fünf pro Tag.«
Mittlerweile legendär ist das wöchentliche »Esel Mehl«, ein kuratierter E-MailNewsletter mit Tipps und Fotos aus der Wiener Kunstwelt. Der Esel gilt seit jeher als Schnittstelle zwischen Museen, Institutionen und all jenen, die sich für Kunst interessieren. Das Markenzeichen in seinem Schaffen ist ohne Zweifel der stets leicht ironische Unter-
ton – oder um es in Seidlers Wortlaut auszudrücken: »Ich glaub, ich bin ganz lustig.« Die Rolle des Kunstvermittlers möchte er dabei aber nicht einnehmen. »Meine Aufgabe ist es nicht, der Kunst zu dienen und irgendetwas rhetorisch aufzubereiten«, führt er aus. »Ich bin Schnittstelle, Kommunikation. Ich gebe Fakten weiter.«
»Ich weiß gar nichts«
Doch wie kam es dazu, dass Seidler mittlerweile ein Team – liebevoll »Eselschwarm« genannt – um sich geschart hat, mit eigenen Räumlichkeiten im Museumsquartier? Wenn er von der Vielzahl seiner Ausstellungen, Kunstprojekte, Initiativen und dergleichen erzählt, fällt es schwer, aus dem Staunen herauszukommen. Eine Frage drängt sich auf: Schläft der Mann jemals? Momentan ist jedenfalls kein Ende seines Schaffens in Sicht. Aber zurück an den Anfang: Lorenz Seidler wurde 1974 in Wien geboren. »Mein Vater stammt aus einer sehr bürgerlichen Familie«, erzählt er. »Es gab bei ihm immer einen Bezug auf einen Wissenskanon, viel intensiver noch als das zum Beispiel in der Kunstwelt der Fall ist. Das bleibt halt auch nicht ohne Folgen«, blickt Seidler zurück. Seine Mutter wiederum stammt aus einer Arbeiter*innenfamilie, insofern sieht sich der Esel als eine »wienerische Konfiguration«. Später folgte dann das
»Ich find’s okay, wenn jemand nur zum Saufen und Tschicken auf eine Vernissage geht.« — Lorenz Seidler


Lorenz Seidler: »Boomer-Perspektive auf Gen Z – hybrides Kuscheln justament entdeckt bei der Vernissage der Kreativarbeiten rund um die Band Bilderbuch.«
Studium der Kunstgeschichte sowie der Philosophie an der Uni Wien. Ein Medium hat es ihm dabei besonders angetan: »Ich habe dauernd fotografiert«, erinnert sich Seidler im Gespräch. Erst für Stadtzeitungen und dann für die eigenen Projekte.
Doch wie wurde aus dem Kunstgeschichte- und Philosophiestudenten der Esel? Das Pseudonym diene ihm oft auch als Schutzschild, so Seidler. Während der Kunstgeschichtestudent stets über alles informiert sein möchte, könne der Esel schon einmal von sich behaupten: »Ich bin der Esel, ich weiß gar nichts.« Doch der Esel ist auch neugierig und lernt gerne dazu. Erstmals in Szene gesetzt wurde die Figur dann in den frühen Nullerjahren beim freien Radiosender Orange 94.0. In seiner Sendung versuchte der Esel, die Co-Moderatorin Sarah Pichler aka »das Schaf«, »die sich nicht so wirklich für Kunst interessiert hat«, in der laufenden Sendung davon zu überzeugen, »dass das doch irgendwie cool ist«, erzählt Seidler. So sei der Esel bereits früh zur Tarnung für einen »Klugscheißer der Kunstwelt« geworden. Der Esel kann jedoch immer auch ein bisschen, naja, eben Esel sein, was Seidler durchaus recht ist: »Ich kann mit dem Esel nach wie vor so blöd sein, wie ich will«, erklärt er schmunzelnd.
Der kultige Newsletter entstand damals, um die Radiosendung anzukündigen – reingemogelt zwischen andere hochkarätige Kunst- und Kulturtipps. Das Konzept ging
auf. Das sei wohl rückblickend auch einer Zeit geschuldet, »in der die Leute sich noch gefreut haben, wenn sie E-Mails kriegen, und alles abonniert haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war«, so Seidler. Der Newsletter ist innerhalb kürzester Zeit explodiert, das Projekt Esel wurde größer und größer. »Ich würde gerne sagen, dass ich mir das alles vorher urleiwand am Papier überlegt habe, aber rückblickend waren das fast alles reine Zufälle.« Auch, dass »Esel« im Grunde seine
»Mit Fotos kannst du relaten.«
— Lorenz Seidler
ausgesprochenen Initialen sind, habe er erst realisiert, als es den Spitznamen bereits gab. Seither schreibt er sich selbst eben mit großem S und großem L.
Eines zieht sich jedenfalls durch Seidlers Alltag und Werdegang: die ständige Konfrontation mit der Kunst. Die Arbeit am Esel-Kalender hat er mittlerweile teils an seinen »Eselschwarm« abgegeben, wie er im Gespräch berichtet. Anstatt tagtäglich den Kalender zu betreuen, beschränkt sich das nun auf zwei Tage in der Woche. Hinzu kommt das
Aufbereiten des wöchentlichen Newsletters. Im nächsten Leben würde der Tausendsassa lieber ein Projekt starten, »bei dem ich einmal im Quartal was mache und den Rest des Jahres blau«, wie er grinsend festhält. Aber, so viel Aufwand er sich damit auch antue: »Ich bin dazu gezwungen, mich ständig zu informieren, das ist eigentlich eh ganz cool.«
Der
Ein Fixpunkt im Newsletter ist die von Seidler kuratierte Fotostrecke. Mittwochnacht sitzt der Esel auf der Couch und – anstatt vielleicht einmal früher ins Bett zu gehen – schaut die Fotos der letzten Woche durch. Dabei werden auch Schmankerl für andere Projekte gefunden, etwa für das »Esel ABC«, das in Zusammenarbeit mit Künstler*innen wie Johannes Grenzfurthner, Jörg Piringer, Tex Rubinowitz und Sophia Süßmilch in der Esel Rezeption im Museumsquartier zu sehen war beziehungsweise ist. Denn Fotos gibt es auf den Speicherkarten von Lorenz Seidler mehr als genug. Immer begeisterter Fotograf gewesen, profitierte auch er von der Digitalisierung im Fotobereich. Während das früher mit relativ hohen Materialkosten verbunden war, »kannst du heute bei einem Shooting rausgehen und theoretisch 1.000 Bilder schießen«, so Seidler. Und bei der Vielzahl an geschossenen Bildern lernt man stets dazu. So stelle auch er durchaus fest, dass er fotografisch »viel besser« sei als vor 20 Jahren.
Dabei sieht er seine Arbeit trotz fortschreitender Automatisierung nicht als gefährdet an: »Alles, wo es nicht spezifisch mich braucht, um das zu machen, soll bitte wer anderer machen«, sagt er spitzbübisch. »Meine Fotos haben einen gewissen Witz. Das ist dann ein Esel-Foto« so Seidler. Die Witze in den Fotos – das stellt Seidler entschieden klar – würden allerdings nie auf Ko sten einer Person gehen. Ein Fotobuch über Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder etwa führte laut Seidler auch zu »wenig schmeichelhaften Bildern«. Doch selbst diese wurden für ihre Originalität gelobt. »Plötzlich hatte ich den Eindruck, dass er sich erstmals auch für mich interessiert«, erinnert sich Seidler amüsiert.
Von der Wiener Fotoszene
Den Esel kann man mit Sicherheit als eine der zentralen Figuren in der Wiener Fotoszene sehen. Was hat sich in dieser getan, seit Seidler mit seinen Projekten begonnen hat? »Vor zehn Jahren ist in Wien wieder der Fotohype ausgebrochen«, bestätigt er. Nach wie vor seien die Galerie Westlicht sowie die alte Ankerbrotfabrik wichtige Player. Und auch hier gebe es einen sozialen Faktor: »Leica (Sponsor der Galerie Westlicht, Anm. d. Red.) ist ja in Wahrheit ein super elitäres Ding«, stellt Seidler klar. Dadurch ermöglichte Ausstellungen wären dann aber für viele Besucher*innen ein ungezwungener Berührungspunkt mit dem Kunstmarkt. Und solche Punkte brauche es dringend. »Mit Fotos kannst du relaten«, meint Seidler. Einen niedrigschwelligen Zugang zur Kunstwelt, den möchte auch Seidler mit seinen Esel-Projekten schaffen. »Ich find’s nach wie vor okay, wenn jemand nur zum Saufen und Tschicken auf eine Vernissage geht.« Denn: »Vielleicht lernt man ja dort trotzdem die richtigen Leute kennen und ein Wissenstransfer passiert.« Der Kunstmarkt ist ein Thema, das Seidler in seiner Karriere schon oft beschäftigt hat. Im Gespräch denkt er etwa zurück an das Jahr 2012, an ein Projekt in den Geschäftslokalen der Gumpendorfer Straße. Für das »Kunstmarkt-Experiment« haben damals ausgewählte Künstler*innen Werkserien entwickelt, deren Preis mit steigender Anzahl an Reservierungen sank. Als Unikat gab es ein Werk für 1.600 Euro zu erwerben. Sobald eine zweite Person aber ebenfalls Interesse zeigte, sank der Preis
»Meine Fotos haben einen gewissen Witz. Das ist dann ein Esel-Foto.«
— Lorenz Seidler
pro Exemplar auf 850 Euro. »Am Schluss gab es dann teilweise Bilder um 80 Euro, das war wirklich super.« Die Aktion sieht Seidler heute nach wie vor als eines seiner besten Projekte an – »aber viel zu aufwendig«, resümiert er aus heutiger Sicht. Dennoch gestaltet sich seine Herangehensweise an Projekte nach wie vor ähnlich: »Es muss ein Thema geben, das mich interessiert, und das will ich dann ein bisschen durcheinanderwirbeln.«
Der Esel als kulturelles Erbe Als vielleicht bekanntestes Projekt gilt eine Schau im Essl Museum, die eher durch Zufall für viel Aufsehen sorgte. Die interaktive Ausstellung »Esel: Die Sammlung Esel« widmete sich mit einer Vielzahl von Fotos, Videos, gesammelten Flyern und Prospekten dem Kunstgeschehen der vergangenen Jahre. Eine beachtliche Sammlung. Seit diesem Jahr ist die Esel-Datenbank übrigens auch offiziell digitales Kulturerbe Europas. »Unsere Daten sind bald wissenschaftlich zugänglich und zitierbar«, freut sich Seidler. Die Aus-
stellung im Essl Museum war jedenfalls die letzte, die dort vor der Schließung des Museums stattfand. So sei es damals zu »einer Vielzahl von Katastrophentourist*innen« gekommen. Ob es sein bedeutendstes Projekt war? »Ich sehe es nicht als das Wichtigste, was ich je gemacht habe«, hält Seidler fest –und zitiert an dieser Stelle Edgar Allan Poe: Für ein gutes Leben sei es wichtig, einen Gegenstand steten Trachtens zu haben, den man jedoch ohne Ehrgeiz verfolge. Aber wie lässt sich diese Fülle an Lebensinhalten mit einem Privat- und Familienleben vereinbaren? Immerhin ist Seidler mittlerweile Vater zweier Kinder und im September 50 Jahre alt geworden. Die Arbeit empfinde er nach wie vor eher als Freizeit. Allerdings: »Ich schaue mittlerweile, dass ich nicht mehr jede Nacht unterwegs bin.«
Martin Zimmermann
Näheres zu Lorenz Seidlers Projekten sowie Neuigkeiten aus der Wiener Kunstwelt findet ihr unter www.esel.at

Lorenz Seidler: »Der Witz eines Fotos sollte halt nicht auf Kosten der abgebildeten Person gehen …«


Entlang der Straßenbahnlinie 49 häufen sich vom Gürtel bis zur Neubaugasse Fotogalerien, -börsen und -reparaturwerkstätten. Mittendrin befindet sich das Foto- sowie Kameramuseum Westlicht. Wir haben uns angesehen, wie die Fotomeile Westbahnstraße technische Entwicklungen mit den Wurzeln der Fotografie vereint und digitaler Übersättigung entgegenwirkt. ———— Ein Kosmos aus kleinen Betrieben, die ihren Fokus alle auf die Fotografie gerichtet haben. In Zeiten von Tiktok und Instagram eher ungewöhnlich: Neben digitalem Angebot wird dort auch der technische Ursprung großgeschrieben. In den Auslagen der Westbahnstraße stehen Analogkameras – von Vintage bis Antik –, Polaroidapparate, Filmrollen. Analog ist auch die Fotomeile an sich. Der persönliche Besuch ist einer Online-Bestellung vorzuziehen. Flaniert man vom Urban-LoritzPlatz in den siebten Bezirk, taucht man in ein Universum der Fotografie ein, das gleichsam ursprünglich wie traumhaft erscheint.
Geschichtsträchtige Gegend
Es ist kein Zufall, dass sich gerade in dieser Straße eine Vielzahl fotografieorientierter Betriebe aneinanderreiht. Man spürt sofort, dass die Fotomeile nicht von gestern auf heute entstanden sein kann. Ihre Geschichte haftet an Hausmauern und präsentiert sich in den Auslagen. Denn historisch betrachtet ist die
Das Westlicht versteckt sich zwar in einem Innenhof, hat aber trotzdem eine große Sichtbarkeit in der Stadt.
Westbahnstraße schon lange eine wichtige Ader der kreativen Szene Wiens: Im Haus mit der Nummer 25 befand sich bis 1967 die Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, kurz »die Graphische«. Auf dem Lehrplan standen auch damals schon Lichtbildapparate, Entwicklungsflüssigkeiten und fotografische Techniken. Nebenan beheimatete die Nummer 23 zunächst eine Drogerie, aus der allerdings bald das renommierte Kamerageschäft Orator werden sollte. Nach dessen Konkurs im Jahr 2003 befindet sich hier mittlerweile das Fachgeschäft United Camera. Und wo sich Expert*innen einmal angesiedelt haben, gehen sie so schnell nicht wieder weg: Viele der Geschäfte in der Umgebung sind im Besitz ehemaliger Mitarbeiter*innen der Firma Orator, die sich mit ihrem Spezialwissen selbstständig gemacht haben. Durch sie hat sich die Westbahnstraße nach und nach zu einem Hotspot für Fotoliebhaber*innen entwickelt.
»Ein echtes Geschäft«
Franz Gibiser, Sammler, Händler und Fachmann für Analogfilmkameras, ist seit 1985 ein fester Bestandteil der Westbahnstraße. Auch er war Teil der Firma Orator, bis er seinen Laden Camera 31 eröffnete. »Ein echtes Geschäft«, in dem man noch vom Experten selbst beraten wird – eines der vielen, die die Westbahnstraße so besonders machen.

Franz Gibiser, Besitzer Camera 31
»Es gibt ein Bedürfnis nach Entschleunigung.« — Franz Gibiser
Camera 31 ist Anlaufstelle für alle, die sich für analoge Kameras interessieren und auf der Suche nach einem eigenen Modell sind. Gibiser erhält seine Ware aus aufgelösten Sammlungen oder direkt von seinen Kund*innen. Wenn sie bei ihm eintrifft, schätzt er ihren Wert, reinigt sie, übernimmt anfällige kleine Reparaturen und bietet sie schließlich wieder zum Verkauf an.
Trotz einiger Versuche kann sich der Händler nicht von seinen Wurzeln trennen: Das Alte liegt Franz Gibiser seit seiner Zeit bei Orator am Herzen. Schon damals war er für gebrauchte und antike Modelle zuständig, bis dato sind sie sein Spezialgebiet. Denn Langlebigkeit, so der Fachmann, sei bei Neuware keine Priorität. Für digitale Kameras gebe es heute kaum Ersatzteile. Bei alten Geräten sei das anders, erklärt er. Analoge Technik könne man mit dem richtigen Wissen reparieren und noch lange weiterverwenden. Auch eine Patina sei bei einem Vintage-Modell gerne gesehen, im Gegensatz zu Verschleißerscheinungen bei Digitalkameras.
Mehr Charme als eine App
Sein ältester Kunde mag zwar an die 90 Jahre alt sein, doch vor allem Jüngere ziehe es mittlerweile in Gibisers Geschäft. Viele Besucher*innen zählen somit zu einer Generation, deren erste Kontakte mit analoger Fotografie online stattfinden. Das Internet habe laut dem Analogexperten einen größeren Einfluss auf den Kameramarkt, als man denken würde: Der Preis eines bestimmten, vielleicht sogar in Vergessenheit geratenen Modells könne mit einem einzelnen Posting der richtigen Person enorm steigen.
Auch Tourist*innen würden mitunter in sein Geschäft kommen, so Gibiser, auf der Suche nach einer Urlaubskamera für ihren Aufenthalt in der Stadt. Das habe mehr Charme als die I-Phone-App.
Analoge Fototechnik hat also trotz rapider Entwicklung im digitalen Bereich weiterhin ihren Platz. Das sieht auch Peter Coeln so. Der gelernte Fotograf gründete 2001 das Foto- und Kameramuseum Westlicht. Neben vielfältigen Ausstellungen gibt es hier auch eine Sammlung historischer Fotoapparate zu bestaunen. Eine Würdigung der analogen Kamerawelt, die der heutigen digitalen Technik zugrunde liegt.
Hierzulande sei das Verständnis für die Fotografie noch unterbelichtet, so Coeln. Da die Fotokunst bis zum Zweiten Weltkrieg hauptsächlich von jüdischen Fotograf*innen ausgeübt worden sei, habe diese nach dem Krieg ihren Stellenwert verloren. Seit seiner Gründung trägt das Westlicht kontinuierlich
dazu bei, die Fotografie wieder ins Spotlight zu rücken, und ist so ein einflussreicher Knotenpunkt der Fotomeile.
Seine Mission sieht Peter Coeln dabei nicht nur darin, ein Verständnis für die Technik und historischen Hintergründe der Fotografie zu schaffen, sondern auch ihren politischen Anspruch zu beleuchten. Das ehemalige Fabriksgebäude im Hinterhof der Westbahnstraße 40 zählt jährlich etwa 70.000 Besucher*innen, darunter auch 200 Schulklassen, bei der seit 23 Jahren gezeigten »World Press Photo«-Ausstellung.
»Politische Ausstellungen sind wichtig«: Trotz mancher Kritik ist Coeln davon überzeugt, dass die Pressefotoschau ein »Paradebeispiel« dafür sei, was Fotografie bewirken könne. Indem die ausgewählten Bilder dramatische Szenen von Verzweiflung, Krieg und Verwüstung zeigten, machten sie die mediale Flut an abstrakten Nachrichten greifbar. Ein Foto, das

Peter Coeln, Leiter
Westlicht
in einem Museum hänge, hinterlasse dabei einen viel persönlicheren Eindruck als eines, das einem beim Scrollen auf dem Handy unterkomme und schnell wieder vergessen sei. Sobald es in einem Rahmen gezeigt werde, der seiner Dringlichkeit gerecht wird, entstehe eine ganz andere, nachhaltigere Wirkung, so Coeln.
In der digitalen Entwicklung sieht Coeln durchaus Vorteile, sie sei »logisch«. Für die Pressefotografie sei sie sogar ein »Quantensprung«. Auch wenn er betont, dass er den Fortschritt nicht verdammen wolle, merkt man ihm – genau wie Franz Gibiser – an: Sein Herz schlägt analog. Obwohl das Smartpho -

Im Camera 31 berät Franz Gibiser mit Vorliebe zum Thema analoge Kameras.
ne heute die meistgenutzte Kamera ist – laut Coeln sei damit eine gewisse Romantik verloren gegangen: »Am Wertvollsten ist und bleibt die analoge Fotografie.« Ein analoges Foto habe eine stärkere Dreidimensionalität und selbst der scheinbare Nachteil der beschränkten Länge einer Filmrolle führe letztlich zu etwas Positivem: zu mehr Sorgfalt. »Das analoge Fotografieren ist mit Sicherheit wesentlich bewusster und damit besser im Ergebnis als das oft zufällige der digitalen Aufnahmetechnik.«
Insel und Anker
Auch viele von Franz Gibisers Kund*innen wünschen sich einen bedachteren Umgang mit dem Festhalten von Erinnerungen: »Es gibt ein Bedürfnis nach Entschleunigung«, meint der Fachhändler. Das Verlangen nach Achtsamkeit spiegelt sich im Interesse für analoge Techniken wider. Die Übersättigung durch das digitale Angebot treibe viele zurück zu den Ursprüngen der Fotografie. Während die Kundschaft von Camera 31 früher hauptsächlich aus eingefleischten Sammler*innen bestand, ist sie heute diverser, internationaler und jünger. Auch für sie ist die Westbahnstraße ein Sehnsuchtsort. Schließlich lässt es sich nirgends besser in
den umfangreichen Kosmos der Fotografie eintauchen als dort.
Auf den ersten Blick mag es verwundern, wie eine solche Fotomeile voll von vermeintlichen Konkurrenzbetrieben unter dem Druck einer kapitalistischen Gesellschaft überleben kann. Das Geheimnis? »Es ist etwas Gemeinsames«, erklärt Gibiser. Statt Konkurrenz gelte Mitbewerb. Da jeder seine eigene ganz besondere Expertise zu bieten habe und die Klientel sich von Geschäft zu Geschäft unterscheide, kann eine Insel wie die Westbahnstraße bestehen, ohne im Meer des großstädtischen Angebots unterzugehen.
Ein Einkaufsviertel mit speziellem Schwerpunkt, ein Universum aus Expert*innen – was in Metropolen wie Paris, London oder Japan ganz üblich ist, ist in Wien noch eine Seltenheit. Die Stadt ist durch den Gürtel zusammengeschnürt und nach innen gekehrt. Ein Umstand der sich für die äußeren Bezirke mit Potenzial für solche Spezialinseln als schwierig erweist, der auf die Westbahnstraße jedoch einen positiven Effekt hat.
Wie die Fotografie spürt auch die Fotomeile Veränderungen. Wie es weitergeht?
Besonders in den letzten Jahren wird deutlich: Die Westbahnstraße gehört auch auf Seite der Geschäftsleute zusehends den Jungen. Ihr Einfluss trägt genauso zur Entwicklung der Kreativmeile bei wie die alteingesessenen Expert*innen. Immer mehr neue Geschäfte siedeln sich an, das Areal weitet sich auch auf die angrenzenden Straßen aus. Dazu gehört etwa das Photo Cluster in der Zieglergasse, eine Mischung aus CoWorking-Space, Café und Galerie. All diese Orte verbindet die Liebe zur Fotografie. Die Westbahnstraße ist das erfolgreiche Abbild einer fortdauernden, sich beständig weiterentwickelnden Gemeinschaft. Auf historischem Boden wird seit Jahrzehnten eine lange Geschichte mit aktuellem Fortschritt vereint. Das eine kann ohne das andere nicht – wie die vielen Stationen der Fotomeile gehören schließlich auch Analoges und Digitales zusammen. Helene Slancar
Das Foto- und Kameramuseum Westlicht ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, donnerstags bis 21 Uhr. Bis 16. Februar 2025 ist dort die Ausstellung »The Lives of Women« mit Bildern der US-amerikanischen Fotografin Mary Ellen Mark zu sehen.
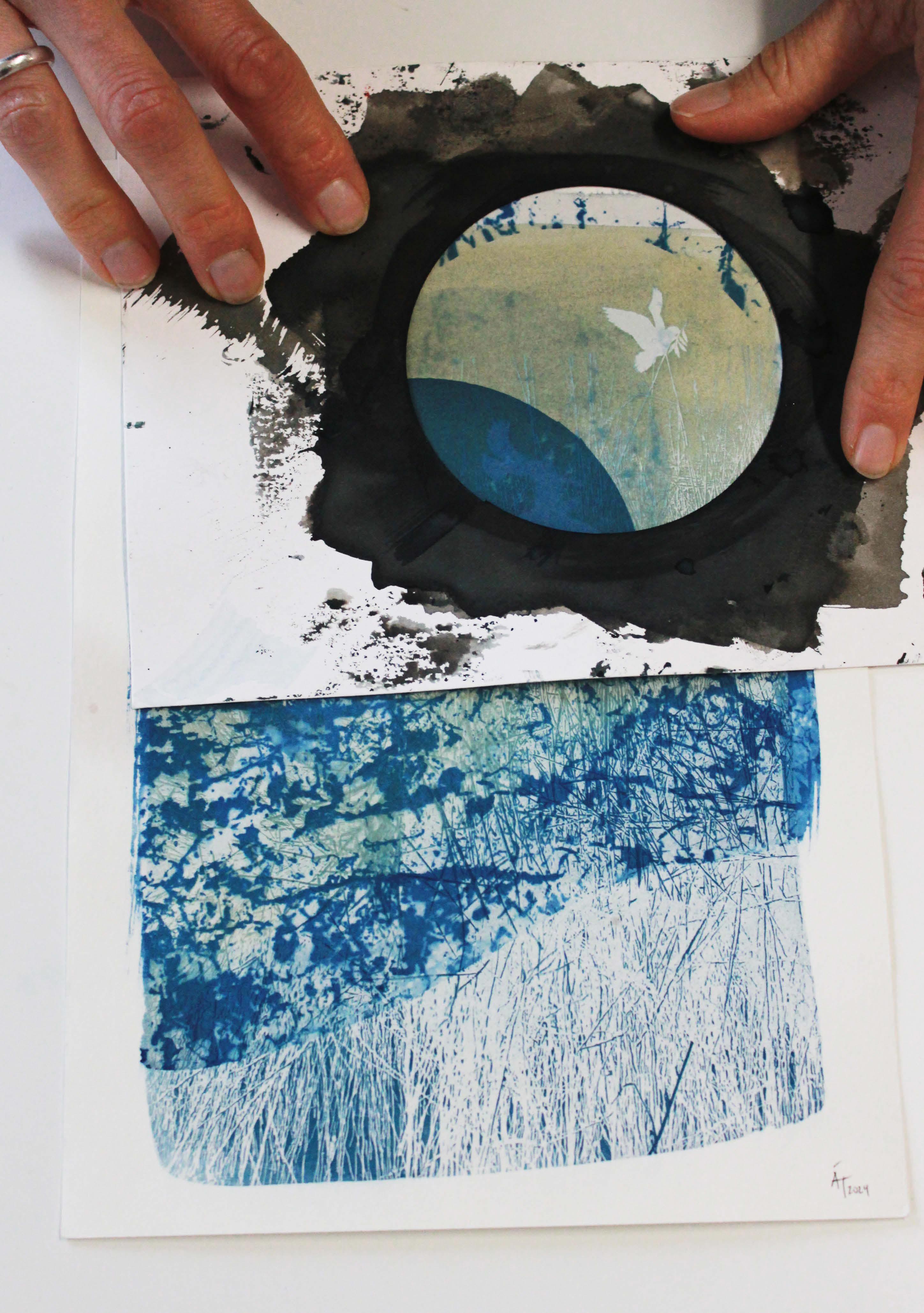
Ángela Tröndle wählt in ihrer Arbeit häufig nachträglich bestimmte Ausschnitte aus.
Die Jazzmusikerin Ángela Tröndle hat nicht nur eine Leidenschaft für Gesang, sondern auch für Zyanotypie. Wie aus Sonne und Salz blaue Bilder entstehen, zeigte sie uns bei einem Besuch in ihrem Workshopkeller. ———— Eine Farbe ist an diesem Tag allgegenwärtig: Es beginnt schon beim satten Blau des Himmels über dem Haus unserer Gastgeberin am Stadtrand Wiens. Langsam wird es Winter. Die Sonnenstunden nehmen von Tag zu Tag ab. Am 21. Dezember wird mit 8,5 Stunden der kürzeste Tag des Jahres erreicht sein. Das sommerliche Hellblau des Horizonts wird dann schnell in die schwarze, mit funkelnden Sternen besetze Nacht übergehen. Irgendwo dazwischen liegt das sogenannte Berliner Blau. Ein mitteldunkler Farbton, dessen HexFarbcode #18206c an die runde Metalldose einer bekannten Feuchtigkeitscreme erinnert. Dem blauen Farbpigment liegt eine EisenBlausäure Verbindung zugrunde.
Überraschungsmomente
Die Wetter-App attestiert an diesem Tag einen UV-Index von zwei, im hochsommerlichen August läge er bei sieben. Je stärker die ultraviolette Strahlung, desto besser funktioniere das Blaumalen, so Workshopleiterin Ángela Tröndle. Das Ergebnis ist ein Blatt Papier mit viel Blau an lichtexponierten und Weiß an lichtgeschützten Stellen. Dieses fotografische Verfahren wird Zyanotypie genannt. Der Begriff setzt sich aus griechisch kyáneos (dun-
kelblau) und týpos (Druck) zusammen. Die 1983 geborene Jazzsängerin und Komponistin Tröndle beschäftigt sich seit ein paar Jahren intensiv damit: »Im Februar 2021 habe ich meinen ersten Zyanotypiekurs besucht und bin gleich vollends in die Technik reingekippt.« Im Hausflur stehen zahlreiche Schuhe der dreiköpfigen Familie Tröndle. Darunter auch dunkelblaue Hauspatschen aus Filz für Besucher*innen. An den Wänden links und rechts der Holzstiege in Richtung Wohnbereich hängen an leichten Fäden mehrere dekorative Objekte aus Papier. Sie sind kreisrund und handflächengroß ausgeschnitten. Die Grundfarbe ist Berliner Blau, darauf in Weiß Abbildungen filigraner Blüten und anderer Naturmaterialien. Im Wohnzimmer hängen ebenfalls Zyanotypien, diesmal großformatig an den Wänden. »Zyanotypie ist Improvisation mit sichtbaren Mitteln«, so Tröndle. »Dazu gehört das Überraschungsmoment und die Ungewissheit oder auch das Akzeptieren der Tatsache, dass nicht alles am Schluss so aussieht, wie man es sich vielleicht erwartet hat.«
Entdeckt wurde die Zyanotypie von John Herschel, als dieser ab 1842 mit Eisensalzen experimentierte. Davor beruhten fotografische Verfahren auf Silberverbindungen. Er ist nicht nur als Erfinder bekannt, sondern auch als Astronom, der Sterne katalogisierte. Sein Vater Friedrich Wilhelm Herschel entdeckte


Die Papiere werden am Tag davor mit einer Lösung bestrichen. Anschließend werden verschiedene Objekte auf ihnen platziert.
»Zyanotypie ist Improvisation mit sichtbaren Mitteln.«
— Ángela Tröndle
1781 den Planeten Uranus. Generell wächst im 18. und 19. Jahrhundert das Interesse an Naturwissenschaften. So zieht 1828 die erste Giraffe im Tiergarten Schönbrunn ein und der Arzt Ignaz Semmelweis veröffentlicht 1861 seine Erkenntnisse zur Hygiene, denen zufolge das Kindbettfieber auf mangelndes Händewaschen von Klinikpersonal zurückzuführen ist.
In Ángela Tröndles Keller und Workshopraum stehen auf einem Tapeziertisch direkt unter den großen Kellerfenstern zahlreiche Terrakottatöpfe, ein Metalleimer sowie unterschiedlich große Gläser und Pappkartons. Darin befinden sich braune Straußenfedern, getrocknete und vergilbte Gräser, Doldengewächse mit den typischen mehrfach verzweigten Blütenständen sowie flache Silberblätter. In einer ausrangierten Holzlade liegen getrocknete Hülsen von Maiskolben, Kastanien, Bohnenschoten, aber auch einige circa zwei Zentimeter große Stücke Klarsichtfolie bedruckt mit Motiven wie Vögeln. »Ich finde es besonders schön, dass man beim Gestalten von Zyanotypien ein Stück Natur auf einem Blatt Papier festhalten kann«, sagt Tröndle.
Herschel hat die Zyanotypie zwar erfunden, aber die britische Botanikerin und Illustratorin Anna Atkins hat diese Technik berühmt gemacht. Ihr Vater, der Universalgelehrte John George Children, war mit der Astronomenfamilie Herschel gut bekannt. 1843 veröffentlichte Atkins den Band »British Algae«, der als erstes Fotobuch gilt. Darin finden sich acht Zyanotypien verschiedener Algenarten, deren Darstellungen einem Herbarium getrockneter Pflanzen gleichen. Binnen eines Jahrzehnts sollten mehr als 10.000 weitere Abbildungen folgen.
Neben dem Tapeziertisch befindet sich ein zweiter freier Tisch, an dem sechs Personen arbeiten können. »Die Zyanotypie ist wohl auch ein Teil der DIY-Bewegung, die in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen ist«, meint Tröndle. »Kreativität spielerisch auszuleben, mit den Händen gestaltend dem Alltag für ein paar Momente zu entwischen, spricht immer mehr Menschen an.« Sie zieht eine schwarze Plastikhülle aus einem dicken Ringordner und entnimmt mehrere feste, strukturierte Papiere im Postkartenformat. Alle sind auf einer Seite mit einer ockergrünen Farbe bestrichen. Sie sehen fast wie Aquarelle aus. Die Workshopleiterin legt eines davon auf die Tischplatte und steckt das schwarze Sackerl gleich wieder verschlossen in den Ordner zurück.
Tröndle hat bereits am Vortag zwei Salze mit destilliertem Wasser angemischt, die Papierblätter damit bestrichen und das Ganze 24 Stunden in Dunkelheit einwirken lassen. Rotes Blutlaugensalz, Kaliumhexacyanoferrat(III), bildet mit Wasser eine ockergelbe bis grünliche Lösung. Als rostrotes Salz dient es auch als Stahlhärter oder Oxidationsmittel und nimmt Elektronen auf. Es ist eine der beiden lichtempfindlichen Komponenten, die Tröndle in dunklen Flaschen aufbewahrt. Die zweite ist Ammoniumeisen(III)-citrat. Unter Sonneneinstrahlung wird das gelbliche Salz der Zitronensäure mit dem roten Blutlaugensalz zu einem unlöslichen blauen Eisensalz reagieren.
Auf die eingefärbte und lichtempfindliche Seite der Postkarte werden aber vor der Reaktion im Sonnenlicht ausgewählte Naturmaterialien gelegt. Die weiche Straußenfeder wird am Kartenrand wie ein Bogen platziert. Der kleine
Blütenstand des Doldengewächses füllt die Mitte aus. Schließlich wird eine Glasplatte daraufgelegt, die Materialien darunter flach gepresst und das Ganze anschließend mit zahlreichen Clips fixiert. Raus aus den blauen Patschen und zurück in den Straßenschuhe, geht es in Tröndles Garten. Ein blauer Korbsessel steht in der Mitte des Grundstücks bereit. An seiner Lehne wird das Bild zur Sonne ausgerichtet. Bereits in den ersten Minuten scheint sich die ockergrüne Farbe zu verändern – bis zum Blau von Tröndles Herbstjacke reicht es noch nicht.
Ganz ohne Dunkelkammer
Die Zyanotypien von Tröndle sind vielseitig. Es gibt unterschiedliche Papierformate mit teils mehrdimensionalen Effekten. Wieder andere sind gebleicht und erneut belichtet. Tröndle experimentiert mit verschiedenen Untergründen wie alten Karten oder verwendet Schablonen, um sich visuell auszudrücken: »Das Auflegen der Objekte, Folien oder Papierschnipsel passiert bei mir spielerisch und intuitiv. Oft weiß ich in diesem Moment gar nicht, wie es aussehen wird und lasse mich überraschen. Später mache ich oft anderes daraus, indem ich die blauen Bilder in Collagen oder Kreisausschnitten neu platziere.«
45 Minuten später geht es mit dem Bilderrahmen vom Garten wieder zurück ins Haus. In der hintersten Ecke des Workshopkellers ist ein metallenes Doppelwaschbecken angebracht. Vom Bilderrahmen werden die Clips entfernt, die Straußenfeder und die Blüte zur
Seite gelegt und das Papier wird unter fließendem Wasser mehrfach geschwenkt. Mehr und mehr färbt sich der belichtete Bereich in das charakteristische Blau um, während die unbelichteten Stellen unter der Feder und der Dolde weiß bleiben. Anschließend wird das Bild in die danebenstehende quietschentengelbe Wanne gelegt und dort für zehn Minuten im Wasser liegen gelassen.
Durch das Wasserbad werden die restlichen Salzkristalle ausgeschwemmt. Ab diesem Zeitpunkt verändert sich das Blau des Bildes nicht mehr. Ein rasches wie kreatives fotografisches Verfahren, das ohne Kamera, Dunkelkammer sowie teure und gefährliche Chemikalien auskommt. Sein Erfinder Herschel hat mit dieser Technik in erster Linie Pläne und Zeichnungen kopiert. Die sogenannten Blaupausen. Für die Anwendung im Bereich der Textilien erklärte die UNESCO den Blaudruck im November 2018 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit.
Nach dem Wasserbad wird das Bild vorsichtig mit einem Handtuch abgetupft. Im trockenen Zustand wird sich auch sein Blau nicht mehr verändern – wie jenes von Tröndles Jacke und den Hauspatschen im Eingangsbereich.

Ángela Tröndle, Workshopleiterin
Sandra Fleck
Für alle, die in den Prozess der Zyanotypie eintauchen wollen, bietet Ángela Tröndle Workshops an. Näheres dazu und zu ihrem künstlerischen Schaffen unter www.angelatroendle.com.
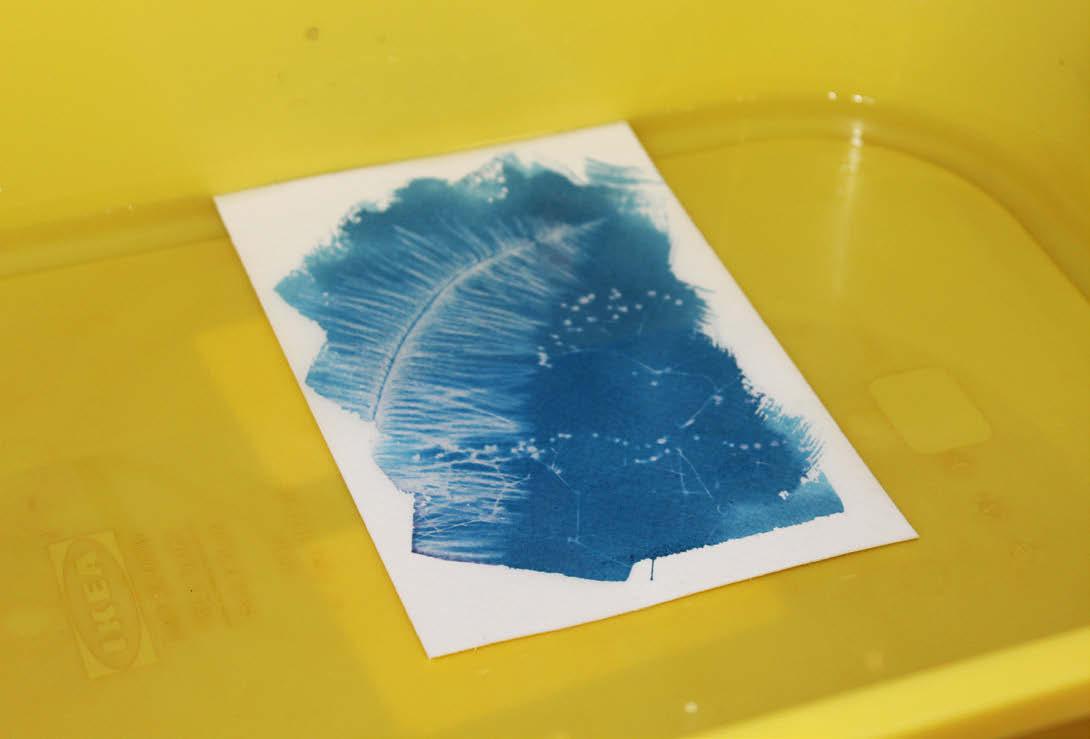
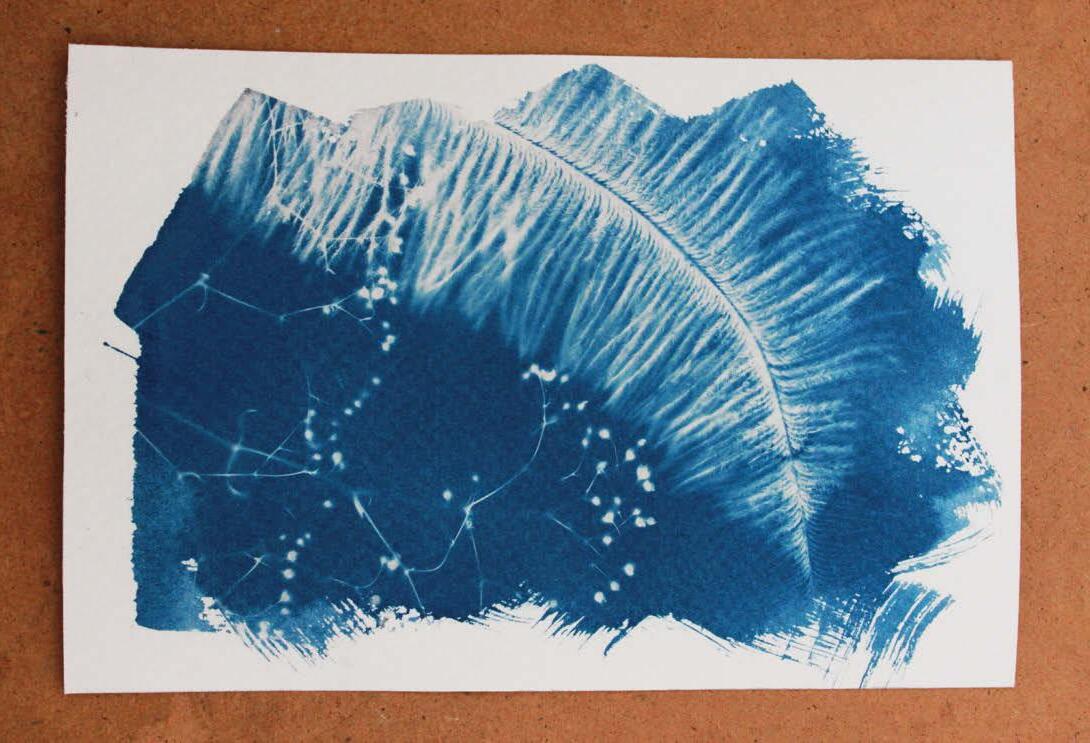
Nachdem die Bilder bei Sonnenlicht entwickelt worden sind, müssen die restlichen Salze im Wasserbad ausgeschwemmt werden. So entsteht das finale Bild.
In seiner Satire »Arcus« lässt Norbert Maria Kröll einen Künstler aus bestens betuchtem Hause mehrere Milliarden erben. Doch dieser will die monetäre Last loswerden. Was gar nicht einmal so einfach ist. Mit ausreichend Seitenhieben auf Kunstbetrieb und Politik wird’s durchaus unterhaltsam böse, wenn sich die narzisstische Künstlerseele in Philanthropie übt. Ein Auszug aus dem fünften Kapitel des Romans, das auf einem Begräbnis spielt. A schiache Leich’ …
Stéphanie. Er sah sie schon von Weitem, wie sie mit ihrem eigenwilligen Look zwischen den schwarz gekleideten Langweilern hindurchschien: mintgrüner, weit geschnittener Hosenanzug, dessen Stoff im Wind an ihren Beinen flatterte, Sonnenbrille (immerhin war es ein Begräbnis!), ebenfalls mintgrüner, breitkrempiger Hut, darunter ihre glatten, dunkelblonden Haare, die ihr bis über die Schultern reichten. An sie geschmiegt ihre zwölfjährige Tochter Anouk, mit einem ins Lachsrot gehenden, ähnlich geschnittenen Hosenanzug, einer braunen, zu groß wirkenden Lederjacke, und hellblonden, sehr kurz geschnittenen Haaren, die ihr igelartig vom Haupt abstanden. Als Stéphanie Arcus auf sich zukommen sah, legte sie eine Prise Traurigkeit in ihr Lächeln. Warum sie keine Darstellerin geworden war, blieb Arcus bis zuletzt ein Rätsel. Die Trauergäste versperrten Arcus den Weg zu Stéphanie; sie streckten ihm ihre vom Geldsammeln schmutzigen Hände entgegen, als wäre er der nächste Heiland, der unbedingt berührt werden musste.
»Herzliches Beileid«, pressten die Liebochs, denen Arcus noch ein paar Tage zuvor durch den Zaun in den Garten gepisst hatte, mit geschwollenen Tränensäcken hervor. »Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr es uns schmerzt …«
»Ja, danke«, unterbrach sie Arcus. »Aber ich sage es Ihnen gleich: Ich werde Ihnen nicht die Hand geben. Ich brauche Ihr Mitleid nicht. Ich verspüre kein Leid. Sie können Ihres, wenn Sie unbedingt wollen, bei einer anderen Person abladen. Bei einem Priester vielleicht. Abgesehen davon möchte ich nichts mit Ihnen zu tun haben.«
Die Liebochs (und alle anderen, denen gegenüber er ähnliche Aussagen tätigte) waren konsterniert. Sie glaubten, die Worte, die aus seinem Mund kamen, falsch verstanden zu haben. Es musste so sein! Er, Arcus, war doch nun einer von ihnen, ja, war es im Grunde immer gewesen, auch wenn er viele Jahre hindurch vorgegeben hatte, er
sei woandershin abgebogen. Von Geburt an war er Teil des Geldes. Würde es immer bleiben. Wer einmal so ein Vermögen besaß, konnte es nicht mehr verlieren, konnte es nur vermehren. Daran führte kein Weg vorbei. Vor den Kopf gestoßen fühlten sich die Trauernden, als sie ihr Bedauern dem Erben nicht mit einem Händedruck kundtun konnten. Arcus spürte, dass man hinter ihm kollektiv mit dem Zeigefinger an die Stirn tippte. Dass sie seine Aussagen als eine Art künstlerisch pathetischer Trauer interpretierten. In Wahrheit aber interessierte sich Arcus gar nicht für diese Zeremonie. Er hatte in der Tat nicht das Gefühl, trauern zu müssen. Wäre es nach ihm gegangen, hätte das Begräbnis erst gar nicht stattgefunden. Der testamentarische Wunsch seiner Eltern, neben dem rechterhand der Kapelle begrabenen Klemens Maria Hofbauer bestattet zu werden, war an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Als würde der Standort ihrer Särge sie im Nachhinein in fromme Menschen verwandeln. Die Kirchengemeinde, die sich auf diese Weise für die finanzielle Unterstützung mehrerer, jahrelang sich hinziehender Renovierungen ihrer Gotteshäuser dankbar zeigen wollte, war hier klar anderer Ansicht. Sie wäre gar beleidigt gewesen, hätte sie die Familie Himmeltroff-Gütersloh nicht auf ihrem Friedhof in unmittelbarer Nähe ihres Heiligen begraben dürfen, der mittlerweile – das wussten Arcus’ Eltern wahrscheinlich nicht einmal – ironischerweise in Wien ruhte.
»Hallo Stéphanie, hey Anouk«, sagte Arcus, als er ihnen endlich gegenüberstand. »Ihr seid, wie ich sehe, passend angezogen«, lächelte er.
»Worauf du einen furzen kannst«, entgegnete Anouk mit ihrem Sommersprossengesicht, das jeden, der sie ansah, augenblicklich entwaffnen musste.
»Ich dachte mir schon, dass dir unsere Kleidung gefallen würde«, sagte Stéphanie und fügte an Anouk gerichtet hinzu, dass es einen lassen heiße und nicht einen furzen, und dass Fäkalsprache – ob sie ihre Abmachung verges-
sen habe? – erst nach dem Begräbnis wieder erlaubt sei. Anouk verdrehte die Augen und verschränkte die Hände. »Ich habe nichts Schwarzes gefunden, das zu diesem Anlass passen würde«, sagte Stéphanie zu Arcus. »Abgesehen davon kann ich mir von meinem Gehalt keine neuen Kleider leisten.«
»Aber du hättest ja mich …«, begann Arcus, doch dann verstummte er, da er genau wusste, dass sie sein Geld nicht haben wollte, auch nicht, wenn er es sich mit seiner Kunst selbst verdient hatte, was erfreulicherweise bald nach seinem Umzug nach Wien der Fall gewesen war.
Stéphanie neigte ihren Kopf etwas zur Seite und nahm ihre Sonnenbrille ab, betrachtete Arcus’ Schultern, seinen Hals, den Mund und die Augen und schien etwas zu erkennen, das Arcus beim Blick in den Spiegel verborgen blieb. »Du solltest mich umarmen«, sagte sie dann. »Schnell, komm! Da steckt was in deiner Brust. Es wird dir danach besser gehen.«
Arcus schloss die Augen und sah sich plötzlich als Kind vor sich. Wie er Stéphanie im Kindergarten das erste Mal gesehen hatte. Und sie ihn. Wie sie ihn noch am selben Tag gefragt hatte, ob er für immer ihr Freund bleiben wolle und er, ohne überlegen zu müssen, mit einem schüchternen Ja geantwortet hatte. Wie sie ihm erklärt hatte, dass ihre Mama aus Frankreich komme und ihr Name daher auf keinen Fall so auszusprechen sei wie der von Stefanie aus der Marienkäfer-Gruppe.
Arcus hatte seine Eltern nie gefragt, warum sie ihn im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht in den Privatkindergarten und später in die Privatschule geschickt hatten. Nicht, weil er es nicht wissen wollte (vielleicht war er kein Wunschkind, vielmehr ein Unfall, jedenfalls nicht der Erstgeborene und daher nicht so viel wert wie sein Bruder?), sondern weil er, rückblickend, froh darüber war. Froh, dort seine beste Freundin kennengelernt zu haben, einen Menschen, der ihn seither begleitete. Froh, mit Personen außerhalb der Welt der Superreichen in Kontakt gekommen zu sein, etwas, das Judith und Johannes verwehrt geblieben war und sie für Arcus zu ärmeren Menschen gemacht hatte. Froh auch, miterlebt zu haben, wie die meisten Eltern mit ihren Kindern umgingen: gewiss nicht immer liebevoll, doch stets mit einer ihm unverständlichen, ja rätselhaften Art von Nähe, die ihm vor Augen führte, dass es etwas Zwischenmenschliches gab in dieser Welt, das er bei sich zuhause niemals erfahren hatte. Arcus war froh, damit konfrontiert worden zu sein, dass es in derselben Stadt Menschen gab, die nicht wussten, wie sie bis zum Ende des Monats mit ihrem Einkommen auskommen sollten, und er war froh, zumindest von einigen wie ein Mensch und nicht wie ein privilegierter Gottgleicher behandelt worden zu sein.
Als Stéphanie Arcus in die Arme nahm, ihre Hände mit sanftem Druck auf seinen Rücken legte und sie dort kreisen ließ, brach dieser, als hätte sie mit ihren Berührungen behutsam einen Wasserhahn aufgedreht, in Tränen aus. Seinen ganzen Körper schüttelte es, er schluchzte laut und immer lauter, sodass die Anwesenden ihre Flüstergesprä-

Norbert Maria Kröll lebt und arbeitet in Mödling. Der 43-Jährige studierte Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien und veröffentlichte 2017 seinen Debütroman »Sanfter Asphalt«. Die Romane »Wer wir wären« und »Die Kuratorin« folgten. Detto Preise und Stipendien. Zuletzt erhielt er für einen Auszug aus seinem jüngst erschienen Neuling »Arcus« (Verlag Kremayr & Scheriau) den »Literatur im Süden«-Sonderpreis der Stadt Villach.
che unterbrachen und nicht anders konnten, als sich zu ihm umzudrehen. Das Weinen schlich sich an diesem Ort wie ein unangenehmer, weil viel zu emotionaler Eindringling in die Realität der Zugeknöpften.
Anouk hörte sich das eine Zeitlang an, zeichnete mit den Schuhspitzen eine Spirale in den Kiesweg und fragte sich, ob sie sich die weißen Stöpsel ins Ohr stecken sollte, die sie für alle Fälle stets dabeihatte, überlegte es sich dann aber anders und sagte: »Peinlich.«
Augenblicklich war es still. Arcus löste seinen Körper von Stéphanies und es wirkte, als käme er von einer weiten Reise zurück.
»Du hast vollkommen recht«, meinte Arcus zu Anouk. »Aber weißt du, manchmal muss man auch den Mut haben, peinlich zu sein.« Er wischte seine Tränen weg, als ihm ein Mann auffiel, der ihn anstarrte. Warum bekam Arcus plötzlich Gänsehaut? Der Mann stand etwa zwanzig Meter entfernt aufrecht und mit herausgestreckter Brust da und wirkte in seiner Warteposition auf Arcus, als hätte er eine Botschaft zu überbringen. Dunkelbraune, schulterlange Haare, gedrungener, kräftiger Körper. Anzug trug er keinen. Als sich der Mann sicher war, Arcus’ Aufmerksamkeit zu haben, nickte er ihm kaum merklich zu. Und verließ den Friedhof durch einen der Seitenausgänge.
»Wer war das?«, fragte Stéphanie, die nur noch den Rücken des Mannes zu Gesicht bekam.
»Ich weiß es nicht«, meinte Arcus, und wiederholte leise: »Ich weiß es nicht.«
Teresa Wagenhofer Bernhard Frena

Bildende Künstlerin
Oberflächen haben es Birgit Graschopf angetan. Glatt, rau, rissig, spröde, gewellt. Schleifpapier, Betonblöcke, Gebäudewände. Die unterschiedlichen Untergründe sind jedoch nicht Motive für ihr Kameraobjektiv, sondern fotografische Trägermaterialien. Denn Graschopf belichtet nicht auf herkömmliches Fotopapier. Stattdessen trägt sie eine spezielle Entwicklungsflüssigkeit direkt beispielsweise auf Schleifpapier in knalligem Obi-Orange auf. Der Reiz liegt für sie hier oft im Kontrast: »Auf meinen Bildern sind manchmal zarte oder durchsichtige Wesen zu sehen, die sehr fragil wirken. Denen möchte ich einen Widerpart entgegensetzen, zum Beispiel ein hartes, schweres Material, das dem Ganzen wieder Gewicht gibt. Oder etwas Kratziges, Widerspenstiges. Die Personen in meinen Bildern sind ja durchaus tough und raumeinnehmend. Das Material bringt dies zum Ausdruck.« Besonders aufwendig sind ihre Arbeiten an Wänden, die sie etwa schon in den Räumen der Albertina umgesetzt hat. Denn bis zum Moment der Belichtung muss dabei alles in Dunkelheit stattfinden. Die Belichtung selbst dauert dann nur Sekunden, da müsse alles stimmen. »Es ist wie eine Choreografie«, meint sie schmunzelnd. Ob an Wand oder auf Beton und Schleifpapier, am Ende stehen dann immer Unikate: »Ganz genau gleich kriegt man es nie wieder hin.«



Bildende Künstlerin
Für die Wiener Künstlerin Sophie Tiller können Fotografien Ausgangspunkt wie Endprodukt ihrer Arbeit sein. Dazwischen steht ein langer Prozess. Er beginnt mit großformatigen Abzügen oder auch Büchern und anderen Objekten. Diese bestreut Tiller mit Kresse und lässt anschließend die Natur walten. Neben der gesteuerten Bepflanzung setzt sie auch auf diverse Flugsamen und Pilzsporen. Das zuvor starre Ausgangsmaterial entwickelt sich so zu einem zunehmend lebendigen Biotop. Dadurch kommt für Tiller auch eine völlig neue Zeitebene hinzu: »Oft hält man als Fotografin nur schnell Momente fest. Bei mir sind das aber Projekte, die über eine lange Zeit gehen und die auch viel Betreuung brauchen.« Schlussendlich kommt es dann allerdings doch wieder auf den Moment an. Denn ihre Objekte stellt sie mittlerweile nicht mehr aus: »Die sind sehr heikel, sie brauchen die richtige Temperatur, das richtige Licht. Manchmal schauen sie auch nur über Nacht so aus oder an einem einzelnen Tag. Sie sind in ständiger Wandlung.« Stattdessen dokumentiert sie einzelne Augenblicke des langsamen Verfallsprozesses. Nicht um ihn nachvollziehbar zu machen, sondern um die eigenwillige Ästhetik dieser Momente herauszuarbeiten.




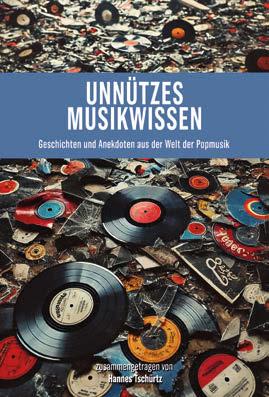
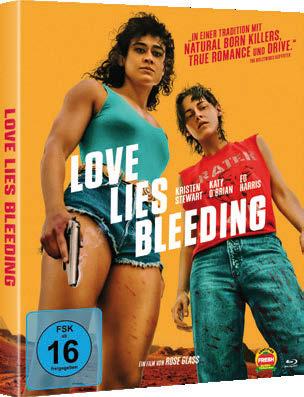
1 Freitag F21 Nightclub
Dass der Lkw-Planen-Recycler Freitag seine DJ-Tasche angesichts des anhaltenden Vinylbooms wieder auf den Markt bringt, scheint geradezu aufgelegt (pun intended). Wie das Original aus dem Jahr 1995 bietet der quadratische Messenger-Bag Platz für bis zu 30 Schallplatten. Robust und wasserabweisend ist das Ding obendrein, also ideal für den nächtlichen Einsatz im Club. Wir verlosen ein Exemplar.
2 Drahdiwaberl »Psychoterror« und »The Worst of«
Die letzten beiden in einer Reihe diverser Drahdiwaberl-Reissues. Limitiert, nummeriert, farbiges Vinyl, dazu Illustrationen von Stefan Weber, dem kreativen Kopf der provokanten Truppe. Und natürlich Musik: von »Boring Old Fart« über »Ganz Wien« (mit Falco) und »Don’t Touch Me There« (mit Dana Gillespie) bis »Lonely« (mit »Kottan« Lukas Resetarits). Wir verlosen je zwei Exemplare.
3 Peter Waldeck »All der wilde Unfug«
Mit raffinierter Komik und der einen oder anderen Überraschung wartet Peter Waldeck in seinem neuen Roman auf. Wie man es von ihm gewohnt ist, könnte man sagen. Nach »Spaß und Schulden am Neustifter Kirtag« (2022) und »Triumph des Scheiterns« (2019) das nächste absurde kleine Meisterwerk des Wiener Autors und abermals ein lesenswertes Buch aus dem Milena Verlag. Wir verlosen zwei Exemplare.
4 Hannes Tschürtz »Unnützes Musikwissen«
Wenn man Hannes Tschürtz beim nächsten Pub-Quiz schon nicht in seinem Team haben kann, sollte man sich zumindest mit diesem Buch darauf vorbereiten. Der gute Mann von Ink Music hat hier nämlich »Geschichten und Anekdoten aus der Welt der Popmusik« zusammengetragen. Bestimmt sehr kurzweilig – und bei der richtigen Gelegenheit eben alles andere als unnütz. Wir verlosen drei Exemplare.
5 »Love Lies Bleeding«
Rose Glass inszeniert Kristen Stewart (Lou) und Katy O’Brian (Bodybuilderin Jackie) als Hals-über-Kopf-Verliebte auf der Flucht vor Lous zwielichtigem Vater (Ed Harries). Dass dieser vor kaum etwas zurückschreckt, um seinen Willen durchzusetzen, sorgt für diverse Gewaltexzesse. Dazu gibt’s tiefschwarzen Humor und einen pulsierenden 80erJahre -Soundtrack. Wir verlosen drei Blu-Rays.

Avec — Jim Bob
Ein Album wie ein Tagebuch. Oder eher: wie ein Nachtbuch. Denn es wird vor allem in Momenten der Schlaflosigkeit aufgeschlagen, um Fragen wie »Is it real love?« oder »Is it real, love?« mit dem imaginären Freundeskreis zu verhandeln. Oder auch: »Why is it easier to feel angry than sad?« Zeile für Zeile füllen sich die Blätter, bis irgendwann plötzlich ein Durchatmen möglich ist. Es geht darum, den Schmerz, den eine zerbrochene Liebe mit sich bringt, zu umarmen – so fest, dass ihm irgendwann die Luft ausgeht, wie dem schon etwas müde wirkenden Herzluftballon, der seit der letzten gemeinsamen Party die Küche ziert. Oder so lange, bis das Leid sich irgendwann an die eigene Körpertemperatur angepasst hat und sich plötzlich warm und wohlig anfühlt. Avecs selbstbetiteltes neues Album ist eine Reise in das innerste Innenleben der Singer-Songwriterin, die durch eine Landschaft voller Höhen und Tiefen verläuft und eine*n irgendwann aus dem eben noch bewohnten emotionalen »Wasteland« hinausführt. Es ist ein Versuch, Herzschmerz und Euphorie miteinander zu verschmelzen. Eine Verbindung, die sowohl wütend-trotzige als auch verletzlich-zarte Untertöne hervorbringt. Sie kommt dabei aber immer einer Umarmung gleich – und zwar keiner, die einem die Luft abschnürt, sondern einer, die sich von Anfang an einfach nur wohlig-warm anfühlt.
Trotz aller Offenheit ist es jedoch nicht so, dass die Sängerin und Songwriterin ein Album geschaffen hat, das vollkommen unverschlüsselt daherkommt. Hier und da gilt es, eine rätselhaft anmutende Stelle zu knacken oder eine Metapher zu dechiffrieren. Wer dieses Nachtbuch aufschlägt, wird zwar das Gefühl haben, kurz in ein anderes Leben hineinschauen zu dürfen, durchschauen lässt sich Avec jedoch nicht. Dafür ist ihr selbstbetiteltes Werk viel zu poetisch und mit viel zu vielen – mal lauteren, mal leiseren – Zwischentönen ausgestattet.
(VÖ: 24. Jänner) Sarah Wetzlmayr
Live: 4. April, Linz, Posthof — 8. April, Graz, Orpheum — 9. April, Salzburg, Rockhouse — 10. April, Innsbruck, Treibhaus — 11. April, Dornbirn, Spielboden



Unsere Facetten
Manchmal ist es gar nicht so einfach, rechtzeitig an die Alben für Rezensionen zu kommen. Der Erstling von Chovo ist gerade noch unter den zufallenden Toren durchgerutscht, und – um es vorwegzunehmen – das Warten hat sich durchaus gelohnt. »Unsere Facetten« ist ein Album, das diese Bezeichnung verdient hat. Keine zufällig zusammengewürfelte Ansammlung von Tracks, sondern ein kohäsives Ganzes mit einem zentralen Thema, das sich durch die knackigen 30 Minuten zieht. Es dreht sich alles um die titelgebenden Facetten des Frauseins in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Mit allen Ups and Downs, allem Sexismus, aller Misogynie, allen drückenden Erwartungen, aber auch mit aller gegenseitigen Solidarität, allen Erfolgsmomenten, aller Lebensfreude. Auch was den emotionalen Zugang betrifft, ist Chovo hier facettenreich. Mal wütend, mal kontemplativ, mal energisch, mal relaxed.
Musikalisch changiert das Album irgendwo zwischen Hip-Hop und R&B. Die stärksten Momente finden sich, wenn die Nadel mehr in Richtung von Letzterem ausschlägt. Während Chovos Rap-Flow solide, aber nicht bemerkenswert ist, landen ihre lyrischen Runs und Hooks treffsicher. Insbesondere der Track »Autopilot« zeigt die Sängerin von ihrer besten Seite. Inmitten eines pulsierenden, mitreißend produzierten Beats schwebt Chovos Stimme zwischen den sieben Wolken. Es ist eine Ode an die Sicherheit in einer Beziehung, die auf Vertrauen und enthusiastischer Zustimmung basiert. Ein Sich-fallen-Lassen, aber gleichzeitig auch ein Aufgehoben-Sein.
Dieses Gefühl der Erleichterung wird umso stärker im Kontrast zum vorhergehenden Track. »Jedermann« erzählt eine düstere, aber allzu alltägliche Geschichte: »Geht jemand hinter mir her / Es ist spät, ja die Straßen sind leer / Schlüssel eingeklemmt zwischen meinen Fingern / Als ob das irgendwie die Chancen verringert«, und schließlich: »Nicht jedermann, aber immer ein Mann / Nicht jeder tut es, aber jeder Mann kann«, wohl eine der stärksten Zeilen auf der ganzen Platte. Zwischen diesen beiden Tracks blitzen die ganzen Facetten von Chovos Debüt auf. Nicht immer perfekt poliert, aber mit genug funkelnden Aspekten, um das Album in seiner Gänze zum Strahlen zu bringen. (VÖ: 9. Dezember) Bernhard Frena

»Kranetude« fühlt sich an, als würde man die ganze Zeit angestupst werden. Ein nerviges kleines Geschwisterchen, das permanent Aufmerksamkeit einfordert, nicht um etwas zu sagen, sondern nur um zu beweisen, dass es diese Aufmerksamkeit bekommen kann. Auf der Rückbank sitzend fragt es in Endlosschleife: »Sind wir schon da?« Katharina Ernsts und Stefan »Schne« Schneiders Album ist als musikalisches Bühnenbild zu einer Performance von Florentina Holzinger entstanden. Im Sommer 2023 wurde das gleichnamige Stück am Berliner Müggelsee uraufgeführt. Dabei bespielten die nackten Tänzerinnen extravagante Requisiten wie Jetskis und einen Kran, der sie kopfüber aus dem Wasser zog. Die Extravaganz der Inszenierung spiegelt sich in der Musik wider: Komponiert für vier Schlagzeuge, eine Marimba, mehrere Gongs und ein Wellblech bewegt sich »Kranetude« musikalisch irgendwo zwischen Ambient und Freejazz. Ernst und Schneider scheinen ununterbrochen Blitze über den Himmel zu schicken, die an dessen Ecken abprallen und sich so in einem endlosen Echo immer und immer wieder potenzieren. »Kranetude« lebt von einer Anspannung, die vergeblich auf Erlösung hofft. Bereits der Opener »Under Water« endet in einem schwindelerregenden Trommelchaos und hinterlässt ein Gefühl von orientierungsloser Faszination. Man möchte die Drums aus der vom Gewitter dicken Luft pflücken. In »Above Water« gibt es einen Versuch der Auflösung. Ein unheimliches Pfeifen kündigt einen Sturm an, der vom Geschwisterchen an den Tomtoms angefeuert wird: Schneller werdendes Trommeln wird über knapp fünf Minuten zu ziellosem Vorwärtsmarschieren. Doch trotz aller Schrägheit, gibt es in »Kranetude« immer wieder Raum für Groove. Wenn bei »Rising II« die komplexen Rhythmen geradlinig nebeneinander herlaufen und die Sicht klarer wird, verspürt man fast den Impuls mit den Füßen zu wippen. »Kranetude« sucht nicht verstanden zu werden. Verstehen würde seine Bedeutungstiefe nur beschneiden und Beschneidung verlangt in einem von Florentina Holzinger in Auftrag gegebenen Stück bestimmt nicht danach, nur impliziert zu werden – wenn doch Explizitheit eh viel schöner ist.
(VÖ: 29. November) Helena Peter



Eine gewisse Schwere ist dem beeindruckenden dritten Soloalbum von Markus Kienzl nicht abzusprechen: Stilistisch im Downtempo-Bereich zwischen Elektronik, Hip-Hop, Rock, Breakbeats und Dub angesiedelt, sprechen sowohl Songtitel wie »Confused«, »Chained« oder »Screenbitch« als auch die Lyrics eine recht düstere Sprache. Kienzls neuer Release erinnert an die Sofa Surfers, bei denen er Gründungsmitglied ist und deren Sound er hörbar mitgeprägt hat. Um die Jahrtausendwende war die Band ein elementarer Teil der international gefeierten Wiener Szene. So viel zum zeitgeschichtlichen Kontext.
»Three« als Soloprojekt wirkt nun roh und treibend, gleichzeitig aber ausgereifter: Jeder der 13 Tracks ist genau am Punkt angekommen. Keine Über-Arrangements, keine zu minimalistischen Produktionen, alles passt zusammen und fühlt sich rund an. Zu dieser Meisterleistung trägt Kienzls langjährige Erfahrung als Komponist von Filmmusik bei: Die anders gelagerte Produktionsweise hat dem Musiker offensichtlich geholfen, im Zentrum seines Sounduniversums anzukommen. Auch das eigene Tonstudio, in dem Kienzl nach Lust und Laune spielt, jammt und experimentiert, ist sicherlich eine wichtige Basis dieses Entwicklungspfads.
Die musikalische Grundierung erstellt Kienzl stets im Alleingang: Er arrangiert detailverliebt und minutiös jeden Ton, jedes Geräusch und jeden Beat eines Tracks, der so zu einer schlüssigen und in sich abgeschlossenen Einheit wird. Erst in der präfinalen Phase kommen die Gastvokalist*innen zum Einsatz, um die Songs zu komplettieren. Es sind bekannte Namen wie Saedi, Oddatee, Semtex MC und Loretta Who, die hier ans Mikro getreten sind. Mit ihnen hat Kienzl schon früher kooperiert, da gibt es Vertrauen und gegenseitiges Verständnis, was dem gesamten Album zugutekommt.
Übrigens: Die erweiterte Fassung von »Three«, die »Metrocosmos Edition«, enthält 13 zusätzliche Instrumentalkompositionen Kienzls, die den Soundtrack zur Arte-Serie »Metrocosmos« bilden. (VÖ: 29. November) Kami Kleedorfer

Manche sagen, das zweite Album, das sei das schwierigste. Andere meinen, es sei das dritte – vom vierten ganz zu schweigen. Aber ganz ehrlich: Jedes Album ist schwierig, sonst hätten wir ja alle schon Tausende gemacht. Dass sich aber genau beim dritten der Gauß mit seiner Kurvendiskussion so türmt, ist schon beachtlich. Du fragst dich nämlich schon, so als Band: In welche Richtung soll das alles jetzt gehen? Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen des kommerziellen Erfolgs fliehen? Oder ist auch deine Band doch irgendwie eine Brand mit Corporate Identity und so? Wenn du dich dann – Spoiler: wie Laundromat Chicks – für Letzteres entscheidest, musst du auch schauen, wie sich das alles framen lässt, irgendwo zwischen »gefundenem Sound« (gut!) und »immer das Gleiche« (schlecht!). Ich sage: Das liegt im Interpretationsspielraum der Hörenden. Ich sage aber auch: Die Laundromat Chicks haben ihren Sound gefunden. Du hörst das und weißt genau: Laundromat Chicks! Zwischen Big Star und Belle & Sebastian, zwischen Power-Pop und Twee, zwischen Jangle-Pop und Shoegaze-Folk.
Da macht es auch wenig bis nichts, dass selbst die Jungs vom Sägewerk stilistische Updates vom Vorgänger aus dem Jahr 2023 (»Lightning Trails«) an einer Hand abzählen können. Ja, ein bisschen anders produziert. Ja, auch irgendwie mehr Band im Songwriting. Aber das merkst du am Endprodukt halt nicht unbedingt – einer der Vorteile daran, seinen Sound eben schon gefunden zu haben. Was man dagegen im Geldbeutel merkt: Du kriegst mehr für dein Geld. Mit einer knappen halben Stunde gibt’s noch einmal plus 33 Prozent bei der Albumlänge drauf. Shrinkflation my ass! Laundromat Chicks for Konsumentenschutzministerium! Ansonsten gilt wie immer bei so einer Sachlage: Wer Laundromat Chicks gut findet, wird auch von »Sometimes Possessed« sometimes possessed sein. Wem das allerdings bislang schon zu schnöde war, wird sich auch jetzt kaum umstimmen lassen. Weil wir aber selbstredend große Fans von Hammermüller, Strohmer, Schnabl und Pöttinger sind, gibt’s für uns da eher keine Diskussion. (VÖ: 24. Jänner) Dominik Oswald
Live: 30. Jänner, Wien, Flucc Deck



Die Band The New Mourning rund um den Produzenten und Songwriter Thomas Pronai hat ihr zweites Album in den Startlöchern stehen. Gefertigt im eigenen, fast ausschließlich analogen Studio. Von dort, aus den burgenländischen Ausläufern der Pannonischen Tiefebene, dringt – geboren in der trockenen Landschaft – organischer Indierock. »Songs of Confusion« präsentiert sich wuchtiger als sein Vorgänger. Pronais Sechssaiter-Bass bildet dabei eine Art wummerndes Fundament, auf dem zwei Gitarren Soundwände hochziehen, die nur durch das Stakkato des hämmernden Schlagzeugs perforiert werden. Sein Gesang schwebt als amorphe Erzählung, diffus wie Nebel, über dem Geschehen und lässt den – wie die Band es nennt – Drei-Gitarren-Zugang sein Gebäude errichten. Das kann mitunter recht rurale Züge annehmen, korreliert aber treffsicher mit den Texten und deren Absichten.
The New Mourning stellen die Sinnfrage. Den Weg dorthin säumen Zweifel, Unsicherheiten und andere Turbulenzen. Sie klingen roh. Hoffnung und Erlösung klingen hingegen zart, ganz wie man es sich vorstellt. Wer »Songs of Confusion« hört, nimmt ein Gitarrenbad der Gefühle, wo die Emotionen schon mal über den Rand schwappen können. Von Kitsch kann allerdings keine Rede sein. Man hört die Tiefe und das Dringliche.
Der Vektor zeigt nicht etwa ins Erdbeerland, wo Zielgruppenpop auf die Konsument*innen wartet. Er zeigt den möglichen Weg zu sich selbst. Ganz ohne Zeigefinger, aber mit dem Mut und der Wut der Verzweiflung. Und am Ende dieses Weges steht wohl im besten Fall das Ich jener, die diese Geschichten erzählen, und vielleicht auch jener, die sie hören. Denn die Existenz geht der Essenz voraus. The New Mourning begeben sich auf diesen Pfad und laden somit zur Weitwanderung. Man kann sich ihnen getrost anschließen.
(VÖ: 17. Jänner) Tobias Natter
Live: 16. Jänner, Wien, Radiokulturhaus — 18. Jänner, Wien, Rave Up Records — 7. März, Oslip, Cello — 13. März, Graz, Café Wolf — 14. März, Kirchdorf an der Krems, Bar-Café Hildegard

Mit »Torso« veröffentlicht Anja Plaschg ihr erstes Coveralbum. Darauf interpretiert sie Lieblingslieder neu, taucht diese in den Soap-&-Skin-Sound und hinterlässt sie frisch poliert in neuem Glanz. Die Musikerin hatte schon immer ein Talent dafür, Songs umzuinterpretieren und diesen ihren eigenen, einzigartigen Touch zu verleihen. Für sie ist das ein Versteck vor sich selbst, eine Flucht in eine andere Haut, in ein musikalisches Monument, das bereits gebaut wurde und das sie nun renovieren darf. Dabei werden die Covers auch Teil ihres eigenen musikalischen Repertoires. So zum Beispiel der Song »Voyage, Voyage« –ursprünglich von Desireless und nun auch auf »Torso« vertreten –, der sie schon länger auf ihren Tourneen begleitet.
»Mystery of Love«, der erste Song des Albums, stammt im Original von Sufjan Stevens und lässt uns gleich voll in die melancholische, teilweise düstere Soundlandschaft von Soap & Skin kippen. Die anderswo am Album meist so kräftigen und imposanten Blasinstrumente begleiten Plaschgs gefühlvolle Stimme hier ganz sanft und sorgen für einen sechsminütigen Trancezustand. Das gesamte Album ist von einer einnehmenden Atmosphäre geprägt, die die Zuhörer*innen mit in ihren schwermütigen Strudel zieht. Selbst David Bowies’ »Girl Loves Me« beugt sich einer gewissen Traurigkeit. Neben Bowie und Stevens sind noch weitere namenhafte Künstler*innen vertreten. Anja Plaschg singt Hans Zimmer, Shirley Bassey, Cat Power, The Velvet Underground und viele mehr. Die digitale Ausgabe beinhaltet auch ihre Version von Lana Del Reys »Gods & Monsters«. Die Auswahl der Interpret*innen scheut vor keinen Genregrenzen zurück. Stattdessen vereinen sich die unterschiedlichen Klangfarben und Musikrichtungen der zwölf Songs durch Plaschgs Stimme – und in musikalischer Begleitung durch ein Ensemble unter ihrer Leitung. »Torso« ist ein Album zum Weinen und zum Erinnern. Eine nostalgische Hommage an die Wehmut.
(VÖ: 22. November) Mira Schneidereit
Live: 10. Jänner, Graz, Orpheum — 11. Jänner, Salzburg, Szene — 17. Jänner, Wien, Konzerthaus — 5. September, Wien, Arena Open Air




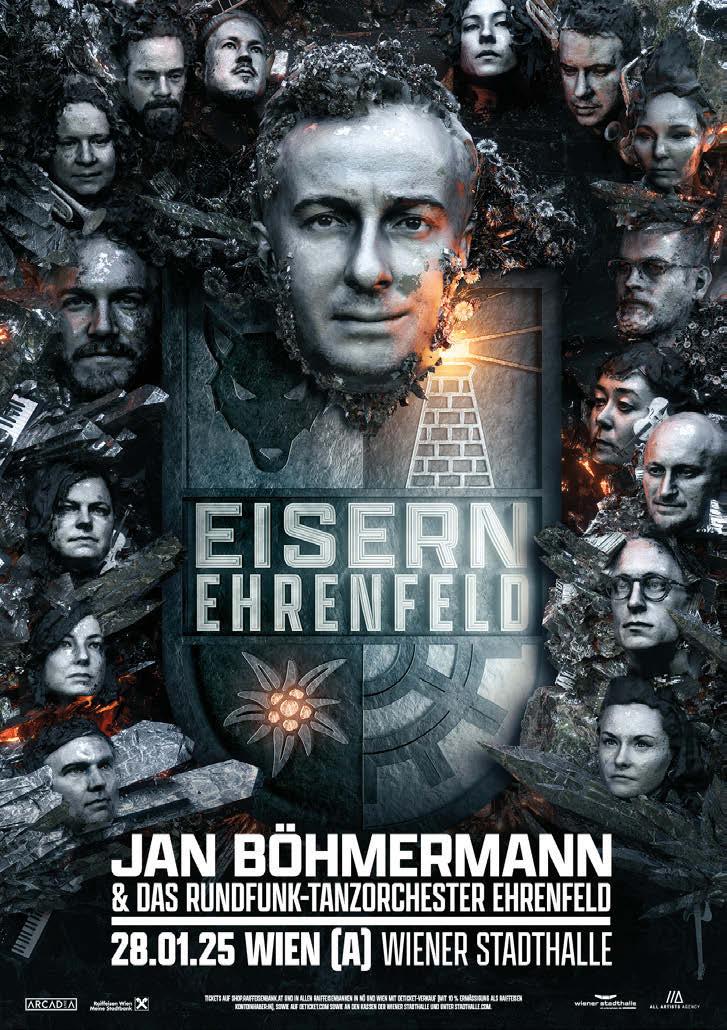



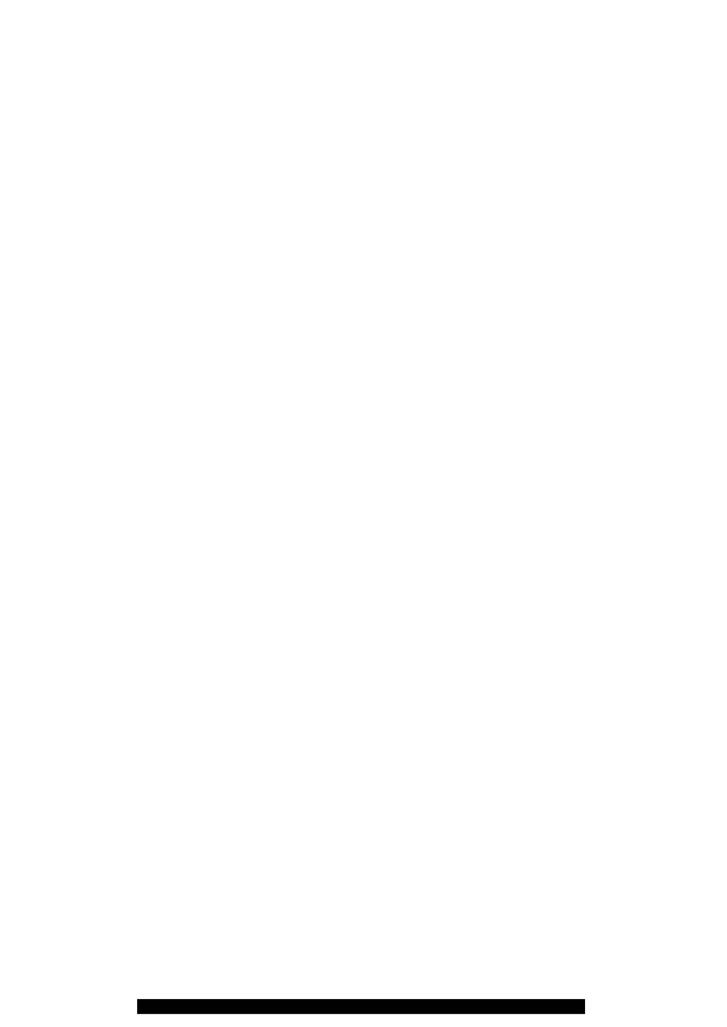













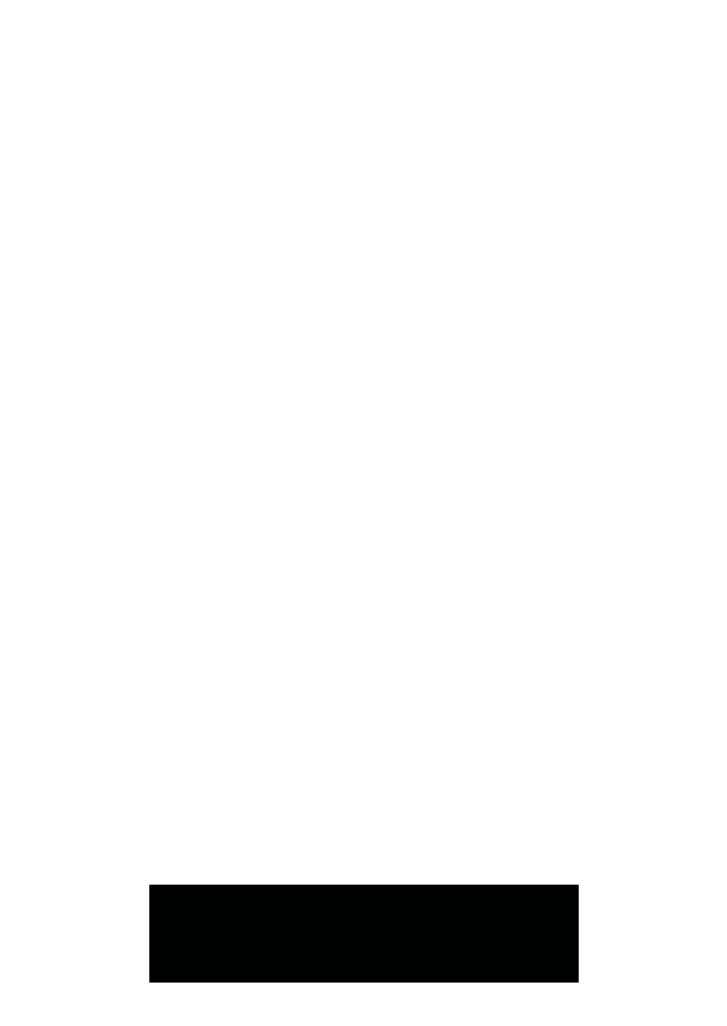







Du liest gerade, was hier steht. Ja, sogar das Kleingedruckte! Und damit bist du nicht allein. Werbung in The Gap erreicht ein interessiertes und sehr musikaffines Publikum. Und das Beste daran: Für Bands und Musiker*innen bieten wir besondere Konditionen. Absolut leistbar, auf all unseren Kanälen und nah dran an einer jungen, aktiven Zielgruppe. Melde dich, wir beraten dich gerne! sales@thegap.at

»Zazel Wants to Fly« heißt das neue Minialbum von Leonie Schlager aka The Zew. Ihre Stimme sowie ihr in diverse Effekte getauchtes Gitarrenspiel bilden dessen Kern und referenzieren auf traditionellen Folk sowie Outsider Music. Der dezent außerweltliche Sound wird von Daniela Czurda am Bass und Matthias Frey am Schlagzeug geerdet. Sehr schön! Das Konzert in Graz ist übrigens Teil des »20 Jahre Rock Is Hell«-Fests –also zwei gute Gründe hinzugehen. 21. Dezember Graz, PPC — 22. Jänner Wien, Radiokulturhaus



Sie schreibe den Pop der 80er in knallbunten Großbuchstaben in die graue Stadtlandschaft, heißt es in unserer Rezension von Ankathie Kois aktuellem Album »Pikant«. Dass sie die Songs dafür erstmals auf Deutsch verfasst hat, sorgt für umso mitreißendere Ergebnisse: »Tanz dich rein, tanz dich rein! Bis zum Morgen wird’s vielleicht viel leichter sein.« In diesem Sinne: Discolichter an! 18. Dezember Wien, Porgy & Bess — 17. Jänner Vöcklabruck, OKH — 18. Jänner Graz, PPC — 31. Jänner Saalfelden, Kunsthaus Nexus





Wenn eine Band so lange around ist wie Nada Surf – ihr Durch bruch gelang 1996 mit der Indie-(Anti-)Hymne »Popular« –, ist es alles andere als ausgemacht, dass noch immer Releases mit besonderer Strahlkraft anfallen. Ihr zehntes Album »Moon Mirror« ist ein solcher Release. In emotionaler wie musikalischer Hinsicht steckt da einiges an Leidenschaft drin. Gutes Vorzeichen für die anstehende Tour. 4. Dezember Wien, Arena

Neues Album, neues Flex-Konzert. Die Band um Dana Margolin hat sich – nach »Every Bad« (2020) und »Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky« (2022) – mit dem abermals großartigen »Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me« auf einen Zweijahresrhythmus eingependelt. Mit rapide steigender Wortanzahl in den Albumtiteln. Indierock, der sein geschundenes Herz auf der Zunge trägt. 12. Dezember Wien, Flex
»Wir feiern die Sünde, das verbotene Riff, den geheimen Akkord, die unheiligen Breaks und diabolischen Sounds.« Der Begleittext legt es nahe: Es wird nicht unbedingt zahm zugehen, wenn die Bands Lausch (Bild), Intra und Dogs Vs Gods beim It’s a Sin Fest diverse Spielarten des Alternative Rock hochleben lassen. Und genau so soll es ja auch sein! After-Show-Party mit DJ Rob Bobbinson. 13. Dezember Wien, B72
Den Abschluss ihrer Tour rund um das Erscheinen des Debütalbums »End of Circles« zelebrieren die vier Geschwister mit Familiennamen Wallner in ihrer Heimatstadt Wien. Und auch wenn wir auf den Release noch etwas warten müssen, wissen wir aus Erfahrung: Der verträumte Pop der Band kann dich tröstend in den Arm nehmen, Sehnsucht und Melancholie wecken und ist einfach schön. 28. Februar Wien, WUK
Wer den Nino mal im gediegenen Ambiente des Wiener Konzerthauses erleben will, hat dazu – nach dem gemeinsamen Auftritt mit Ernst Molden Ende November – im neuen Jahr wieder die Gelegenheit. Mit der Aus Wien Band im Rücken wird er dabei sein aktuelles Album »Endlich Wienerlieder«, das seinem Großvater, dem Wienerliedsänger Rudolf Mandl, gewidmet ist, ins Zentrum des Konzertabends rücken. 1. März Wien, Konzerthaus
We Come to Make You Dance and to Blow Your Mind« – ein gutes Motto, das sich die »Wut-Wave-Sensation« Gewalt für ihre Tour ausgesucht hat. Mit dem neuen Album »Doppeldenk« setzen sie dabei abermals auf Musik als Mittel des Widerstands: »Ich sehe die Welt schwarz schwarz.«
5. Dezember Wien, Arena
Mit dem Schlagwort »Merseybeach« verorten die Lemon Twigs ihr neues Album irgendwo zwischen Mersey Beat (vereinfacht gesagt: den frühen Beatles) und den Beach Boys. Glam und Theatralik – beides durchaus typisch für die Band – haben sie auf Tour sicher auch mit im Gepäck.
14. Dezember Wien, Flucc Wanne
Solo bewegt sich der isländische Komponist und Multiinstrumentalist Ólafur Arnalds mit seiner Musik zwischen Neoklassik, Ambient und Elektronik. Als Teil des Duos Kiasmos zaubert er mit seinem von den Färöerinseln stammenden Kollegen Janus Rasmussen Minimal Techno aus den Geräten. 19. Februar Wien, Konzerthaus

Leitung Programmteam
This Human World
Welche Schwerpunkte setzt ihr als Leiter*innen des Festivals This Human World?
Unsere Schwerpunkte liegen generell in der Sichtbarmachung komplexer gesellschaftlicher und politischer Themen, die durch filmische Narration neue oder vielschichtigere Perspektiven eröffnen. Als Festival möchten wir eine Plattform bieten, die nicht nur informiert, sondern tatsächlich zum Reflektieren anregt. In diesem Jahr thematisieren die Schwerpunkte aktuelle globale Krisen, soziale Gerechtigkeit und die Herausforderungen im Umgang mit gesellschaftlicher Diversität.
Inwiefern funktioniert Film für euch als Medium und Plattform für Menschenrechte?
Film ist ein einzigartiges Medium, um komplexe Themen auf emotionaler und visueller Ebene zu vermitteln. Im Gegensatz zur rein faktischen Berichterstattung öffnet Film Türen zu persönlichen Geschichten und Narrativen, die oft jenseits der öffentlichen Diskussion existieren. Die audiovisuelle Sprache des Films hat die Fähigkeit, Empathie zu wecken und tieferen Einblick in soziale und politische Realitäten der dargestellten Themen zu ermöglichen. In einer Zeit, in der die Aufmerksamkeit der Menschen oft durch schnelllebige Informationen fragmentiert wird, ist Film ein Mittel, um innezuhalten, zuzuhören und neue Perspektiven zu verstehen. Festivals schaffen den Rahmen, in dem diese Filme nicht nur konsumiert, sondern auch im Kontext diskutiert und reflektiert werden können.
Was sollen eure Besucher*innen – etwa in Bezug auf Menschenrechte – vom Festival mitnehmen? Wir möchten, dass sie mit einem erweiterten Verständnis für die Vielschichtigkeit von Menschen, Menschenrechten und den Herausforderungen der heutigen Zeit nach Hause gehen. Unser Ziel ist es, Empathie zu fördern und Dialoge zu öffnen. Außerdem wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Menschenrechte etwas Universelles sind, das wir alle gleichermaßen einfordern und verteidigen müssen. Besonders in Zeiten, in denen sich extremistische Ränder in der Mitte der Gesellschaft ausbreiten.
This Human World 27. November bis 10. Dezember Wien, diverse Kinos

Passend zur Jahreszeit hat sich das Winterfest eine Location mit ordentlich Winterflair ausgesucht. Im Salzburger Volksgarten – zwischen bunten Weihnachtslichtern und hoffentlich der einen oder anderen vom Himmel herabrieselnden Schneeflocke – kann hier Neues aus der Welt des zeitgenössischen Zirkus entdeckt werden. Akrobatik, darstellende Kunst, Musik, Poesie und jede Menge Humor laden zum Bestaunen der vielseitigen Artists und ihrer Kunstform ein. Die handverlesenen Compagnien verbreiten dabei Freude und Magie. Das jährliche Rendezvous mit dem Zirkus verwandelt sich so in ein winterliches Varieté. 27. November bis 6. Jänner Salzburg, Volksgarten

Advent, Advent, mit ganz viel Talent! Zwar verbergen sich hinter den 24 Türchen des musikalischen Adventskalenders keine Mandarinen oder Kekse, dafür aber über 120 Künstler*innen. Beispielsweise Edna Million (Bild), die mit ihrer tiefen Stimme ihrem Türchen eine wohlige Dunkelheit verleiht und die kalten Temperaturen vergessen lässt. Der Schmusechor wiederum versüßt die Weihnachtszeit, indem er Acts wie David Bowie oder Billie Eilish covert. Gemeinsam schmücken diese und weitere Künstler*innen alle Wiener Bezirke mit vielfältigen Performances. 1. bis 24. Dezember Wien, diverse Locations

Tief unten im imposanten Kellergewölbe der Kasematten passiert bei der heurigen Wortwiege genau das, was ihr Name verspricht: Es entspringen und entwickeln sich Wort, Diskurs und Theater in allen Formen. Die »strahlende Finsternis« des alten Wehrbaus wird zur Bühne für dramatisches Storytelling – von der Antike bis zur Gegenwart. In den alten Gemäuern findet das Festival zurück zur mystischen Wiege des Theaters und richtet seinen Blick zeitgleich auf Zeitgenössisches und Zukunftsvisionen. Ganz nach dem Motto: »Back to the roots, forward to the future!« 26. Februar bis 30. März Wiener Neustadt, Kasematten
Als Gegenprogramm zu den unfreundlichen Temperaturen kalter Herbst- und Wintertage bietet die Reihe Pornights 15 knisternde Filmabende in zwei Wiener Kultkinos. Von Straight, Gay und Female Pleasure über BDSM bis hin zu Hentai-Pornos wird so einiges geboten, um die frostigen Abende aufzuheizen. Dabei lassen sich aus dem Kinosessel heraus unterschiedliche Themen wie Sexualität, Politik und Gender durch eine pornografische Linse betrachten. bis 21. März Wien, Fortuna Kino und Schikaneder
Wer seine Weihnachtsmarktbesuche ab jetzt musikalischer gestalten möchte, sollte sich schleunigst auf den Weg zu Musik ab Hof machen und sodann die Ohrenwärmer abnehmen. Dort wartet nämlich eine weihnachtliche Reise in die Welt von 30 Indie-Labels aus ganz Österreich. Tonträger aus unterschiedlichsten Genres von Jazz über Indie bis Hip-Hop, aber auch Liveauftritte und Treffen mit Artists werden am Marktstand der VTMÖ geboten. bis 23. Dezember Wien, Weihnachtsmarkt Spittelberg
Geschüttelt, nicht gerührt! Ob Roboter das wohl genauso gut verstehen wie menschliche Barkeeper*innen? Damit und mit vielem mehr rund um das Thema Cocktailrobotik beschäftigen sich Künstler*innen, Techniker*innen und Bastler*innen bereits seit 25 Jahren im Rahmen der Roboexotica. Dort geht es allerdings nicht nur um Mai Tai, Daiquiri und Co, sondern auch um die Mit- und Neugestaltung moderner Cocktailkultur. 12. bis 15. Dezember Wien, Kunsttankstelle Ottakring
Auch heuer huldigt Slash X-Mas wohl mehr dem furchterregenden Krampus als dem heiligen Nikolaus. Neben der Möglichkeit, sich mit Punsch und Keksen den Bauch zu füllen, bietet das Filmfestival im Dezember nämlich wieder einen Abend voller Weihnachtshorror. Einerseits mit der Österreichpremiere von »Heretic« und andererseits mit »Black Christmas«, dem Weihnachtsslasher schlechthin, für ordentlich 70er-Jahre-Nostalgie. 19. Dezember Wien, Filmcasino
Die Kolleg*innen im Layout werden ihren schönen Spaß mit diesem Titel haben. I’m sorry! Beim Hinüberkopieren ins Word ist vermutlich eh schon ein guter Teil verloren gegangen. Mindestens die Hälfte davon, was Hannah und Lea Neckel machen, ist nicht von dieser Welt –oder nur insofern, wie etwa Videospiele von dieser Welt sind. Der Rest ist übertrieben viel Plastik und Rosa. Ausgangspunkt dieser unaussprechlichen Ausstellung ist der »Herzerlteich« im Schlosspark, ein offensichtlich künstlich angelegter Teich, der von den utopischen Fantasien vergangener Tage erzählt. Nicht völlig vergangen! Denn noch immer liegt im Zusammenspiel von Natur und Technik etwas Paradiesisch-Fortschrittliches. bis 26. Jänner
Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland




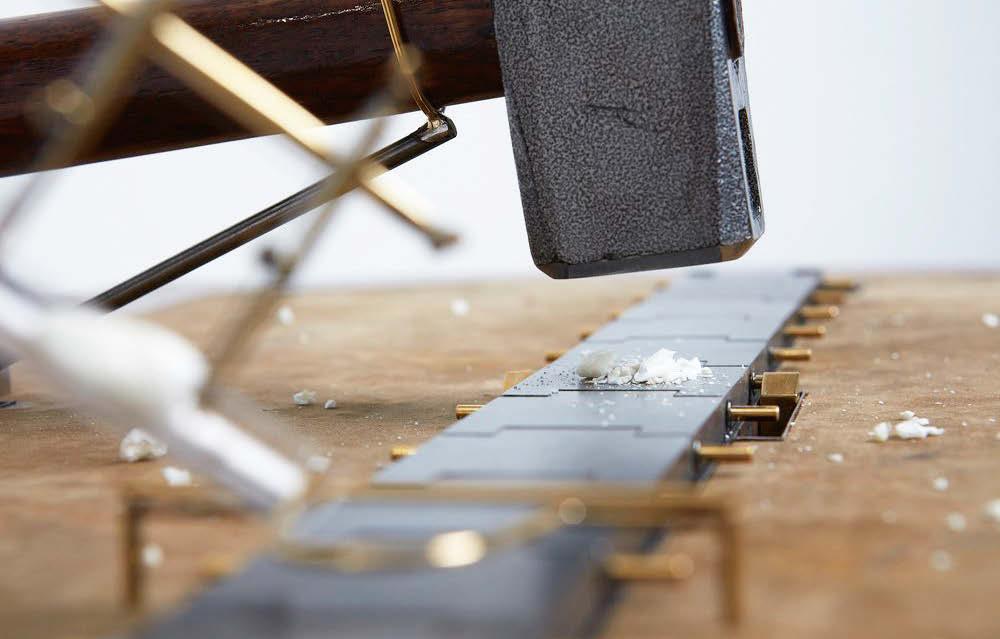


Es ist bemerkenswert, dass der Pressetext Georgien vor allem durch seine Nachbarländer charakterisiert. Die Sowjetunion wirft ihre Schatten nicht nur in Form von Besatzungstruppen, ukrainischen Geflüchteten und russischen Emigrierten. Auch in historischen Bauwerken bildet sich die Identität der postsowjetischen und postkolonialen georgischen Gesellschaft ab. Die drei Künstlerinnen Salome Dumbadze, Ana Gzirishvili und Nina Kintsurashvili nehmen eine Kirche als Startpunkt für eine Auseinandersetzung mit dem (geschlechtsspezifischen) Kulturerbe des Kaukasus. bis 10. Januar Klagenfurt, Kunstraum Lakeside
Eine erste Ahnung dieser Ausstellung vermittelt ein Text von Sophia Eisenhut, der auf sein eigenes Entstehen eingeht und damit ein Selbst-Bewusstsein vorführt, dem sich seit Beginn der Moderne niemand mehr entziehen kann. Der Text lässt erahnen, dass auch die Bilder von Dario Wokurka – und wenn nicht sie selbst, so doch unser Blick auf sie – von diesem Umgang mit dem Selbst geprägt sind. Vielleicht lässt sich sagen: Keine Ausstellung »über X«, sondern darüber, »als über X zu sein, gelesen zu werden«. bis 31. Dezember Wien, Lombardi-Kargl
Der individuelle Klang verschiedener Orte geht weit über deren unterschiedliche Sprachen hinaus. Die jeweilige Stadt und Natur vibrieren, resonieren und gestalten die Klanglandschaft mit. Dass Klang etwas zutiefst Körperlich-Mechanisches ist, kann man den Anordnungen aus Keramik, Glas, Holz, Wasser, Papier, Metall, Plastik usw. ansehen, die über drei Geschosse hinweg verschiedene Hörerlebnisse erfahrbar machen – von Städten wie Porto über Ereignisse wie Regenfall bis hin zur Lebenswelt von Gehörlosen. bis 12. Jänner Bregenz, Kunsthaus
Der Pressetext zu dieser Ausstellung von Céline Struger und Luca Sabot gibt sich gerade in jenem Maße kryptisch, das die Erwartungen an eine interessante Erfahrung erst recht schürt. Von den Maschinen Luca Sabots heißt es dort, in ihnen seien zurückgehaltene Emotionen verarbeitet. Diese Externalisierung ermögliche dem Publikum die äußerliche Berührung einer inneren Unruhe. Dem zur Seite steht Céline Struger, deren ritueller Zugang sich mit Phänomenen der Unterdrückung und Freisetzung beschäftigt. bis 21. Jänner Wien, Discotec
Mit dem Konzept des Liebesbriefs wurde ich schon sehr früh bekannt gemacht. Etwa zur gleichen Zeit wahrscheinlich, wie mit jenem des Küssens. Was natürlich nicht bedeutet, gleichzeitig mit dem theoretischen Verständnis auch in die Praxis eingestiegen zu sein. Aber ich erinnere mich, dass damals schon der Liebesbrief allein, unabhängig vom Inhalt, fast die ganze Botschaft war. Drei Künstler*innen versuchen nun das Gefühl des Liebesbrief-Bekommens, in eine »kollektive Erfahrung« zu verwandeln. bis 26. Jänner Eisenstadt, Kunstverein
Meistens kommt es zu einem exzessiven Einsatz von Requisiten, Flüssigkeiten, Kostümen und Bühneneffekten, wenn Leon Höllhumer eine Bühne oder einen Ausstellungsraum bespielt. Da passiert dann eine Menge Zerstörung oder Neuschöpfung. Je nachdem. Kombiniert mit expressiven Gesten wirkt das alles sehr barock – aber auch sehr punk. Da gibt es ja einige Überschneidungen. »The Feast« verspricht unter anderem, (nicht-menschliches) Trauern und »Technochauvinismus« grenzüberschreitend zusammenzubringen. bis 23. Februar Graz, Halle für Kunst

Was war zuerst da, der Titel eures neuen Films oder dessen Farbgestaltung?
Milena Czernovsky: Der Titel beschreibt für uns ein Dazwischen und die Stimmung des Films. Er hat schon etwas mit »feeling blue« zu tun, aber nicht nur. Dabei ist uns der Titel relativ spät eingefallen, erst im Schnitt merkten wir nämlich, dass die Farbe Blau unseren Film sehr dominiert. Das war eigentlich nicht geplant. Dann begannen wir, über die Farbe zu reden, auch weil Lilith damals das Buch »Bluets« von Maggie Nelson las und mir davon erzählte. Mir fiel der Titel dann im Traum ein – und wir wussten, dass wir den Film »Bluish« nennen wollen.
Ein prägendes Element für den Film ist Wasser. Welche Bedeutung hat dieses für euch?
Lilith Kraxner: Wir wollten ein gewisses Gefühl von Körperlichkeit in unserem Film transportieren und das Bedürfnis danach, sich zu spüren. Wasser sowie Wasser auf der Haut und auf verschiedenen Oberflächen schien uns dafür passend. Wir wussten auch von Anfang an, dass der Film im Winter spielen soll. In diesen vielen Kleidungsschichten, die man in dieser Jahreszeit trägt, ist man so unbeweglich – und dazu kommt dann der Kontrast, im Wasser zu liegen und sich treiben zu lassen. Das fanden wir interessant, daher spielt Wasser eine tragende Rolle.
Was ist euch bei eurer gemeinsamen Arbeit wichtig – bei den kreativen Entscheidungen aber auch beim Umgang mit der Crew am Set?
Czernovsky: Unsere Freund*innenschaften sind uns wichtig. Wir arbeiten in einem sehr kleinen Team und schätzen und unterstützen uns gegenseitig. Alle sollen sich so sicher wie möglich fühlen. Essen ist uns auch sehr wichtig. Wir essen immer zusammen und besprechen, was noch so anfällt. Ich finde, wenn man gut gegessen hat, ist man zufriedener und das Arbeiten funktioniert viel besser.
Kraxner: Außerdem versuchen wir, die Drehzeiten moderat zu halten und keine Zwölf- sondern nur Zehn-Stunden-Drehtage zu planen.
»Bluish« Start: 17. Jänner 2025

Regie: Nora Fingscheidt Basierend auf den Memoiren der Journalistin und Autorin Amy Liptrot erzählt »The Outrun« von Rona (Saoirse Ronan), die nach einem Entzug wieder zur Farm ihrer Familie zurückkehrt. Sie war zehn Jahre nicht auf der verschlafenen Insel, wo ihr Vater Schafe züchtet. Stattdessen erund überlebte sie eine rauschhafte Zeit in London – bis sie in eine Entzugsklinik kam. Ihr Besuch auf den abgeschiedenen Orkneyinseln ist gleichzeitig Flucht und Versuch einer Neuorientierung. Saoirse Ronan spielt – nach Rollen in Filmen wie »Ladybird« und »Little Women« – abermals eine junge Frau auf der Suche nach ihrem Weg. Und Regisseurin Nora Fingscheidt erzählt ein scheinbar bekanntes Suchtnarrativ fernab jedes Selbstfindungsklischees mit überraschender Energie und eindrucksvoller Sogwirkung. Start: 5. Dezember

Regie: Elsa Kremser und Levin Peter »Was bedeutet es, wenn sich Hund und Mensch so sehr annähern, dass ein Leben ohne einander unmöglich scheint?«, fragt das Regiestatement von Elsa Kremser und Levin Peter. Mit »Dreaming Dogs« realisiert das kreative Duo quasi die Fortführung seines vorigen Projekts »Space Dogs«. Während dort der Alltag zweier Straßenhunde – aus deren Perspektive – zu sehen war, fokussieren die beiden in ihrem neuen Film ein Rudel von Streuner*innen: sieben Hunde und eine Frau, die in Moskau leben. Deren Alltag zeigen sie abermals aus dem Blickwinkel der Tiere. Die Gruppe lebt am Rande der Stadt – und am Rande der Gesellschaft. Für Kremser und Peter spiegelt sich in der Hund-Mensch-Beziehung unsere Angst wider, verlassen und verstoßen zu werden. Start: 13. Dezember
Regie: Jacques Audiard ———— Anwältin Rita Moro Castro (Zoë Saldaña) erhält ein ungewöhnliches Angebot: Kartellboss Manitas Del Monte (Karla Sofía Gascón) will sich aus dem Geschäft zurückziehen – und als Frau leben. Rita soll dabei helfen. Jacques Audiard inszeniert den dramatischen Plot als queere Musical-Extravaganza, wie man sie in dieser Form noch selten gesehen hat. Start: 28. November
Regie: Quentin Dupieux ———— Den Liebesproblemen junger, urbaner Menschen kann man in »Le deuxième acte« zusehen: Florence (Léa Seydoux) will ihren Freund David (Louis Garrel) ihrem Vater Guillaume (Vincent Lindon) vorstellen. Doch David hat andere Pläne und will Florence mit seinem Freund Willy (Raphaël Quenard) verkuppeln. Wer nun zu wissen glaubt, was hier zu erwarten ist, hat die Rechnung ohne Metaebene(n) gemacht. Lustig! Start: 6. Dezember
Regie: Friedrich Moser ———— Fake News und Propaganda haben (soziale) Medien sowie Politik in den letzten Jahren dominiert und zum Aufstieg rechtsextremer Parteien beigetragen. Die Doku »How to Build a Truth Engine« geht der Frage nach, wie Big Data und KI dagegen helfen könnten. Diverse Forscher*innen und Journalist*innen zeigen Perspektiven und Möglichkeiten auf, der Wahrheit wieder mediale Luft zu verschaffen. Start: 12. Dezember
Regie: Alexander Horwath ———— Die Geschichte der USA erzählt Alexander Horwarth anhand der Geschichte des berühmten Schauspielers Henry Fonda (Jane Fondas Vater), der mit Filmen wie »Spiel mir das Lied vom Tod« oder »Die zwölf Geschworenen« Berühmtheit erlangte. Dabei kommt Fonda quasi selbst zu Wort, indem wir die Stimme seines letzten Interviews aus dem Jahr 1981 hören. Start: 10. Jänner
Regie: Jesse Eisenberg ———— Jesse Eisenberg ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor und Regisseur. In »A Real Pain« lässt er zwei Cousins (Kieran Culkin und Jesse Eisenberg) nach Polen reisen – auf den Spuren ihrer verstorbenen Großmutter, einer Holocaustüberlebenden. Eisenberg verhandelt im Film auch autobiografische Inhalte. Gedreht wurde unter anderem in einem tatsächlichen Konzentrationslager. Start: 16. Jänner

Idee: Tim Miller Fans von Videospielen macht Amazon Prime eine vorweihnachtliche Freude: In »Secret Level« werden 15 Videospiele als Anthologie aufbereitet – u. a. »God of War« und »Pac-Man«. Bekannte Schauspieler*innen wie Arnold Schwarzenegger oder Keanu Reeves leihen den legendären Figuren dabei ihre Stimme. Hinter dem Projekt steht dasselbe Kreativteam, das schon für die Netflix-Serie »Love, Death & Robots« verantwortlich zeichnete. ab 10. Dezember Amazon Prime

Idee: Dan Erickson Drei Jahre hat’s gedauert, doch nun kehrt der Sci-Fi-Hit »Severance« mit der zweiten Staffel zurück. Beeinflusst unter anderem von »The Truman Show«, »Being John Malkovich« und »Eternal Sunshine of the Spotless Mind« erzählt diese Dystopie von einer vermeintlich perfekten Work-Life-Balance. Die Erinnerungen der Mitarbeiter*innen von Lumon Industries werden nämlich durch einen chirurgischen Eingriff in Arbeits- und Privatleben getrennt. ab 17. Jänner Apple TV+


bewegen bewegte Bilder – in diesem Kompendium zum gleichnamigen Podcast schreibt er drüber
Holy smokes und na servas, das hatte ich mir wirklich anders ausgemalt. Im großen Ganzen wie im konkreten Kleinen. Aber selbst schuld –da braucht man auch kein Mitleid zu erwarten, wenn man als Autor dieser auf Kurzweil angelegten Leinwand-und-Flimmerkasten-Kolumne ausgerechnet den Tag nach der US-Wahl für die Niederschrift auswählt. Und jetzt, nach dem zwar irgendwie befürchteten, darob aber nicht minder niederschmetternden Ausgang, ist die Stimmung so tief in den Minusbereich gerutscht, dass mir beim Tippen fast die Finger abfrieren. »We tell each other lies to hide the truth / And we hate ourselves for everything we do«, sinniert passend dazu der weltmüde Robert Smith in The Cures frischem Klagelied »Warsong« – leider eine pointierte Bestandsaufnahme des Zustands der Gegenwart. Kann man in einer solchen Katerstimmung, die doch eigentlich nach Rückzug ins Bett schreit, überhaupt noch den Kopf frei genug haben, um Überlegungen zu vermeintlich trivialen, fiktiven Bewegtbildereignissen anzustellen? Man kann es nicht nur, man muss es sogar. Denn Filme sind bekanntlich – fünf Euro ins Phrasenschwein! – immer Fenster zur Welt. Und, ja, zugleich ihr Spiegel.
Bauhaus baut Haus
Also erst einmal tief durchatmen – und sich dann ausgiebig einem Film zuwenden, der in vielerlei Hinsicht mit gegenwärtigen politischen Entwicklungen resoniert: »The Brutalist«, ein bereits bei der Viennale und davor in Venedig gefeiertes Epos, das Ende Januar in den Lichtspielhäusern des Landes landen wird. Die dritte Regiearbeit des früheren Schauspielers Brady Corbet entfaltet über mehrere Jahrzehnte die bewegte Geschichte des ungarisch-jüdischen Architekten László Tóth. Kurioserweise nach »Megalopolis« bereits die zweite Kolumne in Folge, die sich brillanten Baumeistern widmet.
Der Bauhaus-Schüler Tóth (von Adrien Brody in einer kraftvollen Karrierebestleistung interpretiert) schlägt anno 1947 in der Neuen Welt auf. Gezeichnet von Krieg und Konzentrationslager steht er vor den Trümmern seiner

In »The Brutalist« baut László Thót (Adrien Brody) in epischen 215 Minuten ein Haus.
Existenz: Seine Frau und seine Nichte sind an der österreichischen Grenze gestrandet, während er selbst zunächst in einer Abstellkammer seines Cousins haust und sich zeitweise als Kohlenschaufler durchschlagen muss. Das Blatt scheint sich zu wenden, als ihm ein betuchter Industrieller einen ebenso hochdotierten wie prestigeträchtigen Auftrag erteilt: Tóth soll ihm einen futuristischen Prachtbau – Gemeindezentrum, Kirche, Bibliothek und Sporthalle in einem – entwerfen, mitten im ländlichen Pennsylvania. Der Perfektionist stürzt sich wie besessen in das irre Unterfangen, das ihm neben der Rückkehr zur Architektur auch die Zusammenführung mit seiner Familie ermöglicht. Doch der Preis ist hoch: Unter dem wachsenden Druck des erratischen, exzentrischen Mäzens steigert sich Tóths detailversessener Ehrgeiz zu einer existenziellen Krise, die ihn an den Rand des Wahnsinns treibt.
Das Drehbuch hat Corbet gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Filmemacherin Mona Fastvold, entwickelt – deren fulminante letzte Regiearbeit »The World to Come« sei hiermit noch einmal wärmstens empfohlen. »The Brutalist« zielt in seiner Konzeption auf eine breite Auseinandersetzung mit den Verheißungen und Verwerfungen des amerikanischen Traums aus der Perspektive von Immigrant*innen. Inwieweit formen Einwander*innen (hier speziell: der Nachkriegszeit) die USA nach ihren Vorstellungen – und wie prägt das Land sie im Gegenzug? Welche Opfer müssen sie für die in Aussicht gestellte Möglichkeit zur Selbstverwirklichung bringen? Ist ihnen die Toleranz des brutal durchkapitalisierten Systems nur so lange sicher, wie sie einen möglichst substanziellen Beitrag zum Gemeinwohl leisten? Wie steht es um dieses Gemeinwohl, wenn es vermehrt um die Begehrlichkeiten Superreicher organisiert wird? Wer kann und darf diesen Traum mitgestalten? Wer vermag ihn zu leben – und wie? Nein, László Tóth hat es genauso wenig gegeben wie Lydia Tár aus »Tár«. Aber denkt man
diese Überlegungen konsequent weiter, kommt man unweigerlich an die Bruchstelle zwischen dieser fiktionalen Welt und der Realität der gesellschaftlichen Gegenwart. Deren zunehmend beklemmende Intersektion von Macht, Ausbeutung und autoritärer Kontrolle wird von Milliardär*innen und ihren populistischen Politlautsprechern nicht nur konserviert, sondern mit meisterhafter Manipulationskunst immer ausgeklügelter ausgestaltet. Filme, Spiegel, Welt.
Bei aller Auseinandersetzung mit diesen und anderen konkreten Themen (Kunst und Kompromiss, Integrität und Identität) strahlt »The Brutalist« freilich auch eine einnehmende Rätselhaftigkeit aus. Wie sein Protagonist bleibt der dreieinhalbstündige Film in seiner Gesamtheit kaum je wirklich entschlüsselbar – was ihn ebenso in eine Ahnenreihe mit Aufstiegsepen wie »Es war einmal in Amerika« oder »There Will Be Blood« stellt wie seine bildgewaltige Vision. Apropos: atemraubend, dass diese vollends ausformulierte Welt angeblich mit lediglich sechs Millionen Dollar realisiert wurde – etwa einem Dreißigstel der Mittel des leb- und lieblose Incel-Trips »Joker: Folie à Deux« und seiner in drei Räumen präsentierten Banalerzählung. Am Ende dieses enigmatischen, ergreifenden Epos bleibt man unweigerlich mit offenem Mund zurück. Hier hat sich tatsächlich eines jener Werke von bestechender Erzähl- und Inszenierungskunst gefunden, die dem Prädikat »they don’t make them like this anymore« mühelos gerecht werden. Möge die Kühnheit dieses mit allen ehrlichen Schrammen versehenen Monuments für die paradoxe Natur des amerikanischen Traums weit über die beklemmende Zeit seiner Veröffentlichung hinaus leuchten. Bis dahin: tief durchatmen!
prenner@thegap.at • @prennero
Christoph Prenner plaudert mit Lillian Moschen im Podcast »Screen Lights« zweimal monatlich über das aktuelle Film- und Seriengeschehen.


Unsere Korrespondentin, Elisabeth Postl, berichtet direkt aus den USA. Die außenpolitische Redaktion analysiert mit geballter Expertise, welchen Einfluss die Wahl auf Österreich und die Welt hat.

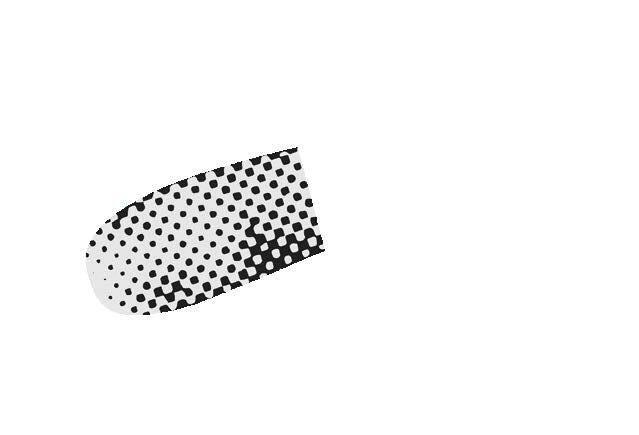
Über den Blattrand hinaus – Internationale Perspektiven
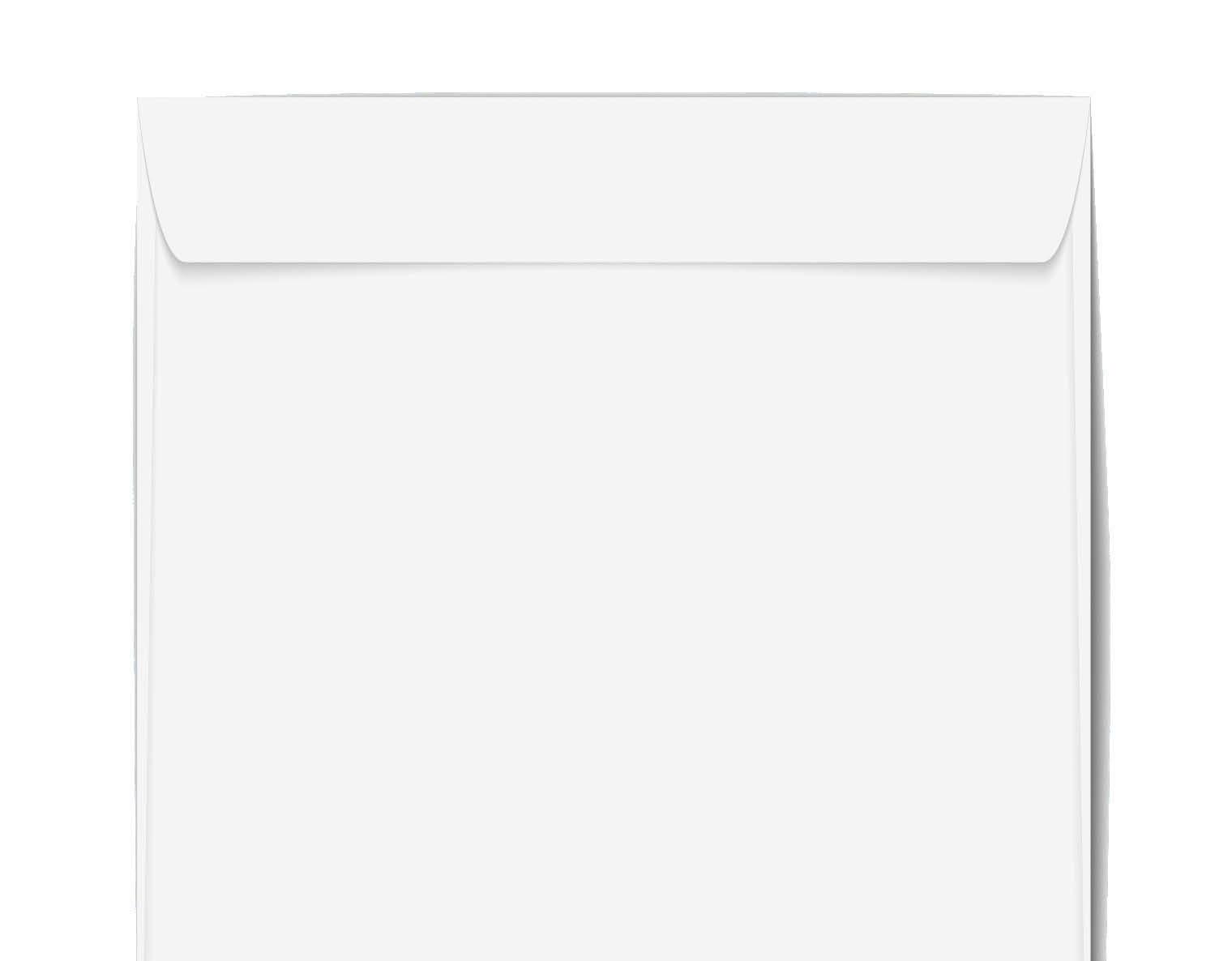
Freitag, Samstag und Sonntag die gedruckte Zeitung
Täglich digital alle Inhalte lesen
Podcast und Videoberichte
12 Monate lesen – nur 8 Monate zahlen
6,90 €
STATT 10,50 € pro Woche
Jetzt bestellen: diepresse.com/wahlabo

Felix Hafner erhielt 2017 den Nestroy-Theaterpreis als bester männlicher Nachwuchs für seine Inszenierung von »Der Menschenfeind« am Wiener Volkstheater. Nun widmet er sich in Linz gemeinsam mit dem Phönix-Ensemble sowie zwei Schlagzeugern der allgegenwärtigen Beschleunigung und kritisiert eine kapitalistische Gesellschaft, in der Zeit Geld ist. Daraus entsteht ein musikalisch-theatraler Abend voll Rhythmus, Drive und vor allem: Tempo. Die Zeit rast, angetrieben von Schlagzeug und tickenden Uhren. Während einige wenige weiter auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten sind, müssen alle anderen die Konsequenzen des zunehmenden Drucks ausbaden und gefühlte Ewigkeiten warten, bis sie dran sind. 5. bis 31. Dezember Linz, Theater Phönix

In Zeiten, in denen Sätze wie »your body, my choice« im Internet und auf Pausenhöfen kursieren und vielerorts versucht wird, Frauenrechte – insbesondere, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht – einzuschränken, könnte ein Stück wie »Voll lieab« wohl kaum aktueller sein. Aus anonymisierten Interviews zu persönlichen Abtreibungserfahrungen verschiedener Menschen ist eine Performance entstanden, die alles rund um das Thema Schwangerschaftsabbrüche abdeckt: Stigma, Kosten, Politik, … Das Stück berichtet von Erlebtem, vom Istzustand in Österreich, gibt einen Ausblick auf Best- und Worst-Case-Szenarien und verspricht einen Theaterabend für Rechte und Souveränität gebärfähiger Menschen. 19. Dezember bis 18. Jänner Graz, Theater am Lend
Mit »Wir haben versagt« liefern Martin Gruber und das Aktionstheater Ensemble eine beklemmende, kluge und musikalisch eindringliche Selbstanklage, die den ultimativen Rechtsruck mit schmerzhafter Ehrlichkeit analysiert. Auf die Frage, wie es so weit kommen konnte, findet sich trotzdem keine Antwort. Zwischen poetischer Verdichtung und der Annäherung an das zeitgenössische dokumentarische Theater entfaltet sich eine Collage aus Selbstzweifel, Wut und Resignation – konterkariert von guter Musik, die die Tragödie erträglicher macht. 3. bis 7. Dezember Dornbirn, Spielboden — 12. bis 19. Jänner Wien, Theater am Werk
In Koproduktion mit dem Slowakischen Nationaltheater verwebt »Am Fluss« Lebenswege aus fünf Jahrzehnten mit dem Medium Wasser und verbindet Geschichte und Gegenwart entlang des Hudson River. Wie Nebenarme eines Gewässers fließen die Schicksale der Figuren vor dem Hintergrund des Faschismus in Europa, dessen Folgen und der Aids-Krise zusammen. Sie alle sind Opfer von Gewalt, doch hier führen sie ein zartes, vielstimmiges Gespräch miteinander – ohne sich zu kennen. 4. bis 14. Dezember und 26. Februar bis 1. März Wien, Schauspielhaus
In »Ava« setzt sich Karin Pauer mit den Verflechtungen zwischen Mensch und Ozean im Anthropozän auseinander und nimmt das Publikum mit in einen Raum, in dem die Grenzen von Land und Wasser verschwimmen. Narrative der Übersäuerung und Verschmutzung, die Mensch und Ozean gleichermaßen verändern, werden erforscht und die Zerbrechlichkeit globaler Gewässer sowie ihre Verbindung zum eigenen Körper erfahrbar gemacht. Das Stück ruft poetisch dazu auf, unsere Beziehung zur Umwelt zu überdenken und zu transformieren. 11. bis 14. Dezember Wien, Brut Nordwest
Mit Humor, Charme und einer Prise Bowie bringt Tamara Stern Lilith, die erste Frau Adams, auf die Bühne. Sie erzählt gewitzt und pointiert von deren Widerstand gegen patriarchale Strukturen, ihrem Verschwinden aus der Mythologie und ihrer Rückkehr als feministische Ikone. Untermalt von David-Bowie-Songs entsteht ein energiegeladener Abend, der das Frauwerden unter schwierigen Bedingungen beleuchtet und dabei zum Lachen, Nachdenken und Staunen einlädt. 17. bis 31. Jänner Wien, Off Theater





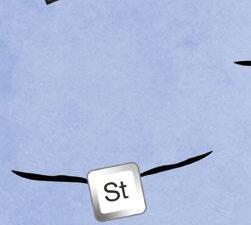
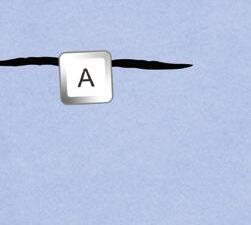






















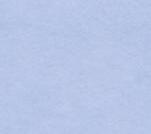
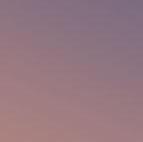











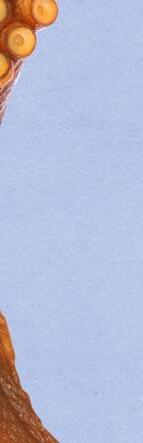
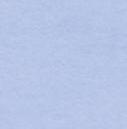


















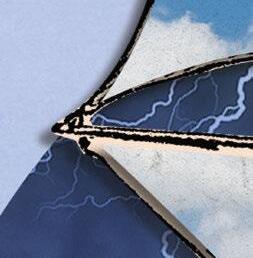














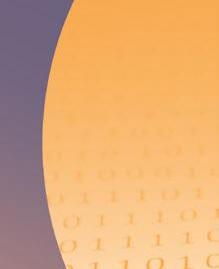





































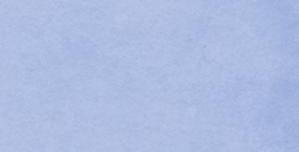



























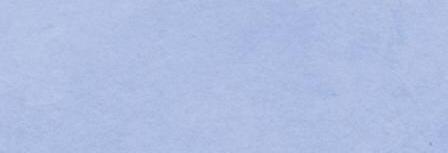










Eine Haltungsübung für stürmische Zeiten: Nach vorne schauen. Und zwar so oft es geht. Dann spüren Sie nämlich nicht nur den Gegenwind, sondern sehen vielleicht auch die Chancen und Möglichkeiten, die auf Sie zukommen.
derStandard.at
Der Haltung gewidmet.
Gewidmet all denjenigen, die beim Lesen auf die eine oder andere Wissenslücke gestoßen sind.
»Brat« heißt das 2024 erschienene, sechste Studioalbum der britischen Sängerin Charli XCX. Das Album ist nicht nur kommerziell eines der erfolgreichsten dieses Jahres, sondern beeinflusste auch den Zeitgeist – inklusive der Wahlkampagne von Kamala Harris. Die Graphische ist vermutlich die bekannteste Ausbildungsstätte für Mediendesign und -produktion in Österreich. Ursprünglich in der Westbahnstraße angesiedelt, befindet sie sich nun in der Leyserstraße 6 im 14. Wiener Gemeindebezirk. »Guilty Pleasure« mit dem Refrain »You give me guilty, guilty pleasure« ist ein Song von Chappell Roan, der sich mit der Ambivalenz auseinandersetzt, sowohl Scham als auch Lust durch die eigene Queerness zu empfinden. Homo neanderthalensis ist ein ausgestorbener Verwandter des Homo sapiens. Warum er ausgestorben ist, ist nicht völlig geklärt. Die Theorien gehen von schlechter Anpassungsfähigkeit über kriegerische Auseinandersetzungen bis hin zur Vermischung mit Homo sapiens. SOS-Musikland wurde 2008 als Initiative von Vertreter*innen der österreichischen Musikindustrie ins Leben gerufen, um den Anteil österreichischer Musik in den ORF-Radiosendern zu steigern. Tape oder Kassette ist ein Tonträger, der seine Hochzeit von den 70ern bis in die 90er hatte und dann von der CD als Hauptmedium für die Musikdistribution abgelöst wurde. Auf Tapes ist die Musik im Gegensatz zu späteren Formaten noch analog gespeichert. Einer der Gründe, warum sie in den letzten Jahren wieder einen Aufschwung erfahren haben. Chauvinismus bezeichnet den Glauben an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Technochauvinismus nennt man die Überzeugung, dass alle Probleme einer Gesellschaft durch neue Technologien gelöst werden können. Im Vollprogramm, das heißt rund um die Uhr, lief Radio FM4 erst im Alter von fünf Jahren, davor teilte es sich die Senderfrequenz mit Blue Danube Radio. Zyanotypie ist – und es tut uns im Herzen weh – mittlerweile leider die einzige S chreibweise, die der Duden kennt. Und bei The Gap herrscht der Duden absolut.

2.–4.10.2025
FM4 bis in die Ecken ausgeleuchtet. ———— Die Beschäftigung mit FM4 begleitet uns schon lange. Und runde Geburtstage waren stets gern gesehene Anlässe, um sich an unserem liebsten Radiosender abzuarbeiten. Zu dessen zehnjährigem Jubiläum gab’s die bislang umfangreichste Auseinandersetzung: Auf 14 Seiten warfen wir einen Blick in »Das FM4-Universum«, leuchteten diverse Ecken aus – die FM4 Charts, die Website des Senders, seine »Berufsjugendlichen« – und sprachen ausführlich mit der damaligen Senderchefin Monika Eigensperger. Für die Bebilderung platzierten wir diverse gelbe Merchandise-Artikel im Auto unseres Chefredakteurs Thomas Weber – gemeinsam mit unserer Redakteurin Nina Hochrainer, die mittlerweile, der Zufall wollte es so, selbst bei FM4 arbeitet. Michael Winkelmann fotografierte das Ganze. Dabei hielt er unter anderem den improvisierten »Ich bremse auch für Blumenau«-Aufkleber fest. Damals eine Hommage, nun traurige Erinnerung an den zu früh verstorbenen FM4-Mann. Und sonst so in dieser Ausgabe? Ein Interview mit Herbert Grönemayer über dessen Label Grönland Records und Klingeltöne, ein Text über die »Wiener Erfindung« Shoppingmall sowie vieles mehr.
Chelsea Wien
Vom Keller eines Wohnhauses in der Piaristengasse in die U-Bahnbögen am Gürtel, vom Vorreiter in Sachen Subkultur zum Ausgangspunkt einer der am stärksten frequentierten Lokalmeilen Wiens – das Chelsea gilt zu Recht als Institution im Nachtleben der Bundeshauptstadt. Ganz besonders Fans von Gitarrenmusik kommen hier voll auf ihre Kosten und ausgiebig zum Tanzen. Und für den Heimweg nach einer durchschwitzten Nacht empfiehlt es sich, noch schnell die neueste Ausgabe von The Gap einzustecken. U-Bahnbögen 29–30, 1080 Wien Wo gibt’s The Gap?

Sublime Aflenz
Für den kleinen Kurort Aflenz bietet das Sublime eine beachtliche Bühne, die immer wieder internationale Acts anlockt und daneben auch für Kinounterhaltung sorgt. Mariazeller Straße 146, 8623 Aflenz
Musik will nicht nur gespielt, sondern erst gelernt, dann geprobt und schließlich aufgenommen werden. Das T-On ist die richtige Location für alle diese Schritte. Linke Wienzeile 40, 1060 Wien
Jetzt Early Bird Tickets sichern!




Josef Jöchl
artikuliert hier ziemlich viele Feels
Teams seien wie kleine Familien, sagte einmal ein väterlicher Arbeitskollege zu mir. Denn wer neue Leute einstelle, bilde immer auch seine eigene Familie nach. So seine systemische Argumentation, bevor er mich an seinem Finger ziehen ließ. Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen Arbeitskolleg*innen und Geschwistern. Man gibt sich neckische Spitznamen, isst an Geburtstagen gemeinsam Kuchen und trifft sich in den meisten Fällen ausschließlich, weil man dazu verpflichtet ist.
Doch die meisten Chef*innen müssen es irgendwann übertreiben. Dann werden Mitarbeitende, die nichts als ihr Broterwerb verbindet, gezwungen, in ihrer Freizeit bowlen zu gehen, Glühwein zu trinken oder beim Wichteln gegenseitig ihren Geschmack zu verfehlen – allesamt Dinge, die gütige Eltern ihren Kindern niemals zumuten würden. Teambuilding heißt diese Unsitte. Die Betriebswirtschaft meint, die arbeitsteilige Produktivität zu steigern, indem man unselbstständig Beschäftigten mit aufoktroyierten Freizeitbeschäftigungen auf den Senkel geht. Am effektivsten vollziehe man dies, wenn man ein ganzes Team in ein Motel One steckt und ein paar Mal mit einem Flipchart draufhaut, so wie es mir vor Kurzem passierte. Ich konnte nicht umhin, mich zu wundern: War ein stabiles Einkommen diese ganzen Strapazen wert?
Love Is Blind
Es hängt immer davon ab, wen man fragt. Hin und wieder kommt es vor, dass sich Angestellte ihrem internalisierten Klassenhass beugen und Teambuildings etwas abgewinnen können. So wie diese eine Salzburger Kollegin. Die saß schon zu Beginn ganz vorne im Seminarraum und gierte nach dem Tennisball, um endlich loszuwerden, wer sie war und was sie sich von den kommenden zwei Workshoptagen erwartete, während ich noch versuchte, mit einem Seminarraummöbel eins zu werden, um zumindest optisch zu verschwinden. Denn es sollte – wie
literally immer – eine Gruppenaufgabe folgen. Edding und Naturpapier, man kennt den Drill. Gefühlte Stunden beobachtete ich meine Teamkolleg*innen, wie sie selbstgebastelte Schilder auf das erwähnte Flipchart klebten, und fragte mich dabei, ob ich viel schlauer oder viel dümmer war als sie. Denn am Ende würden alle alles super finden und die Flipcharts abfotografieren, aus einem mir nicht erfindlichen Grund. Wie viel Sinnvolleres hätte man mit dieser Zeit anfangen können! Zum Beispiel gemeinsam eine ganze Season der Netflix-Show »Love Is Blind« niederreißen. Danach hätte man trefflich darüber diskutieren können, ob Hannah wirklich nur zu direkt ist oder doch eine Bitch, oder ob Ashley ihrem Ehemann in spe Tyler zu früh wegen seiner drei verschwiegenen Kinder verziehen hat oder gerade rechtzeitig. So musste ich all das später im Motel One alleine nachholen. Aber der Reihe nach.
»Love Is Blind« ist eine extrem interessante Datingshow. Die datenden Paare bekommen sich nämlich erst zu Gesicht, nachdem sie sich bereits verlobt haben. Deshalb müssen sie auf die harte Tour herausfinden, dass Liebe alles andere als blind ist. Das ist sehr unterhaltsam, wenn sich jemand sein Significant Other z. B. besonders groß vorgestellt hat und es dann sehr klein ist. Weil jedoch niemand oberflächlich erscheinen und zugeben möchte, dass die Looks des oder der Verlobten nicht up-to-par sind, ergießen sich Schwalle passiver Aggression über die anderen Kandidat*innen. Das macht den meisten überhaupt nichts aus, weil der Cast der Show fast ausschließlich aus Menschen besteht, die irgendetwas managen. Alle sind Regional Manager, Sales Manager, Yoga Instructor Manager oder Interior Decorator Manager. Als leitende Angestellte mit Personalverantwortung reproduzieren sie tagein, tagaus die Kultur des Kapitalis-
mus. Dazu gehört unter anderem, in einer Art Gameshow die große Liebe zu suchen und unbescholtene Mitarbeiter*innen zum Teambuilding zu zwingen. Und hier schließt sich für mich der Kreis dieser Kolumne.
Life Is Bland
Nach einem harten Teambuilding-Tag möchte man einfach nur im Motel One chillen. Doch gerade als ich es mir bei »Love Is Blind«, S07E04, gemütlich gemacht hatte, klopfte es an meiner Tür. Ein Arbeitskollege wies mich darauf hin, dass sich alle noch für einen Absacker an der Bar treffen würden. Natürlich hätte ich am liebsten geantwortet: »Warum willst du mit Arbeitskolleg*innen was trinken gehen? Hast du keine Freund*innen?« Doch ich war mir bewusst: Wenn du beim Absacker mit Kolleg*innen an der Motel-One-Bar abwesend bist, wird gottlos über dich gelästert. Deshalb schleppte ich mich in die Lobby und bestellte mir ein kleines Bier um sieben Euro. Schon von Weitem hörte ich die Salzburger Kollegin ausgelutschte, moralisch aufgeladene Talking Points skandieren. Sie esse zwar Fleisch, aber nur regional – solche Dinge. Als ich auftauchte, plötzlich alle so fake: »Ah, der Josef ist da!« Unter akutem Small-Talk-Zugzwang presste ich kurz ein paar Facts über »Love Is Blind« hervor, worauf die Salzburgerin irgendetwas Meinungsstarkes über Trash-TV sagte. Teams sind schon weirde Gebilde, dachte ich mir, während ich innerlich flüchtete und mich in ein hässliches Loungemöbel vor einem Fernseher mit flackerndem Lagerfeuer curlte. Was danach passierte, weiß ich nicht mehr. Mein Teamleiter muss gekommen sein und mich zugedeckt haben. joechl@thegap.at • @knosef4lyfe
Josef Jöchl ist Comedian. Sein aktuelles Programm heißt »Erinnerungen haben keine Häuser«. Termine und weitere Details unter www.knosef.at.

11/12/24
L’Impératrice
19/02/25 Kiasmos
01/03/25
Der Nino aus Wien & DieAusWienBand
22/03/25 Tocotronic
25/04/25 Monobrother
19 & 20/06/25 Kruder & Dorfmeister
u. v. m.




