

Untypisch österreichisch
Bernhard Wenger, sein Debütfilm »Pfau – Bin ich echt?« und ein Protagonist ohne Eigenschaften




Bernhard Wenger, sein Debütfilm »Pfau – Bin ich echt?« und ein Protagonist ohne Eigenschaften

Die Lage ist hoffnungslos. Da bin ich weder der Erste, der das denkt, noch der Erste, der es öffentlich kundtut. Die Klimakrise ist unvermeidlich. Das Leben wird immer unleistbarer. Die Lohnschere klafft. Überall rechte Demagog*innen an der Macht. Minderheiten werden angegriffen. Krieg in der Ukraine. Eskalation in Taiwan. Und Nahost-»Konflikt« ist ein Hilfsausdruck. Wohin der Blick auch schweift, türmen sich Katastrophen, Dystopien, gesellschaftliche Abgründe.
Was können wir tun, wenn nichts mehr getan werden kann? Zuallererst einmal – so paradox das klingen mag: auch in hoffnungslosen Zeiten die Hoffnung nicht aufgeben. Denn entgegen der gängigen Weisheit stirbt diese nicht zuletzt, sondern vielmehr zuerst. Die Hoffnung zu verlieren, ist nämlich der erste Schritt, uns tatsächlich handlungsunfähig zu machen. Wer nicht hofft, wer sich keine andere, keine bessere, keine gerechtere Welt vorstellen kann, wird auch keine weiteren Schritte setzen können, diese zu erreichen.
Manchmal scheint mir, dass weite Teile einer bürgerlich-linken Gesellschaft aktuell gerade zum ersten Mal etwas bemerken, das marginalisierte Menschen schon lange wissen: Die Gesellschaft ist scheiße und sie zu ändern, scheint unmöglich. Es trotzdem zu versuchen, trotzdem nicht die Lust am Leben zu verlieren, erfordert eine gewisse Übung und einen gewissen Trotz.
Es gibt ein schönes Zitat, das gerne der Anarchistin Emma Goldman zugeschrieben wird: »Wenn ich nicht tanzen kann, ist das nicht meine Revolution.« Tatsächlich stammt das so zwar nicht von ihr, gibt ihren Grundgedanken allerdings prägnant wieder. Wie kann der Versuch, eine schönere Welt herzustellen, gelingen, wenn wir nicht gewillt sind, diese schönere Welt hier und jetzt zu leben? Oder es zumindest zu versuchen. Denn gerade das kann die andere Seite ja nicht aushalten: das Leben zu feiern – in all seinen Facetten.
Also so hoffnungslos die Lage auch ist, müssen wir lernen, trotzdem zu hoffen, trotzdem an etwas zu arbeiten, das uns unerreichbar zu sein scheint. Denn die Alternative ist keine. Wir müssen auf die Straßen gehen – aber auch in ihnen tanzen.

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at
Web www.thegap.at
Facebook www.facebook.com / thegapmagazin
Twitter @the_gap
Instagram thegapmag
Issuu the_gap
Herausgeber
Manuel Fronhofer, Thomas Heher
Chefredaktion
Bernhard Frena
Leitender Redakteur
Manfred Gram
Gestaltung
Markus Raffetseder
Autor*innen dieser Ausgabe
Luise Aymar, Lara Cortellini, Victor Cos Ortega, Sandra Fleck, Barbara Fohringer, Susanne Gottlieb, Johanna T. Hellmich, Jannik Hiddeßen, Sandro Nicolussi, Dominik Oswald, Helena Peter, Barbara Pfeifer, Simon Pfeifer, Alexandra Isabel Reis, Mira Schneidereit, Katharina Serles, Jana Wachtmann, Sarah Wetzlmayr
Kolumnist*innen
Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner
Fotograf*innen dieser Ausgabe
Alexander Galler
Coverfoto
Alexander Galler
Lektorat
Jana Wachtmann
Anzeigenverkauf
Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl
Distribution
Wolfgang Grob
Druck
Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.
Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien
Geschäftsführung
Thomas Heher
Produktion & Medieninhaberin
Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien
Kontakt
The Gap c/o Comrades GmbH
Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at
Bankverbindung
Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX
Abonnement
6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at
Heftpreis
€ 0,—
Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.
Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.
010 »Es ist völlig legitim, nicht immer zu wissen, was man machen will« Bernhard Wenger und sein Langfilmdebüt »Pfau«
016 Wie ein Comic unsere Geschichte neu zeichnet
»Die Frau als Mensch« von Ulli Lust
020 »Schweben« zwischen den Rollen Amira Ben Saoud und ihr dystopischer Debütroman
022 Der Vorstadtcasanova Rainhard Fendrich wird 70
026 Play or Pay Wer verdient mit Streaming Geld?
028 Von Bild und Bildung Das Foto Arsenal Wien als neues Zentrum für Fotografie
030 Das Bildungssystem brennt aus Junge Lehrende im Berufsleben
034 Was soziale Medien uns schulen Tiktok & Co als neue Bildungskanäle



Bildung Von Medien, Menschen und Institutionen, die uns lehren
003 Editorial / Impressum
006 Comics aus Österreich: Jasmin Rehrmbacher
007 Charts
014 Golden Frame
038 Wortwechsel
040 Gewinnen
041 Rezensionen
046 Termine
008 Gender Gap: Toni Patzak
054 Screen Lights: Christoph Prenner
058 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl
Zum ersten Mal dürfen wir eine Redakteurin auch als Winzerin vorstellen. Unter Sande-Serles Wein frönt Katharina dieser Leidenschaft nämlich seit ein paar Jahren. Aber nicht, dass sie sonst unterbeschäftigt wäre. Journalistisch schreibt sie immer wieder über Kulturpolitik, Fair Pay und Comics. Sonst ist sie noch Literatur- und Comicwissenschaftlerin, singt im Schmusechor, arbeitet im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Comics, lebt mit einem Bein in Norwegen – und das alles mit mittlerweile zwei Kindern. Hut ab!
Für dieses Porträt hat Alex uns ein Wort beigebracht: Muttizettel. Diese – sicherlich fälschungssichere – Bestätigung der Erziehungsberechtigten kann man in Deutschland anscheinend abgeben, wenn man minderjährig nach Mitternacht in einem Club bleiben möchte. Das hat auch Alex zu Schulzeiten hin und wieder in Anspruch genommen. Mittlerweile wohnt sie in Wien, studiert Sprachkunst und geht immer noch gerne aus. Für uns hat sie sich diesmal angeschaut, wie soziale Medien für politische Bildung genutzt werden können.



Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal begibt sich Jasmin Rehrmbacher an den Rand der Zivilisation. ———— Als »offene Arbeit« bezeichnet Rehrmbacher ihren Comic für The Gap. Das trifft gleich mehrfach ins Schwarze. Narrativ scheint der Comic nach vorne und hinten auszulaufen, er beginnt so unvermittelt wie er aufhört. Die Blitzlichtaufnahme einer Situation, deren Kontext wir für uns selbst herstellen müssen. Dieses Herstellen von Kontexten ist eine der fundamentalen Eigenheiten der Comicsprache. Was zwischen zwei Panels passiert, ist gewissermaßen immer unklar, muss immer hinzugedacht werden. Doch Rehrmbachers Comic ist auch in seiner Form offen. Es gibt keine klare Abgrenzung zwischen den Panels, Sprechblasen ragen aus ihnen heraus und in sie hinein. Wie ein nicht enden wollender Fluss, aus dem ein Stück herausgebrochen wurde – und der dennoch weiterfließt.
Das Portfolio von Jasmin Rehrmbacher ist breit: Wandgestaltungen, Plakatserien, botanische Illustrationen und eben Comics. Ihr neuester erscheint im Frühjahr.
Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

TOP 10

Literarische Lektüre, um das moderne Russland zu begreifen
01 »Die Reise nach Petuschki« – Wenedikt Jerofejew
02 »A Woman Walks into a Bank« – Roxy Cook
03 »Patriot« – Alexej Nawalny
04 »Im Inneren des Klaviers« – Mario Wurmitzer
05 »Reise in den siebenten Himmel« – Ljudmila Ulitzkaja
06 »Petrow hat Fieber« – Alexei Salnikow
07 »Trinken Sie Essig, meine Herren« – Daniil Charms
08 »Hundeherz« – Michail Bulgakow
09 »Der Idiot« – Fjodor Dostojewski
10 »Der Revisor« – Nikolai Gogol
TOP 03
Österreicherinnen, die mich inspirieren
01 Elizabeth T. Spira
02 Lotte Tobisch
03 Valie Export
Auch nicht schlecht:
Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Nachhaltigkeit
Ira Süssenbach inszeniert »Worüber man lacht, wenn es nichts zu lachen gibt« von Mario Wurmitzer am 14. und 15. März beim Wortwiege Festival in den Kasematten Wiener Neustadt.
TOP 10
Diskussionsthemen für philo-soff-ische Abende
01 Wann ist eigentlich das Tote Meer gestorben?

02 Was genau findet man »Somewhere over the Rainbow«?
03 Wissen ist Macht. Was ist dann »unnützes Wissen«?
04 Kommt wirklich jede*r irgendwann nach Haus’?














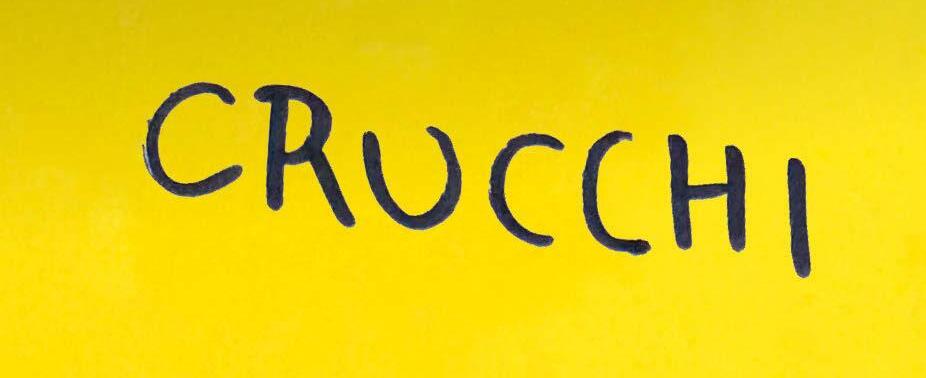

















05 Wenn man für die besten Dinge kein Geld bekommt, was gibt’s dann dafür?
06 What the hell is a »blam-blam«? (»Suffragette City« – David Bowie)
07 Wenn nur der Tod umsonst ist, warum werben dann alle mit »Jetzt! Neu! GRATIS!«?
08 Was muss man eigentlich hergeben, wenn laut Albert Einstein »die besten Dinge im Leben nicht die sind, die man für Geld bekommt«?
09 Warum heißt The Gap eigentlich The Gap?
10 Und werden die Mitarbeiter*innen von The Gap wirklich von Gap ausgestattet?
»Wien im Überblick«-Aussichtspunkte
01 Südturm des Stephansdoms (343 Stufen, kein Aufzug!)
02 Station 17E im Grünen Bettenturm des AKH (Thoraxchirurgie)
03 Kahlenberg mit Josefskirche (sogar Papst Johannes Paul II. war schon dort)
Auch nicht schlecht
Keith Richards – forever young; Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll – ein Lifestyle wie keiner; »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum« (Friedrich Nietzsche)
Till Philippi ist Werber aus Leidenschaft und machte 2015 seine zweite Passion zum Beruf: »Vinyl & Music«. Das gleichnamige Festival findet am 8. und 9. März in der Ottakringer Brauerei statt.












































Toni Patzak
hakt dort nach, wo es wehtut
Mein kleiner Halbbruder hat zwei nigerianische Eltern, das heißt, dass er im Gegensatz zu mir, die nur ein nigerianisches Elternteil hat, doppelt so scharf essen kann, doppelt so viele Tanten hat und doppelt so dunkel ist. Als er noch kleiner war, habe ich ihm oft bei Hausaufgaben und schulischen Angelegenheiten geholfen. Seine Schule lag etwa 15 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Nachdem ich eines Tages doch sehr lange auf ihn hatte warten müssen, kam er lachend an und meinte, dass sein Handy keinen Akku mehr und er sich verfahren habe, aber niemand stehen geblieben sei, um ihm zu helfen. »Die eine Frau hatte sogar Angst vor mir, glaube ich.«
Er habe über 20 Minuten warten und Passant*innen fragen müssen, ob sie ihm den Weg erklären könnten. Wenn ich daran denke, geht mir das immer noch unter die Haut, weil ich weiß, wie sich so etwas anfühlen kann. Aber mein Bruder lachte nur. Er lachte und lachte, als hätte er einen Witz gehört. Ich verstand seine Reaktion nicht, weil aus meiner Sicht der einzige Witz, der in der Situation gemacht worden war, auf seine Kosten ging.
Wie man in den Wald hineinruft
Nach diesem Tag hatte ich öfters Angst, dass ihm etwas passieren könnte oder dass er von unseren Engeln in Blau mehr Aufmerksamkeit bekommen würde als notwendig. Sein Glück war, dass er nie so viel Blödsinn gemacht hat wie ich damals. Er war früh recht groß für sein Alter, aber trotzdem eindeutig ein Kind, wenn er den Mund aufmachte. Heute ist er noch größer und redet genauso viel Blödsinn, nur mit einer tieferen Stimme. Und weil er eben ein großer Schwarzer Mann mit dunkler Stimme ist, sorge ich mich, wie das wahrgenommen wird.
Rassismus ist immer komisch und macht Angst, aber Rassismus ist nicht gleich Rassismus. Sprich: Jeden trifft das anders. Woher du kommst, welche Staatsbürger*innenschaft
du hast, wie du aussiehst, welches Geschlecht du hast und in welche soziale Schicht du geboren bist – all das spielt eine große Rolle und lässt das gleiche strukturelle Problem in vielen verschiedenen, hässlichen Farben erscheinen. So ist Diskriminierung für mich komplett anders als für ihn.
Er ist ein großer, böser, Schwarzer Mann, und ich bin eine kleine, dumme, Schwarze Frau. Er ist gefährlich, ich bin unfähig. Er wird von der Polizei angehalten, ich werde ungefragt angefasst – weil wir beide anders aussehen und deswegen entweder verdächtig oder ein Fetisch sind. Unsere Erfahrungen sind verwandt, stammen aus dem gleichen Sentiment, nur erleben wir den ganzen Spaß anders. Und weil wir unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben, gehen wir auch unterschiedlich damit um.
Das sage nicht nur ich, das sagen auch viele klügere Menschen, die Forschung zu Gendered Racism und differenzierte Coping-Mechanismen betreiben. Sie erklären, wieso ich damals nicht gelacht habe und wieso er sich nicht großartig für diese Kolumne interessieren wird. Ich möchte an dieser Stelle vermeiden, erst recht zu pauschalisieren und Schwarzen Menschen geschlechterspezifische Verhaltensweisen nachzusagen, aber: Wie man in den Wald hineinschreit, so kämpft er auch zurück. Allerdings sind viele der vorliegenden Studien sowohl in als auch mit der afroamerikanischen Community entstanden und daher nicht einfach auf den österreichischen Kontext zu übertragen, außerdem quantifizieren sie höchst individuelle Situationen und sind daher nie auf jeden spezifischen Menschen übertragbar.
Die Studie »Gender Differences in Coping with Racism« hat 2021 zum Beispiel feststellen können, dass Schwarze Männer, die Rassismus in Form von Angst oder Aggression erfahren, diesem oft mit Selbstzerstörung und aktiver Wut entgegenwirken. Das hat unterschiedliche Erscheinungsformen und kann von Überarbei-
tung und Burn-out bis zu Substanzmissbrauch und Selbstverletzung führen. Bei Frauen wurden hingegen häufiger Versuche der Assimilation beobachtet. Vermeidungsstrategien wie nicht aufzufallen oder herauszustechen, wie das Streben nach Stärkung durch religiöse und soziale Gruppierungen oder wie das Umgehen von Stressoren durch Minimierung und Leugnung der Erfahrungen. Aber wie gesagt, solche extrem persönlichen sozialen Verhaltensweisen wie Coping-Mechanismen sind immer schwer allgemein in Studien zusammenzufassen. Mich und meinen Bruder erkenne ich in diesen Beschreibungen etwa keineswegs wieder.
Schreiben oder lachen?
Nichtsdestotrotz ist es interessant und wichtig, die Verarbeitung und Bewältigung von Rassismus in verschiedenen Gendergruppen zu erforschen. Schon ohne strukturelles Trauma ist es meist schwer zu verstehen, wieso man manchmal auf Situationen auf gewisse Weise reagiert. Zu lernen, wie man seine Emotionen auf nicht destruktive Art regulieren kann, ist eine Lebensaufgabe und fällt in den Bereich unbezahlter Selbstarbeit. Besonders wenn man mit Unverständnis darüber allein gelassen wird, wie Wut von außen zu Wut von innen führen kann. Und mit der Frage, was man dagegen machen kann angesichts der Tatsache, dass man fortlaufend Traumata im Leben erfahren wird, die immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen werden.
Ich als Schwarze Frau werde nie verstehen, wie es ist, das Leben als Schwarzer Mann zu durchlaufen, und Gleiches gilt im Umkehrschluss für meinen kleinen Bruder. Dennoch sind wir wenigstens nicht allein mit diesen Gedanken. Er hat eine Schwester, die halb gescheite Kolumnen schreibt, und ich habe einen Bruder, der auch einfach mal über das Ganze lachen kann. patzak@thegap.at @tonilolasmile










Das Filmarchiv Austria feiert Jubiläum und präsentiert unter anderem eine neue Onlineplattform. ———— Sieben Jahrzehnte, so lange sammelt das Filmarchiv Austria nun schon das österreichische Filmerbe. Neben der Zentrale im Augarten und dem Filmdepot in Laxenburg betreibt das Filmarchiv noch das Metro Kinokulturhaus im ersten Wiener Gemeindebezirk. An letzterem Standort finden neben dem eigenen Programm auch etliche Festivals regelmäßig eine Leinwand. Insgesamt umfasst die Sammlung des Filmarchivs mittlerweile über drei Millionen Fundstücke – von Werbespots für Milde Sorte über Newsfilme der »Austria Wochenschau« bis hin zu Castingaufnahmen von Romy Schneider (siehe Bild).
Archiv mit Kontext












































KASEMATTEN








































































































Bernhard Frena
Seit Kurzem sind diese und einige andere Kleinode der Sammlung auch online frei zugänglich. Unter dem Namen Filmarchiv On werden auf der Website wöchentlich neu restaurierte Filmdokumente veröffentlicht. Dies geschieht jedoch nicht ohne die nötige Aufarbeitung, denn jeder Einblick in die über 120 Jahre Lichtspielgeschichte wird anmoderiert und damit wissenschaftlich kontextualisiert. Doch auch wer eher an klassischen Kinofilmen interessiert ist, darf sich jede Woche über einen neuen freuen. Und ihn dann einen ganzen Monat lang gratis streamen. Neben dem Internetangebot wird das Jubiläum noch mit einem erweiterten monatlichen Programmheft gefeiert. Und auch das Metro Kinokulturhaus blieb nicht unbedacht: Dort eröffnete nämlich gerade ein zusätzliches »Pop-up-Kino«. Kinosalon heißt die neue Projektionsstätte, die mit 80 Sitzen die Lücke zwischen dem großen Historischen Saal (161) und dem kleinen Eric-Pleskow-Studiokino (49) schließt. Dafür, dass diese drei Säle in der Johannesgasse 4 nun auch ausgiebig bespielt werden, sorgt die ganzjährige Retrospektive »Landvermessung«. In einer Reihe von Schwerpunkten sind hier Filme aus der gesamten österreichischen Bewegtbildgeschichte zu sehen.
Filmarchiv On ist unter www.filmarchiv.at abrufbar. Der aktuelle zweite Schwerpunkt der Retrospektive »Landvermessung« mit dem Namen »Prater Kino Welt« läuft noch bis 4. März im Metro Kinokulturhaus.












FESTIVAL FÜR THEATERFORMEN






wortwiege.at 26. FEBRUAR –30. MÄRZ 2025



»Es ist völlig legitim, nicht immer zu wissen,
Nach frühen Erfolgen mit schwarzhumorigen, skurrilen Kurzfilmen erobert Regisseur Bernhard Wenger nun die Kinoleinwände mit seinem ersten abendfüllenden Spielfilm. ———— »Der Pfau kann weder gut fliegen noch singen. Selbst sein Schrei hat nichts Liebliches oder Schönes an sich, sondern ist unangenehm. Aber er präsentiert brav seine Federn und wird als eitles und edles Tier gesehen.« So erklärt Bernhard Wenger die Allegorie, die sich hinter dem Titel seines Spielfilmdebüts »Pfau – Bin ich echt?« verbirgt. Im Zentrum: ein junger Mann, gespielt vom deutschen Charaktermimen Albrecht Schuch, der für seinen Job in einer Renta-Friend-Agentur regelmäßig neue Persönlichkeiten annimmt; der häufig als protziges Begleitstück fungiert; der hinter der Fassade aber nur noch wenig an eigenem Charakter zu bieten hat.
Selbst wirkt Wenger nicht wie ein stolzer Pfau, als wir ihn an einem kühlen Jänner-Nachmittag im Filmcasino zum Gespräch treffen. Dieser junge Mann erweckt den Eindruck, ruhig und in sich gekehrt zu sein. Gelegentlich huscht ein süffisantes Lächeln über seine Lippen. Weniger wie der stets scherzende Ruben Östlund oder der von chaotischer Energie sprühende Ari Kaurismäki, sondern eher wie der zurückgezogen wirkende Giorgos Lanthimos. Alle drei sind Filmemacher, mit deren Werken »Pfau« nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig verglichen wurde.
Wie er selbst den Vergleich zu den großen satirisch-humoristischen Stimmen der Gegenwart sieht? »Sicher ehrt mich das. Es sind wahnsinnig tolle Filmemacher, deren Werke ich sehr bewundere.« Besonders Kaurismäki habe es ihm angetan: »Er war der erste Regisseur, der mich wirklich begeistert hat, dessen Filme ich alle sehen wollte. So ist meine Liebe
»Mein Credo ist: Wenn ich es selbst lustig finde, dann sollte es funktionieren.« — Bernhard Wenger
zum skandinavischen Kino entstanden.« Trockener und schwarzer Humor sowie Understatement in der Handlung gepaart mit Absurdität und Surrealismus – dazu gelegentliche Situationskomik. Das sind klassische Charakteristika skandinavischer und britischer Komödien. Es sind auch Elemente, auf die Wenger in seinen Filmen immer wieder zurückgreift. Der Erfolg gibt ihm recht. »Pfau – Bin ich echt?« lief in Venedig in der unabhängigen Sektion »Settimana Internazionale della Cri-
tica« und wurde dort mit zwei Preisen ausgezeichnet. Beim Internationalen Filmfestival von Stockholm gewann er das Aluminium Horse für den besten Debütfilm. Und der gebürtige Salzburger Wenger konnte auch davor schon reüssieren – mit seinen Kurzfilmen: »Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin« von 2018 gewann Preise bei der Alpinale, der Diagonale, beim Filmfestival Max Ophüls Preis, beim Filmfestival Kitzbühel und beim Österreichischen Filmpreis. »Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain« wurde bei den Vienna Shorts 2019 ausgezeichnet.
Untypisch österreichisch
Eine typisch österreichische Note merkt man Wengers Filmen dabei nicht wirklich an, wenn auch immer wieder typisch österreichische Originale durch den Raum stolzieren. Für Wenger ist das neben seiner Liebe für nördlicheren Humor auch ein Statement, dass Humor in einer Nische existieren kann und muss. »In Österreich haben wir zwar einen ausgeprägten Humor, aber es gibt wenige Filme mit Humor, die nicht kommerziell ist.« Soll heißen? »Das ist Humor, der hauptsächlich über Dialog, Slapstick und große Übertreibung funktioniert. Der Humor, mit dem ich arbeite, ist subtiler.« Er versuche stets, aus einem Realismus heraus zu arbeiten: »Die Übertreibung darf nie so groß sein, dass man sich denkt, dass das jetzt unrealistisch ist.«
Ebenso eine Seltenheit, die sich in seinen Filmen findet: ein internationaler Cast mit Darsteller*innen von außerhalb der deutschen Sprachinsel. »Selbst in einem kleinen Land wie Österreich kommen alle täglich mit Menschen in Berührung, die aus anderen Ländern sind und die andere Sprachen sprechen.« Daher finde er es interessanter, Projekte international aufzuziehen: »Weltoffenheit statt Nabelschau und anstatt nur innerhalb der eigenen Grenzen zu denken.«
Produktion, dann Regie
Seine Filmsprache perfektionierte Wenger vor allem in den letzten Jahren, doch die Liebe zum Film begleitet ihn seit seiner Jugend. »In der Stadtbibliothek Salzburg gibt es eine Filmsektion. Dort habe ich mir DVDs ausgeborgt und alles angeschaut.« Um diese Zeit herum begann er auch, Kurzfilme zu drehen, und mit 18 Jahren bewarb er sich für die Filmakademie in Wien. Für einen Studienplatz wurde er damals aber nicht genommen. »Im Nachhinein völlig nachvollziehbar bei dem, was ich da abgegeben hatte«, erinnert er sich schmunzelnd. Doch die Leidenschaft brannte weiter und als Filmemacher in spe sucht man daraufhin eben andere Wege, um in die Branche einzusteigen. Erste Set-Erfahrung sammelte Wenger bei diversen Produktionen und Kurzfilmen: »Egal ob Kabel tragen oder Brote schmieren – einfach dabei sein.«
Dann begann eine Reise der Umwege. »Ich wusste immer, dass ich Regie machen möchte«, erklärt er den damaligen Gedankengang. Doch die Erfahrung in der Produktion,
unter anderem bei seinen eigenen Kurzfilmen, habe ihn dazu getrieben, sich beim nächsten Versuch an der Filmakademie stattdessen für Produktion zu bewerben. »Für Regie hatte ich das Selbstbewusstsein noch nicht. Ich wusste, dass ich dafür noch viel lernen müsste.«
2014 klappte es dann. Die eineinhalbjährige Grundausbildung, die alle durchlaufen müssen, sowie seine Kurzfilme, mit denen er Erfolge bei Festivals feierte, gaben ihm letztlich das zuvor fehlende Selbstbewusstsein. »Ich habe in diesen eineinhalb Jahren so viel gelernt wie noch nie in meinem Leben«, erzählt Wenger. »Danach wusste ich, dass ich bereit bin, auch Regie zu studieren, und habe es als zweites Hauptfach dazugenommen.«
Bereut er die Zeit im Bereich Produktion? »Es hat mir sehr geholfen – beim Schreiben, beim Regieführen. Ich weiß dadurch, was alles möglich ist. Aber das Herz war halt bei der Regie.« Als Regisseur möchte er nun Arthouse mit Humor verbinden. Den nicht-kommerziellen Humor kultivieren. »Ich mag es, wenn man mit einem Film die Leute zum Lachen bringen kann, aber gleichzeitig tiefgründige Themen vermittelt.«
In Falle von »Pfau – Bin ich echt?«, in dem seine Hauptfigur zwischen Sein und Schein hin- und herstolpert, reflektiert Wenger die Bedeutung von Status und Prestige sowie die Selbstinszenierung in den Medien und die dahintersteckende Einsamkeit. Matthias ist zwar Weltmeister darin, seine Kund*innen gut dastehen zu lassen, doch wie steht es um sein eigenes Seelenleben? Wenger inszeniert ihn als unentschlossenen, fast schon widerwilligen
Helden, der seine Misere nicht versteht. Diese Passivität findet sich schon im Protagonisten von »Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin«. Dort geistert ein junger Schwede unmotiviert durch ein österreichisches Wellnesshotel, während er nur halbherzig versucht, seine beleidigte, verschwundene Freundin wiederzufinden.
»Ich arbeite immer mit Figuren, die im Leben nach etwas oder sich selbst suchen«, reflektiert der Regisseur seinen Zugang. »Es ist für jüngere Generationen völlig legitim nicht immer zu wissen, was man machen will oder was klug wäre.« Diese Figur dann aus ihrer Passivität herauskommen zu lassen, ihre Ecken und Kanten durch kleinere Details zu zeigen, das ist die Herausforderung. Diese Entschleunigung, zuzuschauen wie seine Protagonist*innen durchs Leben stolpern, macht eines der Kernelemente von Wengers Erzählweise aus. »Humor funktioniert entweder durch Beschleunigung oder durch Entschleunigung«, meint er. »Bis jetzt finde ich die Entschleunigung das interessantere Mittel.«
Skurril wie das Leben
Die Inspirationen für seine Geschichten ergeben sich dabei durch ganz unterschiedliche Zusammenhänge. »Sehr viele dieser Skurrilitäten habe ich selbst erlebt oder beobachtet. Oft geht es auch um die Fortsetzung von Dingen, die ich im echten Leben erlebe. Bei denen denke ich dann: Was wäre, wenn jetzt noch das und das passieren würde.« So sammle er verschiedenste Ideen, bis sie dann plötz-

Entschleunigung ist für Bernhard Wenger ein essenzielles filmisches Mittel.
lich in einem Drehbuch Sinn ergeben. Aber grundsätzlich seien immer Grundidee und Ausgangsproblem einer Figur da.
Die Inspiration für Matthias und seine Agentur kam Wenger etwa zehn Jahre vor dem fertigen Film. »2014 las ich in einem Artikel im New Yorker über Rent-a-Friend-Agenturen und ich dachte mir schon damals, das wäre spannend für einen Kinofilm.« Zunächst war dies aber noch keine relevante Option, erst Jahre später sollte sich eine konkrete Idee kristallisieren: »Nachdem ich an der Filmakademie zu studieren begonnen hatte und 2018 den Erfolg mit ›Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin‹ hatte, flog ich zur Recherche nach Japan.« Dort traf er sich mit Mitarbeiter*innen von derartigen Agenturen.
»Einer davon hat mir von seinem Problem erzählt, dass er gar nicht mehr wirklich wisse, wer er selbst sei. Er begebe sich ständig in neue Figuren und müsse sich dabei emotional verschließen, um keine Verbindungen aufzubauen.« In der Vorbereitung probten Wenger und Schuch dann, wie sich diese Verschlossenheit in Blicken ausdrücken kann. »Was bedeutet dieser Blick? Heißt das jetzt ›Ich bin ratlos‹ oder ›Ich bin hilflos‹ oder ›Ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert‹ oder ›Ich weiß nicht, wie ich als nächstes reagieren will‹?« Humor mag im fertigen Film spontan wirken, aber er ist oft hart erarbeitet und bis ins Detail geplant. Wenger will hier kaum etwas dem Zufall überlassen: »Für mich ist Vorbereitung wahrscheinlich 70 Prozent des Filmemachens.«
Gute Vorbereitung bedeutet Üben. Für Wenger bedeutet das, den gesamten Film einmal vorab mit einer kleinen Kamera durchzudrehen. »Wir spielen dann quasi selbst vor der Kamera. So können wir den Ablauf, den wir geschrieben haben, testen, und auch schon in einem Testschnitt herausfinden, ob alles so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben.« Nebenbei helfe es auch, ein Gefühl für die Figuren zu bekommen. Für den Rhythmus. Für das Timing. »Das sind wahnsinnig wichtige Dinge in einer Komödie. Ist es überhaupt realistisch, dass ein Schauspieler von dort nach dort geht? Oder würde er einen ganz anderen Weg wählen?«
Neben dem Proben sind es auch die jahrelangen Wegbegleiter*innen, die Wenger in der Produktion genaue Abläufe und Beständigkeit garantieren. Seit der frühesten Jugend in Salzburg steht ihm etwa Rupert

Höller zur Seite. »Wir haben in der Jugend begonnen, gemeinsam Kurzfilme zu machen, und sind diesen ganzen Weg inklusive Filmakademie gemeinsam gegangen«, erinnert sich Wenger. »Er hat immer schon meine Kurzfilme geschnitten und früher habe ich noch seine Kurzfilme produziert.« Zwar mache Höller inzwischen Musikvideos und Werbung, »aber die Zusammenarbeit, was den Schnitt betrifft, haben wir zum Glück trotzdem weitergeführt.«
Wenn man sich durch die jahrelange, gemeinsame Filmografie wühlt, fällt einem vor allem eines auf: Wenger stellt seine Figuren, so skurril und passiv sie auch sein mögen, nie bloß. Auch über Rent-a-FriendAgenturen macht er sich nicht lustig. »Diese Agenturen sind nicht aus einer schlechten Idee heraus gegründet worden«, meint er stattdessen. »Man ist dann nicht alleine oder kann damit soziale Kontakte üben, wenn man eine sehr introvertierte Person ist.« Das Problem sei, was die Gesellschaft daraus mache: ein Lügenkonstrukt, das die soziale Realität, in der sich Menschen bewegen, nach außen verzerre. »Deswegen gehe ich mit der Gesellschaft härter ins Gericht als mit diesen Agenturen.«
Sein Protagonist Matthias ist also nicht nur ein Mann ohne Eigenschaften. Er ist auch ein Opfer seiner Umstände. Wenger greift dafür auf seine Gespräche mit dem Agenturmitarbeiter in Japan zurück. »Dadurch, dass er sich in diesen Rollen so verschließt, braucht es auch Zeit, bis er sich wieder öffnen kann«, erklärt er. »Wenn er in einem Moment zu Hause bei der Familie ist und am Tag danach schon wieder die nächste Rolle einnehmen muss, hat er gar nicht die Möglichkeit, sich zu öffnen. Erst wenn er mal längere Zeit nicht vorgibt, jemand anderes zu sein, gelingt ihm das. Ich fand das wahnsinnig tragisch.«
Durch die jahrelange Arbeit an dem Buch, das er 2020 etwa bei der Cinéfondation Residence des Filmfestivals in Cannes weiterentwickelte, fand aber auch viel persönliche Bernhard-Wenger-Erfahrung Einzug in die Handlung. »In dieser Residency waren wir fünf, sechs internationale Filmschaffende, die dann wegen Corona plötzlich nach einer Woche in der Wohnung eingesperrt waren. Durch die Pandemie floss zum Beispiel ein paranoider Strang von Matthias in die Handlung.« Im Film äußert sich diese Paranoia angesichts des wütenden Ehemanns einer ehemaligen Kundin.
Hat er je Zweifel, dass sein Humor nicht ankommen könnte? »Mein Credo ist: Wenn ich es selbst lustig finde, dann sollte es funktionieren«, gibt sich Wenger selbstbewusst. Er sei auch sehr dankbar, dass der Film bisher so erfolgreich gelaufen ist. »Die Schwierigkeit ist natürlich«, meint er grinsend, »dass man nachlegen muss«. Der Wunsch nach einem Zweitfilm ist bereits da. »Ich habe mir jetzt noch Zeit genommen. Erst für das Marketing von ›Pfau‹. Und dann um dieses Projekt langsam wieder aus meinem Kopf rauszubekommen, weil es da sechs Jahre lang verankert war. Inzwischen juckt es mich schon wieder richtig in den Fingern, etwas Neues zu schreiben.«
Wird er in Zukunft bei seinen tragisch-passiven Figuren bleiben? Jenen Protagonist*innen, bei denen man schlussendlich nie weiß, ob sie aus ihrem sie knebelnden, skurrilen Umfeld ausbrechen können oder ob sie sich einfach weiter treiben lassen? »Ich glaube, dass es im Leben sehr oft nicht gut läuft«, antwortet Wenger auf Umwegen. »Aber das heißt nicht, dass man deswegen den Optimismus oder die Positivität verlieren muss.« Susanne Gottlieb
Der Film »Pfau – Bin ich echt?« von Bernhard Wenger startet am 20. Februar in den österreichischen Kinos.


Mit ihren auf mehreren sinnlichen Ebenen erfahrbaren Skulpturen und Installationen berührt Sophie Hirsch Fragen nach dem Verhältnis von Psyche und Physis einerseits sowie Individuum und Gesellschaft andererseits. ———— 1927 wurde in Stuttgart innerhalb weniger Monate die heute berühmte Weißenhofsiedlung gebaut. Dieser Stadtteil, damals im Zuge der Werkbund-Ausstellung »Die Wohnung« entwickelt, steht heute paradigmatisch für eine neue Art des Bauens und Gestaltens, die üblicherweise »modern« genannt wird. »Modern« bedeutete damals wie heute vor allem »funktional«.
Teil dieser Ausstellung war auch ein neuartiger Stuhltypus: der Freischwinger. Erste Modelle eines solchen gehen auf den niederländischen Designer Mart Stam zurück, aber heute werden vor allem Marcel Breuer, der für die Firma Thonet in den folgenden Jahren mehrere Freischwinger-Modelle entwarf, und Ludwig Mies van der Rohe, der im Jahr der Weißenhof-Ausstellung seinen MR20 vorstellte, für die Popularisierung des Freischwingers verantwortlich gesehen. Die Sitzund Lehnflächen waren in diesen Modellen allerdings nicht – wie im vorliegenden Fall – aus pieksigen Massagebällen gefertigt, sondern aus Leder oder Korbgeflecht.
Die Wiener Künstlerin Sophie Hirsch greift die Idee der Funktionalität in ihrer Adaption des Freischwingers auf. Ebenso lassen sich ihre Objekte auf die Vorstellung einer Wechselwirkung von (Wohn-) Design und psychischer Verfasstheit ein. Immerhin standen auch die Weißenhofsiedlung und das gesamte Projekt der Moderne unter dem Zeichen, einen »neuen Menschen« hervorbringen zu wollen.
Knappe 100 Jahre später durchdringt dieser Anspruch weite Teile unserer Lebensrealität, nur dass der »neue Mensch« mittlerweile vor allem als »neues Ich« gedacht wird. Nicht zufällig spricht die zeitgenössische Werbung für Fitness-, Wellness- und Self-Care-Programme ihre Zielgruppen oft mit einem direkten »Du« an. Für Sophie Hirsch liegt in dieser Ansprache, die ein bestimmtes Mindset propagiert, eine Gefahr. Denn im Umkehrschluss impliziert die Eigenverantwortung über physische und psychische Gesundheit auch eine »Selbst schuld!«-Haltung gegenüber dem Fall, dass die eigene Verfassung die kultivierten Normen nicht erfüllt. Und so spricht Hirschs Freischwinger gleichzeitig ein Versprechen und eine Drohung aus: Setzt du dich, wird es dir danach besser gehen. Aber setzt du dich nicht?
Victor Cos Ortega
Sophie Hirsch wurde 1986 in Wien geboren und beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Praxis mit Spannungsfeldern zwischen dem Innen und Außen. Für die von 14. März bis 9. Juni im Kunstraum Dornbirn zu sehende Ausstellung der Künstlerin entsteht derzeit eine ortsspezifische Installation.
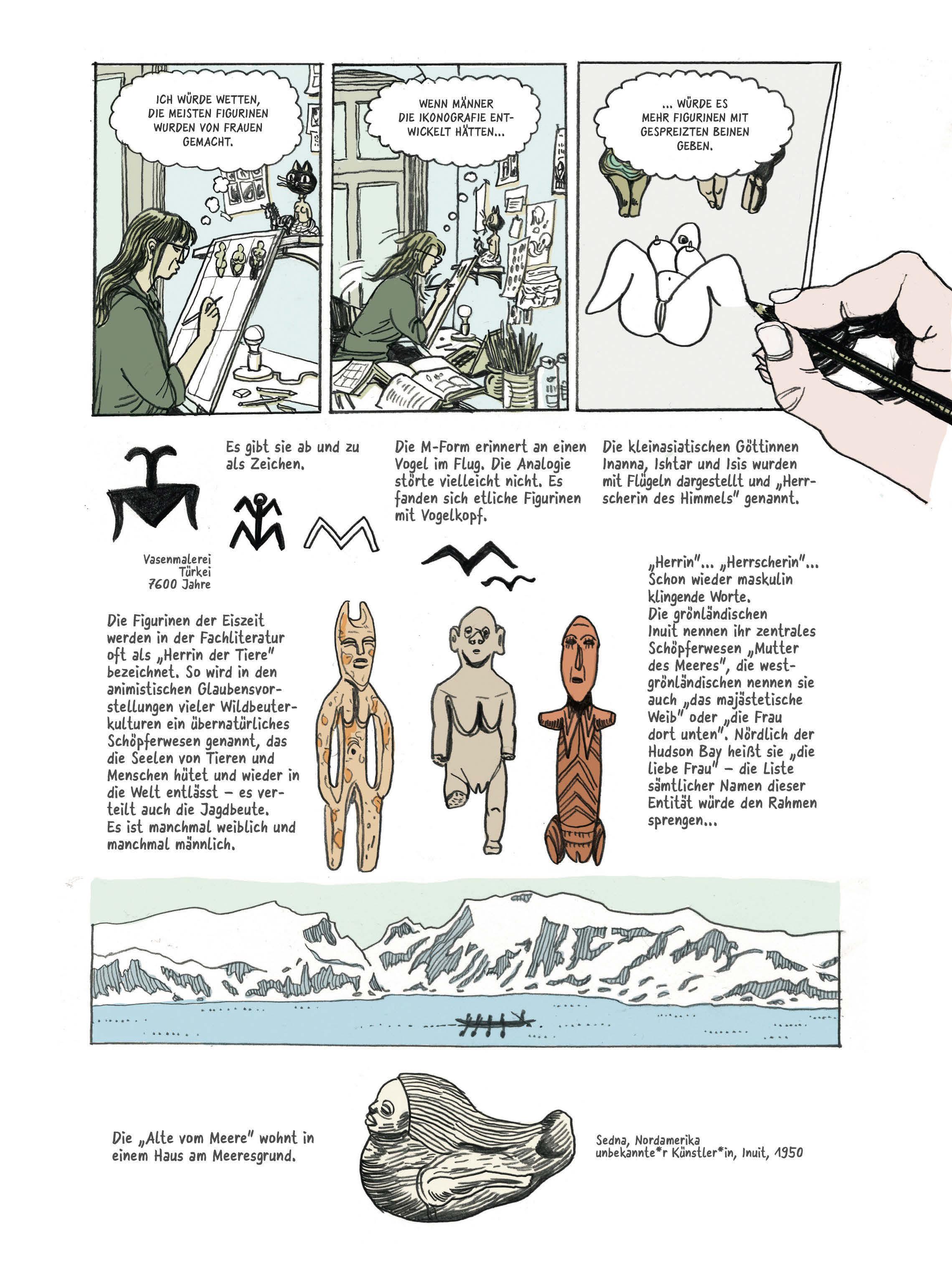
Mit ihrem aktuellen Buch überblickt die Comiczeichnerin Ulli Lust Zehntausende Jahre menschlicher, kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung – und rückt Frauen ins Zentrum der Erzählung. ———— Statt um namhafte Protagonist*innen der Weltgeschichte dreht sich »Die Frau als Mensch« von Ulli Lust um ein sonst wenig beleuchtetes Thema: die Rolle der Frau in der Eiszeit. Dabei liest sie prähistorische Spuren auf ihre Weise und hinterfragt dominante Geschichtsschreibung. The Gap hat die Künstlerin zu ihrem Mammutprojekt (pun intended) interviewt.
Dein Buch denkt darüber nach, was Bilder einer Gesellschaft über ihre psychische Verfasstheit verraten. Du wirst darin zur Bildforscherin. Seit wann stellst du dir diese Frage und warum?
ulli lust: Das mache ich schon lange. Wenn einem einmal aufgefallen ist, dass wir von Männerbildern umzingelt sind – man muss nur in eine katholische Kirche gehen –, kommt man davon nicht mehr los. Im Kunstschatz aus der Eiszeit zeigten Menschendarstellungen dagegen über 28.000 Jahre lang zu 70 Prozent Frauen. Was war die Voraussetzung für diese souveränen und in sich ruhend wirkenden Frauenfiguren? Wie lebten die Menschen damals zusammen, um diese Kunst zu schaffen? Meine These ist, dass nur eine friedliche, egalitäre Kultur so selbstverständlich Frauenstatuetten produzieren kann.

Ulli Lust, Comickünstlerin
Was könnte das denn angesichts der weltpolitischen Lage für die Gegenwartskunst bedeuten?
Ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, aber es ist auch gut zu wissen – das führe ich im Buch aus –, dass wir qua Geburt eine starke soziale Komponente haben. Weil der Mensch ein riesiges Gehirn hat, müssen Menschenbabys auf die Welt kommen, bevor sie fertig entwickelt sind. Tiere werden geboren und können laufen, Menschen liegen erst einmal ewig rum, können nichts und müssen alles voneinander lernen. Das widerlegt den Mythos vom Menschenwolf, von unserer Urwüchsigkeit
und Triebhaftigkeit, die gewalttätig und egozentrisch ist.
Dieses Mammutprojekt überblickt Jahrtausende, aus denen es keinen Text und kaum Bilder gibt. Wie packt man so etwas ausgerechnet in einen Comic?
Ich wollte dem Klischee widersprechen, dass Frauen eher klein-klein machen, und ich wusste, was ich erzählen möchte: Es gab Neujustierungen in der archäologischen Forschung, die ich zusammenfassen und chronologisch aufdröseln wollte. Während des Zeichnens habe ich viel über die Lebensweise dieser Menschen gelernt. Plötzlich konnte ich mich in diese Gesellschaften besser einfühlen. Sie waren keine abstrakte, primitive Masse mehr, die sehr alt ist und lange Zeit unverändert geblieben ist.
Wie kamst du zu deinem Material?
Vieles habe ich von Researchgate. Wenn möglich, habe ich mir Originale in Museen angeschaut, weil diese in Wirklichkeit oft kleiner sind, als sie auf Fotos aussehen. Landschaften musste ich mir im Kopf zusammensetzen: Ich recherchierte Bilder aus Sibirien, Skandinavien, Alaska – eiskalten Gegenden eben – und orientierte mich auch an Landschaften mit wenig Bäumen, aber einem diversen Pflanzenbestand, wie zum Beispiel modernen Alpenwiesen. Während eines Forschungssemesters konnte ich mich in Südfrankreich mit dem Kolorieren beschäf-

tigen. Ich studierte die Ockerfelsen dort, weil Rot und Ocker zentral waren für das eiszeitliche Alltagsleben. Man findet seit mindestens 70.000 Jahren Reste von menschengemachter roter Farbe. Das Rot, das die Leute in der Eiszeit gesehen haben, ist allerdings, wenn wir es mit einem Kirschrot aus dem Malkasten vergleichen, eher ein Braun. Die Aufgabe war, sich einzufühlen in eine Farbwelt, in der es keine künstlichen Farben gibt.
Diese Art der künstlerischen Forschung überzeugt. Ist das Medium Comic vielleicht sogar besonders geeignet für deine Arbeit?
Ich hatte den Vorteil, dass ich damit vergangene Szenarios wieder auferstehen lassen konnte – und zwar günstiger als jeder Film. Außerdem war es hilfreich, Text und Bild parallel zu führen. Normalerweise muss man sich Bilder in Textbüchern immer mühsam vorstellen. Im künstlerischen Tun ergaben sich auch neue Erkenntnisse, das hatte etwas mit Instinkt zu tun. Ich denke, unsere Vorfahren haben das genauso empfunden. Die haben Dinge gesehen und verstanden, dass diese auch als Gleichnis für etwas anderes, Größeres dienen. Unsere Fähigkeit zum symbolischen Denken wird in Comics stimuliert. Sie liefern einerseits ein Szenario, etwas, das man als Welt entziffern kann. Und andererseits auch etwas, das wir symbolisch lesen, instinktiv.
Was hast du beim Nachzeichnen der ältesten Bilder der Menschheit gelernt?
Es ist faszinierend, diese selbst nachzufahren. Kleine Details bemerkt man erst,
wenn man sie zeichnen muss. Ich glaube zum Beispiel, dass die Frauenfiguren von Frauen gemacht wurden, vielleicht sogar Selbstporträts waren. Wenn ich selbst etwa erotische Comics zeichne, zeichne ich auch lieber die Frau als den Mann. Und wenn Männer diese Figuren gemacht hätten, hätten sie sie häufiger mit gespreizten Beinen gezeigt, denke ich.
Im Comic kommentierst du die verschiedenen Funde und Beobachtungen nicht. Vereinzelt kommst du aber als Figur vor. Welche Funktion hat es, dass wir dich sehen, wie du Forscherinnen über prähistorische Menstruation befragst?
Es ist wichtig, dass klar ist, wer aus welcher Perspektive erzählt. Ich bin weiblich, ich bin weiß, ich wurde in einer patriarchalen Gesellschaft sozialisiert. Ab und zu mache ich ein paar Scherze, bringe eine gewisse Leichtigkeit hinein. Aber letzten Endes geht es nicht um mich. Es gibt Comicbücher, in denen ein Erzähler als Figur auftritt, Dinge erklärt und mit einem Zeigestab visualisiert. Das wäre mir zu verschult.
Bereits der Titel deutet an, was du im Buch eindrücklich zeigst: Die Setzung des Männlichen als Norm ist eine neuzeitliche Erfindung. Ist dein Buch ein feministisches Projekt – auch wenn das Wort nie darin vorkommt?
Ich halte es für ein humanitäres Projekt. Natürlich erzähle ich aus einer weiblichen Perspektive, aus der Fassungslosigkeit heraus, wie man Geschichte bislang interpretiert hat. Es gab etwa auch geschlechtsfluide Menschen
»Es geht mir um die Darstellung egalitärer Gesellschaftssysteme und um das Ausbalancieren eines Übergewichts, einer männlichen Omnipotenz.«
— Ulli Lust
in der Eiszeit – das hat man lange nicht richtig gelesen. Aber eigentlich geht es mir um die Darstellung egalitärer Gesellschaftssysteme und um das Ausbalancieren eines Übergewichts, einer männlichen Omnipotenz.
Damit musst du immer noch gegen mächtige Dogmen der Wissenschaft anschreiben. Mein Glück ist, bereits Teil der nächsten Generation zu sein. Die Archäologin Marija Gimbutas wurde massiv angegriffen, weil es undenkbar war, dass Frauen eine nicht völlig untergeordnete Rolle in jeglicher Frühgesellschaft gehabt haben könnten. Sie und andere Forscherinnen wurden als naive Feministinnen und Fantastinnen dargestellt. Ich habe versucht, diesen Diskurs gar nicht zu führen. Es interessiert mich eigentlich nicht, ob mir jemand glaubt oder nicht. Außerdem bin ich sowieso eine Laienforscherin, komme aus der Kunst und kann meine Expertise über meine künstlerische Form einbringen.
Das Projekt ist »to be continued« – was kannst beziehungsweise möchtest du über Fortsetzungen verraten?
Während sich Teil eins mit Biologie und Evolution beschäftigt, geht es in Teil zwei um Mythologie und orale Literatur. Zum Glück bin ich bereits mit dem zweiten Teil fertig. Das heißt: Ich kann jetzt ganz cool und relaxed Interviews geben, weil ich schon weiß, wie es ausgeht.
Katharina Serles
»Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte« von Ulli Lust ist am 12. Februar 2025 bei Reprodukt erschienen.



Nach langer Tätigkeit als Journalistin stellt Amira Ben Saoud nun mit »Schweben« ihren ersten Roman vor.
Mit ihrem Erstling »Schweben« liefert die ehemalige The-Gap-Chefredakteurin Amira Ben Saoud eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Rollen und Identität in einer statischen Gesellschaft. Angesiedelt in einer dystopischen Zukunft, ist das Thema dennoch hochaktuell. ———— Im gesellschaftlichen Miteinander spielen wir alle unterschiedliche Rollen: als Tochter, als Mutter, als Arbeitskollegin. Rollen, die wiederum an Erwartungen geknüpft sind. Manchmal nehmen wir sie nicht einmal wahr, manchmal fallen sie uns regelrecht auf die Zehen. Oder wir werden uns ihrer erst bewusst, wenn uns jemand mit der Nase darauf stößt.
Zwei prägende Rollen im Leben von Amira Ben Saoud sind jene der Journalistin und jene der Autorin. Schon bevor sie meine Fragen kennt, trifft sie eine klare Unterscheidung: »Ich bin leider total mies bei spontanen Antworten – deswegen war ich auch so lange Journalistin, weil ich da nur Fragen stellen musste«, erklärt sie lachend. Dass sie durch diesen Rollenwechsel nun im direkten Blickpunkt steht und auch Verantwortung trägt, sei ihr bewusst.
Der Übergang von einer Rolle zur anderen fällt ihr jedoch nicht ganz so leicht, wie man vielleicht annehmen könnte – schließlich hätte ja beides irgendwie mit Schreiben zu tun, oder?
Doch Amira gesteht, dass es ihr manchmal noch schwerfalle, sich zu ihrem neuen Beruf zu bekennen: »Da sitze ich dann vier Stunden und überlege, ob ich lieber ›friemeln‹ oder ›nesteln‹ schreibe. Dass das auch eine Arbeit ist, geht noch nicht ganz in meinen Kopf rein.« Sie sei einfach mit einem anderen Bild von Arbeit sozialisiert worden, stellt sie abgeklärt fest. Damit gibt sie einen Einblick in eine Person, die nicht nur sich selbst, sondern auch die sozialen Strukturen um sich herum immer wieder hinterfragt. Weshalb es auch wenig überrascht, dass in ihrem Erstling Themen wie Rolle, Identität und Selbstwahrnehmung zentral sind –sowohl explizit als auch zwischen den Zeilen. Im Schwebezustand
Amira bezeichnet sich selbst gerne als »Autorin, die eigentlich nie geschrieben hat«. Doch wenn das Schmunzeln nicht deutlich mitgeklungen wäre, hätte sie sich kurz darauf selbst überführt. Viel eher mutet ihr Schreiben wie ein geheimnisvolles Projekt an, das schon früh seinen Anfang nahm. Denn nicht nur, dass sie schon als Kind gerne Welten erfand – sie habe auch immer etwas mit dem Schreiben machen wollen.
Nach dem Studium der klassischen Philologie führte sie ihr Interesse an Popkultur zu
The Gap, wo sie zunächst als Praktikantin begann und später zur Chefredakteurin aufstieg. »Es ist quasi einfach so passiert, ein bisschen.« Das Schulterzucken ist fast hörbar und lässt wie Zufall wirken, was dann doch viel mit Talent zu tun gehabt haben muss.
Nicht mehr Erklärbär
Sie sei immer gerne Journalistin gewesen, betont Amira, was unter anderem ihre fünf Jahre als Kulturredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard belegen. Die Anforderungen dieses Berufs – geprägt von überbordendem Effizienzzwang, sich plötzlich ergebenden Fristen und ständigem Zeitdruck – hätten aber doch nicht ganz zu ihrem Naturell gepasst. »Schweben« habe dann ab 2019 als starker Kontrast zum beruflichen Alltag gedient und sei als »super ineffizientes« Projekt entstanden, bei dem sie sich »über alles
Lage, in der die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten sei. So viele Menschen würden tagtäglich so vieles hinnehmen oder sich gar nicht richtig bewusst sein, »wo wir da halt einfach hineinlaufen, sehenden Auges«.
Es überrascht daher wenig, dass in ihrem Roman ausgerechnet eine Frau für die Aufgabe, verlorene zwischenmenschliche Beziehungen zu ersetzen, »gekauft« werden kann. Und obwohl – oder gerade weil – die Hauptfigur einen eigenen Geschäftszweig entwickelt, indem sie Menschen nachahmt, werde sie zum Spiegelbild jener Frauen, die glauben, Handlungsmacht zu besitzen, dabei aber unbewusst patriarchalen Mustern folgen, wie die Autorin meint.
Während des Schreibens sei ihr zudem bewusst geworden, wie Projektionen auch in ihr selbst wirken. Insbesondere, als in diesem Film, der sich ständig in ihrem Kopf abspielte,
»Menschen sollen sich fragen: ›Woher kommen eigentlich diese Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt?«
— Amira Ben Saoud
Tausende Gedanken gemacht« habe. Die Rolle der Autorin einzunehmen, bedeute für Amira ein bewusstes Heraustreten aus dem journalistischen »Erklärbär-Modus«, wie sie es selbst nennt. Sie erzählt dort atmosphärisch und dicht, manchmal plakativ, manchmal zwischen den Zeilen, oft auch gewollt offenbleibend.
»Schweben« ist eine Dystopie, die in einer abgeschotteten Siedlung spielt. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die ihren eigenen Namen nicht kennt und sich darauf spezialisiert hat, gegen Geld verlorene Bezugspersonen zu ersetzen – eine surreal anmutende Aufgabe, eingebettet in eine Welt, die durchaus auch die unsere sein könnte. Denn nicht nur die dort bereits unkontrolliert eskalierte Klimakrise, sondern auch das Festhalten der Menschen an Gewohntem scheint eine Parallele zur heutigen Zeit zu sein.
Amira sieht unsere Gesellschaft als zu statisch. Mit ernstem Blick äußert sie Besorgnis und Unverständnis gegenüber der aktuellen
alle Figuren ihrer futuristischen Gesellschaft unerwartet weiß gewesen seien. »Dabei müssten sie das gar nicht sein«, betont Amira Ben Saoud nachdrücklich.
Als es dann darum geht, ob sie genau das – nämlich Impulse zur Reflexion – vermitteln möchte, kann sie endlich wieder schmunzeln. Obwohl sie das Wort »vermitteln« nicht besonders mag, sagt Amira, dass sie es »schon schön fände, wenn Menschen, die das lesen, sich vielleicht fragen: ›Woher kommen eigentlich diese Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt?‹« Und so wird ihr Debütroman zu einer Einladung, über die eigenen Rollen und Strukturen im Alltag nachzudenken. Vielleicht auch über solche, die vermeintlich selbst gewählt wurden – oder vielleicht doch nicht ganz? Barbara Pfeifer
Der Roman »Schweben« von Amira Ben Saoud erscheint am 18. März 2025 im Zsolnay Verlag und wird noch am selben Tag im Wien Museum präsentiert.
Ende Februar feiert Rainhard Fendrich seinen 70. Geburtstag. Ob als prägende Figur der heimischen Musikszene, Moderator von »Herzblatt«, Schauspieler oder Person des öffentlichen Leb ens – seit den 1980er-Jahren ist er konstant präsent und bewegt sich dabei oft an der spannenden Schnittstelle zwischen nationalem Heldentum, Vereinnahmung und Polarisierung. Bei The Gap möchten wir dieses Jubiläum entsprechend würdigen und baten Kulturschaffende, zu Fendrich Stellung zu beziehen.

Musiker
Lieber Rainhard F., wir sind einander noch nie begegnet, und doch läufst du mir schon mein ganzes Leben lang über’n Weg. Erst letztens hat meine Mutter zu mir gesagt: »Weißt du eigentlich, dass du als Kleinkind durchgehend das Album ›Voller Mond‹ mit uns gehört hast? Das lief in Dauerschleife, und du hast immer bei ›Der Wind‹ mitgesummt.« Musikalische Früherziehung nennt man das vielleicht – und mit deinem schönsten Album zu beginnen, ist wohl ein guter erster Schritt in deine Welt. »Mit 15 ist die Zeit, wo’s alle ehrlich manen«, das stand mir damals alles noch bevor, ich war gerade zwei geworden.
In meiner Umgebung gibt es ein paar Leute, die behaupten, du hast nur zwei, drei gute Songs, und der Rest ist inhaltsarme Kommerzmusik. A Bledsinn … Wenn diese Leute dich zufällig im Radio hören, kommen sie dann doch nicht drum rum, deinen Kommerzsong
auswendig mitzusingen. Da kann man machen, was man will. Ich habe auch erst später herausgefunden, wie hintergründig vieles ist, wie poetisch, mit deinem ganz eigenen Blick auf das Leben und die Welt. Neben »Malibu« und »Tränen trocknen schnell«, die Wiener Welthits sind, beeindrucken mich immer wieder diese Songs von dir, die fast zu gut versteckt auf Alben schlummern. Die erst geweckt werden müssen. »Der Drachen« auf »Blond«; oder das Fußballlied auf »Brüder«; oder »A jeder is zum hab’n«. Leiwande Scheiben. Ich würde gerne »Zwischen eins und vier« covern, aber trau mich kaum. Auch wenn ich Wien schon bei Nacht gesehen hab. Dafür haben wir in der Schule immer »Razzia« gesungen. Gustav ans an Gustav zwa. Und »Strada del Sole« ist seit Jahren ein Fixpunkt bei meinen Soundchecks. Mein Lieblingslied bleibt aber seit etwa 35 Jahren »Der Wind«. Treibt mich an und passt in meine Welt. Wenn das kein Beweis ist.
Vielleicht lebst du auch in deiner Welt, und du nimmst offenbar viel wahr um dich herum and beyond. Stay focused! Ich wünsche dir, lieber R. Fendrich, alles Gute zum 70. Geburtstag. Das neue Album werde ich durchhören.
Respect, Nino (aus Wien)
PS: Ich habe in der Zeit gelesen, dass du in Favoriten wohnst. Wer weiß, vielleicht sind wir fast Nachbarn.
Der Nino aus Wien alias Nino Mandl ist einer der umtriebigsten Musikschaffenden des Landes. Zuletzt erschienen: »Endlich Wienerlieder« (2024).

Rahel
Musikerin
»Hallo Rahel, magst du einen Text zu Rainhard Fendrich schreiben?« – »Nein«, denke ich, denn meine Sozialisierung hatte mehr mit Trommelkreisen als mit der österreichischen Leitkultur zu tun. Doch dann will ich es wissen: Wer ist diese rätselhafte Feen-drichGestalt? So, gleich singt mir der Rainhard ins Ohr: »Vor mir is jede kniat, i hab’s bei ana jeden bracht, hab no aus alle Hofratstöchterl Schlampen g’macht.«
Mir wird klar, warum die zeitgenössischen Feen-driche und Falcos immer noch so viel Aufmerksamkeit genießen. Viele aktuelle Männerstars sind Teil einer langen österreichischen Macho-Macho-Tradition. Der Danzer sang: »I hob scho haufnweis de Hasn übas Glanda bogn. Da kenn i nix, und überhaupt, de woins jo so. Zerscht tuan sa se no ziern und mochn an auf zimperlich und nachher schreibns mein Namen do aufs Damenklo.«
Ein bisserl früher dichtete der Kreisler ein lustiges Femizidlied: »Lola mit den Engelsminen legt’ ich auf die D-Zugschienen. Lilli, Lene und Marianne starben in der Badewanne.« Und auch der Falco hatte seine »künstlerische« Mordfantasie.
Die breitentaugliche wienerische Männermusik kokettiert seit jeher mit dem Strizzi, der halt nicht anders kann: Der Strizzi liebt den Rausch und die Macht und benutzt die Frau entweder als Zeitvertreib oder als Vergewaltigungsobjekt. »Strizzi«, so nannte man in Wien Zuhälter (»strýc« aus dem Tschechischen: Onkel), und bis heute gilt das Wort als Bezeichnung für kleine Buben. Spreche ich hier am Ende also nur von (Fendrichs) Jugendsünden?! Macho Machos sterben jedenfalls ned aus.
Rahel macht Musik, die zwar nach Austropop, aber definitiv nicht nach Fendrich klingt. 2024 veröffentlichte sie ihr Debütalbum »Miniano«.

Stefan Niederwieser Musikjournalist
1989 weht ein »Wind of Change« durch Europa. Sogar durch Österreich. Die 80er-Jahre hatten es in sich: AKH-Skandal, Weinskandal, illegale Waffenlieferungen, Versicherungsbetrug inklusive Sechsfachmord und die Waldheim-Affäre. Kurt Waldheim wurde 1986 trotz seiner möglichen Beteiligung an Kriegsverbrechen der Wehrmacht zum Präsidenten von Österreich gewählt. Das Land steht etwas braun und in der Welt reichlich isoliert da. In dieser Atmosphäre schreibt Rainhard Fendrich in seinem Haus im fernen Florida »I Am from Austria«. Zweimal blitzt im Text Kritik an diesem Österreich auf, dann aber wird man von einem Sturzbach der Gefühle mitgenommen, dessen man sich nicht erwehren kann. Der Song wird politisch vereinnahmt.
Und Fendrich muss immer wieder klar machen, dass er für Toleranz und Menschlichkeit einsteht. In seinem Song ist Österreich nicht einfach nur eine Fahne, eine Hymne oder ein Punschkrapferl. Österreich ist auch eine Katastrophe. Aber die Sehnsucht bleibt unüberwindbar. In genau dieser Ambivalenz gibt es kaum eine bessere klandestine Bundeshymne.
Stefan Niederwieser war von 2011 bis 2016 Chefredakteur von The Gap. Er gestaltet den Podcast »100 Songs – Geschichte wird gemacht« für Ö1, Co-Host ist Robert Stadlober.

Barbara Kaufmann
Filmemacherin
Mein Jahr mit Andrea Depression ist Leben im Zwischenzustand. Man ist wach, kann aber nicht aufstehen. Man ist müde, schläft jedoch nicht. 2003 war so ein Jahr in meinem Leben. »Depressive Episode« klingt nach einer kurzen Zeit. Nach einer Serienfolge. Es wurde eine ganze Staffel. Ich lag viel. Am Sofa, im Bett, im Krankenhaus. Und ich las viele Promimagazine. Niemals wieder war mein Interesse am Leben anderer so groß wie damals, als ich selbst keines hatte.
Irgendwann war sie plötzlich da: Andrea Fendrich. Laut, direkt, wütend. Eine Frau, die von ihrem Mann verlassen worden war. Die sich offenbar jahrelang um seine Karriere und seine Kinder gekümmert hatte. Die alles im Griff zu haben schien. Und nun mit Fragen bombardiert wurde, die einfach unwürdig waren. Zu ihren angeblichen Affären. Dazu, »kalt und berechnend« zu sein. Ich gewöhnte mich an Andrea Fendrich. An die wöchentlichen Geschichten, an ihr lautes Lachen, an ihre Bestimmtheit.
Ich glaube heute, ich identifizierte mich mit ihr, diesem Gefühl, zur Seite geräumt zu werden, einfach so. Irgendwann nach diesem Jahr erholte ich mich von der Depression und mit ihr verschwand auch mein Interesse an Andrea Fendrich. So untreu ist die depressive Promimagazin-Leserin. Wenn sie wieder selbst ein Leben hat, braucht sie das der anderen nicht mehr.
Vor Kurzem habe ich sie gegoogelt. Es geht ihr gut und sie kann »den Rainhard jederzeit anrufen«. Wenn sie will. Es ist also auch für sie gut ausgegangen. Hoffentlich.
Barbara Kaufmann ist Filmemacherin und Autorin. 2023 veröffentlichte sie ihren ersten abendfüllenden Dokumentarfilm »Juli«, in dem sie sich der Geschichte ihrer Uroma annähert.

Drehli Robnik
Filmwissenschaftler
Ich sah ihn zum einzigen Mal live bei einer »Star-Gala« 1982 in der Wiener Stadthalle. Ich war wegen Blümchen Blau und vor allem Chuzpe dort (zu jung, um sie an hipperen Orten zu sehen).
Fendrich spielte, so erinnere ich mich, in Strickweste solo mit Klampfe, etwa »Kommune« oder »Razzia« mit der Hook »Gustav ans an Gustav zwa«. Von einer Kommune hatte ich vage Vorstellungen, aber Polizei-Schmählieder auf Deutsch waren mir vertraut, weil damals verbreitet, auch im Ö3-Zielgebiet: Falcos »Kommissar«, Extrabreits »Polizisten«, viel besser Drahdiwaberls »Supersheriff« und abseitiger »Scheiß Polizei« vom Hotel Morphila Orchester rund um Peter Weibel.
Die genannten Fendrich-Stücke im Protestsong-Nachgang variierten eine brachialironische Konstruktion: Die Intonation und der Jargon jeweils gedisster Personen(kreise) werden in direkter Rede performt – Empörung der Eltern, deren Kind in eine Kommune zieht; Ressentiment und Gewalt bei der Polizei; obsessiver Auto-Fetischismus (»Zweierbeziehung«). Das wird dabei auf- und vorgeführt.
Beim Debüthit »Strada del Sole« allerdings trat das Vorführen austro-xenophober Italienerklischees (»Katzelmacher«-Memes) in den Hintergrund zugunsten ihrer Klospruch-Reenactment- und Mitgröl-Potenziale: »Dem hau i die Zähnt ei’!« (aus maskuliner Potenzpanik), »Auf Italien pfeif’ i«. Biedere Ironie als Freibrief: Im Hitformat, im Lokalkulturkanon erlaubt sie das, lädt ein zum Schimpfen auf orientalisierte »Gfrieser«. Es folgte Heimatstolz-schmettern-Dürfen im Balladentarnmantel der Kleinbürgergrübelei, dienlich als polizeiliches Beschallungstool zu Pandemiebeginn. In so many words: nein.
Drehli Robnik lehrt nicht nur an der Uni und schreibt (wissenschaftliche) Bücher, er legt unter anderem auch regelmäßig bei der Sonntag’sdisco im Flucc auf.

Zum Fendrich fällt mir als Erstes ein, dass mir einmal eine Person, die kein Fan von meinen Queen-Austropop-Variationen gewesen sein dürfte, in mein früheres Homepage-Gästebuch geschrieben hat: »Shame on you, Austrofred, der Rainhard Fendrich würde sich im Grab umdrehen!« Darüber muss ich heute noch lachen.
Gott sei Dank ist der Fendrich nicht tot, auch wenn das seinem Leumund nicht schaden täte, wenn man dem alten In-Wienmusst-erst-sterben-et-cetera-Bonmot vom Falco Glauben schenken will, weil mir kommt vor, er hat in der jungen Pop-Generation kein rechtes Standing. Wieso, kann ich mir nicht wirklich erklären.
Klar, er war ein bisschen zu spät dran für die innovative erste Austropop-Phase und ist gleich in die uncoole eingestiegen, was aber die konkrete Qualität gerade seines Frühwerks keineswegs schmälert. Anfang der 90er war er dann ein bisschen gar allgegenwärtig, mit »Millionenshow« und »Herzblatt« und romantischen Komödien und weiß der Teufel was; so einem gönnen viele einen Dämpfer, den er sich kokstechnisch gleich selbst besorgt hat. Nüchtern betrachtet hat er aber sicherlich fünf oder mehr Nummern, für die ich persönlich mir einen Finger abhacken täte. Tu ich natürlich nicht, sonst halten mich alle für einen Tischler.
Besonders hervorheben möchte ich seine Gabe im Finden von exaltierten Reimwörtern und im gesanglichen Verschleifen derselben, sodass sie ganz nonchalant wirken. Eine Disziplin, in der ihm maximal der Spitzer von der EAV das Wasser reichen kann. Hörempfehlung dazu: »Ich bin ein Negerant, Madame«.
Der Austrofred ist für seine Austropop-Veredelungen von Queen-Hits bekannt. Außerdem hat er schon das eine oder andere Buch geschrieben. Zuletzt: »Gänsehaut – Unerklärliche Phänomene erklärt«.

Schwarz
Musikmanager
Mitte der 70er-Jahre begann ich, in der Musikbranche in unterschiedlichen Bereichen sowohl bei Plattenfirmen als auch bei Künstlern zu arbeiten, bis ich 1989 Verlag und Management von Georg Danzer übernahm.
Es war 1980, als ich Rainhard Fendrich erstmals getroffen habe. Er saß anlässlich der Promotion für sein Album »Ich wollte nie einer von denen sein« mit seinem Manager in der Kantine des Funkhauses in Wien und wartete auf einen Interviewtermin. Danach sahen wir uns viele Jahre lang nur gelegentlich bei diversen Branchenveranstaltungen.
Erst 1997, als Rainhard die Idee zu einem Benefizkonzert für Obdachlose in Wien hatte und daraus die legendäre Formation Austria 3 entstand, lernten wir uns näher kennen. Nach dem viel zu frühen Tod von Georg, der mir zuvor offenbar noch »die Rutsch’n« gelegt hatte, wurde ich Rainhards Tourmanager. In den fast 20 Jahren unserer Bekannt- und auch Freundschaft konnte ich ihn von unterschiedlichen Seiten kennenlernen.
Erstens: als den großartigen Songschreiber und humorvollen Interpreten, was besonders bei den zahlreichen Konzerten von Austria 3 zutage trat. Die spontanen Moderationen der drei Protagonisten riefen immer wieder Lachsalven des Publikums hervor.
Zweitens: als einen großzügigen Chef und Gastgeber. Nach erfolgreichen Tourneen lud Rainhard meistens alle seine Musiker und die Crew zu einem von ihm so genannten »Erntedankfest« ein. Auch während der Konzertreisen in den gemeinsamen sieben Jahren sorgte er immer wieder – sogar an spielfreien Tagen – für das Wohl seiner Mitstreiter. Die Zusammenarbeit war zwar nicht immer einfach, die entstandenen Konflikte konnten allerdings meistens rasch aus dem Weg geräumt werden.
Drittens: …
Franz Christian »Blacky« Schwarz ist seit 1977 in der Musikbranche tätig, unter anderem als Manager von Georg Danzer. 2021 gab er den Gedenkband »Georg Danzer. Sonne und Mond« mit heraus.
Erfand den Kapuzenpulli, wie wir ihn heute kennen: Champion
Hoodies sind ein zeitloser Alltagsgegenstand, über den man scheinbar nicht groß nachdenken muss. Ein simples Design, das jedoch einer Fülle von Verwendungszwecken dienen kann – von Sportswear über Workwear und Streetwear bis hin zu High Fashion.
Begonnen hat die Geschichte von Oberbekleidung mit Kapuze spätestens im antiken Rom, als Männer eine Falte ihrer Toga als temporäre Kopfbedeckung nutzten. Im Mittelalter erfreute sich dann die sogenannte Gugel großer Beliebtheit – ein kurzer Überwurf mit Kapuze. Der Name des Bettelordens Kapuziner aus dem 16. Jahrhundert leitet sich gar von der markanten Kapuze ihrer Kleidung ab. Und Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert legen nahe, dass feine Damen ihre Kapuzen auf dem Weg zu einer geheimen Liebschaft mitunter tief ins Gesicht zogen.
Der Kapuzenpullover, wie wir ihn heute kennen, tauchte allerdings erstmals in den 1930er-Jahren auf und wurde von der Knickerbocker Knitting Company hergestellt – bald darauf bekannt als Champion Knitting Mills aka Champion. Die wesentlichen Elemente des Hoodies haben sich seit damals kaum verändert: ein langärmliges Oberteil aus dickem Baumwolljersey, an dem eine Kopfbedeckung befestigt ist, die sich mit zwei Kordelzügen zusammenziehen lässt; optional mit Kängurutasche am Bauch und Bündchen an Ärmeln und der Taille.
Nicht mehr nur Sportswear
Ein praktisches wie komfortables Design, das ursprünglich dafür gedacht war Athlet*innen vor, während und nach Wettkämpfen warm zu halten. Wegen ebendieser Eigenschaft wurde der Hoodie auch rasch von Arbeiter*innen übernommen, war plötzlich nicht mehr nur Sports-, sondern auch Workwear. Immer mehr Hersteller*innen sprangen auf den Zug auf und produzierten eigene Hoodies.
In den 1960ern verbreitete sich das Kleidungsstück rasant, als Highschool-Schüler*innen und CollegeStudent*innen Kapuzenpullis als Uniform trugen und damit ihre Ausbildungsstätten repräsentierten. Bis heute sind klassische College-Designs eine der beliebtesten Varianten
von Hoodies. In den 70ern und 80ern wurden Hoodies dann von den neu aufkommenden Jugendkulturen entdeckt und durch Skater*innen, Breaker*innen und Graffitikünstler*innen zur das Stadtbild prägenden Streetwear. Als in den 90ern der Hype um Streetwear explodierte, wurde der Kapuzenpullover zum absoluten Must-have und Kultgegenstand – besonders mit überdimensioniertem Logoprint.
Fixplatz in der Modegeschichte
Das ikonische Flammenlogo auf Thrasher-Pullis oder die Full Zippers von A Bathing Ape wurden zu Designklassikern und sicherten sich ihren fixen Platz in der jüngeren Modegeschichte. Es dauerte nicht lange und Hoodies fanden Einzug in die Kollektionen von Luxusmarken wie Lanvin, Givenchy und Co. Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung, als Louis Vuitton mit Supreme kollaborierte und sie gemeinsam einen All-Over-Box-Logo-Sweater kreierten, der ursprünglich an die 1.000 Euro kostete, auf dem Zweitmarkt allerdings zeitweise über 10.000 Euro einbrachte. Hoodies sind fixe Bestandteile unserer Garderoben und zeigen dabei auch, wie stark sich die Konnotationen einzelner Kleidungsstücke verändern können: Heute tragen Bodyguards zweiteilige Anzüge, während die tatsächlich mächtige Person T-Shirt, Jeans und Hoodie trägt –siehe etwa Mark Zuckerberg.
Du hast deinen Lieblingshoodie noch nicht gefunden oder suchst einen weiteren? Entdecke jetzt unter www.zalando.at zahlreiche Modelle von Marken wie Champion, Fila, Vans, Billabong und mehr. presented by
01:38 00:33
Streaming hat nicht nur unseren Musikkonsum verändert, sondern beeinflusst auch maßgeblich das (Über-)Leben von Musiker*innen. So festgefahren diese neuen Strukturen bereits scheinen, möchten sie doch hinterfragt werden. Ganz nach dem britischen Songwriter und Producer James Blake: »Wollt ihr gute Musik oder das, wofür ihr bezahlt habt? Wenn wir hochwertige Musik wollen, muss jemand dafür bezahlen.« ———— Der Jahresrückblick der Streamingdienste – gleich ob Wrapped oder Replay – liegt schon wieder eine Zeit zurück. Bei mir trafen sich diesmal Charlie XCX, Mark Lanegan und Amyl and the Sniffers in den Top-Platzierungen. Ein kleines Fenster ins eigene Hörverhalten, das immer mit etwas Selbstüberwachung verbunden ist. Der Philosoph Michel Foucault hätte seine Freude mit diesen farbenfrohen Datenbündeln gehabt. Stichwort: Panoptikum.
Doch ungeachtet dieses jährlichen Rituals gab es zuletzt eine wichtige Neuerung

in der Streamingwelt – verbunden mit einem viel zu kleinen Aufbegehren: das Konzept der »Streamshares«. Davor konnten Künstler*innen nämlich mit einem Betrag irgendwo zwischen 0,002 und 0,01 Cent pro Play rechnen. Lächerlich wenig angesichts dreistelliger Millionenumsätze der Anbieter*innen sowie der Tatsache, dass die
Auszahlungen meistens noch mit Label und/ oder Produzent*innen geteilt werden müssen. Doch dank Streamshares fließt das Geld nun in einen großen Topf, aus dem nach dem Anteil an den Gesamtstreams ausgezahlt wird. Nicht nur für recherchierende Journalist*innen ist das nun schwieriger nachzuvollziehen.
Die aus Linz stammende Newcomerin Kleinabaoho hat 2023 ihren ersten Song veröffentlicht. Im Gespräch, erzählt sie, dass sie das Streaminggeld bisher gar nicht zähle: »Kleine Acts sind abhängig davon, eine Plattform zu haben, wo sie irgendwie gefunden werden können. Manchmal denke ich dann, dass ich meine Musik so wenigstens überhaupt präsentieren kann. Aber das ist eine unfaire Besser-als-nix-Mentalität.«
Unter 1.000 Streams innerhalb von einem Jahr gibt es bei Spotify übrigens gar kein Geld. Die Aussage, ob gewollt oder nicht: Deine Musik ist unter dieser Hörer*innenzahl nichts wert.
Die Non-Profit-Organisation Recording Fund bewog diese Neuerung zu einer dramatischen Aussage: »Spotify ist jetzt im Endeffekt Richter, Jury und Henker von Musik.« Was früher hauptsächlich Gatekeeper wie Radiosender und Redakteure (das gendere ich mal absichtlich nicht) waren, ist heute der ominöse Algorithmus der Streamingdienste, den anscheinend niemand wirklich versteht – egal, ob Künstler*in oder Hörer*in. Mit Absicht, so die Autor*innen des Buchs »Spotify Teardown«, denn dahinter stehe ein Eigeninteresse. Die uneinsichtige »Blackbox« halte Machtverhältnisse aufrecht: Wer nicht weiß, wie es funktioniert, tut sich auch schwer, es zu kritisieren.
Gleichzeitig wird durch einzelne Erfolgsgeschichten das Narrativ vom American Dream am Laufen gehalten. Wenn es immer wieder ein paar wenige Glückliche gibt, kann man sie als Beweis verkaufen, dass das gesamte System ja doch funktioniere. Damit spielt auch der Außenauftritt vieler Streamingservices, die sich gerne als wohlwollende Mäzen*innen präsentieren.
Leave Me Alone, Taylor!
Nicht nur das Leben von Künstler*innen hat sich durch Streaming verändert, auch wir haben unser Hörverhalten schon längst dem steigenden Angebot angepasst. Durch Apps wie Tiktok werden beliebte Songs kürzer, ver-
»Kleine Acts sind abhängig davon, eine Plattform zu haben, wo sie irgendwie gefunden werden können.« — Kleinabaoho
chenzeitung Der Freitag ähnliche Schlüsse: »Seltsamerweise erleben wir eine immer gleichförmigere Musiklandschaft, in der der Geschmack in einer Feedbackschleife gefangen ist, die der Algorithmus selbst geschaffen hat.« Bestätigt wird diese Annahme von der der Studie »Does Spotify Create Attachment?«. In dieser wurde festgestellt, dass Musik, die Menschen über algorithmisch generierte Playlists hören, bei ihnen kaum einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Selbst wenn diese bekennende Musikfans sind. Es fehle der Kontext zur Musik, Songs würden eher beiläufig konsumiert, als auf bedeutsame Weise wahrgenommen zu werden, lautet eine Schlussfolgerung. Was sich letztlich gerade auf Musiker*innen negativ auswirkt, die auf involvierte Fans angewiesen sind. Der Mythos, dass man über Playlists und Streaming entdeckt werden könne, scheint damit teilweise widerlegt.
Wer keine Lust auf unsichere Ergebnisse (und genug Budget) hat, kauft sich laut Recherchen von Investigativjournalist*innen des Y-Kollektivs sowieso einfach Plays. Ein anonymer Interviewpartner behauptet, die damals fünf erfolgreichsten Rapper so in die Charts gepusht zu haben. Das sei total verbreitet und einfach, erklärt er: »Auch wenn sie (Anm.: die Künstler*innen) selbst es nicht wissen, ihre Manager wissen es.« Das sei nicht nur unethisch und verzerre Charts, so das Resümee der Reportage, sondern es berge auch Gefahren wie Geldwäsche.
Warum aber Zahlen faken, wenn es ohnehin kaum Bezahlung dafür gibt? Kleinabaoho kennt das Phänomen und habe selbst schon fragwürdige Angebote ausgeschlagen. Dennoch verstehe sie die Motivation dahinter: »Auch wenn man es nicht wahrhaben will, sind Zahlen vor allem für den Industrieteil der Musik wichtig. Du hättest mich vielleicht nicht zum Interview eingeladen, wenn ich nur 300 Hörer*innen hätte. Man vergleicht sich leider auch untereinander anhand von Streamingzahlen. Dabei bringt das gar nichts, denn Fake Hörer*innen kommen zu keinem Konzert.«
Liebe zum Detail
zichten auf Intro und Outro, setzen dafür aber auf häufige Wiederholung. Letzteres gilt auch für die Empfehlungen des Algorithmus: Egal, wie oft ich Taylor Swift noch wegklicke, sie lässt mich einfach nicht in Ruhe.
Rebecca Nicholson zieht in ihrem Artikel »Haben wir langsam alle den gleichen Musikgeschmack?« in der deutschen Wo -
Dass wir heutzutage für wenige Euros im Monat uneingeschränkt Musik hören können, hat seine Vorteile. Und dennoch zerstört die Nachfrage nach diesem Angebot das Produkt selbst – vor allem Independent-Projekte, die auf langfristige Entwicklung setzen. Jamal Hachem von Affine Records wünscht sich im Interview mit der Organisation Music
Austria einen neuen Kollektivismus, um sich von großen Streamingmonopolen zu emanzipieren. Ein Lösungsvorschlag, der utopisch klingt, aber vielleicht nicht unmöglich wäre. In der Arte-Doku »Wie Streaming die Musik auffraß« heißt es, dass wir seit Erfindung des MP3-Formats und damit verbundener Musikdistribution (ob legal oder illegal) in einer »Ära des Überflusses« leben, im Kontrast zur vorherigen »Ära der Raritäten«. Selbst vergriffene alte Platten findet man oft digital auf Apple Music & Co. Dabei hätten doch vor allem wir Hipster so gerne wieder Raritäten – ob alte Designermöbel, Echtle -
»Fake-Hörer*innen kommen zu keinem Konzert.«
— Kleinabaoho
derboots oder eben eine Plattensammlung. Ein Vorschlag: gerne Lana-Del-Rey- oder Bilderbuch-Alben auf High-End-Vinyl kaufen, aber dann trotzdem auch mal ein wirklich rares Kunstwerk erstehen. Nämlich die Arbeit von kleinen lokalen Musiker*innen, deren Herz in diesen 500 Kopien steckt und deren Konzert letzte Woche doch eigentlich cool war. Dann kann ich auch versprechen, dass das eigene Wohnzimmerregal aussehen wird wie kein anderes. Und wenn das Geld dafür zu knapp ist, zählt ein Mixtape – notfalls auch digital – noch immer zu den romantischsten Gesten, die es gibt. Da sind Kleinabaoho und ich uns einig. Eine musikalische Reise, die ganz ohne Algorithmus auskommt. Lara Cortellini
Kleinabaoho hat letztes Jahr ihre DebütEP »Bilder« veröffentlicht. Kürzlich kam ihr neuester Song »Verlierer« heraus. Viele lokale Künstler*innen verkaufen physische Tonträger auf ihren Konzerten oder über Anbieter wie Bandcamp.
Dieser Text ist im Rahmen des The-GapNachwuchspreises für Musikjournalismus in Kooperation mit dem Festival Waves Vienna entstanden.

Dieses Rendering zeigt, wie das Foto Arsenal Wien einmal aussehen soll.
Am Gelände des Arsenals entsteht unter der Leitung von Felix Hoffmann das Foto Arsenal Wien – ein Ausstellungshaus für Fotografie und Lens-Based Media. Mit Eröffnungswochenende, Festivals und verschiedenen Bildungsangeboten scharrt so einiges in den Startlöchern. The Gap hat Felix Hoffmann, den künstlerischen Leiter des Hauses, getroffen. Ein Gespräch über Bildmanipulation, Fotografie als kulturelle Praxis und darüber, wie man Menschen ohne besondere Kunstaffinität erreicht. ———— Für unser Gespräch an einem Dienstagvormittag treffe ich Felix Hoffmann noch nicht in sei-
nen neuen Räumlichkeiten im dritten Bezirk, hinter dem Hauptbahnhof. Dort wird nämlich noch umgebaut. Stattdessen treffen wir uns in jenen Räumen im Museumsquartier, die das Foto Arsenal Wien für ein Jahr zu Übergangszwecken nutzte. Eine Wand im Büro ist mit Fotos und Zeitungsausschnitten beklebt. Mir fällt Che Guevara mit seiner übergroßen Zigarre auf, an einer anderen Stelle hängen Fotos von der Baustelle im Arsenal. Sobald diese im Frühjahr fertiggestellt ist, werden Hoffmann und sein Team die frisch renovierten rund 700 Quadratmeter beziehen.
Was ist das Foto Arsenal Wien und wie verortet es sich in der Wiener Fotografieszene?
felix hoffmann: Das Foto Arsenal Wien will Verstärker und Generator sein. Wir wollen Orte zugänglich machen, an die man nicht so leicht rankommt – wie mit unseren Pop-upEvents unter dem Titel »In Transition«. Und überdies institutionell Brücken zu anderen Einrichtungen, Galerien und Räumen bauen. Wir sind ein reines Wechselausstellungshaus, das heißt: Alles, was kommt, geht auch wieder. Keine eigene Sammlung zu haben, gibt
»Fotografie kann ein Trittbrett sein, das Leuten ermöglicht, in eine Welt der Kunst und Kultur einzusteigen.«
— Felix Hoffmann
uns leichteres Gepäck. Mein großer Wunsch ist es, Sachen sichtbar zu machen sowie zu Kooperationen und Interaktionen anzuregen.
Wie richtet sich das Foto Arsenal Wien programmatisch aus?
Wir wollen internationales Programm anbieten, das sich immer wieder lokal und national über verschiedene Ausstellungstätigkeiten rückbindet. Das sieht man vor allem an unseren Festivals: Gemeinsam mit der Kunsthalle Wien veranstalten wir Vienna Digital Cultures, das diesen Frühling stattfindet. Dort setzen wir uns mit gegenwärtigen Fragen der Fotografie auseinander und beleuchten die Schnittstelle von Medien und zeitgenössischer Kunst. Im Oktober veranstalten wir die Foto Wien, ein Festival, das sich auch mit traditionellen Fragen der Fotografie auseinandersetzt und dieses Jahr den Verbindungen von Fotografie und KI nachgeht. Das ist der Versuch, in einer Institution beides zu implementieren: die Welt der Fotografie und gleichzeitig digital immersive Welten.
In Wien konzentriert sich die Fotografieszene auf den siebten Bezirk rund um die Westbahnstraße. Das Foto Arsenal Wien zieht jetzt auf das zentrumsfernere Arsenalgelände. Wieso lokalisiert man sich so weit weg vom Schuss?
Man kann das mit einem Satz beantworten: Das war nicht meine Entscheidung. Ich kann aber die politische Wahl des Standorts gut nachvollziehen. Es geht darum, die Stadt dezentraler zu denken und die bestehenden Hotspots der Fotografie bewusst nicht noch mehr zu stärken. Zudem gibt es im Arsenal bereits verschiedene andere Player: das Heeresgeschichtliche Museum, das Belvedere 21 – und in unser Gebäude zieht das Filmmuseum Lab mit ein. Das Arsenal, eine ehemalige Kaserne mit viel Grünfläche, funktioniert wie ein kleines Dorf. Dort wollen wir neue Impulse setzen.
Wen wünscht sich das Foto Arsenal Wien als Zielpublikum?
Unser Zielpublikum ist tendenziell jung und divers. Jetzt kommen wir aber in Bezirke, in denen es andere bildungstechnische, historische oder kulturelle Strukturen gibt. Die Leute gehen vielleicht lieber zum Fußball statt in eine Ausstellung. Und da stellt sich die Frage: Wie kommt man an solche Gruppen, die nie ein Ausstellungshaus besuchen? Das ist eine der wesentlichen Herausforderungen. Das Medium Fotografie bietet hier viele Möglichkeiten, weil es nicht nur Kunstform,
sondern auch eine breite, gesellschaftliche, kulturelle Praxis ist. Fotografie gibt es in Fotoalben zu Hause, in unseren Computern, sie kommt in der Mode, in der Werbung, im Fotojournalismus vor und ist mit der täglichen Handyfotografie über Social-Media-Kanäle ständig präsent. Fotografie ist einfach eingängiger als andere Kunstformen und das ist eine große Chance.
Wie haben sich Social Media auf Fotografie ausgewirkt?
Ich weiß nicht, wie viele Fotos du auf deinem Handy hast, aber ich habe jetzt ungefähr 26.000 Bilder auf meinem. Über Social Media

Felix
erreichen uns tagtäglich Bilder von außen und das wirft die Frage nach Bildmanipulation auf. Seit der Erfindung der Fotografie gibt es den Glauben, die Fotografie würde die Wirklichkeit abbilden. Das hat sie noch nie. Sowohl der Ausschnitt als auch der Moment ist immer ein Framing. Dazu kommt, dass Bilder eingängiger sind als Text. Was wir als Gesellschaft aber nie gelernt haben, ist, Bilder zu lesen. Wenn wir uns Russland und den Krieg mit der Ukraine anschauen, dann sehen wir bestimmte Mechanismen im Umgang mit Bildern, die Einfluss auf unsere politischen Systeme und die Parteienlandschaft nehmen. Ich bekam beispielsweise noch nie so viel Social-MediaWerbung wie in den letzten Monaten von der FPÖ. Auf den ersten Blick fragte ich mich oft, ob das Berichterstattung ist. Erst im Header sah ich, dass es Wahlwerbung war. Dass
rechte Parteien Social Media besser für sich nutzen können, hat Tradition. Wenn man sich Deutschland in den 1930er-Jahren anschaut, sieht man, dass die Nutzung der damals zur Verfügung stehenden Medien auch richtig gut beherrscht wurde – vor 90 Jahren gab es also eine ganz ähnliche Situation.
Das ist beängstigend. Findest du Fotografie hat einen Bildungsauftrag?
Ja, absolut. Deshalb hat das Foto Arsenal Wien auch zwei Standbeine: auf der einen Seite die Ausstellungstätigkeit und auf der anderen einen Education- beziehungsweise Vermittlungsbereich, der die Auseinandersetzung mit Bildungsfragen in Bezug auf fotografische Bilder ermöglicht. Wir haben Workshopräume für Jugendliche mit einer Dunkelkammer und werden hier sehr aktiv versuchen, den Umgang mit Bildern zu fördern.
Du warst von 2005 bis 2022 Programmchef des Ausstellungshauses C/O Berlin. Was hat dich daran gereizt, von Berlin nach Wien zu wechseln?
Eine institutionelle Neugründung wie hier mit dem Foto Arsenal Wien ist in Europa singulär, das passiert nicht so oft. Es hat mich gereizt einen Ort mitzugestalten, der andere und neue Fragestellungen für das 21. Jahrhundert in einer Gesellschaft zu verankern versucht.
Was interessiert dich an der Arbeit als Kurator?
Für mich stellt sich die Frage, welche Relevanz ein Ausstellungsort heute hat, der sich mit Fotografie und Lens-Based Media auseinandersetzt. Ich denke, die Relevanz ist der Bildungsauftrag. Wir verstehen uns deshalb auch als Medienkompetenzzentrum und wollen die Leerstelle zwischen schulischer Bildung sowie dem Umgang mit Bildern in der breiten Gesellschaft schließen. Da gibt es nämlich große Lücken und Fotografie kann ein Trittbrett sein, das Leuten ermöglicht, in eine Welt der Kunst und Kultur einzusteigen. Helena Peter
Von 21. bis 23. März findet das Eröffnungswochenende im Foto Arsenal Wien statt –mit Party, Talks, Performances, Führungen und Workshops bei freiem Eintritt. Eröffnet wird mit den Ausstellungen »Magnum. A World of Photography« sowie »Clean Thoughts. Clean Images« von Simon Lehner. Das Festival Foto Wien findet von 3. Oktober bis 2. November am neuen Standort statt.

Nicht nur das Unterrichten, sondern auch diverse administrative Aufgaben sorgen bei Lehrer*innen für ein enormes Arbeitspensum.
* Name von der Redaktion geändert
Meinungen zum Thema Schule sowie Kritik am Bildungssystem gibt es scheinbar aus allen Richtungen. Doch was ist die Perspektive jener Menschen, die in diesem System beruflich Fuß fassen wollen? Wie geht es jungen Lehrkräften, die teilweise unterrichten, während sie selbst noch in der Ausbildung stecken? Wo und wie können die herrschenden Verhältnisse verbessert werden? ———— Anna* ist 24 Jahre alt und arbeitet seit September 2024 als Teamlehrerin in einer Ganztagesvolkschule in Wien. Sie hat das Lehramtsstudium für Primarstufen im Bachelor abgeschlossen, studiert aber noch im Master: »Der Master ist nicht freiwillig, leider. Ich hätte sofort zu studieren aufgehört – wie viele andere.« Anna sieht in dieser Doppelbelastung als Lehrkraft und Studentin eine große Schwierigkeit, die kaum angesprochen werde.
Realitätsferne Uni
Vier der sechs Lehrkräfte, mit denen wir gesprochen haben, befinden sich in verschiedenen Abschnitten ihres Studiums. Parallel arbeiten sie, um Praxiserfahrung zu sammeln, oder weil es aus finanziellen Gründen notwendig geworden ist. Zeitlich lässt sich das nicht immer gut mit Studien vereinbaren, die teilweise strikte Anwesenheitspflichten haben. Mit ein Grund, weshalb sich Studienabschlüsse immer weiter nach
hinten verschieben. »Im Unibetrieb ist vieles realitätsfern«, meint Anna dazu. »Sie bilden uns zu Forscher*innen aus, die wir nicht sind. Meine Seminararbeiten schreibe ich als Beschäftigungstherapie. Sinn sehe ich keinen mehr darin, in die Uni zu gehen. Ich lerne dort nichts mehr, was mir etwas bringt.«
Viele Aspekte des Schulalltags beschönige das Studium zudem enorm, zum Beispiel die unterschiedlichen sozialen Situationen
»Einmal habe ich mir nach Unterrichtsschluss gedacht: Jetzt habe ich endlich Zeit zum Arbeiten.«
— Teresa
der Kinder. Anna hätte sich mehr Fokus auf solche Problematiken gewünscht. Es werde oft von einer idealen Lern- und Lehrsituation ausgegangen. Viele Dozent*innen seien einfach selbst noch nie oder schon lange nicht mehr vor einer Schulklasse gestanden. Der
33-jährige Jonny lehrt seit vier Jahren an einer alternativen öffentlichen Schule und sieht im Unibetrieb genau dasselbe Problem, das er auch am Schulsystem kritisiert: ein sehr hierarchisches, möglichst kosteneffizientes Abfertigen für einen zukünftigen Beruf.
Dieses Streamlining des Curriculums führt auch dazu, dass gerade pädagogische Fächer, die unsere Gesprächspartner*innen durchwegs als sehr sinnvoll bezeichnen, häufig einfach abgewählt werden können. Viel praktisches und rechtliches Wissen wird erst in separaten Seminaren oder Fortbildungen während der Induktionsphase gelehrt. Von einem absurden Beispiel dafür, wie nachgelagert hier oft elementares Know-how vermittelt wird, weiß die 31-jährige AHS-Lehrerin Teresa zu erzählen: Das Fach »Digitale Grundbildung« wurde im September 2022 als Unterrichtsfach eingeführt. Die Ausbildung für die zus tändigen Lehrpersonen habe aber erst danach, im Oktober desselben Jahres, begonnen.
Insgesamt braucht es offensichtlich mehr Unterstützung – auch nach dem Berufseinstieg. Wolfi, 27, unterrichtet an einer AHS und fände auch dort ein besseres sowie weiter ausgebautes Mentoringprogramm notwendig, um die gerade im ersten Unterrichtsjahr häufigen Burn-outs zu verhindern.
Aber Kritik gibt es nicht nur an der Ausbildung, sondern auch am Schulsystem selbst. Mehrfach bemängeln die Junglehrer*innen die Trennung der Kinder direkt nach der Primarstufe in AHS und Mittelschule. Hier werde schon sehr früh eine Hierarchie vermittelt, die auch die Kinder zu spüren bekommen, so die einhellige Meinung. Diese Geringschätzung sowie das vermehrte »fachfremde Unterrichten« überfordere viele Lehrkräfte und schrecke junge Lehrpersonen ab, an eine Neue Mittelschule zu gehen, meint Wolfi. Das Unterrichten sei dort sehr herausfordernd: »Meiner Meinung nach gehören an die Mittelschulen eigentlich die besten Lehrer*innen. Sie sollten dort mehr verdienen als in der AHS.«
Abstellgleis für
Von herausfordernden Unterrichtsbedingungen kann auch Michelle berichten. Sie ist ebenfalls 27 und hat in einer Deutschförderklasse (DFK) gelehrt, bevor sie Teamlehrerin einer Mehrstufenklasse in derselben Volksschule wurde. In einer DFK kommen Kinder mit sehr unterschiedlichen Deutschkenntnissen zusammen, mit ständigen Neuzugängen im Laufe des Jahres. Sie alle bekommen mehr oder weniger denselben Unterricht. Die Lehrkräfte sind dabei meistens nicht speziell für die DFKs ausgebildet. Michelle selbst studiert Psychologie und Philosophie, Kunst und Gestaltung sowie Technik und Design im Lehramt (Anm.: die letzten beiden Fächer hießen früher Bildnerische Erziehung beziehungsweise Werken). Ihren Bachelor hat sie noch nicht abgeschlossen. »Das Problem in der DFK war nicht, dass ich das ABC nicht kannte, sondern mir fehlte die Methodik, weil ich nicht für die Primarstufe ausgebildet wurde.« Jonny sieht die DFKs als Abstellgleis für Kinder, mit denen andere Lehrer*innen nicht zurechtkommen: »Hier werden viele junge Kolleg*innen verbrannt.«
Ganz allgemein fehle es eben an Ressourcen und Zeit. Es gebe zu viele Kinder in den Klassen beziehungsweise Gruppen in zu kleinen Räumen mit zu wenigen Lehrpersonen. Auf individuelle Bedürfnisse und Situationen könne kaum eingegangen werden, selbst wenn man zu zweit oder sogar zu dritt unterrichtet. Jederzeit könne man abgezogen werden, um woanders einzuspringen, erklären sowohl Anna als auch Michelle. Joshi, 22, kennt diese Situation auch aus seiner Arbeit im Kindergarten: »Wenn du dann mit 25 Kindern alleine bist, kannst du eigentlich alles, was du geplant hast, schmeißen. Bildungsarbeit kann man da vergessen.«
Dabei sei diese intensive Zeit dringend notwendig für Kinder, die gerade lernen, in einer Gruppe mit anderen Kindern zu existieren. Den sozialen Aspekt und das soziale Lernen sieht er als zentral in seiner Arbeit. »Der Kindergarten ist eigentlich die letzte Instituti-
on, in der man die Mittel und die Zeit für emotionale und soziale Arbeit finden kann«, meint Joshi. »In der Volkschule geht es bereits viel mehr um die Inhalte, die die Kinder können müssen.« Oft gehe ihm allerdings wertvolle Zeit mit administrativer Arbeit verloren, Programmplanung passiere dann teilweise in der unbezahlten Freizeit.

Damit ist er nicht alleine. Teresa und Wolfi bemerken auch in der AHS einen steigenden Aufwand bei der administrativen Arbeit. Teresa erzählt von einer Klasse mit mittlerweile 32 Kindern – da häufen sich diese Aufgaben schnell: »Einmal habe ich mir nach Unterrichtsschluss gedacht: Jetzt habe ich endlich Zeit zum Arbeiten.« Aufgrund solcher Umstände forderte die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) im September in einem offenen Brief an den Nationalrat eine Entlastung der Lehrkräfte von administrativer Arbeit.
Schule brennt
Neben den Gewerkschaften gibt es noch eine Reihe von anderen Initiativen, die versuchen Druck aufzubauen. Seit er vor vier Jah ren zu unterrichten begonnen hat, ist Jonny in der von Lehrkräften auf die Beine gestellten Organisation Schule brennt involviert: »Grundsätzlich setzen wir uns für bessere Arbeits-, Lehr- und Lernbedingungen an Schulen ein. Spezifisch sind unsere Ziele mehr Sozialarbeiter*innen und Psychagog*innen an den Schulen, kleinere Klassen, mehr Ressourcen. Das sind die ersten Notmaßnahmen.«
Im Weiteren gehe es Schule brennt aber auch um ein grundsätzliches Neudenken des österreichischen Schulsystems, ein Aufzeigen von Missständen mit der Idee, Kolleg*innen unabhängig von der Gewerkschaft zu mobilisieren. »Das Endziel wäre ein Streik«, sagt
Jonny. »Da sollte die GÖD dahinterstehen, es kann aber auch ohne sie gehen.« Doch viele Lehrkräfte seien stark überarbeitet und überfordert, manche auch träge und nicht überzeugt, dass ein Streik etwas ändern würde.
Für den 26. November 2024, zwei Tage vor den Bundes-Personalvertretungswahlen, hatte die Gewerkschaft dann endlich einen Streik geplant – nur um ihn kurzfristig doch wieder abzusagen. Sie finde das eine Frechheit, sagt Anna: »Wir hätten trotzdem hingehen sollen, allein schon wegen der Arbeitsbedingungen.« Auch Teresa steht der GÖD kritisch gegenüber: »Die Gewerkschaft ist total konservativ, das ist eine ÖVP-Gewerkschaft und das merkt man.«
Dennoch sammelt Schule brennt Stimmen, um die GÖD dazu zu bringen, einen Streik auszurufen – und auch durchzuziehen. In der Zwischenzeit finden kleinere Störaktionen und alternative Streikformen statt, um dem Unmut der Lehrkräfte Ausdruck zu verleihen. Jonny: »Wir kämpfen nicht für Lehrer*innen, es geht nur mit ihnen.« Mit einer Gewerkschaft, von der sie sich nicht unterstützt fühlen, und angesichts der zu erwartenden Änderungen in der kommenden Bundesregierung, ist das allerdings kein einfaches Unterfangen. Informieren und Solidarisieren sind in der Zwischenzeit wichtig.
Die Zukunft der Bildung
Wie kann es weitergehen? Damit unser Schulsystem und die darin Arbeitenden nicht ausbrennen, muss sich fundamental etwas ändern. Es braucht realistische, schaffbare Lernpläne sowie mehr praxisnahe Ausbildung und Ausbildende in der Lehre für zukünftige Lehrkräfte. Die ersten Lehrerfahrungen sollten früher und über einen längeren, betreuten Zeitraum stattfinden. Derzeitige Praktika fühlten sich laut Michelle eher wie Referate an.
Michelle und Jonny, die beide in Mehrstufenklassen und dadurch in eher alternativen Schulsystemen arbeiten, sehen einen großen Vorteil in der Interaktion der unterschiedlich alten Kinder untereinander. Sie könnten selbstbestimmt lernen, einander helfen. Bei Michelle in der Klasse lernen die Kinder zum Beispiel, von Anfang an mit der Neurodivergenz von Klassenkolleg*innen umzugehen. Jonny sieht die Zukunft des Schulsystems überhaupt nur noch in solchen alternativen Unterrichtsformen. Ob und wann der Rest der Gesellschaft diesen Schritt mitgeht, bleibt abzuwarten. Johanna T. Hellmich
Schule brennt sucht immer nach persönlichen anonymen Berichten aus Schulen, um Missstände im Schulalltag sichtbar zu machen. Weitere Ressourcen und Informationen sind unter www.schulebrennt.at zu finden.

Gerade in den letzten Jahren wird Politisierung auf Youtube, Instagram, Tiktok und X häufig mit rechter Propaganda gleichgesetzt. Dabei bieten die sozialen Medien ein reichhaltiges Potenzial, um zu vermitteln, wie wir unsere Welt aktiv mitgestalten können. ———— Kurz nach Neujahr protestieren Zehntausende Menschen auf dem Ballhausplatz in Wien. Unabhängig davon postet die Anthropologin Rahaf Harfoush eine Woche später auf ihrem Instagramkanal @foushy ein Video, in dem sie das Phänomen der sogenannten »Hypernormalisierung« erklärt. Dieses beschreibt einen widersprüchlichen Wahrnehmungszustand: Auf der einen Seite sind wir uns all der strukturellen Unterdrückungsverhältnisse, der Ausbeutung und Täuschung durch politische Eliten durchaus bewusst. Auf der anderen sind wir aber alle so sehr Teil dieses Systems, dass die meisten von uns sich eine reale Alternative nicht einmal mehr vorstellen können. Wir erkennen, wie außergewöhnlich, wie surreal die Situation ist, und gleichzeitig fühlt sie sich dennoch unvermeidlich, gewohnt, normal an. Hypernormal eben. So kommt es zwar hin und wieder zu einem Aufschrei wie am Ballhausplatz, zu einer tatsächlichen Veränderung der Verhältnisse in weiterer Folge allerdings nicht. Geprägt wurde der Begriff der Hypernormalisierung von Alexej Jurtschak, der damit jene Generation beschreibt, die sich den Zusammenbruch der Sowjetunion zwar niemals hätte vorstellen können, aber dennoch nicht überrascht war, als er schließlich passierte. 2016 kam ein gleichnamiger Dokumentarfilm von Adam Curtis heraus, der den Begriff ins aktuelle popkulturelle Bewusst-
sein holte. »Hypernormalisation« erzählt davon, wie Politiker*innen, Technokrat*innen, Populist*innen und der Finanzsektor aus unserer komplexen Realität eine vereinfachte »Fake World« konstruiert haben, die wir einfach hingenommen haben und die mittlerweile zur Normalität geworden ist.
Ein wichtiges Vehikel für die Propagierung dieser Konstruktion sind die sozialen Me dien. Die österreichische Journalistin
»Instagram kann nicht nur genutzt werden, um politische Informationen zu vermitteln, sondern auch, um Affekte zu wecken.«
— Tanja Maier
Ingrid Brodnig spricht hier von einer »wutgeladenen Parallelrealität«, die aber zunehmend Einfluss und konkrete Auswirkungen auf unsere politische Realität habe. Doch wie sieht dieses Verhältnis von sozialen Medien zur Wirklichkeit aus? Und welche Potenziale für Politisierung und politische Bildung liegen darin?
Über ein Drittel der Österreicher*innen – genauer 37,1 Prozent – benutzten 2024 laut »Digital News Report« der Universität Salzburg soziale Medien als eine ihrer Nachrichtenquellen, 15 Prozent gar als Hauptquelle. Besonders in den Alterssegmenten zwischen 18 und 34 zählen Youtube, Instagram, Tiktok und X zu den beliebtesten politischen Informationskanälen. Gleichzeitig gaben jedoch 39 Prozent der Befragten an, bei Onlinenachrichten zwischen Fakten und Falschmeldungen kaum unterscheiden zu können.
Gezielt gestreute Desinformation und ideologische Erzählungen sind eine allgegenwärtige Bedrohung, die sich seit dem Au fkommen von Social Media allerdings potenziert hat. Propagandastrategien verstärken Feindbilder, bestehende Ungleichheiten und den Status quo, sie spalten uns zunehmend, während der Diskurs immer weiter nach rechts abdriftet. Staaten wie Russland wissen um den politischen Einfluss von sozialen Medien und nutzen diese für heimtückische Destabilisierungskampagnen und hybride Kriegsführung, wie kürzlich Investigativjournalist*innen von Correctiv und Arte aufgedeckt haben. Und auch misogyne Persönlichkeiten aus der antifeministischen Manosphere haben soziale Netzwerke als direkte Einflusskanäle erkannt, durch die sie junge Männer radikalisieren und mächtig Profit schlagen können. Immer mehr Teenager wählen faschistische Parteien, die kein Geheimnis aus ihren Deportationsfantasien und Zerstörungsplänen für soziale Auffangsysteme machen.

Durch eine international gut vernetzte rechtsextreme Szene sowie die drohende Abschaffung von Faktencheckabteilungen müssen wir uns zudem darauf einstellen, dass digitale Gewalt noch stärker zunehmen und weniger eingedämmt werden wird. Das verstärkt immer auch Gewaltbereitschaft im häuslichen und öffentlichen Raum. Und dadurch, dass traditionelle Nachrichtenkanäle in ihrer Berichterstattung häufig unverhältnismäßige Schwerpunkte setzen und diskriminierende Narrative unkritisch wiedergeben, spielen sie den Rechtspopulist*innen in die Hände, die so die öffentliche Debatte bestimmen – etwa beim Thema Migration. Hasserfüllten Erzählungen wird damit Raum gegeben, ohne sie als das einzuordnen, was sie eigentlich sind.
Wir steuern zunehmend auf ein postfaktisches und technokratisches Zeitalter zu und verkürzte Berichterstattung findet sich leider sowohl in etablierten wie auch alternativen Kanälen, im öffentlich-rechtlichen TV-Special wie auch in dubiosen Telegram-Chats wieder. Um handlungsfähig zu bleiben, ist es deshalb wichtig, ein Gegengewicht zu haben. Soziale Medien können uns vieles schulen – und sie tun das seit zwei Jahrzehnten. Dieses Potenzial kann uns als Tool gegen faschistische Kräfte weiterhelfen, um deren Strategien aufzudecken und kritische Gegenstimmen zu Wort kommen zu lassen. Wie das funktionieren kann, erproben einige alternative Bildungskanäle bereits.
Politische Bildung hat noch nie nur aus dicken Büchern, aufgeblasenen TV-Debatten und akademischen Seminardiskursen bestanden. Formate unabhängiger Berichterstattung passen sich unserem digitalen Zeitalter, temporeichem Konsumverhalten und unseren verkürzten Aufmerksamkeitsspannen an: Teaser-Posts im Look kompakter, ästhetisierter Info-Slides mit Auszügen aus Artikeln und journalistischen Kommentaren; kurze Videos mit Untertiteln, in denen Aktivist*innen, Journalist*innen, Politiker*innen oder fachliche Expert*innen komplexe politische Zusammenhänge zugänglich aufbereiten, aktuelle Geschehnisse sowie viral gegangene Aussagen kritisch einordnen und kontextualisieren; Formate, in denen Menschen aus Betroffenenperspektive ihre eigenen Geschichten erzählen.
Selbst öffentlich-rechtliche Sender wie der ORF bekommen für die Produktion eigener Formate im Internet langsam mehr Handlungsspielraum – siehe Topos, »Zeit im Bild«-Tiktok oder die neue »Young Audience«-Schiene. Welche Perspektiven in Zukunft auf diesen großen Kanälen Sendezeit kriegen, wird sich zeigen.
Die Alltäglichkeit, in die soziale Plattformen gerade bei jüngeren Generationen eingebettet sind, bietet jedenfalls die Chance, kontinuierlich auf neuen Content von unterschiedlichsten Produzent*innen zu stoßen. Denn trotz Zensur und Monitoring der
Inhalte durch privatwirtschaftliche TechKonzerne ist eine grundlegende Vielfalt an Perspektiven in den sozialen Medien immer schon angelegt: Die Plattformen leben davon, dass wir alle ständig Inhalte für sie produzieren – egal ob Texte, Bilder, Videos oder Musik. Schlussendlich haben sie weder ein Interesse noch die Möglichkeit, diese Flut an Content völlig einzudämmen.
Soziale Medien sollten selbstverständlich nie unsere einzige politische Informationsquelle sein, sondern idealerweise eine von vielen. Wir können ihre Vorteile aber stärker nutzen und verantwortungsbewusster mit ihnen umgehen. Der für Social Media so charakteristische Austausch geht weit über Kommentarspalten, Story-Posts an die eigene Follower*innenschaft oder virale Trends hinaus. Denn über geteilte Inhalte wird sich auch in der Realität ausgetauscht.
Dieser Rückkanal ist zwar nicht immer positiv, gerade deshalb gibt es aber immer mehr Initiativen, wie das Schweizer Projekt »Stop Hate Speech«, die zugänglich vermitteln, wie gegen Hassrede in Kommentarspalten und Shitstorms vorgegangen werden kann. In Form produktiver Gegenrede, die zu einem
Sich nicht zu informieren, ist keine Option, sonst wird unsere Zukunft gewaltvoll ohne uns gestaltet.
konkreten Thema alternative Positionen aufzeigt, was nachweislich beeinflusst, wie der öffentliche Diskurs wahrgenommen wird. Die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin Tanja Maier schreibt, dass Sichtbarkeit eng mit der Gestaltung von politischen Öffentlichkeiten verknüpft sei. Laut ihr ist die Aufgabe politischer Bildung eine Form der Selbstermächtigung, ein »Community-Management«, eine »Befähigung der Lernenden, sich eigenständig zu organisieren«. Collective Take-over Technologische Innovationen bergen immer auch Gefahren. Social Media sind zu einer Parallelrealität geworden, in der Appelle an die Menschlichkeit entmenschlichenden Darstellungen direkt gegenüberstehen. Eine kritische Beschäftigung mit der Einflussnahme sozialer Medien auf unsere Politik und Psyche sollte daher unbedingt stattfinden, aber nicht ihre Politisierungspotenziale verteufeln oder verleugnen. Besonders wenn es um die Dokumentation und das Aufdecken von Menschenrechtsverletzungen geht, er-
möglichen soziale Medien eine nicht zu unterschätzende Form von Teilhabe. In einer Zeit, in der sich politische Ereignisse in einem solchen Tempo überschlagen, dass niemand mehr hinterherkommt, sind zugängliche und flächendeckende Formen politischer Bildung durch uns alle und mit uns allen unverzichtbar. Sich nicht zu informieren, ist keine Option, sonst wird unsere Zukunft gewaltvoll ohne uns gestaltet. Wir dürfen an der Komplexität und den Widersprüchlichkeiten unserer politischen Realität nicht scheitern. Wir müssen uns mit ihr beschäftigen und sie verständlich machen, statt so zu tun, als gäbe es sie nicht. Es braucht eine flächendeckende, multiperspektivische und zugängliche Aufbereitung von Informationszusammenhängen – auf öffentlich-rechtlichen Kanälen, in deren Social-Media-Zweigen wie auch durch unabhängigen Journalismus; für Menschen mit unterschiedlichsten Backgrounds und Bildungsständen. Damit wir inmitten all dieser Gefahren nicht vermeintlich einfachen Erklärungen und faschistoiden Versprechen verfallen, sondern handlungsfähig bleiben. Und gerade weil alles so undurchsichtig und komplex ist, müssen wir zusammen kritisch denken, Narrative hinterfragen und Gegenerzählungen und alternative Antworten auf Propaganda und Desinformation liefern. Tanja Maier beschreibt wie gerade bildlastige soziale Medien genutzt werden können, »um nicht nur politische Informationen zu vermitteln, sondern auch, um Affekte zu wecken, Verbundenheit herzustellen und die Öffentlichkeit zur Partizipation einzuladen«. Dieser solidarische Austausch, der Leute direkt und emotional anspricht, habe das Potenzial, eine Praxis des Widerstands zu sein und Einfluss auf eine Veränderung der Verhältnisse zu nehmen. Nicht durch performativen Aktivismus durch Story-Posts auf Instagram, sondern hoffentlich als ein Aspekt eines längerfristigen solidarischen Miteinanders, das populistischen Kräften keinen Teil unserer Öffentlichkeiten einfach so überlässt. Denn wenn wir uns gemeinschaftlich organisieren und lernen uns aktiv in die Gestaltung unserer politischen Realität einzumischen, dann sind wir nicht mehr in der Hypernormalisierung gefangen. Dann erscheint uns die außergewöhnliche, surreale Situation, in der wir leben, nicht mehr normal, nicht mehr unveränderlich. Dann erkennen wir die Fake World, die uns vorgegaukelt wird, als jenes fadenscheinige Konstrukt, das sie ist. Dann sind wir nicht mehr in der endlosen Spirale des Doomscrollings gefangen, sondern können aktiv beginnen, unsere Welt – die digitale wie die physische – mitzugestalten. Alexandra Isabel Reis
Informationen zu Tanja Maiers Publikationen finden sich auf www.tanjamaier.net. Rahaf Harfoush veröffentlicht regelmäßig neue Videos auf ihrem Instagram-Account @foushy.

Weiterbildung, die so flexibel ist wie ich.

> STACKABLE PROGRAMS
> MICRO-CREDENTIAL PROGRAMS > BACHELOR > MASTER > LL.M. > MBA > PhD
Jetzt berufsbegleitend studieren!
Drei Tage. Drei Tage hat es gedauert, bis zum ersten Femizid im neuen Jahr 2025. Während auf den Straßen die allerletzten Böller verklingen und noch an das Neujahrsfeuerwerk erinnern, ist in Österreich bereits die erste Frau aufgrund ihres Geschlechts von einem Mann ermordet worden. Da bleibt nicht einmal Zeit für die Trauer um die 27 ermordeten Frauen des vergangenen Jahres. Österreich ist Spitzenreiter in der EU, wenn es um Frauenmorde geht. Doch obwohl das Problem so offensichtlich ist, ändert sich seit Jahren nichts. Wie können Femizide in Österreich verhindert werden? Welche Maßnahmen müssen Politik, Medien und Justiz setzen? Inwiefern ist ein gesellschaftliches Umdenken notwendig?
Alexandra Stanić Medienschaffende

Frauenhass nicht totschweigen ———— »Ehedrama«, »Aus Eifersucht ermordet« oder »Rosenkrieg« – wenn so über Morde an Frauen berichtet wird, erweckt es den absurden Anschein, die Tat hätte etwas mit Zuneigung zu tun. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine vollkommen verzerrte Realität. Niemand mordet aus Liebe. Medien müssen endlich aufhören, mit problematischen Schlagzeilen Klicks zu generieren und ihren Konkurrenzkampf auf dem Rücken von Betroffenen auszutragen. Leidtragende brauchen eine Medienlandschaft, die sich für sie einsetzt, ihnen glaubt und aufzeigt, wie tief verwurzelt Frauenhass in Österreich wirklich ist.
Wir leben in Österreich in einer rechten Gesellschaft, in der ein konservatives Frauenbild vorherrscht. Ebenso wird ein toxisches Männlichkeitsbild mittransportiert. Der »starke« Mann, der nicht weinen darf und den Beschützer spielt, ist eben derselbe Mann, der seine Partnerin und sich selbst ermordet, wenn sie sich von ihm trennen möch
te. In rechtem Denken wird Gewalt an Frauen wenig bis gar keine Existenz zugesprochen. Wenn Gewalt an Frauen anerkannt wird, dann nur die, die ins Bild passt: Männer (mit Migrationshintergrund), die im Busch warten, um fremde Frauen zu überfallen. Dass es in Wirklichkeit der Partner, Vater, Bruder oder Ex ist und der gefährlichste Ort für Frauen die eigenen vier Wände sind, wird gekonnt ignoriert.
Frauenhass beginnt nicht erst beim Femizid oder bei einem körperlichen Angriff, sondern startet schon bei Einstellungen und Überzeugungen. Nacktfotos weiterzuschicken, »Bodycounts« zu erstellen oder Frauen auf der Straße hinterherzupfeifen, ist ebenso gewaltvoll. Wer das erkennt, erkennt auch, welch große Verantwortung Medien tragen. Denn sie sind Meinungsmacher*innen und Gatekeeper*innen und prägen Einstellungen sowie Überzeugungen maßgeblich. Von ihnen verwendete Sprache formt, wie wir im Alltag über Geschehnisse nachdenken. Deshalb ist es ihre Aufgabe, stetig und wahrheitsgemäß über Gewalt an Frauen zu berichten, aufzuklären und Dinge so zu benennen, wie sie tatsächlich sind. Nämlich nicht als Drama zwischen Liebenden, sondern als strukturelles Problem.
Alexandra Stanić ist Medienschaffende und Content-Creatorin aus Wien. Ihre journalistische Karriere fand ihren Anfang beim Wiener Stadtmagazin Biber. Ihre Texte drehen sich unter anderem um gesellschaftspolitische Themen wie Queerness, Feminismus und Rassismus.
Mercedes Haindl
Rechtspsychologin

Gewaltschutz betrifft uns alle ———— Femizide als extremste Form geschlechtsspezifischer Gewalt stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. In den Medien ist Gewalt gegen Frauen erst seit wenigen Jahren eine Thematik, die große Wellen schlägt, obwohl speziell in den 1960er- bis 1990er-Jahren die Zahlen der Frauenmorde laut Kriminalstatistik des Innenministeriums wesentlich höher waren als aktuell. Nichtsdestotrotz ist jeder Femizid einer zu viel. Maßnahmen wie das Gewaltschutzgesetz als auch Anlaufstellen verschiedenster Art (beispielsweise Frauenhäuser und Beratungsstellen) sind wichtige Eckpfeiler, um interpersonellen Gewalteskalationen entgegenzutreten. Diese greifen allerdings erst, wenn es bereits zu gewalttätigen Handlungen gekommen ist. Somit gilt es, Aufklärung und Achtsamkeit als präventive Faktoren in den Fokus zu rücken: Wo beginnt geschlechtsspezifische Gewalt? Welche Strukturen fördern diese? Was sind die »red flags«, auf die man achten sollte – sowohl im individuellen als auch im sozialen Umfeld?
Präventionsprogramme jeglicher Art müssen außerdem zusätzlich so gestaltet werden, dass sie nicht nur Betroffene erreichen, sondern Menschen jeglichen Geschlechts – und das bedeutet auch eine Inklusion von Gefährder*innen und Täter*innen. Dafür muss es einen offenen Diskurs über Funktionsweisen von Gewalt sowie ein »Verständlichmachen« der zugrunde liegenden Dynamiken geben. Das schließt eine klare Haltung gegen Gewalt und deren Ursachen nicht aus. Weiters ist aus psychologischer Sicht in dieser Thematik zu beachten, dass es nicht zu einer Verantwortungsdiffusion kommen darf – damit ist das Übergeben der Verantwortung an höhere Stellen wie beispielsweise Politik und Justiz gemeint. Natürlich ist eine Positionierung dieser Institutionen von enormer Bedeutung, wenn es um Maßnahmen und deren Umsetzung geht. Dennoch gilt es, Verantwortungsübernahme bei jedem*jeder Einzelnen von uns zu fördern, damit kein Wegschauen, kein Bagatellisieren passiert, sondern Hilfe auch von Individuen angeboten wird, wo es nötig ist. Gewaltschutz betrifft uns alle – und diese Erkenntnis kann ein gesellschaftliches Umdenken ermöglichen.
Mercedes Haindl ist klinische Psychologin und Rechtspsychologin. Sie war unter anderem als Projektmitarbeiterin beim Kriminalpsychologischen Dienst in Wien und als Psychologin in einer Justizanstalt in Oberösterreich tätig.
Maria Pober Sprachwissenschaftlerin

Sachverhalt klar benennen ———— Männergewalt, sei sie nun »nur« gewalttätig oder in Form von sexualisierten Gewaltdelikten bis hin zu Frauenmord beziehungsweise Femizid, stellt immer noch – nach fast 50 Jahren Eherechtsreform (in Österreich: 1975 bis 1978) und damit Gleichberechtigung der Frau – eine grausame sowie traurige Realität dar. Ein Blick in die Medien zeigt, dass dieses Problem unter anderen natürlich auch ein sprachliches ist. Denn wenn ein Sachverhalt wie Männergewalt nicht klar und transparent benannt wird, sondern verallgemeinernd als »Gewalt gegen Frauen« oder als »häusliche Gewalt«, kann sich auch kein wirkliches Bewusstsein für diese Straftat und deren Verursacher entwickeln.
Bei letzterem Begriff wird zwar der Fokus auf die Gewalt im Haus gelegt, also auf das familiäre Umfeld und nicht auf den großen Unbekannten, wie das lange der Fall war. Aber gleichzeitig weitet das Attribut »häuslich« den Personenkreis auch sehr aus und führt damit vom eigentlichen Täter weg. Denn in einem Haus leben in der Regel die Ehefrau oder -partnerin, die Kinder und manchmal auch die Großeltern. Sie alle werden durch die Verallgemeinerung »häuslich« in der Wahrnehmung zu potenziellen Täter*innen. Wenn weiters in diesem Zusammenhang von »Beziehungstat« oder »Familientragödie«, also dezidiert von positiv besetzten Begriffen wie »Familie« oder »Beziehung« und überhaupt nicht von »Gewalt« die Rede ist, dann drängt sich doch die Vermutung auf, dass hier bewusst etwas verschleiert oder sogar beschönigt werden soll: nämlich die Straftat Männergewalt.
Obwohl es die Funktion von Bestimmungswörtern wie Beziehung und Familie sein sollte, einen Sachverhalt möglichst genau zu beschreiben und präzise zu bestimmen, wird diese Funktion in diesem Fall unterlaufen. Weder ist »Tat« mit einer Straftat gleichzusetzen, noch verweist eine »Tragödie« auf einen aktiv Beteiligten, sondern in ihr ist bereits das Ende durch die Ausgangslage festgelegt. Damit wird suggeriert, der Gewalttäter befände sich in einer ausweglosen Situation, weil die ganze Tragödie buchstäblich über ihn hereinbreche und ihn daher zumindest weniger oder vielleicht sogar keine Schuld treffe.
Maria Pober ist Sprachwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Gender, Semantik und Lexikografie an der Universität Wien und sie ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik.
Julia Brož Geschäftsführerin Wiener Frauenhäuser

Jetzt schützen, langfristig denken ———— Hinter jeder Ermordung einer Frau durch ihren (Ex-)Partner steht eine meist lange Geschichte von Kontrolle, Demütigung und Gewalt. Diese Gewalt ist ein Ausdruck ungleicher gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Es gilt, jede dieser Ebenen zu adressieren, um sowohl den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten als auch langfristig geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern.
Gewaltbetroffene Frauen müssen die Möglichkeit haben, verfahrensunabhängig und unkompliziert mit einer spezialisierten Beratungseinrichtung (zum Beispiel Frauenberatungsstelle und Frauenhaus) in Kontakt zu treten, und Unterstützung dabei erhalten, sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen. Gleichzeitig ist es essenziell, die Verantwortung für die Gewalt nicht bei der Betroffenen zu suchen, wenn Frauen sich (noch) nicht aus einer Gewaltbeziehung lösen (können). Es gilt, auch die Täter zu adressieren und flächendeckend langfristig wirksame opferschutzorientierte Täterarbeit umzusetzen.
Um den bestmöglichen Schutz der Betroffenen zu gewährleisten, sind eine gute Vernetzung und ein regelmäßiger Austausch von Opferschutzeinrichtungen und Institutionen (zum Beispiel Justiz, Polizei, Gesundheitsbereich, Kinder- und Jugendhilfe) notwendig. All das kann jedoch nur dann gelingen, wenn alle beteiligten Institution sich – mittels Schulungen durch Expert*innen – der Spezifika von häuslicher Gewalt bewusst werden.
Dabei können auch detaillierte Analysen von schweren Gewalttaten bis hin zu Femizidversuchen und Femiziden stattfinden, im Rahmen derer strukturelle Lücken aufgedeckt und präventive Maßnahmen entwickelt werden können. Forschung kann uns hierbei wichtige Hinweise für Risikofaktoren und Handlunsgspielräume. Deren Finanzierung und Durchführung ist daher essenziell.
Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen als Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse braucht somit auch gesamtgesellschaftliche Antworten: etwa die Erkenntnis, dass Geschlechterungleichheit Gewalt verursacht und es Frauen erschwert, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen. Gleichstellungsmaßnahmen und breite Primärprävention können dazu führen, dass wir uns Fragen wie diese in Zukunft nicht mehr stellen müssen.
Julia Brož ist ausgebildete Sozialarbeiterin und seit 2024 Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser.

Die Künstler*innenporträts des niederländischen Fotografen Anton Corbijn sind Legende. Nicht ohne Grund passt etwa seine in Schwarz-Weiß gehaltene Regiearbeit »Control«, ein Ian-Curtis-Biopic, derart gut ins Bild, das man von dessen Band Joy Division hat. Eine Auswahl der ikonischen Fotografien (oben: Dave Gahan von Depeche Mode) wird nun im Rahmen der Frühjahrsausstellung des Kunstforums gezeigt –mit Porträtierten aus Musik, Film, Literatur und Mode.
Die Ausstellung »Anton Corbijn – Favourite Darkness« ist von 15. Februar bis 29. Juni 2025 im Bank Austria Kunstforum Wien zu sehen. Unsere Leser*innenführung findet am 12. März von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr statt. Wir verlosen 25 Tickets unter www.thegap.at/gewinnen.









































































1 Waterdrop Explorer Thermo Tumbler


Nachhaltigkeit mit Stil: Der neue Explorer Thermo Tumbler von Waterdrop vereint hochwertige Materialien mit intelligenter Funktionalität und wird so zum idealen Begleiter für all jene, die in ihrem Alltag Stil und Komfort schätzen. Ein Statement-Piece, das langlebiges Design und innovative Isoliertechnologie kombiniert. Ab 20. Februar im Handel erhältlich. Wir verlosen zwei Exemplare.
2 »Pfau – Bin ich echt?«
Mit seinem Langfilmdebüt hat es Bernhard Wenger nicht nur aufs Cover unserer aktuellen Ausgabe geschafft, sondern auch in die Herzen diverser Festivaljurys. Er erzählt darin von Matthias (Albrecht Schuch), der in seinem Job bei einer Rent-a-Friend-Agentur geradezu aufgeht und dabei verlernt, er selbst zu sein. Witzig! Wir verlosen 5 × 2 Kinogutscheine, gültig in fast allen österreichischen Kinos.
3 Mario Wurmitzer »Tiny House«
Emil lebt in einem Tiny House am Rande einer Musterhaussiedlung. Er wird dafür bezahlt, dass er sich dabei rund um die Uhr filmen lässt – bis eines Tages sein Zuhause abbrennt. Absurd-komisch und gleichzeitig nah dran an der Realität unseres digitalen Zeitalters. Wirtschaftsskandale und Vernetzungstreffen von Rechtsextremen inklusive. Ab 12 . März im Handel erhältlich. Wir verlosen drei Exemplare.
4 Konrad Paul Liessmann »Der Plattenspieler«
Der Philosoph und begeisterte Plattensammler Konrad Paul Liessmann über »das Instrument, das alle Instrumente in sich vereint«. Der neueste Band aus der Reihe »Dinge des Lebens« stellt persönliche Musikerfahrungen Liessmanns neben eine kleine Kulturgeschichte des Hörens. Mit zahlreichen Illustrationen von Hanna Zeckau. Ab 24. März im Handel erhältlich. Wir verlosen drei Exemplare.
5 »Andy Warhols Frankenstein«
Paul Morrisseys Horrorgroteske aus dem Jahr 1973 gilt – mit ihren surrealen Gewaltorgien – als ein Highlight des Exploitationkinos. In der Hauptrolle: Udo Kier als Baron Frankenstein, der eine neue, vollkommene Rasse erschaffen will. »Flesh for Frankenstein«, so der Originaltitel des Films, wurde von Andy Warhol produziert. Ab 27. Februar im Handel erhältlich. Erstmals in 4K. Wir verlosen drei Mediabooks.

Auf die Fadesse wird g’schissen. »›Boring‹ is the worst word that I know«, machen die Cousinen Breitfuß auf ihrem zweiten Album klar und man darf durchaus davon ausgehen, dass die Langeweile normalerweise gar nicht im Gefühl oder Wortschatz vorkommt. Von Salzburg aus binnen kürzester Zeit zu heimischem Indie-Stardom: Das genrebegründende Debüt »Avant Trash« erscheint im September 2023; es regnet attraktive Slots auf Showcase-Bühnen und Gratisfestivals; Gigs in New York, Chicago, Peking. Zwangsläufig wächst mit einer gewissen Weltberühmtheit auch die Band. Live ist man jetzt zu fünft, am Cover immer noch zu zweit. Und, das wissen sogar diejenigen ohne Tarotkarten und Pendel: Auch 2025 wird’s sicher nicht »boring« für Cousines Like Shit. Tour und so. Aber auch in dieser Welt – weil du musst ja auch immer das große Ganze sehen –, in diesem »Permanent Earthquake« wird’s nicht fad. Ganz ehrlich, viel schöner kannst du es nicht beschreiben, was uns da alles noch bevorsteht.
Und, Bogen gespannt, »boring« ist auch musikalisch so ziemlich gar nichts: Da hast du natürlich deinen Trademark-Gitarrenrock mit zweistimmigem Gesang. Hin und wieder schummelt sich ein Synth in den Vordergrund. Dann hast du aber auch glitchige Dissonanzen drinnen (ist das noch Rockmusik oder schon »Hochkultur«?). Es ist schon für weniger eine Donaufestival-Anfrage durch einen Briefschlitz geflattert. Natürlich merkst du »Permanent Earthquake« die gewachsene Besetzung an, alles andere wäre ja auch seltsam. Du merkst aber auch eine Evolution in der Lyrikarbeit. Da gibt’s tolle Zeilen satt. Hier nur eine aus »No« als Teaser: »Is vintage clothing in the future an anachronism?« Cousines Like Shit geben dir also ordentlich etwas zum Nachdenken mit, lassen dir aber gar nicht so viel Zeit dafür. Blitzgneißer müsste man sein, acht kurze Songs vergehen schnell. Also lieber noch einmal von vorne. Aber: Auch beim zweiten, dritten, vierten Durchgang ist hier so gar nichts »boring«. Das gibt’s ja nicht! (VÖ: 21. März) Dominik Oswald
Live: 20. März, Wien, Chelsea — 29. März, Dornbirn, Spielboden — 11. April, Vöcklabruck, OKH


Konstrukt 5 — Phat Penguin
Mit »Konstrukt 5« veröffentlichen Buntspecht ihr bereits sechstes Studioalbum. Die Wiener Band versteht es wie wenige sonst, Gitarrenballaden mit dystopischer Romantik und freigeistiger Aufrichtigkeit zu verbinden. Sie ist wie ein Überraschungscocktail – eine zwar ungewohnte Mischung, aber mit Sicherheit hochprozentig. Im ersten Stück der Platte erklingt Lukas Kleins unverkennbare Stimme und singt: »Ganz egal, was vom Himmel fällt / Ganz egal, ob die Liebe hält.« Damit führt er uns gleich hin zum Thema des Albums: die Leichtigkeit der Gleichgültigkeit. »I don’t mind« und »Ganz egal«, heißt es in kindlicher Positivität bei »Im Fluss« sowie »Reprise«. Buntspecht begeben sich damit in die Hände des Schicksals, lehnen sich zurück und lassen sich sorglos in den Wellen der Melodien treiben. Auch beim Track »Vom Kopf der Hut« heißt es, »Alles wird gut / Schon morgen kommt die Flut« und »Egal, wovor du Angst hast / Es ist halb so schlimm«. Hier ist alles genau, wie es sein soll, und das Vertrauen darauf nimmt allen Ängsten die Ernsthaftigkeit. Es sind Balladen über die Sorglosigkeit, eine Wertschätzung der Apathie. Dazwischen finden sich Liebeslieder und Instrumentaltracks, melancholische Melodien sowie ein funky Fiebertraum. Bei allen Songs kommt das fantastische Arsenal von Instrumenten wie Saxofon, Trompete, Klavier und Kontrabass zur Geltung. Immer wieder verlieren sich Buntspecht in den sprachlichen Schönheiten der Unsinnigkeit.
»Konstrukt 5« ist ein Album mit ausgeprägtem Charakter, das die kalten Wintermonate mit seiner sturen Zuversichtlichkeit erträglicher macht. Wer aus dem Titel nicht schlau wird, ist der Band auf den Leim gegangen. Denn immer wieder sorgen Buntspecht für diverse Verwirrungen, legen falsche Fährten und geben sich den schönen Zufällen des Lebens hin. Ist man verrückt genug, sich in dieser Welt zu verlieben, wie Buntspecht es schon 2019 in ihrem Hit »Unter den Masken« predigten, so verliebt man sich mit Sicherheit auch in dieses Album.
(VÖ: 14. März) Mira Schneidereit
Live: 22. Mai, St. Pölten, Cinema Paradiso — 23. Mai, Klagenfurt, Burghof — 20. September, Wien, Arena Open Air

Selten noch lief ein Rezensionsexemplar bei mir so schnell in Endlosschleife wie das Debütalbum von Color the Night. »Queer Rage« fügt sich nahtlos in die Reihe der queeren Dancepop-Releases der letzten Jahre ein. Und muss sich auch im internationalen Vergleich mit Chappell Roan, Kim Petras, Troye Sivan & Co nicht verstecken. Dabei passt die junge Band aus Linz nicht nur in den musikalischen Trend. Noch nie zuvor war queere Sexualität derart breit und explizit zu hören. Was früher vielleicht ein paar Queercore-Artists für die Community-Nische produziert haben, findet heute ganz selbstbewusst und -verständlich Einzug in Songs, die auch die Heten da draußen hören dürfen. Nicht falsch verstehen: Sex ist nicht das einzige Thema von »Queer Rage«. Die Band findet klare Worte für eine Vielzahl von queeren Lebenserfahrungen. »It’s straight to hell / Not queer to hell«, heißt es etwa in »Alone« als Absage ans homophobe Heteronormativ. Oder wenn in »Drama Drama« die Ehefrau des heimlichen Lovers adressiert wird: »Honestly, I find it hard to believe / That you never noticed that he likes to receive.« Musikalisch liegt der Fokus klar auf dem eingangs erwähnten Dancepop. Egal ob energiegeladen-upbeat (»You and I«) oder funky-relaxed (»Fem Divine«). Viel Bass, viel Synthie, viel Falsett. Damit es nicht fad wird, geht es dazwischen in etwas indierockigere Gefilde (»Good Luck«) und sogar ins Soulig-Jazzige (»Bubbles«). Im glitzernden Cast von »Queer Rage« sind sie aber mehr die interessanten Charakterköpfe als die leuchtenden Stars.

Auch deshalb stellt sich mir zum Schluss dann doch die Frage, ob »Queer Rage« tatsächlich der passende Titel für das Ding ist. Denn Wut ist hier höchstens stellenweise zu spüren. Eher Lebensfreude. Vielleicht wäre »Queer Joy« treffender. Oder schlicht: »Unapologetically Queer«. Denn darum geht es hier im Kern. Queer sein ungeachtet der Umstände, ungeachtet der Anfeindungen und gesellschaftlichen Diskriminierungen. Party in your face. Und das ist eh produktiver als Wut, oder? Es macht zumindest mehr Spaß.
(VÖ: 7. März) Bernhard Frena
Live: 7. März, Linz, Stadtwerkstatt — 8. März, Wien, The Loft — 15. März, St. Pölten, Freiraum



Wenn sie sagen »Wer rastet, der rostet«, dann ist das erstens eine ziemliche kapitalistische Scheißideologie, die deinen Wert für dieses Scheißsystem nur nach deiner Produktivität misst; und zweitens hier nicht zutreffend, denn Garish scheinen, um zum springenden Punkt zu kommen, in Korrosionsschutzmittel zu baden wie andere in Milch. Sonst schafft man es fast nicht, nach acht langen Jahren genau so zu klingen, als wäre man nie weggewesen. Und das ist sowieso auch ein bisschen eine Übertreibung, weil hie und da hast du sicher was mitbekommen von vielleicht der österreichischen Indie-Institution. Debüt aus dem Nullerjahr; erst 2023 gab’s zum 25er ein Best-of; 2019 noch ein Livealbum; diverse andere Projekte; Familien gibt’s auch – like, wer’s kennt. Da kommen schon einmal acht Jahre zusammen. Aber Comeback ist’s keines, so viel sei klargestellt, von allen Seiten – nie weg und so. Würde man eh nicht glauben.
So zeigt sich der burgenländische Vierer auf dem malerisch betitelten und ebenso klingenden »Am Ende wird alles ein Garten« nämlich als unerschütterlich seiner »Brand Identity« verpflichtet. Wie etwa bei Element of Crime oder – sagen wir – AC/DC hörst du, spürst du beim ersten Takt, bei der ersten Silbe unverwechselbar Garish. Da aktivieren sich Flashbacks, dein episodisches Gedächtnis, das Verlieren in jener Zeit, als du zum ersten Mal diese Band gehört hast. Oder, beliebter: Erinnerungen an das erste Schmusen zu ihrer Musik. Und ich sage: Das ist gar nicht schlecht, das ist so circa das Beste, was dir passieren kann. Vor allem, wenn auch die neuen Stücke alles Potenzial dazu haben, solche Momente der Erinnerung zu schaffen. So ist auch auf Album acht diese musikalische Sanftheit allgegenwärtig (schätzomativ zu 95 Prozent). Romantischer Indiepop, zu leise für draußen, mehr ein Hörbuch für drinnen. Da musst du dich auf jede der vielen tollen Zeilen konzentrieren, darüber tausendmal nachdenken, mitfiebern, aufatmen, dechiffrieren. Also: so ziemlich alles beim Alten bei Garish. Und das ist ziemlich gut.
(VÖ: 14. März) Dominik Oswald
Live: 20. März, Linz, Posthof — 21. März, Graz, Orpheum — 22. März, Dornbirn, Spielboden — 4. April, Innsbruck, Die Bäckerei — 10. April, Wien, Wuk

Mit den Zeilen »Du siehst keine Farben / Bitte geh mir aus dem Weg / Ich brauch nicht dein Mitleid / Das ist keine Charity« steigt Kvsal selbstbewusst in das Eröffnungsstück »Natemu « ein. Er gibt uns eine Vorahnung davon, worum es in den nächsten knapp 30 Minuten gehen wird: Ansagen gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft und ein Feiern der eigenen Identität. Fließend wechselt er dabei zwischen Sinhala, Deutsch und Englisch. Auch musikalisch sind im ersten Track bereits viele Elemente vorhanden, die sich durch das Album ziehen. Dicke 808s treffen auf Trommelrhythmen und Flötenmelodien. Einflüsse aus Sri Lanka verbinden sich nahtlos mit Trap-Drums und elektronischen Synthiesounds. Besonders im Ohr bleibt »¡¡Shakeit!!«, ein Duett mit der Wiener R&B-Sängerin Chovo, das definitiv Sommerhitpotenzial mitbringt. Der lyrisch stärkste Track ist allerdings »Chef’s Kiss :*«. Kvsal rechnet darin mit Teilen der Wiener Hip-Hop-Szene ab und zeigt sich wütend auf Menschen, deren scheinbar antirassistische Einstellung sich nur in Lippenbekenntnissen, nicht aber im Handeln äußert.
Kurz vor Ende nimmt die Platte eine überraschende Wendung. Wer nach den ersten sieben Tracks denkt, die musikalische Palette sei ausgeschöpft, wird hier eines Besseren belehrt. Die beiden Stücke »Supersaiyajin« und »Scorch€d €arth Pol1c.y« kommen deutlich elektronischer daher und gipfeln schließlich in einer dichten Klangwand aus überlagerten, teils geschrienen Vocals, großen Drums und verzerrten Synths. Dieser Höhepunkt ist allerdings nicht der Abschluss des Albums. Mit »Thoughts While Eating Ramen Noodle« reiht sich am Ende ein Boom-Bap-Stück ein, das mehr wie ein Bonustrack wirkt. Kvsal bringt hier zwar starke Zeilen unter, musikalisch hätte es an einer anderen Stelle der Tracklist aber mehr Sinn ergeben. Möglich, dass der Künstler einfach noch ein paar Dinge klarstellen wollte. So verspricht er uns kurz vor Schluss: »Die Zukunft ist nicht pink, sondern melaninreich.« Wir können hoffen, dass er Recht behält, denn Kvsal beschert dem Wiener Rap eine neue Facette, die bislang fehlte.
(VÖ: 4. April) Jannik Hiddeßen



Lassen wir den Frühling in die Wiesen und Wälder einziehen. Das Gras weht im Wind. Bienen wie Schmetterlinge schwirren im Sonnenschein. Etwas Frisches liegt in der Luft. Mit derselben Schrittgeschwindigkeit, mit der man durch die Natur schweift, bewegt man sich auch durch Oehls Musik. Der namensgebende Liedermacher Ariel Oehl veröffentlicht sein drittes Album, es trägt den Titel »Lieben wir«. Als erster der 15 Tracks erdet das einminütige »Intro«, das eine gewisse Wehmut vor sich her seufzt. Hauchende, sich umspielende Saxofontöne samt Streicher erzeugen einen wärmenden Klang von Welt.
Ein Idyll, das vom Wort »Weltenuntergang« und dem gleichnamigen nächsten Song dieses Albums, gesprengt wird. Unterstrichen wird die Melancholie, indem Oehl die deutschsprachigen Liedtexte bis zur Unverständlichkeit in die Welt nuschelt. Das zwingt Hörende zur vollen Aufmerksamkeit und macht das Erlebnis so nahbar wie unnahbar. Was man versteht, stimmt nachdenklich: Es geht um nichts anderes als die Facetten der Liebe – »feuchte Augen«, »Veränderung«, »kleine Schritte« und »dann ist es zu spät«. Trivial sind die Texte nicht, denn wie bittet man schon jemanden zu bleiben. Darin verwoben: Franz Schuberts »Die Liebe liebt das Wandern« für die großen Ohren und »Auf der Mauer, auf der Lauer« für die kleinen. Sphärisch-mediativ mutet die Musik an, die einen ganzen Orchestersound erschafft und verstummt, sobald es der lyrische Schockmoment fordert. Hier und dort hüpfende wie schweifende Synthesizer, seufzendes Holz, melodisches Blech und kristalline Klavierhämmer. Besonders verführerisch klingt das vielseitige Schlagzeugspiel – intensiviert vom Bass –, das mit Nuancen von Becken, leeren Glasflaschen und Kuhglocke im poppigen Viervierteltakt nach einem Liveauftritt dürsten lässt. Ein akustisches wie elektronisches Musikwerk, das von einer flüchtigen Ewigkeit wispernd lyrisch von der Vergänglichkeit berichtet und zum Tanzen im Morgengrauen verlockt. Mehr davon, bitte. (VÖ: 14. März) Sandra Fleck
Live: 26. März, Graz, PPC — 27. März, Salzburg, Rockhouse — 28. März, Villach, Kulturhof — 29. März, Innsbruck, Treibhaus — 23. April, Wien, Arena

»Komm, ich zeig dir ein Stück von meiner Welt / Die mach ich mir so, wie sie mir gefällt«, singt Pippa auf ihrem neuen Album und referenziert dabei auf ihre BeinaheNamensvetterin Pippi Langstrumpf. Pferde und Affen kommen in dieser Welt zwar nicht vor, dafür werden der Verstand und auch die Neugier mit tierischen Qualitäten ausgestattet. Im Song »Verstand« wird ebendieser für ein paar Illusionen verkauft, soll aber – bitte – mit Liebe und ein bisschen Applaus gefüttert werden. Und die Neugier? Die ist überhaupt »ein seltsames Tier / Sie frisst dir aus der Hand / Und übergibt sich dann auf dir«.
Pippas Welt ist aber nicht nur voller Bilder, die einen so schnell nicht mehr loslassen, sondern auch voller lustvoller Widersprüche. Schon der Albumtitel legt nahe, dass die gebürtige Wienerin dem klassischen Entweder-oder überhaupt nichts abgewinnen kann. Ganz im Gegenteil: »Träume auf Zement« beschreibt unter anderem, dass es möglich ist, mit dem Kopf in den Wolken zu stecken, ohne dabei den Kontakt zum betonierten Untergrund vollkommen aufzugeben. Außerdem schließt das Verlangen nach Aufbruch – besungen im Song »Reise« – die Sehnsucht nicht aus, sich der Schönheit des Nichtstuns hinzugeben. Wenn Pippa in »Reise« davon erzählt, aufzubrechen, könnte sie das auf zwei unterschiedliche Arten meinen. Einerseits: alle Zelte abbrechen und los geht’s. Andererseits: Risse in der von Erwartungen, Normen und Rationalität geformten Fassade zulassen, um Tagträume und auch die eine oder andere Illusion hereinzulassen.
Musikalisch changiert Pippas viertes Album zwischen eingängigen Popmelodien und experimenteller Elektronik. Bei »Verstand« meint man ihre Liebe zur Band Wir sind Helden herauszuhören. Die »schüchterne Revolte«, von der sie auf ihrem Zweitling »Idiotenparadies« noch gesungen hat, ist gar nicht mehr so schüchtern. Sie ist mal lauter, mal leiser, mal konkreter, dann wieder abstrakter. Und irgendwie immer alles auf einmal. Entweder und oder.
Außerdem möchte sie unbedingt gefüttert werden.
(VÖ: 28. März) Sarah Wetzlmayr
10. April, Wien, Flucc Wanne


Manche Alben sind wie ein Spaziergang durch eine bekannte, aber doch alternative Welt. »Pierce the Ground«, das Debütalbum der Wiener Künstlerin und Musikerin
Sanna Lu Una, schlägt genau in diese Kerbe. Ein naturalistisches Avantgarde-Pop-Album, auf dem organischmetallische Beats auf Sanna Lu Unas ätherische und stellenweise stark effektierte Stimme treffen. Field-Recordings verorten die Stücke dabei am kroatischen Meer, im steirischen Schneetreiben oder bei einem slowenischen Perchtenlauf. Das getragene Songwriting und die verwobene Komposition der poetischen Verse erinnern stellenweise an Kolleginnen wie Soap & Skin oder Rosa Anschütz. Während das Album beim Verfassen dieser Rezension lief, drang aus dem Nebenraum die Frage: »Ist das Björk?« Vergleiche hin oder her, Sanna Lu Una stellt mit »Pierce the Ground« ein Debüt-Statement vor. Die insgesamt zehn Stücke sind kongruent angeordnet und durch eine ellenlange Liste von Gastmusiker*innen feinstens instrumentiert.
In einem Musikbusiness, in dem sich Künstler*innen gerne mal um ein paar Ecken verbiegen, um in den Katalog eines bestimmten Labels zu passen, welches doch kaum nachhaltige Traktion verspricht, ist es darüber hinaus umso respektabler, wenn der gesamte Prozess in Eigenregie gestemmt wird. Im Gespräch meinte Sanna Lu Una, sie hätte sich gefreut, wenn die Platte bei einem bereits bestehenden Label erschienen wäre. Da niemand das passende Angebot machte, wurde es am Ende der Eigenverlag. Their loss!

Wien, du grausame Stadt. Seit Jahrhunderten wird zu minimalistischer instrumentaler Begleitung darüber sinniert, wie grindig, schiach, traurig, aber doch schen die Bundeshauptstadt mit all ihren verlorenen Seelen nicht sei. Auch 2025, ein Jahr in dem der liebe Augustin längst hin ist, wird das so sein. Jedoch wird in den gegenständlichen Interpretationen von Vereter radikal – und längst überfällig – die Perspektive gewechselt. Es ist nicht so, als würde Pete Prison IV, Wienerkind der zweiten Generation, das Rad neu erfinden. Für ein willkommenes Update muss das aber auch gar nicht sein.
Während das konventionelle Wienerlied eigentlich untragbare Zustände im Innen und Außen romantisiert, legt Vereter den Finger in die Wunde und weigert sich, diese einfach zuzudecken. Das Ergebnis ist eine musikgewordene lokalkolorierte Hassliebe, die aus ihrer queer-migrantischen Perspektive einlädt, die Stadt, ihre Bewohner*innen und Institutionen durch das ansonsten zwinkernde Auge nüchtern zu betrachten.
Typischerweise ist die Platte »Ihr seit alle« durchzogen von einer schweren Melancholie, die ab der ersten Nummer eine massive Gravitation entwickelt, weil sie am Ende doch Hoffnung transportiert, das Bein zum Mitwippen zwingt und dank Zeilen wie »Und dann nehmen’s an fest, wenn ma ka Topfng’sicht hat / Und net Müller oder Maier heißt oder Hildegard« einen Schmunzler sicher haben.
Aufgenommen wurden die Lieder mal völlig solo, mal mit Unterstützung seiner Begleitband Die Woarmen Semmeln. Ebenfalls auf seiner Seite hat Vereter das Timing des politischen Klimas. Nicht, dass dieses für Menschen außerhalb der Dominanzgesellschaft jemals wirklich gemäßigt gewesen wäre. Dennoch findet die abschließende Frage im »Gürtel Walzer« derzeit wohl eine Resonanz wie seit längerer
Zeit nicht: »Wie lang schau ma zua?«

Im Infomaterial zu »Pierce the Ground« fällt außerdem das Zertifikat der Klimaneutralität auf – wohlgemerkt vom Plattenpresswerk selbst ausgestellt. Durch die teils ziemlich intransparenten Öko-Kompensationen macht eine ausgewiesene Klimaneutralität mittlerweile zwar kaum mehr Eindruck. Das Presswerk gibt aber jedenfalls an, durch die Rezyklierung von Produktionsausschüssen einen Recyclinggrad von bis zu 100 Prozent erreichen zu können. Durchaus beeindruckend. (VÖ: 4. April) Sandro Nicolussi Live: 28. Februar, Wien, Celeste
(VÖ: 21. März) Sandro Nicolussi
Live: 14. Februar, Wien, Einbaumöbel — 14. März, Wien, Reigen — 27. März, Graz, Café Wolf — 28. März, Bad Ischl, Kurdirektion — 29. März, Wien, Das Lot

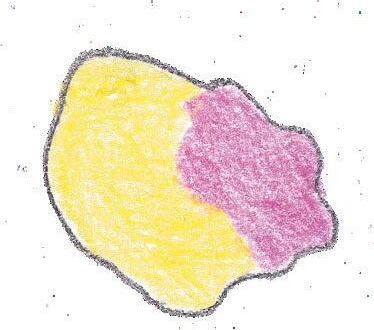

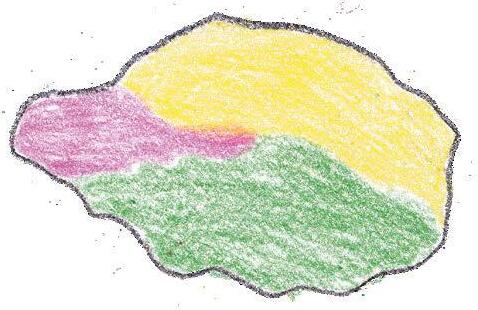
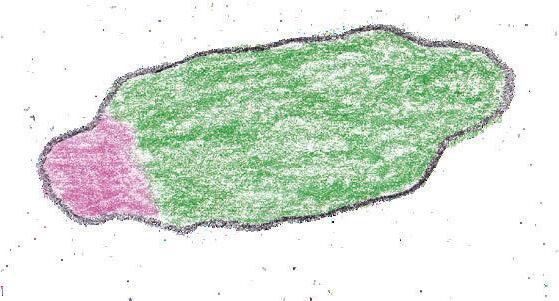
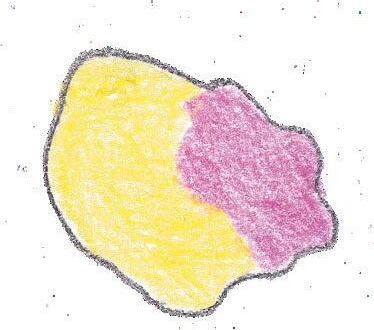


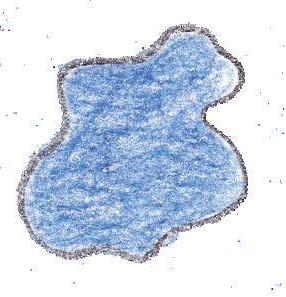
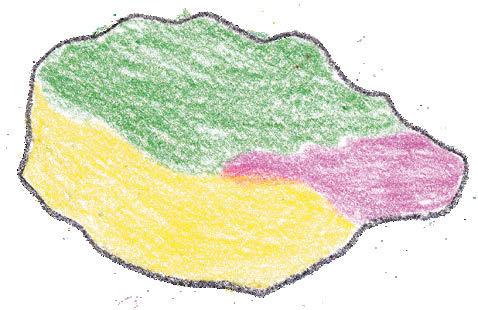





Im März veröffentlichen Cari Cari ihr drittes Album »One More Trip Around the Sun« – und gehen damit gleich auf Tour. Zunächst in den USA, aber ab April statten sie auch der EU eine Reihe von Besuchen ab. Ihr unverkennbarer Sound kommt eben überall gut an und ab einer gewissen Größe wird Österreich halt zu eng. Umso schöner, dass sich im dichten Zeitplan trotzdem vier Shows hierzulande ausgehen. 2. April Graz, Orpheum — 3. April Salzburg, Rockhouse — 9. April Innsbruck, Music Hall — 24. Mai Wien, Arena Open Air





















































»Vollmond«, das sechste Viech-Album, setzt auf Vielstimmigkeit – alle fünf Musiker*innen singen – sowie eine positive Rastlosigkeit. Zwischen Wolfsgeheul und Lachkrämpfen ist bereits beim Albumvorboten »Hasenfuß« die unbeschwerte Spielfreude der Band spürbar. 10. April Graz, Styrian Sounds Festival — 18. April Wien, Rhiz — 24. April Salzburg, Arge Kultur — 25. April Neußerling, Noppen Air — 9. Mai Öblarn, Ku:L — 23. Mai Steyr, Röda — 24. Mai Innsbruck, Bogenfest — 12. Juli Guntramsdorf, Streetfood & Sound Festival





An dieser Stelle dürfen wir euch ein kleines Geheimnis verraten: Good Wilson zählen zu den besten Indiepop-Acts des Landes. Aber pssst, nicht weitersagen! Wäre ja noch schöner, wenn das plötzlich alle wüssten … Nach fünf Jahren hat die Band ein neues Album mit dem passenden Titel »It Is Done« am Start, das wieder den Sound der 60er und 70er aufleben lässt. Das muss mit einer Releaseparty gebührend gefeiert werden. 6. März Wien, Rote Bar
Wer bei Sodl aufgrund der Vibes an einen verträumten FolkAct denkt, wird spätestens bei Tracks wie »Mary the Anarchist« überrascht sein, wie hart die Oberösterreicherin rockt. Ihr Debüt album »Sheepman« kommt am 14. März. Reinhören lohnt sich – ob live oder auf Platte. 8. März Linz, Brucknerhaus — Sargfabrik — 14. März Graz, Music House — 28. März Arge Kultur — 29. März Kirchdorf, Hildegard
Mit »Burn on!« erscheint dieser Tage das siebente Album der Wiener-Soul-Institution. Balsam für die Seele. Schauspielhaus — 20. März Mattersburg, Kulturzentrum — 21. März St. Pölten, Bühne im Hof — 26. März Salzburg, Arge Kultur — 27. März Innsbruck, Treibhaus — 28. März Spielboden — 4. April Graz, Orpheum — 5. April Drau, Schloss Porcia — 11. April Wien, Globe
Hochverlegt! Das Wuk war nicht groß genug für Zaho de Saga zan, die Durchstarterin der französischen Musikszene. Gleicher maßen von Jacques Brel wie von Kraftwerk beeinflusst, bewegt sie sich zwischen Chanson und kühler Elektronik. Das brachte ihr schon jede Menge Preise und ausverkaufte Shows ein – sowie Tränen der Rührung von Cannes-Jury-Präsidentin Greta Gerwig. 20. März Wien, Gasometer

Es gibt nicht genug Clubfestivals. Noch dazu solche mit Ambitionen. Das Offene Herzen Festival versteht sich als Safer Space und will das Thema Mental Health weiter enttabuisieren, weshalb es vor Ort auch Infostände geben wird. Musikalisch ist das Ganze mit Neunundneunzig, Nils Keppel, Mia Morgan, Modular und Ende (Bild) Richtung Postpunk, NNDW und Synthpop unterwegs. 5. April Wien, Wuk
30 Jahre Bandgeschichte haben uns mittlerweile 14 TocotronicAlben beschert. Das neueste heißt »Golden Years«, handelt von Reisen, vom Widerstand und von der Liebe. Es gibt sich gleichermaßen poetisch wie politisch, intim wie idealistisch. So stellen wir uns »Best Agers« vor. 22. März Wien, Konzerthaus
Der Elektropop der Marke Sofie Royer ist leichtfüßig, schillernd und reflektiert, manchmal melancholisch. Auf dem Album »Young-Girl Forever« widmet sich die Wiener Musikerin existenziellen Unsicherheiten und den Fallstricken, die der Kapitalismus –vor allem für junge Frauen – bereithält. 25. April Wien, Porgy & Bess
»Wenn wir politisch so weiteragieren wie bisher, werden wir bald wieder vor einem riesigen Abgrund stehen«, meinte Monobrother 2013 im Interview mit uns. Das hat sich seither mehrfach bestätigt. Welche Prophezeiungen der Rapper heute für die Zukunft hat, lässt sich live feststellen. 25. April Wien, Konzerthaus

Organisatorin Suuuper Samstag beim Nextcomic Festival
Was macht den Samstag beim Nextcomic Festival »suuuper«?
Das, was den Samstag wirklich »suuuper« macht, sind die Künstler*innen. Die österreichische Comicszene steht dort im Vordergrund. Wir haben so viele tolle Künstler*innen im Land, die wirklich großartige Projekte umsetzen, und der Suuuper Samstag bietet da eine Bühne. Die Zeichner*innen sind nicht nur Namen, die man irgendwo liest, sondern Menschen, mit denen man reden kann. Das hat etwas unglaublich Inspirierendes und kann sogar motivieren, seinen eigenen Comicstrip zu gestalten. Ich zum Beispiel habe nach meinem ersten Besuch beim Suuuper Samstag mein erstes Zine gezeichnet.
Was begeistert dich an Comics?
Comics sind so ein vielfältiges Medium, das viel zugänglicher ist als zum Beispiel ein Text. Geschichten in Bildern zu erzählen, ist so etwas Menschliches: von Höhlenmalereien über den Teppich von Bayeux bis zu den Kreuzwegen. Comics sind eine Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Kunst- und Erzählformen, deshalb kann man in der Gestaltung wirklich kreativ sein. Comics sind natürlich für viele spannend, ich habe aber das Gefühl, dass sie ein bisschen die Außenseiter*innen anziehen. Es ist Kunst, die zusammenbringt und nicht versucht, bestimmten Vorgaben zu entsprechen.
Welche Rolle spielt das Nextcomic Festival in der österreichischen Comicszene?
Die Comicszene befindet sich ein bisschen am Rande der österreichischen Kulturbranche, was Medienpräsenz und Förderungen anbelangt. Das Nextcomic Festival bietet da eine Bühne und Raum, um sich einem Publikum zu präsentieren, das sich vielleicht gar nicht so viel mit Comics beschäftigt. Die Ausstellungen ermöglichen es, Kunstwerke hängen zu sehen, die man sonst nicht im Museum finden würde. Im Ursulinenhof kommen Artists aus ganz Österreich und darüber hinaus zusammen, die sich dort vernetzen können. Ich denke, das Festival ist eine Wertschätzung für die Comicszene.
Nextcomic Festival 21. bis 28. März Linz, diverse Locations
Suuuper Samstag 22. März Linz, Ursulinenhof

Choreografien, Performances, Workshops und andere Formate, die tief blicken lassen. Nicht nur mit Studiobesuchen tief in den Probenprozess, der hinter jeder einzelnen Inszenierung steht, sondern auch tief in Fragen der Inklusion in sowie Exklusion aus den darstellenden Künsten. Das Imagetanz Festival sucht hier mit der Reihe »Brut barrierefrei« auch dieses Jahr nach Antworten. Wobei gelebte Erfahrungen von Künstler*innen und Besucher*innen mit Behinderung im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung stehen sollen. Zudem bringt Imagetanz wieder ein abwechslungsreiches Programm mit einer Vielzahl an internationalen und lokalen Künstler*innen und Kollektiven in seine Spielstätten. 15. März bis 12. April Wien, diverse Locations

Tricky Women zeigen Tricky Realities. Auch 2025 beweist die in der Festivallandschaft einzigartige Veranstaltung wieder, wie viel Vorstellungskraft in der Animationskunst von Frauen und genderqueeren Menschen steckt. Fantasievolle Filme erkunden dort direkt oder indirekt die schwierigen Realitäten unserer Zeit und nehmen das Publikum auf eine komplexe Gedankenreise in diverse künstlerische Welten mit. Dabei werden auf den Leinwänden von Tricky Women Tricky Realities die Gesetze der Physik von jenen der Vorstellungskraft abgelöst. 5. bis 9. März Wien, Metro Kinokulturhaus

Neue Perspektiven entdecken, sich Zukunftsfragen stellen und wortwörtlich die Stimme erheben – all das über das Ventil avancierter Musik und audiovisueller Experimente. Indem internationale Sprecher*innen aus den Bereichen Wirtschaft, Journalismus, Technologie und zivilgesellschaftlicher Initiativen auf Musiker*innen und Künstler*innen treffen, schafft das Elevate Festival einen weitreichenden politisch-kritischen Diskurs. Dass das Ganze auch außergewöhnlich gut klingt, dafür sorgen Acts wie: The Blessed Madonna (Bild), Goldie, Helena Hauff, Sofie Royer und Voyage Futur. 5. bis 9. März Graz, diverse Locations
Bereits zum 28. Mal bringt die Diagonale ihre differenzierte, vielschichtige und kritische Auseinandersetzung mit dem österreichischen Kino nach Graz. Die Geschichte des Festivals reicht somit bis in die 1990er-Jahre zurück. Noch weiter in die Vergangenheit geht der Blick in den filmhistorischen Specials – etwa in den sieben Programmen, die sich dem satirischen Schaffen im heimischen Film und Fernsehen widmen. 27. März bis 1. April Graz, diverse Locations
In die genau entgegengesetzte Richtung zur Mainstream-Blockbuster-Filmlandschaft geht es bei der Diametrale. Mit Humor und Komik bewegt sie sich an den eintönigen Ideen unserer optimierungswütigen Konsumgesellschaft vorbei und setzt dazu einen Kontrapunkt. Das Publikum kann sich von originellem Bewegtbild überraschen lassen und mit den vielfältigen Filmen auf der Festivalleinwand das Absurde feiern. 2. bis 6. April Innsbruck, Leokino
Schluss mit Tabus. Schluss mit Scham für die eigene Lust. Das Porn Film Festival begibt sich erneut auf die ehrgeizige Mission, das Genre der Pornografie aus den privaten Räumen zurück auf die öffentliche Leinwand des Kinos zu bringen. Damit feiert es Lust wie Leidenschaft aller Art und trotzt den monotonen Blickwinkeln des konservativen Mainstream-Pornos mit queer-feministischen Gegenentwürfen. 10. bis 14. April Wien, diverse Kinos
Nach dem Namenswechsel im letzten Jahr – aus dem Craft Bier Fest wurde das Super Bier Fest –findet dieser Pflichttermin für Freund*innen des gepflegten Biergenusses nun erstmals in der Ottakringer Brauerei statt. Eure Gaumen erwartet eine so bunte wie umfangreiche Auswahl heimischer und internationaler Biere, über die man sich leidenschaftlich mit den zahlreich anwesenden Brauer*innen austauschen kann. 11. und 12. April Wien, Ottakringer Brauerei
Arvida Byström: Who’s Your Daddy?
Für ihre Kunst stellt sich Arvida Byström vor wie auch hinter die Kamera und spiegelt so einen zentralen Aspekt digitalisierter Welt wider, in der sich die Rollen von Produzent*in und Konsument*in immer überlappen. Der (weibliche) Körper und die (weibliche) Sexualität stehen im Zentrum ihrer Auseinandersetzung mit Onlinewelten sowie der darin erfolgenden Produktion von Körperbildern und -begriffen.
Eine besondere Rolle für die Ausstellung im OK Linz spielen die Bildproduktion durch künstliche Intelligenz und das zwiespältige Verhältnis zu Kopien von Bildern unseres Selbst –zwischen der digitalen Vervielfältigung in den eigenen Onlineprofilen und der Angst vor Fälschung. bis 25. Mai Linz, OK







1977 war in Österreich die letzte institutionelle Einzelausstellung von Greta Schödl zu sehen. Im Anschluss an ihre Einladung vergangenes Jahr zur internationalen Biennale von Venedig ist jetzt zum ersten Mal nach fast 50 Jahren wieder eine Ausstellung ihrem Werk gewidmet. Schödls Arbeiten werden dem Feld der Visuellen Poesie zugeschrieben und beschäftigen sich mit Sprache als Schriftbild und dem, was sich in ihr zeigen kann – oft mit explizit feministischem Einschlag. »Mit der Handschrift zu schreiben, offenbart, wer wir sind«, sagt die Künstlerin. bis 26. April Wien, Phileas
Der Kunstverein Gartenhaus eröffnet den neuen Standort in der Piaristengasse im achten Bezirk mit einer Ausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Raque Ford. Fords Praxis und Arbeiten sind stark von der kulturellen Produktion der Gesellschaft informiert. In ihnen kommen Bilder, Objekte, Gedanken und Sprache einer Zeit zusammen, um inmitten all diesen Materials die Frage nach der Produktion von Identität zu umkreisen und den Blick auf das Dazwischen freizugeben. bis 15. März Wien, Kunstverein Gartenhaus
Zuletzt vergab die Kunsthalle Wien ihren jährlichen Preis nicht nur an je ein*e Student*in von Akademie und Angewandte, sondern zusätzlich noch an weitere acht Nebenpreisträger*innen. Unter der neuen Leitung von Michelle Cotton werden wieder nur noch zwei Künstler*innen prämiert. Ein Schritt, der sicherlich die Entscheidung der Jury erschwert, den Ausgewählten aber eine größere Bühne bietet. Die Arbeiten von Rawan Almukhtar und Ida Kammerloch sind bei freiem Eintritt im Glaskubus am Karlsplatz zu sehen. bis 20. April Wien, Kunsthalle Karlsplatz
Das Anthropozän bezeichnet jene erdgeschichtliche Epoche, in der sich die Anwesenheit der Menschheit auf dem Planeten merklich in dessen Ökosystem eingeschrieben und dieses verändert hat. Ein Umstand, mit dem sich in den letzten Jahren österreichische sowie lokale Künstler*innen in zwölf über Europa und die USA verteilten Ausstellungen auseinandergesetzt haben. Im Linzer Lentos sind nun die gesammelten Arbeiten der über 100 Künstler*innen zu einer großen Gruppenschau zusammengefasst. bis 18. Mai Linz, Lentos
Mit dieser Ausstellung nähert sich das Architekturzentrum dem Einfamilienhaus in der Vorstadt und der Vorstadt selbst an. Nicht nur als Bauform und stadtplanerisches (Standard-)Modell, sondern auch als Lebensentwurf, in dem bestimmte Begriffsverständnisse von Gesellschaft und Individuum, Raum und Umwelt ausgedrückt sind. Ein Lebensentwurf, der zunehmend als Belastung empfunden wird. Wie können Alternativen dazu aussehen? Wie kann der Bestand verändert und genutzt werden? 6. März bis 4. August Wien, Architekturzentrum
Im historischen Zentrum von Feldkirch steht der Pulverturm. 1460 erbaut und ursprünglich für die Lagerung von – no na – Schießpulver konzipiert, beheimatet er nun geistigen Sprengstoff: Kunst. Im März wird der Verein Offene Kultur Feldkirch darin zündeln und zur Eröffnung gibt’s gleich ein Feuerwerk: Unser Artdirector Markus »Dr. Knoche« Raffetseder und der Comickünstler Michael Hacker verschmelzen zu Dr. Knacker und stellen ihre Siebdrucke und Gigposter aus. 7. bis 11. März Feldkirch, Pulverturm

Regisseurin »Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte«
Dein Film beschäftigt sich mit Leben und Werk der Fotografin Libuše Jarcovjáková. Wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
Ihre Fotoserien aus dem legendären T-Club hatte ich zuvor schon gesehen, aber erst mit ihrer ersten großen Einzelausstellung auf dem Fotofestival in Arles, Frankreich, wurde eine breitere Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. Die Ausstellung wurde mit hohem Lob bedacht. Später wurde ich von der Redaktion des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens Česká televize angesprochen, ob ich Interesse hätte, ein dokumentarisches Porträt von Libuše zu erstellen. Als ich sie zum ersten Mal traf, war ich zutiefst fasziniert von ihrer Persönlichkeit, ihrer Geschichte und den Fotos, die ihr bemerkenswertes Leben dokumentieren.
Warum hast du auf »klassische« Mittel des Dokumentarfilms wie Interviews oder neu gedrehtes Material verzichtet?
Libuše hat mir zu Beginn gesagt, dass sie auf keinen Fall als sprechender Kopf in dem Film auftreten möchte, und ich war damit einverstanden. Ich wollte unbedingt ihre Perspektive, ihre damaligen Gedanken bewahren, damit ihre Geschichte, ihre Suche und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit auf der Leinwand lebendig werden. Ich wollte nicht meine eigenen Bilder in die Geschichte einbringen, sondern die Sichtweise aus ihrer Perspektive beibehalten. Das erschien mir als der reinste und stärkste Ansatz.
Welche Geschichte(n) erzählen uns Jarcovjákovás Fotografien aus der LGBTQIA*-Szene, heute?
Es stellte sich heraus, dass Libušes Fotos aus dem T-Club wirklich einzigartig sind; niemand sonst hielt die queere Szene zu dieser Zeit auf diese Weise fest – nicht nur im T-Club, sondern innerhalb der gesamten queeren Community. Der historische Kontext ist unbestreitbar faszinierend – es ist ein Einblick in die verborgene Seite des sozialistischen Lebens, wo sich die marginalisierte, damals nicht akzeptierte queere Community heimlich versammelte. Gleichzeitig sind Libušes Fotos zutiefst künstlerisch und fangen eine Sehnsucht nach Freiheit, Freude und Lebendigkeit ein, selbst in Schwarz-Weiß.
»Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte«
Start: 21. März

Regie: Gia Coppola
Die Kritik zeigt sich begeistert von Pamela Andersons Darstellung in Gia Coppolas »The Last Showgirl«. Dabei hätte sie fast nicht von dem Projekt erfahren, denn Andersons (mittlerweile ehemaliger) Agent sagte der Regisseurin einfach ab. Durch ihren Sohn, der zuvor auch die Netflix-Doku über Pamela Anderson produziert hatte, erfuhr sie dann doch noch davon – und war sofort begeistert. Der Plot: Shelly (Pamela Anderson) ist seit mehr als 30 Jahren Tänzerin in der Show »Le Razzle Dazzle« in Las Vegas. Nun soll der letzte Vorhang fallen. Shelly muss über ihre Zukunft nachdenken – und die Beziehung zu ihrer Tochter Hannah (Billie Lourd) retten. Der Film ermöglicht Pamela Anderson, neue Facetten ihrer Schauspielkunst zu zeigen, und verhandelt Träume sowie deren Ende. Start: 20. März

Regie: Rich Peppiatt Regisseur Rich Peppiatt bringt die Geschichte der irischen Hip-Hop-Crew Kneecap auf die große Leinwand – und der Film wurde gleich von Irland für den »Auslandsoscar« eingereicht. Gegründet wurde die Gruppe 2017 von Mo Chara, Móglaí Bap sowie DJ Próvaí und noch im selben Jahr erschien ihre erste Single »C.E.A.R.T.A«. Gleichzeitig wurde auch die politische Gesinnung der drei publik: Sie setzen sich nämlich für den irischen Republikanismus ein, eine politische Bewegung, die die Wiedervereinigung Irlands anstrebt – das Land ist ja seit 1921 in Irland und Nordirland geteilt. Die Bandmitglieder spielen sich im Film selbst, sonst ist unter anderem noch Michael Fassbender dabei. Ein Film über Sprache und Identität sowie Jugend- und Musikkultur. »Eine der lustigsten Filme des Jahres«, urteilte The Guardian. Start: 21. März
Regie: Andrea Arnold ———— Für diesen Film ließ Barry Keoghan »Gladiator II« sausen. In »Bird« erzählt Andrea Arnold vom Mädchen Bailey (Nykiya Adams), das mit ihrem Bruder Hunter (Jason Buda) und ihrem Vater Bug (Keoghan) zusammenlebt. Während der arbeitslose Bug ständig wirre Geschäftsideen hat, hat er vor allem eines nicht: Zeit für Bailey. Diese flieht von daheim und trifft auf den Außenseiter Bird (Franz Rogowski). Start: 14. Februar
Regie: Bong Joon-ho ———— Wie wäre es, wenn man sich nach dem vorzeitigen Ableben einfach neu »ausdrucken« lassen könnte? Nicht so super, glaubt man der Vision von Bong Joon-ho, dem Regisseur von »Snowpiercer« und »Parasite«. Denn der titelgebende Mickey (Robert Pattinson) und seine Klone werden nacheinander als Versuchskaninchen für gefährliche Missionen auf einem anderen Planeten verwendet. Bis ein Klon wider Erwarten doch nicht stirbt. Start: 6. März
Regie: James Mangold ———— Braucht es ein weiteres Bob-Dylan-Biopic? Kommt auf den Hauptdarsteller an. Im New York der 1960er versucht Dylan (Timothée Chalamet) seinen eigenen (musikalischen) Weg zu gehen, und das in einer turbulenten Zeit. Er wechselt von Folk zu Rock und packt beim Newport Folk Festival 1965 erstmals seine E-Gitarre aus. Der Film erhielt mehr als 100 Nominierungen für Preise, darunter acht für einen Oscar. Start: 27. Februar
Regie: Pamela Hogan ———— 24. Oktober 1975: 90 Prozent der weiblichen Bevölkerung Islands lassen an diesem Tag die Care-Arbeit unerledigt. Ein Streik, der seinesgleichen sucht. Die Frauen verweigerten Putzen, Kochen und die Kinderbetreuung und gingen stattdessen auf die Straße. 50 Jahre später blicken damalige Aktivistinnen auf den Tag und dessen Auswirkungen zurück. Ein Film über die Macht des kollektiven weiblichen Widerstands. Start: 7. März
Regie: Johan Grimonprez ———— 1961 wird Patrice Lumumba, Premierminister der Republik Kongo und Kämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung, ermordet. Die belgische Königsfamilie und die CIA sollen involviert sein. Kurz danach wird der Sicherheitsrat der UN von Protestant*innen gestürmt, die gegen Lumumbas Ermordung demonstrieren, darunter die Musiker*innen Max Roach und Abbey Lincoln. Start: 3. April

Idee: Eric Newman und Noah D. Oppenheim Mit einem bekannten Cast und einem aktuellen Thema kann »Zero Day« aufwarten: Die Thrillerserie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Verschwörungstheorien und dem Kampf um die Wahrheit. Dabei gibt Robert De Niro sein TV- beziehungsweise Streamingdebüt: Er spielt den früheren US-Präsidenten George Mullen, der einen Ausschuss zur Klärung einer globalen Cyberattacke leitet. Wird die Wahrheit ans Tageslicht kommen? ab 20. Februar Netflix

Idee: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory und Frida Perez Hier spielt das Filmbusiness die Hauptrolle. Komödienveteran Seth Rogen mimt in »The Studio« Matt Remick, den neuen Leiter der Continental Filmstudios. Ein Job, der ihn mit selbstverliebten Schauspieler*innen und vielen anderen Problemen konfrontiert – schließlich müssen die Filmstudios gerettet werden. Chaos, Drama, schräger Humor und berühmte Gaststars erwarten uns. ab 26. April Apple TV+


bewegen bewegte Bilder – in diesem Kompendium zum gleichnamigen Podcast schreibt er drüber
Hmm, ja, okay – aber was müsste man sich dafür reinpfeifen, wenn man es wirklich drauf anlegen wollte? In welcher Dosierung? Und mit welchen Wechselwirkungen? Kein Pharmazeut weit und breit, der das klären könnte – und leider auch kein David Lynch mehr, na ja. Ah, ihr seid ja schon da! Sorry, war kurz in slightly melancholischer Stimmung und auch sonst latent abgelenkt. Eben stand noch Janelle Monáe in einem bis zur Decke vollgeräumten Kammerl der Criterion Collection und meinte, das Anschauen von Lynchs »Eraserhead« fühle sich an, als wäre man gleichzeitig auf fünf verschiedenen Drogen.
Ich geb’s zu: Vielleicht war ich doch ein bisschen zu lange im »Criterion Closet« versumpft – jenem tollen Youtube-Format, in dem Popkultur-Zelebritäten sich ein Sackerl mit filmischen Preziosen vollräumen, die ihnen taugen, fehlen oder einfach gut ins Regal passen. Ein echtes Rabbit Hole mit erstaunlichen Erkenntnissen: Jarvis Cocker hat »Salò« noch nie gesehen (holt es aber nach), Winona Ryder erinnert sich gern ans Schreibmaschinenrattern ihres Vaters und Pamela Anderson outet sich als Cinephile mit Faible für Fellini, Godard und – again! – Lynch.
Salles ist noch da Eigentlich war ich hier – rein zu Recherchezwecken, ich schwöre! – wegen Walter Salles, jenem Regisseur, der sich vor gut zwei Jahrzehnten mit behutsam-brillanten Werken wie »Central Station« und »The Motorcycle Diaries« als hervorragender Mitgestalter des lateinamerikanischen Kinos einen Namen gemacht hatte. Dann kam Hollywood: Auf ein solides JapanHorror-Remake (»Dark Water«) und eine dürftige Kerouac-Adaption (»On the Road«) folgte jedoch eine viel zu lange Schaffenspause. Nun ist Salles wieder da. Nicht nur im »Criterion Closet« (seine Beute btw: Tarkovskis »Andrei Rublev«, Scorseses »Raging Bull«, Antonionis »La notte«), sondern auch in seiner Heimat und auf den Kinoleinwänden – mit einem neuen Film, dessen Titel kaum passender gewählt sein könnte: »I’m Still Here« (Kinostart: 14. März).

Das Familienidyll zu Beginn von »I’m Still Here« trügt: Im Hintergrund lauert bereits die Militärdiktatur.
Bevor Salles zum Kern der (wahren) Geschichte seines Werkes vordringt, lockt er das Publikum aber erst einmal in eine raffiniert konstruierte Falle. Wir schreiben das Jahr 1971 in Rio de Janeiro: Der Ex-Politiker Rubens Paiva (Selton Mello) ist nach Jahren im Exil erst kürzlich wieder zu seiner Familie zurückgekehrt, nachdem er während der Revolution aus der Regierung gedrängt worden war. Mit seiner Frau Eunice (Fernanda Torres) und den fünf Kindern führt er ein ausgefülltes sowie von Wärme und Zuneigung durchdrungenes Leben. Endlose Tage am Strand, spontane Tanzpartys, Freund*innen, die kommen und gehen – sogar ein streunender Hund findet Unterschlupf: Die Harmonie im Hause Paivas scheint schier unerschütterlich.
Unwillkürlich und wider jede Wahrscheinlichkeit hofft man bei sich, dass dieses fragile Paradies mehr als die ersten Minuten des Films überdauern und sich hier nichts Unangenehmes mehr ereignen möge. Aber, aber: Die Idylle spielt sich vor dem Hintergrund einer Militärdiktatur ab, die seit einem Putsch vor sieben Jahren das Sagen im Land hat. Helikopter durchpflügen den Himmel, Armeekonvois rollen durch die Straßen, die Nachrichten berichten von politischen Entführungen wie jener des Schweizer Botschafters – das Regime ist omnipräsent.
Die Eltern wissen um die Gefahr, wahren aber den Schein. Bis das Unvermeidliche eintritt und eines Tages strenge, bewaffnete Herren vor der Tür stehen, die Rubens zu einer »kurzen Befragung« mitnehmen wollen. »Zum Soufflé bin ich wieder da«, versucht er die Seinen noch mit demonstrativer Gelassenheit zu beruhigen, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Bald darauf wird auch Eunice an einen geheimen, dunklen Ort gebracht, wochenlang verhört und dann ohne Erklärung entlassen. Zu Hause setzt sie alles daran, den Kindern ein Leben in relativer Normalität zu ermöglichen. Obwohl sie ahnt, dass sie alle Rubens nie wiedersehen werden, sucht sie jahrelang weiter nach Informationen über sein Schicksal, stößt aber beharrlich auf Schweigen und unverblümte Gleichgültigkeit.
Filmische Arbeiten, die sich mit Schandtaten repressiver Systeme auseinandersetzen, gibt es zwar nicht wie Sand an der Copacabana, aber doch genug, um ihre Muster zu erkennen. Salles beschreitet auf wohltuende Weise nicht den Zugang eines heroisch aufgeladenen Agitprop, sondern einen weit subtileren. Dass der Filmemacher selbst aus einer brasilianischen Politikerfamilie stammt und die Paiva-Kinder aus seiner Jugend kennt, verleiht »Ainda estou aqui«, wie der Film im Original heißt, dabei greifbare Authentizität. Das Gezeigte gleicht sogar einer ausgedehnten Erinnerung: In gedämpften Farben, mit zurückhaltender Kamera und einer gespenstischen Grundstimmung wird hier von der seltsamen Ohnmacht berichtet, die sich einstellt, wenn der eigenen Welt von oben herab ein elementarer Teil entrissen wird.
Keine lauten Töne
Aufbauend auf der monumentalen Leistung seiner mehrfach preisgekrönten Hauptdarstellerin Fernanda Torres legt Walter Salles in seinem Comeback ein eindringliches Porträt von Verlust und unbeugsamem Widerstand vor, das umso kraftvoller wirken kann, als es ohne laute Töne auskommt. In der unaufgeregten Schilderung der Erosion dessen, was sich Alltag nennt, liegt die ureigene Qualität dieses Films. Er fordert schlicht heraus, über eine bürgerliche Existenz unter autoritärer Führung zu sinnieren – über ein allgegenwärtiges Szenario der Angst, das sich nicht immer in Schüssen, sondern ebenso gut im Schweigen manifestiert. Hier transportiert dieses eine bedrückende filmische Botschaft aus einer spezifischen Vergangenheit, die sich als universelle Mahnung für die Gegenwart erweist: Der Firn der Zivilisation ist entschieden dünner, als wir uns einzugestehen wagen.
prenner@thegap.at • www.screenlights.at
Christoph Prenner plaudert mit Lillian Moschen im Podcast »Screen Lights« zweimal monatlich über das aktuelle Film- und Seriengeschehen.
Lesen Sie, was die Welt bewegt. Am Wochenende gedruckt und täglich digital.

Nachrichten für jeden Moment – Print & Digital. Jetzt abonnieren: diepresse.com/kombiabo

»Mondmilch trinken immer und jetzt – Dein Solarplexus ist mir egal« ist ein temporeiches, absurdes Theaterstück, das die drängendsten Fragen unserer Zeit kaleidoskopartig aufgreift. Inszeniert von Josef Maria Krasanovsky prallen hier die Welten von Mensch, Tier und Klima aufeinander. Dabei wird allerdings nicht nur zum Nachdenken angeregt, sondern auch das Lachen kommt ob der Skurrilität des Ganzen nicht zu kurz. Zwischen Klimacowboys und übergewichtigen Papageien entfaltet sich nämlich ein schillernder Bilderreigen – ein einzigartiges Theatererlebnis, das alles andere als vorhersehbar ist. 14. und 15. Februar Salzburg, Schauspielhaus 21. und 22. Februar Wien, Schauspielhaus 28. Februar und 1. März Graz, Theater am Lend

Eric und Margot sind zwei Holocaustüberlebende, die sich 1945 in einem Zug nach Paris kennenlernen und danach gemeinsam versuchen, ihre Traumata zu verarbeiten und eine neue Zukunft aufzubauen. Die Produktion »Langsam ohne zu zögern« von Elise Hofner und Samuel Machto verwebt Tanz, Musik und Erzählkunst zu einer bewegenden Reflexion über Resilienz, Verlust und jüdische Identität. Nachdem das Stück bereits 2022 im Theater Nestroyhof in französischer Originalfassung gezeigt worden ist, kehrt es nun für seine deutschsprachige Erstaufführung dorthin zurück. Der Abend verspricht ein intensives, berührendes Theatererlebnis, das lange nachhallt und zur Auseinandersetzung mit der Geschichte einlädt. 4. bis 12. März Wien, Theater Nestroyhof / Hamakom
Ein Alien erzählt von prekären Biografien, familiärer Solidarität und gesellschaftlichen Kämpfen. Mit »Fotzenschleimpower gegen Raubtierkaputtalismus« (was für ein Titel!) entfacht Mateja Meded im Kosmos Theater ein fulminantes Solo-PerformanceFeuerwerk, das mit Witz und Schärfe Klischees über Flucht und Ankommen zerschlägt sowie den »Jugofuturismus« feiert. Eine 70-minütige Tour de Force, die berührt, provoziert und begeistert. Special Wiederaufnahme-Treat: jetzt mit erweitertem Kapitel über Pseudo-Aktivismus! 27. Februar bis 1. März Wien, Kosmos Theater
Rasant, laut und provokant: »Eskalation Interdit« vom Theaterkollektiv Kochen mit Wasser verbindet immersive Performance, Punkmusik und den Geist von Drahdiwaberl zu einem grellen Diskurs über Verbotskulturen, Gruppenzugehörigkeit und Machtmechanismen. Für das Stück wurde interviewbasiert gearbeitet. Es wird hinterfragt, wie wir denken, handeln und kommunizieren. Wenn alles gesagt ist, bleiben die Bewegung, der gemeinsame Atem und Schweiß sowie die Musik. Eine Übung in echter Akzeptanz. 28. Februar bis 13. März Wien, Theater am Werk Petersplatz
Zwei Frauen untersuchen ihre Körper und Sexualität, während sie das Publikum herausfordern, hinzuschauen und dabei den eigenen Blick auf Tabus zu reflektieren. Als provokante Körperperformance spielt »Articulated – Back Then We Were Always Naked« mit Lust, Fantasie und sexuellen Grenzen. Sexpositivity, BDSM und der heutige Diskurs über sexuelle Freiheit werden in ihrer Komplexität humorvoll und subversiv beleuchtet. Ein faszinierender Blick auf die Verschiebung von Grenzen in der gegenwärtigen Gesellschaft. 6. bis 8. März Graz, Theater am Lend
Sehr frei nach Shakespeare versetzen Kaja Dymnicki und Alex Pschill Cäsar aus dem Rom des Jahres 50 vor unserer Zeitrechnung in ein Büro der 1980er. Während Cäsar dort kettenrauchend allerlei antidemokratische Gesetzesänderungen plant, versuchen seine Kumpels Brutus, Casca und Cassius verzweifelt, die Republik zu retten und dabei ihre eigenen neurotischen Probleme zu lösen. »Cäsars Büro« verspricht eine Kriminalkomödie, eine brillante Satire und eine pointierte Reflexion über den populistischen Zeitgeist. 9. März bis 13. Mai Wien, Bronski & Grünberg
Gewidmet all denjenigen, die beim Lesen auf die eine oder andere Wissenslücke gestoßen sind.
02:11 dauert der kürzeste Taylor-Swift-Song »I Look in People’s Windows«. Don’t be creepy, Taylor! Vor Emotionen kommen die Affekte. Sie sind eine grundlegende initiale Reaktion, die noch nicht in bestimmte Bahnen geleitet worden ist. Das erlaubt einen unmittelbaren – positiven wie negativen – Bezug zu was auch immer den Affekt ausgelöst hat. Ein Bodycount bezeichnet die Anzahl der Menschen, mit denen eine Person sexuellen Kontakt hatte. Der Begriff wird unter anderem in toxisch-männlichen Internetkreisen – der sogenannten Manosphere – verwendet, wobei für Männer ein hoher Bodycount gut sei und für Frauen ein niedriger. Jugofuturismus versteht sich selbst als Gegenbewegung zur Jugonostalgie und möchte die unausgeschöpften Potenziale des ehemaligen sozialistischen Staates nutzen, ohne die negativen Seiten schönzureden. Psychagog*innen vereinen psychologische und pädagogische Ansätze, um Kinder und Jugendliche nicht nur akademisch, sondern auch sozial sowie psychisch zu unterstützen. Mit dem Panoptikum erfand Jeremy Bentham eine neue Form des Gefängnisses, dank der Wärter*innen die Inhaftierten theoretisch zu jedem Zeitpunkt observieren können, ohne dass diese jemals wissen, ob sie gerade gesehen werden oder nicht. Das führt dazu, dass sie stets so handeln müssen, als stünden sie unter Beobachtung. Sie verinnerlichen die Wärter*innen. Foucault nahm dies als Modell, um zu beschreiben, wie sich alle Menschen in unserer Gesellschaft der allgegenwärtigen Überwachung und Disziplin verhalten. Unter Sexpositivity wird eine Reihe von Ansätzen zusammengefasst, die versuchen, ein offeneres und insbesondere für FLINTA* freieres sowie sichereres Verständnis von Sexualität zu etablieren. Hervorgegangen sind diese Bemühungen aus den sogenannten »Sex Wars«, während derer Feminist*innen in den 70ern und 80ern darüber diskutierten, inwiefern Sexualität als Mittel der Emanzipation oder der Unterdrückung funktioniere. Von einem Take-over spricht man, wenn ein Social-Media-Kanal für eine gewisse Zeit von einer anderen Person als üblich bespielt wird.


Meinungsfreiheit, Political Correctness und wie sie instrumentalisiert werden. ———— Vor genau sechs Jahren näherte sich Jonas Vogt in der Coverstory mit dem Titel »Das wird man wohl noch sagen dürfen« einer – zugegeben – nicht ganz unkomplizierten Gemengelage an, die immer wieder den (vor allem von rechts kommenden) Reflex auslöst, es gäbe eine übertriebene Kultur der Political Correctness und regelrechte Denkverbote (natürlich von links). In aller Kürze: Das von radikalen Stimmen bewusst verschobene »Overton-Fenster« gesellschaftlich akzeptierter Äußerungen, Reaktanz, also eine Abwehrreaktion auf empfundene Einschränkungen, und der Zusammenhang von Sprache und Machtstrukturen spielen dabei eine Rolle. Und sonst so in dieser Ausgabe? Evi Romen und David Schalko über ihre Serie »M – Eine Stadt sucht einen Mörder« sowie Gabriel Roland im Interview mit Hans-Christian Dany, dem Autor des Bomberjackenhandbuchs »MA-1. Mode und Uniform«. Außerdem zitiert Stefan Niederwieser in seinem Text über »Drogen in heimischen Popsongs« Raf Camora: »Die Taschen voll mit Geld wegen Kokain / Das Taxi wird bestellt, sie haben Bock zu ziehen.« Wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Wei Sraum Innsbruck
Der White Cube ist nicht umsonst ein beliebter Raumtypus in Kunst- sowie Designkontexten. Er drängt sich nicht in den Vordergrund, bietet eine leere Leinwand, auf der vieles möglich ist. Das Wei Sraum Designforum in Innsbruck nimmt diesen Möglichkeitsraum, um Gesprächen, Workshops und Ausstellungen eine Plattform zu bieten. Im Zentrum steht dabei immer das Potenzial, das Gestaltung – im weitesten Sinne – für unsere Gesellschaft hat. Bestes Ambiente für das edle Designobjekt The Gap! Andreas-Hofer-Straße 27, 6020 Innsbruck
Schallter Wien
Plattenläden gibt es viele, aber wenige sind so hell, einladend und gut sortiert wie der Schallter Record Store im siebten Wiener Gemeindebezirk. Westbahnstraße 13, 1070 Wien
Mitten im Herzen Mödlings bietet die Redbox nicht nur ein reichhaltiges Eventprogramm, sondern auch Proberäume und Auftrittsmöglichkeiten für junge Bands. Eisentorgasse 5, 2340 Mödling

Josef Jöchl
artikuliert hier ziemlich viele Feels
Ein kräftiges Hallo schadet nie. Im Gegenteil. Es verleiht eine freundliche und selbstbewusste Aura, selbst wenn man eine Person gar nicht so gut kennt. Außerdem bilde ich mir ein, dass man mit jedem Gruß ein kleines Nest der Menschlichkeit baut, das uns in eisigen Zeiten ein wenig zu wärmen vermag. Wer wird nicht gerne wahrgenommen? Die ganze Welt ist Hallo-Territory, so meine langjährige Überzeugung. Doch im Alltag geht manchen ein Hallo nicht so leicht über die Lippen. Zum Beispiel meinem Nachbarn. Egal, wie laut ich ihn grüße, zurück kommt nur lärmende Stille.
Diese Situation ist aus einem besonderen Grund pikant. Vor einigen Jahren bat er mich nämlich, ihm mein ungenutztes Kellerabteil zu überlassen, weil er Platz für sein angeblich florierendes Online-Business brauchte. In einem Anflug von Großzügigkeit trat ich ihm meine sechs Quadratmeter Stellfläche gerne ab. Insgeheim erwartete ich, dass wir uns von da an auf einer soliden Grüßbasis befinden würden. Aber nichts da. Im Laufe der letzten Jahre hat er Schulden in der Höhe von mehr als hundert Hallos bei mir angehäuft. Als ich ihm vor Kurzem am Postkasten begegnete, grüßte er mal wieder nicht zurück. Ich konnte nicht umhin, mich zu wundern: War ich als verlässliche Grüßmaus eigentlich der Trottel vom Dienst?
Gesichtsblindheit ist real
Diese Frage ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Der Weg zum erfolgreichen Austausch von Hallos kann ein weiter sein. Unbedingte Voraussetzung ist dabei vor allem eines: sich gegenseitig wiederzuerkennen. Hier beginnen schon die Schwierigkeiten. Denn Gesichter sind längst nicht so verschieden, wie viele glauben. Im geschäftigen Treiben einer Großstadt gerinnen sie oft zu circa. Weil sie mittlerweile so häufig vorkommen, kann man sich selbst an originellen Charakteristika wie
Curtain Bangs oder Oberlippenbärtchen nicht mehr festhalten. Einander wiederzuerkennen ist praktisch zur Glückssache geworden. Das wissen vor allem Menschen, die wie ich an Gesichtsblindheit leiden. Gleich-verschieden-Urteile fallen uns Betroffenen schwer, vor allem wenn wir in der U-Bahn oder einer Bar wieder mal von einem beigen Tellergesicht angesprochen werden. Gesichtsblinde haben dann nur zwei Möglichkeiten: entweder vorzutäuschen, dass sie die unbekannte Person erkennen, oder sich charmant und ein bisschen quirky als gesichtsblind zu outen.
Es ist unnötig zu erwähnen, dass mich die Kombination aus begeistertem Hallo-Sagen und Gesichtsblindheit in meinem Alltag häufig vor Probleme stellt. Mein Nachbar hingegen war ja sogar einmal in der Lage, mein Gesicht mit einem Kellerabteil zu verbinden. Von Gesichtsblindheit konnte bei ihm also keine Rede sein. Ist er also einfach ein schlechter Mensch?
So weit würde ich nicht gehen. Denn jedes erfolgreiche Hallo verlangt nach einem Followup. Hat sich die zarte Knospe eines Grußes nämlich erst einmal geöffnet, kommt man um den Vornamen meistens nicht herum. Hier offenbaren sich zwei meiner größten Schwächen. Erstens kann ich mir Vornamen nicht so gut merken. Jede zufällige Begegnung empfinde ich deshalb ein bisschen wie eine Quizfrage, deren Antwort mir auf der Zunge liegt. Zweitens kann ich mir manche Schwächen nicht so gut eingestehen, weshalb ich meistens alles auf eine Karte setze und jenen Vornamen laut ausspreche, den ich für am wahrscheinlichsten halte. Das ist dann nicht immer schön. Wenig ist unangenehmer als herauszufinden, dass jemand eigentlich Julian heißt, nachdem du ihn monatelang äußerst souverän Matthias genannt hast. Aber Christoph, Anna, Kathi, Lukas? Österreichische Vornamen – einfach ein Rack reizlose Oberteile in einem Vorstadt-H&M. Wohlgemerkt: Das sage ich als jemand, der Josef heißt.
Vom Kontext ganz zu schweigen. Woher kenne ich diese Person? Was empfinde ich ihr gegenüber? Hat sie mich schon einmal nackt gesehen? Grüßen wirft so viele Fragen auf! Sollte ich überhaupt so vielen Menschen ein –in dieser Stadt so kostbares – Hallo schenken? Ich musste an einen Freund denken, der immer alle grüßt. Allerdings ist er auch praktischer Arzt. Ohne E-Card-System hätte selbst er keine Chance, Tausende Patient*innen auseinanderzuhalten. Bei näherer Betrachtung ist ein angemessener Gruß ohne Zugang zu den Daten der Sozialversicherung also nicht nur unmöglich, sondern höchstwahrscheinlich auch ungesund.
So in etwa meine Gedanken, als ich unlängst wieder vor dem Postkasten stand. Plötzlich räusperte sich jemand hinter mir – mein Nachbar. »Kann ich mal?«, fragte er, als wären wir uns noch nie begegnet. »Na sicher«, antwortete ich menschenfreundlich, aber doch cool. »Wir sind doch auch nur zwei Gesichtsblinde mit einem Online-Business, die sich nach etwas Wärme in ihrem Alltag sehnen.« Doch er sah mich nur verwundert an. »Ich glaube, Sie müssen mich verwechseln«, antwortete er, während er seine Post unter den Arm klemmte und sein Fach wieder verschloss.
Vielleicht hatte ich ihn tatsächlich verwechselt, kam es mir. Trotzdem war da so eine wohlige Stimmung zwischen uns. In diesem Moment schwor ich mir, weiterhin ein Grüßotto zu bleiben und der Welt meine Hallos zuteilwerden zu lassen. Es kostet schließlich nichts! Im Gegensatz zu sechs Quadratmetern Stellfläche. Wer zur Hölle nutzt eigentlich meinen Keller? joechl@thegap.at • @knosef4lyfe
Josef Jöchl ist Comedian. Sein aktuelles Programm heißt »Erinnerungen haben keine Häuser«. Termine und weitere Details unter www.knosef.at.
Programminfo ab 14. März und Tickets ab 21. März www.diagonale.at
#Diagonale25
#FestivalOfAustrianFilm
| D | iagonale Festival des österreichischen Films 27. März – 1. April 2025, Graz
































