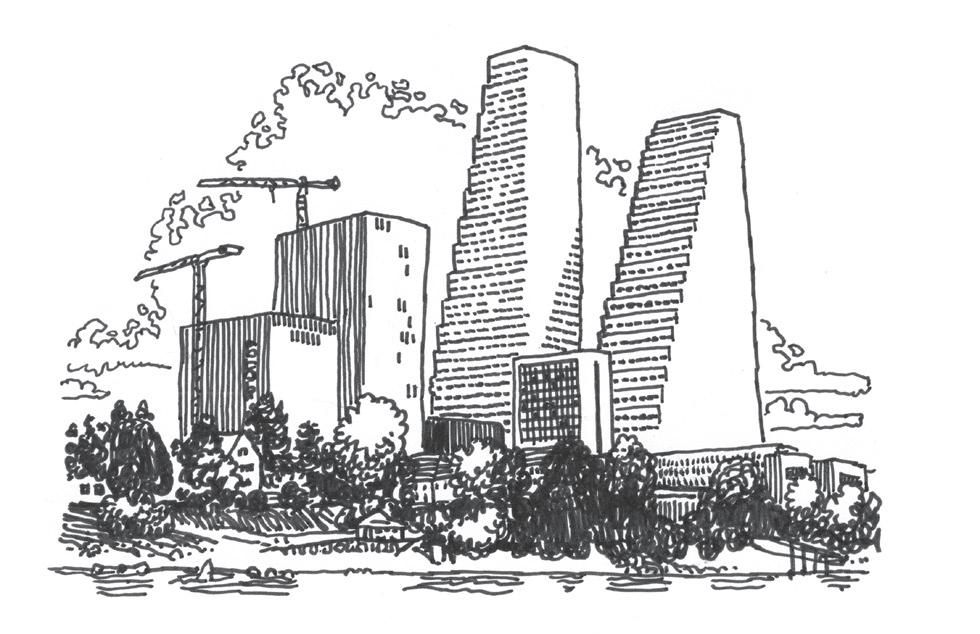ROCÍO PUNTAS BERNET Staatliche Korruption, Faulheit und eine verbaute Zukunft: Das Leben der jungen Analphabeten aus Andalusien. S.54 inSprachlosSevilla FLORIAN LEU SchlafstadtGoogles Verschiedene Menschen zeigen ihr San Francisco. Wem gehört eine Stadt? S.38 CHRISTOPH FISCHER Wie sich mit Bleistift und Papier in der rauen West Side die Türen öffnen lassen. S.70 ChicagoGezeichnetes JASON COWLEY Ein Mord in seiner Heimatstadt führt dem Autor gesellschaftliche Probleme vor Augen. S.16 Was geschah in Harlow? HANNES KARKOWSKI tanztStuttgarteng Wer etwas auf sich hält, hat die Stadt längst verlassen. Am Weihnachtsabend kehren sie heim und wiegen sich in Nostalgie. S.104 In Kapstadt ist Wasser knapp, das verbindet und macht kreativ. S.116 EVE FAIRBANKS Wassernot 13 porträtierenSchriftstellerinnen13SchweizerStädte. Ab S.6 SONDERAUSGABE 125 JAHRE SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBANDwww.reportagen.comAUGUST 2022
DAS UNABHÄNGIGE MAGAZIN FÜR ERZÄHLTE GEGENWART Die Stadt ist kein Dschungel aus Beton, sondern ein Zoo aus Menschen. DESMOND JOHN MORRIS, BRITISCHER ZOOLOGE UND VERHALTENSFORSCHER
Liebe Leserin, lieber Leser 125 Jahre alt wird der Schweizerische Städteverband 2022. Was 1897 als Initiative einiger weniger Städte begann, ist heute ein starkes, trag fähiges Netz. Ein Grund zum Feiern also? Ja, denn über die städtische Stärke, Innovationsdynamik und Lebensqualität dürfen wir uns freuen. Städte sind Seismografen der Veränderung. Stadt sein bedeutet immer auch, Lösungen zu finden. Angesichts dessen ist es befremdlich, dass ein – wichtiger – Grund zum Feiern weiter auf sich warten lässt: die Zeit, in der Art. 50 der Bundesverfassung und damit der Einbezug der Städte und Gemeinden in die Bundespolitik selbstverständlich ist. Unser Jubiläum fällt in eine Zeit der Multikrisen. Klimakatastrophe, Pan demie und Krieg lassen uns vermeintliche Gewissheiten verlieren. Was unvorstellbar schien, ist plötzlich Realität. Umso wichtiger ist der Ein bezug der Städte und Gemeinden auf Augenhöhe in die politischen Ent scheide. Nur in der engen Zusammenarbeit aller, auch über (Landes-) Grenzen hinweg, können wir Solidarität statt Spaltung ermöglichen, den Rechtsstaat schützen und unsere Demokratie bewahren.
Fluri Präsident
In diesem Reportagen-Sonderband laden wir ein, städtische Realitäten über den ganzen Globus zu ergründen. Und wir geben der Kultur Raum: Schweizer Autorinnen schreiben für diese Publikation mit einer Carte blanche der Geschäftsstelle persönlich und subjektiv über jeweils eine von ihnen frei gewählte Stadt.
Ich danke den Mitgliedern, dem Vorstand und der Geschäftsstelle sowie allen Partnern für das Vertrauen, das ich als Präsident stets erhielt, und für die fruchtbare Zusammenarbeit während vielen Jahren. In diesem Engagement aller liegt eine einzigartige Stärke unseres Verbandes, auch für die NationalratZukunft.Kurt Schweizerischer Städteverband
WO S N REPORTER UNTERWEGS is a member of Select – The Independent Longform Club. Making-of 4 Von Hum bis Tokio 144 13 porträtierenSchriftstellerinnen13Städteab 6 125 Jahre SSV 14 Chicago, USA GezeichnetesChicago 70 Sevilla, Spanien Sprachlos in Sevilla 54 Harlow, England Was geschah in Harlow? 16 San Francisco, USA SchlafstadtGoogles 38 Kapstadt, Südafrika Wassernot 116 Stuttgart, Deutschland tanztStuttgarteng 104
6 BASEL Welche eine Sache würde ich aus dem einstürzenden Haus retten? Gianna Molinari, in Basel geboren, lebt in Zürich. Sie studierte Literarisches Schreiben in Biel/Bienne und Neuere deutsche Litera
Am besten gefällt mir meine Stadt da, wo sie spriesst. Odile Cornuz erforscht das Schreiben in ver schiedenen Formen: radiomedial, theatral, erzählerisch, poetisch, performativ, analytisch ... und mischt dabei die literarischen Genres mit ausufernder Freude. Sie hat bereits meh rere Bücher veröffentlicht, im Herbst 2022 erscheint mit Fusil ihr erster Roman. Sie ziehen Städte an, die es schaffen, den motorisierten Verkehr loszuwerden. 10 BUCHS (SG) Wie es sich genau damit verhält, kann ich nicht sicher sagen.
Für Judith Keller ist eine Stadt eine immer gebastelt wirkende Kulisse, die ihr jeweils eigenes Licht auf die Menschen wirft. In La chen geboren, studierte Keller Literarisches Schreiben in Biel/Bienne und Leipzig sowie Deutsch als Fremdsprache in Berlin und Bo gotá. Ihre ersten beiden Bücher erschienen beim Gesunden Menschenversand.
BELLINZONA
Literarisches Schreiben am Literaturinstitut Biel/Bienne und Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Ihre Stücke wurden an diversen Bühnen auf diversen Kontinenten gespielt. Ihr Buchdebüt heisst Geister sind auch nur Menschen. Leben möchte sie noch in «sexy Thessaloniki».
8
Geboren in Lugano, studierte Virginia Helbling Literatur und Philosophie an der Universität Fribourg. Heute arbeitet sie als Journalistin. Ihr Debütroman Am Abend fliesst die Mutter aus dem Krug zeigt den Einschnitt, den die Geburt eines Kindes für eine junge Frau bedeutet. Zum Leben braucht sie Natur, die Stadt ist für sie ein Ort der Begegnung und des Austauschs. 148 ZÜRICH Ich umwerbe dich, schmeichle dir. Kannst du denn nicht lieben?
Dorothee Elmiger publiziert Romane, Essays, Montagen und Texte zur Kunst, zuletzt den Roman Aus der Zuckerfabrik . Zuvor studierte sie Geschichte, Philosophie und Literarisches Schreiben. Nach Jahren in Leipzig und Berlin lebt und arbeitet sie wieder in Zürich. Aber vielleicht nicht mehr lange: Wie sie uns verrät, spielt sie mit dem Gedanken auszuwandern. 98 CHUR Diese Stadt hatte meinen Freund auf dem Gewissen. Romana Ganzoni lebt als Schriftstellerin in Celerina. Sie hat Geschichte und Germanistik studiert und viele Jahre als Lehrerin gearbei tet. Die mehrsprachige Autorin schreibt Er zählungen, Romane, Gedichte, Essays, Kolum nen und Radiobeiträge. Längere Zeit lebte sie bisher in Zürich und London, die Sehn sucht zieht sie immer wieder nach Genua und Leipzig. 12 CHIASSO Gianna misstraut dem Bison immer noch. Sie möchte ihn töten.
MAKING-OF 4
Soll ich etwa von Palmen in einer Sommerbrise schwelgen? Katja Brunner, geboren in Zürich, studierte
146 NEUCHÂTEL
140 LA CHAUX-DE-FONDS Le fatre, il a schlagué le katz avec un steck en bas de la strasse. Bettina Wohlfender, im Toggenburg geboren, lebt heute als freie Autorin in La Chaux-deFonds. Sie hätte aber auch nichts dagegen, mit ihrer Familie eines Tages nach Stockholm zu ziehen. Studium des Literarischen Schreibens in Biel/Bienne. Gerade beschäftigt sie sich mit Räderuhren, Spessart-Eichen und Wörtern, die sich von Sprache zu Sprache schleichen.
MAKING-OF 5
Die hiesige Baumeisterin aber ist und bleibt die Sonne. Für Tabea Steiner ist eine Stadt erst dann eine Stadt, wenn unklar bleibt, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Steiner studierte Ger manistik und Geschichte. In Thun und Bern hat sie mehrere Literaturfestivals initiiert und mitorganisiert. Nach dem grossen Erfolg ihres ersten Romans Balg erscheint im Früh jahr 2023 ihr neues Buch. Mittlerweile lebt sie in 102Zürich.EFFRETIKON
tur in Lausanne. Für ihr Romandebüt Hier ist noch alles möglich erhielt sie in Klagenfurt den 3sat-Preis. Seit einem denkwürdigen Schultag wartet sie auf die fünfprozentige Wahr scheinlichkeit, dass am Rheinknie das Erd reich aufbricht.
142 LAUSANNE Hier ist man kein Erdbewohner, man ist Fisch oder Vogel. Aude Seigne studierte französische Literatur und mesopotamische Zivilisationen, reiste in rund 40 Länder, arbeitete als Web-Redakteurin und konzipierte eine Marke für handwerklich hergestellte Kosmetika. Daneben publizierte sie Bücher. Stadt bedeutet für sie Verdichtung, Möglichkeit, Vielfalt. Trotzdem findet sie im mer weniger Gefallen am Urbanen.
Ich schwanke zwischen Anerkennung und Abscheu. Geboren in Zürich, studierte Doris Wirth Ger manistik, Filmwissenschaft und Philosophie in Zürich und Berlin. Sie hat zwei Erzählbände veröffentlicht und beendet zurzeit ihren ers ten Roman. In Berlin unterrichtet sie Alpha betisierungskurse für Erwachsene. Eine Stadt lässt sie über den Tellerrand blicken, sie ist eine nie endende Konfrontation mit der Rohheit des Lebens.
Wenn die Bise kommt, toben und rauschen die Wogen. Wie am Meer. Stadt ist für Anja Schmitter: orange Lichter in violetter Nacht, Gesichter, Hupen, Lachen und dass man sich auf der Strasse nicht grüsst. In Münsterlingen geboren, studierte Schmitter Germanistik, Komparatistik und Literarisches Schreiben in Zürich, Bordeaux, Wien und Bern. Sie hat für ein Gefängnis theater geschrieben, im Herbst 2022 erscheint ihr erster Roman.
136 GENF Selbst die Gewässer in dieser Stadt bleiben einander fremd. Marina Skalova, in Russland geboren, wuchs in Frankreich und in Deutschland auf und studierte Literarisches Schreiben in Biel/Bi enne. Heute lebt sie als Schriftstellerin, Dichterin, Dramatikerin und Übersetzerin in Genf. Für längere Zeit hat sie bereits in Moskau, Stuttgart, Kaiserslautern, Paris, Berlin, Biel und Genf gelebt. Es zieht sie noch nach Buenos Aires. 100 DAVOS
138 KREUZLINGEN
6
6
Ich habe in der Schule gelernt, dass die Wahr scheinlichkeit, innerhalb der nächsten fünf zig Jahre ein Erdbeben der Stärke sechs oder stärker zu erleben, zirka bei fünf Pro zent liegt. Seit diesem Schultag warte ich auf diese fünf Prozent und das Beben. Warte darauf, dass Türen scheppern, obwohl kein Wind weht, und Gläser und Teller auf dem Tisch zittern, wie von Geisterhand bewegt.
Einst dehnte sich hier die Erdkruste, Sediment sank ab, der Boden brach ein, Spalten und Verwerfungen im Gestein entstanden, eine Senke breitete sich aus. Beim Einsinken des Grabens wurde Gestein an den Rand geschoben, die Grabenschultern Vogesen und Schwarzwald erhoben sich. Durch die Senke suchte sich der Rhein seinen Weg. Und mit dem Wasser kamen Siedlungen, und es mauserte sich eine Stadt durch die Zeiten, wuchs und wuchs, einer Knolle gleich, schmiegte sich in die Kurve, blieb dort lie gen, am Rheinknie. Die Erdkruste senkt sich weiter. Ein Sand korn breit sinkt der Graben an gewissen Stellen Jahr für Jahr. Du wirst denken: Ein lächerlicher Durchmesser ist der Durch messer eines Sandkorns. Aber rechnest du mit der Zeit und lässt drei bis vier Generationen heranwachsen, werden aus dem Sandkorndurchmesser zehn Meter, was bei weitem keinem Hochhaus entspricht, aber einem Haus. Haushoch in hundert Jahren also sinkt der Graben. Du zweifelst an dieser Rechnung?
Ich spielte das Gedankenspiel, was ich mit nehmen würde, wenn ich nur einen einzigen Gegenstand retten könnte, schwankte je weils zwischen dem Kaninchen und der Steinsammlung. Und ich entschied mich jedes Mal für dasselbe. Nicht zuletzt, weil ich dachte, dass Steine unter einem Haufen Steine unmöglich wiederzufinden wären.
Das letzte grosse Beben in Basel, das stärkste Beben der Schweiz, riss im Jahre 1356 un zählige Häuser, Kirchen, Mauerwerke aller Art und alle fünf Münstertürme nieder.
Ich dachte als Kind darüber nach, was ich aus dem einstürzenden Haus retten würde.
Ton
Du fragst dich, was kommt, was geht. Die Pest kam und ging. Der Rheinlachs ver schwand, auf seine Rückkehr wird gehofft. Auch die Menschenschauen im Basler Zoo verschwanden. Die Fasnacht während der Spanischen Grippe und während der Covid19-Pandemie, Maulbeerbäume und Seiden webereien, das Gorillaweibchen Goma, sie alle verschwanden. Das Bettelverbot ging, das Bettelverbot kam. Napoleon kam 1797 durch das St.-Alban-Tor, stoppte kurz im Hotel Trois Rois und verliess die Stadt nach wenigen Stunden wieder. Der Hafen kam, und mit dem Hafen kamen Containerschiffe, Containerburgen, Geschichten und Fernweh. Die Störche kamen und kommen noch im mer jedes Jahr im Februar und fliegen im August Richtung Süden. Überhaupt die Tiere: Die Füchse kommen in der Nacht und gehen im Morgengrauen. Es kommt vor, dass einzelne Rehe bis nach Basel vordringen, auf einer grünen Achse aus Allschwil, Bin ningen, Bottmingen oder über die Landes grenze vom Elsass her, und plötzlich stehen sie auf einer Verkehrskreuzung und sorgen für Chaos. Ruhiger, wenn auch nicht weniger gefährlich ist es für sie auf dem Friedhof Hörnli. Dort äsen sie in Gruppen, springen über Grabsteine, knabbern am Grabschmuck.
7
nen von rotem Buntsandstein lagen in Brü chen. Zwei Münstertürme wurden wieder aufgebaut, die Stadt wiedererrichtet. Warum errichtet man auf wackligem Grund, wirst du dich fragen. Das fragst du dich zu Recht. Und auch ich warte ja seit jenem Schultag auf die fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, auf das Aufbrechen des Erdreichs. Es ist ein Kommen am Rheinknie und ein Gehen und mittendrin der Fluss, mit stetig neuem Wasser.
Es gibt Ratten am Rheinbord und in der Kanalisation, Zander, Welse, Rotaugen im Rhein, etwa 8000 Tauben über den Dächern und auf den Plätzen der Stadt. Es gibt 30 Parks und Grünanlagen, insgesamt 26 500 Stadtbäume der Stadtgärtnerei, davon 5560 Linden, 3170 Rosskastanien und 2430 Plata nen. Es gibt 18 969 Gebäude in der Stadt und acht Brücken über den Rhein, rund 350 Sitzbänke vom Typ Miramondo mit Lehne und 70 ohne Lehne, rund 520 historische Basler Bänke einfach und 75 historische Basler Bänke doppelt, 234 Abfallkübel, die 35 Liter fassen, 415 Abfallkübel zu 110 Liter und unterirdisch noch einmal 18 Abfallkübel für 1000 Liter, es gibt 17 freistehende und 59 eingebaute WC-Anlagen, 24 Trinkbrunnen Standard, 31 Basiliskenbrunnen und mehrere Hundert Steinpoller. Es gibt Unmengen Alpnacher Quarzsand steine, die aneinandergelegt Gassen bilden und Strassen, die rutschfest sind und frost beständig. Es sollen sich von ihrer Oberfläche Kaugummis gut entfernen lassen und Kon fetti, hier besser als Räppli bekannt. Jedoch: Räppli sind nie ganz zu entfernen, Kaugum mirückstände werden bleiben, auch Abdrü cke von Essensresten. Flüssigkeiten dringen in die Poren des Gesteins, zeichnen die Stras sen und Gassen der Stadt. Spuren werden bleiben. Du wirst denken: Eine lächerliche Spur, die Spur auf einem Alpnacher Quarz sandstein in einer kleinen Basler Gasse. Aber Archäologinnen werden darüber viel leicht einmal äusserst erfreut sein, über den Fund eines Räpplis oder über Reste eines Kaugummis aus dem Jahr 2022 in einer fei nen Alpnacher Quarzsandsteinrille. Einen Alpnacher Quarzsandstein mit be sonders schönen Spuren nehme ich in meine Sammlung auf. Und sollte die fünf prozentige Wahrscheinlichkeit eintreffen: Ich werde ihn retten.
8
Dann endlich lange ich an. In Bellinzona. Und jetzt?
Und ich denke an die Wetterfront, die aufzieht, bald sind wir im Tessin, dort ist alles anders. Eintritt in Sphären der Gelnägel, des Burka verbots, der Selbstironie, der verkleinerten Italianità, oder jedenfalls dem, was Deutsch schweizer, also Zucchini, damit verwech seln. Little Eataly. Im Tessin war’s immer eso schön, sagt Onkel Eddie zu seiner Verabre dung, die er nach Tante Hildegards Ableben für sich reklamierte, im Tessin hatten wir es immer eso gut, sagt er. Goldgelbes Licht, eine gute Pizza und echli Boccia. Flussbäder, fast schon Italien, und Wandern kann man so gut und Marroni sammeln. Oh, bella frisura, komm doch noch auf einen Kaffee vorbei. Der Motor vom Bus Richtung Süden dröhnt. Die Häuser sind kühl im Sommer und haben Wände wie Burgen im Winter, schwerfällig warm gewordene Gastlichkeit. Und draussen der Alpenfirn. Die Schnellstrasse führt mit ten durchs Dorf, es ist wichtig, dass sie fast jeden Dorfkern durchtrennt. Und da ist die Migros neben einer Gruppe Kakibäume, so orange behangen mit samtigsaftigen Früchten. Dahinter erstreckt sich grünbraunes Weide land. Der Fluss. Wieder Weideland. Und dann noch ein Dorf, das sich an den aufsteigenden Berg kuschelt, sich in seine Achselhöhle legt. Menschen drücken sich an Häusern vorbei, warten an Bushaltestellen auf liebe Worte. Ein Hotel, verlassen, mit Brettern zugena gelte Fenster. Ein Platz wie ein Sperrmüll lager: Campinghocker, ein Handball, kaputte Sonnenschirme, eine Badewanne, ein Schrein für eine, die bei einem Verkehrsunfall das Leben gelassen hat. Dann ein Kiosk mit ei nem dicken Mann darin, der lächelt. Eine Nonne, sie schreitet eher, als dass sie geht, im Vorbeifahren dünkt mich ihr Gesicht so, als wüchse Kohlrabi darauf, immer ein An zeichen von Herzgeschichten.
Soll ich schreibend von Palmen in einer Sommerbrise schwelgen, vom äusserst beru higenden Geräusch, wenn die Kanten ihrer Blätter gegeneinander rascheln? Soll ich nun hier auf Papier traurig und allein den Sand
8
9 abtragen, der an den Ufern des Ticino liegt, ihn beschwören und bannen, das ausneh mend irisierende Glitzern der Granitstein partikelchen beschreiben und dann daran verlorengehen? Soll ich, romantisierend, von der Zuverlässigkeit des Rufs des Uhus schreiben? Und danach, fast eloquent, fast glatt, aalglatt, und gleich wieder gebotener massen widerborstig Um- und Zustände beschreiben, die einen ereilen, wenn man betritt, beschreitet, atmet dieses Bellinzona? Tritt man ein und besieht sich diese Stadt, beruhigt sich der Puls. Hier der Regierungs sitz der Kantonshauptstadt, die sich trotz allem ihren dörflichen Charme erhalten hat. Dort das Bundesstrafgericht, es wohnt in ihr, nein, thront, kühl, konzentriert, unver handelbar.
Drei Burgen formen Bellinzona, die eine umschloss frühe Bellenzerinnen und Bellenzer, in der mittigen spielen sie heute manchmal Opernklassiker, die dritte schaut über alles, sogar bis nach Italien, sagen manche, warnend, mahnend. Dieses Bellin zona, das kein Filmfestival hat von Rang, keine mondänen Ereignisse beheimatet, die pressegierig verziert werden. Nein, Bellin zona ist so zuverlässig wie das Essen in der «Casa del Popolo», verträumt ebenso wie vernünftig. Mittwochs und samstags findet ein berühmter Markt unter blauroten Segeln statt, solide Eleganz. Einmal im Jahr Karne val, hier Rabadan genannt, pure Fleisch lichkeit. Geduldete Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, aber eine robuste, spiralhafte Eigenständigkeit. Soll ich, wenn ich schon mal hier bin, Liebes lieder an den Sandstein verfassen, von eifri gen Altrömern, in Wirklichkeit ihren Leib eigenen, verlegt? Wie diese nämlich den Sandstein erst zerlegten, dann verlegten und eine Strasse aus ihm machten, damit diese Strasse jetzt die Altstadt geschmeidig macht, warm, eifrig und einig von Bürgerinnen und Bürgern bestiegen, liebevoll glatt poliert, wie das glänzende Fell von Pferden im Juli. Soll ich nun davon erzählen? Oder doch lieber noch mehr vom Ticino, dem Fluss Bellinzo nas, der kaltes, gesund frisches Alpenwasser trägt, der aus der Höhe stammt und wie er sich durch die Stadt schlängelt, mal gemäch lich tröpfelt oder auch mal üppige Wasser massen abtransportiert? Soll ich von seinen hinterlistigen Anwandlungen erzählen, da von, dass er glitzernd, kühlend, wissend einen umspült, einen trägt, wenn es denn ginge ohne Verletzung, bis in den – Achtung – Po?
Und wenn er gar nicht gestorben ist, weil ausgerechnet Paola ihn gefunden hat? Ich könnte erzählen, wie er jetzt nach einer auskurierten Lungenentzündung – ganz da vonkommen liess ihn der Ticino dann doch nicht – wieder auf den Markt geht, recht zu frieden, auf seine mürrische Weise zufrieden, einen Spritz trinkt e un grappin und dann Gemüse und Käse einkauft. Wie er den Käse einpackt und seine pandemiebedingte ma scherina dabei auf den Boden fällt und je mand sie ihm aufhebt und hinterherträgt im Gewusel des Markts. Unter der Bau marktjacke (viele Prozente Polyester) trägt Zio ein hochwertiges Hemd. Soll ich all das er zählen? Und zum Schluss anfügen, dass der Ticino die Locke seiner Liebsten behalten hat?
9
Oder soll ich die Geschichte von einem wei teren Onkel erzählen, von Paolas Onkel, den alle schlicht Onkel nennen, Zio auf Itali enisch? Wie Paolas Zio sich in einer Juni nacht in den Ticino legte. Es war ein unge wöhnlich regnerischer Frühling, der dieser Juninacht vorangegangen war, das Wasser stand demnach nicht zu niedrig. Paolas Zio hatte einige Obstschnäpse – tirilli – intus, ein Haarbüschel, er nannte es «Locke», seiner verstorbenen Frau hat er sich mutig und verquirlt in die Brusttasche gestopft.
Die Erinnerung an ein Bild, vor fünfzehn oder sechzehn Jahren geschossen: Die Dämme rung ist weit fortgeschritten, du befindest dich hoch oben in den Bergen. Die gewaltigen Gipfel im Hintergrund heben sich kaum mehr vom lichtlosen Himmel ab. Nicht viel ist zu erkennen von dem, was sich in deiner Umgebung befindet – Geröll, unsichere Wege, die im Nichts verlaufen. Du hast die Hände vors Gesicht geschlagen, weiss leuchtet der Blitz dich aus. Wie du so dastehst, spätado leszent, unter dem Eindruck der einbrechen den Nacht und der Einsamkeit des kargen Tals: eine Allegorie auf die teenage angst, die existentielle Panik, die grosse Verlassenheit. Denkst du dir die Gemütszustände als Land schaften, als Orte, so will dir im Falle dieser angst immer gleich Buchs einfallen: dunkles Rheintal, ein schwach leuchtender SelectaAutomat am Bahnhof, Gleisfelder, bedrohlich steil aus der Schwärze aufragende Gebirgsket ten, Uniformierte an den Gleisen, irgendwo der Rhein, ein reguliertes Band, das sich durch die Landschaft windet. Buchs als Grenzbahnhof, den die Züge Rich tung Osten verlassen und der dir als Heim reisender die Schweiz ankündigt: Immer scheint es spät zu sein, wenn dein Zug aus Wien, aus Zagreb, aus Salzburg eintrifft.
10
Vor Max Vogts kubischen Bahnhofsbauten aus den achtziger Jahren höchstens zwei, drei Lehrlinge mit Dosenbier aus dem Con venience-Shop. So fängt dieses Land also an, oder so hört es auf: als finsteres Tal in der Nacht mit Autobahn und monolithischen Futtertürmen – eine Ebene ohne echte Weite, eine begrenzte, ominöse Talung. Du erahnst Teile der stumm thronenden Drei Schwestern, den Schnee oberhalb der Baumgrenze. Und läufst du einmal in die Stadt, Buchs, hi nein, folgst der schnurgeraden Bahnhof strasse, weil du auf einen Anschluss wartest und auch weil du Aufschluss suchst, weil du der Stadt, über die du zugegebenermassen gar nichts weisst, doch gerecht werden willst, siehst du die Luxor Pub Bar mit grüner Mar kise, einen schiefergrauen Dodge vor dem Haus der Mode, siehst eine gerahmte Dar 10
11
Dabei meinst du natürlich nicht, Buchs die Schuld dafür geben zu können, was du so fährlässig in Buchs hineinlegst, ohne viel über Buchs zu wissen. Vielmehr findest du dort, in Buchs, jedes Mal, bei jedem Halt, bei jedem Umstieg zuverlässig zum Ausdruck gebracht, was du sowieso schon kennst als Bewohne rin dieses Landes: die Furcht vor dem Ver schwinden in der Provinz, die sich in nächt lichen Träumen wiederholenden Szenarien der verpassten Züge, der zersiedelten Land striche ohne Eigenschaften, der ausfahrtlo sen, namenlosen Raststätten. Kurz vor deiner Weiterfahrt, als du einmal noch einen Augenblick lang stehenbleibst vor der dreiachsigen Rangierlokomotive, die im Jahr 1909 in der Schweizerischen Loko motiv- und Maschinenfabrik in Winterthur gebaut wurde und dann in Buchs ein halbes Jahrhundert lang die Güterwagen rangierte, glaubst du plötzlich doch zu verstehen, dass dein Buchser Gefühl nicht ganz aus der Luft gegriffen ist: Es ist nicht so, dass dir an dieser Stelle und in diesem Moment einfällt, was du schon weisst, dass nämlich die un mittelbar bei Buchs verlaufende Schweizer Grenze im August 1938 geschlossen wurde, eine Tatsache, die das Tal in deinen Augen stets noch unheilvoller, die Fahrt über den Rhein, den Auftritt des Grenzwachtkorps noch beklemmender machte. Vielmehr liest du nun, vor der Lokomotive, dass hier im frühen 20. Jahrhundert einmal Züge passierten, die von Paris bis Istanbul verkehrten, dass hier alles Mögliche umgeschlagen und gelagert wurde, Früchte, Holz, Wein, Getreide von der Balkanhalbinsel, aus der Türkei, du liest, dass Steinegger’s Bazar an der Bahnhofstrasse 17 Reisekoffer verkaufte, Auswanderungs agenturen und Spediteure sich einst hier niederliessen, Könige und Kaiserinnen aus den an Buchs vorbeifahrenden oder in Buchs haltenden Zügen blickten.
Den Denner siehst du, das in den Sechzigern gebaute Rathaus, später den Da men- und Herren-Coiffure-Salon Bijou, den Van Loi Asia Take-away, den Standort der alten Teppichfabrik, die noch 1964 einen Um satz von sechs Millionen Franken erzielte, eine portugiesische Spezialitätenhandlung, die ganz kubische Herz-Jesu-Kirche aus den Sechzigern mit ihrem fünfstimmigen Geläut im Turm, und beinahe alles, beinahe jedes Gebäude, jedes Lokal erscheint dir so, als hätte es jemand vor einer Weile verlassen und seither nicht mehr oft angerührt.
Vielleicht, denkst du, noch immer vor der alten Rangierlok stehend, ist diese Buchser angst, diese Verlorenheit im Rheintal also doch nicht allein die deine, sondern steckt schon lange drin in dieser Stadt, die einmal ein Platz von Bedeutung war, ein Ort, wie es heisst, von Welt, den man vom Schwemm gebiet zum betriebsamen Verbindungspunkt entwickelte und der dann wieder an den Rand rückte: Eins ums andere ersetzte man die Häuser jener blühenden Zeit, und die letzten Passagiere, deren Ankunft in Buchs die Aufmerksamkeit des Landes erregte, führten statt royaler Güter eilig gepackte Rucksäcke und Plastiktüten mit.
Trotzdem: Wie es sich genau mit Buchs ver hält, das kannst du nicht mit Sicherheit sa gen. Schliesslich gehörst du zu jenen, die auch heute noch immer nur durchreisen, müde und mit schweren Beinen, willst immer gleich weiter, kannst sie gar nicht schnell genug verlassen, diese Stadt, Buchs, die dir so ver traut erscheint, als handelte es sich um eine deiner Ausgeburten, als wärst du eine ihrer Töchter.
11 stellung über den Aufbau der «handgerollten Cigarre» im Schaufenster des Tabakfachge schäfts.
12 Gianna öffnet das Fenster, und er ist da. Fast scheint es, dass er schläft, aber sobald sie neben dem Vorhang auftaucht, öffnet er die Augen. Es ist offensichtlich: Er beobachtet sie, mit seinen zwanzig schamlos dem Him mel dargebotenen Balkonen. Der Block weiss, dass sie ihm den Tod wünscht, hat es mit dem Sterben aber nicht eilig. Ihm gefällt diese Spannung, für ihn ist es eine verquere Form von Liebe. Zwanzig Jahre schon behält Gianna ihn im Auge und behält er sie im Auge. Im Herbst sehen sie einander auch durch den Ne bel an, in aller Eindringlichkeit, um sich dann Dinge einzubilden. Der Blick reicht nicht bis zur flaschengrünen Fassade, aber sie weiss, dass er da ist, daliegt im Grau, die zementene Schnauze in ihre Richtung gereckt.
Nach all dieser Zeit hätte sich eine gewisse Gleichgültigkeit einstellen müssen, wie bei langjährigen Paaren. Doch Gianna und der grüne Block misstrauen einander immer noch: Wo die Gemüter sich nicht beruhigt haben, gibt es keine Vorhersehbarkeit. Gianna streicht sich die Haare aus dem Gesicht und wirft ihm ein schiefes Lächeln zu. Ihn so herumfaulenzen zu sehen, widert sie an.
12
Er liegt verschwitzt in der untergehenden Sonne, strahlt glühende Aufregung aus. Auf arrogante Fassaden dieser Art war man in den siebziger Jahren stolz und ist es noch heute, wer wilden Eifer mit Inspiration ver wechselt. Gianna möchte ihn töten. Manchmal dringt das Brüllen der Züge zu ihr. Dann will Gianna aufbrechen. Sie beschleu nigt ihre Schritte, muss plötzlich aufräumen, wischt mit dem Lappen Sauberes noch sau berer. Wenn das geschieht, hat Gianna win zige Augen, der Blick ist nach draussen auf einen persönlichen Horizont gerichtet. Bison, wie sie ihn getauft hat, spürt es und legt die Stirn in Falten, lässt die Schultern hängen und verschwindet, denn die Beute durch Flucht zu verlieren, würde wirklich den Tod bedeuten. So bindet der Block sie an sich, noch unterhalb der Schwelle des Zweifels, die ser Tyrann und T-Rex im Zwinger, durchtrie ben und grossspurig wie jemand, der um seine Unentbehrlichkeit weiss.
Rundum stehen andere Wohnblöcke, und auch sie beobachten Gianna, hauchen ihr Lange weile entgegen. Sie blickt sie an, verzieht den Mund, aber die Schuld liegt bei Bison, allein bei ihm. Nur er löscht Gipfel aus, ebnet sie ein, sobald sie Chiasso erreichen. Der Ort be käme alpinen Charakter, wenn Bison heute Nacht sterben würde, doch er atmet, knab bert an den Hügeln oder wälzt sich im Staub, um alte Spuren zu verwischen. Bison tut alles, um die Blicke auf sich zu ziehen. Er würdigt die Anwesenden herab. Spannt die Bauchmuskeln. Und von Chiasso und seinen Wundern bleiben nur vereinzelte kleinste Details übrig. Etwa die Steintreppe, die oben mit einer Gittertür endet, hinter dem alten Oratorio. Das sind die Stimmen von gestern, die sich nach den heutigen ausrichten. Wie im Nein,Theater.Bison kann ihr nichts vormachen: Na türlich atmet Chiasso hinter dem Vorhang des Offensichtlichen, hinter der Ecke der Angst vor Ungeheuern und Überproportio niertem in Makrovergrösserung. «Aufbre chen!», sagt sich Gianna, «diesen ganzen Aberwitz weit hinter sich lassen, zurück ins italienische Dorf oder in den Norden, mit den Bergen als Schutzschild vor Ereignissen und Gedanken.» Aufbrechen! Gianna hat es schon oft gesagt. «Ich gehe! Bevor die abend dunkle Kirche im Regen ertrinkt.» Sie ist immer geblieben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, amen. Weil sie, wenn sie die Sitzbank sieht, die sich mit ihrem Grau in den Pfützen, Scheiben, Zimmern ausbreitet, weiss, dass es an jedem Ort gleich wäre. Es lohnt sich nicht, aufzubrechen, um doch wieder auf ei nen Bison zu stossen, oder schlimmer, um zu entdecken, dass sie ohne ihn nicht leben kann. Bison ist ein Traum, der beisst, unmenschli che Gelüste hat und viel Elend an sich. Er schüchtert ein und zieht an, er ist der beste aller Liebhaber. «Geh! Gianna, brich auf!» Der Bahnhof weiss es und auch die im Garten verborgene Villa, die gesehen hat, wie im Zweiten Weltkrieg dreitausend Soldaten das ganze Land verteidigten. Die Gebäude haben eine uralte Seele, Voluten aus den Tiefen des 19. Jahrhunderts, sie tragen Geschichte, bergen die Wahrheit in sich. Auch sie beob achten Gianna, aber ihre Absicht ist eine an dere. Sie haben gesehen, wie sie gekommen und geblieben ist, Italien verlassen hat, knapp über die Grenze. Genau, weder da noch dort, aber Verrat ist erlaubt, wenn man danach Reue mit sich herumträgt. Chiasso. «Ach egal!», hatte sie sich gesagt, als sie zu bleiben beschloss. «Geh, Gianna! Brich auf!» Der Bahnhof durchleuchtet alle, sieht sofort, wer bereit ist, wegzufahren. Aus diesem Grund hat er sich ausgedehnt: um Gianna den Aufbruch nahezulegen, auch wenn ihre Beine zittern und es nur so wimmelt von Vielleichts. Bei jedem Zögern hat er einen Backstein, ein Gleis, einen Waggon hinzugefügt, hat er –«Geh!» – die Strassen in Beschlag genom men, die Zahl der Triebwagen erhöht, die Kapazität der Züge, bis auf die Felder hinaus hat er sich breitgemacht, einen Drittel des Orts verschlungen. Aber ohne Erfolg: Gianna bricht nicht auf. Wer weiss, ob eher das Provisorium Wurzeln schlägt und sich bis unter die Haut festhakt oder ob die Geome trie des äusseren Raums eine innerliche Struktur widerspiegelt, dieses Ich, dessen Widerschein verführt. Gianna macht das Fenster zu und seufzt. Als der Tag entschwindet, kommt das Brau sen der Autobahn näher und wispert ihr ins Ohr. Es erinnert an das ferne Rauschen eines Baches. Es tröstet sie, andere vorbei ziehen zu hören. Aus dem Italienischen von Barbara Sauser.
13
13
DIE STÄDTER:INNEN LEBEN IN RUND 2 MIO. WOHNUNGEN VERTEILT AUF KNAPP 540 000 GEBÄUDE. NETTO-MIETZINS,DURCHSCHNITTLICHERMONATLICHER2021 Höchste Mieten Küsnacht (ZH) 2114 Meilen 1963 Zug Freienbach19051838Thalwil1721 Tiefste Mieten Delémont 962 Chiasso Moutier865827 La Chaux-de-Fonds 804 Le Locle 715 UM DIE JAHRTAUSENDWENDE LEBTE JEDER VIERTE STADTBEWOHNENDE DER WELT UNTERHALB DER ARMUTSGRENZE. IN DER SCHWEIZ SIND 2020 8,5% DER EINKOMMENSARMUTPRIVATHAUSHALTENWOHNBEVÖLKERUNGSTÄNDIGENINVONBETROFFEN.ZWEIDRITTELDAVONLEBENMITBLICKAUFDENGRADDERVERSTÄDTERUNGIM«MÄSSIGBESIEDELTENGEBIET»(53,6%)ODERIN«DÜNNBESIEDELTEMGEBIET»(13,4%).RUND EIN DRITTEL VERKEHRSBETRIEBE FÜR DIE CORONABEDINGTENAUSFÄLLE ENTSCHÄDIGT. DER STÄDTISCHE ORTSVERKEHR LITT STARK UNTER DER PANDEMIE, DIE VERKEHRSBETRIEBE RECHNEN MIT EINNAHMEVERLUSTEN VON ETWA 150 MIO. CHF – NUN TRÄGT DER BUND DAVON 50 MIO. CHF. ENDE DES 14. JAHRHUNDERTS GAB ES IN DER SCHWEIZ ETWA 200 ORTE STADTRECHT.MIT 2022 GIBT ES IN DER SCHWEIZ 162 STATISTISCHE STÄDTE. EINE STADT IN DER SCHWEIZ MUSS PER DEFINITION EINE KERNZONE MIT MINDESTENS 12 000 EBL AUFWEISEN, WAS DER SUMME AUS EINWOHNER:INNEN, BESCHÄFTIGTEN UND ÄQUIVALENTEN AUS LOGIERNÄCHTEN ENTSPRICHT. DER STÄDTEVERBAND HAT AUCH 7 MITGLIEDER, DIE NICHT DIESER STATISTISCHEN DEFINITION ENTSPRECHEN. APPENZELL, AROSA, LA NEUVEVILLE, MOUTIER, MURTEN, WORB UND ZUCHWIL WEISEN JEDOCH IN IHRER TRADITION UND ENTWICKLUNG STÄDTISCHEN CHARAKTER AUF. SiedlungsflächeStädtische besiedelte RestlicheFläche WO DIE MENSCHEN WOHNEN Landwirtschaftsflächen 35% Bestockte Fläche (Wald) 32% Unproduktive Flächen 25% Siedlungsflächen 8% davon städtisches Wohnareal <1% FLÄCHE DER SCHWEIZ der Bevölkerung der Bevölkerung 2,3% 5,7% 48% 52% SEIT 2007 LEBEN WELTWEIT MEHR MENSCHEN IN STÄDTISCH GEPRÄGTEN RÄUMEN ALS AUF DEM LAND. ERST SEIT 1999 IST DER BUND DURCH ART. 50 DER BUNDESVERFASSUNG VERPFLICHTET, AUF DIE BESONDERE SITUATION DER STÄDTE UND AGGLOMERATIONEN RÜCKSICHT ZU NEHMEN. DER STÄDTEVERBAND WURDE 1897 GEGRÜNDET. HEUTE VERTRITT ER 128 MITGLIEDER. ER SETZT SICH IN DER BUNDESPOLITIK FÜR DIE INTERESSEN DER STÄDTE UND AGGLOMERATIONSGEMEINDEN EIN. DORT LEBEN ETWA 75% ALLER SCHWEIZER:INNEN, UND ÜBER 80% WIRTSCHAFTSLEISTUNGDER DER SCHWEIZ WIRD IM URBANEN RAUM ERBRACHT. DER STÄDTEVERBAND BIETET DEN MITGLIEDERSTÄDTEN ZUDEM IN 7 SEKTIONEN, 5 KOMMISSIONEN UND 7 ARBEITSGRUPPEN GELEGENHEIT FÜR ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND VERNETZUNG. ERFOLG BEI DER BEWÄLTIGUNG DER CORONA-PANDEMIE: DER STÄDTEVERBAND HAT ERREICHT, DASS DER BUND DIE STÄDTISCHEN SchweizerischerStädteverband125JahrefürdasLebeninderStadt
* 1. Verkehrshaus der Schweiz, Luzern; 2.Fondation Beyeler, Riehen; 3. Château de Chillon, Veytaux; 4. Maison Cailler, Broc; 5. Musée Olympique, Lausanne; 6. Landesmuseum, Zürich; 7. Musée d'histoire naturelle, Genève; 8. Swiss Science Center Tech norama, Winterthur; 9. Kunsthaus Zürich 10. Kunstmuseum Basel Quellen: Bundesverfassung der Schweizer. Eidgenossenschaft; EFV Finanzstatistik: 2022; Florida, Richard: Cities and the Creative Class; Frey, René: Stadt. Lebens- und Wirtschafts raum; Historisches Lexikon der Schweiz: Eintrag «Stadt»; Science Daily: 25.5.2007; Statistik der Schweizer Städte: 1930, 2000, 2015, 2021, 2022; Taschenstatistik Kultur in der Schweiz: 2020. BFS, Arealstatistik 2021, BFS, SILC 2020 Recherche: Marlene Iseli und Janis Lüber Grafik: Moiré DER STÄDTER:INNEN STAMMEN AUS DEM AUSLAND, WÄHREND AUSLÄNDER:INNEN AUSSERHALB DER STÄDTE NUR 20% DER BEVÖLKERUNG AUSMACHEN. 2021 LIESSEN SICH 4,3 PERSONEN PRO 1000 EINWOHNER:INNEN VERHEIRATEN, 1930 WAREN ES DURCHSCHNITT LICH NOCH 7,8 IN DEN DAMALS 26 ERHOBENEN STÄDTEN. DIE 12 GRÖSSTEN STÄDTE ZÄHLEN GLEICH EINWOHNER:INNENVIELEWIEDIE 14 KLEINSTEN KANTONE. ES GIBT KEIN STÄDTEMEHR. BEIM STÄNDEMEHR HAT EIN STIMMBERECHTIGTER IM KANTON INNERRHODENAPPENZELL 40-MAL MEHR GEWICHT ALS EINE STIMMBERECHTIGTE DES KANTONS ZÜRICH. DIE STÄDTER:INNEN HABEN EIN GROSSES KULTURANGEBOT VOR IHRER TÜRE. IN DEN ZEHN GRÖSSTEN SCHWEIZER STÄDTEN GAB ES 2017 CA. 80 KINOS MIT ÜBER 220 SÄLEN. VON DEN ZEHN BELIEBTESTEN MUSEEN DER SCHWEIZ 2019 BEFINDEN SICH DEREN 8 AUF STÄDTISCHEM BODEN – CHÂTEAU DE CHILLON UND MAISON CAILLER BILDEN DIE AUSNAHME.* DIE FUSSBALL SUPER LEAGUE UND DIE EISHOCKEY NATIONAL LEAGUE ZOGEN IN DER LETZTEN SAISON VOR CORONA INSGESAMT RUND 4,18 MIO. ZUSCHAUER:INNEN IN DIE JEWEILIGEN STÄDTE. 2015 UMFASSTE DAS PARKPLATZ AREAL DER SCHWEIZ EINE FLÄCHE VON 6404 HEKTAREN. DAS ENTSPRICHT DURCHSCHNITTLICH 5,1 MIO. PARKPLÄTZEN VON JE 5 M LÄNGE UND 2,5 M BREITE. FÜNF STÄDTE MIT DEM WENIGSTEN AUTOBESITZ 2022 UND 2000, PRO 1000 EINWOHNER:INNEN Basel 320 324 Zürich 331 380 Genf 346 472 Lausanne 349 456 Vevey 378 434 IN DER STADT BASEL WURDEN 2021 INSGESAMT 23 410 BÄUME VON ÜBER 500 VERSCHIEDENEN ARTEN GEZÄHLT. 2019 LEBTEN 10-MAL MEHR FÜCHSE IM SIEDLUNGSGEBIET ALS AUF DEM LAND. RENÉ L. FREY PRÄGTE ANFANG DER 1990ER JAHRE DEN BEGRIFF DER A-STADT: ALTE, AUSLÄNDERARBEITSLOSE,UNDASOZIALE. IN DEN 2000ER JAHREN FÜHRTE RICHARD FLORIDA DENJENIGEN DER CREATIVE CITIES EIN. TALENT, TOLERANCE,TECHNOLOGY, DAS GILT HEUTE ALS ANZIEHUNGSFORMEL FÜR DIE KREATIVEN. WELCHES STÄDTEBILD WIRD DEN SSV BEI SEINEM 150-JAHRJUBILÄUM PRÄGEN? Bildung 23,2% Soziale Sicherheit 21,5% Allgemeine Verwaltung 9% Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 8,5% Finanzen und Steuern 8,4% Verkehr und Nachrichtenübermit. 7,8% Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 7,8% Gesundheit 6,2% Umweltschutz und Raumordnung 5,6% Volkswirtschaft 2% AUSGABEN DER STÄDTE 2019 +11,5% +10,4% >100 000 +2,6% +5,5% 50 000–99 999 +6,7% +9,6% 20 000–49 999 +6,7% +9,1% 15 000–19 999 +8,7% +9,2% 10 000–14 999 -3,1% +5,4% <10 000 Einwohner:innen ENTWICKLUNG DER NACHDERSCHÜLER:INNENANZAHLUNDGESAMTBEVÖLKERUNG:GEMEINDEGRÖSSE,2022
16 RUBRIK JASON COWLEY Was geschah in England.MeineeinerDerHarlow?NiedergangUtopie:Stadtin
17 REPORTAGEN STÄDTEVERBAND
Tags drauf nannte die Essexer Polizei den Angriff «brutal» und «möglicherweise durch Hass motiviert». Man liess anklingen, dass Jóźwik wohl angegriffen wurde, weil er Polnisch gesprochen hatte. Dies alarmierte die Presse, denn es bedeutete, dass das, was sich am Samstag, dem 27. August 2016, beim Einkaufszentrum abgespielt hatte, mehr war als eine nächtliche Auseinandersetzung, die aus dem Ruder gelaufen war. Hier ging es um Hass. Um Politik. Wir befanden uns mitten im hitzigen Referendumssommer. Die Atmosphäre war vergiftet mit Vorwürfen und Gegenvorwürfen und England gespaltener denn je. Auf der einen Seite standen diejenigen, die das Vereinigte Königreich weiterhin als Mitglied der Europäischen Union sehen wollten, auf der anderen Seite diejenigen, die raus wollten aus der EU – remainer gegen leaver. Wie Hunderttausende seiner Lands männer, die in den Jahren seit dem EU-Beitritt der ehemaligen Ost blockstaaten nach Grossbritannien gezogen waren, war Jóźwik über zeugt, dass England ihm mehr zu bieten hatte als sein Heimatland. Er hatte keine Frau, und auch, weil er nicht allein in Polen bleiben wollte, war er 2012 zu seiner verwitweten Mutter nach Harlow gezogen und hatte begonnen, in einer Wurstfabrik zu arbeiten.
Die1 drei Männer hatten bereits mehrere Stunden lang tief ins Glas geschaut, als ihr Weg sie schliesslich zu «The Stow» führte, einem Einkaufszentrum im englischen Harlow. Es war kurz vor Mitternacht an einem warmen Wochenende im August, und Arkadiusz Jóźwik und seine beiden Begleiter – Polen wie er – waren erschöpft und hungrig. Harlow ist eine von Schwierigkeiten geplagte Stadt in der Grafschaft Essex, nordöstlich von London. Jóźwik und seine Begleiter lebten und arbeiteten hier. Er hatte im Take-away eingekauft und setzte sich auf eine Mauer, um die Pizza zu essen. In dem Moment bemerkten die Männer eine Gruppe von Jugendlichen ganz in der Nähe, ein paar von ihnen auf Fahrrädern. Die Jungs, gerade einmal fünfzehn oder sechzehn Jahre alt, kamen näher. Es wurde laut, feindselig, einer stachelte den an deren an, die Lage eskalierte. Einer der Jugendlichen verliess die Clique und schlich sich zu Jóźwik herüber. Sein «Superman-Hieb», wie man ihn später vor Gericht nennen würde, traf Jóźwik am Hinterkopf. Jóźwik stürzte – vielleicht, weil er betrunken war, vielleicht auch, weil er Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hatte – und schlug mit dem Kopf auf den Bürgersteig, woraufhin die Jugendlichen in Panik gerieten und wegrannten. Jóźwik war bewusstlos, und Blut lief ihm aus den Ohren, er wurde ins Krankenhaus gebracht.
Am Tag nach dem Übergriff im Einkaufszentrum wurden sechs Jugendliche wegen des Verdachts des versuchten Mordes ver haftet. Arkadiusz Jóźwik hatte eine Hirnverletzung und eine Schä delfraktur erlitten. Wenig später, am 29. August, starb Arek, wie er von seinen Freunden und der Familie genannt wurde – im Alter von vierzig Jahren im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein zurücker langt zu haben.Diegenauen Hintergründe des Angriffs kennt man bis heute nicht – ein Zeuge sagte aus, dass Jóźwik einen der Jugendlichen mit schwarzer Hautfarbe rassistisch beschimpft habe –, was auch immer das Motiv gewesen sein mag, die Auswirkungen des Hiebes, der Jóźwik tötete, waren auf der ganzen Welt zu spüren. Bald war nur noch vom «Brexit-Mord» die Rede.
Im Referendum am 23. Juni 2016 hatte jeder einzelne Bezirk in Essex sich mehrheitlich für den Austritt aus der EU ausgesprochen (die Brexit-Befürworter in Harlow, das mit hoher Arbeitslosigkeit und sozial benachteiligten Vierteln zu kämpfen hat, lagen mit 68 Prozent deutlich weiter vorn als der Landesdurchschnitt von 52 Prozent). Nach Jóźwiks Tod wandte sich der polnische Staatspräsident Andrzej Duda an die geistlichen Oberhäupter in Grossbritannien und bat um ihre Mithilfe, um weitere Angriffe auf polnische Staatsangehörige zu ver hindern. Der polnische Botschafter in Grossbritannien wurde zu einer Stadtführung durch Harlow eingeladen. Etwa zur gleichen Zeit ent sandte Warschau polnische Polizisten auf Streife rund um das Ein kaufszentrum in Harlow, und die polnische Gemeinschaft rief zu einem Solidaritätsmarsch in der Stadt auf. «Wir Europäer werden es niemals hinnehmen, dass polnische Arbeiter auf den Strassen von Harlow […] belästigt, angegriffen oder gar ermordet werden», sagte der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, am 14. September 2016 in seiner jährlichen Rede zur Lage derWasUnion.beiJunckers Wortwahl mitschwang: Fremdenfeindliche Kräfte infolge des Brexit-Referendums waren schuld an Arkadiusz Jóź wiks Tod, und Harlow und seine Einwohner waren mitverantwortlich. Manchmal2 träume ich von Harlow. Ich wurde in dem Teil der Stadt geboren, der damals «New Town» hiess. Ich besuchte verschiedene öffentliche Schulen in der Stadt und verbrachte die ersten achtzehn Jahre meines Lebens dort.
18 KRIMINALITÄT
Es war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit, dennoch wirk te alles irgendwie trostlos. Als ich zum Auto kam, sassen drei junge Männer auf einer Mauer in der Nähe. Einer von ihnen begrüsste mich mit den Worten: «Schicke Karre!» Er sprach Englisch mit starkem Akzent, und es stellte sich heraus, dass er und seine Freunde Rumänen waren. Als ich mich erkundigte, wie es sich als Osteuropäer in der Stadt lebe, drucksten sie herum. Hatten sie Arbeit? Nein, antworteten sie.
In meinen Träumen von Harlow bin ich mein heutiges Ich – ein Mann mittleren Alters, verheiratet, mit Kind –, doch stets finde ich mich in dem Haus in der kaum befahrenen Sackgasse wieder, welches wir als fünfköpfige Familie von 1972 bis 1983 bewohnten und wo ich den grössten Teil meiner Kindheit und Jugend verbrachte, bevor meine Eltern, verunsichert durch das, was sie für den unaufhaltsamen Nie dergang der Stadt hielten, in die benachbarte Grafschaft Hertfordshire zogen. Mein Vater lebt in diesen Träumen noch. Er ist rational und ruhig, genau wie ich ihn in Erinnerung habe, und es ist, als hätten wir nun Gelegenheit, all jene Gespräche zu führen, die uns durch seinen plötzlichen Tod an einem Herzinfarkt im Alter von gerade einmal sechsundfünfzig Jahren verwehrt geblieben sind.
19 WAS GESCHAH IN HARLOW?
«The3 Stow» war bei seiner Eröffnung in den fünfziger Jah ren das erste Einkaufszentrum der Stadt. Wie viele andere öffentliche Räume in Harlow wurde es in der Folgezeit vernachlässigt. Als mich der «Brexit-Mord» nach langer Zeit zurück ins «Stow» zog, war ich überrascht, wie heruntergekommen es wirkte. Die Ladenzeile war fest in der Hand von 1-Pfund-Läden, Secondhandläden für wohltätige Zwe cke und abgewrackten Schnellimbissen. Ein Tattoo- und Piercingstudio durfte natürlich nicht fehlen. Eine Thai-Massage direkt neben einem Bestattungsinstitut. Der Pub machte einen verkommenen und wenig einladenden Eindruck.
Als ich mit Mitte zwanzig in London zu arbeiten begann, war der Ort, an dem ich aufgewachsen war, das Allerletzte, woran ich er innert werden wollte. Ich erwähnte nur ungern, dass ich aus Essex beziehungsweise aus Harlow kam. Etwas in mir sträubte sich dage gen. Am liebsten wollte ich meine Herkunft vergessen, sie hinter mir lassen. Ich spürte ein Schamgefühl, das ich nicht in Worte fassen konnte, das etwas mit dem englischen Klassensystem und der allge meinen Wahrnehmung von Harlow als gescheiterter Stadt, als Heimat der Prolls, zu tun hatte.
Durch die New Towns Act von 1946 wurden acht neue Städte erbaut, um eine angemessene Unterkunft für die 340 000 «überschüs sigen» oder «ausgebombten» Londoner zu schaffen, da während des Zweiten Weltkriegs in London über eine Million Häuser zerstört oder beschädigt worden waren. Meist handelte es sich um kleine Ortschaften auf dem Land – Hemel, Stevenage, Hatfield, Welwyn –, die erweitert werden sollten. Harlow im ländlich geprägten Westen von Essex aller dings sollte ganz neu entstehen. Sechzig Prozent des Baulandes waren dem Besitzer, Kommandant Godfrey Arkwright, Familienoberhaupt einer alteingesessenen Essexer Jagd- und Landbesitzerfamilie, zwangs weise abgekauft worden, und die ersten Einwohner der Stadt betrach teten sich als Pioniere für etwas noch nie Dagewesenes.
Es wirke alt.4Meine Eltern zogen 1959 nach Harlow, zu einem Zeitpunkt, als die Stadt noch unter 6000 Einwohner hatte (heute sind es 86 000, und die Zahl wächst weiter). Beide kamen aus dem Osten Londons, und beide waren als Kinder während des Krieges evakuiert worden – eine Erfahrung von Trennung und Entwurzelung, die vor allem meiner Mutter sehr zu schaffen machte. Kriegsbedingt verliessen beide die Schule im Alter von fünfzehn Jahren. Mein Vater (der ein Stipendium für ein Ingenieurstudium ausgeschlagen hatte) begann eine Lehre als Hemdenschneider, und meine Mutter arbeitete als Assistentin in einer Anwaltskanzlei in der City of London. Sie lernten sich beim Tanzen kennen und heirateten 1958. Kurz darauf zogen sie nach Harlow – die älteste Schwester meiner Mutter wohnte dort. Sie waren auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und hofften, sie in der gerade entstehenden «New Town» zu finden.
KRIMINALITÄT
20
Wie lange sie schon hier seien? Noch nicht lange. Sie hatten geglaubt, sie kämen in eine neue Stadt. Aber, so sagten sie, Harlow sei nicht neu.
Das ursprüngliche Dorf Harlow (später umbenannt in Old Harlow) findet schon im Domesday Book, einem Grundbuch aus dem 11. Jahr hundert, Erwähnung. Harlow und andere alteingesessene Siedlungen – Potter Street, Parndon, Netteswell, Tye Green, Latton, Churchgate Street – wurden vom hauptverantwortlichen Architekten Frederick Gibberd in sein städtebauliches Konzept mit aufgenommen: Man er weiterte und entwickelte sie, liess sie aber nicht verschwinden oder abreissen. Gibberd wollte, dass Harlow Urbanes und Ländliches miteinander verband. Natur sollte es innerhalb und ausserhalb der Stadt
21 geben. Sein erklärtes Ziel war ein «gelungener Gegensatz von dem Werk des Menschen und dem Werk Gottes».
Für ihn waren diese Städte «Zivilisationsexperimente», und er wünschte sich «glückliche und gütige» Einwohner.
Meine Eltern waren begeistert, wie ländlich Harlow bei ihrer An kunft wirkte. Die Stadt wuchs um sie herum, eine in sich geschlossene Wohnsiedlung folgte der nächsten.
Heute schmückt Moores Harlow Family Group den Eingangsbereich des Bürgerzentrums der Stadt. Ein Mann und eine Frau sitzen Seite an Seite, aufrecht und stolz. Der rechte Arm des Mannes ruht schützend auf der Schulter seiner Frau, sie hat ein kleines Kind auf dem Schoss.
Sir Kenneth Clark, damals Vorsitzender des britischen Arts Council, nannte die 2,5 Meter hohe und 1,5 Tonnen schwere Skulptur von Moore bei ihrer Enthüllung im Jahr 1956 vor der Kirche St Mary-at-Latton das Symbol einer «neuen menschenfreundlichen Zivilisation», die aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen sei.
WAS GESCHAH IN HARLOW?
Ich hingegen kannte keine andere Heimat. Als ich geboren wurde, nannte man Harlow wegen der vielen jungen Paare, die dort Familien gründeten, nur die «Kinderwagenstadt». Die Geburtenrate war dort dreimal so hoch wie im Landesdurchschnitt. Der Künstler Henry Moore, der ein Haus und Atelier in der nahe gelegenen Ortschaft Perry Green in der Grafschaft Hertfordshire hatte, wurde gebeten, eine Skulptur zu ent werfen, die das grandiose Versprechen der New Town symbolisierte.
In Harlow richtete man den Blick in den ersten Jahren ausschliess lich nach vorn – Hoffnung, Neuanfang und jugendlicher Elan standen im Mittelpunkt. Schaut nicht zurück! Schaut bloss nicht zurück! Doch in den sechziger Jahren kamen erste Berichte über ein Phänomen auf, das man als «New Town Blues» bezeichnete. Es beschrieb ein Gefühl der Entfremdung und der Isolation, empfunden von denjenigen, denen es schwerfiel, sich anzupassen, oder die jene Gemeinschaften vermissten, aus denen man sie gerissen hatte.
Für meine Eltern war der Umzug nach Harlow eine Art Flucht: Weg von der Vergangenheit mit ihren Bombenkratern und zerstörten viktorianischen Gebäuden und Strassen im Londoner Osten und hin, so glaubten sie, in eine bessere Zukunft. Lord Reith, der erste Gene raldirektor der BBC, war Vorsitzender des New-Towns-Ausschusses.
Die Harlow Family Group war eines von vielen bemerkenswer ten Stücken, die vom 1953 gegründeten und von Philanthropen und der Stadtverwaltung unterstützten Harlow Arts Trust angekauft oder in Auftrag gegeben wurden. Die Idee von öffentlicher Kunst für die
Illustration: Luca Schenardi
KRIMINALITÄT
arbeitende Bevölkerung hatte etwas Bevormundendes, aber die Ab sichten waren gut. «Oftmals sind Skulpturen nur eine Art kulturelles Zugeständnis, die für das tatsächliche Leben einer Stadt wenig Bedeu tung haben, aber in diesem Fall sind sie ein integraler Bestandteil von Harlow geworden», sagte Frederick Gibberd 1964. Er wollte, dass Har low «die Heimat der schönsten Kunstwerke wird, wie Florenz und andere eindrucksvolle Städte».
Damals5
– heute kaum vorstellbar – schrumpfte Londons Bevölkerung. Bevor er heiratete, hatte mein Vater, als einziges Kind eines Busfahrers, in einem Reihenhaus im Londoner East End gelebt, die Besiedelung wurde in diesem Stadtviertel langsam dünner, und der Wald begann. Das Haus hatte einen kleinen Garten, die Toilette befand sich draussen. Mein Vater war talentiert und obendrein ein begabter Cricketspieler; er und seine Mutter erhofften sich mehr als das, was das Leben für ihn bereitzuhalten schien. Sein Vater Frank, der in seiner Freizeit in den Pubs des East End boxte, war ein ruhiger und umgäng licher Mann ohne grossen Ehrgeiz. Mein Vater wollte nicht Busfahrer wie sein Vater werden oder an den Docks arbeiten wie seine Vorfahren. Es zog ihn ebenso wenig nach Australien, wohin einer seiner Onkel ausgewandert war. Er hatte kulturelle Ambitionen. Mit der Unterstüt zung seiner kampfeslustigen, unnachsichtigen, rothaarigen Mutter (die stets eine Brosche mit einem Foto ihres Sohnes trug, der bei ihr nur «jedermanns Liebling» hiess) kleidete er sich elegant, las Gedichte, hörte Jazzmusik und kaufte jeden Sonntag den Observer, um die Literatur- und Kunstkritiken zu lesen. Er ging gern ins Theater und war von Hollywood fasziniert. Er liebte die Marx Brothers und W. C. Fields. Als er ein junger Mann war, war das East End nicht das heutige pulsierende, polyglotte, multiethnische Reich der Hipster-Bars, Tech-Startups, Craft-Beer-Festi vals und Barista-Seminare, ein Ort mit astronomischen Immobilien preisen. Es war engstirnig, arm und kleingeistig. Er wollte raus. Doch viele Jahre später, in Harlow, als mein Vater im mittleren Alter war und seine erfolgreiche Karriere im «Lumpenhandel», wie er seinen Schneiderberuf ironisch nannte, ins Stocken geriet, passierte etwas mit ihm. Er wurde zunehmend nostalgischer und introspektiver. Er fing an, über die verlorene Welt im East End seiner Jugend zu grübeln – über das Gemeinschaftsgefühl und den Nachbarschaftsgeist von da mals. Vielleicht war es ein sehr später Ausbruch des New Town Blues. Er hörte immerzu Musik aus den vierziger Jahren, am liebsten die populären
24 Songs von Al Bowlly, dem südafrikanischen Sänger, den eine deutsche Bombe in seiner Londoner Wohnung tötete. «Oh, nein, jetzt fängt er schon wieder mit dem Krieg an», frotzelten wir dann. Er zeigte mir einige der Gedichte, die er geschrieben hatte. Immer war der Schauplatz das East End der frühen vierziger Jahre oder unmittelbar nach Kriegsende. Mein Vater war ein Kriegskind. Der erste Tag des Blitzkrieges, der 7. September 1940 – der «Schwarze Samstag» –, ein Tag mit strahlend blauem Himmel, war sein sechster Geburtstag. Er war so traumatisiert vom Angriff auf die Docklands und die umliegenden Viertel – er erin nerte sich an brennende Gebäude und das apokalyptische rote Leuchten des Himmels –, dass er zu sprechen aufhörte. Mein Grossvater, der Bus fahrer, weigerte sich, das Haus selbst bei starken Bombenangriffen zu verlassen. Mein Vater und meine Grossmutter rannten zum nächsten Luftschutzbunker, sobald die Sirenen ertönten und vor einem Angriff der Luftwaffe warnten, doch Frank blieb lieber über der Erde, selbst wenn die Häuser der Nachbarn den Bomben zum Opfer fielen.
In6 Harlow aufzuwachsen, hiess, an vorderster Front der englischen Revolution zu kämpfen. Mehr noch, man war selbst ein kleines Zahnrad in einem bedeutenden sozialen und politischen Experiment. Heute verstehe ich das, aber damals fehlte mir der Abstand. Meine Freunde
In späteren Jahren sprach mein Vater oft darüber, wie die Zerstörungen, die eindrücklichen Erfahrungen eines Kindes an der Hei matfront und die Allgegenwärtigkeit des Krieges die Menschen zusam menschweissten: Sie hielten zusammen in der Überzeugung, dass, wenn sie gemeinsam das Schlimmste überstanden, eine bessere Zukunft auf sie wartete. Harlow schien dieses Versprechen wahr zu machen.
Der Krieg und die dadurch bedingte Planwirtschaft schufen die Voraussetzungen für Sozialismus und eine neue Siedlungspolitik in Grossbritannien. Ohne den Krieg wäre Labour 1945 nicht an die Macht gekommen. «Die Revolution in England hat begonnen», sagte der Schrift steller H. G. Wells am 22. Mai 1940, als das Notstandsgesetz ins Unter haus eingebracht wurde und Sandsäcke rund ums Parlamentsgebäude gestapelt wurden. Für George Orwell, der den Patriotismus der Arbei terklasse bewunderte, entwickelte die «englische Revolution» mit dem heroischen Rückzug aus Dünkirchen ihre eigene Dynamik. «Wie alles in England passiert es auf eine verschlafene, widerwillige Weise, aber es passiert», schrieb Orwell. «Der Krieg hat es beschleunigt und die Beschleunigung gleichzeitig notwendig gemacht.»
KRIMINALITÄT
25 und ich waren Kinder des Sozialstaates. Die sozialen Veränderungen und die zentralisierten Planungen der Nachkriegszeit, als die neue LabourRegierung mit dem Aufbau dessen begann, was Attlee das «Neue Je rusalem» nannte, boten uns aufregende neue Möglichkeiten. Der Nati onal Health Service wurde ins Leben gerufen, die National Insurance Act schaffte den verhassten Bedürftigkeitsnachweis als Bedingung für Sozialleistungen ab; wichtige Industriezweige wie die Eisenbahn und der Bergbau wurden verstaatlicht; die Town and Country Planning Act wurde verabschiedet und ebnete den Weg für den Wohnungsbau im grossen Stil und die Neugestaltung riesiger Landstriche; Grossbritan nien bekam eigene Atomwaffen zur nuklearen Abschreckung; die Kluft zwischen Reich und Arm wurde kleiner.
Die individuelle Freiheit und die grossen britischen Institutionen blieben weiterhin bestehen. Die Kriegs kosten hatten die Kassen der Nation geleert, für ein ruinöses Handels defizit gesorgt und die imperiale Hegemonie des Landes beendet. Aber jetzt waren neue Zeiten angebrochen. Fortschritt war nicht nur möglich, er war unausweichlich. Attlee erkannte, dass das britische Volk «einen Neuanfang wollte». Es hatte viel gelitten und Schlimmes durchgestan den. Ab jetzt, sagte er, «blicke man in die Zukunft». Unsere Kindheit war ein soziales Experiment, und es schien, als ob alles, was wir brauchten, vom Staat zur Verfügung gestellt wurde: Woh nung, Bildung, Krankenversorgung, Bibliotheken, Freizeit- und Sportan lagen. Es gab sogenannte playschemes (die ein bisschen an Sommerlager erinnerten), wo wir uns trafen, um während der Ferien zu spielen oder an organisierten Wettbewerben teilzunehmen. Die Stadt verfügte über eines der ausgedehntesten Radwegenetze im Lande, welches alle Stadtteile mit dem dichtbebauten Stadtzentrum, dem auf einem Hügel errichteten «High» und mit den beiden wichtigsten Industriegebieten, den Temple Fields und den Pinnacles, verband. 1961 wurde ein Mehrzwecksportzen trum eröffnet, das erste seiner Art in Grossbritannien. Es wurde von den Bewohnern der Stadt durch freiwillige Zusatzabgaben auf die Gemeindesteuer finanziert (meine Tante war eine begeisterte Unterstützerin).
WAS GESCHAH IN HARLOW?
Es war eine sehr britische Revolution, ein sehr pragmatisches so zialistisches Experiment: Der Staat wurde mächtig, aber nicht über mächtig. Hier wurde nicht rachsüchtig etwas zerstört, sondern etwas geschaffen: ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen dem Staat und dem Einzelnen zur Verbesserung des Gemeinwohls. Die Monarchie und Familien mit Grundbesitz blieben ebenso verschont wie die traditions reichen Privatschulen (Attlee selbst war stolzer Absolvent des Hailey bury and Imperial Service College).
Alle anderen waren weiss. Die Eltern meiner Klassenkame raden kamen überwiegend aus dem East End oder den ärmeren Vier teln im Norden Londons, viele arbeiteten in den Fabriken und Indus trieanlagen der Stadt. Jedes Unternehmen unterhielt seine eigenen Vereine und Sportmannschaften, ja sogar Fussballteams für Jungen, gegen die ich in der Freizeitliga für Newtown Spartak antrat – ein 26
KRIMINALITÄT
Aber im Grossen und Ganzen war eigentlich jeder, mit dem ich zu tun hatte, weiss und der Arbeiterklasse zuzurechnen. Unter den rund 250 Kindern in meinem Jahrgang an der weiterführenden Schule – einer gigantischen Gesamtschule, die 1959 ihre Pforten geöffnet hatte und 1972 erweitert wurde, einer von insgesamt acht Schulen in der Stadt – kann ich mich nur an einen einzigen Jungen erinnern, dessen Familie aus Hongkong kam (er eröffnete später ein Restaurant in Deutschland), und an zwei Mädchen, deren Eltern Inder waren.
26
Ein Freund hat die Erfahrung, in den sechziger und siebziger Jah ren in der Stadt aufzuwachsen, später als «Ostdeutschland ohne Stasi» beschrieben. Diejenigen von uns, die dort geboren und aufgewachsen waren, galten als die «Bürger der Zukunft». Ländliche Räume (soge nannte Grünzüge im Generalbebauungsplan, von denen sich einer zum imposanten Stadtpark entwickelte, inklusive Eislaufbahn, Musikpa villon, Neun-Loch-Golfplatz und Zoo) und Spielzonen für Kinder sollten uns ermutigen, ein gesundes, aktives Leben zu führen, und sichere Orte zum Spielen bieten. Oder wie es im öffentlichen Informationsfilm über Harlow von 1958 hiess: «Wenn es diesen Jungen und Mädchen im Er wachsenenalter nicht gelingt, erfolgreich die Probleme ihrer Zeit zu bewältigen, so kann man die Schuld sicher nicht bei den Architekten und Planern suchen, die ihnen diesen aussergewöhnlichen Start er möglicht haben.»
Was7 ich damals nicht sah – beziehungsweise schon sah, aber mir nichts dabei dachte –, war, dass Harlow im Grunde eine reine Mono kultur war. Das erklärte Ziel war es gewesen, eine «klassenlose» Gesell schaft zu schaffen, doch wer dort aufwuchs, hatte die meiste Zeit das Gefühl, in einer «Einklassenstadt» zu leben. Die Arbeiterklasse blieb hier unter sich. Es gab eine kleine Gruppe bürgerlicher Intellektueller, die sich in der Labour-Partei und den lokalen Theater-, Literatur- und Filmgesellschaften engagierte und sich ab 1971 zu Live-Theater-Auf führungen, Filmen und Ausstellungen traf. Mein Vater, den Kultur im mer mehr interessiert hatte als Politik, war unter ihnen.
In den fünf Jahren, die ich an der Gesamtschule verbrachte (ich verliess die Schule mit sechzehn Jahren und machte später mein Abitur am Harlow College), hatte ich nicht das Gefühl, dass man uns hier
Meine Schulzeit war eine einzige Übung in Kompromiss und Anpassung: Wenn ich zu Hause so gesprochen hätte wie in der Schule, hätte meine Mutter meine Aussprache kritisiert. Hätte ich umgekehrt in der Schule so gesprochen wie zu Hause, wäre ich als posh verspottet worden, was eine der schlimmsten Beleidigungen war. Wenn meine Klassenkameraden mich in unserem mit Büchern vollgestopften Haus besuchten, versteckte ich die Zeitschriften und Zeitungen meines Vaters – den New Statesman, The Listener, i-D, City Limits –, weil es nicht die Sun oder der Mirror waren, die die anderen Väter lasen. Ich war wenig begeis tert, dass er sich nicht an die in Harlow geltenden Normen hielt. Gleich zeitig wäre die Konformität, die ich mir wünschte, ein Verrat an allem gewesen, was ihm wichtig war und was ihn ausmachte. Manchmal, wenn er nicht da war, öffnete ich seinen Schrank und atmete den warmen, betörenden Geruch seiner Kleidung ein. Besonders faszinierten mich seine zweifarbigen Schuhe, die exotischen Hemden und grellen Krawat ten. Warum kleidete er sich nicht wie die Väter meiner Klassenkameraden, die typische Arbeiterjacken und Doc-Martens-Stiefel trugen?
WAS GESCHAH IN HARLOW?
27 Klub mit einem Namen, den man spontan wohl eher in der Sowjetunion verortet hätte.Vor
Wir selbst waren bereits seit 1972 stolze Eigentümer unseres eigenen Hauses und lebten in einer der wenigen privaten Siedlungen, den sogenannten Executive Estates. Damit stachen wir aus der Masse heraus, ebenso wie durch die Tatsache, dass mein Vater nicht vor Ort arbeitete, sondern in London (und dann noch mit seinem Alfa Romeo hin- und herpendelte, anstatt den Zug zu nehmen). Da er in der Kleiderbranche tätig war – er kümmerte sich um Design, Sortiments gestaltung, Vermarktung –, trug er modische, oft extravagante Kleidung und reiste viel – nach Indien, Hongkong, in die Vereinigten Staaten, Südkorea, Frankreich, die Schweiz, Italien und Deutschland.
der Einführung von Margaret Thatchers «Right to Buy»Programm, das es Mietern ermöglichte, ihr Haus von der Gemeinde stark vergünstigt zu erwerben, hatten die meisten Häuser in der Stadt der Gemeinde gehört. Noch heute ist ein Drittel des Wohnungsbestands in Gemeindebesitz.
Mein Vater hatte ein Abendstudium absolviert und konnte sich gut ausdrücken – für meine Freunde war er damit piekfein, posh. Natürlich war er das nicht, sondern er sprach bloss nicht den lokalen Dialekt, der in und um London gesprochen wird.
KRIMINALITÄT
28 auf ein mögliches Studium vorbereitete. Ich sagte einmal aus einer Laune heraus, dass ich gern Jura studieren würde, ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich bedeutete. Ein Lehrer erwiderte, Jura sei etwas für die «Jungs von der Privatschule», und damit war die Sache für ihn durch. Es war eine wichtige Lektion für mich. Meine Hauptarbeit bestand darin, mich irgendwie durchzumogeln. Holzarbeit, Metall arbeit, Kraftfahrzeuglehre und Hauswirtschaftslehre gehörten zu unse ren Unterrichtsfächern. Ich erwies mich in jedem einzelnen von ihnen als hoffnungslos untalentiert. Mein8 Vater verpasste keine Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass wir unsere Möglichkeiten als Bürger der Zukunft dem Idealismus der Kriegsgeneration verdankten. Nur leider ist der Fortschritt keine Einbahnstrasse. Es geht nicht von selbst immer nur vorwärts, und der Verlauf der Geschichte bringt die Menschen einer aufgeklärten Gesell schaft nicht automatisch näher. Die Geschichte verläuft nicht linear, sondern sie ist Zufällen, Zäsuren und Zyklen unterworfen. Ron Bill, ein Bekannter meiner Mutter, der für die Harlow Development Corporation arbeitete, sagte mir einmal, dass er und seine Kollegen eine Utopie hätten verwirklichen wollen. «Die Stadt zog fortschrittsgläubige, gemein schaftsorientierte Menschen an», sagte er. Der Stadtarchitekt Frederick Gibberd war selbst einer von ihnen gewesen. Die erste Welle von Men schen, die in den fünfziger und sechziger Jahren in die Stadt kam – unter ihnen viele Sozialisten und Kommunisten –, träumte davon, etwas gemeinsam aufzubauen. Das Problem war nur, dass dieser ersten Welle keine vergleichbare zweite folgte. Utopie bedeutet «Nichtort» oder «Nirgendwo». Harlow wird oft als abgehängte Stadt bezeichnet, als «Nirgendwo», das man nur durchquert, um nach «Anderswo» zu gelangen. Nach dem Tod von Arkadiusz Jóźwik im Sommer 2016 kamen nur Negativschlagzeilen aus Harlow. Die ersten Berichte über den sogenannten «Brexit-Mord» vermittelten überwie gend den Eindruck, die Pioniere und Planer der Stadt, die eine Utopie im Sinn gehabt hatten, hätten stattdessen ihr Gegenteil geschaffen: eine Dystopie.9Am31. Juli 2017 begab ich mich zum Chelmsford Crown Court, um zu hören, wie Richterin Patricia Lynch ihr Urteil im Fall Jóźwik verkündete. Als ich im heruntergekommenen Wartebereich vor
Die Mutter wirkte nicht sonderlich überrascht, als die Jury ihren Sohn des Totschlags an Arkadiusz Jóźwik schuldig sprach. Ge neralstaatsanwältin Jenny Hopkins sagte, ihrer Ansicht nach hätten die Jugendlichen nicht die Absicht gehabt, Jóźwik zu töten. Es handele sich nicht um eine durch Rassismus oder Fremdenhass motivierte Tat, wie man weithin berichtet hatte. «Die korrekte Anklage lautet daher unserer Ansicht nach auf Totschlag», sagte sie. «Totschlag ist die rechts widrige Tötung einer anderen Person mit der Absicht, ihr Schaden zuzufügen, oder unter der Inkaufnahme, dass ein gewisser körperlicher Schaden daraus folgen könnte.» Dem Gericht wurde vorgetragen, dass der Jugendliche den Hieb «mit vollem Körpereinsatz» ausgeführt habe und gewusst haben müsse, dass ein gewisser Schaden die wahrschein liche Folge sein würde.
29 dem Gerichtssaal darauf wartete, dass die Verhandlung begann, sass die Familie des jungen Angeklagten mir gegenüber. Fast ein Jahr war seit Arkadiusz Jóźwiks Tod vergangen, und der Angeklagte, dessen Name aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden darf, war in zwischen sechzehn Jahre alt. Seine Familie – er war in Begleitung seiner Mutter und Grossmutter erschienen – betrachtete mich arg wöhnisch und lehnte jede Stellungnahme ab, als ich sie ansprach. Der Junge starrte mich einfach nur mit leerem Blick an. Ich gab der Fami lie meine Kontaktdaten und bat sie, sich bei mir zu melden. Ich hörte nichts mehr von ihnen. Ich unternahm noch mehrere Versuche über ihren Anwalt in Old Harlow. Doch die Familie hatte sich entschieden zu schweigen.AmNachmittag wechselte ich ein paar Worte mit dem Onkel des Angeklagten, der vor dem Gerichtsgebäude eine Zigarette in der Sonne rauchte. Er war in den Zwanzigern, hatte jede Menge Tätowie rungen am Arm und konnte nicht verstehen, was in «The Stow» passiert war. Der Junge im Gerichtssaal trug ein zu grosses weisses Hemd, eine locker geknotete dunkle Krawatte und eine schlichte schwarze Hose. Er war nicht gross, mit gewelltem Pony und einem dünnen Schnurrbart. Er machte auf der Anklagebank einen verlorenen, stellenweise sogar gelangweilten Eindruck unter den besorgten Blicken seiner Mutter. Man sah, dass ihre Nägel auf die Haut heruntergekaut waren.
WAS GESCHAH IN HARLOW?
Die Generalstaatsanwältin fuhr fort: «Es war ein sinnloser Angriff, und durch diesen einen Hieb, der in Sekundenschnelle vorbei war, trägt der junge Mann die Verantwortung dafür, dass Herr Jóźwik sein Leben verlor und seiner Familie und seinen Freunden unvorstellbares Leid zugefügt wurde.»
30
Die Richterin kündigte an, dass die Urteilsverkündung am Freitag, dem 8. September, stattfinden werde. Zu diesem Zeitpunkt
Doch das Panorama war unvollständig, es fehlte das modernisti sche Hochhaus, welches einst das Rathaus beherbergt hatte. Es galt seinerzeit als das bedeutendste Gebäude Harlows und lag am Dreh- und Angelpunkt der Stadt, dem Bürgerplatz. Gibberd hatte es selbst entwor fen, und Clement Attlee hatte es 1960 eröffnet. Einige Jahre nach der Jahrtausendwende wurde es als eine der ersten Massnahmen zur Neu gestaltung der halbverfallenen Innenstadt abgerissen. Ein riesiger Su permarkt nimmt heute den Platz ein, wo einst das Rathaus allein auf weiter Flur wie ein monumentaler Wachturm in den Himmel ragte.
Hinter den Feldern konnte ich gerade noch die Wohnsiedlung erspähen, in die mein Grossvater nach seiner Pensionierung gezogen war, um näher bei seinem Sohn zu sein, der letztlich vor ihm starb.
Vor vielen Jahren, als ich noch in Harlow lebte, machten wir nach mittags einmal einen Schulausflug zum «High», wie wir das markante Hochhaus nannten. Ein paar Freunde und ich setzten uns von der Gruppe ab und schlichen ins Rathaus. Es kursierten Gerüchte, dass sich im Keller ein Atombunker befände, und den wollten wir sehen. Statt dessen landeten wir im Aufzug zum Aussichtsturm. Die Aussichts plattform hatten wir dann ganz für uns allein. Wir liessen unseren Blick über die Landschaft schweifen. Vor uns lagen die nüchternen, geraden, 30
hatten die Medien das Interesse an dem Fall bereits verloren. Es war doch kein «Brexit-Mord» gewesen.
KRIMINALITÄT
An10 einem regnerischen Morgen kurz vor Weihnachten besuchte ich den Stadtratsvorsitzenden von Harlow, einen energiegeladenen Labour-Politiker namens Jon Clempner. Dieser erregte sich darüber, dass die Essexer Polizei seiner Meinung nach den Fall ungeschickt gehand habt und so dazu beigetragen habe, dass Gerüchte und Anschuldigungen ausser Kontrolle gerieten. «Die Polizei wusste innerhalb von 24 Stunden, dass es sich nicht um einen rassistischen Angriff oder gar Mord han delte. Aber sie traten den Spekulationen erst entgegen, als es schon zu spät war», sagte er bei einer Tasse Tee zu mir. Wir sassen in seinem Büro im Bürgerzentrum mit Blick auf die Water Gardens, die ursprünglich von Frederick Gibberd als eine Reihe von parallel verlaufenden Terras sen angelegt worden, aber seitdem umgestaltet und verkleinert worden waren. Durch das Panoramafenster konnte ich ausserdem einen Park platz, einen Radweg, ein Stück Wald und nahe gelegene Felder sehen.
Es11 dauerte lange, bis ich die Erfahrung meiner Kindheit und Jugend in Harlow verdaut hatte. Die meisten Kinder, die ich kannte, einige davon blitzgescheit und begabt, spielten nie auch nur mit dem Gedanken, ein Studium aufzunehmen. Sie waren froh, die Schule so schnell wie möglich hinter sich gebracht zu haben. Manchmal frage ich mich, was wohl aus ihnen geworden ist. Auch ich wäre fast nicht an der Universität gelandet. Wäh rend meiner Schulzeit rebellierte ich, wechselte unentwegt die Fächer, kam zu spät zum Unterricht oder blieb gleich ganz weg und brach schliesslich die Schule ab. Meine letzten Teenagerjahre verbrachte ich damit, arbeitslos, ruhelos und ideenlos zu sein, mich hoffnungslos zu verlieben und chronisch pleite zu sein. Schliesslich fand ich einen Schreibtischjob beim Electricity Council in London. Die Zugfahrt konnte ich mir nicht leisten, also pendelte ich mit dem Bus vom Haus meiner Eltern in die Stadt, eine Fahrt, die je nach Verkehrslage zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen konnte. Und abends dann das Gleiche zurück. Ausgerechnet auf diesen Busfahrten begann ich, zum ersten Mal ernsthaft Bücher zu lesen. Nach sechs Monaten in der undurchschaubaren Bürokratie des öffentlichen Dienstes beschloss ich, dass es an der Zeit war, mein Abitur so schnell wie möglich nachzuholen. Ich gab mir neun Monate Zeit, um mein Leben umzukrempeln. Ein wohlwollender Vorgesetzter im Electricity Council stellte mich freitags für den berufsbegleitenden Unterricht von der Arbeit frei, damit ich ans Harlow College zurück kehren konnte, wo ich als Schüler von meinem Tutor als «Dilettant» verspottet worden war. Diesmal wählte ich Politik als Fach, ein Thema, an dem ich ein wachsendes Interesse entwickelte. Ich schrieb mich für einen Abendkurs am Donnerstagabend zur Vorbereitung auf das Abitur in englischer Literatur an einer Gesamtschule in Old Harlow ein. Dort begegnete ich David Huband, einem klugen Mann mit leiser Stimme 32
32 geometrischen Linien unserer Heimatstadt mit ihrem Netz von Stras sen und Alleen, Schulen und Fabriken, Wohnsiedlungen und Grünzügen.
Wir blieben auf dem Turm, bis es fast dunkel war, und sahen staunend zu, wie eine Lampe nach der anderen in den winzigen Häuschen anging und wie das bernsteinfarbene Licht die gitterartigen Strukturen der Stadt nachzeichnete. Schliesslich verschwammen die Lichter der Häuser, und ich versuchte mir vorzustellen, wie es hier ausgesehen hatte, bevor die New Town erbaut wurde, ländlich, ruhig und menschenleer.
KRIMINALITÄT
Am12 8. September 2017 wurde ein sechzehnjähriger Bewohner Harlows wegen Totschlags an Arkadiusz Jóźwik zu dreieinhalb Jah ren in einer Einrichtung für junge Straftäter verurteilt. Die Richterin Patricia Lynch sagte, dass Jóźwik ein «anständiger, geschätzter Mann, der sein Leben noch vor sich hatte» gewesen sei. Seine Familie ver misse ihn schmerzlich. Während die Richterin sprach, hörte man leises Schluchzen im Gerichtssaal. «Ein Jahr ist jetzt vergangen seit Areks Tod, aber ich vermisse ihn immer noch jeden Tag», erklärte Ewa Jóźwik, die Mutter, in einer vor Gericht verlesenen Erklärung. «Manchmal möchte ich nicht mehr leben.» Sie war während der Urteilsverkündung anwesend und weinte die ganze Zeit.
Die drei Stunden, die ich jeden Donnerstag zwischen sieben und zehn Uhr abends in seiner Gesellschaft zubrachte, stellten meine Weltsicht auf den Kopf, und die neun Monate von September 1985 bis Mai 1986, während deren ich im Electricity Council arbeitete, im Bus las und das Wochenende zu Hause oder in der Bibliothek mit Lernen ver brachte, veränderten mich nachhaltig. Ich hatte niemandem erzählt, was ich vorhatte, aus Angst zu scheitern und weiter mein Dasein als Büroangestellter fristen zu müssen. Im Mai und Juni, zeitgleich mit der Fussballweltmeisterschaft in Mexiko, machte ich mein Abitur. Als der Sommer zu Ende ging, nahm ich mein Studium auf: Ich war überzeugt, Harlow und alles, was damit zusammenhing, in einem einzigen grossen Befreiungsschlag ein für alle Mal hinter mir gelassen zu haben. Ab jetzt würde nur noch nach vorn geschaut.
Der Verteidiger Patrick Upward sagte, sein Mandant, der auf der Anklagebank wieder ein weisses Hemd und eine schwarze Krawatte trug, «bereue», was geschehen sei – der Angeklagte bestätigte dies mit einem Nicken –, und wies auf den familiären Hintergrund und die schwere Krankheit des Vaters hin. Das Gericht erfuhr, dass der Junge zwei Vorstrafen hatte, eine wegen bedrohlichen Verhaltens. Dennoch sei «der junge Mann trotz aller Schwierigkeiten kaum vom rechten Weg abgekommen». Richterin Lynch schloss jedoch mit den Worten,
WAS GESCHAH IN HARLOW?
33 und Bart. Er war einer von jenen Lehrern, die andere inspirieren kön nen. Es war ein Lehrer, wie ich ihn bis dahin nicht gekannt hatte und wie wir ihn alle brauchen. Er gehörte zur intellektuellen Szene von Harlow, kannte meinen Vater über fünf Ecken und nahm mich unter seine Fittiche. Er muss gespürt haben, dass ich in Schwierigkeiten war, in existenzieller Angst und ohne Orientierung.
Als Ewa Jóźwik das Gerichtsgebäude in Chelmsford verliess, reg nete es. Reporter von mehreren polnischen Fernsehsendern, die vor dem Gebäude warteten, wollten wissen, ob sie die Strafe für angemessen halte. Sie schüttelte den Kopf als ein Zeichen der Enttäuschung oder Resignation. «Ich sehe ihn immerzu vor mir, bewegungslos im Kranken hausbett, nur von den Maschinen am Leben gehalten», sagte sie über ihren toten Sohn. «Ich wollte ihn einfach nur aufwecken.»
34 dass der Angeklagte nach dem Übergriff aus dem Einkaufszentrum geflohen sei und «nichts getan habe, um dem Opfer zu helfen». Als das Urteil verkündet wurde, winkte der Junge – der verlorener aussah denn je – seiner Familie verlegen zu und stolperte beinahe beim Verlassen der Anklagebank. Seine Mutter weinte jetzt auch und rief ihm zu: «Ich liebe dich!» Sie und andere Familienmitglieder hasteten aus dem Gerichts saal, man hörte sie im Flur weiterweinen.
Vor13 kurzem habe ich eine Radtour rund um Harlow gemacht: Das Radwegenetz ist mittlerweile ausgefahren und holprig, zählt aber immer noch zu den Highlights der Stadt. Es war knackig kalt, und ich genoss es, wieder einmal hier zu sein. Ich kenne fast niemanden mehr in der Stadt und besuche nur alle Jubeljahre die älteste Schwester meiner Mutter, die schon neunzig ist. Sie lebt seit mehr als fünfzig Jahren im gleichen bescheidenen Reihenhaus, nur wenige Gehminuten von meiner ehemaligen Schule entfernt. In der letzten Zeit ertappe ich mich
KRIMINALITÄT
Arkadiusz Jóźwik ist in Harlow begraben, und auf seinem Grab stein steht: «Du warst ein Traum, jetzt bist du eine Erinnerung.»
Je mehr ich über den Fall nachdachte, umso mehr taten sie mir alle leid – Jóźwik natürlich und die, die ihm nahestanden, aber auch der Junge im Gefängnis, «der trotz aller Schwierigkeiten kaum vom rechten Weg abgekommen» war, und seine Familie. Auch Harlow tat mir leid, die Stadt, in die kurz nach Jóźwiks Tod Journalisten aus aller Welt ein fielen, in der die polnische Polizei im Einkaufszentrum auf Streife ging und die zum Symbol für all jenes geworden war, was in England schief lief. Die Brexit-Abstimmung hatte ein zänkisches und zerrissenes Land offenbart. Harlow, die War-einmal-Utopie, war zu einer «abgehängten» Stadt mit einer desillusionierten und fremdenfeindlichen Bevölkerung geworden. Obwohl Harlow nur dreissig Zugminuten von dem immen sen Reichtum und der Vielfalt einer der am stärksten globalisierten Städte der Welt trennen, kam der Wohlstand hier nicht an. Die Stadt schien Teil eines anderen Landes, einer anderen Welt zu sein.
Harlow14 feierte 2017 sein 70-Jahr-Jubiläum, und es gibt spürbare Zeichen der Veränderung: 10 000 neue Häuser werden im Rahmen des Bauprojektes Gilston Park nördlich des Hauptbahnhofs hochgezogen; Public Health England baut einen neuen Wissenschafts- und Forschungs campus, der Tausende neue Arbeitsplätze schaffen soll; ein Gewerbege biet zieht ausländische Investoren an; das Stadtzentrum, das in meiner Jugendzeit vor allem an Markttagen so lebendig war, soll neu gestaltet und zu einer reinen Wohnsiedlung werden. Harlow liegt an der Autobahn M11 zwischen London und Cambridge. Es muss nicht abgehängt sein.
Zum Zeitvertreib traten sie Löcher in die hölzernen Gartenzäune, und obwohl sich das Ganze nur etwa hundert Meter von den Schultoren entfernt abspielte, ist nie ein Lehrer vorbeigekommen und hat sie zu rechtgewiesen.DieSchule gibt es längst nicht mehr, dort steht heute ein Geschäftszentrum. In Gedanken wandere ich ihre Gänge jedoch oft auf und ab, besonders seit mein eigener Sohn vor vier Jahren in die Schule gekommen ist. Als ich bei meinem Besuch auf dem Parkplatz stand, der früher unser Spielplatz gewesen war, war mir, als könnte ich die aufge regten Kinderstimmen um mich herum hören, und ich spürte das bren nende Gefühl von lange unterdrückten Enttäuschungen und Bedauern.
Ich bin mir nicht sicher, was genau mich dort hinzieht. Ein mal bin ich sogar meinen alten Schulweg abgegangen, der durch eine schmale Gasse zwischen zwei Gärten führte, an deren Ende immer rauchende Teenager rumlungerten, die mir äusserst unheimlich waren.
Die Stadt ereilte das gleiche Schicksal wie die meisten in der Nachkriegszeit gebauten New Towns. Es ging bergab mit ihr, und der Niedergang beschleunigte sich, als die Entwicklungsgesellschaft ihre Arbeit einstellte und Investitionen in Wohngebiete und Infrastruktur ausblieben. Grosse Fabriken und Industrieanlagen wurden geschlossen oder verlegten ihren Standort, was die Arbeitslosigkeit in die Höhe trieb. Grössere Investitionen blieben aus. Nun leiden sie unter den Folgen dieser Unterernährung.
35 immer wieder dabei, wie ich nach dem Besuch bei ihr nicht direkt nach Hause fahre, sondern stattdessen durch die so vertrauten Wohnsied lungen, durch die so vertrauten Strassen fahre, an den Feldern vorbei, auf denen ich damals gespielt habe. Einmal hielt ich vor der Kirche an, wo ich Ministrant gewesen war, bis Fussballspiele am Sonntagmorgen mich von dem ungeliebten Ritual befreiten.
WAS GESCHAH IN HARLOW?
KRIMINALITÄT
36
Frederick Gibberds Gesamtbebauungsplan hatte von Anfang an seine Schwächen, vor allem die Tatsache, dass es im Stadtzentrum keine Wohnungen gab und Wohn- und Industriegebiete streng voneinander getrennt waren. Eine Innenstadt wird erst lebendig, wenn Menschen in ihr wohnen und arbeiten. Einige der Siedlungen, wie Bishopsfield mit seinen bedrückend schmalen Gassen, das bei uns in der Nähe lag, waren ideologische Experimente in modernistischer Architektur. Nur hatte niemand darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutete, in dieser brutalistischen Architektur tatsächlich zu leben. Ein Teil der Gebäude musste später abgerissen werden, weil sie mit Materialien gebaut wor den waren, die nicht den Anforderungen an öffentlichen Wohnungsbau entsprachen. Ausserdem hatte Gibberd nicht mit der explosionsartigen Zunahme von Autos gerechnet. Heute sind viele der kleinen Vorgärten zubetoniert und dienen als Parkplatz. Vieles von dem, was ich als sportbegeisterter Junge so genossen hatte – das Schwimmbad, das Sportzentrum, den Golfplatz im Park, das Rathaus –, verfiel zunächst und wurde schliesslich abgerissen. Aber vielleicht war es einfach so, dass die zweite Generation, die in Harlow geboren wurde und den Krieg und andere Städte nicht erlebt hatte, sich nicht wie die Elterngeneration mit Harlow identifizierte. Für sie war es bloss der Ort, an dem sie zufälligerweise lebten, weder mehr noch weniger. Von den Kindern der idealistischen Mittelschicht blieben die wenigsten in Harlow: Sie zogen so bald wie möglich hinaus ins Leben und in die Ferne nach London, dorthin, wo ihre Eltern herge kommen waren. Eine zweite Welle von Fortschrittsgläubigen, die sich dem Traum der New Town verschrieb, blieb aus. Die Abneigung oder Scham, die ich früher einmal gegenüber der Stadt empfunden habe, verspüre ich heute nicht mehr. Ich bin froh, dass die Kriegsgeneration eine Utopie schaffen wollte. Es war richtig von meinen Eltern, Lon don zu verlassen. Man sollte nicht vergessen, dass das Wort «Utopie» immer auch für einen erstrebenswerten Ort steht. Irgendwo auf dem Weg zu diesem Ort verlor Harlow seinen Status als etwas Besonderes, als etwas Neues. Aber es ist trotzdem kein «Nirgendwo» oder ein «Nichtort». Es ist der Ort, an dem ich geboren und aufgewachsen bin. Es ist meine Heimat. Aus dem Englischen von Nadine Alexander.
DIE NEUEN STÄDTE VON EINST
In Deutschland hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung vor zwei Jahren eine Studie zu abgehängten Orten herausgegeben: Sie liegen in Ostdeutschland – und fast immer auf dem Land. Besonders die Regionen Frankfurt (Oder), Mecklenburgische Seenplatte und Harz sind betroffen. Dort fehlt es an Arbeitsplätzen, junge Menschen wandern ab, die Alten bleiben. Auch in der Schweiz gibt es einige Regionen, die einen Bevölkerungsschwund erleben: Gemeinden im Jura, in den Voral pen und im Tessin. In diesen strukturschwachen Gebieten finden sich schweizweit die höchsten Arbeitslosenquoten. Im Tessin ist ein «Austausch» der Arbeitskräfte zu beobachten: Schweizer gehen, Italiener kommen. Mehr als ein Viertel der Arbeitsplätze wird im Tessin von Grenzgängern besetzt, die in Italien wohnen.
KONTEXT ABGEHÄNGTE ORTE
Doch er sah auch den Wert seiner Herkunft: «Ich hatte eine andere Pers pektive auf die Dinge und war skeptisch.» Und er verstand die Men schen in Städten wie Harlow besser. «Sie sind so unzufrieden, weil sie Vernachlässigung und Verfall erlebt haben.»
37 Mehr zum Thema#36 — Stadtentwicklung: Wem gehört die Stadt? — ein Reportagen-Projekt
JasonAUTORCowley ist Chefredakteur der politischen Wochenzeitung New Statesman und ein bekannter Journalist in England. Cowleys Karriere ist ungewöhnlich: Wer in «kleinen Verhältnissen» aufgewachsen ist, schafft es in England selten in die Chefetage. Das gesellschaftliche Sys tem ist undurchlässig, wie in vielen anderen Ländern auch. Als er zum Studium ging, war Cowley schockiert: «Alle, die ich da traf, kannten sich schon, denn sie waren auf Privatschulen gewesen. Ich hatte diese Netzwerke nicht.» Er vermied es, zu sagen, wo er aufgewachsen war.
Andere ereilte ein ähnliches Schicksal wie Harlow: Verfall und Abwan derung. Das wohl berühmteste Beispiel für ein gescheitertes stadt planerisches Projekt war Pruitt-Igoe in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, eingeweiht 1955, abgerissen 1972. Die Anlage hatte fast 3000 Wohnungen; arme Familien, schwarze und weisse, sollten hier gemein sam leben. Doch die Siedlung war an den Menschen vorbeigeplant, nicht einmal Spielplätze liess man zwischen den Häusern bauen. Bald kam es zu Verwahrlosung, Vandalismus, Kriminalität und Gewalt.
Im Englischen heissen sie New Towns, im Deutschen Planstadt oder etwas abwertend «Retortenstadt». Gemeint sind Städte oder Stadtteile, denen ein Plan am Reissbrett zugrunde liegt, die also nicht natürlich gewachsen sind. Manche von ihnen wurden zu Erfolgsgeschichten.
38 FLORIAN LEU Googles Bevölkerung.dieSoftwaregigantenverdrängenInBlumenAirbnbSmartphoneSchlafstadtundstattimHaar:SanFranciscolokale
39 Tony, Obdachloser In seiner ersten Nacht auf der Strasse hatte er noch sein ge streiftes Schlafkissen dabei. Eine Obdachlose lachte ihn aus. In der zweiten Nacht ahmte er sie nach, zog seine Converse-Schuhe aus, fal tete die Jacke, legte sie drauf. Im Juni 2011 wurde Tony Longshanks obdachlos, er war vierunddreissig Jahre alt. Doch er ging immer noch zur Arbeit bei Wells Fargo, der grössten Bank des Landes, er hatte da eine Stelle in einem Arbeitslosenprogramm bekommen, stand hinter dem Schalter, als ob nichts wäre. Seinen Besitz verstaute er in einem Lagerhaus, vor allem Hippiekleider. Wenn er im Schlafsack lag, las er immer wieder den Herrn der Ringe, die Stelle über die sprechenden Bäu me weiss er heute noch auswendig. Er drückte sich Stöpsel in die Oh ren, den Verkehrslärm hörte er aber auch so. Irgendwann half ihm das beim Einschlafen, graues Rauschen. Morgens weckten ihn die Last wagen, die zwölf Meter weiter oben über die Autobahnbrücke fuhren.
Die Pfeiler übertrugen die Schwingung auf den Betonsockel, auf dem Tony schlief. Oft dachte er, noch übernächtigt, als Erstes an ein Erdbe ben. Meist war er verkatert, weil er am Abend eine Flasche Two-BuckChuck getrunken hatte, den Billigwein von Trader Joe’s. Immer schaute er, etwas ängstlich, gleich auf die Uhr. Um sieben mussten er und die anderen vom Parkplatz verschwunden sein, sonst würde der Besitzer die Polizei rufen. Tony stand jeden Morgen am Ort seiner Albträume auf, kam sich vor wie ein Zombie in einem noch nicht gedrehten Film, Die lebenden Toten von San Francisco . Er schlich zum Lagerhaus, wusch sich auf der Toilette, holte den Anzug aus dem Spind, hielt sich für einen Hochstapler, wenn er zur Bank im Financial District ging. Manchmal dachte Tony an Superman. Er war ein obdachloser Clark Kent gewor den, der sich morgens in einen Bürger mit roter Krawatte und schwar zen Schuhen verwandelte. Tony, der Bankangestellte. Tony, der Journa list, der Hausbesetzer, der Stadtstreicher, der Sozialarbeiter, der Junkie, der Aktivist, der Träumer, der Schriftsteller, der Astronaut im ameri kanischen Traum. Er spielte schon viele Rollen. Heute ist Tony achtunddreissig. Er riecht nach Wald und trägt ein paar Grashalme in seinem Haar. Diesen Winter verbrachte er zum ersten Mal unter freiem Himmel, draussen im Presidio. Seine Haut ist bleich, der Mantel dünn. Tony zieht ihn nie aus wie fast alle Obdach losen, die vor den Cafés sitzen und schlummern, während die Leute neben ihnen in Macbooks schauen. In der einen Tasche des Mantels steckt ein Notizbuch, in seinem Rucksack trägt Tony ein Dutzend Ausgaben eines Magazins herum, das er schreibt, druckt und verteilt: SF
REPORTAGEN STÄDTEVERBAND
40
WEM GEHÖRT DIE STADT?
Resistor . Es ist kostenlos und entwickelt einen Sog wie ein Tagebuch aus der Wildnis, kein Wort zu viel, jedes Komma am rechten Ort, jeder Fakt doppelt geprüft, San Francisco von unten. Hier leben mehr Leute auf der Strasse als sonstwo in Amerika, darum nennt man die Stadt auch Kapitale der Obdachlosen, sie sind die unteren Siebentausend. San Francisco hat einen Gini-Koeffizienten von 0,52. Nur in Atlanta ist die Ungleichheit so ausgeprägt wie hier. Ein Wert von null würde bedeuten, dass alle gleich viel haben. Ein Wert von eins hiesse, dass einer alles besitzt. Schweden hat einen Wert von 0,25. In Ruanda wird Vermögen eher geteilt als in San Francisco, dort liegt der Wert bei 0,51. Auf der einen Seite die Habenichtse wie Tony, auf der anderen die Be sitzer der Softwarefirmen, nach denen Orte neu benannt werden: Aus dem San Francisco General Hospital wird Ende Jahr wegen einer Spen de das Mark Zuckerberg Hospital. Der Fillmore District, lange ein afro amerikanisches Viertel, taucht in Immobilienprospekten als Lower Pacific Heights auf, gewissermassen geschichtsneutral. Hunters Point Naval Shipyard, ebenfalls eine traditionell schwarze Nachbarschaft, wird nun als San Francisco Shipyard vermarktet. Dafür bekam Pacific Heights, ein Viertel für Reiche, von Leuten wie Tony den Übernamen Specific Heights. Die Gegend um die Market Street, wo Twitter sein Hauptquartier bezog und deswegen Steuererleichterung bekam, nennt er Twitterloin. Wenn er nachts umhertigert, sieht Tony manchmal die Aufräumarbeiten der Polizei. Wer neben der Market Street schläft, wird mit WasserWennverscheucht.esnachdem Wagniskapitalisten Peter Thiel geht, einem der Geldgeber aus dem Silicon Valley, wären Stadtstaaten auf dem Wasser bereits Wirklichkeit. Es ist die frontier im Pazifik, der Flucht punkt der Neoliberalen. Sie wollen aufs Meer, weg von den Regeln. Auf Plattformen Computer hochfahren, Talente ohne Visum einfliegen, keine Steuern zahlen. Apple zahlt schon heute keine Steuern in Kalifor nien, sondern einen Bruchteil davon in Nevada. Würde die Halbinsel, auf der San Francisco liegt, bei San José vom Festland abbrechen und wegdriften, käme man dem Traum vom Seasteading recht nah: Die Stadt spiegelt die Demografie der Technologiefirmen, wo vor allem Weisse arbeiten, vor allem Männer, Junge, Kinderlose. Bei Google sind Schwarze und Latinos am ehesten für Aufgaben wie das Einlesen von Büchern zuständig – oft sind braune oder schwarze Finger auf den Scans zu se hen. In keiner amerikanischen Stadt leben weniger Kinder als in San Francisco. Dazu passt ein Angebot, das Firmen wie Facebook und Google ihren Mitarbeiterinnen machen. Sie können ihre Eizellen einfrieren
41 GOOGLES SCHLAFSTADT lassen, erst die Karriere, dann der Nachwuchs, wenn überhaupt – man nennt das social freezing. Alte, Schwarze, Latinos können sich die Stadt kaum noch leisten, die Durchschnittsmiete liegt bei 3200 Dollar. Nir gends sind die USA so teuer. Tony holt ein Heft aus dem Rucksack, Broke but Not Bored in SF. Darin findet er Anlässe, die kostenlos sind. Free Veggie Dinner Night, Free Standup Comedy Series, Free Yoga. Seit letztem Herbst gibt er sein Magazin heraus: eine Mischung aus Fundstücken, Reportagen, Hassar tikeln, Auszügen seiner Autobiografie, von der ihm viele Seiten ab handengekommen sind, vergessen auf einer Parkbank, verloren auf einem Spaziergang. Als Extra legt Tony selbstgemalte Gutscheine bei, «30 Dollar weniger Busse, wenn Sie das nächste Mal beim Schwarz fahren erwischt werden». Das Heft erlaubt es ihm, Rollen zu spielen. Mal ist er Reiseführer und gibt Ratschläge für Orte, die nur wenige in der Stadt kennen, eine Waldlichtung im Corona Heights Park etwa, er nennt sie Nomad’s Land, wo man sonnenbaden kann, ohne behelligt zu werden. In der Nähe befindet sich das Randall Museum, wo Tony ab und zu am Treffen der Amateurastronomen teilnimmt und durchs Teleskop Galaxien anschaut – ein wenig kostenlose Unendlichkeit. Ein paar hundert Meter entfernt, im Golden Gate Park, übernachtete er eine Weile im Gebüsch. Dann häuften sich die Nachrichten von Leuten, die hier spurlos verschwanden. Tagelang suchte Tony nach Sean Sidi, einem Schuljungen mit Zahnspange, dessen Smartphone beim Stow Lake das letzte Signal gesendet hatte, wo Tony schlief und oft von der Polizei geweckt wurde, die jeweils um vier Uhr früh den Park nach Obdachlosen durchkämmt. Dashiell Hammett, Erfinder des hard-boiled Krimis, schickte den Detektiv Sam Spade durch die Unterwelt San Franciscos. Tony spielte Spades Wiedergänger, bloss auf Speed und mit einem Zelt statt eines verrauchten Büros. Eine Woche später brach er die Suche ab und zog in die Zeltstadt neben dem Regierungsgebäude, Tony als Rebell. Dabei wusste er nicht genau, was er unter «Occupy San Francisco» verstehen sollte. Er blieb zwei Monate, dann hielt er es nicht mehr aus wegen des Lärms. Er hatte viel über Hausbesetzer ge hört, über die Leute der Organisation Homes Not Jails, über die dreis sigtausend leerstehenden Wohnungen in der Stadt, Platz für achtzig tausend Leute – langsam wurde er zum Aktivisten. An der Capp Street besetzten er und ein paar andere ein Haus; weil die Wände verrusst waren, nannte er es Firehouse. Ständig zog er um, in zweieinhalb Jahren wohnte er in 43 Häusern, das entspricht etwa der Zeit, die Besetzer durchschnittlich an einem Ort verbringen: drei Wochen. Meist lebte
In der Nacht stieg er mit einer Kerze in der Hand die Treppe hoch, Geister als einzige Mitbewohner. Schon als Teenager hatten ihm die se Häuser gefallen, der Film Mrs. Doubtfire spielt in der Gegend. Ein Cousin lebt hier, Tony sieht ihn selten, holt nur manchmal die Post bei ihm ab. «Wenn ich die Regeln befolgt und meine Ehrfurcht vor dem Eigentum anderer Leute behalten hätte, dann hätte ich nie hier gelebt. Nun hatte ich sogar zwei Häuser, und eine Aussicht.» Manchmal ruft Tony seine Mutter an, die immer noch in Minnesota lebt und ihm meist erzählt, welchen Level sie in ihren Vi deospielen erreicht habe. Tony lebt zwar am Ort, wo die Spiele herkom men, er kann aber nicht mal ein Smartphone bedienen. Wenn er die Neuigkeiten hört, staunt er darüber. Beim Vietnamesen Essen bestel len, einen Klempner anheuern, Zahnpasta, Alkohol, Smoothies aus dem Reformhaus geliefert bekommen und dafür nur einen Finger rühren, das ist ihm alles entgangen. Während die Leute um ihn herum Labor mäuse waren für die Apps, die in den Internetfirmen entwickelt wer den. Die Nachrichten, etwa über weisse Polizisten, die schwarze Pas santen erschiessen, schnappt er Monate später auf, wenn er zufällig in eine Demonstration gerät. Er sagt, dass er bald ein Amtrak-Ticket kaufen und aus der Stadt verschwinden werde, solange er noch einen Rest an Verstand habe. Er sagt auch, dass er das schon lange sage. Im mer kommt etwas dazwischen, als hätte er sich in einem Netz verhed dert. Er ist enttäuscht von San Francisco, hatte den Ort für die Heimat der Radikalen gehalten. Die Umweltbewegung nahm hier ihren Anfang, der Sommer der Liebe ging von hier aus, «if you’re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair ».
WEM GEHÖRT DIE STADT?
42 er in Häusern, denen die Besetzer einen Namen gegeben hatten: The Old Man Museum, The Emperor’s New Penthouse, The Great Indoors.
Tony liebte es, um leere Gebäude zu laufen, verfolgt von Polizisten und Sicherheitsleuten. Ohne es zu wollen, war er auf Recherche für ein Buch, auch wenn ihm die Notizen immer wieder davonflatterten.
In Pacific Heights entdeckte er zwei viktorianische Häuser, beide vier Stockwerke hoch, beide leer, ohne Strom, ohne Wasser. Öffnete einen Schrank voller Pelzmäntel, trat in einen Ballsaal mit Spinnennetzen.
Aus California Dreamin’ ist California Streamin’ geworden. Er müsse sich damit abfinden, sagt Tony, dass die Stadt austauschbar geworden sei. Er kann trotzdem noch nicht gehen. Am Ende könne man sowieso nur in der Phantasie wirklich fliehen. Seine Vorstellung vom Paradies ist ein Kino wie das Castro Theatre, ein Filmpalast aus den zwanziger Jahren. Er würde für immer in einem Sessel mit rotem
43 Samtbezug versinken. Auf der Leinwand eine andere Welt und in den Händen, das wäre ihm wichtig, einen Becher warmen Popcorns.
Gerade hat Tony angefangen, für das Anti-Eviction Mapping Project zu arbeiten. Er will besser verstehen, was mit der Stadt ge schieht. Seit einer Weile ist er nüchtern, manchmal meditiert er am Morgen, wenn er im Presidio aus seinem Zelt kommt, Sicht auf die Golden Gate. Alle paar Wochen gibt er sein Magazin heraus, kopiert es in der öffentlichen Bibliothek beim Regierungsgebäude. Vor ein paar Monaten fiel ihm auf, dass er seit Jahren dem Blick der Leute ausgewi chen war. Jetzt schaut er ihnen wieder in die Augen, wenn auch scheu. Das Projekt, an dem er sich als Feldforscher beteiligt, war eine Idee der Anthropologiedoktorandin Erin McElroy. Sie versucht seit 2013, San Francisco in immer neuen, ungewöhnlichen Stadtkarten greifbar zu machen. Aber das ist nur ein Teil ihrer aussichtslosen Rebellion. Erin, Aktivistin Erin trägt eine Wollmütze, meist schauen ihre roten Locken drun ter hervor. Sie sieht aus wie Rumpelstilzchen, einfach mit Megafon. Sie wirkt fragil, doch wenn sie mit dem Megafon vor einem der GoogleBusse tanzt, scheint sie unverletzlich zu sein. Es geht um die Busse, die morgens die Mitarbeiter der Firmen abholen, die im Silicon Valley ihren Sitz haben und auf der Landkarte als Google Campus oder Facebook Headquarter auftauchen, als handelte es sich um eine Univer sität oder eine Schaltzentrale des Militärs. Für Erin sind die Busse ein Symptom. Weiss und verspiegelt, stoppen sie an den Haltestellen der Stadtbusse, benutzen die öffentliche Infrastruktur. Lange zahlten die Firmen nichts, obwohl sie, wie Erins Freunde berechneten, der Stadt dafür eigentlich Millionen schuldeten. Denn wer hier mit seinem Pri vatwagen anhält, zahlt eine Busse von 271 Dollar – eine tendenziöse Rechnung. Doch der Preis, auf den sich die Firmen und die Stadt ei nigten, war ebenso verfehlt. Die Firmen zahlten einen Dollar pro Tag und Haltestelle. Rund um die Haltestellen sind die Mieten um zwanzig Prozent schneller gestiegen als sonst in San Francisco. In den Häusern wohnen Leute, die tagsüber im Silicon Valley arbeiten und oft erst spät nach Hause kommen. Sie kaufen selten in den Quartierläden ein, ihr Fitnessklub befindet sich im Geschäft, sie brauchen keine Wäsche reien, das besorgt die Firma. Vierzig Prozent der Leute, die Häuser um die Haltestellen herum besitzen, wohnen gar nicht in der Stadt, son dern kommen nur am Wochenende vorbei. Davon handelt das GoogleBus-Lied, das der Rapper Cachebox auf Youtube stellte. Youtube ist Teil
GOOGLES SCHLAFSTADT
Der Anfang ihrer Arbeit als Aktivistin klingt wie die Geschichten über Emporkömmlinge in den Startups. Monatelang stöberte sie in Buchläden, las alles über Webdesign, was sie wissen muss. Vielleicht bekäme sie eine Stelle im Silicon Valley, ihre Stadtkarten, ihr Spiel mit Daten, ihr visuelles Flair, das spräche dafür. Der Ort ist selbstverständ lich nichts für sie. Wenn sie aufzählt, warum sie die Technologiefirmen nicht mag, kommt sie kaum an ein Ende. Bürgermeister Ed Lee behandelt die Chefs der Firmen, als wären sie Aristokraten. Airbnb muss keine Gebühren zahlen, ein Geschenk von 25 Millionen Dollar. Twitter wurden in den letzten Jahren Steuern über 56 Millionen Dollar erlassen. Peter Shih, CEO eines Startups, bloggte über die zehn Dinge, die er an San Francisco hasst, und schien dabei für viele seiner Branche zu sprechen. Er hasst die Obdachlosen, das Wetter, die Radfahrer, die Transvestiten, «die Frauen, die eine vier sind, sich aber so verhalten, als wären sie eine neun». Wenn Firmen, die von Stanford-Abgängern gegründet wurden, sich zusammenschliessen würden, entstünde die zehntgrösste Wirtschaft der Welt, mit Einnah men von 2,7 Billionen Dollar im Jahr, für Erin zu viel Geld in den Händen von zu wenig Leuten. Zwar fliessen viele Spenden, der Umgang damit ist jedoch Teil des Problems. Denn die Firmen sollten, eigentlich, ein fach Steuern zahlen. Auch Facebook kann Erin nicht ausstehen, trotzdem verzichtet sie nicht darauf. Auch sie versucht, hier Aufmerksamkeit
44 von Google, der Adressat der Kritik gleichzeitig auch das Medium. Die Busse sind Ausdruck der neoliberalen Tendenz, private Lösungen für die Elite zu schaffen. Darum stellen sich Erin und ihre Freunde in den Weg.Auch für Erin, Doktorandin an der Universität von Santa Cruz, wäre die Stadt zu teuer. Darum zogen sie und ihre Mitbewohner zu sätzliche Wände hoch, dünn wie eine Membran. Sie hört ihre Mitbe wohner atmen, wenn sie denn zu Hause schläft. Erin liebt eine Frau, unterrichtete eine Weile Queer Yoga, lebt jetzt aber von ihren Stipen dien als Anthropologiedoktorandin. Auch sie kommt von anderswo, aus Massachusetts, zog vor knapp zehn Jahren hierher. Bald half sie alle paar Wochen einem Freund beim Umzug, irgendwann scherzten sie darüber, eine Transportfirma zu gründen. Mittlerweile wohnen viele Bekannte in Oakland, auf der anderen Seite der Bucht. Gerade mussten wieder ein paar von Erins geliebten Kollektiven ihre Häuser verlassen, das Bus-Stop Collective, das Million Fishes Collective, die Station 40, lauter Symbole des alternativen San Francisco. Erin kommt ihre Stadt abhanden, verschwindet von der Landkarte.
WEM GEHÖRT DIE STADT?
Wenn Erin und ihre Freunde einen Bus aufhalten, sieht das wie Strassentheater aus. Sie treffen sich schon Tage vorher, üben die Cho reografie, schneidern die Kostüme. Die Blockaden erinnern an die Ak tionen der Yes Men, an die Möglichkeiten des Widerstands, die Krea tivität der Kritik. Einmal gingen sie bei Vanguard Properties vorbei, dem Immobilienmakler an der Mission Street, einem Haus mit Säulen vor dem Eingang und Stacheln auf den Mauern. Erin las einen Brief im Namen Benito Santiagos vor, der aus seinem Haus hätte ausziehen müssen. Vanguard Properties hatte ihm eine Woche Zeit gegeben, um über das Angebot nachzudenken. Er hätte 20 000 Dollar bekommen für seine Zweizimmerwohnung. Ein Zimmer wird im Mission District jedoch für 4000 Dollar vermietet, Benito bat den Mieterverband um Hilfe. Erin wurde dann der Brief aus der Hand gerissen, ihre Gruppe rausgeworfen. Doch ein paar Tage später zog Vanguard Properties den Räumungsbefehl zurück: einer von einem Dutzend Erfolgen bisher. Der Community Landtrust kaufte das Haus, nahm es vom Markt. Benito, der Musiklehrer, der schon lange hier lebt, wird bleiben können.
45 für ihre Anliegen zu erhaschen. Viel verspricht sie sich nicht davon.
«Es besteht ein Unterschied dazwischen, ob man an einer Kundgebung teilnimmt oder auf Facebook einen Knopf drückt. Das ist Slacktivism.» Aktivismus für Faule. Fast jede Woche, manchmal auch täglich, trifft Erin Freunde und hält irgendwo in der Stadt einen Google-Bus auf, besonders häufig auf der Valencia Street, der Ikone des Wandels. Die Strasse führt durch den Mission District, der so heisst, weil die Spanier hier ihre erste Kirche gebaut haben. Sie ist winzig und steht noch immer, mit ihren dicken Mauern wirkt sie wie eine Trutzburg. Im Plaza, einem Gebäude zwi schen Mission und Valencia Street, kostet eine Wohnung 7500 Dollar im Monat. Die Plaza Coalition, ein Mieterverband, will die Gegend säubern, die Obdachlosen vertreiben, die Polizei öfter ins Quartier ho len, mehr Überwachungskameras einrichten. Im Mission District wohn ten früher fast nur Iren, dann viele Deutsche, seit ein paar Jahrzehnten sind in la misión vor allem Mexikaner zu Hause. Auf der Strasse hörte man lange öfter Spanisch als Englisch, bis vor ein paar Jahren auch die Schüsse der Gangs, Sureños gegen Norteños, dazwischen Kellner, Köche, Ladenbesitzer, Putzfrauen, die einfach arbeiten und manchmal auf der Treppe vor ihrem Haus sitzen wollten. An der Valencia Street stand auch meist ein Obdachloser, der wie viele Bettler am Morgen aus Oakland gekommen war, weil er in San Francisco mehr verdiente. Sie nannten ihn Bum Jovi.
GOOGLES SCHLAFSTADT
Auf einer ihrer Stadtkarten sieht man, wo das Geld für den Kampf um das Bürgermeisteramt herkommt. Ed Lee, der Bürgermeister, hat einen mächtigen Freund, Ron Conway, ein sogenannter angel investor .
Der Mann ist ein traumhafter Fundraiser, trieb Geld auf bei Marissa Mayer, der CEO von Yahoo, Peter Thiel, dem Geldgeber aus Menlo Park,
Der Landtrust bekommt das Geld von einem städtischen Programm, dem Small Sites Fund. Erin hofft, dass die Stadt bald so viel Geld gibt, dass zwanzig solche Häuser im Jahr gerettet werden können – kleine Hoffnungen. Bei Hunderten von Räumungen, die in den letzten drei, vier Jahren in der Stadt stattfanden, waren sie machtlos. Auf einer ihrer Karten, einer Animation, hat sie die Räumungsbefehle als Kreise dar gestellt, die immer grösser werden, Epizentren eines Bebens. San Franciscos Mietrecht für Anfänger: Wenn jemand ein Haus besitzt und mehr daran verdienen will, kann er sich auf den Ellis Act berufen, wie das bei Benito Santiago geschah. Das Gesetz erlaubt ihm, die Mieter aus dem Haus zu entfernen, er muss nur eine dieser Bedin gungen erfüllen: Entweder muss er selbst einziehen, das Haus selber brauchen. Oder er muss es verkaufen, sich aus dem Geschäft als Ver mieter zurückziehen. Weil die Behörden aber nicht prüfen, ob er sich daran hält, öffnet sich ein Graubereich. Es gibt Dutzende von Geschich ten über Leute, die ausziehen mussten und ihre Wohnung später auf Airbnb fanden. Geschichten von Leuten auch, die dem Vermieter vor ihrem Haus auflauerten, ihn aber nie einziehen sahen. Dann gibt es die no fault evictions , Zwangsräumungen ohne Schuld. Wenn Leute einen Räumungsbescheid erhalten, lassen sie sich oft einschüchtern, vielleicht weil sie das Dokument nicht verstehen, vielleicht weil sie sich vor ge richtlichen Folgen fürchten. Sie ziehen aus, ohne zu müssen. Aber auch wer Hilfe holt, muss sofort handeln, die Einsprachefrist beträgt nur ein paar Tage. Der Vorgang setzt juristische Raffinesse voraus, sprachliches Können auch. Die Leute, die vor der Tenants’ Union, dem Mieterverband in der Capp Street, Schlange stehen, leben meist seit Jahrzehnten in der Stadt. Oft sprechen sie aber nur schlechtes Englisch.
WEM GEHÖRT DIE STADT?
Vor drei Jahren nahmen Härtefälle und Selbstmorde zu. Eine Grei sin, die aus ihrem Haus im Mission District geworfen wurde. Ein Mann, der sein Geschäft im Castro verlor. Der Mann hiess Jonathan Klein, er stürzte sich von der Golden Gate. An der Trauerfeier hielten sie ein Transparent in die Höhe, Eviction = Death. Ein Echo der Kundgebungen für die Rechte der Homosexuellen, die in dieser Stadt ihren Anfang nahmen, Silence = Death. Erin stellte sich eine Frage, die auf Englisch doppeldeutig ist: How to get these things on the map?
46
Die Viertel mit der höchsten Anzahl Obdachlosen sind auch die Viertel mit der höchsten Anzahl leerstehender Häuser, Tenderloin und South of Market. Es gibt etwa 7000 Obdachlose in der Stadt, 1000 davon Kinder, und es gibt etwa 7000 Häuser und Wohnungen, die auf Portalen wie Airbnb und VRBO angeboten werden.
Jeremy Stoppelman, dem CEO von Yelp, Laurene Powell Jobs, der Witwe des Apple-Gründers, bei einem Mitgründer von Twitter, bei einem Ver waltungsrat von Google. Conway half mit einer Spende von 275 000 Dollar, die «Proposition E» zu verankern und so die Steuern auf Un ternehmen zu senken, in die er selbst investiert hat, Firmen wie Airbnb, Twitter, Digg, Zynga. Er setzte sich dafür ein, dass die Busse aus dem Silicon Valley weiterhin kostenlos die städtischen Haltestellen nutzen können. Sein Vermögen wird auf anderthalb Milliarden Dollar ge schätzt. Auf einer anderen von Erins Karten kann man sehen, wie sich der Mission District verändert. Es ist einer der wenigen Orte in den USA, wo die Zahl der Latinos stark gesunken ist in den letzten Jahren. Eine Karte zeigt glühende Punkte auf einer nachtschwarzen Land schaft. Es sieht aus wie aufgescheuchtes Plankton und stellt die Orte dar, in denen Airbnb sich eingenistet hat, mehr als fünftausend Häu ser und Wohnungen. Eine Karte zeigt, wie die Kinder aus der Stadt verschwanden, heute sind noch dreizehn Prozent der Einwohner un ter achtzehn. Auf einer anderen Karte, überlegt Erin, könnte sie dar stellen, wie die Anzahl der Hunde in der Stadt gestiegen oder wie teuer der Kaffee geworden ist. Eine weitere Karte könnte zeigen, wo die Leute unterkommen, die ihr Zuhause auf Airbnb anbieten. Eine App dafür ist seit ein paar Monaten auf dem Markt, ein umständlicher Name für eine umständliche Sache: Can I stay with you while I rent my place on Airbnb? Ihr Spiel mit Big Data bringt oft ironische Fakten ans Licht.
Erin überlegt auch, wie sie das Unsichtbare vermitteln soll. Wenn sie durch die Stadt geht, beobachtet sie oft Dinge, die sie wohl nie in einer Karte wird zeigen können. Eine Freundin, die in einem Super markt arbeitet, schätzt zum Beispiel, dass ein Viertel der Kunden nicht für sich selbst einkauft, sondern Teil einer App ist. Wenn Erin in einem Supermarkt steht, staunt sie selber darüber, wie ratlos die Leute vor den Regalen stehen, vermutlich auf der Suche nach einem raren Arti kel, den jemand online bestellt hat und für ein Trinkgeld nach Hause liefern lässt. Viele Supermärkte steigen auf Bezahlstationen um, die Kassiererinnen verschwinden. So löst sich auch die Möglichkeit auf, dank solchen Stellen in Amerika Fuss zu fassen, Supermärkte werden keine Integrationsmaschinen mehr sein. Doch entstehen durch die Apps
GOOGLES SCHLAFSTADT 47
Erins Schlüsselbund ist schwer, daran klirren mehr als zwei Dut zend Schlüssel. Meist geht sie jeden Tag zur Tenants’ Union an der Capp Street, wo oft ein Dutzend Leute vor der Tür steht und darauf wartet, Hilfe gegen eine Zwangsräumung zu bekommen. Nach den Bürozeiten bleibt sie in der Regel noch hier. Manchmal holt sie Chips und Guaca mole für die Sitzung mit den anderen Leuten vom Anti-Eviction Map ping Project, die sich jede Woche hier treffen, eine Gruppe von StanfordStudenten, Anwälten, alleinerziehenden Müttern und Obdachlosen wie Tony. Wenn Erin auf der Mission Street heimgeht nach Bernal Heights, kommt sie nach einer Minute an einem Haus vorbei, das ein mal ein Hotel war, eine Weile leerstand und mittlerweile 20Mission heisst. Oft stehen junge, etwas bleiche Männer an der Strassenecke und warten auf ihren Uber-Wagen. Auf einer von Erins Stadtkarten sieht man, wo überall digerati dorms oder hacker homes entstanden sind, Schlafsäle für Leute, die mit einem Startup reich werden wollen – die Hippie-Kommunen von heute. Es sind auch die Goldgruben von heute: Ein Bett in einem Massenschlag lässt sich für mehr als tausend Dollar im Monat vermieten, ein Bett für eine Nacht kostet selten weniger als vierzig Dollar. Erin sagt, dass viele der jungen Computertalente wohl nicht wüssten, dass sie nach dreissig Tagen in den Genuss des Mieter schutzes kämen und nicht mehr zahlen müssten als ihren Anteil an der Gesamtmiete. Aber es ist wie mit den Nutzungsbestimmungen im Internet: Das Kleingedruckte liest niemand. In 20Mission kostet die
wiederum Jobs für Leute aus der Unterschicht, wenn sie denn ein Smartphone registriert haben und damit umgehen können. Als Erin vor kurzem nach Norden fuhr, sah sie auch auf der Golden Gate ein Stück Zukunft. In den Häuschen sassen keine Leute mehr, man muss seine Gebühr jetzt in einen Automaten werfen. Bis vor ein, zwei Jah ren fuhren viele von Erins Freunden Taxi, einige stiegen auf Uber und Lyft um, hörten jedoch wenig später wieder auf, weil sie weniger als den Mindestlohn verdienten. Uber ist nicht deshalb mehr wert als die Deutsche Bank, weil die Firma das Taxigeschäft auf der ganzen Welt verändern könnte. Sondern weil fast alle Servicejobs so aussehen könn ten. Wer krank ist, verdient nichts. Wessen Auto eine Panne hat, der zahlt den Ausfall selber. Es gibt eine App, die über Polizeimeldungen No-go Areas angibt und so Viertel, die ohnehin leiden, weiter abwertet. Eine App, mit der man andere anheuern kann, einen Parkplatz zu reser vieren. Vielleicht, sagt Erin, werde es bald auch eine App geben, die einem zeigt, wie viele Leute gerade in der Gegend sind, die man, gegen einen kleinen Betrag, nach dem Weg fragen kann.
WEM GEHÖRT DIE STADT? 48
GOOGLES SCHLAFSTADT 49
Nacht neunzig Dollar, der Vermieter verdient jeden Monat etwa 100 000 Dollar an seinen mageren IT-Talenten. Eines davon ist ein junger Mann aus der Nähe von Delhi, Prateek Dayal. Prateek, Software-Entwickler 20Mission, wo Prateek ein Einzelzimmer hat, könnte sich auch in Bangalore oder Mumbai befinden. Komfort gibt es keinen, doch das WLAN ist gut. In den Gängen hängt der kränkliche Duft von Räucher stäbchen. Dauernd schlendern bärtige Männer durchs Haus, einen Joint zwischen den Lippen. Prateek ist für drei Monate hier, später im Jahr will er erneut nach San Francisco kommen. Viele bleiben länger, haben aus ihrem Zimmer eine Miniaturdisco gemacht oder eine Leinwand aufgehängt, die sie fast verschluckt, wenn sie nachts Videogames spie len. Einer von Prateeks Nachbarn schiesst oft Monster über den Haufen bis ins Morgengrauen. Wegen des Lärms zittern manchmal die dünnen Wände, Prateek hat nichts dagegen. Das einzige Geräusch in seinem Zimmer kommt von einem kleinen Heizkörper, den er selber gekauft hat: ein leises Surren. Eine Woche vor seiner Abreise Mitte Januar sind fast alle ausser Prateek damit beschäftigt, das Haus winterlich einzurichten, grosse Schneeflocken aus Papier auszuschneiden, eine Schneemaschine im Innenhof aufzubauen. Fast alle, das sind etwas mehr als dreissig junge Männer und vier Frauen. Die Feste in 20Mission haben einen guten Ruf. Einmal widmeten sie die Party Joshua Norton, der im 19. Jahrhundert als Geschäftsmann Erfolg hatte und mit Lie genschaften handelte, nach zwei Jahren Abwesenheit aber als Wrack nach San Francisco zurückkehrte. Norton erklärte sich zum Kaiser der USA, zum Protektor von Mexiko. Er zahlte mit selbstgemachtem Geld, darauf sein Porträt: massiver Schnauz, Federn am Hut, ein Hipster vor der Zeit. Die Leute liebten Norton, der eine Phantasieuniform trug und bald einen Hof hatte. Polizisten salutierten, wenn er vorbeiging. Im Theater bekam er kostenlosen Eintritt, und er brauchte auch nichts zu bezahlen, wenn er mit einer Kutsche umherfahren wollte. Die Namen der Gänge in 20Mission erinnern noch immer an Norton und sein er fundenes Geld, es geht um Traditionspflege. Der Besitzer des Hostels ist mit Bitcoin reich geworden, hat die Gänge nach Kryptowährungen benannt: Bitcoin Boulevard, Dogecoin Drive, Litecoin Lane. Prateeks Vater war einer der 1,4 Millionen Angestellten der indischen Eisenbahn, eines der grössten Arbeitgeber der Welt. Prateek und seine Mutter fuhren immer wieder wochenlang durchs Land, waren selten in Kanpur. Vielleicht lebt Prateek deshalb wie ein Nomade.
Prateek meditiert lieber, er nimmt hier eine Auszeit, arbeitet ein wenig in einer Bar in der Nähe der Battery. Mit 27 hat er zum ersten
WEM GEHÖRT DIE STADT?
50 Er ist dreissig, hat nur einen Rucksack und ein Macbook, sein Besitz wiegt 8,4 Kilogramm. In Bangalore hat er eine Internetfirma namens SupportBee gegründet, doch er hat keine Wohnung in der Stadt, lebt lieber im Hotel. Er betreibt auch kein Fundraising. In Indien, sagt er, verbringe man seine Zeit besser mit Meditieren.
Prateeks Eltern steckten viel Geld in seine Ausbildung und schickten ihn in eine Missionsschule. Als Teenager hätte er gern die Computerklasse besucht, doch die Plätze waren vergeben. Er entschied sich für Elektrotechnik und baute einen Synthesizer. Sonst langweilte ihn die Schule, auch die Naturwissenschaften fand er öd. Der Unter richt sei zwar nicht schlecht gewesen, aber er erfuhr nie, was er wirk lich wissen wollte: wie es sich anfühlt, ein Forscher zu sein und etwas Neues zu entdecken. 1995 sah Prateek seinen ersten Supercomputer, obwohl sein Vater und er eigentlich ins Kino gehen wollten. Unterwegs kamen sie an IIT Kanpur vorbei, dem Indian Institute of Technology. Hinter einer Glaswand befand sich der Computer, Prateek war hinge rissen. Seine Eltern dachten, dass er später ebenfalls bei der Eisenbahn arbeiten würde, doch er wollte an eine technische Hochschule. Von den 142 000 Mittelschülern, die an der Prüfung teilnahmen, wurden 2000 aufgenommen, Prateek belegte Rang 957, spricht noch heute mit Bitterkeit davon. Er sagt, der Wettkampf sei für ihn immer wichtig gewesen, er benutzt das Wort «zentral». Er ist untypisch für dieses Haus. Er spielte zwar eine Weile ein Kriegs-Game, wurde aber nie süchtig nach dem Gefühl, ein Level weiter zu sein. Er programmiert selten. Wenn es um Codes geht, über lässt er die Arbeit lieber den Kollegen in Indien. Auch hat er bereits ein Geschäft mit fünf Mitarbeitern, während die anderen in 20Mission selten Erfolg haben. Ben Greenberg, ein sympathischer Typ aus Indiana, scheiterte mit einer Idee namens Glowy Shit. Er wollte im Dunkeln leuchtende Knete im Internet verkaufen, stiess mit der schimmernden Scheisse aber auf wenig Nachfrage. Masaaki Furuki, ein in Kurt-CobainZitaten nuschelnder Japaner, antwortet auf Fragen nach seinen ITPlänen immer mit einem Schwall, der wenig bis nichts mit der Frage zu tun hat. Am Ende kommt er meist auf ein Interview mit Cobain zurück, das alle im Haus schon ein paar Mal gesehen haben. Der Sänger greift sich dauernd in den Mund, verzieht vor Zahnweh das Gesicht und sagt, er sei eben eine moody person. Masaaki schaut begeistert zu, ein paar andere in der Küche gucken unbeteiligt in ihre Smartphones.
In seiner Freizeit liest Prateek manchmal in der Autobiogra phie eines Yogi , die schon Steve Jobs gefiel. Er beschäftigt sich erst seit ein paar Jahren mit indischer Spiritualität, vor allem deswegen, weil
Das Problem hat auch mit der Macht einer Lobby zu tun, jener der Hausbesitzer. Sie wollten nie Mietshäuser in ihrer Nähe. Sie fürchten, dass ihre Liegenschaften dadurch an Wert verlieren. Die etwas mehr als 1700 Technologiefirmen in San Francisco, einer Stadt mit 800 000 Einwohnern, stellen etwas weniger als 50 000 Leute an. Sie allein für den Wandel in der Stadt verantwortlich zu machen, ist zu einfach.
Mal Indien verlassen, nahm in Santiago an Startup Chile teil, drei Jahre ist das her. Er sagt, dass er immer noch versuche, weniger in sich ge kehrt zu sein. In San Francisco will er einfach auf Ideen kommen, auch wenn er sich mit dem Lebenswandel hier manchmal etwas schwertut. Uber ist das beste Beispiel für ihn, wenn es um die sonderbaren Sorgen der ersten Welt geht. Wenn man mit der App einen Wagen bestellt, kann man nicht nur den Fahrer wählen. Man kann auch entscheiden, ob Musik laufen, ob der Fahrer reden oder besser das Maul halten soll. Sich in den Kopf eines Kunden zu versetzen, der seinem Dienstleister per Daumen Stille befiehlt, fällt Prateek nicht leicht. Trotzdem müsse er sich dieser Kultur anschmiegen. Nur so könne er Ideen entwickeln, die in ein paar Jahren vielleicht auch in Bangalore Anklang finden. Er fühlt sich, wenn er solche Sachen ausprobiert, wie ein Schauspieler. Er müsse sich in die Psyche eines sehr verwöhnten Konsumenten einfüh len, selber ein besserer Kunde werden, nur so könne er diese Programme entschlüsseln. Andere Apps hält er für grossartig, Square zum Beispiel. Damit können Bauern, die mit Obst und Gemüse zum Markt fahren, über ihr Smartphone Zahlungen abwickeln. Er hat ein schlechtes Gewis sen, weil er in San Francisco mehr Geld braucht als seine fünf Kollegen in Indien zusammen. Deshalb mag er die Apps, mit denen er in Restau rants günstiger essen kann, wenn er zu Randzeiten vorbeigeht, etwa bei seinem Lieblingsinder an der Valencia Street, Udupi Palace. Leute wie Prateek werden immer wieder beschrieben, als wären sie eine invasive Spezies. Intellektuelle wie die Schriftstellerin Rebecca Solnit, die selbst nicht aus San Francisco stammt, verglich Te chies mit Ausserirdischen, Insekten, preussischen Invasoren, deutschen Touristen – als würde eine Horde über die Stadt herfallen. Die Techies selber halten die Probleme für künstlich. Abgesehen von Financial Dis trict, Tenderloin und einem Teil von South of Market, ist San Francisco nur drei Stockwerke hoch. Dass es so wenig Wohnraum gibt, hat viel mit dem jahrzehntelangen Widerstand der Stadt zu tun, etwas zu wagen.
GOOGLES SCHLAFSTADT 51
Wem gehört San Francisco? Versuch einer Antwort Tony, Erin, Prateek. Niemand war schon immer hier. Doch sie be wegen sich durch dieselben Strassen. Bei allen Unterschieden haben sie viel gemeinsam. Ihre Träume teilen eine ähnliche, fieberhafte In tensität. Tony, der sich im popkulturellen Universum Amerikas verliert.
Erin, die aus der Studentenbewegung der sechziger Jahre herausspa ziert sein könnte, Megafon in der Hand, Mütze auf dem Kopf. Prateek, der hier nach der Zukunft sucht, auf Ideen surft. Kalifornien war schon immer ein Ort für Leute wie sie. Die Pioniere schoben die frontier bis an den Stillen Ozean. Die Traumfabrikanten Hollywoods schoben die Grenzen des Möglichen weiter ins Imaginäre. Die Hippies wollten an ders leben, die Regeln brechen. Die Techies sind ihre wahren Nachfol ger, auch sie träumen von einem Umbruch, auch sie sind meist bleiche Männer mit dichten Bärten und flackernden Augen, dem Standardlook für Revolutionäre. Vielleicht zielt die Rede von der Ungleichheit
WEM GEHÖRT DIE STADT?
52 viele Firmengründer aus San Francisco hier nach Ideen suchten. Prateek zitiert auch gern Sprüche aus dem Zen-Buddhismus und wendet sie auf Konzerne wie Google an. «Wenn du deine Schafe beherrschen willst, dann gib ihnen grössere Weiden.» Ab und zu nimmt er den Caltrain ins Silicon Valley, oft zu sammen mit Kollegen. In Menlo Park gehen sie dann die Sand Hill Road hoch, die Wall Street Kaliforniens, einer der reichsten Orte der Welt, doch unscheinbar. Hier haben die Wagniskapitalisten ihre Niederlas sungen, versteckt hinter Bäumen, nicht recht sichtbar, tödliche Stille. Es ist wenig los, nur ein paar Leute sind unterwegs. Die Geldgeber woh nen in Portola Valley in den Hügeln, wo eher Pferdemist als Hundedreck auf der Strasse liegt. Sie wollen, dass ihre Nachbarschaft so ländlich bleibt, wie sie ist. Sie wollen keine Wohnhäuser in der Gegend. Mit dem, was die Leute bei Google und Facebook im Schnitt verdienen, 100 000 bis 200 000 Dollar im Jahr, können sie sich den Ort nicht leis ten. Sie sind gezwungen, sich anderswo umzusehen.
Die Bilder, die Prateek und seine Bekannten aus 20Mission auf Facebook oder Twitter veröffentlichen, sehen aus wie Updates der Pilgerfahrten. Vor dem Facebook Headquarter steht eine Tafel mit ei nem gigantischen Daumen, die Besucher stehen Schlange davor. Sich ironisch lächelnd davor fotografieren zu lassen und den Daumen hoch zuhalten – das scheint ihnen zu gefallen. Prateek fotografierte seinen Freund, einen enthusiastischen Spanier namens Hikarus. Selber stellte er sich aber nicht in die Reihe.
53 am Herz der Sache vorbei. Vielleicht geht es eher um Durchlässigkeit.
Das Problem ist, dass der Traum, der Amerika gross gemacht hat, schon lange vorbei ist. Der Traum, dass man aufsteigen kann, wenn man hart arbeitet. Dass man sich ein Auto und ein Haus kaufen und seine Kinder an die Hochschule schicken kann, wenn man sich anstrengt und etwas Grips hat. Die Erinnerung an dieses Versprechen hallt nach, die Bilder des Traums spuken immer noch durch die Köpfe. Es gibt auch einen Ort, wo der Traum noch immer geträumt wird: auf diese Halbinsel, die fast nicht mehr zu Amerika gehört, fast schon vom Fest land weggedriftet ist. Hier kann auch ein junger Mann aus Indien auf steigen, der sein Land bis vor ein paar Jahren noch nie verlassen hat. Er sagt zwar, in seinem schönen Singsang, dass er noch nirgends sei.
Aber die Antwort auf die Frage, wem San Francisco gehöre, ist wohl am ehesten: Prateek. Gefällt Ihnen das?
GOOGLES SCHLAFSTADT
54 RUBRIK Solhcarps ni EisAllivesnetnnok eid negirehrov nedieb Neties thcin nesel? Os theg se timNetebahplanamedOcapmedejTxet . O Í COR SATNUP TENREB
55 NEGATROPER DNABREVETDÄTS Eis tuahcs fau nie Ttalb Reipap dnu tgeweb nerhi Fpok nih dnu reh. Rhi sethcer Nieb tppiw fua dnu ba, sla ettäh eis nenie Kcit. Eis tzlanhcs tim red Egnuz dnu tbier eid Regnif na ned Nehcälfnennidnah. Red eznag Reprök: nie segiznei sosövren Nlebbirk. Erhi Negua nereixif sad Ttlab rov rhi fua med Hcsit. Hcildne tgas eis tualblah: «‹M› dnu ‹A›, ‹AM›. ‹M› dnu ‹A›, ‹AM›.» Dnu hcan renie nezruk Esuap, rehcisnu: «AMAM.» Olehc tztis fua med Lesses mi Remmiznohw serhi Sesuah. Etueh tah eis eniek Eluhcs. Medhcan eis hcis mi Fehesnref tsreuz eid Ierd-Rhu-Nethcirhcan dnu dnesseilhcsna erhi Eiressginlbeil nehesegna tah, tztes eis hcis erhi Ellirbesel fua eid Eztipsnesan dnu tnnigbe tim nemasgnal Negungeweb, sad Trow nebierhcsuzfua, sad eis edareg ne seleg tah. Amam. Eis trhäf trof tim Apap, Suah, Hcsit. Nie Trow hcan med neredan thcirps eis tsreuz masgnal tual sua, sla bo se hcis os tkerid sni Sinthcädeg nlepemets esseil. Nnad tsre tbierhcs eis se fua. Tlläfg rhi sad Sinbegre thcin, tlettühcs eis ned Pfok rebü erhi Tiehneflohebun, tfierg muz Immugreidar dnu tnnigeb nov nrov. Os theg sad Gattimhcan rüf Gattimhcan, sib se Teiz driw srüf Nessedneba. Olehc, 37 Erhaj tla, tnrel nesel. Hcon rov rerhi Trubeg dnats senie Segat eid Aidraug Livic rov red Erütsuah dnu etgarf hcan ned Nrennäm sed Sesuah. Sella hahcseg rhes llenhcs, losdunrg, tetrawrenu. Eid Net maeb netrehcisrev red Rettum, ssad rhi Nnam dlab nerhekkcüruz edrüw, eis nettäh aj run nie raap Negarf, eid eis mhi fua red Ehcaw nellets ned ürw. Reba re terhek ein kcüruz. Hcua red Redurb dnu red Retav thcin.
Solehc Rettum beilb niella mi Sauh kcüruz, nemmasuz tim eird Nrednik dnu med netreiv sgewretnu: Olehc. Eiw Ednesuatnehz Nennireinaps ni merhi Retla raw eis sla Dnik negunwzeg, uz netiebra. Eis trennire hcis, eiw eid Eilimaf gidnäts na menie neredna Tro etethcanrebü, retnu Nekcürb, retnu Nemuäb, fua Snotrak, ella fnüf tkcüregnemmasuz, mu red Etläk uz neztort. Tim nebeis etkcülfp eis Nevilo, gurt Egürkressaw fua med Pfok, eid rerewhcs neraw sla eis tsbles. Eis hcsuw egnalos Ehcsäw mi Hcab, sib erhi Ednäh netetulb dnu nam eis uzad tleihna, neröhuzfua. Red Negam raw remmi reel, sad Nletteb mu nie Kcüts Torb Gatlla. Mi nehcsitsiuqnarf Neinaps red Tiezsgeirkhcan nettah eid Rednik red Nemra redew eid Tiez hcon eid Teikhcilgöm, ni ein Eluhcs uz neheg. Dnu emra Nehcdäm osiewos thcin. Hcua hcan med Dot Socnarf dnu med nehcsimonokö Gnuwhcsfua Sneinaps etherd hcis sad Nebel Solehc ni menie nenegelegba nehcsis uladna Frod mi eid Tiebra. Olehc goz eird Rednik ssorg, etuab menmas uz tim merhi Nnam nie Tnaruatser, etetiebra sla Nihcök (rhi Thciregznawhcsneshco raw mi Frod tbeileb) dnu sla Nirefuäkrevlekitrakitemsok.
ROC Í O PUNTAS BERNET Sprachlos in SieSevillakonnten die vorherigen beiden Seiten nicht lesen? So geht es mitAnalphabetendemPacojedemText.
57 REPORTAGEN STÄDTEVERBAND
Sie schaut auf ein Blatt Papier und bewegt ihren Kopf hin und her. Ihr rechtes Bein wippt auf und ab, als hätte sie einen Tick. Sie schnalzt mit der Zunge und reibt die Finger an den Handinnenflächen. Der ganze Körper: ein einziges nervöses Kribbeln. Ihre Augen fixieren das Blatt vor ihr auf dem Tisch. Endlich sagt sie halblaut: «‹M› und ‹A›, ‹MA›. ‹M› und ‹A›, ‹MA›.» Und nach einer kurzen Pause, unsicher: «MAMA.» Chelo sitzt auf dem Sessel im Wohnzimmer ihres Hauses. Heute hat sie keine Schule. Nachdem sie sich im Fernsehen zuerst die Drei-Uhr-Nachrichten und anschliessend ihre Lieblingsserie angesehen hat, setzt sie sich ihre Lesebrille auf die Nasenspitze und beginnt mit langsamen Bewegungen, das Wort aufzuschreiben, das sie gerade ge lesen hat. Mama. Sie fährt fort mit Papa, Haus, Tisch. Ein Wort nach dem anderen spricht sie zuerst langsam laut aus, als ob es sich so direkt ins Gedächtnis stempeln liesse. Dann erst schreibt sie es auf. Gefällt ihr das Ergebnis nicht, schüttelt sie den Kopf über ihre Unbeholfenheit, greift zum Radiergummi und beginnt von vorn. So geht das Nachmittag für Nachmittag, bis es Zeit wird fürs Abendessen. Chelo, 73 Jahre alt, lernt lesen. Noch vor ihrer Geburt stand eines Tages die Guardia Civil vor der Haustüre und fragte nach den Männern des Hauses. Alles geschah sehr schnell, grundlos, unerwartet. Die Beamten versicherten der Mutter, dass ihr Mann bald zurückkehren würde, sie hätten ja nur ein paar Fragen, die sie ihm auf der Wache stellen wür den. Aber er kehrte nie zurück. Auch der Bruder und der Vater nicht. Chelos Mutter blieb allein im Haus zurück, zusammen mit drei Kindern und dem vierten unterwegs: Chelo. Wie Zehntausende Spanierinnen in ihrem Alter war Chelo als Kind gezwungen, zu arbeiten. Sie erinnert sich, wie die Familie ständig an einem anderen Ort übernachtete, unter Brücken, unter Bäumen, auf dem Boden, alle fünf zusammengerückt, um der Kälte zu trotzen. Mit sieben pflückte sie Oliven, trug Wasserkrüge auf dem Kopf, die schwerer waren als sie selbst. Sie wusch so lange Wäsche im Bach, bis ihre Hände bluteten und man sie dazu anhielt, aufzuhören. Der Magen war immer leer, das Betteln um ein Stück Brot Alltag. Im franquistischen Spanien der Nachkriegszeit hatten die Kinder der Armen weder die Zeit noch die Möglichkeit, in die Schule zu gehen.
Und arme Mädchen sowieso nicht. Auch nach dem Tod Francos und dem ökonomischen Aufschwung Spaniens drehte sich das Leben Chelos in einem abgelegenen andalu sischen Dorf um die Arbeit. Chelo zog drei Kinder gross, baute zusam men mit ihrem Mann ein Restaurant, arbeitete als Köchin (ihr Ochsenschwanzgericht war im Dorf beliebt) und als Kosmetikartikelverkäuferin.
58 BILDUNG
Fürs Lesenlernen fehlte ihr die Zeit. Ausserdem ein Angebot. Ein Ort, an dem sie das hätte nachholen können, was ihr als Kind verwehrt geblieben war. Und selbst wenn es das Angebot gegeben hätte, so hätte ihr wohl der Mut gefehlt, sich über das Geschwätz im Dorf hinwegzu setzen, dazu zu stehen, dass sie nicht lesen konnte. Doch vor wenigen Monaten überwand Chelo ihre Scham. 72 Jahre lang bedeuteten Buchstaben für sie nichts, ein unverständliches und geheimnisvolles Rätsel. Ein beschriebenes Blatt Papier war für sie nur ein weisses Blatt Papier. Chelo kennt das Gefühl nicht, einen Brief des Liebsten zu lesen. Sie schwelgte nie vor Freude über ein Gedicht von Federico García Lorca und konnte nie beim Lesen eines Liebesromans mit den Gedanken davonfliegen. Jetzt besucht sie zweimal wöchent lich zusammen mit anderen Frauen in ihrem Alter einen staatlichen Erwachsenenlesekurs im Dorfschulhaus und übt zu Hause mit Papier und Bleistift ihre ersten Buchstaben, die irgendwann einmal Wörter bilden sollen. «‹M› und ‹A›, ‹MA›.» Etwa 700 000 Analphabeten leben heute offiziell in Spanien. Wären all diese Menschen so alt wie Chelo und ihre Klassenkamera dinnen, so brauchte man nur noch ein paar Jahre zu warten – und eines Tages wäre das Phänomen ausgestorben. Im Spanien des 21. Jahrhun derts ist Lesen und Schreiben für alle eine Selbstverständlichkeit geworden, sollte man meinen. Tatsächlich aber nimmt der Analpha betismus im Land von Cervantes nicht überall ab. Aber das wird nicht offiziell gemacht; das Image Spaniens, das nach dem Ende der Diktatur den Anschluss an die führenden Nationen dieser Welt geschafft hat, darf schliesslich keine Kratzer erhalten. Doch an den Rändern der Gross städte, wo Arbeitslose, Arme und Ausländer leben, wird Lesen und Schreiben zu einem vernachlässigten Kulturgut. Heute ist für Antonio Prüfungstag. Sprachtest im zweiten Trimester im Ausbildungszentrum des hauptsächlich von spanischen Roma, den Gitanos, bewohnten Industrieviertels Polígono Sur in Sevilla – im Volksmund Las Tres Mil Viviendas genannt –, einer in den sieb ziger Jahren angelegten Blocksiedlung, in die sich heute in gewissen Strassen weder die Polizei noch ein Fremder hineinwagt. Wo wer sich trotzdem dorthin verirrt, ständig Blicke im Nacken spürt und mit dem Schlimmsten rechnen muss. Antonio kratzt sich mit dem Bleistift am Kopf, schaut mit seinen grossen schwarzen Augen auf das Wörter buch auf seinem Schreibtisch und atmet laut ein und aus. Nach einer Weile hebt er den Kopf, schaut die Lehrerin an, die ihm gegenübersitzt, und beginnt mit seinen braungebrannten Fingern im
59 SPRACHLOS IN SEVILLA Wörterbuch scheinbar wahllos herumzublättern. Dann schliesst er es wieder, ohne etwas aufzuschreiben. Er schaut hinüber zu einer Mit schülerin im gleichen Alter, die konzentriert und ohne Pause mit ihrem Kugelschreiber über die Seiten fliegt. Er zupft sich am Pullover, rückt ihn zurecht, dreht das Blatt um, das vor ihm liegt, und kneift die Augen zusammen, so als ob er dadurch die Sätze besser lesen könnte. End lich gibt er sich einen Ruck: «Frau Lehrerin, ich weiss nicht, was ein Adjektiv ist.»Antonio ist mit 15 von der Schule geflogen, weil er während eines Fussballspiels im Klassenzimmer einen Computer zertrümmerte. Er hatte bis dahin gerade einmal das Abc gelernt und die Zahlen. Nur wegen seines Alters schaffte er es überhaupt in die dritte Klasse. An tonio ging, wie fast alle seiner Freunde, nie gern zur Schule. In Las Tres Mil Viviendas spielt sich das Leben auf der Strasse ab. Jeden Morgen, wenn sich Antonios Eltern am Schuleingang von ihrem Sohn verab schiedeten und umdrehten, tat dieser dasselbe, liess den Unterricht sausen und ging mit Freunden Fussball spielen. Manchmal beschlichen ihn Zweifel; vielleicht war es doch nicht richtig, zu kicken, statt die Schulbank zu drücken, vielleicht hatten die Eltern doch recht, wenn sie ständig wiederholten, wie wichtig Lesen und Schreiben für die Zukunft sei. Doch dann wischte er die Bedenken wieder weg. Wer wollte schon in den Augen aller Freunde der einzige Dummkopf sein und freiwillig zur Schule gehen – und sich damit zum Feigling des Viertels stempeln lassen? In Antonios Mikrokosmos zählt das Gesetz der Strasse, des Stärkeren, und Antonio beschloss, sich darin seinen Platz zu suchen. Ohne zu ahnen, wie sehr er sich dadurch selbst einen Platz in der Welt nehmen würde.
Während der Schulpausen geht Antonio zu seiner Gross mutter, bei der er wohnt, um seine Eltern zu entlasten, die mit seinen drei jüngeren Geschwistern schon genügend Schwierigkeiten damit haben, alle Bäuche zu füllen. Oft hat er dann keine Lust mehr, zurück zur Schule zu gehen, und schaut bei seinem Onkel vorbei, isst etwas und
Antonio, der als funktionaler Analphabet gilt, weil er die Schule besucht hat, sagt nach der Prüfung betreten: «Ich kann lesen, aber ich weiss nichts über das, was ich gerade gelesen habe. So nützt mir das Lesen nichts, und schreiben kann ich auch kaum.» Wenn Antonio schreibt, verwendet er weniger als die Hälfte aller verfügbaren Buch staben und platziert diese meist auch noch falsch. Akzente, Verbkon jugationen, Adjektive, Adverbien, Substantive: alles ein riesengrosses Rätsel für ihn. Mit zwanzig Jahren hat er noch nie ein Buch gelesen.
Und so verwundert es nicht, dass Spanien in einer Studie des Davo ser Weltwirtschaftsforums zur Produktivität der Arbeitskräfte inner halb der EU den vorletzten Platz einnimmt, knapp vor Moldawien. Wie sollte es auch anders sein, in einem Land, in dem Talent und Fleiss eine untergeordnete Rolle spielen, weil eine grassierende Vetternwirtschaft für die Jobverteilung entscheidender ist. In dem sogar der amtierende Präsident Mariano Rajoy seinen Bürgern ernsthaft rät, «bei auftauchenden Problemen einfach wegzuschauen». Eine Aussage, die er anlässlich einer Tagung für Jugendliche äusserte und an die
60 legt sich aufs Ohr. Antonios Leben ist geprägt von Disziplinlosigkeit, Herumstreunen, Abhängen, davon Nächte zu verfeiern und Tage zu verschlafen. Ein Leben, das in seinem Viertel keine Ausnahme ist, son dern ein Normalfall. Ein Leben, das auf der Bequemlichkeit basiert, nichts tun zu müssen. «Diese Jugendlichen verdummen durch unser Wohlfahrtssystem», sagt die Lehrerin Rosa Yáñez, die in Antonios Vier tel arbeitet. «Sie wissen, dass sie alles zum Leben vom Staat bekommen. Warum also sollten sie sich anstrengen? Was die Menschen in diesen Vierteln brauchen, ist Bildung und soziale Akzeptanz – nicht eine schein bar nie versiegende Geldquelle aus Brüssel, die sie in einen Dauer zustand der Lethargie versetzt, aus dem sie nicht erwachen werden.»
BILDUNG
Nicht nur die Jugendlichen von Las Tres Mil Viviendas haben es sich bequem gemacht. Das ganze Land feierte den Tag, als Felipe González 1985 den EU-Beitritt unterzeichnete. In den folgenden dreis sig Jahren gehörte Spanien zu den grössten Nehmerländern Europas. Natürlich hat der historische Schritt geholfen, die junge Demokratie zu festigen und das Land wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Doch es hat seine Bürger auch dazu konditioniert, sich, geschützt durch den Brüsseler Geldschirm, hinter den Beamten-Bürotischen des Lan des einzurichten. Stunden verstreichen zu lassen und dafür bezahlt zu werden, Arbeit nur zu simulieren, statt sie wirklich zu leisten. Wer je in einem spanischen Rathaus einen Termin vereinbart hat, um einen Antrag zu stellen, weiss, was es heisst, mit der ganzen Härte spani schen Beamtentums konfrontiert zu werden: Auf das obligatorische lange Warten, um die Wichtigkeit der anzutreffenden Person zu un terstreichen, folgen beiläufig dahingeworfene Hinweise, wie beschäftigt man sei und was für ein Glück der Besucher habe, überhaupt empfan gen zu werden. Der nicht mehr überschaubare Papierkram, den es für jede unbedeutende Kleinigkeit auszufüllen gilt und der Wochen der Warterei nach sich zieht, überfordert dann sowohl den Beamten als auch den Antragssteller.
Rajoys Äusserung sorgte für Sprengstoff in den sozialen Medien.
Am nächsten Tag erhält Antonio seinen Test zurück. Ungenü gend. Nach der Enttäuschung über die misslungene Prüfung hat er keine Lust, direkt nach Hause zur Grossmutter zu gehen und ihr zu eröffnen, dass es noch unbestimmte Zeit dauern dürfte, bis er seine Ausbildung zum Mechaniker antreten wird. Er zieht einen Spaziergang im Viertel vor. Es ist zwölf Uhr mittags, die Strassen sind praktisch leer, die meis ten Bewohner schlafen um diese Zeit noch. Er trifft auf Paco, einen Freund, der ihm sein Smartphone entgegenhält. Der 28-Jährige kann weder lesen noch schreiben, also muss Antonio die Nachrichten von dessen Freundin vorlesen und so gut wie möglich für ihn beantworten. Oder Paco antwortet mit einer Sprachnachricht. Seine Freundin darf nicht wissen, dass er keinen Job hat, und schon gar nicht, dass er Anal phabet ist. Eine Gruppe Zwanzigjähriger kreuzt den Weg der beiden Freunde. Auch sie haben kaum etwas zu tun, feiern aber ausgelassen.
61 er tatsächlich zu glauben scheint. Wie sonst ist seine viel zu langan haltende Passivität angesichts des seit Jahren schwelenden Katalo nienkonflikts zu verstehen? Wie zu begreifen, dass Rajoy und eine Viel zahl seiner Parteikader des Partido Popular, der korruptesten Regierung in der Geschichte Spaniens, angesichts der laufenden Korruptionspro zesse «einfach wegschauen»?
Auf dem Weg zum Mittagessen bei seiner Grossmutter trifft Antonio auf «el Murciano», einen jungen Mann, der vor wenigen Monaten der Liebe wegen in die Nachbarschaft gezogen ist. Vor dem Kiosk, Chelo ist 73 Jahre alt – und lernt lesen.
SPRACHLOS IN SEVILLA
«Endlich ist das Leitmotiv des Partido Popular bekannt.» – «Was für eine Realsatire!» – «Das erklärt einfach alles.» So lauteten einige der Kommentare im Netz. Denn Rajoys Aussage bedeutet auch: die Faust im Sack machen. Doch wie der Chef, so seine Untertanen. Die Mehr heit des spanischen Volkes schaut selbst ständig weg und unternimmt kaum etwas, um die wuchernde Korruption zu stoppen, die Spanien flächendeckend und parteiübergreifend im Griff hat. Und auch mit dem Thema Analphabetismus haben viele sich abgefunden.
Das Tier hat soeben einen Kampf gewonnen – der Tag ist gerettet.
Einer von ihnen trägt einen Kampfhahn unter dem Arm und grinst von einem Ohr zum andern; kurz blitzen seine Zähne auf, von Karies zerfres sen. Als er sieht, dass Antonio Whatsapp-Nachrichten von Paco beant wortet, lacht er und sagt: «Zum Glück haben sie mich in das Zentrum für Minderjährige gesteckt, dort hab ich wenigstens Lesen und Schrei ben gelernt.» Die Gruppe zieht weiter mit ihrem Hahn, der aufgeregt vor sich hin flattert und versucht, sich aus dem Klammergriff zu befreien.
Gebaut wurde dieses weit abgelegene und von der sevillanischen Gesellschaft verstossene Ghetto zu Beginn der siebziger Jahre. Damals begannen immer mehr Touristen durch die verwinkelten Gässchen der Altstadt zu flanieren. Die Stadtverwaltung Sevillas beschloss, das Zentrum durch die Ansiedlung wohlhabender Familien aufzupolieren.
62
BILDUNG
«Was geht ab, Murciano?» «Nichts. Halte die Stellung. Und du?» «Hänge rum. Klingelt die Kasse?» «Geht so. Kann mich nicht beschweren. Aber die neuen Nach barn! Sie verstehen es einfach nicht. Lassen Musik in voller Lautstärke laufen, mitten am Nachmittag. Wie soll man da Siesta halten?» «Die Leute denken, wir hätten hier in unserem Viertel so wieso keine Regeln.» «Bis sich jemand aufregt.» «Dabei reichen wir uns an den nächtlichen Partys die Flaschen weiter, um keine Papierbecher rumliegen zu lassen wie die reichen Schnösel in der Innenstadt!» «Läuftʼs in der Schule, Antonio?» «Hast«Nein.»du Arbeit?» Antonio«Nein.» hat keine Lust mehr, Arbeit zu suchen. Wieso auch? In Las Tres Mil Viviendas werden den Jugendlichen sämtliche Zutaten der Arbeitslosigkeit von Anfang an auf dem Tablett serviert. Die feh lende Bildung trägt nicht dazu bei, aus der kleinen Blase, in der sie sich in ihrem Streunerleben eingerichtet haben, herauszutreten. Die damit verbundene Arbeitslosigkeit ist sicher nicht schön, aber sie ist gerade noch so angenehm, dass man sie in Kauf nimmt. Weil sie bequemer ist als die Alternativen. Und wenn Antonio und seine Kumpels doch mal auf Jobsuche gehen, verschliessen sich ihnen sämtliche Türen, sobald sie den Namen ihres Viertels aussprechen. Das Resultat: ein Leben beste hend aus kleinen Diebstählen und Gelegenheitsjobs, Perspektivlosig keit und eine Arbeitslosenquote im Viertel von siebzig Prozent.
Die armen und die einfachen Leute, die obdachlosen Bewohner am Guadalquivir, aber auch zwielichtige Gestalten und andere, die das Image der Stadt bei den Touristen beschmutzen könnten, wurden allesamt nach Las Tres Mil Viviendas verfrachtet.
den er mit seiner Vermählten zusammen aufgebaut hat, beginnen die beiden Männer darüber zu reden, wie Murcianos Geschäft so läuft.
Und aus sicherer Distanz, während die Menschenmasse unten in den Gassen schier sich selbst zerdrückt. Die Musikbands proben die Nacht hindurch, zum Ärger derjenigen, die morgens früh aufstehen müssen, und zur Freude aller anderen. Die Tavernen sind von einem Morgen grauen bis zum anderen rappelvoll, das Bier fliesst zu allen möglichen Sorten von Tapas. Sevilla verbreitet in diesen Tagen vor Ostern ein Hochgefühl, das einen beinahe die Wirtschaftskrise vergessen lässt –obwohl gerade Andalusien am stärksten davon betroffen war. Als wolle man die harte Realität des Alltags mit einem schönen Schein über tünchen. Nicht wenige trinken mit Freunden tagsüber, weil zu Hause nur die ungeheizte Wohnung wartet. Die spanische Kultur, auf der Strasse zu leben, bedeutet auch, zu zeigen, was man nicht hat – und selbst damit noch zu prahlen. Noch so ein spanischer Wesenszug. Schon Miguel de Cervantes schrieb vor vierhundert Jahren in seinem Klassiker Don Quijote de la Mancha: «Nicht überall, wo es Pfähle gibt, hat es auch Speck drauf.»
Der Plan funktionierte. Die Innenstadt Sevillas ist heute bis ins kleinste Detail herausgeputzt. In der einen Strasse reihen sich sorgfältig deko rierte Boutiquen an Souvenirläden, in der anderen die Mega-Shops von Zara, Mango oder H&M. Zu praktisch jeder Jahreszeit füllen Touristen die Gässchen und stehen Schlange vor dem mittelalterlichen Königs palast Alcázar oder einer der unzähligen Tapas-Bars. Selbst der Gitano aus dem Ghetto singt nur schnell sein Lied und verschwindet wieder mit den paar Euro, die er sich damit verdient.
SPRACHLOS IN SEVILLA 63
Blumendekorationen
erzählen die Geschichte von Jesus nach: Violette Lilien symbolisieren den Leidensweg, rote Nelken die Aufopferung, weisse Rosen und Orchideen die Reinheit Jesu. Die Costaleros – die Träger während der Osterprozession – balancieren die Throne durch die engen Gassen und an den tiefen Balkonen vorbei; Balkone, für die in der Semana Santa, der Osterwoche in Spanien, bis zu 2000 Euro bezahlt werden, um die Prozession aus nächster Nähe sehen zu können.
Doch wer die Innenstadt wirklich zum Bersten bringt, sind die Sevillaner selbst. Besonders jetzt, in den Vorbereitungen der Karwoche, scheinen die Menschen trunken von der Atmosphäre. Die Strassen riechen nach Weihrauch, in jeder Kirche putzen die Menschen unter Hochdruck ihre Heiligenstatuen auf dem tragbaren Thron heraus. Die Jesusfiguren tragen Tuniken aus teurem Samt und Dornenkronen auf dem Haupt. Die Jungfrauen – die Macarenas, Esperanzas oder Dolores – sind in farbige Spitzenkleider gehüllt, mit Broschetten und Perlen ketten geschmückt, die leidenden Gesichter mit Klöppelspitzen umhüllt.
An eine Hausfassade hat der Künstler Repo einen der besten Sänger in der Geschichte des Flamencos gemalt: Camarón de la Isla. Er sitzt auf einem Holzstuhl und scheint in seiner unverwechselbaren Art gleichzeitig zu lächeln und zu singen. Der Sänger erinnert daran, dass Las Tres Mil Viviendas die vielversprechendsten Talente des an dalusischen Flamenco hervorbringt. Im Viertel machen schon die un geborenen Kinder ihre erste Begegnung mit dem Flamenco, wenn die schwangeren Frauen mit ihren Freundinnen auf den Plätzen spontan zu singen oder tanzen beginnen. Später fühlen sich manche Kinder von der Gitarre angezogen, andere von der Kistentrommel Cajón und wieder andere von Gesang und Tanz. Es gibt diese Momente, wenn die Bewohner von Las Vegas sich sammeln und ganz dem Flamenco verfallen. Die Probleme sind für diese Augenblicke weit weg, und die Welt hört scheinbar auf zu existieren, wenn der tiefe Gesang die Nacht zerreisst.Aberwenn Camarón de la Isla seinen Kopf drehen könnte, würde er aufhören zu lächeln angesichts des desolaten Bildes, das sich ihm offenbart. Die Brise an diesem kühlen Frühlingsmorgen bläst Plastikabfall und leere Coca-Cola-Flaschen über die vom Unkraut überwucherten Plätze. Aus den Wohnblocks starren dort, wo eigentlich Fenster sein sollten, Löcher dem Betrachter entgegen. Einige Löcher sind mit Ziegelsteinen zugemauert worden, aber nur teilweise, so dass die Bewohner noch mitbekommen, was draussen vor sich geht. Und
64
BILDUNG
Die schöne Fassade Sevillas – gemäss dem Reiseführer Lonely Planet 2018 die Nummer eins der «Best-in-Travel- Städte» weltweit – beginnt dann zu bröckeln, wenn ein Tourist irrtümlicherweise den Bus Rich tung Las Tres Mil Viviendas besteigt. Auf seinen Fotos, die bis jetzt die phantastischen Kirchen und Monumente der Innenstadt zeigen, wird zunehmend der architektonische Verfall erkennbar. Der Foto graf bemerkt, dass die zusteigenden Quartierbewohner einfacher ge kleidet sind, auch die Markenlogos auf den Einkaufstaschen verschwin den mit jeder Haltestelle mehr und mehr. Er hört, wie die Menschen hier anders sprechen als jene im Zentrum Sevillas; als hätte ihre Spra che sich vom Andalusisch der Sevillaner noch einen Schritt weiter vom Hochspanischen entfernt: noch schneller, noch undeutlicher und noch verkürzter. Je tiefer der Tourist ins Quartier hineinfährt, desto stärker wird der kulturelle Niedergang auf seinen Fotos sichtbar. Bis der Bus Las Vegas, den entlegensten und berüchtigtsten Quartierteil von Las Tres Mil Viviendas, erreicht. Und der Tourist lieber keine Bil der mehr schiesst.
65 Camarón sähe die Feuerstelle, um die bei nächtlichem Gesang die Schnapsflaschen gereicht werden und sich die Sänger und Tänzer in den Rausch trinken, um ihn am Tage auszuschlafen.
Die Analphabetismus-Rate beträgt 26 Prozent – eine Zahl, die dem Niveau der Demokratischen Republik Kongo entspricht, weit entfernt von den 1,6 Prozent im restlichen Spanien. Trotzdem besuchen nur wenige Erwachsene einen Lesekurs, und die, die es tun, machen es, weil sie sonst die Führerscheinprüfung nicht ablegen dürften. Den Schein brauchen sie aber, um entweder als Schrotthändler oder Markt fahrer in die umliegenden Dörfer zu fahren. Denn das sind zwei der häufigsten Berufe in Las Vegas – neben Drogenhändler, Kredithai und Waffenschmuggler.Dochesgibt auch Ansätze zur Besserung. María del Carmen Utrera, 39, Mutter zweier Kinder und, wie sie sich selbst definiert, «Lehrerin für Lebenserfahrung», denkt genauso wie die Lehrerin Rosa Yáñez. Sie versteht nicht, wieso die Subventionen aus Brüssel immer und immer wieder in den Immobiliensektor fliessen, wo mit Arbeitern von andernorts gearbeitet wird, anstatt dass neue Arbeitsplätze im Quartier geschaffen würden. «Sogar die Strassenkehrer werden aus Sevilla extra hierhergebracht», sagt Utrera, die beim Sportklub in Las Vegas in der Administration arbeitet und von Montag bis Mittwoch meist jüngeren Frauen Lesen und Schreiben beibringt. Angefangen In Andalusien wird Lesen zum vernachlässigten Kulturgut.
SPRACHLOS IN SEVILLA
ohnehin nicht bezahlen könnten. Ratten streunen wie andernorts Hunde durchs Quartier. In Las Vegas deponieren längst nicht alle Bewohner den Müll in die dafür vorgesehenen Container, es kann auch vorkommen, dass Säcke aus den Fenstern geschmissen werden. Der Briefträger kommt nicht mehr vorbei, weil es keine Brief kästen gibt – die wurden vor geraumer Zeit beim Altmetallhändler zu Geld gemacht. An jeder Ecke in Las Vegas steht ein «Wasserträger»: das unterste Glied in der Hierarchie der Kleinkriminellen. Schlecht angezogen und mit einer Plastiktüte in der Hand tut er so, als ob er etwas einsammeln würde. Leicht torkelnd vom Schuss der letzten Nacht gibt er das Codewort von einem zum andern weiter (in dieser Woche lautet es «Coca-Cola»), sobald eine Streife in Sichtweite ist. In Las Vegas gehen morgens Sozialarbeiter von Tür zu Tür, um die Kinder für die Schule zu wecken, weil die Mütter es längst aufgegeben haben.
In Las Vegas stehen bei starkem Regen ganze Strassen unter Wasser, weil die Kanalisation nicht funktioniert. Einstige Aufzugs schächte sind vollgestopft mit Abfall. Die Stromkabel werden von den Bewohnern meist illegal angezapft, weil sie die Rechnung des Elektrizitätswerkes
66 hatte es damit, dass sie beobachtete, wie die Frauen aus dem Quartier bei der Aushändigung der Lebensmittel durch das Rote Kreuz Probleme hatten, die Antragsformulare auszufüllen, und ihren Männern sagten, sie sollten das erledigen. Utrera beschloss, etwas dagegen zu unter nehmen. Der erste Schritt bestand darin, den Frauen ihre Lese- und Schreibschwäche überhaupt als Problem begreiflich zu machen. War das geschafft, musste sie den Frauen klarmachen, dass es ihnen nützen würde, wenn sie lesen könnten. Schliesslich ging es darum, dass sie sich aus dem Haus begeben und zu ihr in den Sportklub kommen soll ten, das Gebäude liegt gleich um die Ecke. Heute macht es sie unendlich stolz, wenn eine ihrer Schülerinnen zu ihr kommt und ihr die erstmals selbst erstellte Einkaufsliste zeigt.
Auch der 36-jährige Quique kämpft gegen den Analphabetismus.
Jeden Donnerstagvormittag beobachtet er die Menschenmenge, wenn der Kleidermarkt nach Las Vegas kommt. Auf Tüchern ausgebreitet liegen Herrenhemden für einen Euro, Röcke für zwei, Abendkleider für drei. Die Verkäufer verwenden nur ganze Eurobeträge, damit das Rechnen beim Herausgeben nicht zu kompliziert wird. Doch Quique ist nicht zum Einkaufen gekommen. Er ist auf der Suche nach jungen Arbeitslosen. Das Aussehen eines Roma und seine Gitarre dienen ihm als Köder. Nach ein paar Liedern gewinnt er die Sympathien der Jungen und kann sie überzeugen, bei ihrem gemeinsamen Berufsförderungs programm in der nahegelegenen Schule mitzumachen. Muss man sich beim Arbeitslosenamt registrieren? Wo liegen die Unterschiede bei Anstellungsverträgen? Was ist eine E-Mail? Wie bitte, mit meinem Smartphone kann ich E-Mails lesen? Was ist ein CV? Warum braucht es einen Lebenslauf für eine Anstellung? Diese und viele weitere Fragen kreisen in den Köpfen der Jugendlichen – als direkte Folge davon, die Schule geschmissen zu haben, um sich noch als Teenager zu verheiraten und von der Improvisation auf der Strasse zu leben. Dort, wo wahrscheinlich auch Antonio leben wird. Er hat den Lesekurs geschmissen. Seine kleine Schwester aber rügt er heftig, wenn sie nicht zur Schule gehen will. Leider ist er ein schlechtes Vor bild. Er hat sogar seine Telefonnummer geändert, damit er nicht mehr von seinen Lehrern angerufen werden kann. Seine Lehrerin kennt solche Situationen zur Genüge. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu üben und zu hoffen, dass Antonio doch noch zur Vernunft kommt und zumindest einen regulären Schulabschluss anvisiert. Wie wenige das tun, zeigt auch die Quote derer, die es aus Antonios Viertel an die Universität schaffen: gerade einmal ein Prozent.
BILDUNG
In diesem andalusischen Dorf sind die Bars nicht so voll wie in Sevilla, ausser im Sommer, wenn die Touristen aus Madrid und halb Europa kommen, sowie sonntags, wenn die Familien auswärts essen gehen, einige nur um zu zeigen, dass man es sich leisten kann – die Kinder derart herausgeputzt, dass sie dem Spielplatz fernbleiben müssen, um nicht schmutzig zu werden. In diesem andalusischen Dorf
67
In diesem andalusischen Dorf, wo die Zahl der Schulabbrecher hoch ist, weil die Eltern denken: Wenn unser kleiner Engel nicht gern zur Schule geht, dann wollen wir ihn mal nicht dazu zwingen. In diesem andalusischen Dorf ist die Arbeitslosenquote zwar auf einem Rekord hoch, doch das braucht niemanden zu kümmern, denn die Einheimi schen dürfen von der Hoffnung leben, eines Tages von der Verwaltung angestellt zu werden; als ob es keinen anderen Beruf gäbe als den des Beamten. Das Glück, als solcher unterzukommen, hängt wiederum nicht von der Ausbildung ab, sondern von der Familie. Ist die nämlich gross, sind den verwandten Lokalpolitikern gleich mehrere Stimmen für deren Wiederwahl garantiert.
SPRACHLOS IN SEVILLA
Vielleicht verändert die Ankunft neuer Analphabeten etwas zum Guten. Auch die afrikanischen Migranten können oft nicht lesen und schreiben, wenn sie hier ankommen. Doch sie unterscheiden sich von Antonio und seinesgleichen in einem: Wer in Afrika aufgebrochen ist und es nach Europa geschafft hat, will lernen und weiterkommen und hört nicht auf, von einer besseren Zukunft zu träumen. Die Antonios Spa niens könnten sich an ihnen ein Beispiel nehmen. Chelo in ihrem andalusischen Dorf hat noch nicht aufge geben. Im Gegenteil: Ihr Leben nimmt nach einer 180-Grad-Wende wieder Fahrt auf: Sie geht jetzt dreimal wöchentlich zum Unterricht. Zusammen mit ihren neuen Freundinnen plant sie Ausflüge zu Wein proben, besteigt alte Burgen oder besucht, wie kürzlich, das Musical El Rey León in Madrid. Sie geht zum Gruppenturnen, wodurch endlich ihre Arthrose besser wird. An den schulfreien Nachmittagen setzen sich die Frauen zum Stricken zusammen, abends widmet sich Chelo zu Hause ihrem Hobby, der Kalligrafie. Chelo führt ein ruhiges Leben in diesem andalusischen Dorf, das wie viele andalusische Dörfer ist, mit seinen einfachen und pfiffigen Menschen, die zwar nicht in einem Ghetto leben, wo sie sich ständig beobachtet fühlen, aber das voll von Tratsch und Klatsch ist, weil jede und jeder die Nase in die Angelegenheiten des anderen steckt, bis alle sich langweilen und ihr schlechtes Gewissen wegen der ganzen Trat scherei mit Rosenkranzgebeten in der Kirche reinzuwaschen versuchen.
Aber Chelo und ihre Klassenkameradinnen sind kraftvoller, als der Wind zu blasen vermag. Zwar schmerzen ihre Körper wegen des Al ters, weshalb sie manchmal zu Hause bleiben. Doch dann rufen sie sich gegenseitig an, um den Schulstoff weiterzureichen. Die Zahl der Schülerinnen nimmt sogar zu, neuerdings sind auch jüngere Frauen darunter, die beschlossen haben, ihre Scham abzulegen. Sie alle wollen endlich mehr als nur die Buchstaben kennen. Sie wollen das Zeugnis verstehen, das ihre Kinder begeistert von der Schule mit nach Hause bringen. Sie wollen ihren Enkeln vor dem Schlafengehen Geschichten vorlesen. Sie wollen selber rechnen können. Und sie wollen endlich auch neue Welten erkunden, die sich in diesen bisher geheimnisvol len Büchern offenbaren. Und vor allem wollen sie in der Gesellschaft nicht mehr schweigen müssen, aus Angst, sich beim Sprechen zum Narren zuChelomachen.hat ausserdem noch ein wichtigeres Ziel: Sie schreibt an einem Gedicht für den Geburtstag ihrer Tochter. Damit das beschrie bene Blatt Papier nach über siebzig Jahren endlich aufhört, nur ein weisses Blatt Papier zu sein.
68 BILDUNG
68 sind die Bänke an der Uferpromenade so aufgestellt, dass jeder, der sich setzt, dem Meer den Rücken zuwendet und auf Häuserblocks starrt, als wollten die Behörden vermeiden, dass jemand den Blick auf neue Horizonte richtet. Vielleicht repräsentieren diese Bänke auch nur das Wesen der Dorfbewohner, die sich trotz Mangelbeschäftigung lieber vor neuen Aufgaben drücken, als diese anzugehen. Wer will, kann in den verkehrt herum aufgestellten Bänken auch eine Rache am Meer erkennen. Längst spuckt es nicht mehr so viele Fische aus wie einst, stattdessen immer mehr Flüchtlinge aus der Sahara. Da tut es der lo kalen Ökonomie gut, dass die Touristen, die sich für solcherlei Dinge in der Regel wenig interessieren, weiterhin rege kommen, des berühm ten Nachtlebens wegen und des Windes, der hier bläst wie sonst nir gendwo inDieEuropa.Einheimischen mögen den Wind nicht besonders, und die Schule ist sehr nah am Strand, wo der Wind noch stärker weht.
69 STATT WENIGER Nach Angaben der Unesco gibt es weltweit rund 750 Millionen Analphabe ten, zwei Drittel davon sind Frauen. Könnten diese Frauen lesen und schreiben, würde sich die Kindersterblichkeit um ein Sechstel, die Müt tersterblichkeit um zwei Drittel und Kinderehen um ein Drittel reduzieren. In Konfliktländern wie dem Südsudan, Afghanistan, Jemen oder Syrien sind drei von zehn Jugendlichen vom Analphabetismus betroffen. Die Unesco schätzt, dass der Analphabetismus unter armen Jugendlichen weltweit erst 2072 ausgerottet sein wird. Dem gegenüber haben die ent wickelten Ländern mit funktionalen Analphabeten zu kämpfen, also mit jenen Menschen, die, obwohl sie eine Pflichtschule besucht haben, nicht in der Lage sind, einfache Sätze zu lesen oder zu schreiben. In der Schweiz und in Deutschland machen sie zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung aus.
MEHR
VIEL ZU VIEL 2,6 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt hat Spanien in diesem Jahr für Bildung vorgesehen. Nichts im Vergleich zu dem, was an Korrup tionsgeldern in die Taschen einiger Spanier fliesst: Laut casos-aislados.com, einer Privatinitiative, beträgt der volkswirtschaftliche Schaden, der zwischen 1981 und heute im Land durch Korruption entstanden ist, rund 204 Milliarden Euro. Diese Zahl resultiert aus einer Auflistung von 370 Fällen – die regierende Partei Partido Popular (PP) führt mit 190 Fällen die Rangliste an, es folgt die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) mit 65 Fällen. Auch das Königshaus findet sich auf der Liste wieder. Der bisher grösste Betrug geht mit drei Milliarden Euro auf das Konto von Oleguer Pujol Ferrusola, dem Sohn des ehemaligen Präsidenten Kataloniens. In Andalusien, dem Schauplatz unserer Reportage, hat die regierende PSOE durch fiktive Ausbildungskurse knapp drei Milliarden Euro veruntreut (mehr als eine Milliarde Euro stammt von der EU).
DIE RocíoAUTORINPuntas
Bernet, Reportagen- Redaktionsmitglied der ersten Stunde, staunte über das Staunen einer Freundin, die nicht glauben konnte, wie verbreitet Analphabetismus in Spanien heute noch ist. Über die Wucherung des funktionalen Analphabetismus in den ärmeren Vierteln Sevillas wunderte sie sich dann aber selbst: «Funktionaler Analphabe tismus wie im Falle Antonios ist das eine. Aber dass einige der Jugend lichen in einem Land wie Spanien überhaupt nicht lesen können, hat mich schockiert.» Mehr von der#57Autorin:Sushi aus dem Käfig
KONTEXT
70 RUBRIK BleistiftWChicagoGezeichnetesiesichmitund Papier in der rauen West Side die Türen öffnen lassen. CHRISTOPH FISCHER
Im Rahmen eines viermonatigen Atelierstipen diums habe ich mir vorgenommen, in der stellenweise stark heruntergekommenen West Side Chicagos zu zeichnen. Ich befinde mich in East Garfield Park, einem Stadtbezirk mit rund 21 000 Bewohnern, davon sind über 97% afro-amerikanischer Herkunft. Laut Statistik zählt diese Gegend zu jenen mit den meisten Gewaltverbrechen in Chicago. Nur etwas mehr als zehn Fahrrad-Minuten sind es von meinem Zuhause im trendigen Wicker Park bis hierher. Doch das soziale Gefälle innerhalb dieser kurzen Strecke ist markant. Eine grosse Zahl der Passanten wirkt gesundheitlich angeschlagen. Löcher klaffen in den Strassen, viele Häuser haben mit Brettern verrammelte Fenster und Türen. Mit dem Zeichenblock in der Hand stehe ich auf der Kedzie Avenue und zeichne die Station der Hochbahn. Auf der niedrigen Mauer hinter einer Brachfläche sitzen einige Junkies. Ihre Zähne sind vom Crack-Rauchen beschädigt, bei manchen verschwunden bis aufs Zahnfleisch. Möwen wühlen in herumliegenden Plastiksäcken. Vor mir hält ein Autofahrer aus dem weissen Mittelstand. Sein kahlgeschorener Kopf glänzt vor Schweiss. Auf dem Beifahrersitz liegt ein Springseil. Er möchte, dass ich ihm die Skyline von Chicago male, fürs Büro seiner Freundin. Dann fragt er: «Und was zeichnest du eigentlich hier? Tote Leute, huh?» 72
74
Ein junger Einzelzigaretten-Verkäufer in schäbiger Kleidung blättert meine Zeichnungen durch und sagt verdutzt: «Look at that! He’a real nigga’!» (In etwa: «Schau dir das an! Er ist echt einer von hier!»)
Auch viele Bewohner verstehen nicht, wieso ich hier in der West Side zeichne. Jemand bietet sich an, mir stattdessen die Hochhäuser in Downtown zu zeigen. Er will mir dort als «Agent» Passanten zum Porträtieren anwerben, um dann den Gewinn aufzuteilen.
75
Ein Mann schaut auf meine Zeichnungen und stellt für sich fest: «God gave him talent!» Ich antworte: «Ja, vielleicht – doch vieles ist natürlich auch Übung.» Verärgert wiederholt er: «Nein, nicht vielleicht. Gott gab ihm Talent!»
Die Figur eines hellhäutigen, bärtigen Mannes wirbt für eine Autowerkstatt an der Grand Avenue. Als ich Monate später zurückkehre, stehen nur noch die Beine der Werbefigur auf dem Dach. Ein Orkan hat im Sommer den Körper heruntergefegt.
76
Goldie, der schon einmal an mir vorbeigefahren ist, hat mich wiedererkannt und parkiert seinen Wagen. Wir kommen ins Gespräch, und als ich frage, wie er denn als Hobby-DJ über die Runden komme, meint er, das sei ganz einfach. Man komme ohne Probleme zu Unter stützung, Lebensmittelmarken und einer Krankenkarte. Vorausgesetzt, man lebe hier in der West Side. Dann müsse man nicht einmal den Nachweis erbringen, dass man staatliche Hilfe Goldiebenötige.nimmtmich mit zum Haus, das seinen Eltern gehört. Er ist meistens hier und passt auf, dass niemand illegal darin wohnt.
Einer der herumstehenden Anwohner kommt zu uns: «Das ist keine gute Idee, hier zu zeichnen», sagt er nachdrücklich, aber freun dlich. Als ich Goldie frage, wieso das nicht gehe, meint er, dass in der Strasse im Moment Drogen verkauft würden. Eine vorbeifahrende Polizeistreife würde bei der Anwesenheit eines Weissen sofort Verdacht schöpfen. Denn Weisse kämen höchstens hierher, um Drogen zu Goldiekaufen.schlägt mir vor, dass ich ihn vor der bemalten Wand der Schule an der Ecke Chicago Avenue & Pulaski Road zeichne. Er möchte vieles erfahren über die Schweiz. Zum Beispiel, ob wir auch solche Stadtteile haben in der Schweiz. Und ob es auch eine Müllabfuhr gibt, Lkw mit hydraulischen Pressen, als gerade einer vorbeifährt. Goldie sagt, er gehe kurz für zwei Minuten seine Zigaretten aus seinem Auto holen. Er kommt nicht mehr zurück.
Anderntags wartet Goldie in der Seitenstrasse auf mich und möchte, dass ich ihn auf dem Schutthaufen eines eingestürzten Hauses zeichne.
Ich zeichne einen roten Chevy 69 auf 26-InchRädern, der vor einer Waschstrasse steht.
Darauf zeige ich den Arbeitern der gedeckten «Touch Hand Car Wash» meine Zeichnungen, sie staunen und bitten mich in das finstere Gebäude hinein. «Absolutely no drugs!» steht neben den handgemalten Preisen an der Wand, in gelben, grünen und blauen Buchstaben. Waschen, wachsen und polieren. Autos oder Schuhe. Kunden sind an diesem Abend keine da, und die Arbeiter vertreiben sich die Zeit mit Fernsehen. Denis, der Besitzer, musste die Belegschaft wegen der Krise innerhalb eines Jahres von 22 auf 9 Mitarbeiter reduzieren. Ein Stör-Coiffeur kommt vorbei und schneidet den Männern mitten auf der leeren Wasch strasse die Haare. Zwei Arbeiter schauen fern, während ich sie zeichne. Über den Ton des Apparates und die Mimik der Betrachter versuche ich herauszufinden, was gerade zu sehen ist. Zuerst wird ein Bericht über die Amerikanerin Donna Simpson gezeigt, welche die dickste Frau der Welt werden möchte und nur noch Essen in sich hineinstopft. Darauf folgt eine Soap, in der ein Afro-Amerikaner nach Afrika aus wandert, in sein wirkliches «motherland», wie der Protagonist verheissungsvoll und schwülstig erklärt. Die beiden müden, leicht betrunkenen Autowäscher kommentieren fortlaufend, was sie sehen. Zu einer Werbung meint der eine: «Die haben nicht eine Lizenz zum Töten, son dern eine für Bla-Bla-Bla.» 78
Ich vergewissere mich bei verschiedenen Per sonen, ob dies wirklich der Treppenabstieg in die Untergrund-Mall ist, von der man mir erzählte. Der Eingang gleicht eher einem No tausgang. Doch unten erstreckt sich eine hell beleuchtete Halle. Im Kunstlicht sitzen in rund einem Dutzend Abteilen Kleiderverkäufer und warten gelangweilt auf Kundschaft. Neben sehr trendigen, teuren Kleidern gibt es hier auch allerhand Läden mit Hip-Hop-Schmuck und Accessoires. «Outfit – Outfit!», ruft Verkäufer Freeman. Spontan porträtiert er mich mit dem Kugelsch reiber auf einem Stück Karton. «Leben auch so viele Schwarze in der Schweiz?», möchte Free man wissen. Es gibt nicht viel Beschäftigung für ihn hier in der Mall. Nur ab und zu, wenn jemand durch die fast leere Halle schlendert, versucht er, diese Person auf die Kleider aufmerksam zu machen. Und auf sich selbst. Zumindest die Frauen, welchen er jeweils einen neckischen Kommentar zu ihrem Hinter teil nachruft.
80
Ein junger Kunde, der mit frisch verbundenem Arm die Stechkabine verlässt, fragt mich, ob ich für ihn einen Körper mit abgehackten Armen und Beinen entwerfen könne. Ich denke spontan an eine Zeichnung von Goya aus der Serie «The Disasters of War». Tracey vom Tattoo-Shop posiert mit aufgestütztem Arm zwischen Mankrey und dem Ladenbesitzer Jimmie. Er erzählt mir später, er habe die Kopie der Zeich nung im Kopiergeschäft vergrössert, sie hängt nun als Bild zu Hause über dem Sofa.
Die komplette Untergrund-Mall wird von Koreanern geführt. Auch die junge Hot-DogVerkäuferin ist aus Südkorea. In ihrer kleinen Kabine zwischen der Treppe verkauft sie die vermutlich billigsten Mahlzeiten in Chicago. Eine Portion Pommes frites kostet einen Dollar, eine Büchse Cola 50 Cents. Wenn keine Kunden da sind – was meistens der Fall ist –übersetzt sie eine Art «Bibel des positiven Denkens» eines religiös motivierten Gurus ins Koreanische. Sie findet, dass die Leute auf meinen Zeichnungen alle so ernst, traurig oder gar zornig aussehen. Sie schüttelt den Kopf und meint: «Vielleicht hast du ein hartes Herz?» Sie nimmt einen farbigen Kalender von der Wand und zeigt mir ein kitschiges Gemälde, das Frauen in üppigen Kleidern bei der Kornernte in der Provence zeigt, und rät mir, ich solle doch besser so etwas malen. Meine Zeichnungen aus dem Tattoo-Shop kommentiert sie mit: «Gott hat Tattoos nicht gerne.» 82
Jimmie’s Tattoo-Shop in der Untergrund-Mall ist von der Decke bis zum Boden mit sehr bunt ausgemalten Tattoo-Vorlagen ausgehängt. Im Angebot sind zähnefletschende Pitbulls, unzählige Schädelvariationen, heulende Wölfe, farbige Delphine, Schwäne, Schmetterlinge mit Totenkopfmustern, Menschensilhouetten mit Schusslöchern und Stacheldrahtherzen.
Auf der staubigen Parkfläche vor dem «Food & Liquor Store 111» sitzen im Innern eines alten Chevy-Vans zwei korpulente Brüder, beide Anfang dreissig. Sie warten, bis es Zeit wird, um ihre Kinder von der Schule abzuholen. Während ich Moose-Man zeichne, bleibt auf einer Parallelstrasse weiter hinten der Auflieger eines Sattelschleppers krachend mit dem Dach in der Trägerkonstruktion der Hochbahn hängen. 84
Die beiden Brüder laden mich ein, die Zeich nung bei ihnen zu Hause an der Walnut Street vorbeizubringen. Moose-Man möchte am folgenden Abend für alle Spaghetti kochen. «Wir bleiben für immer Freunde, weil du mich zeichnest!», sagt er.
Irgendwann reibt sich Rosie am Kopf und fragt: «Und wie heisst doch der andere Leonardo schon wieder?» «Da Vinci», sage ich. Sie lacht bestätigend und schlägt mit der flachen Hand in meine ein.
85 Am folgenden Tag bringe ich die Kopien zur Walnut Street. Hier wohnt Moose-Man mit seiner 28-jährigen Frau Rabbit, die im Sommer ihr dreizehntes Kind erwartet. Die tempera mentvolle Grossmutter Rosie empfängt mich überschwänglich und leicht angeheitert. Sie posiert für ein Porträt vor ihren drei Wellensit tichen. Sie sagt, ich sei wie «Leonardo di Caprio in Titanic», als er im Film an Bord seine Geliebte zeichnet.
Moose-Man zeigt mir sein Haus und führt mich in den oberen Stock. Wir betreten ein möbel losen Zimmer. Auf zwei aufeinandergeschichteten Matratzen liegen fünf schlafende Kinder. «Meine Kinder», sagt er und meint, es sei kein Problem, ich könne hier zeichnen, und verlässt den Raum. Umgeben vom leisen Heben und Senken des Atems der Kinder und den schwachen Pfiffen beim Ausatmen, stehe ich völlig unverhofft in diesem Zimmer. Die Situation wirkt so berührend auf mich, dass mir die Zeichnung nicht auf Anhieb gelingen will. Einmal wacht der vierjährige Michael auf, starrt mich mit grossen Augen an und fragt mich: «Bist du ein Weisser?» Und schläft weiter. 86
Tante Angel flicht farbige Plasticblumen in Derenikas Haar. Wenn sich das Kind bewegt, blinken Leuchtdioden in seinen Gummi sandalen. «Weisse Menschen sind schon in Ordnung», höre ich sie einmal zu Derenika 88 sagen. Im Wohnzimmer herumliegende Gegen stände wie Kleider, Schuhe oder Bierdosen werden täglich mit Schneeschaufeln und Garten rechen zusammengetragen.
89 Mike-Mike, Moose-Mans Bruder, mag diese Zeichnung, weil ein grosser Teil seines beachtli chen Körperumfangs in den Kissen des Sofas verschwindet. Während die Kinder in der Schule sind, spielt Familienvater Moose-Man im oberen Stock oft mit seinen Kollegen oder seiner Frau eine hyperrealistische Basketball-Simulation am Flachbildschirm. Es ist dort manchmal ziemlich neblig. Marihuana-Rauch liegt in der Luft, besonders wenn Freunde zu Besuch sind.
Heute ist Fat Mack zu Besuch. Ich werde ihm scherzhaft als ihr persönlicher Hauskünstler vorgestellt. Fat Mack möchte, dass ich ihm an stelle des Nachahmer-Produkts das exklusivere «Olde English»-Bier in die Hand zeichne.
In die Front seiner Kappe ist eine Uhr eingenäht, und unten durch verläuft der Schriftzug seines Rufnamens – «Fat Mack» – die Buchstaben sind bestückt mit Kunstdiamanten. Seine Zähne hat er mit einem vergoldeten Grill überzogen, einer herausnehmbaren Zahnschmuckplatte. 90
Bei der Familie gehen viele Verwandte, Freunde und Nachbarn ein und aus. Es ist schwer zu sagen, wer von ihnen dauernd hier wohnt und in welcher Beziehung sie zur Familie stehen. Auch ich werde fast zu einem Familienmitglied. Über einen Zeitraum von fast zwei Wochen komme ich täglich zum Zeichnen vorbei. Möchte jemand eine Zigarette rauchen, so wird zuerst das einzige Handy im Haushalt gesucht. Danach ruft man den Einzelzigaretten-Verkäufer an, der die Strasse auf und ab geht, und wartet, bis es an der Haustüre klingelt.
Grossmuter Rosie schläft, während der hyper aktive Michael kaum ruhig sein kann und Derenika mit einer Spaghettizange und ihrer einjährigen Schwester Francis spielt. Wenn Rosie wach ist, ist sie es, die für Ruhe und Ordnung sorgt. Sie lärmt in den oberen Stock, wenn die Kinder ihr nicht mehr gehorchen, ruft fluchend nach Moose-Man, dem Vater. Meistens bleibt er aber oben, ist vielleicht gerade mit einem Videospiel beschäftigt, und die Drohungen verhallen ins Leere. Bei einem Besuch zwei Monate später zeigt mir Rosie das Einschussloch einer Revolverkugel oberhalb des mittleren Fensters. Das Geschoss drang von aussen durch den Fensterrahmen und blieb darin stecken, während im Sessel darunter jemand schlief. Bei Nachbarn war ein Streit ausgebrochen. Es gebe jedes Jahr eine Schiesserei irgendwo in dieser Strasse, doch danach sei es lange wieder ruhig, sagt Rosie. Sie träumt von einer eigenen Wohnung in einer Sozialbau siedlung im ruhigeren Norden der Stadt, die sie für sich beantragt hat.
An ausgewählten Orten in der West Side sind Aufkleber angebracht, die ein Kindergesicht zeigen. «Schiess nicht, ich will hier aufwachsen!», steht darauf. Bei meinen Ausflügen in die West Side fühle ich mich selber nie ernsthaft bedroht. Doch die Frage, ob ich hier sicher bin, ist meine ständige Begleiterin. Einmal kam ein Jugendlicher aus Übermut mit einem Revolver auf mich zugehüpft, mit einem Lachen im Gesicht. Ich hörte zuerst das mehrfache Klicken, was mich merkwürdigerweise beruhigte, weil ich annahm, dass die Waffe deshalb nicht geladen sei. Zweimal gab ich zu meiner Sicherheit eine Originalzeichnung weg, konnte sie aber vorher noch abfotografieren. Wenn es zu Misstrauen mir gegenüber kam, dann wegen des Verdachts, dass ich ein verdeckter Ermittler der Polizei sein könnte. Einer tastete meinen Pullover nach einer Polizeidienstmarke ab. 92
94
DT wohnt bei seinen Eltern, ein paar Häuser weiter als die Familie, bei der ich zeichne. Er ist zweifacher Vater. Den Namen seiner Tochter hat er sich auf seinen Handrücken tätowieren lassen. Vom Balkon seiner Wohnung aus ist die Spitze des Willis Tower (vormals Sears Tower) zu sehen, dem höchsten Gebäude von Chicago. Am Holzgeländer zerrt ein Baby-Pitbull, wenige Wochen alt. DT ist bis nach Iowa gefahren, um diesen Hund aus spezieller Rassenzucht abzuholen. Am Spiegelschrank seines Zimmers kleben Kopien meiner Zeichnungen, welche ihn abbilden oder aus seiner nächsten Umgebung sind. Ich habe sie eingetauscht gegen eine CD mit seiner Musik, der Gruppe Paperwork. Auf meinen Velorouten durch die West Side finde ich überall weggeworfene CDs auf der Fahrbahn, entweder mit Hip-Hop oder mexikanischer Heimweh-Musik bespielt.
Moose-Man lädt mich ein zum Barbecue auf der Holztreppe des Hinterhofs. In riesigen Aluminiumschalen steht das aufgeschichtete Fleisch bereit. Als Mike-Mike die halbe Flasche Anzündflüssigkeit direkt in den brennenden Grill hineinspritzt, trete ich ein paar Schritte Gegessenzurück. wird nicht gemeinsam, auch nicht an einem Tisch. Es sind im ganzen Haus keine Tische vorhanden, abgesehen von einer niedrigen, gläsernen Ablage. Die zwei riesigen Sofas im Wohnzimmer und die geschichteten Matratzen im oberen Stock sind die einzigen Möbel im Haus. Auch Spielsachen sehe ich keine. Ein zersplitterter Flachbildschirm dient als Stereoanlage. Zum Essen sitzen die Kinder auf dem Küchen boden. Keshari versucht eine kleine Schabe mit der Hand zu einzufangen. Sie verschwindet unter einem der beiden riesigen Kühlschränke. Die Kleinsten kippen nach Beenden der Mahlzeit den Inhalt ihrer halbleeren Teller auf den Boden. Nach jeder Kindermahlzeit werden die Kacheln mit dem Wischmop gesäubert. Mit einem Kaffeelöffel schlürfe ich aus der Schale meine Spaghetti Bolognese, auf denen ein gebratener Pouletflügel und Fisch liegt. Beim Verlassen des Hauses sehe ich eine Kopie meiner Zeichnung an der Haustür kleben. Sie zeigt die vielen Kinder von Moose-Man. Grand ma Rosie ruft mir noch schallend lachend zu, dass ich sehr vorsichtig nach Hause fahren soll, schliesslich fahre sie im Zeichenblock mit. 96
98 Chur ROMANA GANZONI
98 Am Anfang war Chur eine Bahnhofstrasse. Die lag hinter den Bergen, abseits des ge wohnt rauen Klimas, ein Boulevard für para dierende Weiblichkeit, zumindest auf den ersten Metern. Wenn meine Mutter mir von ihren Frisörbesuchen in der warmen und zu gigen Bahnhofstrasse erzählte, sah ich ihre Jugend und ihre Möglichkeiten, ich sah eine Allee, fünfmal breiter und zehnmal länger als die Via da la Staziun in Scuol. Da hockst du stundenlang, sagte meine Mutter, wirst drang saliert, sie zerkratzen und verbrennen deine Kopfhaut, aber zum Schluss strahlst du mit deiner Farah-Diba-Frisur in den Spiegel, wunderbaaar, sagst du, bezahlst, bedankst dich, und draussen verluftet dich sofort der Föhn. Frisur im Eimer. Sie lachte. Als Kin dergartenkind war mir das Wetterphänomen unbekannt, ich dachte an meinen Spielzeug föhn, in meiner Phantasie wuchs er fassa dengross heran und blies die schönen Damen und Fräuleins der Sechziger zu den Geleisen, und dann zurück in die Berge, nach Hause. Bis zum Ende des Kindergartens roch Chur nach Haarlack und Tee aus dem Café Maron.
Auf der Bahnhofstrasse spazierte meine la chende Mutter, und auf mich wartete ein Ka russell. Aber im Frühling der ersten Klasse war alles weg, wie vom Riesenföhn weggebla sen. Danach stand in Chur nur noch ein Ge bäude: das Kantonsspital. Ich war sieben, mein Freund, Nachbar und Beschützer war zehn, als er dort starb. Sie hatten ihn lebend aus dem Dorf geholt und tot aus der Stadt zurückge bracht. Wegen des starken Nasenblutens? Krebs, hörte ich. Im Fluss hatte ich einen Krebs gefunden. Wie sollte der Krebs in seiner Ho sentasche überlebt haben? In der Ambulanz. Auf dem Pass. Ohne Wasser. Es war klar: Die Churer hatten meinen Freund auf dem Ge wissen. Und meinen Vater haben sie auch nicht gerettet, als der zwanzig Jahre später ins Kantonsspital gefahren wurde. Immerhin kam er nicht ganz tot zurück. Er sass noch zwei Monate stumm in der Stube. Ein weite res Jahrzehnt verging, da begleitete ich mei nen zweijährigen Sohn in der Ambulanz über den Pass. Das Kind überlebte, Gottseidank.
99
Meine Grossmutter Lina, die Nana, wohnte eine Viertelstunde von Chur entfernt, in Zi zers. Da sagt man Chur und Chäs und nicht Khur und Khäs, und meine Mutter ist dort aufgewachsen. Wenn Nana Lina nach Chur fuhr, montierte sie stets einen Dutt, der nie einen Wank machte, weder bei Föhn noch bei Hagel. Damit konnte sie getrost die Bahn hofstrasse hinunterlaufen. Sie ging aber lie ber hinauf. Zu Disam für den Schmuck, den sie sich nicht leisten konnte. Zu Pedolin für alles Textile. Ich bin ihr zwei Romane schul dig mit den Titeln Disam und Pedolin. Der Disam-Roman müsste von ihren Opal-Ohr ringen handeln. Sie sagte, die Steine zeigten, in welcher Stimmung sie gerade sei. Im Pe dolin-Roman stünde das Leinentuch im Mit telpunkt, das die Leiche des Mannes be deckte, auf den der cholerische Bruder der Nana geschossen hatte. Die Strafe sass er im Churer Sennhof ab. Zu Weihnachten schickte er immer selbstgebastelte Papierkörbe. Darin lag seine ganze Reue. Viele Wege führten nach Chur. Darunter auch die Autobahn, auf der meine Mutter ihre Jung fernfahrt absolvierte, zwei Tage nach bestan dener Fahrprüfung. Die Nana sass auf dem Beifahrersitz und wollte nur helfen, als sie ihr windelgrosses Tuch entfaltete, um die fette Fliege zu verscheuchen, die sie auf der Frontscheibe erblickt hatte. Meine Mutter schrie, ich, auf dem Rücksitz, auch, aber die Grossmutter wedelte nur vehementer hinter dem Brummer her. In Chur angekommen, standen Tochter und Enkelin unter Schock. Lina sagte nur «Sodali» und stieg seelenruhig aus. Wieder gefangen habe ich mich erst auf der weltschönsten Rolltreppe im Vilan. Die Fahrten rauf und runter empfand ich als pa radiesisch, obwohl mir wegen der vielen Reize des Kaufhauses immer wieder schwindlig wurde. Die weiteren Sensationen zu jener Zeit: syrische Goldhamster und Springmäuse in der Tierhandlung am Kornplatz sowie die Stempel in der Papeterie Koch, die meine Mutter für ihr Sportgeschäft brauchte. «Be zahlt» hiess es auf einem ungemein beruhi gend. Bestelle ich deshalb noch immer jedes Jahr meinen Papierkalender bei Koch? In die Buchhandlung hingegen ging ich nie. Den Namen kannte ich, meine Mutter sprach ihn mit Ehrfurcht aus: Schuler. Auch für mich war dieser Ort ein grosses, edles und frem des Geheimnis, nichts für eine ungezogene Göre aus den Bergen. Während der Mittel schule entdeckte ich, dass Schuler auch per Post liefert. Ich bestellte Iphigenie auf Tauris und zwei Benimmbücher, nach der Lektüre waren mir meine Eltern plötzlich sehr pein lich. Als ich zum ersten Mal bei Schuler aus meinem eigenen Buch las, fragte ich mich: Darfst du das? Meine Mutter und ich gingen, ganz in Nanas Sinn, weiterhin zu Pedolin, und nach dem Untergang von Disam fanden wir Konrad Schmid, der meinen Mann und mich kannte, bevor wir uns kannten. Konrad schmiedete unsere Eheringe und die Ringe zum Schul anfang unserer drei Kinder, er wurde ein en ger Freund der Familie, und nun war er es, der Churer, der immer wieder die Bahn nahm und zu uns ins Engadin reiste. Ich reise regelmässig nach Chur, wo ich mich längst zum kulturellen und städtischen Leben zuge lassen habe. Ich gehe in alle Buchhandlungen der Stadt, ins Staatsarchiv, zum Institut des Dicziunari Rumantsch Grischun, zum Radio und zur Zeitung, ins Churer Theater, ins Bündner Kunstmuseum und auch in die Kantonsbibliothek. Da wurde mir unlängst der Bündner Literaturpreis überreicht. Der wichtigste Preis in meinem Leben: Ich be kam ihn in Chur. Die grösste Freude der Er wachsenen bleibt aber das Freilandhähnchen im Restaurant Calanda. Das gibt es nur abends, auf Vorbestellung.
100 Geologisch gesehen ist es nicht lange her, dass ein riesiger Bergsturz im Totalpgebiet über dem Landwassertal eine Aufschüttung hinter liess. Der Grossdavoser See staute sich auf, bald bildeten sich Deltas, die zur Unterteilung dieses Sees führten. In der Folge änderte die Landwasser ihre Fliessrichtung – in der Schichtrichtung der Seitentäler ist die Talum kehr des Flusses noch 20 000 Jahre später gut sichtbar.
Es war die Zeit, in der Davos rasend schnell wuchs: 1860 zählte es 1700 Einwohner und Einwohnerinnen, 1889 kam die Eisenbahn, und schon 1910 lebten hier fast 10 000 Men schen. Eine Bauordnung erhielt Davos aller dings erst 1916, als sich Tatsachen bereits vollendet hatten und die heutige Stadtstruk tur Auffeststand.ErnstLudwig Kirchners farbstarken Bil dern wimmelt es von Bogenschützen, Eisläu ferinnen, Ski- und Bobfahrern. 1934 wurde der erste Bügellift der Welt gebaut, Engländer er oberten das Davoser Gebirge. Bis heute bilden 100
Nur für kurze Aufenthalte kamen die ersten Touristen nach Davos. Bald schon folgten Tu berkulosekranke, die länger blieben. Man ent deckte die antiseptische Wirkung der Sonne, errichtete Sanatorien, funktionierte Hotels um, entwickelte die Heliotherapie samt dreh baren Sonnenpavillons. 1882 wurde in Berlin der Tuberkelbazillus entdeckt, im selben Jahr begann in Davos der Bau der Kanalisation.
Ab dem 12. Jahrhundert besiedelten die Walser das Tal, im 15. Jahrhundert entstand hier der Zehngerichtebund, um das Gebiet vor der Ex pansion der Habsburger zu verteidigen. Davos Dorf und Davos Platz wuchsen heran; die na türliche Grenze zwischen ihnen bildete lange Zeit der Schiabach: Im Winter brachte er Schneelawinen, im Sommer Rüfinen, Bergrut sche. Jahrhundertelang war der Gebirgswald von Brandrodungen und Bergwerken bedroht. Heute schützt er die höchstgelegene Stadt Europas vor den im Winter nach wie vor nie dergehenden Schneemassen. Ausserdem nimmt der dunkle Waldmantel das Sonnen licht auf und trägt das Seine dazu bei, im Win ter den Kaltluftsee über Davos aufzulösen.
Das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung entstand, ebenso das Labo ratorium für experimentelle Chirurgie und das Institut für Schnee- und Lawinenfor schung. Ärztekonferenzen und der Europäi sche Lichtkongress finden in Davos statt, und auch der Weltwirtschaftsgipfel WEF, dem ausgerechnet eine weltweite Tröpfcheninfek tion beinahe ein Ende bereitet hätte.
Als 1943 mit dem Streptomyzin das erste Me dikament gegen Tuberkulose entwickelt war, ging das Kurgeschäft bergab, Sanatorien wur den wieder zu Hotels, der neue Friedhof stellte sich als um das Doppelte zu gross an gelegt heraus. An den ersten Davoser Hoch schulkursen hatte Albert Einstein bereits 1928 mit einem Geigenkonzert überrascht. Die Entwicklung Davos’ zu einer Stadt der Wissenschaft war nicht mehr aufzuhalten.
Damit keine Dachlawinen auf die Gehwege donnern, Passanten erschlagen oder unter sich begraben, wurde das Flachdach erfunden.
Es ist nach der Mitte hin geneigt und führt Schmelz- und Regenwasser zu einem Ablauf, der durch das warme Hausinnere führt und darum nie gefriert. Dieses Konstruktionsprin zip ist weltweit als Davoser Dach bekannt.
Niederländerinnen, Russen, Juden, Zürcherin nen historisch gewachsene Geflechte, eine Vermischung mit der hiesigen Bevölkerung findet kaum statt. Immer wieder wurde mas siv gebaut, Baukulturelles abgerissen, Wohn raum knapp und teurer, nicht zuletzt wegen der AuchZweitwohnungsinitiative.dieWeltgeschichtehat sich ins Land wassertal eingeschrieben. Als Ende 1915 die Kriegsparteien den Austausch verwundeter und kranker Gefangener vereinbarten, nahm die Schweiz Tuberkulosekranke auf und pflege sie in Davos. Aber auch der Leiter der NSDAP Schweiz hielt sich in Davos auf, als er 1936 vom jüdischen Studenten David Frankfurter erschossen wurde.
Pro Jahr zählt man in Davos im Schnitt gerade einmal sieben Nebeltage. An einem dieser Tage muss Gerhard Richter jene Fotos gemacht haben, die als Grundlage für sein Gebirgsge mälde Davos dienten. Die sonst so klare Sicht und dieses typische alpine Licht rühren daher, dass die Luft kaum Dampfpartikel enthält.
Die wahre Davoser Baumeisterin aber bleibt die Sonne. Zu ihr drehen sich die Terrassen und Balkone. Wer hier bauen will, muss vom Geometer prüfen lassen, dass jeder Haupt raum am 21. Dezember mindestens zwei Stun den Sonne hat. Solange die Sonnenlichtvor schrift eingehalten wird, darf der Abstand zu den Nachbargebäuden schrumpfen, was zu immer dichterer Besiedelung führt. Die Ära der Villenstadt mit ihren grosszügigen Gär ten, deren Abstandsgrün auch als Schutz vor Tuberkulosekranken diente, ist vorbei. Noch nicht ganz verschwunden sind die weitver streuten Walserhäuser, die, wie manche mei nen, dem Davoser Charakter einen eigen brötlerischen Zug verliehen haben.
Alle fünf Jahre treffen sich dafür Wissen schaftlerinnen aus aller Welt in Davos, auch wenn die Messungen längst auch im Welt raum Solltestattfinden.derWeltwirtschaftsgipfel also eines Tages doch abziehen, der Schnee winterlang ausbleiben oder der Fluss einmal mehr eine neue Richtung einschlagen – der Wind wird weiter unbeirrt von Nord nach Süd durch das Tal wehen. Und auch die Sonne wird voraus sichtlich noch ein paar Milliarden Jahre für Davos, diese Stadt in den Alpen, scheinen.
101
Carl Dorno, der später die UVB-Strahlen ent deckte, wollte in Davos die Heilwirkung des Klimas ergründen und untersuchte erstmals systematisch die Strahlungsgrössen sowie die Wechselwirkung zwischen Sonnenstrah lung und Atmosphäre. Ende der fünfziger Jahre wurden erste internationale Pyrohelio metervergleiche durchgeführt, und die Davo ser Sonne wurde – analog zum Urkilo oder dem Urmeter in Paris – zum globalen Kalib rierzentrum für Strahlungsmessinstrumente.
In schneereichen Wintern lagern sich Lasten von mehreren Tonnen auf den Dächern ab.
Fahles Kunstlicht, kaum Leute. Was mich anspringt wie ein garstiges Tier, ist nicht die Unheimlichkeit dieser Zwischenwelt – es sind die Schau kästen. An die zehn Stück sind in den Beton eingelassen, rund 30 Zentimeter tief. Man kann die Rückwand für Plakate nutzen, die Simsfläche für allerlei Figürchen. Wie konnte ich sie nur vergessen? Der lokale Ableger der Sozialdemokraten wirbt mit roten Plakaten auf schwarz gestrichenem Hintergrund – klar, aber trist. Im Fenster daneben aber wuchert die Ausdruckswut: Fotos von Hütten bauen den Kindern auf holzverkleideter Wand! «Nehemia kommt nach Effretikon», in blauer Schrift, «Sei auch du dabei!», in Rot. Kamele schleppen winzige Holzbündel über einen Juteteppich, Krippenfiguren in Samtmän teln halten ein «Mitarbeiter gesucht!»-Schild hoch. Immerhin hat sich jemand Mühe ge geben, jedenfalls keine Mühe gescheut. Das beweist auch das Fenster des Samariterver eins. Ohne erkennbaren Zusammenhang tummelt sich im Vordergrund eine Meeres landschaft aus Holzfischen, Glasperlen, Muscheln, Netzen, einem Boot und sogar einem Leuchtturm. Beleuchtet wird die Szenerie von einer Partylichterkette in grel lem Türkis. Ich schwanke zwischen Aner kennung und Abscheu. In diesen Kästen spiegelt sich die Fratze mei ner Provinzkindheit. All die Samstagnach
102 Meine Rückkehr fällt auf einen Nieseltag im Juli. Ich friere an den Füssen, auf dem Bahn steig finde ich keine einzige Sitzbank. Will kommen in Effretikon! Am Ende der Treppe nimmt ein junger Mann mich strahlend in Empfang. Nein, danke, bremse ich seine Euphorie, ich möchte nichts spenden. Genau an dieser Stelle balancierte einst Ivo auf den Pollern. Der Künstler kam von ausser halb, sein Haar trug er lang. Ich, siebzehn, hing an seinen Lippen und stand ihm auf dem Dreimeter-Sprungbrett Modell. Für mich war er eine Verheissung: Wenn er sogar das Betongrau des hiesigen Schwimmbads in eine bunte Welt verwandeln konnte, war nichts mehr Bahnhofsunterführung.unmöglich!
102
Auch ich wollte einst – Nehemia kommt nach Effretikon – Hütten bauen und Seilbrücken. Die Mädchen und Frauen, die bei Regen lieber in der Kirche bleiben und Pompons basteln wollten, emp fanden mich als Exotin, weil ich barfuss ging und Die toten Hosen hörte, statt in der Jugendmusik zu spielen. All diese Nadjas und Nicoles, die in einem Häuschen mit Vor garten aufwuchsen und deren Eltern zu uns in den Schulunterricht kamen, um einen selbstzufriedenen Vortrag über das Leben in ihrem Biotop zu halten.
Ich drehe der Kirche abermals den Rücken zu. Wohnblöcke, so weit das Auge reicht. Dass sie geschindelt wurden, macht sie nicht lieblicher, nur schuppiger. Noch immer frierend folge ich dem schmalen Weg am Friedhof vorbei. Bis ich vor mir die wohl bekannte immergrüne Hecke erblicke, kein bisschen gealtert. Und dahinter die vertrau ten Wiesen, die Schaukeln, die Wippe, das Klettergerüst. Rappenstrasse 30. Ich trete durch das Tor und setze mich auf die Bank. Von drei Seiten blicken Balkone auf mich herab. Hier sass meine junge Mutter und strickte Socken und Schals, während ich im Kinderwagen schlief. Im Winter fuhr ich mit dem Schlitten jenes Hügelchen hinunter, bis die Finger glühten. Türkei, Tibet, Tschechoslowakei, Bolivien, das waren die anderen Nationen in unseren vier Stockwerken. Als wären seit jenen Ta gen nicht fast vier Jahrzehnte vergangen, scheppern die Metalldeckel der Betonzylin der vor dem Haus immer noch, als ich wie früher von einem zum anderen hüpfe. Gut einen halben Meter hoch der erste, etwas niedriger der zweite, kann niemand so ge nau sagen, wozu sie da sind. Irgendwas mit Wasser? Die Teppichstange ist leer. Frau Stach war damals die Einzige, die ihre Teppiche hier ausklopfte. Ich blicke aufs Klingelschild. Frau Stach, sie ist noch da! Ich gehe weiter. In der Biegung der Strasse springt mich ein verwittertes Schild an: «Achtung, Kinder!». Darauf spielt ein gemalter Junge Fussball vor einer dunkelblauen Wolke. Dieses Schild! Plötzlich klopft mein Herz schneller. Ich sehe mir die Zeichnung genauer an. Die Art, die schwarzen Flecken auf den Fussball zu setzen, die Schrift – habe ich etwa ...? Ja! Ein Vierteljahrhundert ist das her! Damals musste ich mich für das Dilettanti sche meiner Malerei geschämt haben. Jetzt aber macht sie mich unfassbar glücklich. Beschwingt tragen mich meine Füsse zurück zum Bahnhof. Die Entgegenkommenden mustern mich neugierig. Bestimmt halten sie mich für eine Fremde. Ich bin von hier!, will ich ihnen hinterherrufen. Vielleicht bin ich es mehr, als mir lieb ist.
Und später, bereits Gymnasiastin in der be nachbarten Grossstadt und damit noch we niger zugehörig: die vielen Abende, an denen ich ziellos durch dieses farblose Kaff schlen derte und mich entscheiden musste zwischen den Jungs im Jugendhaus (mit Tischfussball und kiffen) oder den Jungs im Vereinshaus vom CVJM (ebenfalls Tischfussball, aber ohne kiffen). Das Effretikon meiner Kindheit war eine Kleinstadt, deren Horizont vom Kirchturm zum Schwimmbad reichte. Und die alles, was zu sehr über die Hecken hin auswuchs, beschnitt. Nach der Unterführung atme ich auf. Wieder Tageslicht! Und ein ordentliches, immerhin üppig bepflanztes Beet. Oberhalb der Bagger, die die Brücke über die Gleise wieder in stand setzen, erspähe ich den brutalistischen Glockenturm. Anfang der sechziger Jahre sorgte der abstrakte Betonbau neben der Kir che für Kontroversen. Inzwischen ist er aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken und eines der Wahrzeichen Effretikons. (Mit ihm und vier anderen Postkartenmotiven gin gen wir im Winter hausieren, um die Kasse des Jugendbundes zu füllen.)
103
mittage in der Kirche mit Wollknäuel und Handklatschspielen.
104 HANNES KARKOWSKI tanztStuttgarteng Hallelujah und Eternal Flame. In der Autostadt blüht Weihnachtsritualein.
105 Ihre Wange kommt mir näher. Ich spüre ihre Wärme. Sie berührt mich. Da ist Scham in ihrem Blick, und sie klappt ihre Lider über die erwar tungsvoll funkelnden Augen, legt ihren Kopf auf meine Schulter, hält sich an mir. Ich lasse meine Hände an ihren roten Haaren hinab den Rücken hinunterfahren. Eine Orgel jubelt in Zeitlupe. Ein paar Fetzen der BachKantate 140 «Wachet auf, ruft uns die Stimme». Gespielt auf einer rauchi gen Hammond, als wäre es Percy Sledge «When a Man Loves a Woman». Ist es aber nicht. Der Klang der offenen Becken sirrt wie ein Silberstreif en durch das Halbdunkel. Es ist Procol Harum nie wieder gelungen, dieses Lied exakt so klingen zu lassen. Es war ein einzigartiger Moment: Die Dokumentation der Aufnahmen ging verloren. Es gibt kein zweites Mal.
Als die Royal Airforce im letzten Kriegsjahr 180 000 Brand bomben, 4300 Sprengbomben und 75 schwere Luftminen auf meine Heimatstadt abwarf, um die Naziseuche zu beenden, entfachte sie einen Feuersturm, bei dem die Luft so heiss wird, dass die Strassen zu brennen beginnen. Ein Phänomen, das man auch in Hiroshima beobachten konnte. Wie im Film «Terminator», als das Kind in der Schaukel sitzt, dann kom mt ein Wind, und plötzlich ist es nur noch ein Skelett. Insgesamt wurde Stuttgart 53 Mal bombardiert. Übrig blieb am Ende des Krieges jedes dritte Wohnhaus. Nachdem so vieles bereits flachgebombt worden war,
Der Bass sinkt mir in den Bauch. Langsam komme ich an. Diesmal könnte es klappen. Dieses Jahr. Vielleicht haben wir beide ja ein Leben lang auf diesen Moment gewartet. Vielleicht geht alles schief. Es ist jedes Mal riskant. I was feeling kinda seasick
Aber die Aufnahme und die Schallplatte, sie dreht sich, vorne auf der erhöhten Bühne, wo das Mischpult steht und die beiden DJs bewaffnet mit Kisten voll Soul und Softrock gespannt die Menge analysieren. Wie zwei Kapitäne, die auf Sicht fahren. Hinter Andreas und André glitzern ein paar dieser Lamettastreifen, die sie aufgehängt haben, um die Hässlich keit der Rückwand zu verdecken. Der schleppende Beat beginnt die Menge zu bewegen. Wie hypnotisiert in diese ganz langsame Drehung zu ver setzen. Auch uns. Sie liegt in meinen Händen, ich spüre ihren Frühling, ihre Furcht. Der Gesang hebt an. We skipped the light fandango turned cartwheels 'cross the floor
REPORTAGEN STÄDTEVERBAND
Die Geschwindigkeit ist perfekt. Kein Lied an diesem Abend wird zu schnell sein, zu impulsiv. Andreas Vogel und André Herzer, beide 44, navigieren seit über 20 Jahren durch Stuttgarter Nächte. Jedes Jahr am 25. Dezember ist ihre Kür. Das Kap der guten Hoffnung. Hier müssen sie all ihr Wissen einsetzen, denn jeden Moment können in dieser Stadt Partys zu dumpfen Orgien werden, mit grölenden Männern Arm in Arm, Frauen mit Weissweinschorle-Gläsern auf Bassboxen. So was will jetzt keiner. Es würde alles zerstören, vielleicht für immer. Wir sind zusam men auf dem Weg zu einem ganz anderen, viel sanfteren Moment an diesem Abend. Vogel und Herzer führen uns dahin. Ich spüre ihren Atem an meinem Hals. Wir drehen uns weiter im Uhrzeigersinn.
Durch den im Talkessel verbliebenen Dorfkern mit den Fach werkhäusern wurden nach dem Krieg breite Schneisen geschlagen. Im 150. Todesjahr Friedrich Schillers wurde seine Alma Mater gesprengt, um einer Innenstadt-Autobahn Platz zu machen. Fortan zerteilten fünf
LIEBE IN DER STADT
Auf dem Cover der Platte mit «A Whiter Shade of Pale» sieht man einen Kapitän und einen Rettungsring. Das Lied ist ein Zuhause, jeder Winkel, jede Note ist vertraut, so oft hat man es irgendwo gehört. Es bringt alles unter ein Dach: ein bisschen Bach im Orgellauf, Soul im Gesang, Soft-Rock in der Rhythmusgruppe. Schon in den muffigen Sechzigern muss dieses Lied eine Chance gewesen sein, die Damen zum Tanz aufzufordern, die gesellschaftlichen Abstandsregeln zu unterwandern und ihnen nahe zu kommen, sie zu berühren, ganz legal. Nur ein Tanz.
106 hatten die Übriggebliebenen entweder jedes Feingefühl verloren –oder, was bei Schwaben auch möglich ist, ihren Geschäftssinn zurück gewonnen. Man sah das Scheitern als Chance und sprengte, was ver blieben war, um Neubauten Platz zu machen. So wie das Herz der Stadt, den alten Marktplatz mit seiner Rathausfassade, die früher so prachtvoll erstrahlte wie das weltberühmte Münchner Rathaus. Boom. Alles aus radieren. So geht das seither. but the crowd called out for more «A Whiter Shade of Pale» ist der perfekte Slowsong. Perfekt für diesen Tanz, der darin besteht, dass zwei Umarmende sich langsam um sich sel ber drehen. Diesen einfachsten aller Tänze lernt man mit 12 Jahren bei Geburtstagspartys hinter heruntergelassenen Rolläden. Wenn man zu Kuschelrock-Songs im Dauerloop mit einer aufgeregten Handbreit Ab stand zu den viel grösseren und reiferen Mädchen dem Teenager-Dasein entgegenwankt wie eine Jolle aufs offene Meer der Liebe.
breite Flüsse aus Stahl und Asphalt das einstmalige Weinstädtchen. Zu rück blieben zwei Quadrate Innenstadt voller grauer Kästen. Als ob man für immer klarmachen wollte, dass hier niemals wieder eine Kultur er blühen, sondern Maschinen produziert werden sollten. Daimler, Porsche, Bosch, fertig.Seither gibt es da ein Tal mit 600 000 gutverdienenden Einwohnern, in der Mitte zwei Kilometer Shoppingmeile, genannt Königsstrasse. Karstadt & Co, Kette an Kette, wie in Hannover, Düsseldorf, Dort mund oder Essen. Wie in all den anderen Städten Deutschlands, deren Einwohner sich so sehr ihrer Herkunft schämen, dass sie das Gefühl haben, nichts von dem was sie dort schüfen, könnte je Wert haben. Das beliebteste kulturelle Zentrum Stuttgarts ist tatsächlich das DaimlerMuseum. Statistisch gesehen besucht es fast jeder Einwohner Stuttgarts einmal im Jahr.
Als man 1993 die Stadt im Zuge des unaufhörlichen Umbaus mit einer hochmodernen U-Bahn – dem «gelben Blitz» – versah, wurde eine der Innenstadtverkehrsachsen unnötig. Jene, die die Shoppingmeile mittig unterbrochen hatte. Plötzlich gab es einen Platz mitten in der Stadt. Weil die Stadtverwaltung nicht wusste, was tun mit dem neuen Schlossplatz, stapelte man auf das Loch ein paar riesige Klötze zu einer Art provisorischen Treppe. Städter begannen sich an der Freitreppe zu verabreden. Ein Sammelpunkt für die Jugend entstand. Es war der öffentlichste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Wer etwas in der Stadt zu tun hatte, musste hier vorbeikommen. Alle Arten von Menschen trafen zusammen. Gleichzeitig wurde das Stadtleben zu einem Theater, das man von den Stufen der Treppe aus beobachten konnte. Aus Versehen hatte die Stadt ein Herz bekommen, und unvorhergesehenerweise entwickelte sich ein Kulturleben, und Stuttgart brachte plötzlich sogar Pop stars wie Max Herre, Freundeskreis und die Massiven Töne hervor. Zufällig genau, als ich ein Teenager war. 2002 wurde die Freitreppe abge rissen. Kurz davor hatte ich die Stadt verlassen. The room was humming harder Ich ziehe sie etwas näher an mich. Sie lässt es zu. Sie kennt mich ja seit 15 Jahren, mindestens. Ich weiss, an welcher Schule ihr Vater un terrichtet hat. Ich kenne sicher die Hälfte ihrer alten Freunde. Meine erste Freundin war eine Klasse über ihr. Wir wissen so viel übereinander. Ich fand sie schon mit 18 sehr anziehend. Die lustigen Mandelaugen. Sommersprossen und helle Haut.
STUTTGART TANZT ENG 107
108 as the ceiling flew away Um uns herum nur Tanzpaare. Zwei- oder dreihundert Men schen sind in diesem niedrigen Saal mit den schwarzen Wänden. Die Hälfte davon dreht sich langsam umeinander, ineinander versunken.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat jeder hier die Taschen voll mit Geld. Und wenn es nur der Fünfziger von Oma ist. Die Leute sind gut angezogen, selbst wenn sie aus Stuttgart sind. Wobei, das sind sie ei gentlich gar nicht. Die, die hier heute Abend sind, die kommen aus al len Teilen der Welt eingeflogen. Nur einmal im Jahr kommen sie zusam men. Seit fünfzehn Jahren. An der Engtanzfeier.
Er schmeisst rundenweise Shots. Am Ende sind 200 Euro verfeiert.
Die Trümmer Stuttgarts bilden den höchsten Berg der Stadt. Am Gipfelkreuz des Monte Scherbelino, offiziell «Birkenkopf», schaute ich nachts nochmal auf die Lichter im Tal. Wie so viele, die dann nach Berlin, München oder London ziehen, um dort zu suchen, was man in Stuttgart nie zu finden glaubt: echtes Leben. Oft allerdings finden sie dort entweder gar nichts oder Düsseldorfer, Essener oder Hannoveraner, die das Gleiche suchen. Das wiederum treibt die Stuttgarter so weit, dass man davon ausgehen muss, dass, wenn man am Südpol einem Menschen begegnet, er aus Stuttgart kommt. Stuttgart leidet an einem quasi-afri kanischenMeinBrain-Drain.erweiterter
Der Beat schleppt weiter. Der Bass, der heisere Orgelsound. Am langen schwarzen Tresen neben dem Eingang am anderen Ende ist keine Lücke frei. Ich sehe Martin, er ist jetzt ein Doktor mit einer kleinen Beraterfirma.
When we called out for another drink the waiter brought a tray
LIEBE IN DER STADT
Freundeskreis umfasste vielleicht zweihundert Menschen in meinem Alter. Ich kann keine zwanzig von ihnen aufzählen, die noch in der Stadt sind. Die Gesellschaft hat sich in ihre Einzelteile aufgelöst. Heimat besteht aus Menschen und Orten. Und wie brutal meine Heimat ständig umgebaut wird, zeigt sich am mehrjährigen Wutausbruch der Bevölkerung anlässlich Stuttgart 21, der kompletten Umpflügung der zentral gelegenen Bahnhofsgegend. Es ist ein bisschen wie nach dem Krieg, wenn ich manchmal nach Hause komme. 90 Prozent meiner Generation sind wie ausgelöscht.
109 And so it was that later as the miller told his tale that her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale Ihr Kopf löst sich von meiner Schulter, richtet sich auf, sie lehnt sich etwas nach hinten. Sie hebt ihre Lider und blickt mich von unten herauf direkt an. Sie lächelt ein bisschen. Die Lippen öffnen sich. Ihre grünen Augen glänzen. Ihr ganzes Gesicht leuchtet. Ich spüre, dass die anderen um uns rum bemerken, was hier läuft.
Mir war das schon einmal passiert. Zwei Jahre davor, 2009, mit 29, ver wirrt vom fehlgeschlagenen Berufsanfang, war ich auf der Engtanzfei er gestanden. Zwischen all meinen Freunden, die immer noch am Warten waren, dass aus mir mal wirklich was wird. Überall Drinks, Gin Tonic, in Strömen, wie immer. Die Fragen, wie es denn laufe, wo ich grade lebe.
Sie war ja sowieso weit weg. Grade zurück aus den USA, dabei, sich zu installieren in Berlin oder so.
STUTTGART TANZT ENG
Ich hatte danach mein Jahr 2012 allerdings komplett in den Sand gesetzt, liebesmässig. Ich war um die halbe Welt gereist, aber nir gendwo hatte es gefunkt. Sowieso, ich hatte zu viel gearbeitet. Vielleicht lag es daran. Vielleicht war ich mit 32 Jahren auch auf Abwege gekom men, und die Frauen spürten das, dass ich keine Zukunft hatte, mit mein er Schreiberei. Ich hatte existentielle Zweifel. Keine gute Grundlage. Als ich dann dabei war, mich auf die Heimkehr zur Familie an Weihnachten vorzubereiten, hatte ich plötzlich ihr Gesicht vor meinen Augen. Wie ein Licht am Ende des Tunnels. Ein bisschen ist Heimat ja auch der Ort, wo die Früchte tief hängen. Ich wollte sie.
Erst vor ein paar Tagen ist sie mir wieder in den Sinn gekommen. Plötzlich. Dieser weiche, lange Tanz letztes Jahr. Kurz vor Ende der Feier, irgendwann morgens um drei oder vier, bevor Grant Green mit «Idle Moments» jedes Jahr den Abend abschliesst und das Licht angeht. Ein kurzer Kuss. Ich war im Rausch des Abends gewesen, es war einer dies er Momente, in denen das erlaubt ist wie an einer Silvesterparty mit 15. Ich hatte gar nicht darüber nachgedacht. Einfach ganz freundlich geküsst.
Ich hatte nichts Gutes zu erzählen. Trennung. Kündigung. Ich hielt also lieber die Klappe. Es war eng. Ich bekam das Gefühl, zwischen all den glücklich tanzenden Paaren zermahlen zu werden. Diese Lieder, meine Güte. Emotionen ohne Ende. André Herzer liess Jeff Buckley laufen. Spiritualisierte diese selige Stuttgarter Meute. Liess sie Hallelujah singen und damit inbrünstig diesen Abend preisen. Ich jedenfalls war ganz alleine.
LIEBE IN DER STADT
«Oh, das ist toll.» Sie sah mich interessiert an. Blaue, grosse Augen, blonder, modischer Topfschnitt. «Ich wollte immer Journalistin werden. Deswegen war ich auch so fleissig in der Schule. Viel zu fleissig. Kannst du dich erinnern, wie ich immer gelernt habe und nicht bei dir und dein en Freunden bleiben konnte abends?»
Und schöne Frauen sind eigentlich alle bekannt und vergeben. Eine schlanke Kurzhaarige, die durch die Menge schwebte. An mir vorbei. Sie duftete.Zwei, drei alte Bekannte flüchtig begrüssend, hatte ich mich in ein en Seitengang verdrückt. An eine Wand gelehnt, lauwarmes Getränk genippt. Die Schöne kam in den Gang. Ich folgte ihr schüchtern mit den Augen, sie blickte kurz zu mir, blieb plötzlich stehen.
Ich«Hannes!»hattekeine Ahnung, wer da vor mir stand. «Ich bin’s, Sophie!» «Wow!» brachte ich hervor. «Schön, dich zu sehen.» «Ja genau! Wir haben uns sicher seit 10 Jahren nicht gesehen. Was machst du so?» Sie strahlte, sichtlich erfreut. Einfach jetzt keinen Fehler machen. Behalt deine Sorgen für dich. Sie hat ein leichtes Seidenkleid und dazu Stiefelchen an diesen zwei tollen Beinen. Sieht super aus. Sie kennt dich tatsächlich. Los jetzt. «Hey! Alles klasse! Ich lebe grade in Zürich. Ich hab Wirtschaft studiert und bin Journalist geworden.»
110 Da sah ich einen Engel. Was eigentlich an diesen Feiern nicht passieren kann, weil ich ungefähr die Hälfte aller Anwesenden kenne.
Plötzlich wird mir klar, wer da vor mir steht. Das Mädchen, das ich mit 14 Jahren in meinem Viertel kennengelernt hatte. Sophie, dieses hübsche Wesen, wegen dessen ich zu der Party gegangen war, an der sie dann zu früh nach Hause ging, und ich dann mit ihrer Klassen kameradin zusammenkam, die meine allererste Freundin wurde. Ich hatte Sophie immer anziehend gefunden. Aber sie war anscheinend immer auf dem Weg zum Geigenunterricht. Unerreichbar. «Wollen wir tanzen?», fragte ich. Sie nickte. Es ist, als ob wir durch einen Zeittunnel fahren würden. Stundenlang. Links «Junimond» von Ton Steine Scherben. Rechts Al Greens zart vibrierendes Soul-Falsetto wenn er seufzt «How can you Mend a broken heart». Dann «Purple Rain». Bei «Eternal Flame» von den Bangles dreht Herzer die Regler runter, und der Saal singt. Damit das nicht ausartet, kontert Vogel mit dem elegant en «Funny How Time Slips Away» von Joe Hinton. Alles verschwimmt. Meine Freunde verabschieden sich flüchtig. Kein Problem, wir kennen
111 uns ja gut genug. Sophie und ich tanzen, drehen uns. «Sollen wir zur Aussichtsplatte?», frage ich sie und bin sehr zufrieden, dass meine Mutter sich aus unerfindlichen Gründen diesen BMW Sportcoupé gekauft und ihn mir heute geliehen hat. Nachts, wenn man die Bebauung nicht sieht, ist das Lichter meer im Tal wunderschön. Wie ein unlogisches Universum. Die Aussichtsplatte an der Alten Weinsteige ist autotauglich. Die Heizung läuft, rötliche Innenbeleuchtung, unten glitzert die Stadt. Ringsherum ein bür gerliches Wohngebiet im seligen Weihnachtsschlaf. «Weisst du, ich war immer verknallt in dich als Teenager», sagt sie und schaut auf die Lichter. «Du warst bloss zu wild für mich.» In mir springt etwas auf. Ich atme durch. Ich fasse sie am Kinn, wir kommen uns näher, und ich hatte in diesem Moment das Gefühl, als habe alles in meinem Leben plötzlich Sinn gehabt. Sogar meine Trennung, weil erst dadurch war ja nun Platz für uns. Wir küssen uns, und mir wird klar, das ist die Geschichte unseres Lebens, ich werde einst in einem sonnigen Garten mit Apfelbäumen unseren Enkelkindern erzählen, wie sich die Jugend liebe fünfzehn Jahre später erfüllt hatte. Sie lag halbnackt auf dem Beifahrersitz. «Kommst du zu mir?», fragte sie. «Ich habe ein Zimmer bei meinen Eltern im Keller.» Wir fuhren am Fernsehturm vorbei, oben am Rand des Talkessels. Vor meinem geistigen Auge sah ich unser Glück beginnen. Ich erkannte, dass wir fortan so viel Zeit hatten. Wieso jetzt etwas überstürzen? «Ich hol dich morgen ab», sagte ich. Ich weiss noch, dass sie erstaunt schaute. Als wir uns im Licht des nächsten Tages sahen, war plötzlich alles anders. Wir tranken einen Kaffee. Gingen in den Zoo. Nichts mehr. Aus. Ich brauchte ein halbes Jahr, um das zu verdauen. Es war mir eine Lehre. Dieses Jahr, 2012, bin ich der Erste auf der Engtanzfeier. Gut angezogen. Bargeld abgehoben. Ankunft kurz vor 22 Uhr. Mein Plan steht. Hoffentlich ist sie da. Veranstaltungsort ist das ehemalige Amerika haus. Einer dieser Klötze in der Innenstadt, gleich an der sechsspurigen Theodor-Heuss-Strasse, einer dieser Innenstadtschneisen. Es ist eiskalt, Autos rauschen vorbei, niemand auf der Strasse. Die Tür ist noch zu. Diese Party findet man nicht auf Facebook, sie steht in keinem Veranstal tungskalender. Jedes Jahr gibt es angeblich zweihundert Foto-Flyer, die André und Andreas an Bekannte verteilen. Ich kann mich nicht erin nern, je einen gesehen zu haben. Diese Feier entsteht aus Telefonaten zwischen Freunden.
STUTTGART TANZT ENG
Ein paar Monate vor Weihnachten tauchen in Stuttgart jeweils Gerüchte auf, wo die Engtanzfeier diesmal stattfinden wird. Denn seit
der ersten Engtanzfete mit romantischer Musik am 25. Dezember 1997 im zimmergrossen Falafel-Imbiss «Vegi Voodoo King» kämpfen die beiden Veranstalter mit Platzproblemen. Die ersten Gäste tanzten draussen auf der Strasse im Schnee. Als Andreas Vogel und André Herzer 1999 in einem wohnzimmergrossen ehemaligen Stripclub den Club Hi eröff neten, reihte der Platz bei weitem nicht für alle. Man beschloss, zwei Tage durchgehend Engtanzfeiern zu veranstalten. Ich erinnere mich an Jackenberge vor der Tür. Die weinroten Teppichwände, die kleinen Separées, bei denen man die Vorhänge zuziehen konnte, um ungestört zu sein. Es war so eng, dass man gar nicht mehr von tanzenden Paaren sprechen konnte. Die Menge wurde eine bebende, sich aneinander reibende Masse, so wie diese einzelligen wuchernden Pilze. Jedes Jahr wurde die Feier ein bisschenIchgrösser.habeFreunde, die die Engtanzparty meiden wie die Pest. Die das ekelhaft finden. Dass alle sich weichgeklopft von Weihnachten ein fach in die Arme fallen würden. Ringelpiez mit Anfassen. Ein inzestuöses Loveshag, bei dem lauter Leute miteinander tanzten, die sich seit Geburt kennen würden. Ausgehen, das sei doch Suchen, hier aber würde man nur finden, was man kenne. Genau darum geht es, finde ich. Die Tür geht auf, und wie jedes Jahr beginnt um Punkt 22 Uhr die Party mit dem Song, mit dem die letzte aufhörte. Grant Green, «Idle Moments». Nach und nach kommen die Gäste. Zuerst die Paare. Dann ein paar Freunde. Noch mehr Freunde. Tina kommt mit ihrem Freund rein. Sie wohnt eigentlich in München. Die beiden haben einen Babysitter gefunden. Das ist ziemlich hart an diesem Abend. Da sucht eine ganze Generation Babysitter. Stück für Stück setzt sich unsere alte Ge meinschaft wieder zusammen. «Woher kennen wir uns noch mal? Aus dem ‹Hi›? Oder von der ‹Freitreppe›?». Oder «Ach, das ist deine grosse Schwester? Ja wir waren mal zusammen im Urlaub.» Ich achte darauf, nicht zu viel zu trinken. Hoffentlich kommt sie. Für ein, zwei Stunden ist der ganze Saal nur aufgeregt am Schnat tern. Erstmal müssen alle sich begrüssen. Die DJs haben keine Chance. Dann kommt die rituelle Ansage. Andreas Vogel, der aussieht wie ein Studienrat im Jahr 1982, hebt das Mikrofon: «Willkommen zur Engtanz feier 2012. Es darf getanzt werden.» Langsam geht es los. Mein erster Tanz ist mit Jelena, Klassen kameradin meiner ersten Freundin. Wir waren nie so eng, aber wenn man sich so lange kennt, spielt das irgendwann überhaupt keine Rolle mehr, ob man vor zehn Jahren Freund oder Feind war. Ich erfahre, dass sie in Brasilien als Krankenschwester gearbeitet hat und dort zwei Kin-
LIEBE IN DER STADT
112
Dennoch: Für ihn bin ich ja derjenige, den er zuletzt sah. Und er ist es für mich, auch wenn wir beide nicht mehr sind, was wir voneinander
STUTTGART TANZT ENG
113 der bekam. Erstaunlich. Ich hatte sie völlig unterschätzt. Mein nächster Tanz ist mit der schönen Camille. Die ist seit etwa 12 Jahren mit meinem Schulfreund Noah zusammen. Ihr erster und einziger Mann. Die Engtanzparty ist für sie eine einzigartige Gelegenheit. «So viel Körperkon takt kann man doch sonst nie mit anderen Männern haben, ohne dass die gleich mehr wollen», flüstert sie mir ins Ohr. Es gibt einen Anteil Erotik in den meisten Freundschaften, den man sonst nie ausleben kann, denke ich. Das ist allerdings nicht ungefährlich. Jedes Jahr gibt es an dieser Feier Eifersuchtsdramen und Trennungen. Einmal verlor ich beinahe einen meiner engsten Freunde, weil ich eine Runde zu viel mit seiner Angebeteten eingelegt hatte. Mittlerweile hat sich das Engtanzen ein bisschen ausgebreitet. In Hamburg und Hannover gibt es weihnachtliche Engtanzfeiern. Und in Berlin ist es ein grosses Ding geworden in den letzten zwei Jahren. Ein paar meiner Stuttgarter Freunde haben mir von den Praktikantinnen und Studentinnen erzählt, die im Hinterhof des «Picknick Club» nach amourösen Abenteuern suchen würden. Ein Freund von mir hat sich darauf spezialisiert. Das Prinzip funktioniere so gut, weil es so klare Regeln gäbe. Statt sich wie in einer Disco jedes Mal neu zu erfinden und ungeheuer innovativ sein zu müssen, um anderen näherzukommen, fragt der Mann bei Engtanz die Frau. Man trete über die Schwelle solch einer Veranstaltung, und schon gälten eben ganz andere, ganz klare un geschriebene Regeln. Das sei ein erfolgversprechendes Prinzip für unsere verwirrte Multioptionengeneration. In Stuttgart geht es um viel mehr als amouröse Abenteuer. Beispielsweise tanze ich mit Thomas. Ein Tanz für ein ungestörtes Gespräch unter vier Augen, völlig normal an diesem Abend. Thomas macht grade eine schwierige Phase durch, weil er seit zwei Jahren keine Stelle findet und immer noch an der Uni vor sich hindümpelt. 1000 Euro im Monat. Und sein Vater ist krank. Nie kann man so offen sprechen wie unter alten Freunden. Man kann kaum mehr auseinander, so viel hat man schon geteilt.
Sie ist gekommen. Sie hat ein grünes Wollkleid. Sie tanzt die ganze Zeit mit einem dürren Typ, den ich nicht kenne. Ich beginne mich diskret umzuhören. Hier kennt jeder jeden. Der Typ ist ihr Exfreund. Ich gebe ihnen noch ein paar Minuten. «Ah! Die Degerlocher sind da», grüsst mich Noah. Ich muss lachen. Degerloch ist ein Stadtviertel, aus dem viele von meinen Freunden kom men. Keiner von ihnen wohnt mehr dort. Seit mindestens zehn Jahren.
LIEBE IN DER STADT
Ich halte sie, schaue sie an, und um uns herum scheinen die Men schen zu leuchten. Die Tänzer versinken immer mehr ineinander, es ist, als wäre es still, und es ist, als ob die Lichter der Diskokugel in der Luft anhalten würden, und die Musik ist einfach nur noch Wärme und Licht,
Links tanzen Noah und Ali miteinander, und vielleicht erzählt Noah ihm grade von seinen Absichten mit Camille. Und jetzt kann er ihr dabei zusehen, wie sie mit Tim tanzt. Übrigens schon zum zweiten Mal.
«Ist eigentlich irgendeiner in den letzten Jahren gestorben?», frage ich Astrid. «Nein, alle gesund. Komische Frage. Wobei.» Wir drehen uns. Astrid ist hier geblieben. Es tobt ein stiller Streit zwischen jenen, die gin gen, und jenen, die blieben. Es geht um zwei Lebensentwürfe, um einen Statuswettbewerb. Am niedrigsten angesehen sind die Heimkehrer. Viel zu schnell kommt bei ihnen der Verdacht auf, sie hätten es anderswo nicht hingekriegt, seien in der Ferne beruflich gescheitert.
Tim war immer der Beau aus unserem Freundeskreis. Unser Lied endet. Ich lass Astrid los, bahne mir meinen Weg durch die Menge und bitte sie um einen Tanz. Endlich. Sie sagt Ja. Als ich die ersten Orgeltöne höre, ihre Wangen spüre, schlägt mein Herz ein bisschen mehr. Neben uns tanzen Noah und Camille. In ihren Gesichtern liegt pure Zufriedenheit. Zwölf gemeinsame Jahre. In sechs Monaten werde ich auf ihrer Hoch zeit stehen, Blumen werfen. Wir drehen uns. Ich sehe Leanne und Thomas. In zwei Monaten wird er mir von der Schwangerschaft erzählen. She said, «There is no reason and the truth is plain to see»
114 denken. So ist das in diesem ganzen Saal, fällt mir auf. Hier steht ein Stuttgart wieder auf, das längst nicht mehr existiert. Die Gespräche set zen sich dort fort, wo sie letztes Jahr endeten. Es ist wie ein Daumen kino im Jahrestempo. Und während sich diese Gemeinschaft, die sich für das wahre Stuttgart hält, Jahr für Jahr langsam fortentwickelt, bewegt sich das wirkliche Stuttgart in eine ganz andere Richtung, wird es von ganz anderen Menschen gestaltet, als jenen, die hier sind. Es ist wie ein Raumschiff, das sich immer weiter vom Heimatplaneten entfernt. Astrid ist mein Trick. Höflich bitte ich sie um einen Tanz und schiebe sie in die Nähe des grünen Wollkleides mit dem Ex-Freund. Astrid und ich sind ein bisschen formal miteinander. Obwohl sie mir gerade erzählt, dass sie ihren allerersten Stehblues anscheinend mit mir getanzt habe. Mit elf, auf einer Freizeit. Ich schiele nach meiner Partie. Sie schaut herüber. Ich zwinkere ihr zu. Sie zwinkert zurück.
Um uns herum ist mein halbes Leben versammelt. Unser halbes Leben. Meine Freunde, mit denen ich aufwuchs. Ihre Freunde, mit denen sie aufwuchs. Gibt es ein Zurück, frage ich mich inmitten dieses sich im mer wiederholenden Abschlussballes. Ist das überhaupt möglich? Oder kann man nur immer weiterziehen? Ich will nicht noch mal denselben Fehler machen wie damals. and although my eyes were open they might have just as well've been closed Ihre Lippen kommen näher. «Lass uns gehen», sage ich. «Ganz unauffällig. Erst ich, dann du, okay?» And so it was that later as the miller told his tale
115 und die Zeit bleibt stehen. Ich gehe nach Stuttgart zurück, flüstert sie. Sag es niemandem. Sie lächelt. But I wandered through my playing cards and would not let her be one of sixteen vestal virgins who were leaving for the coast
STUTTGART TANZT ENG
Als sie zu mir kommt, in die Kälte, draussen vor der Tür, da wird mir plötzlich klar, dass sie und ich hier keinen Platz mehr ha ben, an den wir jetzt gehen könnten. that her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale And so it was that later as the miller told his tale that her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale
116 RUBRIK EVE FAIRBANKS längstistWasWassernotwirfürchten,inKapstadtRealität.
Viele Teile des Paradieses gibt es nun nicht mehr. Kapstadt setzt sich jetzt aus Beige und Kalkfarben zusammen, der Farbpalette
Einige akzeptierten sie schmerzvoll als Tatsache der Natur und der menschlichen Rasse.
Ich dachte an diese Regeln, als ich im März nach Kapstadt flog, der zweitgrössten Stadt Südafrikas. In den letzten drei Jahren hat Kap stadt besonders unter einer ausserordentlichen Dürre gelitten, die nur etwa einmal in 300 Jahren vorkommt. Und die durch den Klimawandel begünstigt worden ist, wie die meisten Analysten bestätigten. Die Veränderung, die die Stadt in ihrer physischen Erscheinung als Kon sequenz der Dürre durchläuft, ist frappierend. Das Kap ist vom Rest des Landes abgetrennt durch eine 1500 Meter hohe Bergkette. Im Nord osten sieht die Landschaft aus wie in den Safari-Broschüren: trocken, heiss und dschungelartig. Aber im Becken zwischen der Bergkette und dem südwestlichen Ende des afrikanischen Kontinents ist das Klima aussergewöhnlich, wissenschaftlich als «mediterran» bezeichnet. Wenn man von den Bergspitzen nach Kapstadt hinunterschaut, auf eine Vier millionenstadt, die sich durch elegante Architektur und schroffe Hän ge hervortut, dachte man bis dato vielleicht an Griechenland, wenn Griechenland noch träumerischer wäre: elfenbeinfarbene Häuser, ko baltblaues Meer, Olivenhaine, die opulente Landschaft durchwoben mit den goldenen Bändern und glänzenden Früchten der Weinberge.
Als ich vor neun Jahren nach Südafrika zog, hörte ich als einen der ersten Ratschläge von den Einheimischen, ich solle mich beim Auto fahren nicht zu sehr auf das Navi verlassen. Das Land habe zwar Regeln für die Navigation, sagte man mir, aber manche seien zu kompliziert für einen Computer und nur intuitiv zu befolgen: Durch dieses Viertel könne man zwar fahren, jedoch nicht in der Nacht. Durch jenes eben falls, aber nur mit geschlossenen Fenstern, vor allem als weisse Person. Es waren oft weisse Südafrikaner, die vom Navi redeten, aber viele Schwarze stimmten ihnen zu. Es sei traurig, sagten alle; traurig, dass das einst geteilte Land anscheinend die Vergangenheit noch nicht voll ständig hinter sich gelassen habe. Aber so war es. Das waren die Regeln.
117 REPORTAGEN STÄDTEVERBAND
Gespeist von fünfmal mehr Regengüssen als Südafrikas dürre Zentralregion, ist das Kap eines der vielfältigsten Blumenreiche der Erde, voller riesiger rötlicher Blüten. Dazu Wolkenformationen von aufge blähten weissen Gewitterwolken bis zu Nebel, der fliesst wie ein Fluss, und Dunst, der wie ein Wasserfall vom Tafelberg hinunterströmt, jener Felswand, die über der Stadt aufragt; das Paradies scheint hier fast Rea lität geworden zu sein. Oder schien es bis dato zumindest.
118 RESSOURCEN der Dürre. Die Rasenflächen und Gärten sind tot. Die riesigen Town ships der Stadt – Orte, reserviert für people of color unter dem Apart heid-Regime – unterschieden sich früher von den reichen Quartieren, die sich auf der Atlantikseite des Tafelbergs hinunterrollen, nicht nur geografisch, bequem versteckt hinter dem Berg, wo sie kaum zu sehen sind. Sondern auch durch ihr eigenes, weniger wünschenswertes Mikro klima, sumpfig und dem Wind ausgesetzt, anfällig für Überschwem mungen bei nassem Wetter und in den trockenen, windigen Sommern in einer Smogwolke versteckt. Am Staub, angehäuft in kleinen Verwehun gen in den Rinnsteinen, konnte man früher erkennen, wenn man in eine «schlechte» Gegend kam. Heute liegt der Staub überall. Touristen lieben Kapstadt. Der Ort hat nach den Hamptons die zweithöchste «saisonbedingte Fluktuationsrate von Multimillio nären» (will heissen: Sommertourismus in Superjachten). Die Stadt ist chic: Technologie-Startups und hippe Restaurants mit Namen wie «The Bombay Bicycle Club» gibt es überall. Sie ist wohlhabend: Neun von zehn der reichsten Viertel Südafrikas befinden sich hier. Ich vermute manchmal, dass Touristen herkommen, weil Kapstadt in Afrika liegt und daher exotisch ist, sie aber gleichzeitig den Kontakt zur schwarzen Bevölkerung grösstenteils vermeiden können. Bantusprachige waren noch nicht hier, als die Europäer ankamen. Sie migrieren nun als Ar beitslose aus ländlichen Gegenden gen Osten in die Stadt, aber Kap stadt hat mit 39 Prozent noch immer einen unüblich kleinen schwarzen Bevölkerungsanteil.
42 Prozent der Einwohner sind coloreds, gemischt rassige Südafrikaner einer multikulturellen, nicht verortbaren Her kunft. Der internationale Flughafen begrüsst seine Besucher mit wand hohen Fotos von Weinbergen, Paraden, Jazzmusikern, staunenerregenden Stränden und Zebras – aber es gibt auffällig wenige Bilder von schwar zen Dörfern und den Stadtlandschaften, die den Rest des Kontinents ausmachen.Innerhalb
Südafrikas verhalf dieses Bild Kapstadt zu einem zweifelhaften Ruf: bekannt als Ort für Südafrikaner – und Ausländer –, die nicht offen rassistische Dinge sagen wollen, aber gedenken, an ihren Privilegien festzuhalten. Obwohl der Anteil der weissen Bevölke rung nur 16 Prozent ausmacht im Vergleich zu acht Prozent landesweit, ist diese doch viel sichtbarer hier; die Bars an vornehmen Avenues und die wie Diamanten glitzernden Strandanlagen werden fast ausschliess lich von weissen Gästen frequentiert. Geschichten unverhohlener Dis kriminierung von schwarzen Menschen in Restaurants gibt es in Hülle und Fülle: Letztes Jahr wurde ein Parkplatz in einer Hochpreisgegend
119 WASSERNOT namens Clifton für 83 000 Dollar verkauft. Ich kenne Clifton. Es ist überfüllt, aber es gibt Parkmöglichkeiten. Irgendein Investor zahlte womöglich den Betrag, den zu erarbeiten eine normale südafrikanische Familie über 23 Jahre braucht, um das Privileg zu haben, sich nicht mit car guards – Parkwächtern – auseinandersetzen zu müssen, denjeni gen schwarzen oder farbigen Kapstädtern, die sich anstellen, um dein Auto für ein paar Cents zu bewachen.
Was los war, erklärte er, sei nicht nur eine Dürreperiode, sondern eine Art riesiges, ungeplantes, durchgeknalltes und phantastisches gesellschaftliches Experiment. «Ich hoffe, du bist bereit dazu, deine Wasserspar-Grenzen zu testen!», schrieb er mir. «Kein Tropfen verlässt die Wohnung, ausser durch die Toilette. Waschbecken und Badewanne
Ich liess mich von der Spar-Euphorie anstecken –es machte auch Spass Dies alles hilft zu erklären, warum es im Rest des Landes um die Dürre seltsam ruhig bleibt. Meine Freunde in Johannesburg reden kaum darüber, und es scheint sie nicht zu kümmern. «Geschieht ihnen recht, weil sie ihre Swimmingpools auffüllen!», war ein ätzender Kommentar, den ich hörte. Als der «Tag null» näherkam, an dem die Verwaltung die Hähne zudrehte, schrieb das Magazin National Geographic warnend: «Vier Millionen Menschen müssen Schlange stehen, überwacht von bewaffnetem Sicherheitspersonal.» Die Südafrikaner ausserhalb von Kapstadt gingen davon aus, dass dies die ausgleichende, gerechte Strafe sei. Der Gedanke an eine Person, die 83 000 Dollar bezahlt, nur um einem farbigen Parkwächter aus dem Weg zu gehen, und dann für einen Eimer Wasser schwitzend vor einem Verteilwagen anstehen muss, war schon fast angenehm.
Ich schrieb meinem Freund Paul in Kapstadt, der in einem Apart ment in einem Viertel der gehobenen Mittelklasse wohnt, um herauszu finden, ob ich bei ihm unterkommen könne. Er willigte ein – aber nur, wenn ich verstehen wollte, was in seiner Stadt eigentlich vor sich ging.
Als ich einmal durch Johannesburg fuhr, sah ich eine Werbe tafel einer Kapstädter Immobilienfirma, die Südafrikaner zum «Semig rieren» aufforderte. Es war ein Wortspiel mit «emigrieren», jenem Verb, mit dem viele weisse Südafrikaner seit dem Ende der weissen Herrschaft nach 1994 drohen: dem Auswandern in ein weisseres Land. Für Kapstadt ergab sich daraus eine seltsame Schlussfolgerung: Hierher zu ziehen, war fast genauso gut, wie Afrika ganz zu verlassen.
Die Gruppenmitglieder, die aus verschiedenen Gesellschaftsschichten kommen, nennen sich gegenseitig «Wassermitstreiter». Für ihren nied rigen Wasserverbrauch, ihre «Brauchwassersysteme», «Tauchpumpen» und die seltsamen Vorrichtungen, die sie erfunden haben, um den Wasserverbrauch in ihren Häusern sinnvoller zu machen, geben sie sich gegenseitig digitale high fives, also Likes. Je verrückter und selbstge bastelter, desto besser. Monique und Clint Tarling, ein Paar, das mit seinen Kindern am Rand der Innenstadt lebt, zeigten mir eine «nach haltige Dusche», die sie aus einem 500-Liter-Tank und Holzpaletten gebaut hatten. Die neue Dusche steht auf der Eingangsveranda, aber daran stören die Tarlings sich nicht.
120 sind versiegelt. Die Waschmaschine verwende ich auf kleinster Stufe, und was herauskommt, fliesst in einen 25-Liter-Behälter für zusätzliche Spülung. Es ist vielleicht alles ein bisschen extrem», räumte er ein.
RESSOURCEN
Im vergangenen Jahr hat der Wasserverbrauch in der Stadt uner wartet um 40 Prozent abgenommen. «Eimerduschen» – oder das Wasser in einem Plastikbecken auffangen, um es wiederzuverwenden – ist nun die Norm. Geschirrspülen mit sauberem Wasser ist ein Luxus; Küchen riechen nach tagealtem Abwaschwasser. Leute stellen übergrosse Be hälter in den Hof, um Regenwasser zu sammeln, und ersticken dabei das wenige Gras, das noch wächst. Reiche Südafrikaner haben traditio nellerweise penible Sauberkeitsanforderungen, um sich abzugrenzen.
Nun sind sie bereit dazu, einem Besucher tagealten Urin in der Toiletten schüssel zuzumuten, um zu beweisen, dass sie nicht spülen, und es macht sie stolz. Körpergeruch ist kein Tabu mehr. Viele Frauen haben ihre Haarpflegeroutine radikal angepasst: Sie geben natürlichen Locken den Vorzug, um weniger waschen und stylen zu müssen, oder, wie mir eine Frau in einer Diskussion auf einer lokalen Facebook-Seite zur Dürrebekämpfung schrieb: «Ich experimentiere damit, meine Haare mit einem Pflanzenbestäuber leicht einzusprühen.»
Er und sein momentaner Gast würden nur ungefähr ein Fünftel der 50 Liter pro Tag und Person verbrauchen, die die Stadtverwaltung verfügt habe, sagte er. «Es ist mehr eine Herausforderung als eine Notwendigkeit», erklärte er. «Aber es macht auch irgendwie Spass!»
Clint baute eine alte Wurmfarm zum Filter um. Monique, die als Hausfrau ausgesetzte Kleinkinder aufnimmt – zwanzig in den letzten sechs Jahren –, entdeckte für sich, dass das Projekt von einer Notwendigkeit zur kreativen Neigung wurde, einer Sehnsucht nach Schönheit,
Auf der Facebook-Seite über die Dürre, die nun 160 000 Mitglieder zählt, gehört es zum guten Ton, sich gegenseitig anzustacheln.
Wir glauben oft, dass es lange braucht, bis «Normen» sich durchsetzen oder verschieben. Der Kothaufen eines Fremden an einem gutsituierten Ort fühlt sich wie ein Tabu an, wie ein grundsätzliches Zeichen, das dessen Entdecker nicht nur anwidert, sondern auch un sicher macht, als wäre die Umgebung vernachlässigt und beunruhigend unkontrolliert.
als Weisser in Zeiten der Apartheid aufgewachsen. 33 Jahre lang hatte er als Feuerwehrmann gearbeitet, bevor er in Rente
Ich liess mich von der «Wasserspar-Euphorie» Kapstadts an stecken. In der ersten Nacht musste ich glattweg würgen, als mein Freund Paul seine Hände in mein schmutziges Duschwasser steckte, um es für die Toilette herauszuschöpfen. Doch schon ein bis zwei Tage später, als ich bei einem Freund auf der Gäste-Toilette den Deckel öffnete und einen Scheisshaufen erblickte, quietschte ich fast vor Vergnügen. Noch nie war ich so erfreut, ein zuvor hinterlegtes Stück Kot in einer Toilette vorzufinden, die ich selbst gerade benutzen wollte.
Smit, ein stämmiger 60-jähriger Vorstadtbewohner mit einem TomSelleck-Schnurrbart, war einer der vier freiwilligen Administratoren der Dürre-Facebook-Seite. Beinahe ein Vollzeitjob. «Ich könnte meinen Swimmingpool von meinem Wasserhahn aus auffüllen und wäre noch immer unter der Obergrenze, die die Stadt gesetzt hat», sagte er mir.
Doch in Kapstadt wurde der Kothaufen zu einem Symbol von etwas ganz anderem: ein Bedeutungsträger für Verantwortung und Gemeinschaftssinn.Eswarmir anfangs unbegreiflich, wie die Regeln sich so plötzlich ändern konnten. Deon Smit half mir, eine Erklärung zu finden.
WASSERNOT
In einem Land voller Empfindlichkeiten, in dem ein Witz der einen Person die andere unakzeptabel verletzt, ist auf dieser FacebookSeite eine relativ seltene Art von öffentlichem Humor vorherrschend.
«Aber das ist falsch! Das Wasser, das ich nehmen würde, gehört je mand anderem.»Smitwar
Man macht sich ein wenig lustig über die Anstrengungen seiner Mit bürger. Eine Frau lud stolz ein Bild von ihrer Waschmaschine hoch, die sie an die Wand hochgeschraubt hatte, damit ein Schlauch das gebrauchte Wasser direkt in die Zisterne leiten kann. «Sieht aus wie eine Gaskam mer!», kommentierte jemand. «Die Chancen stehen gut, dass man beim Kacken von einer Waschmaschine erschlagen wird», sagte ein anderer.
121 von der sie selbst nichts geahnt hatte. Sie dekorierte die neue Dusche mit Farnen und wasserdichten Lichterketten. Magisch. Ihre Kinder duschen extra lange – das Wasser läuft in einem geschlossenen Kreis lauf –, nur um in der Dusche stehen zu können.
RESSOURCEN Illustration: Dario
ging. Ich fragte ihn, warum er sich den ganzen Tag der Facebook-Wasser spar-Seite und anderen erschöpfenden Missionen rund um die Was in Kapstadt widme, obwohl ihm das alles schreckliche Kopf schmerzen bereite. Als Kind habe er «zwei Wünsche im Leben gehabt», erklärte er mir in seinem Büro, während auf seinem ComputerBildschirm private Facebook-Nachrichten von Wassermitstreitern auf poppten. «Der erste war, Feuerwehrmann zu werden. Und der andere, mich in einem Projekt zu engagieren, bei dem ich etwas für die Gemein schaft tun«Diekann.»Dürre hat manche von uns gleicher gemacht» Bloss war in der Vergangenheit nicht klar gewesen, wer oder was «die Gemeinschaft» eigentlich war. Um die weisse Herr schaft aufrechtzuerhalten, hatte die Apartheid-Regierung behauptet, die schwarzen Territorien von Südafrika seien «souveräne Staaten», obwohl kein anderes Land sie anerkannt hatte. Manchmal sagen die Weissen in Südafrika heute noch «sie» und meinen damit schwarze und «schlechte» Menschen wie korrupte Politiker oder Kriminelle. Es ist in Ordnung, zu jammern: «Sie haben mein Auto gestohlen», bevor überhaupt klar ist, wer es gestohlen hat. Menschen aller Rassen haben immer auch Beziehungen mit einander geführt. Und sie teilten eine gemeinsame Erfahrung, wenn auch von verschiedenen Blickwinkeln aus. Es gab Smit eine gewisse Befriedigung, von der Dürre ange spornt, etwas Positives für eine grössere Gruppe Menschen zu tun. Dieses Gefühl beschlich mich bei manchen in der Stadt. Auf der Facebook-Seite reflektierte eine Frau namens Valerie darüber, dass die Dürre sie «aufmerksamer gemacht hat auf diejenigen, die sie umgeben … Es hat manche von uns gleicher gemacht.» Sie nannte es «demütigend und erhebend zugleich».
serproblematik
Dies wurde grösstenteils als furchteinflössendes Sze nario dargestellt. Doch in mir wuchs langsam das Gefühl, dass dies nicht nur eine Angst, sondern auch eine Phantasie war. In den Büchern berei teten die Grenzüberschreitungen den privilegierten Figuren ein selt sames Gefühl der Erleichterung. In Mein Verräterherz, das vier Jahre Forlin
Als ich anfing, zeitgenössische weisse Literatur aus Süd afrika zu lesen, fiel mir auf, dass die Zerstörung der Infrastruktur von Privilegierten ein wichtiges Thema war: der Untergang von Häusern, Farmen, Gärten und Swimmingpools bis hin zu der Zerstörung von Toren und Mauern durch Vernachlässigung oder Rache der historisch Benachteiligten.
Es könne vorhergesagt werden, dass die Reichen versuchen würden, sich aus «allen Unannehmlichkeiten herauszukaufen». Doch was ich über Kapstadt geschrieben hatte, brachte ihn dazu, sich zu fragen, ob nicht vielleicht die höheren Klassen auf eine Gelegenheit warteten, um ihren Nachbarn und sich selbst zu beweisen, dass es «wirklich so etwas wie eine Gesellschaft gibt».
Doch was, wenn es eine naturgemachte Entschuldigung gäbe, die Mauern des Absonderns und der Stille einzureissen und ein anderes Leben auszuprobieren? Wäre das wirklich so schlecht?
124 vor Ende der weissen Herrschaft publiziert wurde, sagt die Frau eines weissen Farmers, während sie über die Aussöhnung mit den Verwand ten seines Mörders nachdenkt: «Vertrauen kann nie eine Festung sein, ein sicheres Gehäuse gegen das Leben … Ohne Vertrauen gibt es keine Hoffnung auf NachLiebe.»derEinführung der Demokratie jedoch bauten sich sowohl reiche wie auch Mittelklasse-Südafrikaner Festungen: Hohe, mit Eisenspitzen bewehrte Mauern umgaben die Häuser. Viele dieser Häuser haben nicht einmal eine Klingel, um unbekannte Besucher ab zuschrecken. Stattdessen tragen sie ominöse Schilder mit einem Toten schädel oder dem Namen der Sicherheitsfirmen darauf. Verbringt man ein bisschen mehr Zeit mit den Reichen oder Weissen, merkt man, dass sie sehr wohl ein Bewusstsein von der Ver gänglichkeit ihrer «Festungen» haben. Dass diese nicht überleben können – oder sogarEinsollen.Freund aus der Nähe von Johannesburg sinnierte jüngst darüber, dass er und seine Frau «im tiefsten Innersten» wüssten, dass die Weissen in Südafrika mit Hunderten Jahren der Ungerechtigkeit «davongekommen» seien. Seine Frau würde das bloss niemals zuge ben oder ambivalente Gefühle ausdrücken gegenüber ihrem FünfZimmer-Haus oder ihrer abgeschotteten Lebensweise, aus Angst, sie würde sich zum «Ziel von Vergeltung» machen: Persönlich vermutet mein Freund «das Gegenteil». Nämlich, dass die Wut der Schwarzen sich genau deshalb entfacht, weil die Weissen sich weiterhin abson dern. Und still bleiben. Die Ansicht seiner Frau gewinnt meist, da sie als vorsichtiger gilt.
RESSOURCEN
Der Historiker Jacob Remes von der New York University, der menschliches Verhalten während Katastrophen untersucht, erklärte mir, dass während «plötzlicher» Katastrophen – wie etwa Hurrikanen oder Erdbeben – das Gefühl von Gemeinschaftssinn anschwillt, dies aber nicht unbedingt für langsamer geschehende Katastrophen gilt.
Das Interessante an der Quelle ist, dass sie einem ehemals ge mischten Viertel entspringt (heute ist es weiss) – die Art Viertel, die in Südafrika Spannungen hervorrufen, weil sogar Langzeitbesitzer von Häusern sich immer noch Sorgen machen, jemand könne rechtlichen Anspruch auf ihr Land geltend machen. Tatsächlich hatten Rawoots Vorfahren zwei Strassen weiter weg von der Quelle gewohnt. «Men schen von überall in den ‹Cape Flats› gehen hin», flüsterte Omar mir zu. Einige kamen von so weit her wie Mitchell’s Plain, einer Township, die mehr als zehn Meilen entfernt liegt. «Sie wollen zu ihren Gewässern zurück», sagte Omar.
In einer ehemals «weissen» Nachbarschaft namens Newlands ste hen täglich Tausende Bewohner von Kapstadt an, um an einer natür lichen Quelle Wasser zu bekommen. Abgesehen von einem kleinen Polizeihäuschen, das die Autos überwacht, wird die Quelle von keiner Autorität verwaltet. Ein 42-Jähriger Inder namens Riyaz Rawoot arbei tete 14 Monate an der Infrastruktur der Quelle – eine lange Vorrichtung aus Beton, Ziegelsteinen, Metallständern, PVC und Schläuchen, die das Wasser in 26 Ausläufe verteilt –, vor denen eine ausserordentliche Viel falt von Menschen mit Krügen wie auf einer Kommunionbank kniet. Rawoot erklärte, er habe die Infrastruktur gebaut, weil er einen ethni schen Hintergrund habe, bei dem es normal sei, «alles mit allen zu teilen».
Viele der reicheren Kapstädter wertschätzen ihre Gärten. Sie fungieren als mikroskopische Länder, sorgsam gepflegte, vermeint lich unantastbare Eden hinter ihren Mauern, gegenüber der Unbe ständigkeit des nun integrativen Gemeinschaftsraumes. «Diese kleine Rasenfläche», sagte Smit, «war mein kleines Königreich.» Als ich ihn fragte, ob er traurig sei, dass der Rasen gestorben ist, lachte er nur. «Ich muss mich anpassen», sagte er. «Er ist weg. Na und?»
125 Gegen Ende meines Besuches sagte Smit, er wolle mir seinen Rasen zeigen, eine erbärmliche Staublandschaft. «Du kannst dir nicht vorstel len, wie smaragdgrün er war», sagte er mir und schüttelte den Kopf.
Anwar Omar, den ich über die Facebook-Seite kennengelernt und dem ich gesagt hatte, wie sehr mir seine Dusche, bestehend aus einem Insektizid-Spray, gefiel, insistierte, dass ich mir die Quelle anschauen müsse. Er sagte, ich würde etwas sehen, das meine Meinung darüber, was in der Welt möglich sei, verändern würde.
Noch interessanter allerdings war eine andere Tatsache: Trotz allen Spannungen, trotz ihren Ängsten schienen viele weisse Bewohner die Stimmung an der Quelle zu geniessen. Und sie war tatsächlich unglaublich: Eine Massenszene, etwa 60 Menschen in Flip-Flops, Bademänteln,
WASSERNOT
126 Kopftüchern, schicken Privatschuluniformen und hautengen Kleidern, wirbelten um Harleys und halb defekte Fahrräder, schoben Wasser kannen in Kinder- und Einkaufswagen, selbstgebastelten Laufkatzen und auf Skateboards hin und her. Rucksäcke und leere Wasserflaschen lagen überall verstreut wie in einem Schulhauskorridor zur Mittagszeit. Ein 16-Jähriger machte einen Handstand nach dem nächsten für ein paar Leute. Rawoot verteilte derweil Eis am Stiel mit Traubengeschmack.
Die Stimmung war irgendwie ehrerbietig: Menschen glitten an mutig umeinander herum, deuteten leise an, welcher Ausfluss am meis ten Wasser hergebe, lenkten die Wagen von anderen, gaben gefüllte Kannen in organisch entstandenen Schlangen weiter. Heutzutage exis tiert der Traum von einer nicht hierarchischen Gesellschaft kaum noch; Anarchismus ist höchstens noch ein Sound für trashige Schülerbands. Doch an der Quelle kam das Gefühl auf, als wäre der Traum wiederbe lebt. Alles funktionierte auf einfache Weise, wie selbstverständlich. Abdulrahman, ein älterer Muslim, erzählte mir, er habe in den Town ships 48 Jahre lang als Getränkehändler geschuftet und Erfrischungs getränke verkauft. Er war es leid, zu verkaufen. Er wollte geben. Vor ein paar Wochen kam er zu der Quelle, um ein paar Kübel zu füllen, und ertappte sich dabei, wie er eine Stunde lang den Schlauch hielt. Zwei Tage später machte er die 10-Meilen-Wanderung noch einmal – nur, um den Schlauch zu halten. Er trage absichtlich Schuhe mit Löchern, «damit das Wasser abfliessen kann», sagte er mir und lachte laut dabei. Er war nass von Kopf bis Fuss. Als ich ihn fragte, warum er diese un bezahlte Arbeit mache, schaute er mich an und lachte noch einmal, so, als wäre es offensichtlich. «Alle sind gestresst», sagte er. «Alle hetzen.»
RESSOURCEN
Aber weil er den Schlauch halte, «können sich die Leute entspannen»! «Geht’s schnell genug?», fragte er eine fremde Blonde erwartungs voll. Von ihrem Hals hing ein Kreuz. «Es ist grossartig!», sagte sie. Er strahlte voller Stolz.
Rawoot, der die Rohre für die Quelle gebaut und sie auch bezahlt hatte, arbeitet normalerweise als Physiotherapeut. Er führte mich in sein «Büro» an der Quelle – ein Fleck ausgetrocknetes, mit Zigaretten übersätes Gras – und sagt mir, er liebe es, Menschen «vom Schmerz zur Freude» zu führen und sie dabei intimer zu berühren als ein nor maler Arzt. Schmerz, sinnierte er, «ist wie ein ausgetretener Pfad»: Es gibt vielleicht eine ursächliche Verletzung, aber nach und nach gewöh nen sich Körper und Seele an den Schmerz und spüren ihn auch dann noch, wenn die Verletzung offiziell verheilt ist. Rawoots Arbeit als Physiotherapeut besteht darin, seine Hände auf die Körper der Patienten
Als Kind, sagte er, sei er bestürzt und betrübt gewesen über Südafrikas «Nur für Weisse»-Schilder. Offiziell als «indisch» klassi fiziert, hatte Rawoots Grossmutter weisse Vorfahren. Er ging immer wieder mit seiner Tante zum Hauptbahnhof, wo sich Weisse, Coloreds, Inder, Chinesen und Schwarze in der Haupthalle mischten – jedoch alle in andere Richtungen gingen. Das Bild dieses brodelnden Kosmopoli tismus ist ihm geblieben. Das hatte er sich erhofft, als Nelson Mandela 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde. «Aber es geschah nicht wirklich», sagte er, zur Quelle hinblickend. Stattdessen leiden, 15 Meilen von Newlands entfernt, in Khaye litsha, der riesigen, in den achtziger Jahren erbauten und von Millionen Schwarzen bewohnten Township, die meisten Familien an Versor gungsunsicherheit und leben in Hütten. Cindy Mkaza, eine Pädagogin, die dort arbeitet und aufgewachsen ist, sagte mir, das Vergnügen an der Dürre habe ihre Schüler nicht wirklich erreicht. Die meisten von ihnen hätten sowieso weder einen Garten noch eine Dusche, und wäh rend Jahren war das unterversorgte Wassersystem immer wieder ohne Vorwarnung abgeschaltet worden. «Es ist, als würden sie sowieso schon dieses Dürre-Leben führen», sagte sie.
WASSERNOT
Die städtische Wasserbegrenzung kümmert sich nicht um die Grösse der Haushalte, ausser ein Bewohner unternimmt ein be schwerliches Berufungsverfahren. Und so leiden die Ärmeren verstärkt unter der Wasserknappheit. Weil sie häufig mit viel zu vielen Men schen in einem Haus leben, das eigentlich nur für eine Person gedacht ist. Shaheed Mohammed, der in einer anderen verarmten Township namens Athlone lebt, erzählte mir, dass sein Nachbar jeden Morgen um vier aufstehe, um für seine stattliche Grossfamilie Wasser in Eimern zu besorgen – bevor ein Gerät, das die Stadt an ihren Sanitärinstalla tionen angebracht hat und das das Wasser limitieren soll, sich einschal tet und den Hahn zudreht.
127 zu legen, sie zu mobilisieren und einzelne Körperteile subtil neu zu arrangieren, so erklärte er es mir. Nicht, um sie zu «reparieren», sondern um ihnen zu helfen, sich bewusst zu werden, dass in ihnen bereits die Fähigkeit schlummert, sich anders zu fühlen. «Es gibt eine neue Denkweise. Eine Verlagerung.»
Als ich Cindy Mkaza, der Pädagogin, von der Frau aus der Facebook-Gruppe erzählte, die gesagt hatte, sie sei «von Demut erfüllt», da sie sich um das Wasser sorgen müsse, lachte sie nur. Sie sagte, die
128
Bei Treffen einer Gruppe namens Water Crisis Coalition – Wasser krisenvereinigung –, deren Mitglieder in erster Linie People of Color sind, fielen ihm Kapstädter auf, die normalerweise nicht in die Town ships kommen. Weisse, Reiche, sogar ein Zionist war dabei. Historisch gesehen, reflektierte Mohammed, seien sie auf so viele Arten «an den Rändern. Aber wir haben immer von dieser Art der Einheit geträumt. Wir waren nicht sicher, ob die Rhetorik, die be hauptet, dass die Weissen die ‹Kolonialisten› sind, wirklich immer stimmt oder stimmen muss.» Mohammed war erfreut, zu sehen, dass seine neuen Verbündeten bereit dazu waren, Fähigkeiten und Mittel zur Verfügung zu stellen, die er und seine Gefährten nicht hatten.
Mohammed hingegen fühlte eine neue Art Neugier von Weis sen oder Nachbarn aus höheren Klassen, von denen er nicht viel Liebe gewohnt war. «Es gibt eine neue Denkweise. Eine Verlagerung», sagte er.
Nachbarn ihrer Mutter, die sich selten die drei Dollar leisten könnten, um mit dem Minibus-Taxi in die Stadt zu fahren, seien sich der Bemü hungen der reicheren Kapstädter nicht bewusst. Und sie war besorgt, dass die Mittel- und Oberschicht immer noch mehr Optionen hätte als die Armen, falls die Situation wirklich ausser Kontrolle gerate. Die Rei cheren könnten immer noch nach Wasser bohren – oder wegziehen.
RESSOURCEN
Die Dürre hat viel grössere Veränderungen gebracht als nur bezüglich der Einstellung zum eigenen Wasserverbrauch. Einer, der in einer reichen Gegend Autos bewacht, sagte mir, er sehe nun mehr Anwohner, die zu Fuss gingen – etwas, was die Wohlhabenden in ge wissen südafrikanischen Vierteln praktisch nie tun. An seiner Quelle machte mich Rawoot auf eine Gruppe von Trägern aufmerk sam, die Kleingeld verdienen, indem sie für andere Kannen herumschieben. In Südafrika kommen sich ungelernte Arbeiter, wie zum Beispiel Autobewacher, oft wegen Revierstreitereien ins Gehege. Doch hier sassen
«Diese Leute haben oft einfacher Zugang zum Internet. Sie können bei der Regierung Beschwerde einlegen und Vorschläge machen, wie grössere Haushalte behandelt werden sollen.» Und mehr noch als das: Mohammed war berührt davon, wie die Weissen und Reicheren seinen Nutzen anerkannten. Bei einem Treffen der Water Crisis Coalition lobten weisse Teilnehmer eine gigantische Demonstration, die People of Color in den 1960er Jahren abgehalten hatten, um gegen Rassen ungerechtigkeit zu protestieren, als Inspirationsquelle, wie Leute sich für Veränderung verbünden können. Eine weisse Frau sagte zu ihm: «Wir brauchen die Unterstützung der Cape Flats. Ohne die Unterstüt zung der Cape Flats sind wir nichts.»
130 die Träger, die gerade erst angekommen waren, geduldig auf dem Randstein und überliessen die Arbeit den Erfahreneren. «Sie behan deln sich spontan mit einer neuen Art von Respekt», sagte Rawoot. «Eine neue Kultur der Höflichkeit.» Es gibt eine menschliche Grundangst vor den Chancenlosen. Davor, dass sie eines Tages ihre Wut in Brutalität umsetzen, wenn es keine von oben auferlegte Ordnung gibt. Getreu dem Motto «Jeder kämpft für sich allein.» Diese Angst mag heute noch stärker sein als früher, in einer Zeit, in der Phänomene wie der Brexit oder Donald Trump einigen das Gefühl geben, der Volkswille sei gleichzusetzen mit selbstzerstörerischem Stammesdenken, und in der Eliten wie die Manager von Cambridge Analytica uns darüber informieren, dass Men schen nichts anderes sind als Bündel, die man nach Lust und Laune manipulieren kann, indem man ihre Ängste anzapft. Wir nennen es heute weise, anzunehmen, Menschen seien nur durch Eigennutz, Status und Angst zu motivieren. Es gilt als unklug, zu glauben, dass wir mas senhaft motiviert werden könnten durch den Wunsch, Respekt zu zeigen – oder durch Liebe.
RESSOURCEN
Ich traf mich mit Lance Greyling, dem Direktor für Wirtschaft und Investition in Kapstadt, weil er versprochen hatte, mir etwas über die Dürre zu verraten, was die wenigsten begreifen würden. Greyling gab zu, praktisch nichts vom Wort «Wasser» gehört zu haben, als er 2015 der Regierung beitrat. Die Niederschlagsmuster hatten während Jahr zehnten zwar langsam und stetig abgenommen, aber die Stromversor gungsengpässe schienen viel dringlicher. Dann wuchs plötzlich das Bewusstsein für eine Dürrekrise. Im Mai 2017 sprach die Bürgermeis terin ein Gebet am Fusse des Tafelbergs, um den Himmel um Wasser anzuflehen. Anthony Turton, ein führender Experte für Wassermanage ment, verkündete, Kapstadt brauche «höhere Gewalt». Gott oder irgend eine unglaublich riesige, fette, phantastische Maschine. Greyling, ein fröhlicher 44-Jähriger, lacht heute über die ver zweifelten Ideen, für die die Regierung warb, damit sie sich nicht nur darauf verlassen musste, dass die Bewohner von Kapstadt ihr Verhalten änderten: eine Entsalzungsanlage aus Saudiarabien, einen Eisberg aus der Antarktik herschleppen. Im November stellte die Stadt strategische Kommunikationsspezialisten ein, die sich einig waren, die beste Lösung sei, den Menschen höllische Angst einzujagen. Die Stadtbeamten gaben ihr sanftes und nettes Bitten auf, es solle doch Wasser gespart werden, und setzten auf Schwarzmalerei, Blossstellung und Gewalt. Sie setzten die Wasserbegrenzungsgeräte ein, von denen mir Mohammed später
Eine Regierung, die mit Gewalt führt und gleichzeitig ihre Beschränkt heit zugibt, statt das Blaue vom Himmel zu versprechen, ist eine er staunliche Abkehr von der Art, wie normalerweise heutzutage Politik gemachtDochwird.erfuhr die Regierung dafür nicht viel Anerkennung. Und wird es wahr scheinlich auch nie. Daniel Aldrich, der an der North eastern University die Widerstandsfähigkeit nach Katastrophen unter sucht, erklärte mir, dass der Verlust an Vertrauen einer Bevölkerung in ihre Regierung nach einer Katastrophe quasi typisch sei, ja sogar un vermeidlich. Aldrich hatte umfangreiche Feldstudien in Japan nach dem Tsunami von 2011 durchgeführt, der mitverantwortlich gewesen war dafür, dass sich Japan von einem der «vertrauensseligsten Länder ins
Wenn du den Versuch wagst, mehr als das tägliche Kontingent zu beziehen, dreht es dir einfach den Hahn zu. 2025 wird die Hälfte der Menschheit in Gebieten mit Wasserknappheit leben Techniker installieren nun jede Woche 2500 solche Geräte. Und im Januar verkündete die Bürgermeisterin, dass der ominöse «Tag null» nicht länger nur eine Möglichkeit, sondern eine schiere Gewissheit darstelle. Der Provinzgouverneur warnte vor drohender Anarchie. «Bis jetzt», fügte er traurig hinzu, «haben über 50 Prozent der Bewohner von Kapstadt die Bitten, Wasser zu sparen, ignoriert.»
WASSERNOT
131 erzählen sollte, landläufig bekannt unter dem Namen «Aqua-Loc». Sie wirkten sich auf Wassernutzer in etwa so aus wie ein Magenband bei Adipositas-Patienten:
Doch die Magenband-Wasserspargeräte funktionierten. Die Stadt behörden konnten erkennen, wie der Wasserverbrauch rapide sank. Aber Greyling sagte mir, die dystopischsten Behauptungen der Regie rung seien «nicht wirklich wahr». Der grösste Teil der Bevölkerung von Kapstadt hatte den Wasserverbrauch gesenkt, obwohl einige es nicht schafften, unter die Limitierung zu kommen. Die Folgerung, dass der «Tag null» eine Art gottgegebene rote Linie sei, nach der das Wasser in der Stadt «versiegen» würde, war auch nicht ganz präzise; der Tag stand nur für jene Höhe des Wasserspiegels im Stausee, unterhalb deren die Stadt beschlossen hatte, das Wasser noch aggressiver zu rationieren.
In gewissem Sinne waren diese Massnahmen äusserst mutig. Greyling sagte, die Botschaft, die die Regierung an die Öffentlichkeit habe senden wollen, sei auch gewesen: «Schaut, Leute, wir haben es nicht komplett im Griff. Es liegt genaugenommen in euren Händen.»
Doch verschwinde dieser Feind, suchten sich die Menschen, unglück lich beim Gedanken, den neuen Glauben in die anderen wieder aufgeben zu müssen, ein neues Ziel.
Als der Vorsitzende der führenden Partei in Kapstadt Anfang März verkündete, die Bewohner sollten die drastische Reduktion des Wasserverbrauchs feiern und der Tag null könne nun wohl abgewen det werden, kochten die Kapstädter vor Wut. Einige nannten die Re gierung dämlich, weil sie die aktualisierte Wahrheit verkündete, die es den Bürgern unter Umständen erlauben würde, wieder zu ihren trägen Gewohnheiten zurückzukehren. Andere fragten sich, ob die Krise eine reine Erfindung gewesen sei, um die Bevölkerung dazu zu bringen, höhere Steuern zu bezahlen. Einige liessen gar Drohnen über Kapstadts grösstem Stausee kreisen, um herauszufinden, ob er insgeheim voller Wasser war. (Er war es nicht.)
Laut Rawoot und einem Zeugen bezeichnete ihn ein Bezirksrat an einer öffentlichen Versammlung im März als «verrückt». Ein Professor, der eine soziologische Abhandlung über die Quelle verfasst hatte, sagte mir, viele Beamte «wollten und konnten nicht glauben», dass Rawoot seine Arbeit an der Quelle nur machte, um zu helfen. Sie waren überzeugt davon, dass er von jemandem Geld erhielt, um das Image der Regierung zu untergraben. Stadtbeamte nannten die Quelle ein öffentliches Ärger nis, ein Gesundheitsrisiko, chaotisch konstruiert von Menschen, die keine Ahnung von zentraler Planung hätten. Sie wollen das Wasser in
RESSOURCEN
132 Gegenteil verwandelte». Menschen schmiedeten neue Allianzen gegen einen gemeinsamen Feind, vor allem einen natürlichen, erklärte er.
Im Jahr 2025 wird die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten mit Wasserknappheit leben. Das macht Kapstadt zu einem speziellen Fall: Auf der einen Seite lässt sich beobachten, wie wagemutig und effektiv mit einer beängstigenden Ressourcenkrise umgegangen wer den kann; auf der anderen Seite ist die Situation Kapstadts ein abschreck endes Beispiel dafür, wie energische Führung darin endet, dass sich die Allgemeinheit gegen die Regierung stellt und zukünftige Pro blemlösungen unmöglich macht. In meiner Zeit in der Stadt schien sich ein Kreislauf von immer stärker werdendem Misstrauen und einer wachsenden Feindseligkeit zwischen Regierung und Bürgern zu eta blieren. Es ist nicht unser Fehler, es ist alles euer Fehler, so fasste Greyling die Rückmeldungen zusammen, die er bekam. Es schien ihn zu verletzen. Er seufzte, als wir über Mohammeds Aktivistengruppe redeten. «Leider sind viele ihrer Ansichten unsinnig», sagte er. Und als ich Rawoots Quelle erwähnte, stöhnte er auf.
Kapstadt suggeriert das Gegenteil. Es könnte sein, dass Men schen nur auf etwas warten, das sie herausfordert, eine Gelegenheit, über ihren politikmüden Zynismus hinauszuwachsen und zu beweisen, dass sie gute Nachbarn sein können, auf mehr als nur Geld und Erfolg
Eigentlich existiert längst ein Konsens darüber, dass uns das Unvorstellbare erwartet: Wettlauf um Ressourcen, anhaltende Globa lisierung und die dazugehörigen Kulturkämpfe, das mögliche Zusam menbrechen des Wirtschaftssystems, auf dem die moderne Zivilisation beruht. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird es, etwas gegen diese Veränderungen zu tun. So fühlt es sich an. James Workman, Autor und Wasser-Analyst, fing die herr schende Angst in seinem 2009 erschienenen Buch Das Herz der Trocken heit ein. «Wir regieren nicht über das Wasser», schrieb er. «Das Wasser regiert über uns.» Ohne Sicherheit über die Versorgung mit dieser we sentlichen Ressource – mit ihrer Allgegenwärtigkeit, in industriali sierten Gesellschaften zu grossen Teilen versteckt, unvorhersehbarer geworden durch den Klimawandel – könnte die Gesellschaft ausein anderbrechen.
Workman sorgte sich, «dass das unverblümte anthro pologische Zeugnis der menschlichen Natur zeigt, dass jeder und jede von uns immer im Eigeninteresse handelt».
133 einen von der Stadt verwalteten Swimmingpool umleiten, was zweifel los ihren Charakter zerstören würde. «Es gab Streit an der Quelle», sagte Greyling, und die Stadt stationierte dort Polizei. Doch sagten mir Cindy Mkaza, die an der Quelle nach wie vor Wasser holt, wie auch der Pro fessor, dass Streit ausserordentlich selten sei. Als ich jemandem, der für die Regierung arbeitet, die wunderschöne Szenerie beschrieb, die ich selbst an der Quelle erlebt hatte, antwortete er mir warnend: «Ich habe keine Gegenbeweise. Aber nimm an, dass es viel mehr darüber heraus zufinden gäbe, wenn du wirklich die ganze Geschichte willst.» «Alhamdulilah», schrieb Bahia. «Danke, Regenfee!», schrieb Wayne Als ich nach Hause zurückkehrte, nach Johannesburg, betä tigte ich die Toilettenspülung. Aber zuvor hielt ich inne, um nachzu denken. Eine Therapeutin empfahl mir einst, mit einem Freund, mit dem ich Probleme hatte, in die Ferien zu fahren. Sie sagte, der Ortswechsel könnte helfen, dass wir uns in einem anderen Licht sähen. «Aber wir kommen ja dann wieder an denselben Ort nach Hause», wandte ich ein. «Eine Erinnerung», sagte sie, «ist auch eine Möglichkeit.»
WASSERNOT
RESSOURCEN
134 aus sind und zusammen raffinierte Kniffe erfinden, um ihre neuen Peiniger zu überlisten. Es könnte sein, dass gewisse Arten von Katas trophen – vor allem natürliche, die einem neutraler und akzeptabler erscheinen als politisch gesteuerte – vielleicht Räume für Veränderung aufmachen in Bereichen, in denen wir bislang glaubten, festzustecken. «Es gibt einen Riss in allem Gottgemachten», sagte Ralph Waldo Emer son, ein amerikanischer Philosoph und Schriftsteller des 19. Jahrhun derts, «nachtragende Umstände schleichen sich unversehens ein, sogar in die wilde Poesie, in der die menschliche Phantasie versucht, wage mutig Urlaub zu machen.»
«Die Wunde ist dort, wo Licht eindringt», sagt Rumi. Viel leicht wissen wir, dass die langanhaltende Zeit der Entwicklung und Selbstbereicherung bald ein Ende haben wird. Vielleicht wissen wir, im tiefsten Inneren, dass wir zurückmüssen zum Menschenwerk, das in der Natur verankert ist und sich nicht darüber hinaus erhebt. Vielleicht wird es einigen sogar Erleichterung bringen, vielleicht Freude. Viel leicht stellt sich heraus, dass wir offener sind als erwartet, etwas mühe voller zu leben.Esist schwierig, vorherzusagen, welche der Veränderun gen in Kapstadt bleiben werden. Aber wenigstens werden sie zu einer Erinnerung.Ich erinnere mich, wie ich vom Haus der Tarlings, weg von der Rückseite des Bergs, Richtung Kapstadt fuhr, als es plötzlich in Strömen zu regnen begann. Aus einem neuen Instinkt heraus oder einem schlafenden, der nun geweckt wurde, fuhr ich an den Strassen rand und schaute ruhig zu, wie sich die Tropfen auf der Windschutz scheibe sammelten und das Licht der Strassenlampen einfingen, ähn lich jener Lichtkreise, die im Kino einen Film ankünden oder die Geburt eines winzigen Universums. Ich loggte mich in die Facebook-Gruppe ein. 400 Leute hatten bereits etwas gepostet. «Habe eben bei einer Sitzung einem Raum voller Menschen mitgeteilt, dass es regnet, und alle haben gejubelt!», schrieb Lesley. «Nimm einen Schirm, aber wir werden den Regen nicht auf halten», schrieb Moegsien. «Jetzt regnet es in Mitchell’s Plain», schrieb Carmelita. «Regen in Sea Point», schrieb Gillian. «Danke, Gott! Unser edler Erlöser!», schrieb Cobie. «Alhamdulilah», schrieb Bahia. «Danke, Regenfee!», schrieb Wayne. «Gepriesen sei seine Nudeligkeit. R’amen», sagte Roxanne. Aus dem Englischen von Raphael Urweider. 134
135 Mehr zum Thema#38 — Klimawandel: Wein aus Nordeaux — von Fabian Federl KONTEXT
Es gibt am Klimawandel nichts zu beschönigen. Er ist bereits jetzt spürbar. Aber: Auch wenn die negativen Auswirkungen deutlich überwiegen, gibt es positive Nebenwirkungen. So schreibt etwa das Deut sche Umweltbundesamt auf seiner Website: «Mildere Winter können zum Beispiel die gesundheitlichen Auswirkungen von Kälteperioden verringern, die Ausfallzeiten in der Bauwirtschaft reduzieren oder unseren Bedarf an Heizenergie senken. Auch in anderen Bereichen sind positive Effekte möglich.» Und durch Greta Thunberg und die «Fridays for Future»Bewegung erlebt die Jugend derzeit eine Politisierung, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, nicht nur in Deutschland.
ZUR AUTORIN Eve Fairbanks, 36, lebt seit zehn Jahren in Südafrika. Sie wurde von ihrem Huffington Post- Redaktor nach Kapstadt geschickt, um von dort über die Wasserkrise zu berichten. «Sobald ich ankam, realisierte ich, wie faszi nierend die Situation vor Ort war», sagt sie. «In Kapstadt vollzieht sich der demografische und soziale Wandel sehr schnell.» Fairbanks glaubt nach wie vor, dass aus ökologischen Krisen wie der Dürre in Kapstadt Raum entstehen kann für konstruktive soziale Entwicklungen. «Die Bewohner erlebten ihre Stadt in der Krise in einer positiveren Art und Weise – obwohl sie nicht so perfekt funktionierte wie sonst.» Diese Veränderung halte immer noch an, sagt sie. Und ein bisschen hat sich auch ihr eigenes Verhal ten verändert nach der Recherche: Fairbanks spült jetzt die Toilette nicht mehr nach jedem Gang. Ihren Rasen sprengt sie aber immer noch.
EinsKOMPLEXstehtfest:
EsKNAPPgibt ein Wort für akuten Wassermangel: Wasserstress. Er stellt sich ein, wenn zu grosse Mengen aus Süsswasserreserven entnommen werden. Dann können sich diese nicht ausreichend genug wieder auffüllen. Um Wasserstress zu vermeiden, will die Uno, dass nicht mehr als 25 Prozent der erneuerbaren Wasserreserven, die sich aus Flüssen und Nieder schlagsmengen ergeben, angetastet werden. Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit leiden laut der Uno bereits unter dem Phänomen. Und es werden in Zukunft mehr sein, denn seit den 1980er Jahren steigt der Wasserverbrauch weltweit um etwa ein Prozent pro Jahr. Laut den Prognosen wird dieser Trend anhalten – was bis 2050 einem Anstieg von 20 bis 30 Prozent des jetzigen Verbrauchs entspräche. Verschlim mert wird die Situation noch durch den Klimawandel, der zu mehr Dürren und häufigeren Hitzewellen führt.
136 «Städte sind Körper, deren Wunden langsam heilen und die umso besser neue Kraft schöp fen, als ein Fluss durch ihre Mitte fliesst», schreibt Cécile Wajsbrot in Nevermore , dem Buch, das gerade auf meinem Nachttisch liegt. Genf ist grosszügig mit Wasserläufen bestückt und reich an Ressourcen, aus denen die Stadt ihre Kraft schöpft. See und Flüsse zeichnen ihre Anatomie, füllen ihre Lungen. Ihre Wunden kommen nie zum Vorschein. Es heisst, man soll sich vor allzu lieblichem Wasser hüten. Der Genfersee ist eine weite, unheimliche Fläche. Beim Betrachten seiner gleichmütigen Wellen sehe ich mich versinken wie ein Stein. Anders ist es mit den Flüssen. Rhone und Arve sind ungestüme Gewässer, sie springen einander an. Sie leiden und las sen leiden. Zwei Flüsse wie zwei Geschwister, wie Remus und Romulus, wobei das grös sere – die Rhone – die Oberhand behält. Da rum will ich Genf lieber von der Arve aus betrachten, ein Bach eher, ein übermütiger Nebenfluss, der sich vom Gipfel des Mont blanc hinunter in die Rhone stürzt. Genau da wohne ich. Von meinem Fenster aus höre ich das Rauschen eines kleinen Wasserfalls. Um den Fluten Einhalt zu ge bieten, sind Felsen zu Deichen aufgeschüttet worden. Das Wasser wirbelt um sie herum, bildet eine kleine Kaskade. Schroffe Bö schungen führen zu kleinen Kieselstränden hinab, auf der Wasseroberfläche treiben zer trümmerte Baumstämme. Im Gebüsch deuten sich kleine Wege an, Hunde streunen durch das Dickicht. Zwischen den Ästen verbergen sich Obdachlosenzelte. Seit der Schliessung der Notunterkunft in der ehemaligen Kaserne von Les Vernets streifen Menschen ohne Bleibe durch die erdigen Halden am Ufer der Arve. Viele von ihnen haben sich hier ein quartiert, verstecken ihre Schlafsäcke in den verschlungenen Ästen, geistern herum in diesem verwilderten Gelände am Rand eines sich ständig wandelnden Industriegebiets. Manche von ihnen grüssen uns, wenn ich mit meinem Sohn an der Hand morgens zur Kita gehe. Es sind immer dieselben, die auf den Bänken über dem Ufer sitzen. Vereinzelte,
136
sehr reinliche Männer. Höfliches Lächeln. Seit Tagesanbruch warten sie hier, vom Mor gentau benetzt, dass die Stunden vergehen.
137
Der eine hat sein Hab und Gut in einem Ein kaufswagen verstaut, der andere muss es woanders untergebracht haben. Mein Sohn weiss im Voraus, wer auf welcher Bank sitzt. Wir biegen ab in Richtung Augustinerviertel. Rechts von uns, in die Ecke eines Primar schulhofs geschmiegt, ein Marionettentheater, links die rosaroten Fassaden eines Massage salons, wo Sexarbeiterinnen dem ältesten Be ruf der Welt nachgehen. So früh am Morgen liegen die beiden Gebäude noch im Schlaf. Für meinen Sohn gibt es keinen wesentli chen Unterschied zwischen den beiden Schau fenstern. Nichts irritiert seinen unschuldi gen Blick, schon gar nicht die scheinbare Arglosigkeit der Strassen, in denen alle Ge werbe austauschbar zu sein scheinen. Viel mehr interessiert ihn das bunte Schild der Tamoil-Tankstelle und ihr Autowaschser vice. Mit einem Kuss verabschiede ich mich von ihm. Meine Schritte führen mich erneut den Fluss entlang. Krähen krächzen. Ich sehe den Vögeln zu, wie sie wütend zwischen den Kieselsteinen picken. In den Morgenstunden begegnet man auf den Uferwegen Joggern, jungen Eltern, Hundebesitzern. Ich gehe eine der graffitibesprühten Metalltreppen hinun ter, setze mich auf die sandige Erde. Teenager schmusen im Gebüsch. Verkeilte Baum stämme versperren den Weg. Ich steige über sie, nähere mich dem Wasser. Sein schlam miges Grün hindert mich daran, auf den Grund zu sehen. Mein Blick bleibt an den Fluten hängen. Sie haben dieselbe Farbe wie die Amtsgebäude in Bern, ein blasses Kaki, wie eine verblichene Militäruniform. Die Kaserne von Les Vernets ist kürzlich einer Kooperative übergeben worden, die sie in Künstlerateliers hat umbauen lassen. Die Nut zungsdauer ist befristet. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude abgerissen sein. Ein neues Viertel wird hier aus dem Boden gestampft, die Bäume werden gefällt, Wohnungen gebaut. Bis dahin hat dieses vergängliche Areal etwas von einem Brachland: Ich gehe jeden Tag an Zäunen mit bunten Graffiti entlang, vorbei an mehreren kleinen Theatern, Wohnwagen und allerlei Krimskrams. Manchmal entdecke ich auf dem Grund des Wassers von Algen und anderer Flussvegetation umschlungene Fahr radleichen, metallene Gerippe von Einkaufs wagen aus dem Supermarkt. Meistens aber bleibt das Wasser der Arve undurchsichtig, es gibt nichts preis, spiegelt nichts. In dieser Stadt begegne ich nur erratischen Gestalten, flüchtigen Erscheinungen. Genf ist ein Kon glomerat aus Adern, von sibyllinischem Wasser durchwogt. Wäre Genf eine Person, so hätte sie bestimmt ängstlich-vermeidende Züge. Die Stadt entgleitet mir, sobald ich sie zu fassen versuche. Man kann sich schlecht vor stellen, dass man auf ihren Gehsteigen Wur zeln schlägt, sich in ihren Winkeln liebt. Jeder Morgen wischt die Erinnerung an die ver gangene Nacht fort, nur selten zeugen ein paar Glasscherben auf dem Asphalt von ihr. Da bei versteht es Genf durchaus, festlich, gar übermütig zu sein – aber überbordend nie. Auf den Moment, wenn die Nacht in den Tag umschlägt, der Schatten in schillerndes Licht übergeht, wartet man vergebens. Genf ist ein Körper ohne Organe. Die Jonction, der Ort, wo die beiden Flüsse zusammenfliessen, erinnert weder an eine Narbe noch eine Nahtstelle, die zwei Fleischränder vereint. Sie gleicht eher einem Transplantat, das nicht recht einwachsen will. Das Wasser der Rhone glänzt in einem prächtigen Grünblau, das der Arve behält seine Olivtöne. In Genf geht alles aneinander vorbei, durchdringt sich nicht. Jeder klammert sich an seiner Einzig artigkeit fest. Selbst die Gewässer bleiben einander fremd. Aus dem Französischen von Lis Künzli.
138 Kreuzlingen, Bärenplatz. Ich steige aus. Es ist Mitte April, nasse Schneeflocken fallen vom Himmel. In dem kleinen Park neben der Bushaltestelle sind keine Kiffer, keine Kan tischüler. Nur ein Junge aus Metall. Sein pink farben besprayter Penis ist der einzige warme Farbfleck in diesem sonst grauen Tag. Ich schlage mir dir Kapuze über den Kopf und setze mich in Bewegung. Links vom Bären platz ist ein Kreisel, rechts ist ein Kreisel. Sie wirken wie Zahnräder, die die Autos zur Weiterfahrt antreiben. Wie ein riesiges Getriebe dreht sich der Verkehr um die Kreisel und fliesst dann in verschiedene Richtungen davon. Als möchte niemand Halt machen in Kreuzlingen, niemand bleiben. Die Strasse, die über den Hauptzoll direkt nach Konstanz führt, heisst seit 2011 Boulevard und soll eine Begegnungszone sein. Mir be gegnen zwei, drei eilige Menschen. Der Schneeregen wird zu Regen, und ich gehe ebenfalls schneller. In der geografischen Mitte der Stadt steht eine Litfasssäule. «In Kreuzlingen ist was los», verspricht sie. An der Säule klebt das offizielle Kulturprogramm der Stadt, März bis Juni. Daneben das Bild einer zugelaufenen Katze. Sonst weisse, leere Flächen. Ja, in Kreuzlingen ist was los. Was macht Kreuzlingen aus? Ich gehe weiter Richtung Konstanz. Die «Traube» am Zoll hat pandemiebedingt geschlossen, der Zoll posten ist schon seit Jahren unbesetzt. Ich gehe über die Grenze und erinnere mich, wie wir als Kinder an dieser Stelle hin- und hersprangen: Schweiz, Deutschland, Schweiz, Deutschland. Oder wir blieben breitbeinig stehen: in der Schweiz und in Deutschland Konstanzgleichzeitig.war meine zweite Stadt. Konstanz machte Kreuzlingen, meine erste Stadt, zur Agglo. Universitätsstadt steht auf einem dun kelgelben Schild jenseits der Grenze. Dann folgt eine Dönerbude. Ich gehe ein paar Schritte auf der Hauptstrasse, die hier Kreuz lingerstrasse heisst. Die wenigen Passanten, die unterwegs sind, sprechen Schweizer deutsch. Im Frühjahr 2020 wurde die Agglo von ihrer Stadt getrennt. Zum ersten Mal seit 138
139
139 dem Zweiten Weltkrieg waren die Grenzen ge schlossen. Zäune führten durch Wohnquar tiere, Paare waren getrennt, Familien, Städte.
Die Altstadt von Konstanz grenzt quasi an Kreuzlingen. Es ist die Altstadt, die Kreuz lingen selbst nicht hat und selbstverständlich mitnutzt. Wenn man sich achtet, fällt auf, dass die Architektur hier eine leicht andere ist als auf der Schweizer Seite. Vor den Häu sern sind mancherorts golden glänzende Stolpersteine für die Opfer des Nationalso zialismus in den Boden eingelassen, gelebte Erinnerung. Die Sonne drückt durch die Wol ken, es wird wärmer, trotzdem kommen kaum Menschen heraus. Ich frage mich, ob der Grenzübertritt zurzeit überhaupt er laubt ist, und kehre rasch in die Schweiz zu rück. An der Grenzstrasse fällt mir auf, dass die Gartenzäune der Schweizer Häuser ge nau auf der Grenze stehen. Kreuzlingen Hauptbahnhof. Drei Snackau tomaten, ein Kaffeeautomat, ein Pronto phot-Automat. Einige Schliessfächer, War tehäuschen. Wartehäuschen riechen überall gleich: nach abgestandenem Zigarettenrauch. Mit dem Zug fahre ich eine Station zum Kreuzlinger Hafen. Dort regnet es wieder. Ich stelle mich beim Avec unters Dach, bis der Regen abflaut. Mit mir warten drei Ju gendliche, die etwas stoned aussehen, und zwei Bauarbeiter, die hier ihre Nachmittags pause verbringen. Keiner sagt ein Wort. Kantonsschule Kreuzlingen. Zum letzten Mal war ich hier zur Jubiläumsfeier 2019. Mitten auf dem Festgelände war ein Panzerfahr zeug der Mowag platziert. Auf meine Nach frage teilte man mir mit, dass dies nicht pro blematisch sei, der Mowag Eagle habe nichts mit Krieg zu tun, sondern stehe symbolisch für das stolze Thurgauer Unternehmertum. Na, wenn das so ist. Als ich zurück zum Bä renplatz gehe, erinnere ich mich, dass Kreuzlingen oft nicht genug war. Uns Halb wüchsigen fehlten die 1.-Mai-Demos oder die Street Parade. Wir träumten von Ausbruch und Anonymität. Stattdessen gingen wir jedes Jahr ans Fantastical, das grenzüber greifende Seefest. Im Siebenschläferzelt kannte man alle. Ich fahre mit dem Bus zurück ins Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und während neuerli cher Regen an die Scheiben trommelt, kom men plötzlich andere Erinnerungen: flanie ren im Kreuzlinger Seeburgpark, wehendes Gras, Lachen, erste Küsse, ewig lange blaue Tage, Eiscrème, Sonnencrème, der Boden see in den Ohren. Und wenn die Bise kommt, toben und rauschen die Wogen. Wie am Meer. Hoffnungsvoll komme ich im Sommer wie der. Doch als ich Ende Juli am Bärenplatz aus dem Bus steige, ist der Himmel wieder grau, dicke Tropfen klatschen auf unverän dert graue Strassen. Es scheint, als hätte sich nur die Vegetation in den letzten Monaten verändert: Die Statue beim Bärenplatz ist von hüfthohen Blumen umkreist, sie neigen ihre nassen Köpfe im Regen. Durch die vio letten Blüten erkenne ich, dass man unter dessen wenigstens das beste Stück des me tallenen Jungen gereinigt hat. Ich wiederhole meinen Spaziergang vom Frühling. Bei der noch immer geschlossenen «Traube» am Zoll stelle ich mich resigniert unters Dach und schreibe in mein Notizheft, dass es regnet und nichts los ist. «Hendo de notiot?», fragt mich plötzlich ein älterer Herr und deutet erschrocken auf sein kleines Auto, das neben mir auf einem Parkplatz steht. «Han extra zwe Franke inegloh!» Ich kläre ihn auf, dass ich keine Knöllchenver teilerin bin, sondern einen Text über Kreuz lingen schreibe. Er lacht erleichtert. «Do hendo abo viel z vozelle.» Er geht weiter. Ich bin mir nicht sicher, wie er das gemeint hat. Ich schaue ihm nach, wie er im Regen über die Grenze geht und in Deutschland verschwindet.
Vor neun Jahren bin ich tatsächlich in meine Monopoly-Stadt gezogen, und seitdem ich hier bin, werde ich in unregelmässigen Ab ständen daran erinnert, dass in La Chauxde-Fonds mal noch ganz viele andere aus der Deutschschweiz waren, dass es sogar eine eigene Kirche für sie gab, dass alles so schnell gegangen ist: von der Alp zum Dorf zur Uhrenmetropole. 1880 stammte ein Drittel der Bevölkerung der Stadt aus der Deutsch schweiz. Die meisten sind wieder weg. Der Temple Allemand ist heute ein Theater. Es sind einzig ein paar Wörter, die geblieben sind, ein paar Namen. Die Nussbaums, die Kaufmanns oder die Aeschlimanns sprechen heute genauso we nig Schweizerdeutsch wie die Dubois, die Sandoz, die Droz. Auch die Vorfahren väter licherseits meiner Kinder kommen aus der Deutschschweiz. Der Grossvater des Gross vaters war Orgelbub im Temple, kümmerte sich um die Bälge, den Wind. Er sprach noch Schweizerdeutsch, aber an den Generati onsgrenzen wurde die einstige Muttersprache Stück für Stück abgelegt. Nur ein paar Ger manismen haben sich über die Jahrzehnte ge 140
140 La Chaux-de-Fonds begegnete ich zum ersten Mal im Toggenburg, als ich mit meiner Gross mutter Monopoly spielte. Es war der exo tischste Ort, den es zu kaufen gab. Ich sprach ihn auf Deutsch aus, mit diesem Ch, diesem au, diesem x, und meine Grossmutter lachte, gab mir die Karte, gab mir von den grünen Plastikhäusern, den roten Hotels. Erst viel später bin ich dann zum ersten Mal mit dem Regionalzug von Biel durchs Sankt-Im mer-Tal, durch all die Dörfer mit C – Corgé mont, Cortébert, Courtelary, Cormoret – über die Nebelgrenze gefahren und kam mir vor wie auf einem Balkon, der aus dem Rest der Schweiz ragt. Die Stadt liegt nicht auf den Verkehrsachsen. Man muss es sich vornehmen oder sich ver fahren, um hier zu landen. Man muss in kleine Züge wechseln, die immer mal ausfallen oder sich auf unbestimmte Zeit verspäten. Den Leuten hier scheint es nichts auszumachen, abseits der Achsen zu leben. Im Gegenteil.
Sie sind so schön, dass ich dem hartnäckigen Winter nicht böse sein kann. Kurz nachdem die letzten Eiszapfen von den Dachrinnen gefallen sind, kommen die Mau ersegler. Ihre Rufe, ihr rasanter Flug. Sie schla gen mit ihren Sicheln, jagen über das Schach brettmuster, auf dem die Strassennamen noch vom Eigenwillen und der Grosszügigkeit erzählen, mit der die Stadt nach dem Feuer von 1794 geplant worden war: Rue de l’Ave nir, Avenue Léopold Robert, Boulevard de la AnLiberté.schönen Herbsttagen wandern wir über die Weiden und machen ein Feuer zwischen den hohen Fichten. Une torrée. Wir wickeln Kohl- und Zeitungsblätter um die Neuen burger Saucissons, schnüren kompakte Pakete und befeuchten sie mit Wasser, vergraben sie unter dem Ascheberg. Le grossfatre ruft: Le fatre, il a schlagué le katz avec un steck en bas de la strasse. Wir lachen. Es ist das Spiel aus seiner Jugend. Wer am meisten geret tete Wörter in einen Satz packen kann, ge winnt. Meine Kinder reden ähnlich. Aber es sind nicht die Sätze mit Wörtern, die ge blieben, sondern mit jenen, die hinzuge kommen sind. Je peux avoir un zuckerbolle? Lueg, il y a un bagger! Tu peux me chräzebuggele? Ich habe von meiner Grossmutter das Mo nopoly und den Holzschlitten geerbt. Meine Kinder steigen auf, und ich ziehe sie auf dem Schachbrett durch das Labyrinth aus ho hen Schneewällen und Fassaden, immer weiter, mit diesem Gefühl von Balkon, von Linien in die Unendlichkeit.
141
141 rettet. Der Grossvater meiner Kinder sagt le fatre, la moutre, wenn er von seinen Eltern spricht.
Die grossen Schneeflocken, die in Zeitlupe vom Himmel fallen und am Boden sofort schmelzen.
.
Ich glaube, von allen Wörtern, die hiergeblie ben sind, beginnen die meisten mit s: schlaguer, schwenser, schneuquer, le schnec, le steck, le speck, la strasse, les spätzli, le schlouck, les schlecks, la stimmoung, le spatz, le schnetz, le schnaps, le stamm, le stempf. Einmal sind auch Elefanten hiergeblieben.
Die Artisten des Zirkus Hagenbeck mussten 1914 zurück nach Deutschland in den Krieg, während man sich in La Chaux-de-Fonds um die Elefanten kümmerte, sie Kohle und Was ser durch die Stadt tragen liess. Der kleinste starb vor Kälte und ist noch heute in der Sammlung des Musée d’histoire naturelle. Wir stehen am verschneiten Hang. Le gross fatre sagt: On fait une rütschée? Dann geht er leicht in die Knie und rutscht auf den Fer sen den Hang hinab. Wenn am Fuss des Ju ras der Frühling kommt, werde ich ungedul dig. Meine Kinder rufen: les tatouillards!
Ich sage dem Grossvater meiner Kinder grossfatre , extra, obwohl ich weiss, dass genaugenommen nur le fatre in der Sprache geblieben ist. Jeden Morgen fliegen die Krähen vom Gym nasium zur Kompostanlage und jeden Abend wieder zurück. Wenn mich nachts ein Piep sen weckt und orange Blinklichter über Vorhang und Wände wandern, weiss ich: der Schnee. Die Schürfleisten der Schneepflüge schaben über die Strassen. Es sind die über mütigen Morgen. Wir denken an die hohen Haufen und hoffen, dass es immer weiter schneit. Wir bauen Riesinnen, Schlösser mit Rutschbahnen, einen Park voll Schneemänner. Aber die Winter, in denen am Stück Schnee liegt, gehören zur Kindheit vom gross fatre. Heute gibt es immer wieder Pausen, und meine Kinder sagen Pflotsch, meine Kin der sagen pètche
142 Es ist nicht deine Geburtsstadt, es ist die Stadt nebenan. Das erste Mal muss ein Schulaus flug ins Olympische Museum gewesen sein. Später gab es eine Lesung russischer Dichte rinnen durch deine schauspielernde Schwes ter und eine Ausstellung ebenfalls russi scher Impressionisten in der Hermitage. Und da waren zwei Freundinnen. Eine von ihnen verliess ihre Heimatstadt, um in der Lausanner Theaterschule Teintureries zu studieren, die andere nahm jeden Tag den Zug, um mit dir gemeinsam die Universitätsbank zu drücken. Russland, das Theater, die Freundschaft, sie alle haben mit deiner Entdeckung von Lau sanne zu tun. Im Unterschied zu deiner Geburtsstadt Genf, von der du seit Jahren jedes Viertel durch streifst, setzt sich dein Bild von Lausanne aus einzelnen Tupfern, unabhängigen Pixeln zu sammen, die du nach und nach zusammen führst. Erst scheinen die Orte, die du be suchst, in keiner Verbindung zueinander zu stehen, das fällt dir jedes Mal wieder auf. Man sagt dir: Du brauchst nur den Aufzug zu nehmen, und schon bist du da, es ist unter der Passerelle, nein, ganz woanders, nicht da, wo du meinst, gleich darunter, aber du musst zuerst hinauf. Die Ortsbezeichnungen helfen dir auch nicht viel weiter. Du erfährst, dass es einen Platz namens Tunnel gibt, eine Kreu zung namens Chauderon, Kochkessel, ein französischsprachiges Boston und ein Vier tel namens Flon, das viel protziger ist, als seine klangliche Nähe zu Flan nahelegt. Im Lauf der Zeit ziehst du Linien, setzt Oberflä chen und Volumen ein. Nach deinen Reise erfahrungen sollte man meinen, dein Orien tierungssinn sei nicht allzu schlecht. Hier aber brauchst du mehr, um dich zurechtzufinden, mehr an allem, an Zeit, an Orientierung, an Erfahrung. Denn hier ist man kein Erdbe wohner, man ist Fisch oder Vogel. Man arran giert sich mit dieser zusätzlichen Dimension, mit Höhen, Tälern und mit Brücken, die über kein Wasser führen.
Die ersten Entdeckungen finden nachts statt: eine Aufführung, eine Wohnungseinwei hung, eine Party, um einmal woanders zu tan 142
Du legst dich am Festival de la Cité in einen Park, unterhältst dich bis spät in die Nacht auf der Terrasse des Gre nette, du läufst auf eine Pagode zu, schreibst im Garten eines Museums, erwachst in ei ner Wohnung unterhalb des Bahnhofs. Deine Freunde ziehen oft um; da sie verschie dene Höhenlinien bewohnen, kannst du auf sie zählen, um deine geografischen Lücken zu schliessen. Deine Kenntnis differenziert sich. Du erfährst, dass Mont und Belmont über Lausanne nicht wirklich zu Lausanne gehö ren, dass die Metro früher ficelle hiess, Schnur, dass du die Einzige bist, für die Ou chy sich anhört, als tue etwas weh – denn eigentlich ist es ein eher schickes Viertel. Eines Tages bricht die Covid-19-Pandemie deine Verbindung zur Stadt ab, in der du dich vorher jede Woche aufgehalten hast.
Aus dem Französischen von Lis Künzli.
zen als in der Disco. Unter Studierenden hält sich das Gerücht, Lausanne sei besser zum Tanzen, relaxter, es gebe mehr Auswahl für weniger Geld als in Genf. Dann beginnt die Stadt auch für dein Berufsleben immer wichti ger zu werden. Im Café de Grancy triffst du dich zum ersten Mal mit einem Verleger, er ist jünger als du, er sagt sofort, er werde dein Buch herausbringen, du kritzelst ein Gedicht auf die Rückseite der Rechnung und bewahrst es auf, obwohl es nicht gut ist. Ihr werdet Freunde. Nach dieser Begegnung änderst du dein Leben. Du wirst Schriftstellerin. Du be reist die Schweiz, dann Europa, und Lausanne bildet einen guten Mittelpunkt. Du wirst hier zu Lesungen eingeladen, zu Arbeiten im Kollektiv, zu Interviews. Beruf und Freundschaft verschmelzen schliesslich miteinander, inzwischen ist es hier, wo du Sofas belagerst, wo deine Augen leuchten, wo du Geheimnisse preisgibst und entgegennimmst.
143
Du gehorchst den Behörden, fährst nicht mehr Zug, siehst niemanden mehr, obwohl es dir sehr zu schaffen macht. Dir wird be wusst, dass im Falle eines Weltuntergangs, der viel abrupter und radikaler wäre als diese Pandemie – und unter Weltuntergang verstehst du vor allem das Ende der Telekom munikation – die einzige Möglichkeit, deine Freunde wiederzufinden, diese Orte wären, die du kennst, die Adressen, die du bei dei nem Couchsurfing auswendig gelernt hast. Als du endlich wieder nach Lausanne kommst, ist die Stadt im wahrsten Sinn des Wortes exotisch geworden: fremd und tropisch. Am Bellerive-Strand erlebst du einen Moment der Ewigkeit. Niemand weiss, ob diese Krise vorbei ist oder ob sie noch immer über uns schwebt, dies jedoch hebt die Vergänglichkeit, das Einzigartige jedes Augenblicks hervor. Ihr seid vier befreundete Menschen am Strand, ihr schwimmt, lacht, trinkt Wein in der mil den Nacht, dann fliegt am Himmel ein Flug zeug vorbei, und es hat, da seit Monaten niemand ein Flugzeug sah, etwas von einem Ufo. Danach liegt ihr alle schweigend im Sand unter den Sternen, und du bist dir sicher, dass ihr alle an dasselbe denkt, dass Unsterb lichkeit die anderen sind, dass die Liebe, im weitesten Sinn, eine physische Energie ist, die die Wesen miteinander verbindet. Was du an Lausanne am wenigsten magst, ist der Abschied. Da er meist abends statt findet, ist es oft ein Abstieg, geografisch wie emotional. Allein auf dem Bahnsteig, wartest du auf den Zug, und der Zug kommt nicht, weil er irgendwo von einem anderen abhängt, weil er der letzte ist. Du reisst dich von Lausanne los wie ein Schiffbrüchiger von seiner Insel, und du weisst, dass niemand von ausserhalb in der Lage wäre, die Stadt ge nauso zu sehen wie du, als eine Metropole winziger Erinnerungen. Sie schillert. In vier Dimensionen. Der Platz, den sie in deinem Leben eingenommen hat, ist impressionistisch.
In Dänemark gilt eine Ortschaft mit 200 Einwohnern bereits als Stadt. In Deutschland braucht es dafür schon 2000 Einwohner, in der Schweiz, in Italien und Spanien 10 000, in Japan 50 000. Die Uni Münster stellt deshalb fest: «Eine allgemeingültige epochen- und re gionenübergreifende Definition für die Stadt existiert nicht.»
Über die Hälfte der Weltbevölkerung (57 Prozent) von sehr bald 8 Milliarden Menschen lebt in Städten. Im Jahr 2030 wird dieser An teil bereits 60 Prozent betragen.
144 RUBRIKVon Hum bis Tokio — von Dmitrij Gawrisch
Besonders kalt ist es in Jakutsk. Im Winter fällt das Thermo meter in der 300 000-Einwohner-Stadt in der russischen Region Jaku tien (Sacha) regelmässig unter minus 40 Grad Celsius. Es wurden auch schon minus 63 Grad Celsius gemessen.144
Luc Bessons Science-Fiction-Streifen
Aufgrund der fehlenden Definition lässt sich nicht präzise feststellen, wie viele Städte es auf der Erde gibt. Mit über 150 000 Ein wohnern soll es etwas über 4400 Städte geben, 470 Millionenstädte, 34 Megastädte mit jeweils mehr als 10 Millionen Einwohnern. 21 davon liegen in Asien, 6 in Nord- und Südamerika, 4 in Europa und 3 in Afrika. 37 Länder haben Hauptstädte, die nicht ihre grössten Städte sind. Darunter die USA, China, die Schweiz und Liechtenstein.
Während Sie diesen Text lesen, wachsen die Städte. 510 100 000 Quadratkilometer beträgt die Oberfläche der Erde. Städte bedecken nicht einmal ein Prozent davon (0,87 Prozent).
Die tiefstgelegene Stadt der Welt – 250 Meter unterhalb des Meeresspiegels – ist zugleich nach aktuellem Kenntnisstand die älteste: die palästinensische «Palmenstadt» Jericho. Erste archäologische Funde, darunter Befestigungsmauern, datieren von 9000 v. Chr. Rund 20-mal wurde die Stadt im Laufe ihrer Geschichte zerstört und wiederaufgebaut.
Die grösste Stadt der Welt ist der Ballungsraum Tokio, in dem heute 37 Millionen Menschen leben. Die Metropolregion erstreckt sich über eine Fläche von knapp 2 Millionen Fussballfeldern.
Das fünfte Element von 1997 spielt im Jahr 2263. Er zeigt die Erde als eine einzige, von Hoch häusern gespickte Stadt.
Als kleinste Stadt der Welt gilt Hum auf der kroatischen Halb insel Istrien. Das mittelalterliche Örtchen, das halb so gross ist wie ein Fussballfeld, zählt rund 20 Einwohner. An manchen Tagen übersteigt die Zahl der Touristen diejenige der Lokalbevölkerung um das 25-Fache.
Goldfunde sind der Grund, weshalb in Peru mit La Rinconada die höchstgelegene Stadt der Welt gegründet wurde. Lange hält es aber keiner der rund 50 000 Menschen auf 5100 Meter über Meer aus.
145 TITEL
Der Moskauer Kreml ist die einzige mittelalterliche Festung der Welt, die noch immer in Betrieb ist. Im 11. Jahrhundert begründet, umfasst der Kreml fünf Paläste und vier Kathedralen. Er ist Museum und Sitz des russischen Präsidenten in einem.
Als Wiege der Wolkenkratzer gilt nicht New York, sondern Chicago. Dort entstand 1885 das erste Hochhaus, 42 Meter, nur 10 Stock werke hoch.In London entstand um 1890 die erste U-Bahn. Das längste U-Bahn-Netz der Welt besitzt mittlerweile die chinesische Metropole Schanghai, es ist über 800 Kilometer lang. Die tiefste U-Bahn-Station ist Arsenalna in Kyjiw. 1960 eröffnet, liegt sie 105 Meter unter der Erde und sollte im Falle eines Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt auch als Luftschutzbunker dienen. Erstmals als Schutzbunker benutzt wurde Arsenalna am 24. Februar 2022.
Im kolumbianischen Quibdo regnet es fast jeden Tag (an durch schnittlich 304 Tagen im Jahr), oft mehrere Stunden lang. Dabei fallen im Jahresverlauf rund 9 Meter Regen. Noch mehr Regen erhält Maw synram in Indien, fast 12 Meter. Dort regnet es seltener als in Quibdo, dafür heftiger.Alsregenärmste Stadt der Welt gilt Assuan in Ägypten: Dort fällt weniger als ein Millimeter Niederschlag pro Jahr. Trotzdem ha ben die Bewohner mehr als genug Wasser: Assuan liegt direkt am Nil.
Aus dem Weltraum betrachtet, ist die amerikanische Glücks spiel-Metropole Las Vegas die hellste Stadt der Erde, es folgt dicht da hinter Hongkong. Bei Nacht kaum zu sehen ist dagegen Pjongjang.
New York ist die diverseste Stadt der Welt. Mindestens 800 verschiedene Sprachen werden in der amerikanischen Metropole ge sprochen, nur 4 von 10 Familien sprechen zu Hause Englisch.
Während Sie diesen Text gelesen haben, hat die Stadtbevöl kerung weltweit um 510 Personen zugenommen. Während Sie dieses Heft lesen, wird sie um über 21 000 Menschen zunehmen.
Das älteste Restaurant der Welt ist das «Sobrino de Botín» in Madrid. Seit 1725 verköstigt es seine Gäste. Die Betreiber behaupten, dass die Herdflamme in der Küche seit der Eröffnung ununterbrochen brennt.
Den Hitzerekord hält Mekka in Saudiarabien: In den Jahren 2010 und 2016 betrug die Jahresdurchschnittstemperatur 32,9 Grad. Venedig? St. Petersburg? Gar Pittsburgh, wie viele Amerika ner standhaft behaupten? Falsch! Die Stadt mit den meisten Brücken ist Hamburg, rund 2500 davon finden sich in der Hansestadt. Die Altstadt von Venedig hat «nur» 400 davon.
146 Zärtlich will ich dich behandeln, krauses Gras. Walt Whitman
Der Vorteil der Zeit, der vergehenden Zeit in nerhalb eines Raums, irgendeines Raums, sind die vielen Variationen. Die Verwandlung der Stadt (durch Baustellen, Bauten, Grabun gen), aber auch der Natur, die sich in ihr ent faltet: Verfärben des Laubs, Aufblühen der Blumen, Reifen der Früchte, Wachsen der Stämme, Fallen der Blätter. Nur eine Jahres zeit, einen einzigen Zeitraum eines Ortes zu kennen, heisst, ihn nicht zu kennen. Man muss denselben Weg mehr als tausendmal ge hen, jedes Mal etwas Neues entdecken (sich selbst, verändert durch eine kleine Begeben heit, eine Lektüre, ein Ereignis, ein Gefühl, eine Erinnerung; ein Vogel, der sich hinsetzt oder über den Himmel gleitet, eine Katze auf der Strasse, Abfall, der unter einem Baum ge strandet ist). Es kommt auf die Aufmerksam 146
Ein Stück weiter, im Englischen Garten, er streckt sich nördlich der Lindenallee ein üp piges Band, dem akkurat gemähter Rasen und hübsch arrangierte Blumen erspart geblieben sind. Ein sich verjüngender Streifen Unterholz (von zehn zu zwei Schritten Breite und hun dertdreissig Schritten Länge), in dem sich Farn, Waldmeister und Geissbart ausbreiten. Fri sche, Ruf des Waldes – den man viel zu oft ig noriert. Und wenn wir ihn heute für einmal nicht ignorieren würden?
Am besten gefällt mir die Stadt da, wo sie spriesst. Zum Beispiel in den Ritzen der alten Mauer, die sich meine Strasse entlangzieht, bevor sie einen Bogen schlägt und dann steil abfällt. Quer durch die städtische Landschaft klammern sich Streifenfarn, Steinpfeffer, Zim belkraut und rote Spornblumen an den Stein. Diese Pflanzen brauchen keine Pflege. Sie star ren auf den Asphalt und spiegeln sich in den weiter oben gelegenen Gärten. Sie entwickeln Strategien, um mit wenig auszukommen. Im Vorbeigehen betrachte ich sie. Ich habe ihre Namen gelernt und füge sie meinem geistigen Herbarium hinzu. Damit kann ich die Welt um mich herum besser in Besitz nehmen.
Verschmähen Sie keinen geheimen Garten und kehren Sie, zu anderen Zeiten des Jahres, an dieselben Orte zurück.
Um zurückzukehren, muss man nur den Hügel wieder hinuntergehen – es gibt viele Wege. Geben Sie acht, nicht die Schnecken zu zertre ten (sich bücken, diejenigen, die sich in der Mitte der Treppe befinden, an ihren Häuschen fassen und ein Stück weiter weg ins Gras le gen). Andere Blätter warten auf Sie, diejenigen der Bücher. Vielleicht finden Sie in der Biblio thek oder in der Boutique du livre Walt Whit mans Grashalme. Lassen Sie sich, mit diesem Buch unter dem Arm, ein wenig durch die Altstadt treiben, die in ihrem gelben Stein leuchtet. Vergessen Sie nicht, jeden Ansturm des Lebens auf alles Erstarrte zu begrüssen.
keit für das Detail an – und auf die stetige Erneuerung dieser Aufmerksamkeit.
Aus dem Französischen von Lis Künzli.
Was monumental ist und bereits benannt, finden Sie auf einer Karte im Verkehrsverein. Die Kollegiatkirche und das Schloss, der Ge fängnisturm und die Museen (sehr gut, die Museen), der Hafen und seine grossen Aus flugsschiffe, die gepflasterten Gassen. Das al les ist keineswegs belanglos, hüpft aber auch nicht vor Freude. Die Freude entspringt den Zwischenräumen, den Rissen, einem plötzli chen Aufblühen, einem jähen Lichteinfall. Die Freude, das ist ein Löwenmaul in einer As phaltspalte, Stockrosen auf ihren hohen Stie len, die Rückkehr der pfeifenden Mauersegler. Es ist das spontane Entstehen, die Natur, allem zum Trotz, ihr hartnäckiges Überleben, ihre nachverfolgbaren Kreisläufe. Dies zumindest macht meine tägliche Freude in der Stadt aus. Das Unerwartete, die Überraschungsgäste, die unverhofften Geschenke, das Aufwachen aus einem langen Keimschlaf. Wenn Sie sich an einem Tag ohne viel Sonne und grosse Men schenmassen an den See setzen, werden Sie mit ein wenig Glück draussen einen Biber vorbeischwimmen sehen oder einen Fluss krebs auf den Kieselsteinen am Strand. Und natürlich Schwäne und Stockenten, vielleicht aber auch das kurze Aufblitzen eines Eisvo gels oder das schwungvolle Versinken eines Haubentauchers im Wasser. Sind Sie genug zwischen See, Strassen und Parks flaniert auf der Suche nach Spuren des Lebens und möchten tiefer in die Natur ein dringen, gehen Sie selbstverständlich zum Botanischen Garten hinauf, der sich im be zaubernden Vallon de l’Ermitage befindet. Sie beugen sich über die winzigen Schilder, auf denen lateinische Namen und Herkunfts orte stehen: eine Musik von hier und an derswo und gleichzeitig eine Reise durch die Zeit. Ein fossiles Palmblatt erinnert Sie, falls nötig, an die relative Bedeutung unserer Spe zies, bevor es weitergeht: alpine Steingärten, Bienen, Kräuter, Sie können Atem schöpfen im hohen Gras und nicht mehr an die Stadt denken, den ständigen Bass der Motoren nicht mehr hören (aber noch immer den Ruf der Schiffssirene in der Ferne). Für einen Mo ment befinden Sie sich in der Abstraktion der postindustriellen Zivilisation. Vergessen sind Bildschirme und künstliche Intelligenz, ge nauso wie die Blockchain oder die Besied lung des Mars. Sie beobachten, wie sich ein Schmetterling auf einer Blume niederlässt, und für den Augenblick ist das genug. Sind Puste und Neugier noch nicht erschöpft, gehen Sie weiter hinauf in den Wald von Chaumont bis zum Combacervey-Teich. Im Frühjahr findet man hier Eier, aus denen Kaulquappen schlüpfen, heiss begehrt von den Molchen, die wiederum gerne von Strumpfbandnattern gefressen werden. Über alldem fliegen Libellen, deren abgelegte Haut noch an den Schachtelhalmen haftet und da mit die Erinnerung an ihr früheres Leben.
147
Kommen Sie, beflügeln wir uns selbst, behal ten wir unsere Haut, aber nehmen all diese Schönheit, diese Klarheit, diese Metamorpho sen in uns auf.
148
Die Teile seines Gefieders bewegen sich, als gehörten sie nicht zum selben Leib. Es sieht seltsam mechanisch aus, als wollte er auf die geheimnisvollen Scharniere aufmerksam machen, die die Stadt zusammenhalten.
148
Die Schwäne kommen und gehen so plötz lich und doch ähnlich langsam wie die Streifenwagen, die auf der Seepromenade in Zeitlupentempo auf und ab fahren. In aufreizender Trägheit steuern sie jeden an, der ihren Verdacht erregt. Süchtig nach Be stätigung, wie die Stadtpolizei, fühlen sie sich von jeder Bewegung gemeint, glauben, alles, was da ins Wasser falle – auch ein E-Bike –, sei für sie bestimmt. Hochnäsig werfen sie ihre Hälse zurück, während sie ihre Bewun derer mustern. Keiner der da Sitzenden ist es wert, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie brauchen keine neuen Freunde, bewegen sich in alten Kreisen. Nichts kann sie über raschen. Unberührt bieten sie Hunderten von Handykameras die Stirn. «Bro, there is no food», ruft ein junger Mann, der ein Date mit einer freundlichen GothicFrau hat, einem Schwan zu. Dieser hat mit dunkel-gierigem Blick nach seiner Zigarette geschnappt. Die Zürcher Schwäne sind süch
Jede Stadt hat ihre Tiere. Die Katzen Istanbuls, die Hunde Bogotás, die Hühner Kinshasas.
Istanbuls, die Hunde Bogotás, die Hühner Kinshasas. Die Schwäne Zürichs. Zürich und seine Schwäne. Zürich und die tausend Schwäne. Die eigenartigen Schwan schaften zu Z. In den Schwänen findet die Stadt ihren Widerhall. Alles, was es in Zürich gibt, spiegelt sich wider in ihrer Gestalt. Verkleidet in ihre weissen Federn, tritt aus dem dunklen Wasser die Stadt selbst her vor. Während ich das denke, geht ein merk würdiges Flattern durch einen der Schwäne.
Ich sitze am Bellevue auf einer Bank an der Promenade. Es ist neun Uhr abends, der See schimmert in einem silbrigen Blau. Leute essen am Wasser Oliven und Sushi, trinken aus Plastikbechern Aperol Spritz, viele Spra chen sind zu hören. Der See schwappt über das Ufer. Die Schwäne schwimmen höher als Diesonst.Katzen
Das unabhängige Magazin für grosse Reportagen. Jetzt gratis
Unverbindlicheswww.reportagen.com/geschenkprobelesen!AngebotohneautomatischeVerlängerung.
Basel ist im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik ein Pionier und national wie auch international ein Vorbild: So betreibt Basel das grösste Fernwärmenetz der Schweiz und der Strom des regionalen Energieanbieters stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Zudem werden energetische Sanierungen, effiziente Neubauten und Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer Energie bereits seit 1984 mit Förderbeiträgen unterstützt.
HeckhausenPhilipFoto:/BaselinEnergieundUmweltfürAmtsdesNeubau
Neuster Pionierstreich ist der Neubau des Amts für Umwelt und Energie, der seinen Strombedarf mit einer kunstvollen Photovoltaikfassade und dank opti miertem Gebäudekonzept selber decken kann. Dabei verfolgt Basel ein ehrgeiziges Ziel: netto null Treibhausgasemissionen bis 2040. www.basel.ch CityBasel
Städtetag 2022 125 Jahre SSV
151
tige Schwäne. Abends sieht man sie nervös am Ufer des Bürkliplatzes herumlungern, sich mit ihren Schnäbeln kratzen und plötz lich aus dem Schlaf auffahren. Sie leben prekär, doch geniessen sie einen gewissen Schutz. Dass kürzlich einer von ihnen mit einem Messer geköpft wurde, blieb nicht un gestraft. Fischige Luft hängt über ihrem Schlafplatz, und das sonst so makellose Ge fieder wirkt gelblich und eingefallen. «Du Model!», sagt die Gothic-Frau zu einem jungen Schwan, der noch braune Stellen trägt und eine feine Punkfrisur. Und dann, während er faucht: «Oh, der ist wütend.» Er: «Aber so entstehen Bilder!» Stolz zeigt er ihr seine Aufnahmen. Sie sprechen über die Stadt. «Ich habe mir so lange richtige Freunde gewünscht, bis ich gemerkt habe, dass sie vor meiner Nase herumlaufen.» Der junge Mann stammt nicht aus Zürich, fühlt sich aber nun wohl hier und tunkt seine Füsse ins Wasser. Alles, was er sagt, klingt weise. Geläutert? Sie, die Gothic-Frau, lächelt. Es ist eine gnädige Geste der Stadt, dass sie einen Bescheidenheit und Resignation nur schlecht voneinander unterscheiden lässt. Die Lebensqualität in der Stadt Zürich, heisst es in den oft zitierten Statistiken, sei hoch. Man kann sich nicht beschweren. Und er ist ja auch wirklich schön, der See. Die Bäume sind grün. Die Luft ist gut! Wer hier länger lebt, kann sich schlecht dagegen wehren: Ei nes Tages wird sie oder er erschrocken feststellen, auf eine realistische Weise zu frieden geworden zu sein. Es geschah schleichend. Wut und Auflehnung haben ihren Weg in die dafür bestehenden Ein richtungen gefunden und einem Realitäts sinn Platz gemacht, der anerkennt, dass die Leute Verschiedenes wollen, Ungerechtig keiten von Mehrheiten gewollt sind. Ein blaues Tram gleitet über die Quaibrücke. Feine, klebrige Mücken schwirren fast unmerklich in der Luft.
Aber Zürich, denke ich, du blaue, graue, schimmernde, leuchtende, geblendete, matte Stadt der latenten Sattheit und des Hungers danach, warum machst du mich so ungeduldig? Was ist nur mit dir los? Abendröte ist aufgezogen. Ein dunkles Schiff gleitet über den See, und der Mond ist auf gegangen. Unparteiisch hängt er am blau grauen Himmel. Die Federn haben sich mit einem samtenen Dunkelblau vollgesaugt und überqueren die von feinen Wellen zer furchten Lichtsäulen. «Ich würde dich voll gern streicheln», seufzt die Gothic-Frau sehn süchtig. Sie sagt es zu einem Schwan, aber es klingt, als spräche sie zu der Stadt selbst. Doch das Tier entzieht sich ihr und schwimmt weg. «Hast du Stress, Mann?», ruft sie ihm ver letzt hinterher. Die Schwäne machen jetzt Geräusche, die ich von Fröschen kenne. Ach, Z.! Kannst du denn nicht lieben? Täg lich beobachte ich dich, umwerbe dich, schmeichle dir. Das kleinste Zeichen deiner Liebe stimmt mich versöhnlich, erfüllt mich mit Glück und Hunger nach mehr. Und du? Was willst du? Wo bist du? Wann kommst du, Z.? Das Wasser liegt nun schwarz in der Bucht, die Trams leuchten. In der Zwischen zeit haben die Schwäne begonnen, mit dem Schnabel das Wasser abzuklappern, als such ten sie etwas, was auch ich suche. Sie sind auf der Spur. Eines Tages werden sie den richti gen Stoff finden, ihn mit ihren Schnäbeln aus dem Wasser klopfen und schnatternd be ginnen mit dem, was fehlt. Und bis dahin … Warum nicht eine neue Brille kaufen, einer seriösen Arbeit nachgehen, ein Tinder-Profil erstellen, den Laptop zum Apple Store bringen? Es gibt auch Museen, manche sind sogar gratis! Und Partys. Den Zoo, die Stadtgärtnerei, das Freibad Letzigraben. Die Schwäne, wie gesagt. Das Litera turhaus. Und gute Freunde. Sogar Liebe. Also gut!
Wir danken für die Unterstützung von: 152 VERLAGIMPRESSUMPuntas Reportagen AG REDAKTION Reportagen, Monbijoustrasse 36, 3011 Bern, T +41 31 981 11 14, redaktion@reportagen.com CHEFREDAKTOR Daniel Puntas Bernet daniel.puntas@reportagen.com REDAKTION Daniel B. Peterlunger, Juliane Schiemenz, Rocío Puntas Bernet, Raffaela Angstmann, Dmitrij Gawrisch, Christoph Dorner STÄNDIGE AUTOREN Amir Hassan Cheheltan, Barbara Bachmann, Dmitrij Kapitelman, Erwin Koch, Florian Leu, Urs Mannhart, Sandro Mattioli, Linus Reichlin, Marzio G. Mian, Sabine Riedel, Christian Schmidt, Daniela Schröder, Margrit Sprecher, Michael Stührenberg ART DIRECTION UND GESTALTUNG Moiré: Marc Kappeler, Dominik Huber, Vera Rijks, www.moire.ch, hello@moire.ch MARKETING UND VERTRIEB Lucas Hugelshofer, lucas.hugelshofer@reportagen.com KORREKTORAT Andrea Suter, Gorica Jakovljevic ABONNEMENTE Michael michael.borter@reportagen.comBorter, ANZEIGENLEITUNG Ivo ivo.knuesel@reportagen.comKnüsel, SCHRIFT GT Sectra (www.grillitype.com) ILLUSTRATION COVER UND RUBRIKEN Gregory Gilbert-Lodge KARTE Martin Woodtli BACKCOVER Claudia Blum PAPIER Lessebo 1.3 Natural 115 gm2, CO2-neutral, FSCzertifiziert DRUCK Druckerei Odermatt AG, Dallenwil BUCHBINDER: Buchbinderei An der Reuss, Luzern Printed in Switzerland © 2022 Puntas Reportagen AG © für die Texte: Reportagen und die Autoren © für die Illustrationen/Grafiken: die Gestalter VERTRIEB CH 7Days Media Services GmbH VERTRIEB D/A IPS Pressevertrieb GmbH Postfach 12 11, 53334 Meckenheim ERSCHEINUNGSWEISE 6 x jährlich www.reportagen.com Reportagen ist Mitglied von Select, dem RechercheNetzwerk unabhängiger Magazine rund um den Globus. Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, nutzen wir gelegentlich das generische Maskulinum. In diesem Fall ist eine Personen- oder Berufsbezeichnung gemeint und kein biologisches Geschlecht. und von:
Abonnieren Sie Reportagen. Weltgeschehen im www.reportagen.comKleinformat.