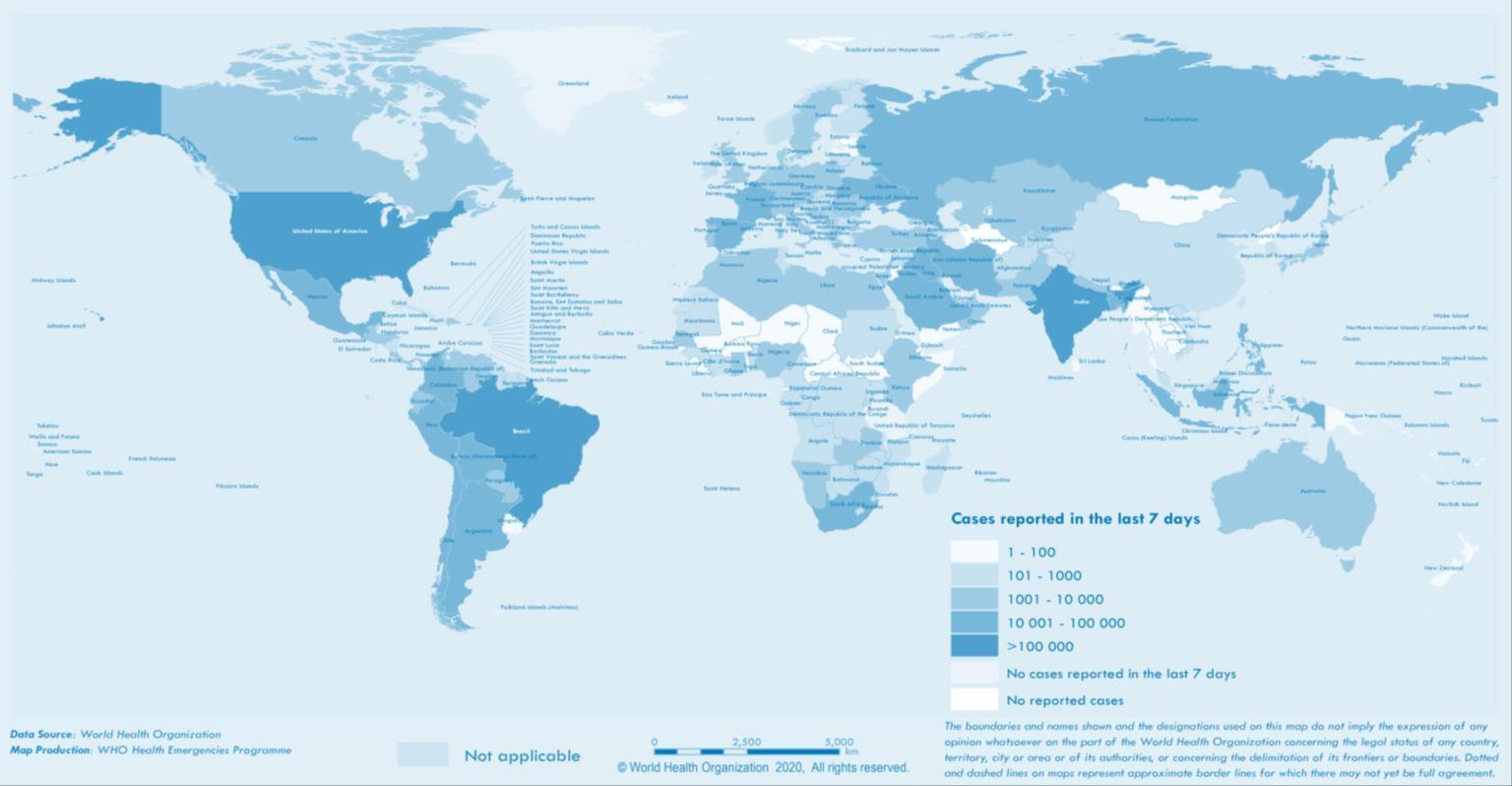September 2020 GLOBALER WACHSTUMSAUSBLICK
Gefährdete Erholung Impulse für die Weltwirtschaft nötig
▪
Die Weltwirtschaft wird dieses Jahr kräftig schrumpfen, ein Einbruch um gut viereinhalb Prozent ist wahrscheinlich. Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird bestenfalls anderthalb bis zweieinhalb Jahre benötigen; in einigen Schwellenländern sogar eher fünf. Das Risiko für hoch verschuldete, schlecht regierte oder anderweitig verwundbare Länder, in einen gefährlichen Mix aus Banken-, Finanz- und Währungskrisen abzurutschen, bleibt atypisch hoch.
▪
Deutschland kommt in diesem Jahr unter den 19 Eurostaaten laut Prognose der EU-Kommission vergleichsweise moderat durch die Krise. In 15 Volkswirtschaften sackt die Konjunktur stärker ab. Dafür rangiert das deutsche Wachstum 2021 nur auf Platz 17.
▪
Es zeichnet sich deutlich ab, dass Unsicherheit und Zurückhaltung bei Verbrauch und Investitionen noch anhalten, bis eine Impfung der Mehrheit der Bevölkerung erfolgt. Dies dürfte selbst in den optimistischsten Einschätzungen frühestens zum Jahresende 2021 in den ersten Ländern erreicht werden.
▪
Die Finanzpolitik muss von der Stützung von Unternehmen und Arbeitnehmern zur Ankurbelung von Investitionen umschalten. Die EU wird erstmals starke Impulse setzen, die aber erst im nächsten Jahr wirken (Next Generation EU).
▪
Der weltweite wirtschaftspolitische Auftakt im Kampf gegen die Pandemie war nicht übermäßig koordiniert, aber weitgehend zielgerichtet und adäquat. Der gesundheitspolitische Start blieb bislang viel schwerer. Die internationale Zusammenarbeit in Pandemiebekämpfung und Prävention muss deutlich besser werden. Wechselseitiges Lernen, wie Tests, Nachverfolgung, Identifikation und Isolation am besten funktionieren, ist nötig. Internationale Kooperation auf dem Weg zur Impfung der Bevölkerungen ist vordringlich.
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Inhaltsverzeichnis Die Pandemie bringt die Weltwirtschaft auf die schiefe Bahn ....................................................... 3 Die Entwicklung der Pandemie .......................................................................................................... 5 Wirtschaftliche Folgen der Pandemie ............................................................................................... 7 Weltweite Industrieproduktion: Alle Regionen von Corona-Pandemie betroffen ...................... 13 Welthandel ......................................................................................................................................... 17 Ausländische Direktinvestitionen ................................................................................................... 17 Finanzpolitik auf Expansionskurs ................................................................................................... 18 Notenbanken flankieren die Konjunkturstimulierung ................................................................... 20 USA ..................................................................................................................................................... 21 China: Einbruch überwunden, nachhaltiges Wachstum gesucht ................................................ 26 Japan: kräftige Rezession bei milder Epidemie ............................................................................. 30 Europäische Union und Euroraum .................................................................................................. 31 Deutschland ....................................................................................................................................... 36 Vereinigtes Königreich ..................................................................................................................... 36 Regionaler Ausblick .......................................................................................................................... 37 Fazit .................................................................................................................................................... 41 BOX: Geldpolitik in der Pandemie ................................................................................................... 42 Quellenverzeichnis ............................................................................................................................ 45
2
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Die Pandemie bringt die Weltwirtschaft auf die schiefe Bahn Die weltwirtschaftliche Entwicklung wird in diesem Jahr in einem einmaligen Ausmaß von der COVID19-Pandemie dominiert. Diese ist auf globaler Ebene durch weiterhin stark steigende Infektionen geprägt. Die akuten Herde des Infektionsgeschehen haben sich zwar von China über Europa nach Nordund Südamerika und Westasien verlagert, von einer erfolgreichen weltweiten Eindämmung kann jedoch noch keine Rede sein. Dies dürfte leider auch das weitere Geschehen in diesem Jahr bestimmen. Ob es im nächsten Jahr zu breiteren Eindämmungserfolgen und echten Vorbeugemaßnahmen durch massenweise Impfungen kommen kann, ist zudem weiterhin sehr unsicher. Unbestreitbar ist auch, dass die Vorbeugung und die internationale Zusammenarbeit zur Pandemiebekämpfung weltweit mangelhaft war und nahezu alle Regierungen die Warnungen und Empfehlungen der Wissenschaft nicht ausreichend berücksichtigt hatten (Osterholm und Olshaker 2020). Insofern traf die Pandemie die Welt unvorbereitet. Der wirtschaftliche Schaden liegt allein in diesem Jahr bei einfachster Betrachtung bei gut zehn Billionen US-Dollar (verlorener Output). Es ist bereits jetzt klar, welche grundsätzlichen Folgen diese Entwicklung für die Weltwirtschaft hat. Diese lassen sich in zehn zentrale Punkte fassen: 1. Die weltweite wirtschaftliche Aktivität erlebt einen drastischen Einbruch von ungeahntem Tempo und bislang unbekannter Tiefe. Im ersten Quartal belief sich der Rückgang auf gut dreieinhalb Prozent, im zweiten Quartal ist mit einem weiteren Einbruch um sieben bis acht Prozent zu rechnen. Im besten Fall wird es im dritten und vierten Quartal zu soliden Erholungen in den großen Volkswirtschaften kommen, in anderen Ländern kommt es erst dann zu den größten Schäden. 2. Die gesundheitspolitischen Maßnahmen der Regierungen haben sich in ebenso ungeahntem Tempo und bislang nicht erprobtem Ausmaß entwickelt. In Länder mit frühen stringenten Maßnahmen sind zwar wieder Lockerungen in Kraft getreten, in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern steigt der Restriktionsgrad jedoch noch oder bereits wieder an. 3. Die wirtschafts- und geldpolitischen Notfallmaßnahmen zum Schutz von Unternehmen, Arbeitnehmern, Gebietskörperschaften und Banken- und Finanzmärkten durch Regierungen und Notenbanken sind bereits jetzt größer als je zuvor, absolut und relativ. Diese sind jedoch nur für einen einfachen Verlauf einer raschen Kontrolle der Epidemie dimensioniert worden und müssen ggf. nachgesteuert werden. Die Maßnahmenpakete sind mit wenigen Ausnahmen durchaus angemessen dimensioniert worden. 4. Trotz all dieser Hilfsmaßnahmen verursachen die Pandemie selbst und die gesundheitlichen Gegenmaßnahmen enorm hohe wirtschaftliche Kosten und Risiken für Bürger und Unternehmen in der mittleren Frist. Die Hilfsmaßnahmen sind typischerweise auf die kurze Frist weniger Monate ausgerichtet, decken jedoch in der Regel noch keine absehbaren Strukturbrüche in der Nachfrage, dem Angebot, der Produktionsweise und den Konsumentenpräferenzen ab. Trotz des hohen Maßes an Ex-post-Versicherungsschutz durch Regierungen und Notenbanken bleibt ein hohes Maß an zusätzlicher Unsicherheit für Einkommen und Vermögen von Bürgern und Unternehmen für mindestens noch einige Quartale bestehen. 5. Teilweise Entwarnung in Entwicklungsländern. Die Pandemie hat bislang existierende wirtschaftliche Verwundbarkeiten von Volkswirtschaften noch nicht stark zum Vorschein gebracht.
3
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Das Risiko für viele, zum Teil hoch extern verschuldete, schlecht regierte oder anderweitig verwundbare Länder, im Zuge der nächsten Quartale in den üblichen Mix aus Banken-, Finanz- und Währungskrisen abzurutschen, bleibt jedoch atypisch hoch, zumal bislang nur den ärmsten Ländern finanziell unter die Arme gegriffen wurde. Die reale Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften ist de facto gesunken, und die finanziellen Verpflichtungen werden an diese angepasst werden müssen. 6. Mögliche Strukturbrüche, hohe Unsicherheit, hohe Kosten. Es muss damit gerechnet werden, dass in vielen hart getroffenen Branchen angelegte strukturelle Veränderungen der Nachfrage, der Konsumentenpräferenzen und der geschäftlichen Praktiken durch die Wucht der Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, Kostenerwägungen und die Neubewertung von Entscheidungsfaktoren im Zeitraffertempo beschleunigt werden. Dies hat bereits signifikante Veränderungen in der Bewertung von Branchen, der Marktkapitalisierung von Unternehmen und der Beschäftigung hervorgerufen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass es partiell zu einer Rückkehr zu Vorkrisenmustern kommen kann, in vielen Fällen sind die Brüche aber hart und schnell und erlauben keine graduelle Anpassung. Insofern ist in vielen Branchen eine sehr hohe Unsicherheit über die Nachfragemuster und Geschäftsmodelle bei gleichzeitig extrem hohen Anpassungskosten vorzufinden. Daher bleibt eine aktive Arbeitsmarktpolitik zur Flankierung wichtig. 7. Die Pandemie ist möglicherweise nicht in wenigen Quartalen überwunden. Üblicherweise unterstellen die internationalen Organisationen und die meisten Marktteilnehmer, dass die Pandemie mit einer Spitze, schlimmstenfalls mit zwei Spitzen (im Winter 20/21), im Infektionsgeschehen und Gesundheitsschutz einhergeht und zweite Wellen mit deutlich kostengünstigeren Maßnahmen (testing, tracking, tracing, isolating) eingedämmt werden können. Zudem wird gemeinhin angenommen, dass massenweite Impfungen im Jahresverlauf 2021 erfolgen können. Aus heutiger Sicht sind beide Annahmen optimistisch. Leider kann es auch deutlich schlechter kommen, was an sich die Anzahl, Reichweite und Tiefe permanenter wirtschaftlicher Veränderungen deutlich wahrscheinlicher erscheinen lässt. Zudem sind die für dieses Szenarium notwendigen wirtschaftspolitischen Flankierungen deutlich schwieriger, teurer, strittiger und komplexer. Zudem werden einige Länder an echte Finanzierungsgrenzen stoßen. 8. Die Pandemie hat selbst im günstigsten Verlauf bereits jetzt erhebliche Wohlstandseinbußen hervorgerufen, die die Weltwirtschaft auf einen deutlich niedrigeren Stand des Outputs und des Pro-Kopf-Einkommens herabgeführt haben. Zudem beeinträchtigt die Pandemie die Investitionstätigkeit massiv, erzwingt ineffiziente Distanz- und Vorsorgeregeln in vielen Branchen und senkt damit die totale Faktorproduktivität über im Minimum mehrere Quartale ab und reduziert den Arbeitseinsatz massiv. Mit anderen Worten: die Pandemie senkt somit das Wachstumspotenzial zumindest über einige Jahre ab. Daran können auch die massiven – und überaus notwendigen – nachfrageseitigen Stützungsmaßnahmen nichts ändern, denn diese helfen nur, einen noch stärkeren Einbruch von Einkommen und Produktion abzufedern. Diese Eintrübung des Wachstumspotenzials ist genau das Gegenteil dessen, was die entwickelten Volkswirtschaften benötigt hätten, um besser mit der Sicherung des Lebensstandards in alternden Gesellschaften klar zu kommen. 9. Die langfristigen Folgen von sprunghaft angestiegenen fiskalischen Belastungen der Staaten und finanziellen Verwundbarkeiten bzw. bilanziellen Schieflagen von Unternehmen in der Real- und Finanzwirtschaft werden nach erfolgreicher Eindämmung zu mehrjährigen schmerz-
4
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
haften Anpassungen im staatlichen Leistungsangebot und in der privatwirtschaftlichen Produktion führen, bis die mittelfristige fiskalische Tragfähigkeit der öffentlichen Hand bzw. die nachhaltige Finanzierung von Unternehmen wieder hergestellt sein wird. Die graduelle Anpassung im öffentlichen Sektor sollte in den meisten Ländern angesichts relativ kommoder Finanzierungskonditionen leichter, dosierter und zeitlich gestreckter möglich sein als in den meisten durch Strukturbrüche, Konsolidierungen und Anpassungen geprägten Branchen der Privatwirtschaft. 10. Der politische Handlungsspielraum demokratischer Regierungen für die Bewältigung anderer Aufgaben wird durch die Pandemiebewältigung deutlich eingeschränkt. Da kurz- und möglicherweise auch mittelfristig kaum eine Alternative zur umfassenden Stützung von Einkommen und Produktion besteht, können fiskalische und politische Spielräume für andere große Aufgaben wie die Steigerung der Produktivität, die Verbesserung der Einkommens- und Vermögensgleichheit und den Klimaschutz nicht vollumfänglich verfolgt werden. Insbesondere in Europa und Japan wird derzeit der Versuch unternommen, Stützungs- und Transformationsaufgaben zu koppeln, in anderen Weltteilen könnte sich dies auch abzeichnen.
Die Entwicklung der Pandemie Sich verlagernde Herde Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie ist im ersten Halbjahr durch eine große Dynamik geprägt gewesen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist im August auf über 24 Millionen angestiegen,
Ausbreitung der Covid-19-Infektionen weltweit*
*bestätigte Fälle. Stand 16. August 2020 Quelle: WHO
5
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
gut die Hälfte der Infektionen entfällt auf Nord- und Südamerika (53 Prozent), etwa 17 Prozent auf Europa. Mitte August war bislang die Spitze bei knapp 300 Tausend täglichen Neuinfektionen erreicht, seither sinkt der Wert leicht. Während China zum Jahresbeginn und Westeuropa in den Monaten März bis Mai im Zentrum des Infektionsgeschehens standen, sind die Vereinigten Staaten, Südamerika, v.a. Brasilien, Chile und Peru, sowie Südwestasien in den Sommermonaten am stärksten betroffen gewesen. Muster der Pandemiebekämpfung Die Regierungen fast aller betroffenen Länder haben mit einer Vielzahl von Maßnahmen auf die Pandemie reagiert; in Europa hat anfänglich das Vereinigte Königreich gezögert, und Schweden hat spät und mit geringerer Dosis reagiert. Es hat sich gezeigt, dass ein möglichst rasches Durchgreifen bei den Quarantänebestimmungen, ein gutes Management der Krise durch die Regierung und die Einhaltung restriktiver Verhaltensregeln durch die Bevölkerung wesentliche Erfolgsfaktoren sind. Derzeit sind insbesondere in Nord- und Südamerika, in großen Teilen Afrikas und Asiens noch besonders restriktive Bestimmungen in Kraft. Stringenz der gesundheitspolitischen Maßnahmen, September 2020
Quelle: Hale, Thomas, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government.
Dabei haben sich mittlerweile drei Ländergruppen herauskristallisiert. Die erste Gruppe umfasst China, Südkorea, Japan, Westeuropa, Kanada und Australien. Dort sind die Quarantänemaßnahmen im ersten Schritt erfolgreich gewesen und haben zu einer drastischen Eindämmung der Pandemie geführt. Seither flackern zwar immer wieder lokale Infektionsherde auf, bislang jedoch ohne rasche Verbreitung. In der zweiten Gruppe befinden sind Länder, deren erste Welle noch nicht eingedämmt ist. Dazu zählen die Vereinigten Staaten, Brasilien, Chile, Mexiko, Indien, Russland und Süd-Afrika. In der dritten
6
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Gruppe finden sich Länder, die bereits eine zweite Welle durchlaufen. Vor allem zählen dazu Israel und der Iran. In einigen Ländern in Europa sind die Infektionszahlen auch erneut stark angestiegen, so in Frankreich und Spanien. Die Lockerungen der Beschränkungen sind daher sehr unterschiedlich verlaufen. Eine Forschergruppe an der Universität Oxford hat einen Gesamtindikator für die Strenge der Maßnahmen gebildet, der dies gut abbildet. Stringenzwerte der Gesundheitspolitik in ausgewählten Ländern 120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20 0
0 China Japan Russland
USA Brasilien Indien
Deutschland Italien V. Königreich
Frankreich Spanien
Quelle: Hale, Thomas, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government.
Es besteht ein lockerer umgekehrter Zusammenhang zwischen der Strenge der Quarantäne und Beschränkungen und der wirtschaftlichen Aktivität. Es hat sich zwar gezeigt, dass die Strenge der Maßnahmen allein nicht sehr viel über die wirtschaftlichen Schäden aussagt, da es auch sehr auf Verhaltensänderungen der privaten Haushalte, Veränderungen im Außenhandel und Transportwesen und andere Faktoren ankommt (IfW 2020). Gleichwohl spielt es natürlich für die breiteren gesellschaftlichen Folgen eine wichtige Rolle.
Wirtschaftliche Folgen der Pandemie Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben in der überwiegenden Anzahl der Industrieländer sehr ähnliche Muster des wirtschaftlichen Einbruchs erzeugt. Sektormuster der Einbrüche überall ähnlich Die OECD (2020: 62ff.) hat mittlerweile geschätzt, dass pro Monat umfassender Restriktionen für Bürger und Unternehmen durch direkte Effekte eine Wertschöpfung von 20 bis 30 Prozent (im OECDMedian 25 Prozent) verloren geht, was sich im Mittel auf eine Einbuße im BIP von zwei Prozent über das Jahr gerechnet beläuft. Weitere sechs bis acht Prozent an verlorener Produktion kommen typi-
7
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
scherweise durch indirekte Effekte hinzu. Mittlerweile wird deutlich, dass auch nach Aufhebung drastischer Beschränkungen kein normales Zurück auf Platz eins stattfindet, sondern Verhaltensänderungen und Nachfrageeinbrüche gegenüber der Vorkrisenzeit festzustellen sind. Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich zudem erhebliche Sektor- und Branchenunterschiede. So sind naturgemäß der Luftverkehr, die Reisebranche und der Tourismus, das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Kulturwirtschaft, Unternehmensdienstleistungen und personenbezogene Dienstleistungen besonders betroffen. Luftverkehr und Tourismus erleiden oft Einbrüche von in der Spitze mehr als zwei Drittel der normalen Aktivität. In manchen Ländern ist auch die Baubranche betroffen gewesen und musste die Aktivität zurückfahren. Das Verarbeitende Gewerbe erfährt im Schnitt mit gut 30 Prozent ebenfalls einen erheblichen Einbruch. Ähnliche Größenordnungen sind bei den Auswirkungen auf den privaten Verbrauch festzustellen, der in den meisten Ländern um gut 30 Prozent einbricht. Der stationäre Einzelhandel leidet ebenfalls stark unter Mobilitätsbeschränkungen und verändertem Kaufverhalten. Deutschland hatte in diesen Vergleichen Glück, dass nicht ganz so strenge Maßnahmen wie in anderen Ländern ergriffen worden sind und die Baubranche ohne Aktivitätsbeschränkungen blieb. Diese Muster haben naturgemäß für einzelne Ländergruppen ganz unterschiedliche Auswirkungen: insbesondere Volkswirtschaften mit ausgeprägter Spezialisierung im Tourismus und den relevanten Dienstleistungen haben unter den direkten Effekten stark gelitten. Generelles Problem: Unsicherheit und dauerhafte Effekte Bereits nach einem halben Jahr zeichnet sich zudem deutlich ab, dass Unsicherheit und Zurückhaltung bei Verbrauch und Investitionen zumindest noch solange anhalten dürften, bis eine Impfung des Löwenanteils der Bevölkerung erfolgt ist. Dies dürfte selbst in den optimistischsten Einschätzungen frühestens zum Jahresende 2021 in einzelnen Ländern, in der OECD-Welt wohl kaum vor 2022 erreicht werden. Dabei ist noch völlig offen, ob Impfstoffe gefunden werden, wie wirksam diese sein werden, wie rasch diese massenweise bereitgestellt werden können und mit welchen Prioritäten geimpft werden wird. Viele der Verhaltensänderungen und Beschränkungen werden erst dann wirklich aufgehoben werden, wenn de facto ein Großteil der Bevölkerung mit hochgradig wirksamen Stoffen geimpft ist. Insofern muss damit gerechnet werden, dass in den Quartalen bis zu diesem Zeitpunkt eine spürbare Vernichtung von Kapital und eine zumindest mittelfristig höhere Arbeitslosigkeit eintreten werden. Harte Strukturbrüche und hohe Kosten der Reallokation von Kapital und Arbeit sind in diesem Szenario kaum zu vermeiden. Insofern ist bei den Prognosen über die nächsten Quartale und Jahre ein hohes Maß an Unsicherheit unvermeidbar, da das zugrundliegende Pandemie- und Impfszenario nicht bekannt ist. Größte Rezession der Nachkriegsgeschichte Nach dem deutlichen Einbruch der weltwirtschaftlichen Aktivität im ersten Quartal um mehr als drei Prozent und dem erwarteten historisch schwachen zweiten Quartal – die OECD rechnet mit minus 12,5 Prozent – ist für das gesamte Jahr mit einem Einbruch der weltweiten Wirtschaftsleistung von gut viereinhalb Prozent zu rechnen, sollte es bei einem einmaligen Maßnahmenpaket zur Pandemiebekämpfung bleiben. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren etwas besser als von IWF und OECD erwartet, aber natürlich weiterhin dramatisch schlecht. Die Industrieländer dürften nach Ansicht der internationalen Organisationen sogar kumuliert mit acht Prozent schrumpfen, während die Entwicklungs- und Schwellenländer mit drei Prozent zurückgehen
8
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
sollten (IWF 2020, OECD 2020). In vielen Volkswirtschaften ist mit zweistelligen Einbrüchen zu rechnen. Dies gilt vor allem für Deutschlands große europäische Partner: Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Die OECD rechnet auch mit einer Verdopplung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote in den OECD-Ländern auf zehn Prozent. Besonders problematisch ist die Tatsache, dass viele besonders betroffene Branchen durch einen hohen Anteil geringqualifizierter Jobs geprägt sind und die gesundheitspolitischen Maßnahmen daher besonders verwundbare Gruppen trafen. Die OECD geht zudem davon aus, dass im Fall einer zweiten Welle von Infektionen in Ländern mit bereits eingetretener Stabilisierung weitere wirtschaftliche Einbußen in der Größenordnung von etwa der Hälfte der in der ersten Welle erreichten Schäden zu erwarten wären. Die weltwirtschaftliche Leistung würde dann 2021 um weitere vier Prozent schrumpfen, bevor eine echte Erholung einsetzt. Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau in der Produktion würde sich dann bis weit ins Jahr 2023 bzw. in manchen Ländern bis 2024 hinziehen. Der IWF schätzt dies ähnlich ein. Unterstellt wird dabei, dass Regierungen und Notenbanken weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen würden, um die Folgen einer zweiten Welle abzufedern und die gesundheitspolitischen Gegenmaßnahmen dann mit geringerer Stringenz, aber höherer Zielgenauigkeit erfolgen würden.
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts 2020 gegenüber Vorjahr (in Prozent)
Weltwirtschaft
(-4 ½)
Eurogebiet
(-8,0)
Welthandel
(-12,0)
EU
(-7½)
USA
(-6¾)
Deutschland
(-6½)
VR China
2,0
Japan
(-6¼)
Quelle: BDI
Erholung wird Zeit benötigen Die mit erfolgreicher Bekämpfung der Pandemie einhergehende Besserung der wirtschaftlichen Lage wird sehr wahrscheinlich nur langsam erfolgen. Dies liegt vor allem an der wirtschaftlichen Schwächung von Unternehmen, insbesondere in den hart getroffenen Dienstleistungsbereichen, an zunächst durch Insolvenzen verringertem Produktionspotenzial und an der Schwierigkeit für Arbeitnehmer, rasch wieder in alte Arbeitsplätze zurückzukehren oder zu neuen Aktivitäten eingestellt zu werden. Insofern dürften einige Branchen noch mehrere Quartale unter normaler oder voller Auslastung zurückbleiben. So erwartet die OECD zwar ein Wachstum im Jahr 2021 für die Weltwirtschaft in Höhe von 5,2 Prozent bzw. für die OECD-Länder in Höhe von 4,8 Prozent gegenüber Vorjahr (im Szenario mit einer Spitze; im Szenario mit zwei Wellen wären es 2,8 und 3,1 Prozent) und der Währungsfonds 5,4 Prozent für die Welt und 4,8 Prozent für die Industrieländer. Die globale Wirtschaftsleistung wird erst zum Jahresende 2021 (IWF) oder im Laufe des Jahres 2022 (OECD) das Ausgangsniveau des vierten Quartals 2019 wieder erreichen; für die Industrieländer insgesamt wird es in jedem Fall bis 2022 dauern. Dies setzt in beiden Prognosen eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung voraus. Die internationalen Wirtschaftsorganisation haben derzeit noch keine Berechnung vorgenommen, wie sich
9
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
ein mittleres Muster mit mehreren Phasen von Öffnung und Schließung über die nächsten zwei Jahre auswirken könnte. Zwar werden die Schließungen möglicherweise mithilfe von TTTI-Strategien (testing, tracking, tracing, isolating) moderater ausfallen können, gleichwohl könnten sich jedoch in stärkerem Maß Solvenzprobleme zeigen, die mit einer Entwertung des Kapitalstocks und erhöhter Arbeitslosigkeit einhergehen. Währungen und Ölmärkte stark betroffen Die Pandemie hat zunächst nur geringe Verwerfungen an den Devisenmärkten ausgelöst. Eher allmählich hat sich dagegen die reale effektive Abwertung des US-Dollars ergeben. Nach einer anfänglichen Flucht in die Leitwährung der Welt gab der Dollar in den letzten Monaten deutlich nach. So stieg der reale effektive Außenwert zunächst um acht Prozent von Januar bis April an, um dann um vier Prozent bis Juli zu sinken. Spiegelbildlich legte der Euro seit März um sechs Prozentpunkte zu. Ab Mai zog auch der Renminbi wieder deutlich gegenüber dem Dollar an und sank erneut unter die Schwelle von sieben Renminbi pro US-Dollar. Der weltweite Nachfrageeinbruch hat auch zu einem starken Rückgang der Ölpreise geführt. Der Preis dürfte dieses Jahr gut ein Viertel unter Vorjahresniveau liegen; der IWF erwartet einen Preis von 36 US-Dollar in diesem Jahr und von 37,5 US-Dollar im nächsten (einfacher Mittelwert der drei gängigsten Ölsorten). Dies trifft u.a. auch die Ölexportländer hart. So werden die Rezessionen in Russland, Saudi-Arabien und Nigeria alle über fünf Prozent hinausgehen. Rezession trifft privaten Verbrauch, Investitionen, Außenhandel und Arbeitsmarkt Generell gilt, dass diese Rezession von mehreren Quellen gespeist wird. Die Konsumausgaben werden durch Distanzregeln, Schließungen von Geschäften, Einkommensverlusten der privaten Haushalte und einem Vertrauenseinbruch angesichts hoher Unsicherheit über Arbeitsplätze und Löhne beeinträchtigt. Investitionen werden durch Nachfrageeinbrüche, Angebotsunterbrechungen und hohe Unsicherheit über die kurz- und mittelfristigen Absatzperspektiven beschädigt. Dort, wo bereits Lockerungen beschlossen wurden, ziehen die Mobilität, der Stromverbrauch und andere indirekte Indikatoren für die Normalisierung in der Regel nur langsam an.
Wirtschaftsklimaindikatoren*, OECD 101 100 99 98 97 96 95 94 93 Jan 2020
Feb 2020
Mrz 2020
Geschäftsvertrauen (Industrie)
Apr 2020
Mai 2020
Konsumentenvertrauen
Jun 2020
Jul 2020
Leading Indicator (Gesamtindikator)
*saisonbereinigt (Index=100) Quelle: Macrobond
10
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Die Wirkungen der Pandemie auf die Verwendungskomponenten des BIP sind kurzfristig für dieses Jahr recht gut abzuschätzen. So rechnet die OECD mit einem Einbruch des privaten Verbrauchs in Höhe von 8,5 Prozent und der Ausrüstungsinvestitionen in Höhe von 10,5 Prozent. Der Staatsverbrauch wird dagegen überdurchschnittlich mit vier Prozent wachsen. Für das nächste Jahr ist eher mit einer Erholung des privaten Verbrauchs im Zuge einer zumindest partiellen Normalisierung des Konsumverhaltens als der Investitionstätigkeit zu rechnen, die noch etwas länger durch den kombinierten Angebots- und Nachfrageschock gedämpft bleiben dürfte. Die deutlichen Rückgänge beim Außenhandel wirken ebenfalls bremsend auf die Investitionen. Die Pandemie hat auch schmerzhafte Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte. Im ersten Quartal fielen ILO-Angaben zufolge Arbeitsstunden, die 130 Millionen Vollzeit-Arbeitsplätzen entsprachen, weg; im zweiten Quartal weitere 300 Millionen. In Europa sind etwa 20-25 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeitssystemen vor der unmittelbaren Arbeitslosigkeit geschützt worden. Es bleibt abzuwarten, ob die Regierungen diese Regelungen fortführen werden. In den USA ist die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal kurzfristig auf über 14 Prozent angestiegen, sinkt nun aber wieder leicht. Die OECD rechnet für dieses Jahr mit Arbeitslosenquoten in Spanien von mehr als 20 Prozent, in Brasilien von 15 Prozent und in den USA, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich von mehr als zehn Prozent. OECD-weit wird der Schnitt bei knapp zehn Prozent liegen. Tiefpunkt nach Frühindikatoren durchschritten In der Mehrzahl der entwickelten Volkswirtschaften dürfte der tiefste Punkt der wirtschaftlichen Aktivität im Mai oder Juni erreicht worden sein. Seither zeigen die monatlichen Indikatoren wieder leicht nach oben, da sich in einigen Branchen die Aktivität belebt. Daher haben sich die Vertrauensindikatoren der OECD für Verbraucher und Unternehmen auch in den Sommermonaten wieder stabilisiert. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Einkaufsmanagerindizes wider. Die Werte für die Welt sind im Juni bereits wieder auf 48 für Industrie, Dienstleistungen und den Gesamtindex angestiegen und liegen damit nur noch knapp unter der Expansionsschwelle. In China wurde die Expansionsschwelle im Mai, in den USA im Juni und in Deutschland sowie im Euroraum im Juli überwunden. Japan liegt noch gut fünf Punkte darunter.
Einkaufsmanagerindex* Welt 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2020
Feb 2020
Mrz 2020
PMI Verarbeitendes Gewerbe
Apr 2020
Mai 2020
PMI Dienstleistung
Jun 2020
Jul 2020
Aug 2020
PMI gesamt
*PMI Quelle: Market Quelle: Macrobond
11
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Einkaufsmanagerindizes*
65
Deutschland
Euroraum
65 55
55
45
45
35 35
25
25
15
15
5 2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt
60
USA
2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25 2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt *PMI Quelle: Market Quelle: Macrobond
China
60
25 2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt
Die Auftragseingänge weisen jedoch noch eine ausgeprägte Schwäche auf. In den USA lagen die Auftragseingänge für die Industrie im Mai noch 17 Prozent unter dem Januarniveau, in Japan 25 Prozent und in Deutschland sowie im Euroraum je 30 Prozent. In China haben sich die Werte schon im Laufe des März wieder auf Vorkrisenniveau eingependelt. Die internationalen Wirtschaftsorganisationen sehen in ihren Prognosen für 2021 eine weltweit durchgängige Erholung mit relativ starken Wachstumsraten voraus. Dies ist naturgemäß stark getrieben durch die Annahme eines mittleren Szenarios mit entweder einer weiteren Welle Anfang 2021 (OECD) bzw. von der Annahme einer Vermeidung einer zweiten Welle mit stringenten lockdown-Maßnahmen. Die Prognosen für 2021 sind daher mit besonders großer Vorsicht zu genießen. Zwar dürfte sich in einigen hart betroffenen Branchen eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität einstellen. Ob es jedoch zur gesamtwirtschaftlichen Erholung in dem besagten Ausmaß kommen kann, hängt entscheidend von der Tragfähigkeit der Annahmen ab. Es ist ebenfalls gut vorstellbar, dass in einer Vielzahl von
12
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Ländern eine längere Phase des Stop-and-go von Öffnung und Restriktion eintreten könnte, deren wirtschaftliche Folgen gravierend sein dürften. In diesem Szenario wird die staatliche Intervention zur Rettung von Unternehmen und zum Schutz der Einkommen der Bevölkerung unter viel höhere Anforderungen gestellt.
Prognoseübersicht: Wachstum der realen Wirtschaftsleistung 2019/20/21 in Prozent 2020
2021
EUKOM3
IWF1
-6,04
-8,7
5,4
5,24
6,1
-8,0
-7,3
-6,5*
4,5
4,1
4,9*
China
1,0
-2,6
1,0*
8,2
6,8
7,8*
Japan
-5,8
-6,0
-5,0*
2,4
2,1
2,7*
IWF1
OECD2
Welt
-4,9
USA
EU Euroraum
OECD2
-8,3
EUKOM3
5,8
-10,2
-9,1
-8,7
6,0
6,5
6,1
-7,8
-6,6
-6,3
5,4
5,8
5,3
Frankreich
-12,5
-11,4
10,6
7,3
7,7
7,6
Italien
-12,8
-11,3
-11,2
6,3
7,7
6,1
Spanien
-12,8
-11,1
-10,9
6,3
7,5
7,1
V. Königreich
-10,2
-11,5
-9,7
6,3
9,0
6,0
Indien
-4,55
-3,7
1,1*
6,05
7,9
6,7*
Brasilien
-9,1
-7,4
-5,2*
3,6
4,2
1,9*
Russland
-6,6
-5,0*
4,1
1,3*
1,6*
Deutschland
1,2*
1: IWF (2020). Stand Juni. 2: OECD (2020). Stand Juni (single-hit-scenario). *März. Daten für Deutschland ohne Arbeitstagbereinigung. 3: Europäische Kommission (2020). Stand Juli. *Mai. 4: Prognose auf Grundlage von 70 Prozent des Welt-BIP (in Kaufkraftparitäten von 2013) 5: Angaben zu Indien für das Fiskaljahr und in laufenden Preisen
Weltweite Industrieproduktion: Alle Regionen von Corona-Pandemie betroffen Erstmals seit der Finanzkrise im Jahr 2009 dürfte die weltweite Industrieproduktion im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich zurückgehen. Anders als vor elf Jahren, als die Industrien in den entwickelten Volkswirtschaften einen zweistelligen Produktionseinbruch zu verkraften hatten und in den Schwellenländern dagegen nur stagnierten, beeinträchtigt die Corona-Pandemie dieses Mal beide Ländergruppen. Laut Angaben des Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) sank die weltweite
13
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Industrieproduktion im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent. Im Verlauf des zweiten Quartals haben die Aktivitäten nach Durchschreiten des Tiefpunktes im April zwar wieder zugenommen. Im Ergebnis war aber noch ein Produktionsrückgang von 10,6 Prozent zu verkraften. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie weltweit ist seit dem Tief im April (39,6 Punkte) deutlich gestiegen. Mit 50,3 Indexpunkten im Juli bewegt er sich erstmals seit Januar 2020 wieder im Expansionsbereich. Wird bereits ab der zweiten Jahreshälfte das Produktionsniveau des Vorjahres erreicht, dürften die Produktionseinbußen für das gesamte Jahr drei Prozent betragen. Sollte die Erholung erst im vierten Quartal einsetzen, dürfte das Jahresergebnis mit minus sechs deutlich schlechter ausfallen. In den entwickelten Volkswirtschaften sinkt die Industrieproduktion bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2019. Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat sich der Produktionsrückgang mit minus drei Prozent nochmals beschleunigt. Mit dem Einsetzen der Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie kam es im Frühjahr zu einer deutlichen Behinderung der Industrieproduktion, die im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16,7 Prozent nachgab. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie hat sich zwar von seinem Tiefpunkt im April wieder erholt, lag aber im Juli noch immer unterhalb der Expansionsschwelle. Je nach Verlauf dürfte die Industrieproduktion in den entwickelten Volkswirtschaften im Jahr 2020 um minus vier bis minus acht Prozent sinken.
Welt: Industrieproduktion* Schwellenländer entwickelte Volkswirtschaften
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 2016
2017
2018
2019
2020
*Produktionsindex: 2-Monatsdurchschnitt, kalender- und saisonbereinigt in Prozent zum Vorjahr Quellen: Macrobond, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, eigene Berechnungen
Die Industrieproduktion in den Schwellenländern befand sich bis Jahresende 2019 noch auf Wachstumskurs bevor die Ausbreitung des Coronavirus in China ihren Anfang nahm. Gleich im ersten Quartal 2020 sank die Industrieproduktion in den Schwellenländern mit minus 5,3 Prozent im Vorjahresvergleich kräftig. Im zweiten Quartal sank die Produktion im Vorjahresvergleich erneut, mit minus 5,1 Prozent aber deutlich geringer als in den entwickelten Volkswirtschaften. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in den Schwellenländern erholte sich nach seinen Double-Dips im Februar und April sehr schnell und erreichte mit 51,4 Indexpunkten im Juli den höchsten Wert seit 29 Monaten. Je
14
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
nach Verlauf der Erholung dürfte die Industrieproduktion in dieser Ländergruppe im Jahr 2020 um minus zwei bis minus vier Prozent sinken. Industrieproduktion in den entwickelten Volkswirtschaften Euroraum mit stärkstem Einbruch im ersten und zweiten Quartal Nach drei Jahren hat die US-Industrie Ende 2019 ihren Wachstumspfad verlassen und verzeichnete im ersten Quartal 2020 einen Produktionsrückgang um 1,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Im zweiten Quartal sank die Industrieproduktion um 14,4 Prozent. Dies war der stärkste Einbruch seit dem Jahr 2009, als im zweiten Quartal ein Rückgang um 15,1 Prozent zu verzeichnen war. Sollte in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Vorjahresniveau produziert werden, ist im Jahresergebnis ein Minus von drei Prozent zu erwarten, setzt die vollständige Erholung erst im vierten Quartal ein, ein Minus von sieben Prozent. Japans Industrie befand sich bereits seit dem Jahr 2019 in einer Rezession und ist mit einem Produktionsrückgang um 4,2 Prozent im ersten Quartal in das laufende Jahr gestartet. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der Abwärtstrend beschleunigt. Im zweiten Quartal brach die Produktion der japanischen Industrie mit minus 19,3 Prozent im Vorjahresvergleich regelrecht ein. Je nach Stärke und Verlauf der Erholung dürfte die Industrieproduktion im Jahr 2020 um fünf bis neun Prozent zurückgehen.
Entwickelte Volkswirtschaften: Industrieproduktion* restliche entw. Volkswirtschaften Euroraum Japan USA
5
0
-5
-10
-15
-20 2016
2017
2018
2019
2020
*Produktionsindex: 2-Monatsdurchschnitt, kalender- und saisonbereinigt in Prozent zum Vorjahr Quellen: Macrobond, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)
Im Euroraum nehmen die industriellen Aktivitäten bereits seit dem 4. Quartal 2018 ab. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat diesen Schrumpfungsprozess nicht nur verlängert, sondern auch noch beschleunigt. Der Rückgang um 5,9 Prozent im ersten Quartal 2020 und um 20,5 Prozent im zweiten Quartal war jeweils der stärkste innerhalb der entwickelten Volkswirtschaften. Am aktuellen Rand ist die Industrieproduktion zwar wieder kräftig gestiegen. Selbst wenn die Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Vorjahresniveau steigen, dürfte die Industrieproduktion im Euroraum im Vergleich
15
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
zum Vorjahr um sechs Prozent sinken. Wird erst im vierten Quartal wieder auf Vorjahresniveau produziert, liefe dies auf einen Rückgang um zwölf Prozent hinaus. In den restlichen entwickelten Volkswirtschaften ist die Industrieproduktion das erste Mal seit dem Jahr 2009 gesunken. Nach einem Minus von 0,3 Prozent im ersten Quartal gab die Industrieproduktion im zweiten Quartal mit 14,3 Prozent deutlich nach. Für das Gesamtjahr 2020 dürfte der Produktionsrückgang je nach Verlauf und Stärke der Erholung zwischen drei und sieben Prozent betragen. Industrieproduktion in den Schwellenländern Tiefer Einbruch und schnelle Erholung in China; Dauerkrise in Lateinamerika Der Ausbruch der Corona-Pandemie in China gleich zu Jahresbeginn 2020 hat zu einem deutlichen Einbruch der Industrieproduktion (minus neun Prozent) im ersten Quartal geführt. Da es sehr früh gelang, die Ausbreitung der Pandemie im Land einzudämmen und die Produktion wieder hochzufahren, konnte bereits im April das Produktionsniveau des Vorjahres überschritten werden. Im gesamten zweiten Quartal stieg die Produktion im Vorjahresvergleich um 4,3 Prozent. Sollte es im weiteren Jahresverlauf zu keinen weiteren pandemiebedingten Beschränkungen kommen, könnte im Jahresvergleich noch ein positives Ergebnis erreicht werden. In den Schwellenländern Asiens ohne China stieg die Industrieproduktion im ersten Quartal 2020 noch um 1,1 Prozent an. Aus dem kurzen und kräftigen Produktionseinbruch, vor allem im April und Mai, ergab sich für das zweite Quartal 2020 ein Produktionsrückgang von 12,3 Prozent (Vorjahrsvergleich). Sollte bereits in der zweiten Jahreshälfte das Produktionsniveau des Vorjahres erreicht werden, dürften die Produktionseinbußen für das gesamte Jahr drei Prozent betragen. Sofern die Rückkehr auf diesen Wachstumspfad erst im vierten Quartal erfolgt, resultierte hieraus im Jahresvergleich ein Rückgang um sechs Prozent. Neben den asiatischen Schwellenländern kamen im ersten Quartal 2020 auch positive Wachstumsimpulse aus den Ländern Zentral- und Osteuropas. Hier stieg die Industrieproduktion zu Jahresbeginn um ein Prozent. Der konjunkturelle Einbruch erfolgte im zweiten Quartal, er fiel aber mit minus 7,5 Prozent geringer aus als in allen anderen Ländergruppen. Im Jahresergebnis ist je nach Verlauf ein Rückgang um zwei bis drei Prozent zu erwarten. In den Industrien in Afrika und dem Mittleren Ostens sank die Industrieproduktion bereits seit mehr als einem Jahr. Im ersten Quartal 2020 hatte sich der Produktionsrückgang von über vier Prozent zum Jahresende 2019 auf 2,9 Prozent vermindert. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie sank in dieser Ländergruppe die Industrieproduktion im zweiten Quartal dann um 13,7 Prozent, wobei der Rückgang im Verlauf des Quartals noch zugenommen hat. Dies hat zur Folge, dass der Erholungsprozess entsprechend später einsetzt. Im gesamten Jahr 2020 dürfte die Industrieproduktion dieser Ländergruppe im Vergleich zum Vorjahr in einer Größenordnung von drei bis fünf Prozent zurückgehen. Nahezu katastrophal sieht die Situation in Lateinamerika aus. In dieser Region ist seit dem Jahr 2014 in der Industrie ein kontinuierlicher Produktionsrückgang zu beobachten. Obwohl die Covid-19-Pandemie im ersten Quartal noch nicht ausgebrochen war, betrug der Rückgang bereits 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im zweiten Quartal brach die Industrieproduktion mit minus 21,8 Prozent regelrecht ein. Der Produktionsindex sank auf den niedrigsten Wert seit 25 Jahren. Am aktuellen Rand deutet sich zwar eine Erholung an. Im Jahresergebnis dürften die industriellen Aktivitäten in Lateinamerika um sechs bis elf Prozent abnehmen.
16
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Afrika/Mittlerer Osten Lateinamerika Zentral- und Osteuropa Asien (ohne China) China
Schwellenländer: Industrieproduktion* 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 2016
2017
2018
2019
2020
*Produktionsindex: 2-Monatsdurchschnitt, kalender- und saisonbereinigt in Prozent zum Vorjahr Quellen: Macrobond, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)
Welthandel Nach Einschätzung des IWF vom Juni ist der Welthandel schon im vergangenen Jahr nur sehr schwach um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Mit dem Jahreswechsel geriet der globale Warenverkehr dann in den Strudel der Corona-Pandemie. Schon im Schlussquartal 2019 ging das Volumen des Welthandels laut vorläufiger Angaben des Netherlands Bureau for Economic Policy gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zurück. Im ersten Quartal 2020 ist der Welthandel dann um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal eingebrochen. Von dem Einbruch der globalen Handelsströme waren bisher sowohl Industrie- als auch Schwellenländer in ähnlichem Ausmaß betroffen. Der RWI/ISL-Containerumschlag-Index, mit dem die Entwicklung des Welthandels auf Grundlage der Auslastung der weltweit wichtigsten Containerhäfen prognostiziert wird, ist nach einem erheblichen Einbruch zu Jahresbeginn mittlerweile wieder auf Wachstumskurs. Mit einem Wert von mittlerweile 111,5 liegt er aber immer noch um 4,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr geht der IWF von einem historischen Einbruch des Welthandels in Höhe von elf Prozent aus, schaut aber mit einer Wachstumsprognose von acht Prozent für das kommende Jahr vergleichsweise optimistisch in die Zukunft.
Ausländische Direktinvestitionen Die UNCTAD geht von einem dramatischen Rückgang der weltweiten Investitionsströme im Zuge der globalen Corona-Pandemie aus. Die weltweiten FDI-Ströme werden laut OECD World Investment Report vom Juni im Jahr 2020 um bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einbrechen. Ausgehend von einem globalen Investitionsvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2019 würden die Investitionen damit auf unter eine Billionen US-Dollar fallen – so niedrig waren sie zuletzt im Jahr 2005. Ausschlaggebend für den Rückgang sind neben der krisenbedingten Investitionszurückhaltung der Unternehmen die zunehmende Zahl neuer regulatorischer und gesetzlicher Hürden für Auslandsinvestitionen. Der Trend zum Investitionsprotektionismus hat schon vor Corona eingesetzt, beschleunigte
17
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
sich aber durch die Pandemie erheblich. So haben viele Staaten, auch Deutschland (15. AWV-Novelle) und andere EU-Staaten, trotz weltweit einbrechender FDI-Ströme die staatlichen Kontrollen von Auslandsinvestitionen noch weiter verschärft. Für das Jahr 2021 geht die UNCTAD von einem weiteren Rückgang in Höhe von fünf bis zehn Prozent aus, bevor sich die Investitionen erst im Jahr 2022 wieder erholen können.
Finanzpolitik auf Expansionskurs Weltweit haben die Regierungen mit umfangreichen fiskalpolitischen Maßnahmen auf die Pandemiebedingten Einbrüche reagiert. Im Vordergrund standen zunächst Maßnahmen zur Existenzsicherung von Unternehmen und zur Einkommenssicherung von Arbeitnehmern, insbesondere durch Kurzarbeitsregeln und andere Arbeitsmarktmaßnahmen. Darüber hinaus haben viele Regierungen Unternehmensteuern und Sozialbeiträge gestundet, Kredite und Garantien vergeben und Zuschüsse und Eigenkapitalhilfen bereitgestellt. Zudem kamen die normalen Mechanismen der automatischen Stabilisatoren zum Tragen, also höhere Ausgaben in den Arbeitslosenversicherungen und niedrigere Ertrags- und Umsatzsteuereinnahmen. Mittlerweile haben einige Regierungen und Parlamente auch Konjunkturstimuli beschlossen, um die wirtschaftliche Aktivität im Zuge der Lockerung gesundheitspolitischer Maßnahmen zu flankieren. Japan hat Ende Mai mit einem Maßnahmenpaket die Hilfen sogar auf 40 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht. Auch Deutschland hat ein substanzielles Paket verabschiedet. In manchen Ländern sind diese Stimuli aber ausgeblieben oder sehr gering ausgefallen, etwa in Mexiko. Dies alles wird die öffentlichen Haushaltsdefizite in diesem Jahr stark erhöhen. Im Median werden die OECD-Länder einen Anstieg der Defizite um sieben Prozent verzeichnen. Der IWF rechnet weltweit sogar mit Haushaltsdefiziten in Höhe von 14 Prozent im Durchschnitt, 16,5 Prozent in den Industrieländern und 10,5 Prozent in den Schwellenländern. Einzelne Länder werden besonders hohe Defizite aufweisen, u.a. die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Japan, Spanien, Frankreich und Brasilien. Die erwarteten Defizite im Jahr 2021 dürften dabei für die USA noch über zehn Prozent und für das Vereinigte Königreich noch über acht Prozent liegen. Die Schuldenquoten dürften in den meisten Industrieländern in diesem Jahr zweistellig ansteigen und in Griechenland und Italien auf deutlich über 150 Prozent der Wirtschaftsleistung anwachsen. Auch Belgien, Japan, Portugal und Spanien werden sehr hohe Schuldenquoten verzeichnen. Der Schuldenstand wird – auf die Welt gerechnet – erstmal 100 Prozent überschreiten (plus 19 Prozentpunkte). Insgesamt belaufen sich die fiskalischen Programme auf ein Volumen von gut elf Billionen US-Dollar (bei einer weltwirtschaftlichen Leistung von gut 140 Billionen US-Dollar). IWF-Schätzungen zufolge entfällt etwa die Hälfte auf zusätzliche Ausgaben für Konjunktur und Gesundheitssysteme bzw. auf niedrigere staatliche Einnahmen, die andere Hälfte auf Programme zur Stützung von Liquidität und Solvenz, die im Verlustfall haushaltswirksam werden würden. In der G20 liegen die Programme im Schnitt bei sechs Prozent der Wirtschaftsleistung – ein historisch einmalig hoher Wert.
18
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Prognose der Schuldenquote 2020/21*
Prognose des Haushaltssaldos 2020/21* 0
300 250
-5
200 -10 150 -15 100 -20
50
-25
0
2020
2021
2020
2021
*in Prozent des BIP Quelle: IWF
Stabilisierungsmaßnahmen der EU helfen einigen Länder sehr substanziell Die EU wird Kredite in Höhe von 750 Milliarden Euro aufnehmen, um Stimuli bereitzustellen und den Mittelfristigen Finanzrahmen temporär zu erhöhen. 390 Milliarden Euro können als Zuschüsse und 360 Milliarden Euro als Kredite an die Mitgliedstaaten ausgereicht werden. Deutliche Wachstumsimpulse erwarten wir vom Sonderprogramm Next Generation EU (NGEU). Die Einigung muss noch mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden. Das EP wird versuchen, an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungen an der Ratseinigung zum Mittelfristigen Finanzrahmen zu erwirken, insbesondere hinsichtlich der finanziellen Ausgestaltung verschiedener Zukunftsprogramme. Konjunkturell zentral ist das NGEU-Programm. Hauptbestandteil ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. Mit 672,5 Milliarden Euro stehen diesem Unterprogramm knapp 90 Prozent der Gesamtmittel zur Verfügung. Davon stellen 312,5 Milliarden Euro Zuschüsse dar, 350 Milliarden Euro entfallen auf Kredite. 70 Prozent der Mittel sollen in den nächsten beiden Jahren abfließen. Die übrigen zehn Prozent der NGEU-Mittel fließen als Aufstockung in bereits existierende Programme des Mittelfristigen Finanzrahmens. Die Mittel müssen bis 2023 verplant und bis 2026 ausgegeben sein; die ersten Mittel könnten im zweiten Halbjahr 2021 fließen. Dies wird es möglich machen, fiskalische Impulse für öffentliche Investitionen in Höhe von gut zwei Prozentpunkten der Wirtschaftsleistung pro Jahr über mindestens zwei Jahre für einige der am härtesten betroffenen Staaten bereitzustellen. Italien könnte zum Beispiel nach Regierungsangaben 81 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten; dies entspräche 4,5 Prozent des BIP im Jahr 2019. Sollte der Löwenanteil auf die Jahre 2021 bis 2023 entfallen, käme dies einem Impuls von anderthalb Prozent pro Jahr gleich. Spanien könnte knapp 73 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten, was 5,8 Prozent der Wirtschaftsleistung entspräche. Dies entspräche einem Impuls von durchschnittlich knapp zwei
19
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Prozent pro Jahr. Für beide Länder könnten noch Kredite in etwas höherem Umfang aus dem Programm hinzukommen, was konjunkturell die Effekte verdoppeln könnte. Ganz generell gilt für alle Staaten, die Aufbau- und Resilienzprogramme vorlegen und umsetzen wollen, dass die Verwaltungsanforderungen an die rasche Erhöhung der öffentlichen Investitionsausgaben enorm sein werden und insofern eine rasche Aufstellung und Planung sowie nachfolgend eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen nicht leicht werden wird, zumal man nicht über die eingeschliffenen Kanäle der Strukturförderung gehen kann. Bereits zuvor hatten die europäischen Institutionen beschlossen, neue finanzielle Mittel in Höhe von 450 Milliarden Euro über Kredite des ESM, Kreditprogramme der Europäischen Investitionsbank und über das Unionsprogramm SURE (Zuschüsse zu Kurzarbeitergeldzahlungen) anzubieten. Ob und inwiefern diese in Anspruch genommen werden, ist derzeit jedoch noch offen.
Notenbanken flankieren die Konjunkturstimulierung Die großen Notenbanken der Welt haben im ersten Quartal sehr rasch und umfassend auf die Konjunktur- und Deflationsrisiken der Pandemie reagiert. Dazu zählten Zinssenkungen, Wertpapierkaufprogramme, Swap-Abkommen der FED mit einem guten Dutzend anderen Notenbanken zur Sicherstellung von Dollarliquidität, „forward guidance“, also Aussagen zur mittelfristigen Geldpolitik, ggf. die Kontrolle der Zinsstrukturkurve und bankaufsichtsrechtliche Erleichterungen. In manchen Fällen hat die Notenbank auch Kreditrisiken von Gebietskörperschaften oder nicht-finanziellen Unternehmen durch entsprechende Wertpapierkäufe übernommen. Durch dieses aggressive Vorgehen wurde eine erste Verteidigungslinie etabliert, die eine massive Korrektur an den entsprechenden Finanzmarktsegmenten im Zuge von Panikreaktionen verhindert hat. Gleichwohl fielen die Aktienmärkte anfänglich sehr stark, erholten sich aber in der Folge stärker, als es Fundamentaldaten und Konjunkturaussichten nahelegen würden. Die Spreadentwicklung auf den Anleihemärkten verlief dagegen nach Einsatz der Notenbanken moderat.
Leitzinsen im internationalen Umfeld 3
2
1
0
-1
Europäische Zentralbank (Einlagefazilität)
Federal Reserve Bank
Bank of England
Bank of Japan
Quelle: Macrobond
20
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Alle großen Notenbanken stellten von Beginn an klar, dass die Geldpolitik allein mit dem Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs und der Konjunkturstabilisierung überfordert wäre. Insofern war das rasche fiskalpolitische Nachsteuern der Regierungen und der EU überaus notwendig und hat den Druck wieder etwas von den Notenbanken genommen. Erstaunlich ist insgesamt, wie wenige Verwerfungen an den Finanz- und Währungsmärkten angesichts des weltweiten Wirtschaftseinbruchs aufgetreten sind. Neue Entwicklungen sind vor allem von den beiden Prüfrunden für das geldpolitische Instrumentarium der FED und der EZB zu erwarten, in denen die Zielsetzung für die Geldpolitik und das Instrumentarium jeweils leicht angepasst werden dürften (zu den einzelnen geldpolitischen Maßnahmen siehe Box: Geldpolitik in der Pandemie S. 44). Ganz generell ist damit zu rechnen, dass die FED, die EZB, die japanische Notenbank und die Bank of England zumindest für die nächsten zwei Jahre einen klaren expansiven Kurs beibehalten, das Inflationsziel (und dessen Definition) leicht anpassen werden, die Zinsen niedrig halten und die Kaufprogramme durchführen werden. De jure oder de facto wird noch stärker mit forward guidance und dem Management der Zinsstrukturkurve gearbeitet werden. Offen ist, inwiefern speziell gestaltete Kreditprogramme fortgeführt werden. Während die EZB mit der dritten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte derzeit gute Erfahrungen macht, können die Erfahrungen mit den neuartigen Kreditprogrammen der FED, z.B. dem mainstreet lending programme, noch nicht beurteilt werden (Bernanke und Yellen 2020). Zudem wird sich in den nächsten Quartalen das Augenmerk weltweit auch stärker auf den Anstieg notleidender Kredite in den Bankbilanzen richten. Derzeit ist kaum absehbar, inwieweit die implizite Haftungsübernahme für Unternehmenskredite durch die Liquiditätsprogramme der Regierungen wirken und in welchem Umfang darüber hinaus Bankkredite an Unternehmen notleidend werden. In einigen Mitgliedstaaten der EU sind die Liquiditätsprogramme zeitlich befristet worden und laufen im dritten Quartal aus. Die von der EZB befragten Banken erwarten daher eine deutliche Verschärfung der Kreditkonditionen im zweiten Halbjahr.
USA Konjunkturelle Entwicklung Die USA wurden von der Corona-Krise sowohl unter Gesundheitssichtpunkten als auch wirtschaftlich stark getroffen. Seit 2014 hatte die US-Wirtschaft ein stetiges BIP-Wachstum verzeichnet. Dieser Trend wurde im ersten Quartal dieses Jahres unterbrochen. Das US-BIP sank im ersten Quartal des Jahres um fünf Prozent annualisiert. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus in den USA wurde im zweiten Quartal überaus deutlich: Das BIP ging um 31,7 Prozent annualisiert zurück (BEA 2020a). In Anbetracht dieser ersten Zahlen fallen auch die Prognosen für das Jahr 2020 mager aus. Die OECD sieht für die USA einen BIP-Rückgang von 7,3 bis 8,5 Prozent, der IWF schätzt den Rückgang bei acht Prozent des BIP ein (OECD 2020, Internationaler Währungsfonds 2020b). Die Federal Reserve geht aufgrund einer starken Wachstumsprognose für das Jahresende von einem Ganzjahresrückgang von 6,5 Prozent des BIP aus (Federal Reserve 2020). Die US-Arbeitslosenzahlen stellen die Ernsthaftigkeit der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Krise in besonderem Maße dar. Lag die Arbeitslosenquote im Februar noch bei 3,5 Prozent, nahe der Vollbeschäftigung, stieg sie im April um ganze 11,2 Prozentpunkte (der höchste bisher verzeichnete Anstieg) auf 14,7 Prozent an (U.S. Bureau of Labor Statistics 2020). Seither ist die Arbeitslosenquote wieder auf 8,4 Prozent im August zurückgegangen. Die Federal Reserve geht davon aus, dass die Arbeitslo-
21
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
senquote zum Jahresende 2020 bei 9,3 Prozent liegen wird. OECD-Schätzungen zufolge soll die Arbeitslosenquote zwischen 11,3 und 12,9 Prozent im Jahr 2020 liegen (OECD 2020a). Das Congressional Budget Office (CBO) stellt eine optimistischere Prognose mit einer Arbeitslosenquote von 10,6 Prozent im Jahresdurchschnitt 2020 auf (CBO 2020a). Von der Arbeitslosigkeit am härtesten betroffen sind in den USA Selbständige, Zeit- und Niedriglohnarbeiter, Jugendliche sowie Frauen (OECD 2020b). Private Konsumausgaben sind aufgrund der Corona-Krise im März und April um 6,7 Prozent beziehungsweise 12,9 Prozent zurückgegangen (BEA 2020c). Im Mai und Juni nahmen die privaten Ausgaben wieder etwas an Fahrt auf (Mai: plus 8,5 Prozent, Juni: plus 5,6 Prozent). Die OECD rechnet mit einem privaten Konsumrückgang von 7,8 bis 9,4 Prozent. Der Consumer Sentiment Index der University of Michigan, der sich auf Telefonbefragungen zur Einschätzung des gegenwärtigen und zukünftigen Konsumverhaltens stützt, ist ebenso seit Februar eingebrochen. Befand sich dieser Index noch im Februar bei 101,0 Indexpunkten, war er im März auf 89,1 Indexpunkte gesunken und im April auf 71,8 Indexpunkte eingebrochen. Im Mai und Juni gab es mäßige Anstiege mit jeweils 72,3 und 78,1 Indexpunkten (Federal Reserve Bank of Saint Louis 2020). U.S. Consumer Sentiment Index 105 100 95 90 85 80 75 70 2019
2020
Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis
Die Zurückhaltung bei persönlichen Anschaffungen war auch im Kreditverhalten der US-Bürger zu spüren: Die Kreditkartenguthaben sind im zweiten Quartal um 76 Milliarden US-Dollar auf 375 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Die Nicht-Immobilienkredite vermerkten im zweiten Quartal einen noch nie gesehenen Rückgang um 86 Milliarden US-Dollar (New York Federal Reserve 2020). Bis dato sind die Ausfälle und Verzüge von Darlehen und Krediten seit Anfang des Jahres zurückgegangen. Diese Entwicklung ist auf den CARES Act von März 2020 zurückzuführen. Dieser sieht nämlich vor, dass staatliche Studienkreditinhaber bis zum 30. September 2020 keine Zahlungen leisten müssen und dass Immobilienzwangsräumungen unter bestimmten Bedingungen bis Juli/August 2020 nicht erfolgen dürfen. In den USA betragen neben den Immobilienhypotheken (69 Prozent des Kreditwesens, Stand zweites Quartal 2020) auch Studienkredite einen wichtigen Anteil an den privaten Schuldtiteln (elf Prozent des Kreditwesens, Stand zweites Quartal 2020). Die Zahl der Zwangsräumungen war aufgrund des CARES Acts im zweiten Quartal 2020 auf dem niedrigsten Niveau seit 2003. Diese
22
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Entwicklung lässt befürchten, dass – solange keine längerfristige Lösung für Hypotheken und Zwangsräumungen gefunden wird – sich in der Konsequenz höhere Kreditausfallraten sowie eine gestiegene Anzahl an Zwangsräumungen zu einem späteren Zeitpunkt materialisieren könnten. Außenhandel Der US-Außenhandel hatte in der Corona-Krise ebenfalls zu leiden. Im ersten Halbjahr 2020 sind die US-Exporte von Waren und Dienstleistungen um 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Die US-Importe verzeichneten in derselben Zeitspanne ein Minus von 14,2 Prozent (BEA 2020b). Der stärkste Einbruch sowohl bei Importen als auch bei Exporten wurde im Monat April registriert: 20,5 Prozent weniger US-Exporte sowie 13,6 Prozent weniger US-Importe, beides im Vergleich zum Vormonat März. Erst im Juni nahm das US-Außenhandelsgeschäft wieder im Vergleich zum Vormonat an Fahrt auf (plus 9,4 Prozent Exporte von Waren und Dienstleistungen, plus 4,7 Prozent Importe von Waren und Warendienstleistungen). Im Vergleich zum Vorjahresmonat, also Juni 2019, sind sowohl Importe als auch Exporte weiterhin gedämpft (Importe bei minus 24,4 Prozent, Exporte bei minus 19,9 Prozent). Die Aussichten für eine Erholung des Außenhandels bis Ende des Jahres sind entsprechend der Prognosen der OECD wenig vielversprechend. Die OECD schätzt einen Rückgang der USExporte von Waren und Dienstleistungen für das Jahr 2020 um 10,2 Prozent bis 11,1 Prozent. Für USImporte von Waren und Dienstleistungen erwartet die OECD einen Rückgang zwischen zehn Prozent und elf Prozent für dieses Jahr (OECD 2020a).
US-Außenhandel nach Monaten in Milliarden US-Dollar 280 260 240 220 200 180 160 140 2019 Exporte (Waren und Dienstleistungen)
2020 Importe (Waren und Dienstleistungen)
Quelle: Bureau of Economic Analysis
Die durch die US-Administration erhobenen Zölle gegen China und die entsprechenden Retorsionszölle belasten weiterhin den Außenhandel. Nach wie vor ist der US-Durchschnittszoll auf Importe aus China bei einem Rekordzollsatz von 19,3 Prozent sowie der chinesische Durchschnittszoll auf Importe aus den USA bei dem Rekordzollsatz von 20,3 Prozent (Peterson Institute for International Economics 2020). Eine Rücknahme der Zölle würde dem US-Außenhandel dringend benötigte Wachstumsimpulse in der Krise geben. Im jährlichen Bericht des Internationalen Währungsfonds wurde den USA
23
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
dazu geraten, die bestehenden Handelsbeschränkungen aufzuheben, da Zölle und Vergeltungsmaßnahmen die Offenheit und Stabilität des Welthandels untergraben und eine nie da gewesene Eskalationsspirale begünstigen (Internationaler Währungsfonds 2020c). Staatsschulden In Anbetracht der verschiedenen getroffenen fiskalischen Maßnahmen ist ein Anstieg des Haushaltsdefizits nicht überraschend. Das Congressional Budget Office (CBO) veröffentlichte im August eine vorläufige Einschätzung über die Staatsfinanzen im Fiskaljahr 2020 (Oktober 2019 bis September 2020), laut derer das tatsächliche Haushaltsdefizit in den ersten zehn Monaten bei 2,8 Billionen US-Dollar liegt und damit 1,9 Billionen US-Dollar mehr ausmacht als vor der Krisenzeit vorgesehen. Aufgrund der Corona-bedingten Stichtagverschiebung für die Einkommensteuer vom 15. April auf den 15. Juli sind die Einnahmen im Juli um 312 Milliarden US-Dollar höher als normal ausgefallen. Die Ausgaben stiegen im Juli 2020 um 253 Milliarden US-Dollar (also 68 Prozent) verglichen mit dem Vorjahresmonat im Zuge der wirtschaftlichen Maßnahmen für die Eindämmung der Corona-Krise. Die zusätzlichen Ausgaben ergaben sich hauptsächlich aus der Arbeitslosenunterstützung (107 Milliarden US-Dollar), den Corona-Krediten aus dem Paycheck Protection Program, PPE, (26 Milliarden US-Dollar) sowie zusätzlichen finanziellen Mitteln für die Unterstützung der Gesundheitsinfrastruktur (CBO 2020b). Der Anstieg des Haushaltsdefizits und der Staatsschulden wird ebenso von der OECD erwartet. Bezifferten sich die US-Staatsschulden 2019 noch auf 108,5 Prozent des BIP, sollen diese im Jahr 2020 um 23,3 Prozentpunkte bis auf 131,8 Prozent anschwellen (OECD 2020a). Fiskalische Maßnahmen in noch nie gesehenem Ausmaß Der US-Kongress und die Trump-Administration haben mehrere Notfallpakete Anfang des Jahres auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu mildern: Paket I: Am 5. März 2020 verabschiedete der US-Kongress mit überparteilicher Unterstützung ein Notfallpaket in einem Volumen von acht Milliarden US-Dollar (Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020). Schwerpunkt dieses Pakets waren Mittel für Forschung und Entwicklung eines Impfstoffes. Paket II: Am 18. März 2020 wurde ein weiteres Notfallpaket (Families First Coronavirus Response Act) vom US-Kongress verabschiedet. Hierzu gehören unter anderem die bezahlte Freistellung bei Krankheit, kostenlose Tests auf Corona, Lebensmittelversorgung, Arbeitslosenversicherung und die Möglichkeit, Steuerschulden später zu zahlen. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (CBO) schätzt das finanzielle Volumen des Pakets auf fast 200 Milliarden US-Dollar (CBO 2020c). Paket III: Am 27. März verabschiedete der US-Kongress ein drittes Notfallpaket (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act). Dieses Paket wird auf ein Volumen von 1,7 bis zwei Billionen US-Dollar (etwa 10 Prozent des BIP) (CBO 2020d) geschätzt und ist damit doppelt so umfangreich wie die Hilfspakete während der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008/2009. Das Paket beinhaltete: -
500 Milliarden US-Dollar für große Unternehmen in Form von Darlehen und Hilfestellungen für Unternehmen, darunter 58 Milliarden US-Dollar für Kredite an US-Fluggesellschaften;
24
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
-
350 Milliarden US-Dollar an Krediten für kleine Unternehmen (das so genannte Paycheck Protection Program);
-
150 Milliarden US-Dollar an Hilfestellungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister;
-
250 Milliarden US-Dollar Zahlungen an Einzelpersonen mit Einkommen bis 75 Tausend USDollar pro Jahr in Höhe von 1.200 US-Dollar für jeden Erwachsenen sowie 500 US-Dollar für jedes Kind;
-
150 Milliarden US-Dollar an Nothilfezahlungen für Bundesstaaten und lokale Regierungen;
-
250 Milliarden US-Dollar für die Arbeitslosenversicherung. Die Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung wurde um 13 Wochen verlängert und um 600 US-Dollar pro Woche bis Ende Juli aufgestockt. Die Anspruchsberechtigung wurde ausgeweitet, um mehr Arbeitnehmer abzudecken.
Paket IV: Am 23. April 2020 verabschiedete der US-Kongress eine weitere Finanzierung unter dem Namen Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act. Dieses Paket beinhaltete: -
Eine Aufstockung des bereits ausgeschöpften ursprünglich 350 Milliarden US-Dollar umfassenden Topfes für Hilfskredite an kleinere Unternehmen (Paycheck Protection Program) um weitere 310 Milliarden US-Dollar;
-
10 Milliarden US-Dollar für Emergency EIDL Grants (Katastrophenhilfe für Unternehmen)
-
50 Milliarden US-Dollar für den Disaster Loans Program Account (Katastrophenhilfe für Unternehmen)
-
75 Milliarden US-Dollar für Krankenhäuser und Praxen;
-
25 Milliarden US-Dollar für Corona-Tests;
-
2 Milliarden für die Small Business Administration;
-
1 Milliarde für die Seuchenschutzagentur CDC.
Das Paycheck Protection Program, unter dem Arbeitgeber Zuschüsse erhalten konnten, insofern sie ihre Arbeitnehmer weiter beschäftigten, wurde am 5. Juni mittels des Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020 bis zum 8. August verlängert. Trotz des Auslaufens der verschiedenen Corona-bedingten Maßnahmen im August konnten sich die Demokraten und Republikaner bis dato auf kein weiteres Fiskalpaket einigen. US-Präsident Trump erließ daraufhin am 8. August vier Dekrete/Memoranden, die juristisch umstritten sind, da er hiermit das ausschließliche Haushaltsrecht des US-Kongresses umgangen hat. Umstritten ist ebenso, ob diese Dekrete/Memoranden in der jetzigen Form von den US-Bundesstaaten und den jeweiligen US-Behörden erfüllt werden können. Die drei Presidential Memoranda und eine Executive Order sehen Folgendes vor:
25
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
-
Ein Arbeitslosengeld in Höhe von 400 US-Dollar wöchentlich soll zu 75 Prozent aus föderalen und zu 25 Prozent aus Mitteln der Bundesstaaten ausgezahlt werden. Hierfür werden Mittel aus einem föderalen Katastrophenfonds umgeschichtet. Die Finanzierung durch die Bundesstaaten ist jedoch nicht geklärt.
-
Die Federal Housing Finance Agency wird angewiesen, Ressourcen zu prüfen, um Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen von Mietern und Hausbesitzern zu verhindern.
-
Das US-Finanzministerium soll die Eintreibung der so genannten Payroll Tax vom 1. September auf den 31. Dezember verschieben.
-
Inhaber von staatlichen Studienkrediten sollen bis Ende der Corona-Krise keine Zahlungen (inklusive Zinsen) leisten müssen.
Sollte sich der US-Kongress im September doch auf ein neues Finanzmittelpaket einigen, könnten diese präsidentiellen Dekrete und Memoranden zurückgenommen werden. In Anbetracht der kommenden US-Präsidentschaftswahlen wäre eine längerfristige Lösung wichtig, um die Konjunktur und die Unternehmen zu stützen.
China: Einbruch überwunden, nachhaltiges Wachstum gesucht China wurde als erstes Land vom Covid-19-Strudel erfasst und schaffte als erste Volkswirtschaft die Rückkehr zum Wachstum. Nach dem Angebotsschock und dem massiven Einbruch um 6,8 Prozent im Zeitraum von Januar bis März – dem ersten Quartalsminus seit 1992 – schnellte das BIP im zweiten Quartal wieder um 3,2 nach oben. Die Erholung im zweiten Quartal spiegelt in erster Linie eine Stabilisierung und Stärkung der Angebotsseite durch staatliche Impulse wider. Die Nachfrage vor allem von privater Seite hinkt hinterher. Für das erste Halbjahr 2020 ergab sich ein – im internationalen Vergleich kleines – Minus von 1,6 Prozent. Der Primärsektor verzeichnete in diesem Zeitraum sogar ein leichtes Wachstum von 0,9 Prozent, Sekundär- und Tertiärsektor schrumpften um 1,9 bzw. 1,6 Prozent. Verschuldung engt Spielraum ein Die Weltbank hat in ihrem Update zu China Ende Juli die BIP-Prognose im Basisszenario von zuletzt einem Prozent auf 1,6 Prozent für 2020 angehoben. Wir gehen derzeit von einem BIP-Wachstum von zwei Prozent für das Gesamtjahr aus. Dieses auf den ersten Blick positive Szenario wird allerdings dadurch relativiert, dass China als Schwellenland für die Armutsbekämpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen ein weitaus höheres Wachstum benötigt. Ein langfristiges Ziel der Parteiführung um XI Jinping war es, bis Ende 2020 die extreme Armut im Land zu besiegen. Dazu wäre aber wie in den vergangenen Jahren ein Wachstum in der Nähe von sechs Prozent notwendig. Doch die Spielräume sind für den Staat längst eng geworden. Ein vergleichbar massives staatliches Konjunkturprogramm wie nach der Finanzkrise ist angesichts der hohen Verschuldung nicht in Sicht. Nach offiziellen Angaben ist die Gesamtverschuldung von Staat, Unternehmen und Haushalten von 245 Prozent zu Jahresanfang auf 266 Prozent Ende Juni gestiegen. Angesichts der notorischen Intransparenz der Schuldensituation von Lokalregierungen erscheint eine tatsächliche Steigerung von 300 auf 330 Prozent realistischer. Die Weltbank schätzt, dass der bisher angekündigte und eingeleitete fiskalische Stimulus rund fünf Prozent des BIP ausmacht und damit weit unter dem Anteil in der EU, den USA oder Japan liegt.
26
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Zu den staatlichen Stützungsmaßnahmen zählen Steuererleichterungen für die Unternehmen und eine zusätzliche Ausgabe von Staatsanleihen durch die Zentralregierung im Wert von einer Billion CNY (122 Milliarden Euro) sowie im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Anleiheplatzierung durch lokale Regierungen von 2,15 auf 3,75 Billionen CNY (458 Milliarden Euro). Letztere sollen vor allem der Finanzierung der „neuen Infrastruktur (u.a. 5G, industrielles Internet, KI, Verkehrssysteme, Batterieladestationen, Höchstspannungsnetze) dienen. In den Fokus zusätzlicher Kreditvergabe stellt die People’s Bank of China (PBoC) vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die rund 80 Prozent der städtischen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Von außerordentlichen Instrumenten der Geldpolitik sieht die PBoC nach wie vor ab. Überangebot versus Nachfrageschwäche Schon ab März drängte die Zentralregierung die Industrieunternehmen, möglichst rasch die Produktion wiederaufzunehmen. Die vor allem durch den Lockdown in Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei bedingte Disruption der Lieferketten im Land wurde relativ schnell überwunden. Verstärkte Infrastrukturausgaben sorgten für zusätzliche Impulse und einen steigenden Bedarf an Grundstoffen für die Industrie. Am stärksten zog der Baubereich wieder an, als kurzfristig gestoppte Immobilienprojekte wieder aufgenommen wurden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die Branche nach einem Einbruch von 17,5 in den ersten drei Monaten ein deutliches Plus von 7,8 Prozent im zweiten Quartal. Dem Wiedererstarken der industriellen Angebotsseite steht aber nach wie vor eine schwache Nachfrage der Verbraucher gegenüber. Denn statt eines verstärkten Konsums nach dem Lockdown üben sich vor allem einkommensschwächere Schichten nach wie vor in Zurückhaltung. Im Durchschnitt schrumpften die Haushaltseinkommen im Zeitraum von Januar bis Juni real um 1,3 Prozent, die der ländlichen Haushalte sogar um zwei Prozent. Im Gegenzug stieg die Sparneigung der Haushalte deutlich an. Darin spiegeln sich in erster Linie die verschlechterten Arbeitsbedingungen und fallende Löhne der rund 280 Millionen Wanderarbeiter wider. Mittlere und ober Einkommensschichten sind dagegen weniger von Einkommenseinbußen betroffen. Die lückenhafte soziale Absicherung in China, insbesondere der nicht in den Städten registrierten Bevölkerung, stellt hier einen systemischen Nachteil dar und belastet eine breite und nachhaltige Erholung des Konsums. Ein weiterer struktureller Schwachpunkt ist der von privaten kleinen und mittleren Unternehmen geprägte Servicesektor. Dieser wurde von der Pandemie besonders stark gebeutelt. Gerade die Arbeitsplätze im einfachen Dienstleistungsbereich sind häufig prekär. Dagegen werden die vergleichsweise privilegierten Stellen in den großen staatlichen Industrieunternehmen notfalls auch durch administrative Interventionen gesichert. Die makroökonomische Schieflage in Form eines vorauseilenden industriellen Outputs in Kombination mit einer hinterherhinkenden Nachfrage übt dabei deflationären Druck aus. Angesichts des langsameren Wachstums und eines vergleichsweise hohen Zinsniveaus steigt damit das Risiko von Kredit- und Anleiheausfällen. Konjunkturdaten: Tempo der Erholung uneinheitlich Die statistisch erfasste Industrieproduktion (d.h. von Unternehmen mit mindestens 20 Millionen CNY Umsatz) fiel in den ersten sechs Monaten um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem in den ersten drei Monaten ein Einbruch von 8,4 Prozent verzeichnet worden war. Der Trend zeigt aber mit einem Plus von 4,4 Prozent im zweiten Quartal und zuletzt 4,8 Prozent im Juli wieder nach oben. Die Privatunternehmen zeigten sich in der Coronakrise robuster als die Staatsunternehmen. Ihr
27
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Output schrumpfte im ersten Halbjahr lediglich um 0,1 Prozent, die Staatsbetriebe mussten dagegen ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen. Der High-Tech-Sektor, konnte für den Zeitraum bis Juni entgegen dem Trend ein Plus von 4,5 Prozent vermelden. Im Segment der Industrieroboter belief sich das Wachstum auf 10,3 und im Halbleiterbereich sogar auf 16,4 Prozent. Die Investitionen in Sachanlagen gingen von Januar bis Juni um insgesamt 3,1 Prozent zurück. Noch stärker wäre das Minus ohne die staatlichen Stützungsmaßnahmen ausgefallen, denn die privaten Investitionen gingen sogar um 7,3 Prozent zurück. Die Investitionen im produzierenden Gewerbe fielen um 11,7 Prozent, im Infrastrukturbereich war der Rückgang in Höhe von 2,7 Prozent vergleichsweise klein, die Immobilienbranche konnte sogar ein Plus von 1,9 Prozent melden. Die besondere Bedeutung der High-Tech-Industrie spiegelt sich auch hier mit einem Investitionsplus von 5,8 Prozent wider. Dem Gesundheitssektor flossen angesichts der Pandemie 15,2 Prozent mehr an Mitteln zu. Profitieren konnte als Folge des Lockdowns besonders der Online-Handel. Hier schnellten die Investitionen um 32 Prozent nach oben. Nach dem Minus von 5,7 Prozent zu Jahresbeginn zeigt sich der Dienstleistungssektor mit einem leichten Plus von 1,9 Prozent im zweiten Quartal etwas erholt. Doch dahinter verbirgt sich über die verschiedenen Branchen hinweg ein sehr uneinheitliches Bild: So konnten IT-Dienstleistungen in den ersten sechs Monaten einen Zuwachs von 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum melden. Finanzdienstleistungen waren 6,6 Prozent im Plus. Indes musste das arbeitsplatzintensive Hotel- und Gaststättengewerbe im ersten Halbjahr einen dramatischen Einbruch von 28,6 Prozent hinnehmen. Ebenso musste der Einzelhandel im ersten Halbjahr deutlich Federn lassen. Der Absatz von Konsumgütern fiel um 11,4 Prozent. Auch in den letzten Monaten lagen die Umsätze noch im negativen – wenngleich niedrig einstelligen – Bereich. So betrug das Minus im Juni noch 1,8 und im Juli 1,1 Prozent. Der Konsum kann damit nach wie vor nicht die Rolle des Wachstumsmotors spielen. Ein Teilbereich, der von der Corona-Krise profitieren konnte, war der Online-Handel. Dieser legte von Januar bis Juni um insgesamt 7,3 Prozent zu. Da die chinesischen Verbraucher sich zunächst mit Restaurantbesuchen zurückhielten, konnte auch der Lebensmitteleinzelhandel ein Plus von 12,9 Prozent verzeichnen. Der Absatz von Pharmazeutika und Medizinprodukten lag um 5,9 Prozent höher. Eine Berg- und Talfahrt gab es in der Automobilbranche. Nach einem Absatzkollaps von 79,1 Prozent im Februar erholte sich der Fahrzeugmarkt von Monat zu Monat. In der Summe lag im ersten Halbjahr der KfzUmsatz noch um 16,9 Prozent im Rückstand – darunter das Pkw-Segment mit einem Minus von 22,4 Prozent. Bereits im April hatten jedoch die monatlichen Absatzzahlen wieder ins Plus gedreht. Zuletzt lag der Zuwachs im Juli bei 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Pkw-Segment: plus 8,5 Prozent). Für das Gesamtjahr erwartet der chinesische Autoherstellerverband CAAM allerdings nach wie vor ein Absatzminus von rund zehn Prozent. Angesichts des weltweiten Nachfrageeinbruchs kam der Außenhandel des Exportweltmeisters China vergleichsweiche glimpflich davon. In US-Dollar gerechnet fielen die Ausfuhren in den ersten sechs Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent. Die Einfuhren kontrahierten um 7,1 Prozent. Zuletzt zogen die Exporte wieder an. Der chinesische Zoll meldete im Juni erstmals wieder einen leichten Anstieg der Exporte um 0,5 Prozent. Im Juli ging es dann um überraschende 7,2 Prozent aufwärts. Die Importe fielen im selben Monat allerdings wieder um 1,4 Prozent, nachdem sie im Juni um 2,7 Prozent zugelegt hatten. Als Hauptstütze des Exports erwiesen sich neben Elektronikprodukten vor allem medizinische Güter, deren weltweite Nachfrage in Corona-Zeiten geradezu explodierte.
28
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Während die Produzentenpreise (PPI) im ersten Halbjahr um 1,9 Prozent zurückgingen, stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent. Auch im Juli bestand weiterhin auf Herstellerseite deflationärer Druck. Der PPI fiel um 2,4 Prozent. Der Anstieg des CPI betrug 2,7 Prozent. U.a. aufgrund der Hochwassersituation in Zentral- und Südchina verteuerten sich Nahrungsmittel und auch steigende Aufwendungen für Energie heizten die Verbraucherpreise an. Nach einem Rekordanstieg auf 6,2 Prozent auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im Februar lag die städtische Arbeitslosenquote im Juni und im Juli jeweils bei 5,7 Prozent. Jedoch gelten die offiziellen Zahlen notorisch als zu niedrig. Eine Studie der Economist Intelligence Unit vom April schätzte den Arbeitsplatzverlust bei der städtischen Bevölkerung in der Spitze bei bis zu 10 Prozent. Darüber hinaus wird in den Statistiken nicht systematisch erfasst, wie die Lage bei dem Heer der ländlichen Wanderarbeiter aussieht. Neben der Baubranche ist ein großer Teil von ihnen traditionell im von Covid-19 besonders hart getroffenen Servicesektor beschäftigt. Der vom National Bureau of Statistics ermittelte offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des produzierenden Gewerbes stieg im Juli zum fünften Mal in Folge, erreichte 51,1 Punkte und blieb damit nach 50,9 Zählern im Vormonat weiterhin im expansiven Bereich. Der private Caixin Einkaufsmanagerindex sprang im Juli sogar auf 52,8 Punkte. Diese kräftige Erholung der beiden Gradmesser industrieller Aktivität erfolgte allerdings auch nach einem historischen Einbruch (35,7 Punkte beim PMI im Februar). Indes zeigte der offizielle PMI-Subindex für KMUs im Juli eine verstärkte Kontraktion an. Auch die Indizes für Exporte und Beschäftigung blieben im Bereich unter 50 Zählern, verzeichneten aber gegenüber dem Vormonat einen deutlichen Aufwärtstrend. Pläne zur Stärkung der Staatswirtschaft Auf dem Ende Mai verspätet abgehaltenen Nationalen Volkskongress verzichtete die chinesische Regierung erstmals seit 1994 auf die Vorgabe eines konkreten Wachstumsziels für das laufende Jahr. Betont wurden hingegen die „sechs zu schützenden Bereiche“ zur Sicherung von gesellschaftlicher und ökonomischer Stabilität: städtische Arbeitsplätze und Grundversorgung, Funktion der Märkte, Energie- und Lebensmittelsicherheit, Lieferketten sowie die Funktion der Verwaltung auf den unteren Ebenen. Die Rolle der Staatswirtschaft soll künftig weiter gestärkt werden. Dazu verabschiedete die von XI Jinping persönlich geleitete „Zentralkommission zur umfassenden Vertiefung der Reformen“ im Juli einen dreijährigen Aktionsplan für die Reform der Staatsunternehmen. Darin stehen eine verbesserte Marktorientierung sowie eine Ausweitung des gemischten Eigentumssystems auf dem Programm. Die Staatsbetriebe sollen die Entwicklung der Regionen durch Großprojekte vorantreiben. Zudem plant die Regierung „Technologiedurchbrüche“ im High-Tech-Bereich. Ziel ist, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und Lieferketten im Land zu stabilisieren und auszubauen. Geostrategischer Konflikt engt Optionen ein Die Sicherung von Lieferketten ist nicht nur eine Reaktion auf die Disruptionen durch Covid-19, sondern vor allem auch eine strategische Antwort auf den Handelskonflikt mit den USA. Dieser entwickelt sich zunehmend zu einer geopolitischen Konfrontation. Im beiderseitigen Verhältnis spielt das mühsam erarbeitete Phase-eins-Abkommen keine ausschlaggebende Rolle mehr. Kurz nach Unterschrift Mitte Januar warf die Pandemie die ambitionierten chinesischen Verpflichtungen zur Einfuhr von US-Gütern bereits über den Haufen. Die Disruption des Außenhandels ist aber noch das geringere Problem für China. Nach der anfänglichen Vertuschung und der verspäteten Reaktion Pekings auf die Pandemie
29
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
hat sich in Washington über Parteigrenzen hinweg das Misstrauen nochmals dramatisch vertieft. Verschärft wurde die Situation durch die die neue aggressive Diplomatie Chinas sowie die massive Einschränkung der Autonomie Hongkongs mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz. Das macht es der Trump-Administration noch leichter, ihre Eindämmungspolitik und ein wirtschaftliches Decoupling zu rechtfertigen. Das offensive Vorgehen gegen die High-tech-Stars aus dem Reich der Mitte, an erster Stelle Huawei, schnürt deren Zugang zu ihrem strategisch wichtigsten Absatz- und Beschaffungsmarkt nach und nach ab. Doppelter Kreislauf nimmt Fahrt auf Mit den Disruptionen durch die Pandemie und den Handelskonflikten rückt eine Rebalancierung zwischen Heimatmarkt und internationalen Verflechtungen in den Fokus. Im Mai führte der Ständige Ausschuss des Politbüros erstmals den Begriff „Wirtschaft der zwei Kreisläufe“ ein. Diese Idee eines binnen- und eines außenwirtschaftlichen Kreislaufes wird voraussichtlich den konzeptionellen Rahmen des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) bilden. Die Formulierung des Plans wird im Zentrum des Fünften Plenums des 19. Zentralkomitees im Oktober stehen. Der 14. Fünfjahresplan wird dann voraussichtlich um die Jahreswende veröffentlicht. Noch ist das Konzept des doppelten Kreislaufs nur in seinen Grundzügen bekannt. Im Zentrum steht die Sicherheit der Binnenwirtschaft: Heimische Produktion und Absatz sollen weniger anfällig für externe Schocks gemacht werden. Angesichts verstärkter protektionistischer Tendenzen und des globalen Abschwungs will die Staats- und Parteiführung die noch bestehenden Lücken in den Lieferketten durch Onshoring schließen und Rückstände in Kerntechnologien – Stichwort Halbleitertechnologie – durch forcierte Forschung und Entwicklung möglichst rasch aufholen. Dazu soll die Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren soweit wie möglich fortgesetzt und intensiviert werden. Eine Abkoppelung von der internationalen Wirtschaft ist also nicht geplant. Aber es deutet auch nichts darauf hin, dass sich an dem Ziel globaler Technologieführerschaft in diversen Zukunftsindustrien, wie es u.a. im Plan „Made in China 2025“ formuliert wurde, etwas geändert hätte. Dazu gehört, ausländische Anbieter im Land nach und nach zu substituieren und von den internationalen Märkten zu verdrängen. Bisher lässt die Strategie der „Wirtschaft der zwei Kreisläufe“ noch viele Fragen offen: Zum einen werden die USA der technologischen Aufholjagd Chinas nicht tatenlos zusehen. Zum anderen steht und fällt das Konzept mit der inländischen Nachfrage. Diese zu stärken, wird angesichts der Verwerfungen durch die Pandemie gerade im Konsumbereich und Servicesektor in der nächsten Zeit eine große Herausforderung sein. Hinzu kommt die substanziell nach wie vor vorhandene Abhängigkeit der chinesischen Volkswirtschaft vom Export, der immer noch rund 17 Prozent des BIPs ausmacht. Das sind zwar zehn Prozentpunkte weniger als noch vor zehn Jahren. Aber an Chinas Außenhandel hängen laut Handelsministerium weiterhin 180 der 530 Millionen städtischen Arbeitsplätze. Wie unter diesen Voraussetzungen die Binnennachfrage die Abhängigkeit von Exporten konkret ersetzen und die Anfälligkeit für externe Schocks entscheidend reduziert werden soll, bleibt nach den bisherigen Verlautbarungen noch unklar. Pekings Planer haben hier eine harte Nuss zu knacken.
Japan: kräftige Rezession bei milder Epidemie Japan hatte nach einer ersten Spitze von Infektionen im April mit leicht unter Tausend Neuinfektionen pro Tag von Mai bis Juli kaum neue Fälle zu verzeichnen. Seit August liegt der tägliche Wert jedoch wieder deutlich über Tausend. Mittlerweile liegt die Zahl der Infektionen insgesamt über 50 Tausend, die Zahl der Toten überstieg jüngst die Marke von Eintausend. Die Regierung agierte in mehreren
30
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Stufen, jedoch vergleichsweise moderat mit kurzen Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit den restriktivsten Maßnahmen von Mitte April bis Mitte Mai. Gleichwohl reagierte die japanische Bevölkerung und blieb vielen üblichen Aktivitäten fern. Daher brach die Nachfrage nach Dienstleistungen im zweiten Quartal auch um 12,7 Prozent ein. Die Gesamtwirtschaft litt mit 7,8 Prozent auch kräftig. Während die privaten Investitionen nur leicht fielen und die öffentlichen Investitionen anstiegen, brach das Exportgeschäft ähnlich wie in Europa im zweiten Quartal um 18,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal ein, während die Importe stagnierten. Insbesondere die Ausfuhren in die USA fielen sehr stark, darunter die Ausfuhr hochwertiger Automobile um mehr als die Hälfte. Somit ging etwas mehr als die Hälfte des Einbruchs auf den Dienstleistungsschock zurück, während der negative Außenbeitrag den Rest beisteuerte. Auch die Industrieproduktion brach im zweiten Quartal um 20 Prozent ein. Die wirtschaftspolitische Reaktion in Japan zählt zu den stärksten weltweit. Mit zwei Nachtragshaushalten in Höhe von 4,7 Prozent der Wirtschaftsleistung im März und 5,8 Prozent im Mai stützt die Regierung die Wirtschaft. Damit werden die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte gestützt (über Direktzahlungen, Kurzarbeitergeld und Lohnzuschüsse an Firmen), die Lieferketten repariert, die Steuer- und Beitragsstundungen für besonders betroffene Betriebe finanziert und Mietzahlungen subventioniert. Zudem stellt die Regierung über die öffentlichen Banken Liquiditätshilfen zur Verfügung. Auch Fördermaßnahmen für den Tourismus und die Digitalisierung sind im Nachtragshaushalt enthalten. Insbesondere die Maßnahmen zur Stärkung der digitalen Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, zur elektronischen Verwaltung und zur Telearbeit könnten den Strukturwandel in Japan beflügeln. Die OECD schätzt das Volumen aller Maßnahmen auf 42,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der Bankenaufsicht und -regulierung wurden ähnliche Maßnahmen wie in Europa getroffen, um die Schockabsorption über das Kreditwesen zu erleichtern. Das jüngste Infektionsgeschehen stellt weiterhin ein hohes Risiko für den wirtschaftlichen Ausblick dar. Der IWF rechnet derzeit mit einem Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität in diesem Jahr in der Größenordnung von 5,8 Prozent, die OECD mit sechs Prozent. Dies dürfte nur zu erreichen sein, wenn das Exportgeschäft wieder nennenswert anzieht und die Japaner sich wieder sicher genug fühlen, ihre Nachfrage nach Dienstleistungen zu erhöhen. Davon kann derzeit nicht verlässlich ausgegangen werden, weshalb wir mit einem Einbruch von 6¼ Prozent rechnen.
Europäische Union und Euroraum Die Europäische Union und der Euroraum wurden wirtschaftlich von der Pandemie härter getroffen als die Vereinigten Staaten, die Volksrepublik China und Japan. Die harten Quarantänemaßnahmen in Italien, Frankreich und Spanien haben zu schweren wirtschaftlichen Einbrüchen geführt. Für das Gesamtjahr 2020 dürften die EU bzw. der Euroraum auch im internationalen Vergleich mit den anderen großen Volkswirtschaften am schlechtesten abschneiden. Viel hängt davon ab, ob die Eindämmung des Infektionsgeschehens im Herbst und Winter gelingen wird.
31
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Wachstumsprognosen Europa
2020
2021
Belgien
-8,8
6,5
Deutschland
-6,3
5,3
Estland
-7,7
6,2
Irland
-8,5
6,3
Griechenland
-9,0
6,0
Spanien
-10,9
7,1
Frankreich
-10,6
7,6
Italien
-11,2
6,1
Zypern
-7,7
5,3
Lettland
-7,0
6,4
Litauen
-7,1
6,7
Luxemburg
-6,2
5,4
Malta
-6,0
6,3
Niederlande
-6,8
4,6
Österreich
-7,1
5,6
Portugal
-9,8
6,0
Slowenien
-7,0
6,1
Slowakei
-9,0
7,4
Finnland
-6,3
2,8
Euroraum
-8,7
6,1
Quelle: Europäische Kommission
Die wirtschaftliche Aktivität ist in der EU im ersten Quartal um 3,2 Prozent und im zweiten Quartal weitere 11,6 Prozent (jeweils gegenüber dem Vorquartal) eingebrochen (Euroraum: 3,6 Prozent und 12,1 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr fiel die Leistung um 2,5 (3,1) Prozent im ersten und um 14,4 (15) Prozent im zweiten Quartal. Besonders hart getroffen hat es Spanien (Q2: minus 18,5 Prozent), Portugal (minus 14,1 Prozent), Frankreich (minus 13,8 Prozent) und Italien (minus 12,4 Prozent). Deutschland schnitt mit einem Rückgang von 9,7 Prozent noch unter Schnitt ab. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum stieg bislang jedoch nur auf 7,8 Prozent an (Vorjahr: 7,5 Prozent im Juni). Die Inflationsrate fiel im April unter die Schwelle eines halben Prozents ab.
32
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Die gesamtwirtschaftliche Erzeugung dürfte im laufenden Jahr um etwa acht Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken; die Kommission hatte vor Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal noch mit 8¾ Prozent gerechnet. Die Einbrüche in Frankreich, Italien und Spanien dürften knapp über zehn Prozent betragen. In einigen Staaten sollte der Einbruch weniger als sieben Prozent betragen (Dänemark, Deutschland, Finnland, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien, Schweden und Ungarn). Zuletzt haben sich zwar einige Indikatoren wieder deutlich gebessert, da in allen Ländern die härtesten Maßnahmen beendet worden sind. So stieg der Stimmungsindikator für die Wirtschaft in der EU bzw. dem Euroraum von Mai bis Juli wieder deutlich an, lag aber noch immer 20 Indexpunkte unter Vorkrisenniveau (nach 40 Punkten im April). Zudem erreichten die Einkaufsmanagerindizes für die EU bzw. den Euroraum im Juli fast durchgehend wieder Expansionsniveau (der Indikator für die Bautätigkeit blieb leicht unter der Schwelle), und dies auch in den drei hart getroffenen großen Volkswirtschaften. Einen weiteren Lichtblick boten die Einzelhandelsumsätze in der EU bzw. dem Euroraum, diese stiegen im Juni sogar über das Vorkrisenniveau vom Februar an und lagen gut ein Prozent über dem Vorjahreswert; in Deutschland, Italien und Spanien lagen die Werte noch leicht unter Februarniveau. Frankreich Mit über 30 Tausend Todesfällen ist Frankeich eines der von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen europäischen Länder. Die am 17. März 2020 verhängte rigide Ausgangsperre und die übrigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus in Frankreich haben sich zunächst ausgezahlt. Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen. Seit Juni 2020 gelten keine Ausgangsbeschränkungen mehr und das öffentliche Leben wurde wieder aufgenommen. In Geschäften und öffentlichen Transportmitteln gibt es eine Maskenpflicht und Telearbeit ist weiterhin das präferierte Modell. Abstands- und Hygieneregeln sowie die Einführung der App StopCovid sollen helfen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten. Seit einigen Wochen steigen die Fallzahlen jedoch wieder leicht. In einzelnen Départements gilt nun auch eine Maskenpflicht im Freien. Die Wirtschaftsleistung lag Ende des zweiten Quartals 19 Prozent unter dem Vorjahreswert, der Einbruch gegenüber dem ersten Quartal lag mit 13,8 Prozent auch über dem EU-Schnitt. Die privaten Konsumausgaben waren um elf Prozent, die Ausrüstungsinvestitionen um 18 Prozent und die Staatsausgaben um acht Prozent gefallen. Die Exporte fielen um 26 Prozent, und der Außenbeitrag reduzierte die Wirtschaftsleistung um 2,8 Prozentpunkte. Zur Stützung der Wirtschaft hat die französische Regierung seit Mitte März eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der COVID-19-Krise abzufedern. Ein Fiskalpaket von 110 Milliarden Euro (knapp fünf Prozent des BIP) wurde verabschiedet. Darüber hinaus wurden eine Reihe von Anpassungen im Steuerbereich eingeführt sowie zusätzliche staatliche Garantien und Kredite gewährt. So sichert der französische Staat beispielsweise mit Garantien auf Bankenkredite in Höhe von bis zu 315 Milliarden Euro die Liquidität der Unternehmen ab (14 Prozent des BIP). Für Unternehmen, die in eine Schieflage geraten sind, wurden bereits über 100 Milliarden Euro an direkten Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt, mehr als in jedem anderen Mitgliedstaat (Anderson et al 2020; Deutsche Bank Research 2020c). Die gebührenfreie Rückzahlung von Firmenkrediten wird von den Banken um sechs Monate verlängert. Außerdem können Unternehmen die Staffelung und Stundung von Sozialabgaben, Steuern, Mieten, Wasser-, Gas- und Stromrechnungen beantragen. Für stark gefährdete Kleinstunternehmen wie Hotels und Gaststätten gibt es einen Zuschuss von bis zu 3.500 Euro. Am 14. Mai kündigte Premierminister Philippe darüber hinaus einen Solidaritätsfonds zur Stützung der schwer gebeutelten französischen Tourismusindustrie an. Bis Ende 2020 werden bis zu 18 Milliarden
33
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Euro für Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Außerdem hat die Regierung ein Investitionsprogramm für die Tourismusbranche von 1,3 Milliarden Euro initiiert. Die französische Regierung stellte Anfang September ein weiteres Maßnahmenpaket zur wirtschaftlichen Erholung in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro (vier Prozent des BIP) vor. In diesem sind 35 Milliarden Euro für steuerliche Erleichterungen für die Industrie und Fördermaßnahmen für Innovation, eine gleich hohe Summe für regionale Strukturpolitik und Qualifizierungsmaßnahmen, sowie spezifische Förderprogramme für Wasserstoff (neun Milliarden Euro), die Bahn (4,7 Milliarden Euro) und die Wärmedämmung von Gebäuden (6,7 Milliarden Euro) vorgesehen. Die Europäische Kommission prognostiziert in ihrer aktuellen Sommervorhersage für Frankreich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 10,6 Prozent 2020, im Frühjahr war sie noch von minus 8,2 Prozent ausgegangen. Im kommenden Jahr könnte das BIP dann wieder um 7,6 Prozent wachsen. Die Arbeitslosenquote wird laut Frühjahrsprognose von aktuell 8,5 Prozent auf voraussichtlich 10,1 Prozent ansteigen (9,7 Prozent in 2021) und das Haushaltsdefizit schätzt die EU-Kommission in diesem Jahr auf 9,9 Prozent. Die Staatsverschuldung wird 2020 gemäß der Frühjahrsvorhersage auf 116,5 Prozent anwachsen. Italien Italien erlebte als erstes europäisches Land einen massiven Ausbruch der Corona-Pandemie. Bereits am 10. März verhängte die Regierung eine strikte Ausgangssperre für ganz Italien. Vom 22. März bis zum 3. Mai war darüber hinaus ein Produktionsstopp für weite Teile der Industrie und des Handels in Kraft. In dieser Zeit standen in Italien rund 2,1 Millionen Unternehmen still, dies entspricht rund 40 Prozent der Wertschöpfung Italiens. Ab dem 3. Mai 2020 wurde die Produktion schrittweise wiederaufgenommen. Auch die Ausgangsbeschränkungen wurde wieder aufgehoben. Die Einführung der App Immuni soll helfen, neue größere Ausbrüche zu verhindern. Weiterhin gelten in Italien in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht sowie die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Die Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 5,3 Prozent und im zweiten Quartal um 12,4 Prozent. Nach einem ersten Hilfspaket in Höhe von rund 20 Milliarden Euro im März hat die italienische Regierung ein lang angekündigtes zweites Hilfspaket mit dem Namen Decreto Rilancio verabschiedet. Es umfasst 55 Milliarden Euro an direkten Zuschüssen. Damit belaufen sich die fiskalischen Maßnahmen auf über vier Prozent der Wirtschaftsleistung. Ein großer Teil von ca. 26 Milliarden Euro werden für den Bereich Beschäftigung aufgewendet, also hauptsächlich für die ca. neun Millionen Italiener in Kurzarbeit, und zur Unterstützung der Haushalte. Ein weiterer großer Posten von 15 bis 16 Milliarden geht an die Unternehmen, insbesondere an den Mittelstand. Die Unterstützungen umfassen zum Beispiel Steuersenkungen und Kompensationen für Mietkosten, die während des Lockdowns angefallen sind. Ungefähr 3,3 Milliarden Euro werden zur Unterstützung des Gesundheitssektors verwendet. Zudem hat die Regierung in zwei Etappen zunächst 340 Milliarden Euro und nachfolgend nochmals 400 Milliarden Euro an möglichen Kreditgarantien bereitgestellt. Im Juli 2020 verabschiedete die italienische Regierung darüber hinaus ein „Vereinfachungsdekret“ mit dem Ziel, bürokratische Hürden abzubauen und beispielsweise Bauaufträge schneller zu vergeben, Ausschreibungsprozesse zu vereinfachen und die öffentliche Verwaltung stärker zu digitalisieren. Für Gesundheitsausgaben hätte Italien auch das Recht, Mittel aus dem Euro-Rettungsfonds ESM zu einem sehr niedrigen Zinssatz zu beziehen. Für diesen Schritt konnte aber bislang kein politischer Konsens innerhalb der italienischen Regierung hergestellt werden.
34
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
In ihrer aktuellen Sommerprognose rechnet die Europäische Kommission in Italien mit einem Rückgang des BIP von 11,2 Prozent. Für 2021 wird ein Wachstum von 6,1 Prozent vorhergesagt. Generell hat sich das Verarbeitende Gewerbe schneller erholt als der noch beeinträchtigte Tourismus und konsumnahe Dienstleistungen. Seit der wirtschaftlichen Öffnung erholt sich die italienische Wirtschaft jedoch zusehends. Die Arbeitslosenquote wird 2020 laut Frühjahrsberechnung voraussichtlich bei 11,8 Prozent liegen, um dann 2021 auf 10,7 Prozent zurückzugehen. Das Haushaltsdefizit wird gemäß EU-Kommission bei einem Minus von 11,1 Prozent in diesem Jahr liegen. Die Staatsverschuldung wird voraussichtlich deutlich von 134,8 Prozent im vergangenen Jahr auf 158,9 Prozent 2020 ansteigen. Spanien Spanien zählt zu den von der Covid-19-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern in der EU. Der Einbruch der spanischen Wirtschaft im zweiten Quartal (minus 18,5 Prozent ggü. Vorquartal) nach einem bereits kräftigen Rückgang von über fünf Prozent im ersten Quartal ist der größte in der EU. Nach der Beendigung des Alarmzustands am 21. Juni 2020 und der schrittweisen Öffnung in die „neue Normalität“ führen derzeit erhöhte Infektionszahlen in einigen Regionen zu erneuten Kontaktbeschränkungen und Reisewarnungen. Das wirkt sich negativ auf die bereits stark betroffene Tourismusbranche aus. Der Branchenverband Exceltur rechnet damit, dass die Einnahmen des Sektors für 2020 um 83 Milliarden Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen werden. Weiterhin ist die Automobilindustrie stark betroffen. Es wird mit einem Umsatzeinbruch von rund 25 Prozent für 2020 gerechnet. Für beide Branchen wurden im Juni neue Hilfspakete mit einem Umfang von 4,3 bzw. 3,75 Milliarden Euro angekündigt. Darin enthalten sind 250 Millionen Euro für Abwrackprämien zum Ersatz alter durch emissionsarme Fahrzeuge. Anfang Juli 2020 hatte die spanische Regierung als weitere Hilfsmaßnahme ein Bürgschaftsprogramm im Umfang von 40 Milliarden Euro vorgestellt, das unternehmerische Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und ökologische Nachhaltigkeit fördern soll. Aus dem Hilfspaket der EU „Next Generation EU“ werden laut einer Pressemitteilung der Regierung insgesamt 140 Milliarden Euro auf Spanien entfallen. Davon sollen 72,7 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen gewährt werden. Diese Mittel werden aber erst ab der Jahresmitte 2021 fließen können. Neben den kürzlich beschlossenen Maßnahmen hatte die spanische Regierung bereits im März Hilfen für Unternehmen, Arbeiter und Selbständige, Familien sowie das Gesundheitswesen auf den Weg gebracht. Sie beliefen sich auf etwa zehn Prozent der Wirtschaftsleistung, davon acht Prozent in Form von Garantien. Mittlerweile summieren sich die direkten Hilfsmaßnahmen auch schon auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Im Garantieprogramm wurden über die spanische nationale Entwicklungsbank ICO (Instituto de Crédito Oficial) Bürgschaften von bis zu 100 Milliarden Euro bereitgestellt, die die Gewährung von Krediten an Unternehmen und Selbständige erleichtern sollten. Gemäß einer Zwischenbilanz vom 3. Juli 2020 hatten bis zu diesem Zeitpunkt 663.995 Unternehmen staatliche Bürgschaften im Wert von 64,7 Milliarden Euro genutzt, womit insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 85,2 Milliarden Euro mobilisiert werden konnten. 97,6 Prozent der gewährten Kredite gingen an kleine und mittlere Unternehmen oder Selbständige. Die ebenso im März beschlossene vereinfachte Bewilligung von befristeten Beschäftigungsregelungen (ERTE, ähnlich Kurzarbeit) hatte dazu beigetragen, den Arbeitsplatzabbau zu begrenzen. Ende Juni war der Zeitraum für die Beantragung und Durchführung von Kurzarbeit aufgrund der Covid-19-Krise auf Ende September ausgeweitet worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich landesweit noch circa 1,8 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit (Höchststand bei 4,8 Millionen). Sobald die ERTEs auslaufen muss mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote gerechnet werden.
35
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
In ihrer aktuellen Sommerprognose hat die Europäische Kommission ihre BIP-Vorhersage gegenüber der Frühjahrsprognose um 1½ Punkte herabgesetzt. Sie rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um etwa elf Prozent (IWF minus 12,8 Prozent). Für 2021 geht sie von einer schrittweisen Erholung der Wirtschaftstätigkeit mit einem Anstieg des BIP um sieben Prozent aus. Die Arbeitslosenquote wird gemäß der Frühjahrsprognose von aktuell rund 14,1 Prozent voraussichtlich auf 18,9 Prozent ansteigen (17 Prozent in 2021). Das Haushaltsdefizit wird 2020 bei etwa 10,1 Prozent liegen (IWF: 13,9 Prozent, 2021 bei 6,7 Prozent). Angesichts der wirtschaftlichen Folgerisiken der zweiten Infektionswelle, die viele Landesteile, u.a. auch Katalonien, betrifft, sind die Abwärtsrisiken trotz des sehr düsteren Ausblicks für Spanien nach wie vor bedeutsam. Die spanische Politik wird gegebenenfalls mit weiteren Stützungsmaßnahmen im Jahresverlauf nachhelfen müssen.
Deutschland In Hinblick auf Sterbefälle und wirtschaftlicher Entwicklung ist Deutschland bisher vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. So verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr nur um 11,7 Prozent, während größere europäische Länder wie Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien Wachstumseinbußen von 17,3 Prozent bis 22,1 Prozent zu verkraften hatten. Die Corona-bedingte weltweite Wachstumsschwäche belastet die deutschen Exporte von Waren und Dienstleistungen. Allein in der ersten Jahreshälfte sanken sie um 12,6 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, mit entsprechenden Folgen für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Dieses befand sich schon seit Jahresmitte 2018 in der Rezession. Die kurzzeitige Erholung zum Jahresanfang 2020 wurde durch die Corona-Pandemie jäh ausgebremst. Auch wesentliche Teile des Dienstleistungssektors wurden von der Corona-Pandemie erfasst. So lagen auch die Wertschöpfungsverluste in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe sowie bei den Unternehmensdienstleistern im zweiten Quartal ebenfalls im zweistelligen Bereich. Konjunkturstützende Maßnahmen wie die Senkung des Mehrwertsteuersatzes, die Erweiterung der Regelungen zur Kurzarbeit, die Liquiditätshilfen für Unternehmen und das Soforthilfeprogramm für kleine Unternehmen und Soloselbstständige dürften mit dazu beigetragen haben, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht noch stärker beeinträchtigt wurden. In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs begeben. Nach Einschätzung der EU-Kommission wurde der Tiefpunkt der Corona-Krise im zweiten Quartal 2020 durchschritten. Mit den ersten Lockerungsmaßnahmen haben im Mai die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder zugenommen. Für das dritte und vierte Quartal rechnet die Kommission mit einer Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten um 4,5 Prozent bzw. 3,2 Prozent jeweils im Vorquartalsvergleich. Für das gesamte Jahr 2020 wird ein BIP-Rückgang von 6,3 Prozent und im Folgejahr ein Anstieg um 5,3 Prozent prognostiziert. Die Rückkehr auf Vorkrisenniveau erfolgt erst im Jahr 2022.
Vereinigtes Königreich Die vergleichsweise späte Reaktion der britischen Regierung auf die Pandemie fiel dann doch sehr hart aus und dauerte vergleichsweise lang an. Nur so gelang es, nach einem Dauerhoch der Infektionen von Ende März bis Ende April die Neuinfektionen unter Tausend pro Tag ab Mitte Juni herabzuführen. Erst Mitte August stiegen die Werte wieder leicht über diese Schwelle an. Gleichwohl infizierten sich nachweislich bislang über 315 Tausend Menschen, und über 41 Tausend starben.
36
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Diese Muster der Gesundheitsmaßnahmen führten zu einem harten Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Konjunkturell musste das Vereinigte Königreich den härtesten Einbruch unter den großen europäischen Volkswirtschaften verkraften. Die Wirtschaftsleistung ging im zweiten Quartal 2020 um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück. Der private Verbrauch brach um 23 Prozent ein und die Bruttoanlageinvestitionen sanken um ein Viertel, jeweils gegenüber Vorquartal. Die Bautätigkeit brach sogar um ein Drittel ein. Im ersten Halbjahr schrumpfte die britische Wirtschaft um gut 22 Prozent, nur Spanien traf es noch etwas härter. Im Juni setzte die Erholung ein. Durch die Wiedereröffnung einzelner Wirtschaftsbereiche und Prozessumstellungen zeigte sich ein Anstieg um 8,7 Prozent im Vergleich zur Vorperiode, allerdings konnte dieser Anstieg die Einbrüche aus April und Mai nur teilweise kompensieren. Nahezu unverändert blieb die Arbeitslosenquote mit 3,9 Prozent. Dabei ist zu beachten, dass sich die Anzahl der Beschäftigten um 220 Tausend verringert hat. Ferner sorgten staatliche Stützungsprogramme (Furlough Scheme) für einen stark dämpfenden Effekt in der Statistik: Im Juni erhielten ca. 7,5 Millionen Beschäftigte staatliche Lohnzuschüsse. Hiervon waren mehr als drei Millionen Menschen länger als drei Monate freigestellt. Die Regierung führte neben dem Kurzarbeitergeld auch ein Garantieprogramm für Liquiditätshilfe in Höhe von 330 Milliarden Pfund Sterling ein. Für das laufende Jahr rechnet die Regierung mit einem Haushaltsfehlbetrag von 300 Milliarden Pfund Sterling; dies entspricht 15 Prozent des BIP. Die Staatsverschuldung erreichte bereits im Juni einen Gegenwert von ca. 100 Prozent der Wirtschaftsleistung, erstmals seit 1963. Anders als in Deutschland gab es allerdings keine Anpassung der allgemeinen Umsatzsteuersätze; die Regierung hat jedoch u.a. die Anwendung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf besonders betroffene Bereiche temporär ausgeweitet. Dazu zählen u.a. weite Teile der Gastronomie und Hotellerie sowie der Freizeitwirtschaft und Kulturveranstaltungen. Die Änderungen gelten bis Mitte Januar 2021. Im Fokus der politischen Diskussion steht derzeit die Fortsetzung des sog. Furlough Scheme, dem britischen Kurzarbeit-Programm. Hierbei erhalten Selbstständige und Gewerbetreibende auf Antrag Lohnersatzleistungen in Höhe von 80 Prozent für Gehälter bis max. 2.500 Pfund pro Mitarbeiter. Dieses kostenintensive System soll nunmehr schrittweise zurückgefahren und am 31. Oktober 2020 auslaufen. Anders als zum Programmauftakt dürfen die betroffenen Angestellten mittlerweile auch in Teilzeit weiterbeschäftigt werden. Ferner zahlt die Regierung Prämien an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter frühzeitig aus dem Furlough zurückholen. Angesichts der unvorhersehbaren Einschränkungen ist allerdings umstritten, ob alle betroffenen Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder rechtzeitig beschäftigen können. Schwer zu prognostizieren sind die Effekte aus der Beendigung der Brexit-Übergangsphase zum Jahresende. Durch das Corona-Krisenmanagement verlaufen die Vorbereitungen in einigen Betrieben schleppend. Daher kann ein weiterer Einbruch in der Wirtschaftsleistung für das kommende und laufende Jahr nicht ausgeschlossen werden. Insofern rechnen wir mit einem Einbruch der Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr in knapp zweistelliger Größenordnung. Der IWF rechnet mit einem Rückgang in der Größenordnung von 10,2 Prozent, die OECD mit 11,5 Prozent (im Szenario mit einem Lockdown). Jedwedes Aufflackern des Infektionsgeschehens dürfte insbesondere die Schwäche der Dienstleistungsbranchen und des privaten Verbrauchs zementieren. Die Erholung der britischen Wirtschaft bleibt in besonderem Maße gefährdet.
Regionaler Ausblick Die Pandemie hat sich auch in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern ausgebreitet. Starke Unterschiede bestehen nicht nur in den Infektionslagen, sondern auch in der gesundheits- und wirtschaftspolitischen Strategie gegen die Pandemie. So gibt es mittlerweile ausgesprochen schwierige
37
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Länder, während andere offenbar die Lage rasch unter Kontrolle bringen konnten. Insgesamt gesehen trifft es die großen Schwellenländer sehr hart. Alle Schwellen- und Entwicklungsländer inclusive China werden wohl das Jahr mit minus drei Prozent in der Summe abschließen. Finanzpolitisch hält man mit durchschnittlich fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gegen, und die öffentlichen Haushaltsdefizite werden im Schnitt auf über zehn Prozent ansteigen. Die wirtschaftliche Leistung in der Region Lateinamerika und die Karibik wird mit 9,4 Prozent schrumpfen, so stark wie sonst keine andere Weltregion. Mexiko mit mittlerweile mehr als einer halben Million Infizierten und über 50 Tausend Toten wird wohl mit gut zehn Prozent den größten Einbruch unter den großen Schwellenländern verzeichnen; im zweiten Quartal brach die Wirtschaft um 17,3 Prozent gegenüber Vorquartal (18,9 Prozent gegenüber Vorjahresquartal) ein. Die Industrieproduktion fiel sogar um mehr als ein Viertel. Immerhin zogen im Juni die Automobilproduktion und -exporte in die USA wieder an. Mexiko war schon 2019 in der Rezession gewesen, aber nun kommt es noch schlimmer. Mexiko hatte von Anfang April bis Mitte Mai relativ stringente Maßnahmen in Kraft, führte danach ein Ampelsystem ein und wies Mitte August noch die Hälfte der Bundesstaaten mit höchster Restriktionsstufe aus. In Mexiko hält sich die Bevölkerung jedoch nur sehr eingeschränkt an gesundheitliche Auflagen der Regierung. Zudem verschärft die hohe Anzahl von chronisch Erkrankten das Bild und erhöht die Sterblichkeit. Zudem leiden der Außenhandel mit den USA, der Tourismus, der Ölexport, die Direktinvestitionen und die Überweisungen von Mexikanern, die in den USA arbeiten, direkt oder indirekt unter der Pandemie. Staatspräsident Obrador verfolgt zudem keine angemessene finanzpolitische Strategie, um den wirtschaftlichen Absturz aufzuhalten. Außer einigen Zusatzausgaben für Gesundheit und Kreditgarantien für Kleinunternehmen fehlt es an Stützungs- und Konjunkturmaßnahmen in der Breite. Die Maßnahmen belaufen sich derzeit nur auf gut ein Prozent der Wirtschaftsleistung – viel zu wenig angesichts der Krise. Immerhin stützt die mexikanische Notenbank auf verschiedenen Wegen das Bankensystem und die Unternehmensfinanzierung. Brasilien liegt nach der Zahl der Infizierten hinter den USA auf Platz zwei, zählt mehr als 3,3 Millionen Infizierte sowie mehr als 100 Tausend Tote. Bislang ist nur eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens, aber kein Rückgang zu verzeichnen. Restriktionen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wurden von den Einzelstaaten differenziert gehandhabt. Vielerorts sind die Bestimmungen wieder etwas gelockert worden, vor allem für Geschäfte, obwohl das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle ist und Testkapazitäten knapp sind. Regierung und Parlament hielten bislang mit umfangreichen Maßnahmen im Volumen von gut zwölf Prozent gegen, wovon gut sieben Prozent dieses Jahr haushaltswirksam werden dürften. Im Vordergrund stehen Transfers an private Haushalte, Zuschüsse für Kurzarbeitergeld, Transfers an die Einzelstaaten zur Deckung von Zusatzausgaben und Liquiditätshilfen für Firmen. Die Notenbank hat darüber hinaus kräftig den Leitzins (um 225 Basispunkte auf zwei Prozent) und die Mindestreserveanforderungen (von 25 auf 17 Prozent) gesenkt und diverse Kreditprogramme für die Wirtschaft aufgelegt. Zudem hat sie am Devisenmarkt interveniert und die Abwertung des Real um gut ein Viertel gegenüber dem Dollar gemanagt. Die wirtschaftliche Leistung dürfte trotz des umfangreichen fiskalpolitischen Pakets um fünf bis sechs Prozent zurückgehen; IWF (minus neun) und OECD (minus sieben) waren im Sommer noch pessimistischer, aber die jüngsten Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel lassen eine vergleichsweise kräftige Erholung erkennen. Auch Argentinien durchleidet eine harte Phase und hat erst Anfang August eine erneute Umstrukturierung eines Anteils seiner Auslandsverbindlichkeiten mit den Gläubigern vereinbart. Dies wird die Verschuldung des Landes um etwa 50 Milliarden Euro senken. Argentinien befindet sich jedoch schon seit 2018 in der Rezession und ist Empfänger von IWF-Hilfskrediten. Das Land will die IWF-Kredite in
38
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Höhe von etwa 40 Milliarden Euro ebenfalls umstrukturieren. Die Regierung hat von Mitte März bis Mitte August umfangreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die Pandemie einzudämmen. Gleichwohl lag die Zahl der Infizierten mit 290 Tausend schon recht hoch, und die erste Welle ist noch nicht gestoppt. Die Regierung steuert mit einem Fiskalpaket von gut fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gegen und muss mit einem Haushaltsdefizit von acht Prozent rechnen. Da die Notenbank dies im Kern finanziert, liegt die Inflationsrate bei über 40 Prozent. Die wirtschaftliche Leistung dürfte dieses Jahr um rund zehn Prozent sinken. Die Stabilisierung der argentinischen Ökonomie wird auch nach der neunten oder zehnten Umschuldung des Landes ein großes Problem bleiben. Die Pazifikanrainer Peru (526 Tausend Infizierte), Kolumbien (456 Tausend) und Chile (386 Tausend) sind ebenfalls hart getroffen und müssen mit Einbrüchen der wirtschaftlichen Aktivität rechnen (Peru und Chile mit minus 4½ Prozent, Kolumbien mit minus 2,4 Prozent). In den europäischen Schwellenländern wird sich der Rückgang auf knapp sechs Prozent belaufen. Russland weist zwar mit gut 930 Tausend Infektionen die vierthöchsten der Welt auf, die täglichen Neuinfektionen sind jedoch seit Mai leicht rückläufig. Zuletzt lagen sie immer noch knapp unter fünftausend pro Tag. Die russische Regierung hatte nur kurzfristig umfangreiche Schließungen vorgenommen (bis zum 11. Mai) und steuert auch mit fiskalischen Maßnahmen in der Größenordnung von knapp drei Prozent des BIP nur moderat gegen die Rezession an. Die russische Wirtschaft ist nicht so stark eingebrochen, zumal der Dienstleistungssektor ohnehin keine große Rolle spielt. Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung um 8,5 Prozent und weniger als im Markt erwartet. Für das Gesamtjahr dürfte ein Einbruch in der Größenordnung von 5½ - sechs Prozent zu erwarten sein (IWF: minus 6,6 Prozent). Die Inflationsrate dürfte mit drei bis vier Prozent auch unter Kontrolle bleiben, trotz einer expansiveren Geldpolitik der Notenbank. Größere wirtschaftliche Probleme hat zudem die Türkei. Zwar ist das Infektionsgeschehen nach einem ersten Hoch im April seit Mitte Mai mit etwa eintausend Fällen pro Tag relativ stabil; auch liegt die Gesamtzahl mit gut 250 Tausend Infizierten nicht sehr hoch. Über die letzten drei Monate konnte die Regierung daher zahlreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder lockern und für eine leichte Belebung des Tourismus sorgen. Die Regierung hat auch mit einem großen Maßnahmenpaket in Höhe von insgesamt elf Prozent des BIP die Wirtschaft gestützt. Das Land erleidet jedoch ein Lirakrise, da die Währung seit Beginn der Pandemie etwa 20 Prozent zum Dollar nachgab und die Markterwartungen bezüglich der Inflationsentwicklung deutlich von der Notenbank- und Regierungslinie abweichen, Präsident Erdogan jedoch gegen höhere Leitzinsen Position bezogen hat. Der Leitzins liegt derzeit bei knapp über acht Prozent, war jedoch in mehreren Schritten von 24 Prozent aus gesenkt worden. Zudem nehmen die Devisenreserven im Zuge von massiven Interventionen der Notenbank stark ab und liegen unter der kritischen Schwelle des Werts der Importe von drei Monaten. Die Notenbank steuert allmählich auf einen restriktiveren Kurs um und beendete günstige Refinanzierungen der Geschäftsbanken. Die Lirakrise erschwert die Bedienung der hohen Hartwährungsverbindlichkeiten des türkischen Unternehmenssektors. Die türkische Wirtschaft brach im zweiten Quartal kalender- und saisonbereinigt um elf Prozent gegenüber Vorquartal ein, nach einer Stagnation im ersten Quartal. Ein starker Rückgang des Tourismus aus dem Ausland um 80 Prozent trug dazu stark bei. Auch die Exporte sanken um ein Drittel, die Industrieproduktion um knapp 17 Prozent gegenüber Vorjahr. Der IWF rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Höhe von fünf Prozent bei einer hohen Inflationsrate von gut zwölf Prozent. Im ersten Quartal war das BIP noch um 4,5 Prozent gestiegen. Auch die meisten asiatischen Länder müssen mit einer Rezession rechnen. Kritisch ist die Lage in Indien. Nach einem langsamen Anstieg der Infektionen von Januar bis April vor allem in den Slums
39
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
der Großstädte und einem raschen Anstieg danach gelang die Stabilisierung des Infektionsgeschehens erst Mitte August. Bislang haben sich mehr als 3,6 Millionen Inder infiziert, mit über 64 Tausend gemeldeten Todesfällen. Zuletzt lagen die täglichen Infektionen bei über 70 Tausend In Indien wird nur wenig getestet, nachverfolgt und isoliert, weil die Kapazitäten im Gesundheitssystem in dem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern begrenzt sind und die Regierung dies auch nicht stark vorantrieb. Daher muss von einer hohen Anzahl von ungemeldeten Infektionen ausgegangen werden. Die Regierung hatte vom 21. März an für drei Wochen über Nacht äußerst strenge landesweite Beschränkungen verhangen, die zum wirtschaftlichen Stillstand in zwei Dritteln der Unternehmen geführt hatten; danach waren immer noch ein Fünftel der Aktivitäten eingeschränkt. Seither wurden die allgemeinen Bestimmungen wieder leicht in mehreren Neustart-Etappen gelockert. Auf lokaler Ebene bestehen je nach Lage unterschiedlich starke Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens fort. Viele wirtschaftlich starke Regionen erleben ein Stopp-and-Go von Öffnung und Schließung. Die indische Regierung hat zwar Mitte Mai ein umfangreiches Programm zur Stützung der Wirtschaft in Höhe von zehn Prozent der Wirtschaftsleistung auf den Weg gebracht, vor allem zur Stützung der Einkommen der ärmeren Personen und Haushalte sowie zur Liquiditätsversorgung der Unternehmen. Daher dürfte das Haushaltsdefizit auch über den Wert von zehn Prozent ansteigen. Zudem hat die indische Notenbank eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Kreditversorgung zu erleichtern. Ein leichter Anstieg der Inflationsrate auf über vier Prozent kann dabei toleriert werden. Die gesamtwirtschaftliche Leistung dürfte dieses Jahr deutlich zurückgehen, Marktschätzungen belaufen sich auf gut acht Prozent im Fiskaljahr 20/21. Im ersten Quartal lag zwar noch ein Wachstum von 3,1 Prozent gegenüber Vorjahr vor. Im zweiten Quartal brach die Wirtschaftsleistung um 21 Prozent (saisonbereinigt) zum Vorquartal ein, gegenüber Vorjahr sogar um knapp 24 Prozent. Die Bruttowertschöpfung sank um 23 Prozent gegenüber Vorjahr, in der Industrie sogar um 40 Prozent. Die Investitionstätigkeit sank um 47 Prozent, nach einem Rückgang im ersten Quartal um 6,5 Prozent. Die Konsumausgaben brachen um ein Viertel ein. Da die Importe noch schneller wegbrachen (minus 40 Prozent) als die Exporte (minus 20 Prozent), stabilisierten die Nettoexporte das Ergebnis erheblich. Die Lage ist jedoch ernst. Die Industrieproduktion lag 36 Prozent unter Vorjahresniveau, mit sehr niedrigen Niveaus im April und Mai. Im Juni lag der Wert noch 17 Prozent unter Vorjahr. Besonders stark dürften im weiteren Jahresverlauf die Investitionen zurückgehen, während der private Verbrauch und die Exporte in geringerem Umfang nachgeben werden. Die indischen Verbraucher dürften sich noch über mehrere Quartale auf wesentliche Einkäufe beschränken. Auch die schwache Ertragslage der indischen Unternehmen wird für eine sehr schleppende Erholung und zögerliche Investitionstätigkeit sorgen. Die Finanzpolitik hat bisher eher mit geringen echten fiskalischen Impulsen (1,5 Prozent des BIP) reagiert. Eine Erholung sollte immerhin in diesem Quartal einsetzen, dies bleibt aber sowohl epidemiologisch als auch wirtschaftlich stark gefährdet (Deutsche Bank Research 2020c). Die fünf ASEAN-Gründungsländer dürften mit einem moderaten Einbruch von insgesamt zwei Prozent getroffen werden und vergleichsweise gut abschneiden; allein Thailand könnte mit einem Rückgang um rund acht Prozent stark getroffen sein. Im Mittleren Osten und den zentralasiatischen Länder wird der Einbruch knapp fünf Prozent betragen und Afrika südlich der Sahara noch mit einem Rückgang von gut drei Prozent betroffen sein; Südafrika erwischt es mit einem harten Absturz um acht Prozent überdurchschnittlich, Nigeria mit 5,4 Prozent ebenfalls.
40
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Unter den weiteren Industrieländern trifft es die kanadische Wirtschaft hart. Der Groß- und Einzelhandel, das Gastgewerbe und die Kfz-Branche sind die Hauptbetroffenen. Der IWF rechnet mit einem Rückgang um 8,4 Prozent, die OECD mit acht Prozent. Der private Verbrauch und der Außenhandel dürften in dieser Größenordnung über das Jahr einbrechen, die Investitionen etwas stärker, z.T. infolge des fallenden Ölpreises. Die Regierung und die Notenbank haben umfangreiche Hilfspakete auf den Weg gebracht, um die Folgen strikter Beschränkungen von Ende März bis Anfang Mai zu begrenzen. Das Fiskalpaket der Zentralregierung beläuft sich auf gut sieben Prozent der Wirtschaftsleistung, Provinzmaßnahmen kommen noch hinzu. Es ist mit einer allmählichen Erholung zu rechnen. Auch die Schweiz muss angesichts der Einbrüche im Tourismus und trotz umfangreicher wirtschaftspolitischer Maßnahmen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Höhe von fast acht Prozent rechnen. Am positiven Ende der Skala bewegt sich dagegen Südkorea. Die Wirtschaftsleistung dürfte um gut ein Prozent zurückgehen. Korea war zu Beginn der Pandemie besonders erfolgreich in der Eindämmung. Gleichwohl schränkten die Konsumenten ihre Ausgaben und Aktivitäten ein. Einen mittleren Platz nimmt Australien ein, das einen moderaten Pandemieverlauf aufwies. Ab Ende Mai wurden die meisten Beschränkungen wieder gelockert. Die australische Wirtschaft dürfte um fünf Prozent nachgeben. Regionaler Konjunkturausblick*
2020
2021
Europa, Fortgeschrittenen Volkswirtschaften und Entwicklungsländer
-8,0*
4,8*
Naher Osten, Nordafrika, Pakistan
-9,8*
-7,8*
Israel
-6,3
5,0
Sub-Sahara Afrika
-3,2*
3,4*
Südamerika
-5,0
3,4
Zentralamerika
-3,0
4,1
Karibik
-2,8
4,0
Asien-Pazifik, Fortgeschrittenen Volkswirtschaften1
-4,5
3,8
1,0
8,5
Asien-Pazifik, Entwicklungsländer2 1 Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, Hongkong, Australien, Neuseeland, Macau 2 inklusive China und Indien * Wachstum des realen BIP ggü. Vorjahr in Prozent Quelle: IWF (April 2020; *Juni 2020)
Fazit Die Erholung der Weltwirtschaft wird ganz zentral vom Erfolg der Pandemiebekämpfung in den großen Volkswirtschaften abhängen. Der Weg bis zu einer breitenwirksamen Impfung wird in jedem Fall noch sechs bis acht Quartale andauern. In dieser Zeit hängt sehr viel davon ab, ob die TTTI-Strategie tatsächlich funktioniert und neue landesweite lockdowns unnötig macht.
41
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Zudem kommt es entscheidend auf die phasengerechte Dosierung der Fiskalpolitik in den großen Volkswirtschaften an. Je nach Land bleibt die Stützung von Unternehmen und Arbeitnehmern noch einige Monate auf der Agenda, aber gezielte Anreize für Investitionen und Nachfrage sind zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Regel fiskalpolitisch sinnvoll. Hier gibt es noch Spielraum in einigen großen Ländern. Neben Maßnahmen zugunsten höherer öffentlicher und privater Investitionen wird auch stärker darauf geachtet werden müssen, dass in den Branchen, in denen sich Strukturbrüche der Nachfrage ergeben haben, Arbeitnehmer in neue Aktivitäten wechseln können. Hier sind ggf. gezielte arbeitsmarktpolitische Instrumente flankierend einzusetzen, um den Strukturwandel befördern zu können. In vielen Ländern wird es zudem zu einer Welle an Insolvenzen in den nächsten beiden Jahren kommen, die wiederum notleidende Kredite in den Bankbilanzen erzeugen. Auch hier ist eine Lehre der Vergangenheit, dass solche Schieflagen möglichst rasch und umfassend und mit wirtschaftspolitischer Flankierung angegangen werden müssen, um die hart gewonnene Stabilität des Bankensystems und der Finanzmärkte nicht erneut zu gefährden. Die Corona-Pandemie stellt unbestreitbar den größten Wirtschaftsschock für die Weltwirtschaft seit Jahrzehnten dar und muss konsequent in allen Feldern gemanagt werden. Der wirtschaftspolitische Auftakt war in diesem Sinn weltweit zwar nicht übermäßig koordiniert, aber doch weitgehend zielgerichtet und adäquat. Der gesundheitspolitische Auftakt blieb bislang viel schwerer.
Geldpolitik in der Pandemie Die EZB stellt umfassend Liquidität und Kapitalerleichterungen bereit Die Europäische Zentralbank hat in einem Doppelpack an Entscheidungen am 12. und 18. März 2020 umfassende Maßnahmen beschlossen, um die bereits eingetretenen und die derzeit absehbaren Störungen der Wirtschaftsaktivität, insbesondere der Finanzierung von Unternehmen über das Bankensystem oder den Kapitalmarkt, abzumildern. Die EZB hat zunächst am 12. März zielgenaue und weitreichende Entscheidungen zur Stabilisierung des Bankensystems und der Finanzmärkte getroffen. Folgende Punkte sind zentral: -
Erleichterte Refinanzierung der Banken: die EZB stellt über Vollzuteilung Mittel zu einem Zinssatz von minus 0,5 Prozent bis Juni bereit. Ab Juni setzt dann das dritte langfristige Refinanzierungsprogramm ein (TLTRO 3 = Targeted long-term Refinancing Operations). Dies wird bis zu diesem Zeitpunkt nun günstiger ausgestaltet (bis Juni 2021). Damit lässt sich die Mittelstandsfinanzierung von Banken deutlich leichter sicherstellen. Der Zinssatz für die Refinanzierung für Banken, die ihre Ausleihungen über bestimmten Schwellenwerten halten, kann bis auf etwa minus 0,75 Prozent sinken. Mit diesem Paket stellt die EZB den Geschäftsbanken ungefähr 1,2 Billionen Euro an zusätzlicher Liquidität bereit und verzichtet über die Konditionensetzung auch teilweise auf Notenbankgewinne aus diesen Transaktionen.
-
Zeitlich begrenzte Erhöhung des Kaufprogramms für Wertpapiere: einmalig hat die EZB den Rahmen für zusätzliche Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Euro (über die derzeit 20 Milliarden Euro pro Monat hinaus) bis zum Jahresende aufgestockt.
-
Kapitalerleichterungen für Banken: Die EZB erleichtert den Banken die Nutzung von Kapital und Liquidität vorübergehend unterhalb der Sollwerte von bestimmten Kapital- und Liquiditätspuffern, vor allem in der Säule-2-Leitlinie, bei dem Kapitalerhaltungs- und dem Liquiditätserhaltungspuffer. Zudem dürfen Banken bestimmte Kapitalanteile schon jetzt auf die Säule 2 anrechnen lassen, obwohl das erst ab Januar 2021 gesetzlich gelten wird.
-
Ergänzende Maßnahmen der Mitgliedstaaten erwartet: Die EZB erwartet zudem, dass der antizyklische Kapitalpuffer, sofern dieser eingesetzt ist, von den Mitgliedstaaten herabgesetzt wird. Dies ist z.B. in Deutschland auch erfolgt.
-
Keine Zinsänderungen: Die Zinssätze sind beibehalten worden (Einlagenzinssatz bei minus 0,5 Prozent, Hauptrefinanzierungssatz 0,25 Prozent und Spitzenrefinanzierungssatz bei null Prozent). Eine weitere Absenkung hätte eine noch komplexere Regelung für die Banken notwendig gemacht.
um die Kosten der Maßnahmen möglichst niedrig zu halten. Genau dies ist auch die Lehre aus der letzten Krise. Die EZB hat zudem am 24. März klargestellt, dass sie Störungen im geldpolitischen Transmissionsprozess in Zeiten der Pandemie nicht zulassen will und daher die üblichen Grenzen für die Aufkaufprogramme für das PEPP aufhebt (EZB 2020a). 42
Am 7. sowie am 22. April hat die EZB zudem die Regelungen für zentralbankfähige Sicherheiten geändert, um die Refinanzierung der Geschäftsbanken zu erhöhen. So können Bankschuldner mit niedrigerer Kreditwürdigkeit, weitere, bisher nicht zugelassene Schuldner und Fremdwährungskredite ein-
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Am 18. März hat die EZB mit einem weitreichenden Programm nachgelegt. Dieses Paket ist vorbeugend, vorsorglich und „vor der Kurve“ der Markterwartungen und stemmt sich gegen mögliche Finanzierungsengpässe auf den Kapitalmärkten. Damit stabilisiert die EZB die Erwartungen an den Märkten im Hinblick auf die Risiken für Staatsanleihen insbesondere Italiens, aber auch im Hinblick auf mögliche Liquiditätsstopps auf bestimmten Segmenten des Finanzmarkts im Euroraum, etwa bei kurzfristigen Schuldtiteln oder Anleihen von Banken bzw. von nicht-finanziellen Unternehmen. Die wesentlichen Bestandteile des Pandemienotfall-Kaufprogramms (Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)) sind: -
Großes Kaufprogramm. Das Programm hat einen Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro bis Jahresende 2020, ggf. mit weiteren Volumina und längeren Fristen, falls erforderlich. Alle unter dem bisher existierenden Wertpapierkaufprogramm bestehenden Unterprogramme können genutzt werden. Die bisherigen Volumina der Kaufprogramme (20 Milliarden Euro pro Monat und einmalig 120 Milliarden Euro) bestehen fort. EZB-Angaben zufolge stellt man über die Kaufprogramme insgesamt 1,3 Billionen Euro (gut sieben Prozent des BIP) zur Verfügung.
-
Flexibilität im Einsatz. Für die Kaufprogramme von Staatsanleihen gilt weiterhin der Kapitalschlüssel der EZB als Maßstab für die Aufteilung. Käufe werden nach Bedarf flexibel durchgeführt. Für Griechenland gibt es eine Sonderbestimmung, die höhere Käufe ermöglicht.
-
Ausweitung auf kurzfristige Schuldtitel der nicht-finanziellen Unternehmen. Besonders wichtig ist die Ausweitung des Kaufprogramms für Unternehmensanleihen, das um non-financial commercial paper, also kurzfristige Schuldtitel der Realwirtschaft, ergänzt wird. Damit kann die Refinanzierung leichter sichergestellt werden.
-
Erleichterung bei Standards für Kreditsicherheiten für die Beleihungsregeln der Geschäftsbanken werden gelockert, um die Refinanzierung sicherzustellen.
Das Maßnahmenpaket dient dazu, die Finanzierung über das Bankensystem für alle Kundengruppen in der akuten Situation sicherzustellen. Die EZB kann darüber Liquiditätsengpässe bei Staats- oder Unternehmensanleihen, bei kurzfristigen Schuldtiteln und auf bestimmten anderen Marktsegmenten gezielt angehen, in dem sie als Käufer auftritt und den Markt liquide hält. Der mehrfache Hinweis darauf, dass diese Maßnahmen auch ausgeweitet werden könnten, sofern notwendig, dient ebenfalls dem Ziel, Panikreaktionen an den Märkten zu vermeiden. Anders als in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 reagiert die Notenbank in diesem Fall von Beginn an mit maximaler Feuerkraft, um die Kosten der Maßnahmen möglichst niedrig zu halten. Genau dies ist auch die Lehre aus der letzten Krise. Die EZB hat zudem am 24. März klargestellt, dass sie Störungen im geldpolitischen Transmissionsprozess in Zeiten der Pandemie nicht zulassen will und daher die üblichen Grenzen für die Aufkaufprogramme für das PEPP aufhebt (EZB 2020a). Am 7. sowie am 22. April hat die EZB zudem die Regelungen für zentralbankfähige Sicherheiten geändert, um die Refinanzierung der Geschäftsbanken zu erhöhen. So können Bankschuldner mit niedrigerer Kreditwürdigkeit, weitere, bisher nicht zugelassene Schuldner und Fremdwährungskredite einbezogen werden. Weitere Regelungen stützen Pfandbrief- und ABS-Marktsegmente. Alle Vermögenswerte, mit Ausnahme von ABS, müssen Investmentgrade sein. Werden von den Ratingagenturen zukünftig Herabstufungen vorgenommen, so werden diese Vermögenswerte nicht im Sicherheitenregime der EZB herabgestuft, sofern diese die Schwelle des Investmentgrades nicht unterschreiten. Diese Maßnahmen sollen mindestens bis September 2021 gelten (siehe EZB 2020a). Die EZB hat am 4. Juni nochmals nachgesteuert und weitere Impulse gesetzt. So wurde der Umfang des Pandemie-Notfallankaufprogramms um 600 Milliarden Euro auf 1.350 Milliarden Euro erweitert und der Zeithorizont auf mindestens Ende Juni 2021 verlängert. Zudem werden die Tilgungsbeträge bis Ende 2022 reinvestiert. Mitte Juli bestätigte die EZB lediglich ihren Kurs. Die Finanzierung der nicht-finanziellen Unternehmen stieg in den letzten Monaten kräftig an, da viele Unternehmen Betriebsmittelkredite benötigten, um über die Einbrüche bei der Wirtschaftsaktivität hinwegzukommen. Zudem bauten einige Unternehmen Liquiditätspuffer auf. Diese Effekte waren stärker als die rückläufige Nachfrage nach Investitionskrediten (EZB 2020b). Die Kreditvergabe an private Haushalte verlor dagegen an Schwung, weil viele Einkommenseinbußen erlitten. Die von der EZB erwartete Inflation wurde für 2020 um 0,8 Prozentpunkte auf noch 0,3 Prozent herabgestuft, bei moderater Erholung auf 0,8 Prozent 2021.
Die US-Notenbank steuert gegen Die US-Notenbank hat in mehreren Maßnahmenpaketen im Laufe des März eine Reihe sehr wichtiger Stützungsmaßnahmen für die US-Wirtschaft beschlossen. Am 15. März senkte sie den Leitzins erneut auf eine Spanne von null bis 0,25 Prozent. Anfang März hatte sie bereits den Leitzins um 50 Basispunkte reduziert. Der Diskontsatz wurde am 15. März um 150 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt, eine Maßnahme, die seither gut angeschlagen hat. Zudem starte die FED ein neues Wertpapierkaufprogramm in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar. Sie senkte darüber hinaus die Kapitalanforderungen an das Bankensystem. Die FED erneuerte zudem Mitte März in mehreren Schritten Refinanzierungsfazilitäten für Geldmarktfonds, für kurzfristige Schuldtitel der Unternehmen und für Investmentbanken (Primary Dealer), um Liquiditätsengpässen in diesen Marktsegmenten entgegenzutreten.
43
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
In einem dritten Schritt legte sie am 23. März nochmal nach und gab bekannt, sie werde Staatsanleihen und staatlich garantiert verbriefte Hypothekenforderungen solange aufkaufen, bis die Märkte richtig funktionieren. Sie weitete den Kreis der Wertpapiere auch auf kommerzielle Hypothekenverbriefungen aus und erweiterte den Kreis der Wertpapiere, die unter den Geld- und Primärfazilitäten erworben werden können. Zudem nahm die FED das ABS-Kaufprogramm aus Krisenzeiten wieder auf und führte ein Sekundärmarktprogramm für Unternehmensanleihen neu ein. Die neuen Programmelemente könnten einen Umfang von bis zu 300 Milliarden US-Dollar erreichen, so die FED. Am 9. April erhöhte die FED nochmals kräftig die Dosis und kündigte ein Programm in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar an, unterstützt von einer Risikoübernahme durch das US-Schatzamt in der Größenordnung von 450 Milliarden US-Dollar. Zu diesem Programm zählt der Erwerb von Schuldtiteln von Unternehmen bis zu einem Umfang von 75 Milliarden US-Dollar Risiko (ca. 750 Milliarden US-Dollar Volumen), der sich auch auf Papiere (Anleihen und syndizierte Kredite) unterhalb eines Investmentgrade-Ratings und auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen erstrecken kann. Weitere 75 Milliarden US-Dollar sind für Kaufprogramme von Krediten (bis zu 600 Milliarden US-Dollar), 35 Milliarden US-Dollar für Darlehen von Kommunen und Einzelstaaten (bis zu 500 Milliarden US-Dollar) vorgesehen (Deutsche Bank Research 2020a). Die beiden vorherigen Fed-Chefs Bernanke und Yellen haben betont, dass allein die Existenz der Kaufprogramme für Unternehmens- und Kommunalanleihen dafür gesorgt hätte, dass sich die entsprechenden Marktsegmente stabilisiert haben (Bernanke und Yellen 2020). Die FED rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Höhe von 6,5 Prozent und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf über neun Prozent in diesem Jahr. Auf den Sitzungen im Juni und Juli wurde daher kein Zweifel daran gelassen, dass die FED die Wirtschaft weiter stützen wird. Im Juni weitete sie die Kreditprogramme auch auf gemeinnützige Institutionen wie öffentliche Krankenhäuser und Schulen aus. Ende Juli entschied sie, die Kreditfazilitäten bis Ende des Jahres laufen zu lassen und die Swap- und Repolinien für ausländische Zentralbanken bis Ende März 2021 fortzuführen.
Die anderen großen Notenbanken Die Bank of England hat im März mit einem massiven Programm von Leitzinssenkung, Wertpapierkäufen und Liquiditätshilfen an Unternehmen reagiert. Zudem wurde der antizyklische Kapitalpuffer auf null herabgesetzt. Im Juni stockte die Notenbank das Programm zum Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen von zuvor 200 auf dann 300 Milliarden Pfund auf; Zielgröße ist ein Wertpapierbestand von 745 Milliarden Pfund. Eine weitere Erhöhung im zweiten Halbjahr ist nicht auszuschließen. Zwar haben sich die Konsumausgaben im Juli wieder erholt, die Investitionsnachfrage ist aber noch sehr schwach. Die japanische Notenbank hat zunächst Anfang März Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft ergriffen, u.a. die Bereitstellung von Dollar. Ende April wurden weitere expansive Maßnahmen beschlossen. So hat die Notenbank das Kaufziel von 80 Billionen Yen aufgehoben, die Obergrenzen für Käufe von kurz- und langfristigen Schuldtiteln von Unternehmen stark angehoben und weitere Papiere zum Kauf zugelassen. Die japanische Notenbank verfolgt weiterhin die Strategie, die Zinsstrukturkurve zu steuern und über die Käufe von privaten Wertpapieren die Finanzierung der Wirtschaft zu stützen.
FED Am 27. August beschloss die FED, ihre geldpolitische Strategie anzupassen. Dies folgte auf einen längeren Konsultationsprozess, den die Notenbank mit der Wissenschaft und der Gesellschaft abgehalten hatte. So soll zukünftig das geldpolitische Ziel als eine Inflationsrate von zwei Prozent über die Zeit definiert sein. Dies bedeutet vor allem, dass nach einer Phase einer tatsächlichen Inflationsentwicklung von weniger als zwei Prozent auch eine Phase von über zwei Prozent akzeptiert würde. Notenbankchef Powell hat betont, dass man sich nicht auf bestimmte Zeiträume einengen lassen wolle. Die neue Zielformulierung solle vielmehr dazu dienen, ein Abrutschen von Inflationserwartungen zu vermeiden und für eine besser ausgeglichene mittelfristige Orientierung in der Geldpolitik zu sorgen. Im Hinblick auf das zweite Ziel der Notenbank wird nun betont, dass das Unterschreiten eines maximalen Beschäftigungsniveaus die relevante Größe sei (nicht die Abweichung, wie vorher). Damit ist die FED die erste Notenbank unter den großen Spielern, die eine Überprüfung ihrer Strategie abgeschlossen und zu einem Ergebnis geführt hat. Diese partielle Korrektur an den Zielsetzungen wird vor allem dazu dienen, die Erwartungen an die Notenbank auch in Zeiten von sehr niedrigen Leitzinsen und sehr niedriger Inflation zu stabilisieren. Geldpolitisch verschafft sich die Notenbank dadurch etwas mehr Spielraum.
44
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Quellenverzeichnis Bureau of Economic Analysis (2020a). News Release. Gross Domestic Product, 2nd Quarter 2020 (Second Estimate); Corporate Profits, 2nd Quarter 2020 (Preliminary Estimate). 27. August. Washington, D.C.. --- (2020b). International Trade in Goods and Services. 07. Januar. --- (2020c). News Release. Personal Income and Outlays. June 2020 and Annual Update. 31. Juli. Washington, D.C.. CBO (2020a). An Update to the Economic Outlook: 2020-2030. Juli. Washington, D.C.. --- (2020b). Monthly Budget Review for July 2020. 10. August. Washington, D.C.. --- (2020c). H.R. 6201. Families First Coronavirus Response Act. 2. April. Washington, D.C.. --- (2020d). H.R. 748. CARES Act. 16. April. Washington, D.C.. Committee for a Responsible Federal Budget (2019). Treasury: 2019 Deficit was $984 Billion. 25. Oktober. Congressional Budget Office (2020). The Budget and Economic Outlook: 2020 to 2030. 28. Januar. Confindustria (2019). Italian Economic Outlook 2019/2020 and the Economic Policy Scenario. Rom. CPC News (2020). 中共中央政治局常务委员会召开会议 中共中央总书记习近平主持会议. 15. Mai. Deutsche Bank Research (2019). Japanese Economy in 2020 - Part 1: On real economy. Tokio. 11. Dezember. ---(2019b). Japanese economy in 2020 – Part 2: Economic Policy. Tokio. 19. Dezember. Deutsche Bundesbank (2020). Folgen des Zunehmenden Protektionismus.20. Januar. Economist Intelligence Unit (2020). Global Outlook: China’s unemployment rate may hit 10 percent tis year. 24. April. Europäische Zentralbank (2019a). Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area. Dezember. Frankfurt/M. ---(2019b). Bulletin. Dezember. Frankfurt/M. Federal Reserve (2020). FOMC Advance Release. 10. Juni. Washington, D.C.. Federal Reserve Bank of St. Louis (2020). University of Michigan: Consumer Sentiment. Internationaler Währungsfonds (2020). Tentative Stabilization, Slugish Recovery? World Economic Outlook Update. Washington, D.C.. 20. Januar. --- (2020b). World Economic Outlook Update. June. Washington, D.C.. --- (2020c). United States of America: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission. 17. Juli. Washington, D.C..
45
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Mofcom (2020). Minister of Commerce Zhong Shan Attends State Council Information Office Press Conference on Stabilizing the Fundamentals of Foreign Trade and Investment and Promoting the Quality Development of Commerce. 18. Mai. National Bureau of Statistics of China (2020). Economic Development Delivered Notable Results with National Economy Recovered Gradually in the First Half of 2020. 16. Juli. ---(2020). National Economy Sustained a Steady Recovery in July. 14. August. New York Federal Reserve (2020). Quarterly Report on Household Debt and Credit 2020:Q2. August. New York. OECD (2020a). Economic Outlook, Volume 2020 Issue 1. Juni. Paris. --- (2020b). OECD Employment Outlook 2020. Worker Security and the Covid-19 Crisis. How does the United States Compare?. Paris. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (2019). US-China Trade War Tariffs: An Upto-Date Chart. 19. Dezember. --- (2020). US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart. 14. Februar, Washington, D.C.. Reuters (2020). China auto sales surge in July, log fourth straight month of gains. 11. August. Rhodium Group (2020). China’s Recovery, Six Month In. 21. Juli. The State Council of the People’s Republik of China (2020). Full Text: Report on the Work of the Government. 30. Mai. U.S. Bureau of Labor Statistics (2020). Civilian unemployment rate. Washington, D.C.. U.S. Department of the Treasury (DoT) (2019). Mnuchin and Vought Release Joint Statement on Budget Results for Fiscal Year 2019. 25. Oktober. White House Office of Management and Budget (2019a). Table 1.2 - Summary of Receipts, Outlays, and Surpluses or Deficits (-) as Percentages of GDP. --- (2019b). Budget of the U.S. Government – Mid-Session Review. 17. Juli. World Bank (2020). China Economic Update: Leaning Forward – Covid 19 and China’s Reform Agenda. 29. Juli. Xinhua (2020). 习近平:在企业家座谈会上的讲话. 21. Juli.
46
Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020
Impressum Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) Breite Straße 29 10178 Berlin T: +49 30 2028-0 www.bdi.eu Autoren Dr. Klaus Günter Deutsch T: +49 30 2028 1591 k.deutsch@bdi.eu Stefan Gätzner BDI-Vertretung, Peking T: +86 1085 322862 s.gaetzner@bdi.eu Julia Howald T.: +49 30 2028 1483 j.howald@bdi.eu Thomas Hüne T: +49 30 2028 1592 t.huene@bdi.eu Paul Maeser T: +49 30 2028 1545 p.maeser@bdi.eu Corinna Neumann T: +49 30 2028 1749 c.neumann@bdi.eu Miriam Philipp T: +49 30 2028 1700 m.phillip@bdi.eu Valerie Ross T.: +49 30 2028 1623 v.ross@bdi.eu Dr. Christoph Sprich T: +49 30 2028 1525 c.sprich@bdi.eu Redaktion/Grafiken Marta Gancarek T: +49 30 2028 1588 m.gancarek@bdi.eu
47