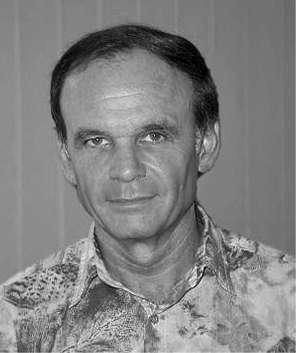
45 minute read
Mit dem Kopf durch die Wand
Von Gerhard Dabi
Es war in den Sommerferien 1973. Noch ein Jahr an der Fakultät für Zivil- und Industriebauten des Polytechnischen Instituts Klausenburg lag vor mir, und dann sollte ich als junger Bauingenieur irgendwo im Land verblöden. Man wusste nicht, wohin einen das Schicksal verschlagen würde, man war der staatlichen Planwirtschaft ausgeliefert. Meine Absicht war, in meine Heimatstadt Hermannstadt zurückzukehren, aber das war Wunschdenken. Die Ferien hatte ich in den letzten Jahren meist zu Hause, aber auch einige Male am Schwarzen Meer oder auf Bergtouren verbracht. Oft traf ich dabei Bekannte oder Verwandte, die aus der BunGerhard Dabi desrepublik Deutschland oder Österreich zu Besuch gekommen waren, es waren stets lustige und unbeschwerte Tage. Doch jedes Mal, wenn der Abschied nahte, waren es immer die gleichen Gefühle, die einen als Zurückbleibender beschlichen. Einerseits die fröhlichen, unbekümmerten Besucher, die sich schon auf die Rückkehr in die freie Welt mit all ihren Annehmlichkeiten freuten, und wir, die zurückbleiben mussten und bloß neidvoll davon träumen konnten, vielleicht auch einmal ohne Beschränkung reisen zu dürfen, andere Länder kennenzulernen, sich eine Scheibe vom westlichen Wohlstand abschneiden zu dürfen, ohne Angst, Meinungen äußern zu dürfen, eben frei zu sein.
Advertisement
In diesen letzten Ferien meiner Studienzeit hatte ich mir in den Kopf gesetzt, auch einmal über die Landesgrenzen zu sehen, um zumindest ein bisschen die Welt zu erkunden. Natürlich war das, wenn überhaupt, bloß in die sogenannten sozialistischen Bruderstaaten möglich. Also war es für mich nahe liegend, zu versuchen, eine Reise in die DDR zu unternehmen. Ich hatte die Anschriften einer Vielzahl von Zufallsbekannten, Brieffreunden, aber auch Leuten, die aus Hermannstadt stammten und durch die Kriegswirren oder nach der Deportation nach Russland dort ansässig geworden waren. Zu meiner großen Überraschung bekam ich schon drei Wochen nach Antragstellung den Reisepass. Es wurde meine erste große Auslandsreise, abgesehen von einem Kurzbesuch als Kind bei einer Tante in Ungarn. In den drei Wochen war ich im südlichen Teil der DDR viel mit Zug, Bus und per Anhalter unterwegs, konnte viel Neues sehen und wurde überall herzlich aufgenommen. Ich kehrte heim mit dem Gefühl, etwas
Besonderes erlebt zu haben. In den folgenden fünf Jahren hatte ich zur Genüge Gelegenheit, die „vielseitig entwickelte sozialistische Gesellschaft“ kennenzuler iums 1974 bekam ich mit etwas Glück in Hermannstadt Arbeit. Gerade hatten die Arbeiten am neuen 17geschossigen Hotel „Continental“ begonnen. Investor war das Kreisamt für Touristik Hermannstadt, und das hatte die Stelle eines Bauleiters frei. Beim Bauunternehmen des Kreises Hermannstadt waren die beiden altgedienten Ingenieure Dieter K. und Julis B. tätig, ehemalige Schulkameraden und Freunde meiner Eltern. Sie hatten auch den Hotelbau in Auftrag, so dass ich durch ihre Vermittlung die Stelle bekam.
Als Anfänger musste ich mich in die Arbeit stürzen, was mir durch die Unterstützung lieber Kollegen im technischen Büro des Touristikamtes auch gut gelang. Wir waren acht Mann, einschließlich unseres Chefs Nicolae C., ein umtriebiger und gebildeter Mann, aber das reinste Nervenbündel. Das war weiter nicht verwunderlich, denn allmählich lernte ich die sozialistische Misswirtschaft kennen.
Nichts funktionierte normal, angefangen von Materialbeschaffung bis zu den Beziehungen zwischen den Firmen, der Investitionsbank, der Arbeitsmoral, der Einhaltung von Normen, letztendlich den Beziehungen zwischen den einzelnen handelnden Personen selber. Bestechung und Korruption waren an der Tagesordnung. Und obenauf thronte die Partei, ohne deren Richtlinien und Anweisungen nichts getan werden durfte.
Einmal wöchentlich wurde auf der Baustelle ein Jour fixe abgehalten unter dem Vorsitz der Parteibonzen des Kreises. Daran mussten alle führenden Kader der beteiligten Firmen teilnehmen, also Investor, Baufirma, Projektanten und Stadtwerke. Die Parteikader gaben Anweisungen im Befehlston, und manch ein Direktor saß da mit gesenktem Blick und wurde wie ein Kindergartenkind behandelt. Der Zeitdruck war immens, was nicht schlimm gewesen wäre, hätte alles normal funktioniert. Es war die Zeit, als Rumänien alles, was nur möglich war, exportierte, um Devisen ins Land zu bekommen. In jeder Firma hatte der Export höchste Priorität, alles andere musste zurückstehen.
Eines Tages musste ich nach Blasendorf (Blaj) in einen Betrieb fahren, um Türen und Fenster zu bestellen. Der Betriebsleiter hatte bloß ein mitleidiges Lächeln für mich übrig, als die Mengen und Termine zur Sprache kamen. Er hatte seinen Exportplan zu erfüllen, alles andere zählte nicht, wir hätten unendliche Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Also wurde im nächsten Jour fixe darüber geklagt, und nur nach Einschaltung der höchsten Parteigremien konnte die Lieferung irgendwie in die Wege geleitet werden.
Schlamperei war an der Tagesordnung. Eines Tages, fast ein Jahr früher als benötigt, wurde die neue Telefonzentrale geliefert. Die einzige Firma, die so etwas herstellte, saß in Bukarest und hatte gerade gemäß der Planwirtschaft die Kapazität für die Lieferung frei gehabt. Auf der Baustelle waren noch die Roh-
bauarbeiten in vollem Gange. Die vier Meter hohe Vorrichtung mit der empfindlichen Anlage wurde einfach, ohne jemanden zu informieren, abgeladen und ungeschützt unter freiem Himmel gelagert. Dort bliebt sie den Winter über. Ein paar Tage vor der Hoteleröffnung wurde es hektisch. Als die Anlage ausgepackt wurde, floss uns der Rost regelrecht entgegen, all die sensiblen Kontakte und Bauteile waren Schrott. Eine Million Lei war in den Sand gesetzt.
Woher jetzt Ersatz holen? Wer sollte das alles verantworten? Meine Chefs waren schier dem Verzweifeln nahe; sie hatten Angst, sich vor der Parteiführung und dem Inspektor der Investitionsbank, der für die Kontrolle der gelieferten Güter zuständig war, verantworten zu müssen.
Eine Komödie
Die Lösung des Problems? Eine Komödie. Einer meiner Bürokollegen, Techniker Stefan L., ein Halbzigeuner und ein sehr lieber Mensch, hilfsbereit und wortgewandt, immer zu Späßen bereit, meinte, er könnte versuchen, das Problem zu lösen. Er kenne den Pförtner der Bukarester Elektronikfirma, die die Telefonanlagen herstellt, er würde mit ihm Verbindung aufnehmen, ob nicht was zu „arrangieren“ sei. Nach etlichen Telefonaten war die Sache klar. Sofort wurde eine Sitzung im engsten Kreis, mit meinem Chef, dem Generaldirektor des Touristikamtes, Stefan und mir einberufen. Ich sollte umgehend nach Bukarest zu der Firma fliegen und „Entsprechendes“ mitnehmen. Nach einigen Gesprächen unseres Direktors mit den Chefs der größten Restaurants in Hermannstadt, die alle dem Touristikamt unterstellt waren, war die Sache organisiert, und das „Entsprechende“ trudelte in den nächsten Stunden ein, alles ausländische Ware: Kaffee und Zigaretten, edle Getränke und Kosmetika. Jeder Lokalchef musste „seinen Beitrag“ leisten. Dann wurde ich mit zwei Koffern zum Flughafen gebracht. In Bukarest fuhr ich mit dem Taxi direkt zu der Firma, wo mich der Pförtner schon erwartete.
Er wies mich an, in einem Konferenzsaal zu warten und verschwand mit den beiden Koffern. Nach zwei Stunden kam er strahlend zurück, wedelte mit Papieren und sagte, es sei alles klar. Er übergab mir die Papiere und meinte, ich solle ruhig nach Hause fahren, in zwei Tagen würde uns eine neue Anlage geliefert und die ruinierte abgeholt werden, um überholt und im Werk aufbewahrt zu werden. So einfach war das. Natürlich kriegte auch unser Bankinspektor „entsprechende Geschenke“, um über die Affäre hinwegzusehen, und so war alles unter den Teppich gekehrt und wieder in Ordnung. Dass beim Einbau der Telefonzentrale noch einmal die fertige Fassade aufgebrochen werden musste, weil sie nicht durch das Treppenhaus passte, war nur noch eine unwichtige Nebenerscheinung.
Die Lieferung und Montage der Aufzüge sollte erfolgen. Die Bukarester Firma besaß als einziger Lieferant das Monopol, und dementsprechend führten
sich ihre Angestellten auch auf. Die Monteure waren so etwas wie kleine Könige im Lande. Eines Tages tauchte der Chef der Truppe auf, die unsere Aufzüge montieren sollte, er wollte unseren Chef sprechen. Der Typ sah wie ein echter Schotte aus, rothaarig mit Sommersprossen und schräg aufgesetzter Baskenmütze, bloß der Rock und der Dudelsack fehlten. Nach einer halben Stunde kam er zusammen mit meinem Chef, der immerhin auch stellvertretender Direktor des Unternehmens war, aus dessen Büro heraus, verschlagen lächelnd, mein Chef hintendrein buckelnd. Für die Übergabe der Aufzugsschächte zur Montage galten strenge Normen. So war zum Beispiel eine Abweichung von der Vertikalen von höchstens 15 Millimetern zulässig, was bei der Höhe der Schächte von 50 Metern ein Ding der Unmöglichkeit war. Auch konnten solche Abweichungen problemlos bei der Montage ausgeglichen werden. Dies war also ein Grund für den Monteur, die Übernahme zu verweigern. Mit dieser Masche konnte er, wann immer er wollte, einfach seine Truppe mit der Begründung abziehen, die Vorgaben seien nicht eingehalten worden; die Firma hätte genug andere Aufträge im ganzen Land zu erfüllen.
Lösung des Problems: Die ganze Truppe wurde für die drei bis vier Wochen Montagedauer kostenlos im Hotel untergebracht bei bester Verpflegung im Restaurant. Zusätzlich wurde sie mit etlichen Paketen ausländischer Ware bedacht. Die Leute mussten bei Laune gehalten werden, und das nutzten sie auch gründlich aus, wussten sie doch, welche „Möglichkeiten“ das Touristikamt hatte.
Gut ein halbes Jahr nach meiner Einstellung musste ich den Militärdienst antreten. Ich hatte Glück. Anfang Juli 1975 kam ich in eine kleine Einheit mitten in einem Wald, etwa zehn Kilometer von Pl es ein halbes Dutzend Gebäude, sie waren umgeben von ausgedehnten Obstbaumplantagen. Die ganze Anlage diente bloß der Überwachung und Verwaltung von weitläufigen unterirdischen Lagern, in denen Uniformen, Stiefel, Lebensmittelkonserven und dergleichen aufbewahrt wurden. Zur Überwachung waren bloß eine handvoll Soldaten nötig, die rund um die Uhr im Einsatz waren. Dort wurde unsere etwa 40 Mann starke Neulingstruppe untergebracht. Es waren durchwegs Hochschulabsolventen, die etwas auf dem Kerbholz hatten; mancher hatte Verwandte im Westen, andere hatten Ausreiseanträge gestellt oder waren politisch aufgefallen.
Einer hatte beispielsweise einen Heiratsantrag mit einer Holländerin gestellt. Obendrein waren wir alle relativ „alte Semester“, das heißt zwischen 25 und 30 Jahre alt. Der älteste war ein 33jähriger Architekt. Offensichtlich hatte man nicht recht gewusst, was mit uns anzufangeni, und hatte uns hier versteckt. Die Offiziere kamen um 8 Uhr aus der Stadt zum Dienst, um 16 Uhr verließen sie die Einheit, und wir waren uns selbst überlassen. Wir spielten Fußball, lagen faul in der Sonne, genossen das frische Obst von den Bäumen und spielten bis spät in die Nacht Karten. Die kaum 20jährigen Korporale der einfachen Wach-
truppe, die eigentlich unsere Vorgesetzten sein sollten, hatten überhaupt keine Autorität uns gegenüber und holten sich bloß Spott und Ironie ab, also ließen sie uns lieber in Ruhe. Wir gehörten zu den letzten, die den Militärdienst nach dem Studium leisten mussten. Die Tage vergingen recht langsam, und wir wähnten uns wie auf Kur. Manchmal war es so langweilig, dass wir uns richtig freuten, wenn einmal ein Nachtmarsch angesetzt wurde oder wenn ab und zu eine neue Ladung Konserven abgeladen werden sollte.
Eines Tages wurden wir zu einer Schießübung gefahren. Als wir ausstiegen, kamen wir den anwesenden Soldaten wie Außerirdische vor. Es waren Truppen des Geheimdienstes Securitate, die ihre Übungen absolvierten. Die armen jungen Kerle wurden in voller Montur durch Schlamm und Wassergräben gehetzt, mussten über das Gelände robben und sahen aus wie Schweine. Dagegen wir in unseren erlesenen und sauberen Uniformen mit Bügelfalten. Jeder von uns durfte die ersten und einzigen vier Kugeln während der ganzen Dienstzeit abfeuern, und schon waren wir unter den neidvollen Blicken der Soldaten im Bus verschwunden.
Nach zweimonatiger Grundausbildung wurde unsere Truppe in alle Winde zerstreut. Ich kam mit sechs Kameraden zu einer Einheit nach Bukarest. Wir sollten innerhalb der Hauptkommandantur im Planungsbüro arbeiten. Es sollten serienweise Projekte erstellt werden für die Einführung von Fernheizungen in Kasernen. Nun waren aber bloß drei der Kameraden dafür Fachingenieure, die andern drei, einschließlich mir, hatten kaum etwas zu tun und langweilten sich. Vier Mann waren Bukarester, sie durften um 16 Uhr, nach Dienstschluss, nach Hause gehen. Ein Kamerad und ich mussten in einer nahen Kaserne wohnen. Wir zwei fühlten uns ungerecht behandelt und kamen mit unserem Hauptmann überein, dass wir abwechselnd zwei Wochen nach Hause fahren durften, wir mussten allerdings jeden zweiten Tag anrufen, für den Fall, dass man uns gesucht hatte. So verging die Zeit im Handumdrehen, und wir wurden um Weihnachten entlassen. Ich nahm meine Arbeit wieder auf. Das Hotel wurde 1976 in Betrieb genommen, und ich bekam andere Aufgaben zugeteilt; dazu gehörten auch Renovierungsarbeiten an Berghütten, die dem Touristikamt gehörten. Unter anderem sollte neben der Bulea-Hütte in 2000 Metern Höhe ein Hotel gebaut werden. Die schneefreie Zeit dauerte drei Monate, in denen unter Extrembedingungen gearbeitet werden musste. Für diese Arbeiten wurde das Militär herangezogen. Doch schon nach einer Saison wurde wieder alles aufgegeben, man konnte kaum erkennen, dass dort überhaupt etwas geleistet worden war.
Der Tag, an dem die Erde bebte
Bei meinen beiden Chefs war ich recht gut angesehen, was sich eines Tages noch steigern sollte. Es war am 4. März 1977. Ich war mit meiner Freundin in einer deutschen Theateraufführung, als die Erde bebte und alle den Saal fluch-
tartig verließen. Als sich alles wieder beruhigt hatte, wurde die Vorstellung zu Ende gespielt. Niemand konnte damals wissen, welch schreckliche Folgen vor allem in Bukarest zu verzeichnen waren mit 1.500 Toten. Ich dachte mir, dass vielleicht am Hotel, das damals das höchste Gebäude der Stadt, abgesehen von den Kirchtürmen, war, Schäden aufgetreten waren und schlenderte um die Ecke die paar Meter dahin, um mich umzusehen. Vor dem Hotel war eine beträchtliche Menschenmenge versammelt, viele im Schlafanzug. Es waren die an einem Kongress teilnehmenden Chefs vieler landwirtschaftlicher Genossenschaften. Aus der Dunkelheit tauchte plötzlich der große Direktor unseres Amtes zusammen mit den andern Chefs auf. Als er mich sah, drehte er sich zu den anderen hin und sagte: „Da könnt ihr mal sehen, was Verantwortungsbewusstsein bedeutet. Unser junger Ingenieur ist sofort zu seinem Bau geeilt, um nach dem Rechten zu sehen“ . Ich musste für mich grinsen. Wochen später hatte ich Gelegenheit, in Bukarest die Erdbebenschäden zu sehen. Im zehnstöckigen Touristik-Ministerium im Stadtzentrum waren Betonstützen geborsten und nur notdürftig mit Stahlklammern gesichert. Ich stellte mir vor, mit welch unangenehmem Gefühl die Angestellten darin arbeiten mussten. 1978 war mein großes Pechjahr. Das Thema Auswanderung kam immer wieder zu Hause und im Freundeskreis zur Sprache. Die Verhältnisse im Lande wurden immer schlechter und bedrückender, jeder versuchte, nach Deutschland zu gelangen, um der Perspektivlosigkeit zu entfliehen und um ein Leben in Freiheit und geordneten Verhältnissen zu führen. Dabei hatten nur jene wirkliche Chancen auf Erteilung einer Ausreisegenehmigung, die Verwandte ersten Grades im Westen hatten. Immer wieder hörte man von gelungener Flucht.
Mir kam die Idee, meinen Sommerurlaub in der DDR zu verbringen, wie schon fünf Jahre davor, um mich dort nach Fluchtmöglichkeiten umzusehen. Dabei war klar, dass so eine Aktion auf keinen Fall über die bestbewachte Grenze des Eisernen Vorhangs geschehen konnte. Ich stellte mir vor, dass ich mit meinem ausländischen Pass weniger Schwierigkeiten haben würde als DDR-Bürger, die ihrerseits Fluchtmöglichkeiten über Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien suchten. Eine verkehrte Welt.
Doch dieses Mal erhielt ich zu meiner Überraschung eine Absage. Ich dachte mir, dass vielleicht einer der Gründe meine Parteilosigkeit war. Man hatte mich zwar zweimal angesprochen, ein Eintrittsgesuch zu schreiben. Weil ich aber jedes Mal abgelehnt hatte, ließ man mich in Ruhe. Frustriert ging ich ins Passamt, wo ich mich empört zeigte und vorwurfsvoll nachfragte, warum mir der Pass verweigert worden war. Die Folge: Zwei Wochen später erhielt ich tatsächlich die Reisegenehmigung.
Die Reise in die DDR über Ungarn und die Tschechoslowakei verlief reibungslos. Ich blieb nur zwei Tage bei Bekannten in Dresden und fuhr dann nach Berlin. Bei meiner ersten Reise hatte ich Berlin nicht besucht. Ich hatte die An-
schrift eines Cousins meines Onkels dabei, der nach dem Krieg nach Berlin verschlagen worden war. Nun war er schon seit etlichen Jahren Rentner und lebte zusammen mit seiner Frau in einer riesigen Villa mit Garten. Er war als Arzt tätig gewesen und angeblich einer der besten Krebsforscher. Die Aufnahme war sehr herzlich, obwohl ich die beiden Alten bis dahin nicht kannte. Ich machte ihnen aber sogleich klar, dass ich bloß abends zum Schlafen kommen werde, den Rest des Tages würde ich in der Stadt verbringen, um vieles zu sehen und zu erleben.
Nach einer Stadtrundfahrt nahm ich mir einzelne Sehenswürdigkeiten vor. Vom Fernsehturm auf dem Alexanderplatz konnte ich gut den Verlauf der Mauer erkennen und weit nach West-Berlin schauen. Wie paradox: Alles schien von dort oben so klein und leicht, man meinte fast, die goldene Siegessäule in der Ferne mit dem Finger berühren zu können. Da lag also das Land meiner Träume, so nah, und doch so unerreichbar fern wegen der Mauer, die sich wie ein Wurm quer durch die Stadt zog. Ich saß stundenlang auf dem Turm in Gedanken und Träumen versunken und überlegte, was ich versuchen könnte, um ins „gelobte Land“ zu gelangen.
Erste Niederlage
Ich wollte mit der U-Bahn hinüber fahren. Ich begab mich also mitten im Zentrum zur Station Friedrichstraße. Ich war überrascht, dass man sich problemlos am Kassenschalter eine Fahrkarte für 1,50 Mark nach West-Berlin kaufen konnte, also zum selben Preis wie auch für jede andere beliebige Fahrt. Ohne Gepäck fuhr ich mit der Rolltreppe in die Station hinab. Ich passierte eine erste Ausweiskontrolle. Der Grenzer hatte mich zwar ziemlich komisch gemustert, aber mir den Pass wortlos zurückgegeben und mich durchgewinkt. In meinem Kopf begann es zu rotieren, ich sah mich schon in der U-Bahn in Richtung Westen fahren. Unten angekommen, gab es eine zweite Sperre, an der man gründlich kontrollierte. Ein Grenzoffizier nahm mir den Pass ab und blätterte darin. Dann musste ich ihm folgen. Er wies mich an, mich auf eine Bank am Bahnsteig zu setzten und verschwand mit meinem Pass. Die U-Bahn stand mit offenen Türen leer und abfahrtbereit keine fünf Meter neben mir, allerdings war sie bewacht. Ab und zu stieg ein Fahrgast ein, meist Leute im Rentenalter. Nach fast einstündiger Wartezeit, in der ich zusehends nervöser wurde, kam der Offizier endlich zurück, gab mir strengen Blickes den Pass zurück und sagte im forschen Ton, dass ich damit hier nicht ausreisen könne, ich müsste mir dafür bei der rumänischen Botschaft ein Visum geben lassen. Damit war für ihn die Sache erledigt, er schubste mich zum Eingang zurück. Eine erste Niederlage.
Was nun weiter? Ich hatte in Rumänien gehört, dass es angeblich Leuten gelungen war, sich von der russischen Botschaft ein Visum für West-Berlin zu
beschaffen. Also machte ich mich am nächsten Tag auf die Suche nach der russischen Botschaft, ein imposanter Bau „Unter den Linden“. An der Pforte trug ich mein Anliegen vor und wurde auch recht freundlich gebeten, in einem großen Warteraum Platz zu nehmen. Nach einiger Zeit kam ein junger Beamter, um sich mein Problem anzuhören. Er sagte, da müsse er sich erkundigen, nahm meinen Pass und verschwand damit. Wieder begann ich, innerlich zu beten und zu hoffen. Alsbald kam er zurück und gab mir freundlich Auskunft, dass für diese Angelegenheit nur die rumänische Botschaft zuständig sei. Umsonst versuchte ich, Einwände vorzutragen, ich wäre in Zeitnot und es handele sich bloß um ein Tagesvisum, um einen Onkel in West-Berlin mit einem Kurzbesuch zu überraschen. Er hob nur bedauernd die Schultern und verabschiedete sich. Die zweite Niederlage.
Zu der Zeit hielt sich mein guter Freund Klaus B. zum Studium in WestBerlin auf. Wir kannten uns seit früher Kindheit, unsere Väter waren Klassenkameraden gewesen und hatten, später, als die Kommunisten an die Macht gekommen waren, in einem alten Schuppen auch eine kleine Werkstatt für galvanotechnische Arbeiten zusammen eröffnet. Mit Klaus hatte ich im Gymnasium die Schulbank gedrückt. Er war 1971 mit seiner ganzen Familie in die Bundesrepublik ausgewandert, und nun studierte er in West-Berlin. Ich konnte ihn telefonisch erreichen, und er kam auch sofort herüber. Nach sieben Jahren genossen wir das Wiedersehen. Klaus hatte eine Sondergenehmigung für den Zutritt in Ostberliner Archive zwecks Nachforschungen für seine Diplomarbeit, hielt sich also öfter im Ostteil der geteilten Stadt auf. Wir erzählten, wie es uns in den Jahren ergangen war, wie gern ich in den Westen gelangen würde und was ich bisher erfolglos unternommen hatte. Ebenso, dass die Chancen, eine offizielle Genehmigung zu erlangen, gegen null strebten. Wir trafen uns in den nächsten Tagen noch einige Male, saßen zusammen oder fuhren durch die Stadt, um uns einiges anzusehen. Da war zum Beispiel auch die Straße, in der früher die UFA-Filmstars gewohnt hatten, mit sehr schönen Villen. Die Spree bildete dort die Grenze, und zwischen Straße und Fluss verlief die Mauer. Wir hielten und stiegen nur kurz aus, weil Klaus meinte, dass es nicht erwünscht sei, sich hier aufzuhalten. Von der etwas erhöht verlaufenden Straße konnte man gut über die Mauer sehen. Drüben, am Westufer, sonnten und badeten die WestBerliner in entspannter Atmosphäre, hier aber, an unserem Ufer, war die graue, bedrohlich wirkende Mauer mit Wachposten. Wir sahen zu, dass wir wegkamen, um nicht aufzufallen.
Wir verabschiedeten uns im Wissen, dass es wohl auf Jahre hinaus unsere letzte Begegnung gewesen ist. Meine nächste Station sollte die Ostsee sein. Noch ahnten wir nicht, wie schnell wir uns wiedersehen würden.
Ich hatte gehört, dass es einem ehemaligem Klassenkameraden gelungen sein soll, über die DDR nach Dänemark zu gelangen. Leider kannte ich keine De-
tails, es war gar nicht sicher, ob das auch stimmte oder nur ein Gerücht war. Ich hatte mir aber vorgenommen, mich unbedingt auch im Norden umzuschauen.
Ich verabschiedete mich von meinen freundlichen Gastgebern in Berlin und fuhr mit der Bahn nach Rostock zu einer Architektenfamilie. Die Leute waren mir zwar nicht bekannt, aber wie so üblich in jenen Jahren, war ich in den Besitz von etlichen Adressen über Freunde und Bekannte gekommen. Viele DDRBürger verbrachten damals den Urlaub in Rumänien, um in den Karpaten zu wandern. Hermannstadt war ein idealer Ausgangspunkt. So lernte man den einen oder andern kennen und tauschte Adressen aus.
Die Aufnahme bei der Familie in Rostock war herzlich und wie selbstverständlich. Da gerade Freitag war, wurde ich eingeladen, die zwei Tage mit der Familie in deren Wochenendhaus außerhalb der Stadt zu verbringen. Am Montag sagte ich meinen Gastleuten, dass ich den ganzen Tag unterwegs sein werde, um mir die Stadt anzuschauen und erst irgendwann abends zurückkehren würde. Ich fuhr zum Bahnhof, um ins 15 Kilometer entfernte Warnemünde an die Anlegestelle der Auto- und Bahnfähre nach Gedser in Dänemark zu gelangen. Der Zug von Rostock nach Warnemünde sollte mit der Fähre nach Dänemark übergesetzt werden. Ich hatte eine Fahrkarte bis Warnemünde gelöst. Schon im Bahnhof Rostock bezogen Grenzsoldaten auf beiden Seiten des Zuges Posten. Es schien, als ob sie einen Geisterzug bewachten, waren doch fast keine Reisende vorhanden. Bahnbegleiter kontrollierten den Zug, sahen in jeden Winkel, auch durch die Luken in die Dachzwischenräume. Auch im Bahnhof Warnemünde wurde der Zug von Soldaten umstellt, so dass kein Mensch unbemerkt hätte zu- oder aussteigen können.
Ich verließ den Bahnhof und orientierte mich gleich in Richtung Fährhafen. Das ganze Gelände war wie ausgestorben. Ein riesiger Vorplatz, auf dem einsam ein halbes Dutzend Lastwagen auf den Durchlass wartete, und außer mir als Fußgänger war nur noch ein junges Pärchen mit Rucksäcken und aufgenähter dänischer Flagge unterwegs, offensichtlich Studenten auf der Rückreise. Ich gelangte zur ersten Sperre mit Kassenhäuschen und versuchte, möglichst unbefangen zu scheinen, was mir als einziger Fußgänger weit und breit nicht leicht fiel. Der Kassierer hatte in meinem Pass geblättert, aber mir dann doch anstandslos eine Hin- und Rückfahrkarte ausgehändigt, wofür ich etwa 30 Deutsche Mark zahlen musste. Innerlich begann ich wieder einmal leise zu jubilieren, natürlich erneut zu früh.
Alle 50 Meter ein Wachsoldat
In der Ferne konnte ich die abfahrtbereite hell erleuchtete Fähre sehen, auch der Zug war schon aufgefahren. Nun musste ich nur noch die 300 Meter entlang des Hafenkais bis dahin zurücklegen, vorbei an den Wachsoldaten, die alle 50 Me-
ter aufgestellt waren. Dann musste ich durch einen letzten Kontrollpunkt, einen kleinen Bau, hinter dem direkt die Fußgängerbrücke zur Fähre anschloss. Drinnen gab es einen schmalen Durchgang, durch den höchstens eine Person passte, und rechter Hand eine hohe Theke, hinter der ein Grenzer saß, so dass gerade nur seine Offiziersmütze sichtbar war. Ich konnte nicht sehen, was der Mann machte, aber das übliche Blättern und Suchen im Pass war in vollem Gange, wie ich es den Geräuschen entnehmen konnte. Dieses Mal dauerte es außergewöhnlich lange, und meine Hoffnung auf ein Durchkommen schwand entsprechend. Nach einem kurzen Telefonat des Grenzers erschien ein Vorgesetzter, nahm den Pass an sich und verschwand damit. Ungeduldiges, nervöses Warten, bloß zehn Schritte noch, und ich wäre in der Freiheit, hämmerte es in mir.
Irgendwann erschien der Offizier wieder, stellte sich breitbeinig in den Durchgang, überreichte mir hämisch grinsend den Pass und sagte nur: „Mit diesem Pass kommen Sie hier nicht durch“. Umsonst versuchte ich, zu erklären, dass es sich bloß um einen 24-Stunden-Kurzbesuch handele. Ich solle doch zu meiner Botschaft gehen und mir dafür ein Visum geben lassen, meinte er abfällig und war nicht bereit, sich auf weitere Diskussionen einzulassen. Auch mein Einwand, dass ich schon eine Fahrkarte hätte, beeindruckte ihn überhaupt nicht, ich könnte versuchen, mein Fahrtgeld an der Kasse wiederzubekommen. Ich ging wortlos, und als ich schon an der Eingangstür war, rief er mir hinterher, ich solle zurückkommen. „Geben sie mir noch mal Ihren Pass“, sagte er, verschwand erneut damit, kam aber gleich wieder, gab mir den Pass zurück und deutete an, ich solle nun gehen. In Gedanken versunken und niedergeschlagen, ging ich am Kai entlang zurück, bekam mein Geld wieder, und draußen war ich. Jetzt durchfuhr es mich, warum hatte der Kerl von mir nochmals den Pass verlangt?
Ich durchblätterte ihn und fand den Grund. Auf der letzten Seite hatte er mir einen Stempel der Grenzstation Warnemünde eingedrückt und diesen handschriftlich durchgestrichen und mit dem Vermerk „ungültig“ versehen. Damit hätte ich nun die größten Schwierigkeiten bei der Rückkehr und Passabgabe gehabt. Ich hätte den Pass allerdings vernichten können und ihn bei der Botschaft in Berlin als verloren melden können. Aber in diesen Momenten reifte nun der Gedanke endgültig in mir heran, jetzt erst recht alles zu versuchen, um zu fliehen, selbst mit dem Kopf durch die Wand.
Ich kehrte nach Berlin zu den freundlichen Gastgebern zurück. Dann rief ich Klaus in West-Berlin an, und wir trafen uns erneut. Auf einer einsamen Parkbank erzählte ich ihm, wie es mir ergangen war, dass ich nicht mehr zurück nach Rumänien wollte und wohl auch sobald keine Gelegenheit gehabt hätte, wieder einmal auszureisen. Er solle mir helfen, irgendwie nach drüben zu gelangen. Wir trennten uns, und er versprach mir, sich zu kümmern, er habe schon von möglichen Fluchthelfern gehört und wolle versuchen, etwas in die Wege zu leiten. In der Zwischenzeit solle ich mich beruhigen und mich möglichst abzu-
lenken versuchen, was ich dann auch in den nächsten Tagen durch Besichtigungen und Museumsbesuche machte.
Nach drei Tagen kam Klaus über die Zonengrenze. Es sollte unser letztes Treffen für viele Jahre werden. Er berichtete mir, dass er Leute kontaktiert hatte, die bereit waren, mich hinüber zu schleusen, und die hätten das auch schon mehrmals gemacht. Die Aktion sollte allerdings 6.000 Mark kosten. Natürlich verfügten er als Student und ich schon ganz und gar nicht über solch eine Summe. Mir fiel als einzige Möglichkeit nur eine bekannte Familie in Herford ein, die eventuell helfen konnte. Es war eine Zufallsbekanntschaft meiner Eltern. Seit vielen Jahren bestand enger Briefkontakt, die Familie war auch schon zu Besuch in Hermannstadt. Auch hatte ich 1969 mit dem Sohn der Familie und dessen Freunden einen Zelturlaub am Schwarzen Meer verbracht. Es waren sehr wohlhabende Leute mit eigenem Betrieb, aber bescheiden und hilfsbereit. Wir vereinbarten, dass Klaus bei der Familie anrufen und ihnen meine Situation und Vorhaben erklären sollte mit der Bitte, die Summe bereitzustellen.
Am nächsten Abend rief ich in Herford bei der Familie an, wir unterhielten uns freudig über Belangloses. Am Ende des Gespräches fragte mich die Frau ganz beiläufig, ob ich mich noch an das Geschenk erinnere, das sie damals bei ihrem Besuch in Hermannstadt erhalten hatten. Ich wusste sofort, dass es sich um einen bemalten Holzteller mit dem Siebenbürger Wappen handelt. Sie meinte, der Teller hinge auch jetzt noch an der Dielenwand als Erinnerung und es sei nun alles klar. Das war also bloß eine pfiffige Identifizierungsfrage gewesen, um sicherzugehen, dass die Geschichte auch wirklich stimmte, die ein ihnen unbekannter Mann am Telefon erzählt hatte.
Nun wollte mein Freund noch einmal von West-Berlin kommen, um mir die Anweisungen zu geben, wie alles ablaufen sollte. Wir hatten bei unseren Telefonaten stets darauf geachtet, nichts Verdächtiges zu äußern und die Gespräche als harmlos erscheinen zu lassen. Dann erschien am Abend des nächsten Tages plötzlich eine junge Dame bei meinen Gastleuten und stellte sich als Gesandte meines Freundes vor, weil er nicht selber kommen könne. Also unterrichtete mich nun die Botin, was ich zu tun hätte. Ich sollte am nächsten Tag mit der Bahn nach Ludwigslust fahren, ein kleiner Ort an der Transitstraße 5 zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik. Dort sollte ich mich um 23 Uhr einfinden und mich am Ortsausgang an die Straße stellen, wo ich dann von einem dunkelblauen Opel abgeholt werden würde. Als Erkennungszeichen sollte ich mir eine Zeitung unter den Arm klemmen und kein Gepäck bei mir haben. Auch sollte ich meine knallgelbe Windjacke anhaben, um in der Dunkelheit besser gesehen zu werden.
Am nächsten Tag verabschiedete ich mich wie immer von den Gastleuten und begab mich zum Bahnhof. Um sicher zu gehen und um mich vor Ort noch umzusehen, nahm ich schon den nächsten Zug und kam dementsprechend sehr früh
in Ludwigslust an, einem verschlafenen Ort, menschenleer. Was nun, es war erst früher Nachmittag, und mir war klar, dass jeder Fremde sofort auffallen würde. Ich machte mich also auf, um die Umgebung bei Tageslicht zu erkunden. Gleich am Ortsausgang querte eine Bahnlinie die Straße, und daneben, an der Schranke, befand sich ein dreistöckiger Bahnwärterturm mit Fenstern nach allen Seiten. Dahinter war nur noch freie Wiese mit Büschen und etwa 200 Meter vom Turm entfernt eine größere Hecke, direkt entlang der Straße. Dahinter wollte ich mich am Abend verstecken.
Ich ging zurück in den Ort, betrat die einzige Kneipe, die ich an der Hauptstraße finden konnte. Ich war der einzige Gast und bestellte beim Wirt etwas zu essen. Dann nahm ich mir lange Zeit, um Zeitung zu lesen, die Minuten und Stunden zogen für mein Gefühl unerträglich langsam dahin. Irgendwann kam noch eine Gruppe Dorfjugendlicher ins Lokal, die sich lärmend an einen Nebentisch setzten und mich immer wieder neugierig und tuschelnd anstarrten. War ja klar, dass da wohl jeder jeden kannte und ich halt der Fremde war. Irgendwann rückte dann der Abend heran, auch konnte ich nun nicht länger in der Kneipe sitzen, das wäre noch auffälliger gewesen. Also begab ich mich schlendernd zum entgegengesetzten Ortsausgang. Ich wollte in großem Bogen über Feld und Wald den Ort umgehen, um gegen 23 Uhr in der Dunkelheit an den vereinbarten Treffpunkt zu gelangen. Ich trachtete danach, möglichst nicht von den heimkehrenden Bauern gesehen zu werden. Als es dunkel war, wurde das Vorwärtskommen immer schwieriger, in der Ferne hatte ich als Orientierung immer die Lichter der Ortschaft, aber ansonsten konnte man kaum etwas erkennen. Ich stolperte einige Male über Elektrodrähte von Kuhweiden oder trat in Pfützen, alles mehr tastend und erahnend. Schließlich erreichte ich die Hecke, die ich mir ausgesucht hatte, und kauerte mich dahinter. Auf der Straße herrschte kaum Verkehr. Der Bahnwärterturm war erleuchtet, ich dachte bei mir, dass er womöglich auch schon Überwachungsfunktion der Transitstrecke hatte.
Kurz vor 23 Uhr stellte ich mich an die Straße, um im Scheinwerferlicht der Autos gesehen zu werden. Schon nach wenigen Minuten sah ich, wie eines der recht schnell vorbeifahrenden Autos nach 50 Metern plötzlich mit quietschenden Reifen stehen blieb, wendete und bei mir auf der anderen Straßenseite hielt. Es war der dunkelblaue Opel mit schwarzem Dach. Ein Mann winkte mich heran und deutete mir an, im Wagenfond einzusteigen. Sie waren zu zweit, soweit ich erkennen konnte, zwei jüngere Typen mit langer Mähne und in Jeansmontur. Anstatt zu wenden, fuhren sie weiter in die Richtung, aus der sie gekommen waren, also wieder durch den ganzen Ort. Erst fünf Kilometer danach wendeten sie, um erneut den Ort in Richtung Grenze zu passieren. Bis zum Grenzkontrollpunkt Lauenberg/Horst waren es noch etwa 90 Kilometer. Die Typen sprachen nicht viel. Ich sollte kurz vor der Grenze die Rücksitzlehnen umklappen und mich dahinter legen. Die Trennwand zum Kofferraum war herausgeschnitten und
dieser voll gestopft mit Teddybären aus Schaumstoff. Sie erzählten, dass sie diese Strecke mindestens einmal in der Woche fuhren, um die Ware von WestBerlin ins Bundesgebiet zu bringen. Sie waren schon an der Grenze bekannt und würden nicht kontrolliert. Wir näherten uns der Grenze, und ich versteckte mich hinter dem Rücksitz, lang ausgestreckt unter dem Haufen Teddybären. Ich hörte nur noch meinen Puls vor Aufregung hämmern, es war die Angst, entdeckt zu werden, aber auch die Vorfreude auf die neue Welt. Dann hörte ich einen der beiden Männer mit dumpfer Stimme sagen, ich solle mich nun ganz ruhig verhalten, wir seien gleich am Grenzübergang. Der Wagen hielt mit laufendem Motor, und ich konnte deutlich Gesprächsfetzen auffangen. Die beiden Fahrer unterhielten sich offensichtlich mit den Grenzern, und das allmählich immer erregter, was natürlich meine Unruhe steigen ließ. Ich konnte verstehen, dass gefragt wurde, wo sie denn so lange geblieben seien. Aus dem Stimmengewirr konnte ich dann nur noch befehlende Anweisungen heraushören, Geräusche die auf ein großes Metalltor hindeuteten. Der Wagen fuhr kurz an, dann wieder das dröhnende Schließen des Tores, und plötzlich Totenstille, minutenlang. Mir wurde klar, dass ich in der Falle saß. In diesen Momenten konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen, nur völlige Leere und Resignation in meinem Kopf.
Im nachhinein kann ich nur spekulieren, warum alles schief gelaufen ist. Waren wir beobachtet worden? Wurden Telefonate abgehört? Oder war es einfach nur Pech. Ich vermute letzteres.
Ich lag noch immer reglos im Versteck, draußen wurde es lauter, Befehle flogen hin und her, Waffengeklapper und Hundegebell waren zu hören. Nun fingen sie an, den Kofferraum auszuräumen. Es wurde immer heller, und bald konnte ich durch Lücken im Teddyhaufen erkennen, was draußen los war. Da stand ein halbes Dutzend Grenzsoldaten mit Waffen im Anschlag. Daneben zwei Schäferhunde, die an den Leinen zerrten und wütend bellten. Mir war klar, dass ich jetzt völlig bewegungslos bleiben müsste, weil die Bewacher genauso Angst hatten wie ich. Es soll vorgekommen sein, dass ertappte Flüchtlinge in ähnlicher Situation durchgedreht hatten und mit Waffengewalt selber zum Angreifer wurden. Ich stieg in Zeitlupentempo aus dem Kofferraum. Soldaten legten mich in Handschellen, die sie an einer Wand befestigten, so dass ich mich nicht umdrehen konnte. Flüchtig konnte ich davor eben noch erkennen, dass die beiden Fluchthelfer ebenfalls gefesselt an der Wand standen, getrennt durch Sichtblenden. Danach habe ich die beiden nie wieder gesehen.
In einem kleinen Büro – ich war mit den Handschellen ans Heizungsrohr gekettet – nahmen mich Stasi-Leute ins Kurzverhör. In erster Linie wollten sie in den folgenden Wochen von mir erfahren, wie der Fluchtversuch organisiert wurde und vor allem, welche Leute damit zu tun hatten. Sie waren davon überzeugt, dass es sich um eine gut organisierte „Bande von Menschenhändlern“ handele und waren scharf darauf, das aufzudecken, um sich zusätzliche Stern-
chen für die Schulterklappen zu verdienen. Noch in derselben Nacht wurde ich in einen Gefangenentransporter geladen und in Untersuchungshaft nach Berlin gefahren. Im Transporter waren etliche 60 mal 60 Zentimeter große zellenartige Abteilungen, in denen man sich nicht bewegen konnte. Mir war das im Moment völlig egal; erschöpft von den Aufregungen des Tages, war ich auch sofort eingeschlafen.
Wie im Krimi
Bei der Ankunft am Morgen in Berlin fragte mich ein Staatsanwalt, ob ich einen Dolmetscher brauche, und las mir die Anklage wegen versuchter Flucht vor. Die Aufnahme ins Gefängnis verlief so, wie sie aus jedem US-Krimi zur Genüge bekannt ist. Alles wurde mir abgenommen, Fingerabdrücke wurden gemacht, ich wurde fotografiert, erhielt Anstaltskleidung, schwarze Trainingshose, graues Hemd und Pantoffeln, dazu Seife, Zahncreme und -bürste, Handtuch. Die ganze Anlage machte einen blitzsauberen Eindruck, alles in Grau-Beige und kaltes Neonlicht getaucht. Die Einzelzelle mit Pritsche, Stuhl, Tisch, WC-Schüssel und Waschbecken, die schwere Tür mit Guckloch und Essensklappe. Es gab ein kleines Fenster unterhalb der Decke, so dass Hinausschauen nicht möglich war. In regelmäßigen Abständen beobachtete mich der Wachposten durch den Türspion. Dreimal am Tag wurde Essen durch die Klappe hereingereicht, alles sehr sauber, hygienisch und recht abwechslungsreich. Um 6 Uhr war Weck- und um 22 Uhr Schlafenszeit. Ein Notlicht brannte ununterbrochen, wir wurden rund um die Uhr beobachtet. Alle drei Tage wurde ein Elektrorasierer hereingereicht, einmal in der Woche wurden wir zum Duschen geführt. Bei Bedarf konnte man ärztliche Behandlung anfordern. Nach einem Monat bekam ich fürchterliche Ohrenschmerzen, eine Sache, die noch aus den Kinderjahren herrührte. Ich wurde gut behandelt, erhielt Medikamente und Bestrahlungen.
Einmal am Tag gab es 30 Minuten Hofgang in etwa 16 Quadratmeter großen Parzellen, umgeben von drei Meter hohen Mauern, über die ein Laufsteg verlegt war, auf dem ein Wachposten seine Runden drehte. Ich nutzte die Zeit, um mich zu bewegen, lief im Kreise herum oder machte Turnübungen. Alles war so organisiert, dass man nie einen anderen Häftling zu Gesicht bekam oder sprechen konnte. Man war immer nur mit dem begleitenden Wachmann unterwegs. Manchmal hatte ich den Eindruck, in einer Geisterburg zu sein.
Gleich am ersten Tag haben die Verhöre begonnen. Man geleitete mich ins Büro eines jungen Stasi-Offiziers. Dieser sollte während der drei Monate Haft mein ständiger und einziger Ansprechpartner werden. Im Bürotrakt gab es lange graue, in grelles Licht getauchte Flure mit einer Vielzahl von schallgedämmten Bürotüren und Signallampen, sowohl innen als auch außen. Diese zeigten dem Personal, welche Räume besetzt waren und wann ein Häftling unterwegs zum
Verhör war oder gerade abgeholt wurde. Dadurch wurde verhindert, dass man andere Gefangene traf oder sprechen konnte.
Das Büro meines Offiziers war ein kahler Raum mit Schrank, Schreibtisch mit Stuhl; ein weiterer Tisch mit Stuhl stand für den Häftling bereit. Außer einem Telefon, einer Verhörlampe, die einem ins Gesicht gerichtet werden konnte, und einem Notizblock war sonst nichts vorhanden.
Die Verhöre fanden anfangs täglich, später in unregelmäßigen Abständen statt und dauerten oft den ganzen Tag. Das war nervenaufreibend, weil ich nie wusste, ob ich wieder dran war, und wenn, wie lange es dauern würde.
Die Stasi war davon überzeugt, dass es sich in meinem Fall um einen Menschenhändlerring handele, der unbedingt enttarnt werden müsse. Der Offizier stellte mir unzählige Male immer wieder dieselbe Frage, er forderte mich auf, endlich zuzugeben, dass ich mit der Absicht ins Land gekommen war, um zu flüchten. Oft kam er dabei in Rage und brüllte mich einschüchternd an, weil ich immerzu alles verneinte und er sich nichts Neues notieren konnte. Das Fatale an der ganzen Geschichte war nämlich mein Adressbuch gewesen, das sie bei mir gefunden hatten. Dieses kleine rote Büchlein war außer dem Reisepass das einzige, was ich bei mir hatte, die Reisetasche hatte ich ja bei den Gastleuten zurückgelassen. Dieses Adressbuch wurde zum reinsten Alptraum. Darin waren all meine Adressen in Rumänien und fatalerweise Unmengen von Leuten in der DDR und der Bundesrepublik, teilweise von Leuten, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte.
Bei der Stasi
Das war das gefundene Fressen für den Stasi-Offizier. Ich musste tagelang unzählige Protokolle schreiben und über jede Adresse Auskunft geben, wer die Person sei, woher ich sie kenne, in welcher Beziehung zu ihr stand, wann ich sie zum letzten Mal gesehen hatte. Ich wollte natürlich, dass keiner der Bekannten in der DDR, deren Adresse ich notiert hatte, wegen mir irgendwelche Schwierigkeiten bekommen sollte. Ich legte mir eine kleine Geschichte zurecht, die ich dem Offizier immer wieder erzählte, und zwar, dass mein Fluchtversuch keineswegs von Anfang an geplant war. Vielmehr wäre es eine spontane Sache gewesen, der Gedanke zur Flucht wäre mir erst spät während des BerlinBesuchs gekommen, keine weitere Person hätte etwas von meinem Vorhaben gewusst, auch nicht meine Eltern, denen ich nun sicherlich große Sorgen bereitet hatte, weil von mir kein Lebenszeichen mehr kam. Erst nach einem Monat durfte ich eine Postkarte nach Hause schreiben mit kurzer Angabe meines Aufenthalts. Als Alibi, dass es mit der Flucht wirklich bloß eine spontane Sache gewesen war und ich eigentlich wieder nach Hause fahren wollte, hatte ich etliche Geschenke eingekauft, die sich in meiner Reisetasche befanden. Während
meiner Haft hat die Stasi all meine Angaben zu den DDR-Adressen überprüft und die ahnungslosen Leute zu meiner Person befragt. Allmählich wurde mein Offizier in den nächsten Wochen zusehends freundlicher, als er merkte, dass meine Angaben zu den DDR-Bekannten auch wirklich stimmten. Es gab auch einige Ungereimtheiten, die ich aber ausräumen konnte. Zum Beispiel hatte ich mir eine fiktive Adresse aus Ludwigslust ins Büchlein eingetragen, um im Falle einer Kontrolle angeben zu können, einen Bekannten besuchen zu wollen. Lustig war dabei, dass ich mir eine Friedensstraße ausgedacht hatte, die es dann aber auch tatsächlich gab. Natürlich suchten die Stasi-Leute vergebens an der eingetragenen Hausnummer nach der Person.
Das schlimmste während der Haft war in den ersten Wochen die Einsamkeit. Alleine in der Zelle ohne jede Ablenkung von den täglichen Verhören, ohne Beschäftigung, immerzu die quälenden Gedanken, was mich nun erwarten würde.
Als sich das Verhältnis zum Stasi-Offizier etwas zu entspannen begonnen hat, wurde mir erlaubt, Bücher zu lesen, natürlich meist politisch entsprechende Bücher. Mir war das egal, Hauptsache, ich hatte eine Beschäftigung und Ablenkung. Ich las während der drei Monate etwa 20 Romane, alles dicke Wälzer. Das wiederum wirkte sich schlimm auf meine Augen aus: Durch das ständige Nahesehen und den nur auf fünf Meter begrenzten Horizont in der Zelle und beim Hofgang verschlechterte sich meine Sehkraft derartig, dass ich richtig erschrak, als ich bei meiner Entlassung alles nur noch verschwommen wahrnehmen konnte. Davor hatte ich richtig Adleraugen gehabt. Vollständig hat sich das nie mehr gebessert.
Ab und an durfte ich im Vernehmungszimmer eine Tageszeitung lesen, oder der Stasi-Offizier unterhielt sich mit mir über Sport und andere belanglose Dinge. Man legte anscheinend Wert darauf, dass ich als Ausländer keinen Grund zur Klage wegen schlechter Behandlung haben sollte. Ich musste sogar zweimal im Laufe der Haft eine Erklärung in diesem Sinne unterschreiben.
Das allerbeste war dann nach sechs Wochen, als ich mit einem anderen Häftling zusammengelegt wurde. Das war ein Türke aus West-Berlin, etwa in meinem Alter. Er sprach zwar sehr schlecht Deutsch und war geistig nicht gerade besonderes gesegnet, aber wir unterhielten uns trotzdem irgendwie und manchmal bloß durch Handzeichen. Hauptsache, ich war nicht mehr alleine. Der Mann war todunglücklich, weil Bekannte sein Auto ohne sein Wissen zur Fluchthilfe benutzt hatten und aufgeflogen waren. Er wurde dann beim Besuch in OstBerlin verhaftet, und nun drohte ihm der Verlust des Arbeitsplatzes und dadurch die Abschiebung in die Heimat.
Irgendwann ließ der Offizier durchblicken, dass ich nach dem Ende der Untersuchungen bald in die Heimat abgeschoben werden würde. Eines Tages brachte der Wärter meine Kleider. Ich zog mich um, und zwei Offiziere in Zivil brachten mich in einen Wagen des Typs Lada. Mit verbundenen Augen und in
Handschellen ging es in eine Vollzugsanstalt. Mir wurde erklärt, dass ich dort den rumänischen Botschafter in Ost-Berlin treffen werde.
Im Vorbeigehen konnte ich noch einen Blick in den Gefangenentrakt werfen. Das sah dort genauso aus, wie man es im Kino schon oft gesehen hatte, alles überfüllt mit Häftlingen, die lärmten, während sie in ihre Zellen gebracht wurden.
Botschafter tödlich verunglückt
Man brachte mich in ein Büro, und dann erschien ein älterer, elegant gekleideter Herr, der sich als der Botschafter vorstellte. Er sprach mich rumänisch und in väterlichem Ton an und erkundigte sich, wie es mir gehe. Was hätte ich mir denn da eingebrockt und ich solle doch nicht denken, dass dort drüben alles golden sei, die hätten auch ihre Probleme, und es sei nicht das Paradies. Er sagte mir noch, dass ich in Kürze nach Rumänien überstellt werde, und weg war er. Später erzählte mir mein Offizier, der Botschafter habe auf der Rückfahrt nach dem Treffen einen schweren Autounfall auf regennasser Straße gehabt.
Ende September war es dann soweit. Ich wurde dem Staatsanwalt vorgeführt, und der teilte mir mit, ich werde wegen einer schweren Straftat, versuchter Republikflucht, des Landes verwiesen und erhalte Einreiseverbot. Gemäß einem Abkommen mit Rumänien werde ich den rumänischen Behörden überstellt.
Am nächsten Tag erhielt ich meine Kleidung und die Reisetasche. Von zwei Stasi-Leuten in Zivil flankiert, ging es in Handschellen und mit verbundenen Augen in einem Auto zum Flughafen Berlin-Schönefeld. In der Abflughalle übergaben sie mich einem Vertreter der rumänischen Botschaft. Mit einer Linienmaschine der rumänischen Fluggesellschaft flog ich als normaler Passagier ohne Bewachung nach Bukarest.
Nach der Landung musste ich warten, bis alle Passagiere ausgestiegen waren. Dann nahmen mich zwei gelangweilte Polizisten an der Treppe in Empfang und fuhren mich in ein Bukarester Gefängnis, wo ich ohne irgendeine Prozedur direkt in eine Zelle gebracht wurde.
Die eine Woche, die ich dort verbringen musste, war schlimmer als die Monate in Berliner U-Haft. Das DDR-Untersuchungsgefängnis war im Vergleich ein Luxushotel. Es waren einfach die hygienischen Umstände, das gesamte Umfeld und der Umgang des Personals mit den Häftlingen, alles zutiefst deprimierend.
Das Gepäck war mir abgenommen worden, ebenso Schnürsenkel und Hosengürtel. Eine Gefängniskluft gab es nicht, ich musste während des gesamten Aufenthaltes meine eigene Kleidung anbehalten.
Die Zelle war eng, dunkel, muffig und sehr niedrig. Auf zwei Seiten des Raumes gab es eine Reihe von Etagenbetten mit dreckigen Matratzen, die wohl noch den Ersten Weltkrieg erlebt hatten. Zwischen den Bettreihen gab es einen
60 Zentimeter breiten Zwischenraum, ferner eine Klomuschel und ein Waschbecken. Es war alles so eng, dass man die ganze Zeit im Bett verbringen musste. Der oben Liegende hatte die Zimmerdecke direkt vor der Nase. Ein Fenster gab es nicht, nur eine Art völlig wirkungsloser Lichtschacht. Tag und Nacht brannte eine schwache Glühbirne, man hatte das Gefühl, in einer schummrigen Höhle zu sitzen. Kein Wunder, dass ich einige Male Platzangst bekam und mich anstrengen musste, auf andere Gedanken zu kommen. Zum Glück war die Zelle nur mit drei Mann besetzt, sonst wäre die Enge unerträglich gewesen. Dreimal am Tag wurde ein Alu-Essnapf hereingereicht mit ewig demselben Zeug: morgens eine Scheibe Brot mit Marmelade und Tee, mittags und abends ein weißer, geschmackloser Getreidebrei, der wie Tapetenkleister aussah.
Einer meiner Zellengenossen war ein stämmiger Zigeuner, der andere eine bleiche, rothaarige Bohnenstange, aber sehr gelassen und abgebrüht. Mit letzterem konnte ich mich wenigstens vernünftig unterhalten. Seine Geschichte war recht interessant und sollte mich auch indirekt tangieren. Zu der Zeit war in Rumänien ein riesiger Weinpantschskandal aufgeflogen, der das ganze Land erfasst hatte. Die Polizei war mit Ermittlungen überfordert. Dieser Zellengenosse war aus Temeswar und in die Affäre verstrickt. Er protzte die ganze Zeit mit seinem Vermögen, das er sich dadurch ergaunert hatte; er war sich sicher, dass er bald entlassen werde, weil er draußen Freunde hatte, die sich mit den „entsprechenden Mitteln“ bei den richtigen Stellen für ihn einsetzen würden. Einmal brachten seine Leute ein Lebensmittelpaket; sie hatten die Wärter bestochen. Lustig war es, als wir uns daran machten, eine steinharte Wintersalami ohne Messer zu essen. Wir entfernten die Matratzen und versuchten Scheiben an den scharfkantigen Stahlbändern der Bettunterlage abzuschneiden. Nur mit größter Anstrengung gelang es uns, daumendicke Stücke abzuschneiden, was uns aber nicht weiter störte.
Am Tag nach meiner Einlieferung wurde ich zum Verhör gebracht, und zwar in ein Großraumbüro, in dem eine Menge Securitate-Offiziere an Schreibtischen saßen. Ich wurde zu einem jungen Oberleutnant an den Tisch gesetzt, der nur flüchtig aufschaute und wie beiläufig fragte, was ich angestellt hätte, ohne sich weiter in seiner Arbeit stören zu lassen. Ich wollte schon anfangen, ausführlich zu berichten, aber er schob mir gleich einen Schreibblock hin, ich solle doch am besten alles aufschreiben. Auch deutete er auf einen handdicken Aktenordner auf seinem Schreibtisch, verdrehte die Augen und meinte stöhnend, dass dieser mit mir aus der DDR angeliefert worden war. Die deutsche Gründlichkeit. Darin waren alle Protokolle und Berichte meiner Untersuchung säuberlich abgeheftet. Das Zeug müsse erst einmal übersetzt werden, meinte der Offizier, und die Übersetzung solle ich auch selber bezahlen. Mein Geschreibsel interessierte ihn auch nicht mehr, er ließ mich wegbringen und vergrub sich weiter in seine Arbeit. Offensichtlich waren vereitelte Fluchtversuche an der Tagesordnung, und die
erwischten Leute kaum noch außergewöhnlich interessant für die SecuritateOffiziere, die waren eher froh, diese Fälle möglichst rasch loszuwerden. Aber sgegeben, in Rumänien gäbe es keine politischen Häftlinge. Jeder, der sich diesbezüglich etwas zu Schulden hatte kommen lassen, sollte seine Strafe im Zivilleben an seinem Arbeitsplatz abarbeiten.
Nach einer Woche wurde ich erneut dem Leutnant vorgeführt, der mir kurz angebunden mitteilte, dass ich nun entlassen werde und mich zu Hause schleunigst um eine Arbeit kümmern sollte. Ansonsten solle ich mich bei den örtlichen Behörden melden, wenn ich dazu aufgefordert werde. Damit war für ihn die Sache erledigt, und ich durfte nach Hermannstadt fahren.
Das ganze Abenteuer hatte Spuren hinterlassen, ich war bleich, hohlwangig, meine Sehkraft angegriffen, und ich hatte zehn Kilogramm abgenommen, in erster Linie wegen der nervlichen Belastung.
Nun sollte eine Zeit des Suchens und Spießrutenlaufens beginnen. Mein Arbeitsvertrag war inzwischen aufgelöst worden. Die ehemaligen Arbeitskollegen begegneten mir teils mit verständlichem Lächeln, teils mit hämischem Grinsen, für linientreue Parteimitglieder war ich ein Landesverräter. Ich holte mein Arbeitsbuch ab und bewarb mich bei mehreren Baufirmen. Es gab immer nur Absagen, spätestens, wenn ich meine Situation darlegte. Die Leute wollten oder durften mich nicht einstellen, auch wenn sie über freie Stellen verfügten. Da war zum Beispiel das Projektionsinstitut des Kreises Hermannstadt. Mit etlichen Angestellten, einschließlich den Chefs, hatte ich während des Hotelbaus oft zu tun gehabt, wir kannten uns. Der Direktor des Institutes, ein angesehener Architekt und in seiner Funktion natürlich Parteimitglied, sollte drei Jahre später selber von einem Aufenthalt im Westen nicht mehr zurückkehren, was auf Kreisebene natürlich ein großes Hallo hervorrief. Der kam allerdings dann nach einem Jahr wieder zurück, weil er in Deutschland nicht zurechtkam; er wurde nur noch als Mensch zweiter Klasse behandelt.
Ich hatte also auch hier eine Absage erhalten, doch einige Tage später kam plötzlich eine schriftliche Einladung zu einem Gespräch. Im Besprechungsraum wurde ich von einem stattlichen Mann erwartet. Er kam auch ohne Umschweife zum Thema und stellte sich als Oberst X des Geheimdienstes vor, verantwortlich für alle Baufirmen des Kreises Hermannstadt. Er erklärte mir in übertrieben freundschaftlichem Ton, dass ohne seine Zustimmung nichts laufen würde; ich könnte auf der Stelle eine Anstellung bekommen, wenn ich mich verpflichten würde, als Informant tätig zu sein. Bei mir schrillten alle Alarmglocken. Ich antwortete ihm, ohne viel zu überlegen, dass ich für Derartiges nicht geeignet sei, es käme überhaupt nicht in Frage. Der Mann entließ mich sogleich mit der Bemerkung, ich solle es mir doch noch überlegen. Nach einigen Tagen zitierte er mich zu einem weiteren Gespräch, um mich zu überzeugen. Weil ich mich weiter-
hin kategorisch weigerte, wurde er plötzlich stinksauer und brüllte mich an, ich solle verschwinden, solange er das Sagen habe, würde ich nie wieder irgendwo eine Anstellung finden.
Hilfsarbeiter
Aber ich hatte wieder Glück mit Chefingenieur Dieter K., der mir schon vier Jahre zuvor geholfen hatte, einen Arbeitsplatz zu finden. Er stellte mich provisorisch in seiner Baufirma als unqualifizierter Hilfsarbeiter ein und teilte mich einem seiner Bauleiter zu, den ich noch aus der Studienzeit in Klausenburg kannte, um ihm beim Schreibkram zu helfen.
Schon zwei Wochen danach hat er mich „weitervermittelt“ an die kreiseigene Firma, die Plattenbauten errichtete und die Wohnungen Privatleuten verkaufte. Für mich gab es damals keine Hoffnung mehr, in absehbarer Zeit auswandern zu können. In der Schwimmschulgasse, in der Nähe des Erlenparks, sollten fünf Wohnblocks hochgezogen werden. Wegen der guten Lage hatten sich viele „Prominente“ und Bonzen Kaufverträge für eine Wohnung gesichert. Weil diese Bauten unter meine Aufsicht gestellt wurden, nutzte ich die Gelegenheit und kaufte auch eine Wohnung, die im Laufe von zehn Jahren in Raten zu bezahlen war. Ich stellte mir vor, dass ich so zumindest ein kleines Pfand in der Hand hätte, wenn es später um die Frage der Aussiedlung gehen sollte. Ich trachtete auch danach, etliche Verbesserungen während der Bauzeit einfließen zu lassen: Bad rundum gefliest, Parkettboden statt PVC, zusätzliche Dämmung an der Außenwand. Die Rückseite der Wohnblocks grenzte an einen großen Parkplatz für Lastwagen, der zu einer Militäreinheit gehörte.
Mein Bruder war der erste nahe Verwandte, der 1980 durch Heirat auswandern durfte. Drei Jahre später folgten meine Eltern durch Freikauf. Nun war ja die Sache klar, die Verwandtschaft ersten Grades im Westen, somit stellte ich mit Frau und Kind auch den Ausreiseantrag. Mitte November 1986, es war schon gegen Mitternacht, klingelte es kurz an der Tür. Durch den Türspion konnte ich einen Offizier erkennen. Er entschuldigte sich mehrmals schüchtern und bat um Einlass. Dann meinte er, dass wir in zwei Wochen die Pässe bekommen würden. Es stellte sich heraus, dass der Mann in der Militäreinheit arbeitete und seine Frau als Sekretärin beim Passamt. Die beiden waren auf unsere Wohnung scharf, und damit war für uns die Sache klar. Sie haben dann sogar einen Teil der Einrichtung übernommen.
Dann folgten die üblichen Phasen der Wohnungsauflösung, Kisten packen und Verzollung in Arad. Die Hausratauflösung erfolgte oft bei Kerzenlicht.
Im Februar 1987 war alles erledigt, und wir konnten die Reise antreten. Bei klirrender Kälte mussten wir mit dem letzten Abendzug die 60 Kilometer von Hermannstadt nach Mediasch fahren, um dort den Zug zu erreichen. Mitten in
der Nacht bei minus 15 Grad warteten wir auf die Bahn. Dann die Durchsage, der Zug habe vier Stunden Verspätung. Es wurden noch mehr. Gegen Morgen endlich die Abfahrt, aber vorerst nur bis Budapest. Dort wurde der Zug auf ein Abstellgleis geschoben; es sollten Stunden bis zur Weiterfahrt vergehen.
Uns waren Getränke und Essen wegen der großen Verspätung ausgegangen. Also lief ich in die Bahnhofshalle, um das letzte rumänische Geld zu wechseln und etwas einzukaufen. Am Wechselschalter stand eine lange Schlange mit Leuten aus aller Herren Länder: Auch Bulgaren, Russen und Tschechen waren darunter. Als ich an der Reihe war, hieß es, alles andere außer rumänischem Geld. Ich schämte mich für etwas, wofür ich gar nichts konnte, und füllte die Thermosflasche draußen um die Ecke mit eiskaltem Leitungswasser.
Mit acht Stunden Verspätung erreichten wir Nürnberg. Es waren aber nicht bloß diese acht Stunden, es waren aus meiner Sicht neun Jahre Verspätung.
Seit meinem ersten Fluchtversuch sind inzwischen mehr als 30 Jahre vergangen. Die Wende, der Mauerfall, der Zusammenbruch des Kommunismus. Manchmal kommt es einem vor, als ob es nie eine andere Welt gegeben hätte, als ob das Ganze nur Fiktion gewesen wäre. Nein, das war es sicherlich nicht, sonst plagten mich nicht auch heute noch die gleichen Alpträume.
In meinem Versicherungskonto klafft die dreimonatige Lücke meiner Haft. Die Bundesversicherungsanstalt verlangte einen Nachweis für diese Zeit. Natürlich hatte ich weder in der DDR noch in Rumänien ein Dokument über die Zeit erhalten. Jahre später bat ich das Gesundheitsamt Berlin, im Stasi-Archiv nachzuforschen. Einige Tage später war meine Akte gefunden. Ich wurde rehabilitiert mit einer kleinen, symbolischen Summe entschädigt für die entstandenen Nachteile.
Diese Aufzeichnungen habe ich zufällig am 3. Oktober 2008, dem Tag der Deutschen Einheit, beendet. Die Medien feierten diesen Tag als den 18. Geburtstag des vereinten Deutschland und gleichzeitig die Großjährigkeit des Landes. Es macht mich nachdenklich, und ich versuche mir vorzustellen, wie es wohl gewesen wäre, wenn diese Vereinigung schon vor 30 Jahren zustande gekommen wäre...
Gerhard Dabi, geboren am 6. Februar 1950 in Hermannstadt, hat sich nach der Ausreise 1987 in Nürnberg niedergelassen; er war 18 Jahre lang in einem Architekturbüro tätigt und hat für die Esso AG und zuletzt auch für Audi Tankstellen und Autohöfe gebaut und umgestaltet. Danach wurde er arbeitslos, weil das Büro wegen Auftragsmangels und schlechter Konjunktur Insolvenz anmelden musste. Obwohl er zwei Fortbildungslehrgänge beendet hat, sind die Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, gleich null.










