
29 minute read
Einkaufen muss sich verändern
Trendforscherin, Publizistin, Kurato- rin, Dozentin – die Wahlpariserin Lidewij Edelkoort füllt viele Rollen aus.
„ Einkaufen muss sich ver ändern“
Lidewij Edelkoort gehört zu den wichtigsten Trendforscherinnen der Welt. Sie hält weltweit Vorträge und Seminare und lehrt an Hochschulen. Darüber hinaus publiziert sie Bücher und ihr eigenes Magazin „Bloom“, kuratiert Ausstellungen wie die „M°BA Modebiennale“ in Arnheim oder „Talking Textiles“ in Tilburg. Für die graue Eminenz der Branche und ihr Unternehmen Trend Union ist Zukunftsforschung kein Werk des Zufalls. Dafür ist die Nomadin permanent auf Reisen. Ihre Prognosesicherheit ist legendär. In den USA und in Asien ist sie mit Edelkoort East in Tokio und Edelkoort Inc. in New York präsent. style in progress traf die gebürtige Niederländerin in Arnheim, wo sie im vergangenen Jahr die Modebiennale kuratierte.
Interview: Ina Köhler. Fotos: Susanne Boidol, Marie Taillefer
Was bedeutet die Stadt Arnheim für Sie?
Gemischte Gefühle. Eine sentimentale Reise, weil ich hier damals die Kunsthochschule besucht hatte. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie sich die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg bis ins 21. Jahrhundert entwickelt hat. Arnheim ist sehr ansprechend mit dem Rhein und den wunderbaren Parks im Zentrum, beinahe dörflich. Für mich ist es ein Vergnügen, hier zu sein, aber auch etwas seltsam. Ich bin in Wageningen, einer Stadt hier in der Nähe aufgewachsen, habe einige Zeit in Amsterdam gearbeitet und 1975 Holland verlassen, um dann in Paris den größten Teil meines Lebens zu verbringen.
Ist Paris immer noch „place to be“ für Trends?
Paris ist eine wundervolle Stadt. Sie können dort im Gegensatz zu Holland, wo jeder jeden kennt, sehr anonym leben. Die Schönheit rührt daher, dass Sie in einer Art Open-Air-Museum leben. Paris ist zwar groß, aber keine Megacity. Jedes Viertel ist wie ein kleines Dorf oder eine Kleinstadt. Aber Sie müssen nicht in einer besonderen Stadt leben, um Trends zu finden. Ideen und neue Trends findet man überall.

Haptik ist eines der Schlüsselelemente für Mode – beim Onlineshoppen geht sie verloren.
Wenn Sie einen Ort betreten, was ist Ihr erster Eindruck?
Ich nehme den Raum wahr, das Volumen.
Und wenn Sie Menschen begegnen, worauf achten Sie als Erstes? Mode, Bekleidung?
Nein, Mode in keinem Fall. Lippen und Augen, Gestik und Körpersprache. Ich bin gar nicht so sehr an Mode interessiert. Ich beurteile keine Menschen, das ist nicht mein Ding. Meine Augen scannen den Raum: Details, verschiedene Materialien, verschiedene Hairstyles, verschiedene Schuhe. Ich bemerke alles, aber nicht absichtlich, es ist mir zur zweiten Natur geworden.
Sie sind sehr umtriebig: Trendforscherin, Herausgeberin, Kuratorin und Dozentin. Welche Rolle liegt Ihnen am meisten?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich mag alles und vor allem die Kombination daraus. Alles scheint zusammenzugehören. Was ich von Trends lerne, kann ich auf Ausstellungen übertragen und teile dann dieses Wissen mit Studenten. Und das führt wieder zu anderen Dingen zurück, alles geht ineinander über. Am glücklichsten bin ich allerdings, wenn ich meine Farben und eigenen Trendbücher gestalten kann.
Als wir uns in London getroffen haben, hielten Sie einen Vortrag über Atmosphäre in Shops. Sie sagten, viele Läden seien zu laut, mit zu vielen Elementen.
Ich denke, Einkaufen muss sich verändern. Die meisten Läden sind altmodisch: Sie zeigen viel zu viel Ware zur gleichen Zeit. Der Laden wird als Lager benutzt, das ist in meinen Augen ein großer Fehler. Viel besser wäre es, weniger in einem kleineren Raum zu präsentieren. Eine Art Showroom mit einem versteckten Lager. Und dann wirkt es unangenehm, dass so viele Leute überall das Gleiche anbieten. Das macht die Auswahl schwierig, weil man nichts Neues sieht – es gibt zu viel Ware in den Läden. Im Augenblick erleben wir eine kleine Revolte der jüngsten Generation, die all diese Verschwendung leid ist. Es ist wichtig, kleinere Kollektionen zu entwickeln, die fokussierter, ausgewählter, überraschender sind. Das immer Gleiche ist zu viel. Und dann gibt es nicht mehr genügend Erfahrungen beim Einkaufen. Es fehlen Erfahrungen in Bezug auf Emotion und Überraschung: Berühr mich und verführ mich – ein Dialog, den Sie mit einer Kollektion oder einer Umgebung führen. Hier muss man im Einzelhandel umdenken.
Wird der Wettbewerb zwischen Online- und Offlinehandel die sen Prozess forcieren?
Er zwingt die Händler dazu, sich eindeutig zu positionieren. Jeder wird gezielt beides bedienen müssen. Aber ab einem bestimmten Punkt wird die mangelnde Aktivität vor dem Bildschirm zum Problem. Wir berühren nichts mehr. Ich glaube, dass wir regelrecht Angst davor haben, dass die haptische Erfahrung verschwindet. Diese ist nicht nur wichtig für den kreativen Konsumenten, sondern für jedermann.
Wie kann man Haptik in einen Laden integrieren?
Nun, Sie können Kleidung in einem Store anfassen, sie können sie anprobieren, das ist genug. Aber der Laden selbst muss sich ändern. Die meisten Shopkonzepte stammen aus dem 20. Jahrhundert, Kaufhäuser sogar aus dem 19. Jahrhundert. Die Idee der Prêt-à-porter ist ein Kind der 1960er-Jahre, das gilt auch für Modeboutiquen. Läden wie Armani oder Ralph Lauren wurden in den 1980er-Jahren entwickelt. Nichts, noch nicht einmal Onlineshopping ist aus unserer Zeit, aus dem 21. Jahrhundert.
Sehen Sie auf Ihren Reisen denn wirklich nichts, was Sie inspiriert?
Nein, ich glaube, die Krise hat nicht zur Kreativität beigetragen, die Leute haben in dieser Zeit nur überlebt. Und im Überlebensmodus ist es schwierig, bahnbrechende Ideen mit neuer Energie zu entwickeln.
Gelegentlich kann eine Krise mehr Freiheit verleihen ...
Aber nicht, wenn schlichtweg das Geld fehlt – und die Ladenmieten sind sehr teuer. Viele

Als Trendforscherin entwickelt Lidewij Edelkoort Ideen, die später auch in Ausstellungen zum Tragen kommen: Hier wird beispielsweise das Thema Schürze inszeniert.
Leute gehen nicht mehr aus, weder für Mode noch für Kultur. Sie müssen darum kämpfen, die Leute wieder herauszulocken – eine große Herausforderung!
Manche Händler haben die Idee, dass Kunden in einem Laden unterhalten werden sollten.
Ich glaube, das ist ein Fehler. Die Ware selbst sollte unterhaltsam sein. Mode war allerdings in den vergangenen 20 Jahren mit all diesen Retro-Trends recht langweilig. Auch deswegen, weil viele Luxusmarken gar nicht mehr an Mode, sondern nur noch an Accessoires interessiert sind. Mode dient ihnen lediglich als Kulisse für ihre Accessoires. Und viele Leute halten Bekleidung dann für Mode und kopieren diese als Mode. Prêt-à-porter kopiert Prêt-à-porter, so wird es zur schrecklichen Prêt-à-porter.
Ist Mode wirklich so langweilig?
Nicht alles! Zur M°BA, der Modebiennale, die ich im letzten Sommer in Arnheim kuratiert hatte, konnten Sie eine junge Generation von großartigen Designern sehen. Sie kommen aus aller Welt und man kann gut erkennen, wie stark deren Arbeit ist, wie energiereich und wie experimentell. Es gibt also noch ein bisschen Hoffnung für eine neue Periode mit experimentierfreudigerer Mode.
Ist das nicht auch ein Resultat der Krise?
Diese Generation ist in der Krise geboren – sie kommt aus Indien, Hongkong, Korea, Nord- und Osteuropa. Für mich war das eher ein Status quo, nicht unbedingt ein Ergebnis der Krise. Die Avantgarde zeigt starke experimentelle Ideen, die andere inspirieren wird. Für den Markt ist das wirklich besser.
Sind große Unternehmen zu sehr vom Marketing beein
flusst, um noch echte Innovationen zu bringen?
Für mich ist die starke Position des Marketings eine Ursache für den mangelnden Fortschritt. Die Malaise im Einzelhandel rührt doch daher, dass wir bereits alle Teile besitzen, die dort angeboten werden. Wir haben sie schon in 15-facher Ausführung. Warum sollten Sie immer wieder das Gleiche kaufen? Der Neuheitswert ist viel zu subtil.
Was könnte man dagegen tun?
Meine neue Winter-Trendsaison hat den Titel „BOLD“. Es geht darin um freche, kühne und gewagte Ideen, die unser Bewusstsein erweitern. Und meine Zuhörer sind glücklich. Niemand möchte weiter stagnieren, alle wollen in die Zukunft schauen und positive Erfahrungen machen und kreativer sein. Wir müssen innovativer sein, stärker mit Emotionen und

„Fetishism in Fashion“ ist der Titel einer Ausstellung, die Edelkoort kuratiert hat.
Erfahrungen spielen. Daher mag ich auch keine vorgefertigten Erfahrungen in den Shops: Die Bekleidung selbst sollte zum Erlebnis werden, die Farben und Produkte. Und möglicherweise noch Filme oder Videos, die das Ganze unterstützen.
Haben wir nicht schon genug Multimedia in den Läden?
Nein, ich kann mir vorstellen, dass es Läden gibt, die nur noch daraus bestehen, wie ein beweglicher Bildershop. Außerdem sind Filme ein wichtiger Teil von Mode, ein neuer Weg, um zu kommunizieren. Es gibt ebenso die Tendenz, mit Mode zu experimentieren, sie zu kuratieren, auszustellen, und dabei bewegt sie sich nahe an der Kunst.
Wenn man heute über Trends spricht, kommt man an Nach haltigkeit nicht vorbei. Nische oder Trend für den Massen markt?
Nachhaltigkeit ist wichtig, aber eher als Prozess denn als Trend. Die großen Marken investieren sehr stark in Nachhaltigkeit, aber es ist sehr schwierig und man braucht Zeit dafür.
Doch auch hier haben Sie zwei Seiten: Einerseits mehr Bewusstsein, anderseits eine Menge Unternehmen, die Weg werfen forcieren.
Diese Wegwerfmentalität ist abstoßend. Sie zerstört Menschen und die Wirtschaft. Viele Leute kümmert es nicht, dass Menschen zu Tode kommen, damit sie billige Kleidung tragen können. Daher ist die Öffentlichkeit dafür verantwortlich. Falls Sie je in Ihrem Leben Brot gebacken haben, wissen Sie, wie viel Arbeit es macht. Sie können kein T-Shirt verkaufen, das billiger als ein Laib Brot ist. Um ein T-Shirt zu produzieren, benötigen Sie eine Menge Know-how und es bedarf vieler Schritte: Anbauen und Ernten der Baumwolle, Spinnen des Garns, Schneiden, Verschönern, Bedrucken, Verpacken, Versenden, Sortieren, Ausgaben für Supermodels und Topfotografen. Und am Ende verkaufen Sie das T-Shirt für wenige Euro? Jeder muss wissen, dass dies unmöglich ist. Die europäische Regierung sollte sich um einen Mindestpreis kümmern, damit wir diese Vorgänge stoppen können.
Viele Unternehmen mit dieser Tiefpreispolitik zielen auf sehr junge Kunden. Diese kennen die Zusammenhänge doch noch gar nicht.
Aber ihre Eltern schon – den Läden sollte per Gesetz verboten werden, mit diesen unrealistischen Preisen zu handeln. Es ist inhuman und ein Ärgernis. Grundlage ist der Gedanke, dass Mode ein Wegwerfprodukt sei. Das ist aber nicht die Idee von Bekleidung. Die Wertigkeit eines schönen Kleides besteht darin, dass Sie es oft tragen können, vielleicht sogar an Ihre Tochter oder Enkelin weitergeben. Sie können es als Vintage-Artikel einer künftigen Generation verkaufen. Aber diese unglaublich billige Bekleidung hält meistens keine Woche. Wir können sie noch nicht mal recyceln, die Qualität ist desaströs. Für mich ist das einer der schlimmsten Seiten unserer Branche. Und wir sollten alle dafür sensibilisiert werden.
Glauben Sie, dass der Gedanke des weniger, aber besser Konsumierens ein Thema für den breiten Markt wird?
Es wird Zeit brauchen und noch mehr Aufklärung darüber. Mehr Dokumentationen und mehr Medienaufmerksamkeit. Unglücklicherweise war die Tragödie in Bangladesch notwendig, um dies auf die politische Agenda zu setzen. Und es wird eine weitere Katastrophe brauchen, um ganz oben auf die Prioritätenliste zu kommen. Möglicherweise sollten wir junge Leute vor Ort in die Produktion schicken, damit sie daraus lernen können.
Stichwort Produktion: Denken Sie, dass wieder mehr nach Europa zurückkehrt?
Das passiert gerade. Sie haben ein riesiges Interesse daran, gerade in jüngeren Industrien. Es gibt ziemlich gute, leistungsfähige und proaktive Maschinen, die auf kleinere Marken zielen. Man kann damit zum Beispiel besondere Farben herstellen, um schnell auf Marktbedürfnisse zu reagieren. Und sie
erlauben es, kleinere Stückzahlen zu produzieren.
Könnte man das Prinzip auch auf den Massenmarkt übertra gen?
Ich denke, dass flexible Maschinen erfunden werden, die einen Teil der Produktion nach Europa verlagern werden. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese nicht die Arbeitsplätze zurückbringen. Roboter und Maschinenarbeit werden menschliche Arbeit ersetzen – und so steckt eher die Idee dahinter, die Unternehmen schlanker zu machen. Es ist nicht zwangsläufig besser für die Gesellschaft. Wir müssen uns Gedanken über eine neue Gesellschaftsordnung machen und darüber nachdenken, wie wir Geld und Arbeit verteilen. Sollen mehr Leute für weniger Stunden arbeiten? Soll man finanzielle Unterstützung vom Zeitpunkt der Geburt erhalten?
Sie arbeiten in unterschiedlichen Bereichen wie Industriedesign, Interior Design, Mode und Architektur. Wo sehen Sie die interessantesten Projekte?
Industriedesign ist in meinen Augen sehr innovativ. Designer arbeiten hier eng mit den Herstellern zusammen und müssen nicht notwendigerweise alle Designschritte selbst übernehmen. Sie haben einerseits eigene Produktionsmöglichkeiten, andererseits können sie auch in anderen Ländern mit Partnern arbeiten – der Designer bringt dann alles zusammen. Im Resultat kooperieren Management und Produktion eng als Team. Im Gegensatz zum Industriedesign forciert die klassische Modeausbildung Individualisten und fördert egozentrisches Denken, was wirklich altmodisch ist. Im 21. Jahrhundert geht es um Kooperation: Menschen und Leute zusammenbringen, um Teamwork und Maschinen kooperativ zu nutzen und zu teilen.
Die neue Generation ist daran schon gewöhnt?
Ja, sie wurden da sozusagen hineingeboren. Und es ist die einzige Möglichkeit, mit den enormen Herausforderungen umzugehen, die auf uns warten. Kooperation ist ein Weg, gemeinsam zu recherchieren und dann eigene Projekte zu realisieren. Man kann Maschinen, Produktionen oder Plattformen teilen oder

Innovation in der Mode funktioniert oft nur über Provokation.
„Viele Leute kümmert es nicht, dass Men- schen zu Tode kommen, damit sie billige Klei- dung tragen können.“
ein Kollektiv von kleinen Shops gründen. Es gibt eine dänische Gruppe junger Designer, die ein Internetkollektiv gestartet haben, das zum Beispiel in Japan sehr populär geworden ist.
Welche wichtigen Trends sehen Sie für die kommenden Jahre?
Generell wird es ein Revival von Casual Fashion geben, das uns weg von formeller Kleidung führt, insbesondere vom Kleid. Ich denke nicht, dass es verschwinden wird, aber es wird weniger Einfluss haben. Das signalisiert uns bessere ökonomische Zeiten, denn das Kleid ist immer mit schlechten Wirtschaftsdaten verbunden. Diese neue Form von Active- und Casualwear wird einen starken Performance-Charakter mit besonderen Details haben. Fast wie Überlebenskleidung oder Ausrüstung für Wandern, Biking und Camping. Für mich ist Fashion, die sich von Outdoor-Bekleidung ableitet, wirklich neu. Dann wird es Marken geben, die sich auf ein Produkt spezialisieren, beispielsweise Schals oder Shirts, komplett aus einem Guss. Zusätzlich wird sich die Mode wieder für androgyne Themen interessieren – Männer werden femininer, eine neue Domäne in der Menswear.
Hat sich Ihre Arbeit als Trendforscherin in den vergangenen Jahren verändert?
Enorm. Es hat sehr einfach angefangen: Drei Haupttrends mit 15 Hauptfarben und Moodboards. So war es gut zu organisieren. Heute mache ich Dachkonzeptbücher, aus denen ich ein Keyword und eine Idee herausnehme und in 15 oder mehr Trends ausarbeite. Diese Entscheidung hat mein Leben sehr verändert: Ich gebe dadurch mehr vor und gehe höhere Risiken ein. Ganz aktuell habe ich einen Trend für den Sommer festgelegt, der nur aus Grau bestand. 14 Grautöne – alle Geschichten drehten sich rund um das Grau, inklusive Regen und Fluten. Trendprognosen sind heutzutage anthropologischer, soziologischer und philosophischer als früher. Die Arbeit wird politischer und engagierter.
Inwiefern?
Nun, Sie kämpfen gegen Verschwendung, versuchen Ihre Kunden zu besseren und effizienteren Produkten zu motivieren. Sie versuchen, sie zu der richtigen Materialwahl zu bringen und sich für mehr Verantwortlichkeit einzusetzen.
Wie viel reisen Sie?
Ziemlich viel. Ich würde sagen fast die Hälfte des Jahres, weil all meine Kunden über den Erdball verstreut sind. Reisen ist immer noch schön, allerdings manchmal etwas zu viel. Ich habe gelernt, als Nomadin zu leben, als Supernomadin. Ich habe ebenso gelernt, überall arbeiten zu können. Und ich habe gelernt, mich überall dort Zuhause zu fühlen, wo ich gerade bin.
Was bedeutet für Sie Heimat?
Heutzutage bin ich mir selbst eine Heimat. Dazu habe ich eine Reihe von Fähigkeiten entwickelt: Auf einem langen Flug wird die Kabine zu meinem Büro. Prinzipiell brauche ich keinen festen Platz mehr. Das ist wirklich neu für mich.

Neues Leben
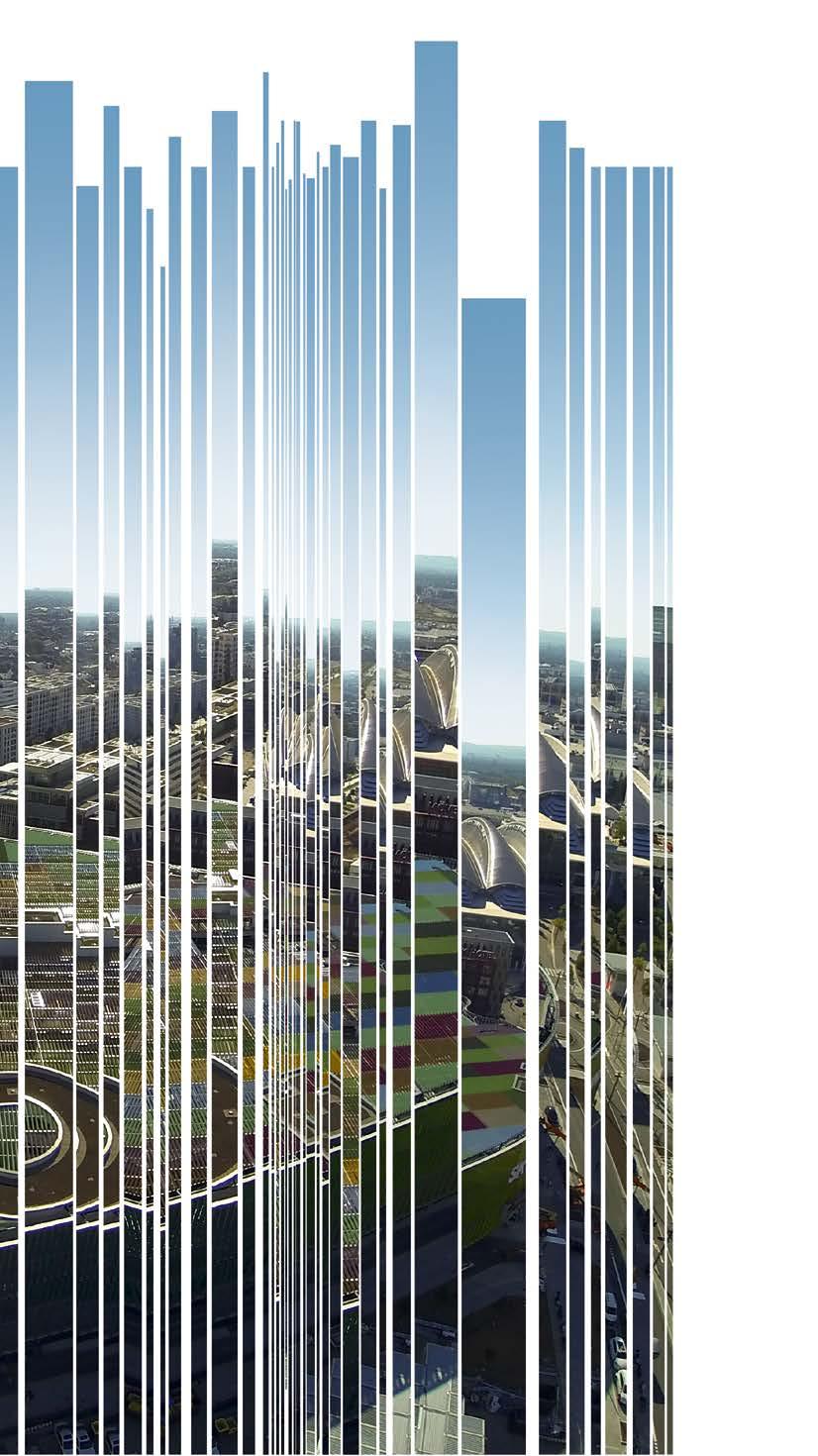
Kehrtwende. Nach der in den letzten Jahren viel besprochenen, drohenden Verödung der deutschen Innenstädte zeichnet sich inzwischen ein völlig neues Bild ab. Dass vertikale Konzepte und MonolabelStores neben individuellen Konzepten bestehen können, ist gelernt. Neu ist allerdings die Herausforderung, steigenden Mietpreisen und der zunehmenden Kommerzialisierung in den 1-A-Lagen Stand zu halten um im Einzelhandel einen attraktiven Branchenmix zu erhalten. In diesem Punkt verlassen sich Unternehmen nicht mehr auf die Stadtführung, sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und kreieren stimmige Lifestylewelten als Mikrokosmos, in denen sich zueinander gesellt, wer gut zusammen passt.
Aus der Vogelperspektive er- schließt sich das städtebauli- che Potenzial eines Quartiers besonders gut: In Frankfurt am Main jagt ein Luxusein- kaufsprojekt das nächste. © ECE, Skyline Plaza Frankfurt
Neue Einkaufsmeilen verändern den Charakter der Innenstädte nachhaltig. Sehr gut kann man das in Düsseldorfs neuem Herzstück Kö-Bogen erfahren. Das im Oktober 2013 eröffnete Prestigeprojekt verleiht der Stadt einen Touch von Luxus.
Text: Ina Köhler. Fotos: Breuninger, die developer
Düsseldorf Wahrzeichen aus Glas & Travertin
Der verkaufsoffene Sonntag im Oktober 2013 erinnerte in Düsseldorf ein wenig an den Schlussverkauf aus Wirtschaftswunderzeiten: Vor der neuen Breuninger-Filiale im gerade eröffneten Kö-Bogen versammelten sich Tausende von Schaulustigen und warteten geduldig, bis sie das 15.000 Quadratmeter große Kaufhaus stürmen konnten. Zwei Stunden später war es noch voller, nur schubweise kam die Menge voran. „Der Engpass sind die Rolltreppen“, meinte Christian Witt, Director Corporate Communications, der sich über den Ansturm bei seinem Arbeitgeber sichtlich freute. „Sind die alle beim Kö-Bogen?“, fragte eine Verkäuferin, die sich über die spärlich eintröpfelnden Kunden am südlichen Ende der Königsallee an einem normalerweise gut besuchten Sonntag wunderte. Ja, alle wollten das neue Prestigeprojekt von Stararchitekt Daniel Libeskind sehen, obwohl nur ein Teil eröffnet wurde. Wenige Wochen zuvor hatte ein spektakulärer Brand die andere Hälfte der Baustelle lahmgelegt und die Läden von Joop oder Windsor zerstört und weitere Eröffnungen von Läden wie Graf von FaberCastell, Laurèl, Apple, Strenesse, Porsche-Design und Hallhuber verhindert. So viel Interesse und Neugierde für ein gerade mal halbfertiges Gebäude ist nicht alltäglich. Doch immerhin ist die Immobilie mit ihrem Investitionsvolumen von rund 400 Millionen Euro und einer Bauzeit von rund vier Jahren auch kein normales Bauwerk. Düsseldorfs Oberbürgermeister Dirk Elbers spricht von einem Jahrhundertprojekt. Fakt ist: Städtebaulich verschiebt es den Schwerpunkt der Luxuslage Königsallee nach Norden zum Hofgarten. Eng verbunden mit dem Kö-Bogen ist ein weiteres Großprojekt, die neue Wehrhahn-U-Bahnlinie und die Verlegung einer innerstädtischen Straßentrasse unter die Erde. Lange war sehr kontrovers diskutiert worden, ob der sogenannte Tausendfüßler, eine denkmalgeschützte Hochstraße auf Stelzen, die diesen Bereich zerteilte, abgerissen werden sollte oder nicht. Im April 2013 rückten die Bagger an – der Verkehr rund um den neuen Kö-Bogen wurde unter die Erde gelegt, der Tausendfüßler war Geschichte. Tatsache ist, dass die architektonischen Eckpfeiler der Innenstadt aus den verschiedenen Jahrzehnten wie Dreischeibenhaus, Schauspielhaus und Richard Meier Weltstadthaus von P&C nun viel besser zur Geltung kommen – und den neuen Kö-Bogen einrahmen. Mit seinem Bau aus Glas, Stahl und Travertin hat der amerikanische Architekt Daniel Libeskind eine zusätzliche Landmark geschaffen. Für ihn ist Düsseldorf „eine der elegantesten Städte, in denen ich jemals war“, sagt er. Sein städtebauliches Wahrzeichen ist dann auch kein Museum wie in Berlin, sondern ein Luxuseinkaufstempel – irgendwie ist das auch typisch für die Stadt am Rhein.

Klotzen nicht Kleckern
„Düsseldorf ist für uns eine Stadt, die sich positiv entwickelt hat; für uns ein äußerst attraktiver Standort“, bestätigt Willy Oergel, Vorsitzender der Unternehmensleitung von Breuninger, dem größten Mieter im KöBogen. Mit ihrem DepartmentStore haben die Schwaben im Rheinland geklotzt. „Wir wollten ein neues Konzept nach Düsseldorf tragen. In meinen Augen gibt es der Stadt einen weiteren Entwicklungsschub. Allerdings sehen wir uns nicht als Luxuskaufhaus, wir orientieren uns an der Qualitätsmitte.“ Das Breuninger-Sortiment ist dann aber in vielen Teilen deutlich im hochwertigen Segment mit Shops von Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Longchamps, Michael Kors oder Boss positioniert. Darüber ist die Luft dünn. Dazwischen sind
1 2


3
1 | Oberbürgermeister Dirk Elbers, Architekt Daniel Libeskind und Willy Oergel, Vorsitzender der Unternehmensleitung Breuninger auf dem roten Teppich zur Eröffnung. 2 | Ein bewährter Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und Büros kenn- zeichnet die Mieterstruktur im neuen Kö-Bogen. 3 | Luxuslabels, aber kein Luxuskaufhaus im Kö-Bogen: Breuninger setzt auf Designer neben der Qualitätsmitte.

Brands aus der Marktmitte wie Liebeskind, Zadig & Voltaire, Brax, Boss Woman, Strenesse, Marc Cain oder Marc O’Polo gestellt. Im Erdgeschoss lockt ein großes Beauty-Sortiment mit Marken wie Aveda, Chanel, Tom Ford, La Mer oder La Prairie. Das Untergeschoss ist hochwertigen Schuhen mit Modellen von Dolce & Gabbana über Gucci bis hin zu Jimmy Choo vorbehalten. Ein anscheinend schlüssiges Rezept in einer an Luxusprodukten nicht gerade armen Stadt. Als Serviceleistung stellt Breuninger ein eigenes Maßatelier für Damen und Herren zur Verfügung, außerdem gibt es die Möglichkeit zum Personal Shopping. „Breuninger sucht immer nach neuen Inspirationen, die unsere Häuser spannend machen und die uns regional verankern. Wir haben großes Interesse daran, Bestandteil der Stadtkultur und des Stadtlebens zu werden“, meint Oergel. Kooperationen mit lokalen Institutionen wie Fortuna Düsseldorf oder der Kunstsammlung NRW unterstreichen diesen Anspruch. Die Anwohner, jahrelang leidgeprüft durch Baustellenlärm, Dreck und wechselnde Verkehrsführungen, können aufatmen. Marc O’Polo, der den Vermieter Breidenbacher Hof an der Kö auf Schadenersatz wegen der Baustelle verklagt hatte, der durch die Baustelle bedingte Wassereinbruch bei P&C wirken da nur wie kleine Störfeuer. Denn allmählich wird sichtbar, dass der Kö-Bogen nicht nur neues städtebauliches Wahrzeichen der Stadt wird, sondern überregionaler Anziehungspunkt – möglicherweise mit ähnlicher Strahlkraft wie der Hafen – und viele neue Besucher aus dem Umland neugierig macht, von denen auch die Wettbewerber profitieren werden. Diese haben sich schon gut gerüstet: Der Kaufhof an der Kö hat vier Millionen Euro in den Umbau seines 21.000 Quadratmeter großen Flaggschiffs investiert – in Sichtweite des neuen Wahrzeichens. Dafür wird die Filiale an der Berliner Allee 2014 mangels Frequenz schließen. P&C hatte seinen Store auf der Schadowstraße schon Anfang 2013 erweitert. Läden wie Hermès, Ludwig Reiter und Max Mara – vor der Eröffnung durch Baustellenfahrzeuge und Bauzäune an den Rand gedrängt, profitieren immens von der aufgewerteten Lage der nördlichen Kö. Auch die seitlich einmündende Schadowstraße wird, wenn die letzten Bagger abgezogen sind, wieder zur wichtigen innerstädtischen Einkaufsachse werden. Mango und Primark haben sich schon angesiedelt, andere Filialisten werden sicherlich bald nachziehen.

1 2


3
Der Frankfurter Handel boomt. Neue Shops, neue Quartiere, neue Herausforderungen. Eine internationale Stadt im Spannungsverhältnis zwischen Kommerz und Individualismus.
Text: Rebecca Espenschied. Fotos: Cadman Real Estate Marketing, Christoph Lison
Frankfurt Zwischenwelten
Im Frankfurter Einzelhandel sind Dynamik und Veränderungen sichtbar – in den Stadtteilen genauso wie in der Innenstadt. 2,5 Millionen Menschen leben in Frankfurts Einzugsgebiet. Dazu kommen internationale Besucher, insbesondere durch Messen und Tourismus: Frankfurt verzeichnete im Jahr 2012 4,3 Millionen Übernachtungen, darunter 1,9 Millionen ausländische Gäste. Die Mainmetropole zählt damit zu den internationalsten Städten in Deutschland. Marken und Konzerne erkennen die Attraktivität des Standorts. 2012 ging Inditex mit Bershka an den Start, in diesem Jahr folgte die Eröffnung von Pull & Bear im neuen Skyline Plaza. Dort eröffneten auch die deutschlandweit ersten Stores von Mango Kids und Laura Kent. Und auf der Zeil, Frankfurts frequenz- und umsatzstärkster Einkaufsmeile, starteten zuletzt amerikanische Lifestylebrands wie Hollister oder New Era ihre Deutschlandexpansion. Auch im Luxusquartier Goethestraße finden zurzeit zahlreiche Umbaumaßnahmen und Umzüge von Exklusivmarken statt. In unmittelbarer Nähe entsteht zudem gerade das One Goethe
4

1 | Die Frankfurter Zeil zählt seit ihrem Umbau in den letzten Jahren zu Deutschlands beliebtesten Einkaufsmeilen. 2 | Ardi Goldman und sein Geschäftspartner Hakan Temür im gemeinsamen Store The Listener. 3 | Das One Goetheplaza beherbergt in Zukunft große Luxuslabels wie Louis Vuitton und Escada. 4 | Das neue Trendquartier MA* verspricht mit seinen unterschiedlichen Concept-Stores ein ganz besonderes Einkaufserlebnis.
plaza. Ankermieter Louis Vuitton wird dort eine Luxushandelsfläche von 1.500 Quadratmetern bespielen, weitere Mieter sind Escada, Omega und Nespresso.
Urbane Stadtteilzentren und neue Nutzungskonzepte
Warum wird Frankfurt als Einzelhandelsstandort immer interessanter? Und was macht den besonderen Reiz der Mainmetropole aus? „In beinahe jedem laufenden Projekt der Stadt zeigt sich ein Trend zum urbanen Nutzungsmix“, sagt Melanie Göbel, Projektleiterin des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts Frankfurt. „Der Einzelhandel bildet einen Magneten und formt in Kombination mit Dienstleistungen, Gastronomie, Sport- und Vergnügungsstätten die soziale Struktur einer Stadt.“ Ähnlich sieht es auch Silvio Zeizinger, Geschäftsführer des Handelsverbands Hessen-Süd: „Die Stadtentwicklung braucht ganzheitliche und nachhaltige Ideen. Der Erlebniseinkauf wird immer bedeutender – auch im Hinblick auf den urbanen Nutzungsmix – und kann dadurch zum Lebensmittelpunkt werden. Urbane Zentren bieten genau das.“ Eines dieser urbanen Zentren ist das Frankfurter Ostend, das als wichtigstes zentrumsnahes Entwicklungsgebiet gilt. Aus dem ehemaligen Gewerbe- und Hafengebiet ist ein neues Szenequartier entstanden. In den vergangenen Jahren siedelten sich Büros, Clubs, Bars und Restaurants an und machten die ehemals trostlose Hanauer Landstraße zu einem Kreativviertel mit rund 1.450 Unternehmen. Stilprägend für diese Transformation ist der Frankfurter Immobilienentwickler Ardi Goldman. Er bemerkte den Mangel an Urbanität an der städtischen Peripherie als Erster, erkannte das Potenzial und verwirklichte Konzepte wie das Uniongelände und das Goldman 25hours Hotel.
„Eine Stadt lebenswert machen!“
Seine neueste Vision hat der Frankfurter Investor auf dem Gebiet der ehemaligen Diamantenbörse in die Realität umgesetzt. Das im August eröffnete, neue Trendquartier MA* bietet auf zwölf Etagen Platz für Loftbüros, Wellness und acht individuelle Einzelhandelskonzepte. Goldmans Vision dabei ist, eine Stadt lebenswert zu machen. „Ein ganz wesentlicher Beitrag dazu ist eine funktionierende und urbane Innenstadt. Deshalb liegt es mir am Herzen, den individuellen Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken. Diese ist angewiesen auf die lebendige Vernetzung von Kunst, Kultur, Entertainment, Gastronomie und Einzelhandel“, erklärt Goldman. Als Lösung sieht er hierfür die Belebung von B-Lagen durch
1
2
1 | Hayashi: Schon das Schaufenster macht Lust auf mehr: Hayashi zeigt, wie individuelle Looks entstehen. 2 | Kerstin Görling: „Ich möchte vor allem eines: Meine Kunden mit Mode überraschen.“


Auf dem Dach des Skyline Plaza locken Freizeitattraktivitäten als zusätzliches Highlight zum Einkauf. ©ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG
qualifizierte und architektonisch anspruchsvolle Raumkonzepte. Entscheidend seien einzigartige Modelle, die emotionale Einkaufserlebnisse versprechen und sich damit von der Masse, aber auch dem Onlinehandel abheben. Goldman realisierte im MA* gemeinsam mit dem Inhaber der Offenbacher Modeagentur Brainpool, Hakan Temür, den Concept-Store The Listener. Dort zeigen die beiden Labels wie Stone Island, Nanamica, Denham, Howlin oder Harris Wharf London. In direkter Nachbarschaft finden sich innerhalb desselben Komplexes die Einrichtungshäuser BoConcept und Design House Stockholm sowie die Modegeschäfte Tutto und Crestline Men. „Welten entdecken“, so lautet der Slogan des zweiten dort eingezogenen Concept-Stores Lieblings, der mit einem breiten Angebot von High Fashion über Blumen bis hin zu Kosmetik und Literatur zum Erkunden einlädt.
„Mit individuellen, progressiven Looks überraschen“
Den Gegentrend zu MonolabelStores und Mainstream setzen auch Concept-Stores wie Uebervart, Frida, B74 und Hayashi. Mit ihren individuellen Sortiments sind sie schon seit vielen Jahren in Frankfurt erfolgreich. Eine persönliche Atmosphäre und die Entdeckung des Besonderen stehen hier im Mittelpunkt des Einkaufserlebnisses. Durch eine sorgsame und pointierte Sortimentszusammenstellung mit internationalen Trendlabels wie Acne, Kenzo, Comme des Garçons, Isabel Marant und Our Legacy gelingt es den Concept-Stores, sich gegen die Monolabel-Stores auf der Zeil, der Goethestraße und in den Shoppingcentern zu verteidigen. „Zwischen den Luxusläden und Filialisten gab es bisher nicht viel in Frankfurt. Meine Kunden wünschen sich persönliche Beratung und individuelle, progressive Looks, die überraschen“, betont Kerstin Görling von Hayashi.
Zwischen Welten
„Welten entdecken“ – das Motto des Concept-Stores Lieblings im neuen Szenequartier MA* könnte auch das Motto des neuen Frankfurts sein. Die Stadt integriert neue Quartiere, macht einen urbanen Nutzungsmix erlebbar, bespielt den Kommerz, lässt aber zugleich Luft für individuelle Konzepte. Es entsteht eine Sogwirkung, die einen gewissen Boom erzeugt. Inwieweit dieser Boom auch den Einzelhandelsumsatz befeuert, bleibt abzuwarten. Die Stadt schwebt zwischen den Welten des dynamischen Wachstums und des zerstörerischen Überangebots. Zwischen Welten? Zwischenwelten.
Urbanit ät und
Komme rzialit ät in Frankfu rts
Shoppin gcente rn
Gerade erst eröffnete das fünfte Einkaufszentrum, das Skyline
Plaza. In zentraler
Lage zwischen Messe, Hauptbahnhof und Bankenviertel gelegen, ist hier in den vergangenen Jahren ein neues Stadtquartier entstanden: das Europaviertel. Das Herz des Viertels soll das Skyline Plaza bilden. Auf einer Verkaufsfläche von 38.000 Quadratmeter verteilen sich seit September rund 170 Läden. Ankermieter sind Modefilialisten wie H&M, Zara und P&C sowie der Elektroanbieter Saturn. Auch hier wird versucht, neue Einkaufserlebnisse zu schaffen. Abgesehen von innovativen Store-Designs wartet die nach amerikanischem Vorbild entstandene Mall mit Frankfurts größtem Foodcourt sowie dem sogenannten Skyline Garden auf. Dieser 7.300 Quadratmeter große Dachgarten wirbt mit einem generationsübergreifenden Freizeitangebot, von Wellness über Kicker und Schach bis hin zu Spielplätzen.
Um seine Kunden zu halten, hält der innerstädtische Einzelhandel mit eigenen, individuellen Konzepten dagegen. Neue Erlebnisse verspricht die modernisierte Zeilgalerie, die es seit 2009, seit der Eröffnung des benachbarten Shoppingcenters MyZeil, besonders schwer hatte. Seit ein Revitalisierungskonzept in der Zeilgalerie umgesetzt wurde, lockt sie mit einer neugestalteten Dachterrasse, einem Premiumfilmtheater sowie einer IndoorMinigolfbahn.
Die sechste Frankfurter Mall könnte schon bald folgen. Rund um die Europäische Zentralbank im Ostend ist ein harmonisches Miteinander von Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten vorgesehen, das durch neuen Wohnraum, ein großes Nahversorgungsangebot und zahlreiche Freizeitoptionen geschaffen werden soll. Realisiert wurde bereits der in diesem Sommer eingeweihte, 40.000 Quadratmeter große Hafenpark. In Planung sind das Schwedler Carrée mit Büro- und Einzelhandelsnutzung sowie das Mainsquare, eine 82.000 Quadratmeter große Shoppingmall mit Kino, Gastronomie und Büros.
München/Brienner Quartier Das neue Viertel der Alteingesessenen
Münchens damaliger zweiter Bürgermeister Joseph von Utzschneider legte 1812 im nördlichsten Eck der Münchner Innenstadt den Grundstein für ein Konzept, das ihn heute zum städtebaulichen Visionär befördert hätte: Er konzipierte einen individuellen, hochwertigen Branchenmix in einem gemeinsamen, stimmigen Lifestylekonzept.
Text: Isabel Faiss. Fotos: Nicole Wawrzinek

Rund um das historische Café Luitpold am Rande der Münchner Innenstadt hat sich im Brienner Quartier ein Stadtviertelkonzept etabliert, das sein hochwertiges Angebot und den spannenden Branchenmix nicht dem Zufall, sondern engagierten Vorstandsmitgliedern wie unter anderem Tina Schmitz überlässt.
Wie ein Fels in der Brandung steht der Luitpoldblock inmitten der Prunkbauten des Brienner Quartiers, das sich vom Odeonsplatz über den Maximiliansplatz und zurück bis über das Literaturhaus erstreckt. Historische Fassaden, Messingbeschläge an den Türen, auf den Namensschildern hauptsächlich Notare, Arztpraxen und Anwaltskanzleien. Das Brienner Quartier zeigt auf stille, unaufdringliche Art das Selbstverständnis des alteingesessenen Münchner Luxus, der sich hier in einer interessanten Mischung aus Moderne und Tradition präsentiert. Besonders ist allerdings nicht das elegante Erscheinungsbild, sondern vielmehr die Signalwirkung für die ganze Stadt. Denn während in den 1-A-Lagen Vermieter horrende Preise aufrufen, dadurch internationale Ketten als Mieter begünstigen und ihre direkten Nachbarn dieser Konsequenz einfach überlassen, haben sich die Inhaber der Gebäude im Brienner Quartier schon vor Jahren an einen Tisch gesetzt. Heraus kam ein Stadtviertelkonzept, das einen spannenden Branchenmix mit hochwertigen Marken aus dem Mode-, Kunst-, Lifestyle- und Gastronomiebereich vorsieht, um dadurch die Frequenz an attraktiven Kunden zu erhöhen und gemeinsam das Areal als gehobenes Einkaufsviertel und als Marke zu etablieren. „Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Mit professioneller Unterstützung möchten wir ein Konzept entwickeln, wie wir uns nach außen als Marke darstellen können, sodass wir auch ein internationales Publikum erreichen. Wir haben viel Tourismus hier in der Straße, aber nur die wenigsten wissen, dass sie sich im Brienner Quartier befinden“, erklärt die Marketingbeauftragte Barbara Weber, welche wichtige Rolle das Image des Viertels vor allem für die attraktivste seiner Zielgruppen spielt: die Münchner. Marika und Paul Buchner, die Eltern der heutigen Gesellschafterin des Luitpoldblocks, Tina Schmitz, begannen schon vor Jahren, sich aktiv für die Modernisierung des Viertels einzusetzen. 2007 gründeten zehn bis zwölf Immobilieneigentümer und einige Mieter den Verein Brienner Quartier. Nur zwei Liegenschaften, die als einzige nicht mehr inhabergeführt sind, nehmen bis heute nicht an dem Projekt teil. Treibende Kraft im Vorstand des Vereins sind vor allem Tina Schmitz und Manfred Böll, die durch den ständigen Dialog mit den Mietern viele Themen anstoßen und Projekte anschieben. Die erste Maßnahme ihres Vereins war eine eigene Weihnachtsbeleuchtung, inzwischen gibt es auch Osteraktionen, einen Adventskalender und ein Literaturfestival. Der Verein zählt über 100 Mitglieder, die
Herz und Seele des Brienner Quartiers ist die Brienner Straße, die mit Traditionsunternehmen wie Ed Meier auf der einen Seite und modernen MarkenStores wie Closed auf der anderen gesäumt ist.

einen jährlichen Beitrag zahlen, der sich bei den Mietern nach Größe und Mitarbeiteranzahl richtet und bei den Liegenschaften nach Quadratmetern berechnet wird. Zu den Mietern gehören einerseits Traditionsunternehmen wie die Porzellanmanufaktur Nymphenburg, die Galerie Bernheimer oder die Schuhmanufaktur Ed Meier, andererseits aber auch Marken wie Closed, Woolrich, Missoni oder der Skischuh- und Sportspezialist Ertl/Renz. „Für die Auswahl unserer Mieter haben wir zum einen ganz pragmatische Kriterien, wie beispielsweise, dass wir keine Ketten möchten, sondern gezielt nach inhabergeführten Unternehmen suchen, die ein ähnliches Wertesystem wie wir selbst haben. Und dazu gehört neben einem Sinn für Nachhaltigkeit vor allem auch, dass nicht immer das Finanzielle an erster Stelle steht und dass man gemeinsam das große Ganze als Ziel vor Augen hat“, erklärt Tina Schmitz, die mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld aussucht, wer dazupasst und auch mal gezielt Marken und Unternehmen anschreibt. „Vieles läuft bei uns über persönliche Empfehlung, wie beispielsweise
1


3 2

1 | Im Erdgeschoss links neben dem Café Luitpold zog 2012 der WoolrichStore in den Luitpoldblock ein. 2 | Tina Schmitz (links), Gesellschafterin des Luitpoldblocks und Vor- standsmitglied des Vereins Brienner Quartier ist es besonders wichtig, nah an ihren Mietern dran zu sein. Hier ist sie gemeinsam mit Henrik Soller und seiner Frau bei der Eröffnung des Woolrich-Stores. 3 | Rund um den malerischen Amiraplatz haben sich Unternehmen wie der Porzellanspezialist Maison Noble von Christofle oder der Einrich- tungs-Store Home by Asa niedergelassen.
mit Ertl/Renz, wo Sven Renz uns als potenzieller Mieter von einer unserer bestehenden Mieterinnen empfohlen wurde. Wir warten lieber etwas länger, bis wir den Richtigen gefunden haben, anstatt über einen Makler zu gehen. Alle unsere Mieter sind handverlesen.“
Der Klügere denkt vorher nach
Während die Münchner Luxus- meile Maximilianstraße mit der Abwanderung inhabergeführter Luxusanbieter zu kämpfen hat, verzeichnet das Brienner Quartier Zuwachs. Denn die Eigentümer wissen, dass sie durch Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Fairness die Qualität ihres Viertels aufrecht- erhalten. Dazu zählt auch, dass man seine Mieter nicht danach aussucht, wer den höchsten Preis zahlt, sondern wer zu einem passt. Florian Ranft und Henrik Soller waren solche Mieter. Mit einem Woolrich-Store zogen sie im September 2012 neben das Café Luitpold im Erdgeschoss ein. „Für Woolrich war die Bri- enner Straße eine Wunschlage. Es hat sich glücklicherweise so ergeben, dass Frau Schmitz selbst auf uns zukam, weil sie ein Fan der Marke ist. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns in diesem stimmigen Konzept sehr gut aufgehoben fühlen. Der größte Vorteil ist unserer Meinung nach die Planungssicherheit und im Allgemeinen das Vertrauen, zu wissen, dass sich das direkte Markenumfeld in seinem Grad an Hochwertigkeit in den kom- menden Jahren nicht abwerten wird, ganz im Gegenteil, es wird immer anspruchsvoller“, sagt Florian Ranft. Was der Luitpoldblock als Mik- rokosmos im Brienner Quartier vormacht, ist ein Sinnbild dafür, wohin es in Zukunft gehen könnte: Ein Stadtviertel konzipiert ein eigenes Konzept, das seinen Mietern ein attrakti- ves Umfeld, faire Geschäftsbe- dingungen und Zuverlässigkeit bietet – und einen gemeinsamen Rahmen, der ein Wertesystem vorgibt und gleichzeitig viel Raum für Individualität lässt. Keiner muss sich anpassen, jeder bleibt er selbst. Und trotzdem steht über allen eine Marke, die vereint, was ohnehin gut zusam- menpasst.










