Bergsport Winter



Wann hast du das letzte Mal auf dem Sofa gesessen und in einem Lehrbuch geblättert? Wir laden dich ein zum ersten Schritt eines verantwortungsvollen Bergsports. Geübt, angewendet und vertieft wird anschliessend draussen – in fachkundiger Begleitung. Ein, zwei Jahre später: Wer erinnert sich noch an all das, was er gelernt hat? Der Griff zum Buch: oft zielführender als ein Online-Tutorial. Bist du schon länger unterwegs und erzählst auf dem Sofa lieber deine Bergerlebnisse? Dann hast du die nötige Erfahrung. Aber sind Wissen und Techniken noch up to date? Die gute Mischung von neusten Methoden und Erfahrung bringt auch alte Hasen am Berg einen Schritt weiter – und sicherer zurück.
Theorie und Praxis – Buch und Bergsteigen – ergänzen sich. «Bergsport Winter» und «Bergsport Sommer» werden beide von Zehntausenden von Bergsteigerinnen und Bergsteigern gelesen. Als Standardwerke werden sie u. a. bei SAC-Kursen, von Bergführern, Jugend + Sport, Armee und der Alpinen Rettung Schweiz genutzt. Das freut uns sehr, lastet aber auch auf unseren Schultern. Der Erfolg weckt den Anspruch, die Lehrbücher inhaltlich und qualitativ auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Hohe Verkaufszahlen und durchwegs positive Rückmeldungen von Einsteigern bis zu Profibergführern aus dem ganzen Alpenraum –was macht «Bergsport Winter» so erfolgreich? Vermutlich der Mut zum Weglassen. Wir beschränken uns auf wenige, standardisierte Vorgehensweisen mit einem breiten Anwendungsbereich, die zudem fehlertolerant, von Anfängern leicht zu erlernen und bis hin zu schwierigsten Touren geeignet sind. Damit wird Bergsteigen einfacher und in den meisten Fällen auch sicherer als mit ständigem Improvisieren.
Lehrmeinungen entstehen im Dialog von Experten. Wir bedanken uns bei allen, die mitgewirkt haben, insbesondere:
• Den Mitgliedern des Kernteams, allen beteiligten Verbänden und den Experten, die uns schon seit der Erstausgabe immer wieder tatkräftig unterstützt haben.
• Ein ganz besonderer Dank gebührt Bruno Hasler vom SAC. Namentlich nennen möchten wir zudem: Florian Strauss, Hans Martin Henny (Armee), Monique Walter (bfu), Thom Zwahlen (Naturfreunde), Martin Künzle (SAC, Tiere im Bergwinter), Monica Zehnder (Ernährung), Stephan Harvey und Lukas Dürr (SLF, Lawinen), Xavier Fournier und Reto Schild (SBV, Nivocheck), Silvan Schüpbach (SAC, Eisfall), Urs Hefti (Erste Hilfe) sowie Manuel Genswein und Martin Gentner (Lawinenrettung).
• Dem SAC-Verlag für die gute Zusammenarbeit und die notwendigen Mittel.
Ist «Bergsport Winter» noch zeitgemäss? Inhaltlich auf jeden Fall, denn wir haben auch die 5. Auflage komplett überarbeitet, von der ersten bis zur letzten Seite. Aber wie steht es mit der Form? Lohnt sich ein Lehrbuch in Zeiten von Wikipedia und YouTube noch? Wir finden ja, solange das Buch handlich und übersichtlich bleibt. Deshalb haben wir nicht nur neustes Wissen aufgenommen, sondern auch altes entfernt.
Im Namen aller Beteiligten wünscht dir das Autorenteam schöne und unfallfreie Touren.
Im Sommer 2021 Kurt Winkler, Autor
Hans-Peter Brehm, Co-Autor
Jürg Haltmeier, Co-Autor

Die Lehrbücher «Bergsport Winter» und «Bergsport Sommer» sind einzeln lesbar und vermitteln ein möglichst sicheres und effizientes Bergsteigen. Zusammen ergeben sie eine umfassende Lehrschrift über alle Bereiche des Bergsteigens. Sie richten sich an alle, vom Einsteiger bis zum Bergführer.
Klassierungen
Hinweis auf zusätzliche Informationsquelle.
Die kleinen Tipps und Tricks, die nicht unbedingt notwendig sind, aber gerade deshalb den Profi vom Amateur unterscheiden.
Wichtige Zusatzinformation, unbedingt beachten.
Gefahr! Bei Missachtung besteht akute Lebensgefahr.
Zusatzinformation für Fortgeschrittene und Tourenleiter.
Didaktischer Hinweis.
Im Gebirge setzen wir uns unweigerlich einem gewissen Risiko aus. Dieses Lehrbuch hilft, dieses auf ein vertretbares Mass zu reduzieren. Ein Lehrbuch alleine genügt jedoch nicht, denn Bergsteigen erfordert neben Wissen und Technik auch Übung und Erfahrung. Eine fundierte Ausbildung unter fachkundiger Aufsicht ist unerlässlich. Wir haben versucht, nur Varianten zu beschreiben, die fehlertolerant, universell einsetzbar, möglichst einfach anzuwenden und sicher sind. Dabei haben wir die Variantenvielfalt bewusst reduziert, damit sich Anfänger, Gelegenheitsbergsteiger und Ausbilder auf das Notwendige beschränken können.
Nicht alle anderen Varianten sind falsch oder gefährlich – wir mussten uns oft zwischen gleichwertigen Möglichkeiten entscheiden. Es gehört zur Freiheit und Eigenverantwortung jedes Bergsteigers, auch andere Techniken anzuwenden, wenn er von deren Richtigkeit überzeugt ist.
Die Lehrmittel «Bergsport Winter» und «Bergsport Sommer» repräsentieren die gesamtschweizerische Lehrmeinung. Herausgeber ist der Schweizer Alpen-Club SAC, mit seinen über 160 000 Mitglieder n der führende Bergsportverein der Schweiz. Die Bücher werden von allen namhaften Bergsportverbänden und -institutionen unterstützt:
• Jugend und Sport (J+S)
• WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)
• Schweizer Bergführerverband (SBV)
• Schweizer Armee
• Naturfreunde Schweiz (NFS)
• Swiss Ski
• Alpine Rettung Schweiz (ARS)

Experten: Ressort Umwelt und Raumentwicklung des SAC
Glitzernde weisse Pracht, strahlendes Licht, stiebender Pulverschnee – die Faszination und Schönheit der winterlichen Berge ist vielfältig. Doch der Bergwinter hat auch harte Seiten wie Sturm, Kälte und kurze Tage. Wir Menschen sind nur einige Stunden im Freien und schützen uns mit der neuesten Ausrüstung. Anders die Alpentiere – für sie ist der Winter die härteste Zeit des Jahres. Die Durchschnittstemperatur auf 2500 m beträgt zwischen Dezember und Februar – 7 °C, Nahrung ist spärlich vorhanden, die Fortbewegung im Schnee zehrt an den Kräften, und Lawinen sind eine zusätzliche Gefahr. Dennoch findet bei vielen Alpentieren die Paarung im Winterhalbjahr statt. Nur so kommen die Jungtiere im Frühling / Frühsommer zur Welt und haben eine Chance, sich im kurzen Bergsommer zu entwickeln – und den nächsten Winter zu überleben.
Alpentiere haben verschiedene Strategien, um den Bergwinter zu überdauern: Zugvögel (wie Steinrötel oder Alpensegler) und Schmetterlinge (z. B. Admiral, Distelfalter) ziehen in südlichere Breiten, gewisse Säugetiere (z. B. Braunbär, Murmeltier oder Siebenschläfer) halten Winterschlaf in einer Höhle, und Amphibien und Reptilien verfallen in Winterstarre.
Diejenigen Alpentiere wie Gämse oder Birkhuhn, welche die kalte Jahreszeit ungeschützt im Freien verbringen, können ebenfalls nur durch geschickte Anpassung überleben. Dass nicht alle Tiere den Winter überleben ist aber natürlich und gehört zur Selektion einer gesunden Population.
Anpassungsstrategie Beispiele
Energie sparen durch Reduktion praktisch alle Tiere der Aktivitätsphasen
Absenkung der Temperatur in Hirsch, Reh den Extremitäten (auf 12 bis 15 °C) in Ruhephasen
Passives Aufwärmen des Körpers Steinbock
durch Sonnenbad
Wechsel in wärmeres Winterfell Gämse, Steinbock, Schneehase
Wechsel zu weisser Tarnfarbe Schneehuhn, Schneehase
«Schneeschuhe» wachsen lassen befiederte Füsse der Raufusshühner (z. B. Schnee-, Birk-, Auerhuhn), Schneehase
Schutz des Gebirgswaldes aufsuchen Gämse, Hirsch, Schneehase
Ruhen in gut isolierender Schneehöhle Schnee- und Birkhuhn (v. a. nordseitig, im pulvrigen Schnee)
Magen auf faserreiche Nahrung umstellen Hirsch und Gämse ( Verbiss(ausgetrocknetes Gras, Flechten, Zweige, schäden), Steinbock Rinden)
Nahrungsmitteldepots anlegen Tannenhäher (mehrere Tausend verschiedene Depots, ca. 80 % werden wieder gefunden!)
Auf Wintertouren begegnen wir nur wenigen Alpentieren, oft aber ihren Spuren. Nebst Trittsiegeln (einzelne Fussabdrücke), Fährten oder Flügelabdrücken sind dies auch Losung (Kot), Frass- und Scheuerspuren, Haare, Federn, Bauten und Rufe. Spuren verraten viel über das Leben der Tiere, ohne dass diese sichtbar sind.
Auf den folgenden Seiten werden die bezüglich Wildtierschutz im Winter wichtigsten Tiere vorgestellt; ihre ungefähren Lebensräume sind in der Grafik auf Seite 19 ersichtlich.
A Federkleidwechsel Sommer
A Hahn glänzend blauschwarz, (Brauntöne) – Winter (weiss); ca. 40 cm gross, Henne braun Grösse ca. 35 cm; gebändert und etwas kleiner; «knarrender» Ruf leicht gegabelter Schwanz


B Oberhalb der Waldgrenze, gerne in B Bereich der oberen Waldgrenze; gut strukturiertem Gelände; angewiesen auf reiche Zwergim Winter oft auf Futtersuche an strauchvegetation; im Winter freigeblasenen Grasrücken vor allem in Nordlagen


C Triebe, Knospen, Samen und C Blätter, Knospen und Früchte Beeren von Zwergsträuchern und von Heidel- und Moosbeeren Alpenkräutern sowie Alpenrosen
D April–Mai
E Juni–August; 5–9 Junge
F 12 000 – 18 000 Paare;
D April–Mai
E Mai–Juli; 6 –10 Junge
F 12 000 – 16 000 Hähne; potenziell gefährdet, aber vom potenziell gefährdet Klimawandel besonders betroffen
A Eindrücklicher 60–85 cm grosser Vogel; A Etwas kleiner als der Feldhase, Hahn grauschwarz mit dunkelgrüner mit kürzeren Ohren (Kälteschutz); Brust, Henne kleiner mit brauner dreimaliger Fellwechsel pro Jahr; Tarnfärbung im Winter reinweiss

B Waldtier, bevorzugt lichte, struktur- B Offene Bereiche oberhalb Waldreiche Wälder des Jura und der grenze, im Winter auch im Alpennordseite lichten Wald; gräbt Schneelöcher für Schutz und Nahrungssuche; nachtaktiv


C Nadeln, Triebe, Knospen, Beeren C Kräuter, Gräser und Knospen, im Winter auch Baumrinde und Wurzeln
D März–Mai
E Mai–Juli; 7–11 Junge
F 380 – 480 Hähne; stark gefährdet
D erstmals März–April
E erstmals Mai–Juni; 2 – 4 Junge; max. 3 Würfe
F ca. 14 000 Tiere; nicht gefährdet
A Massig-gedrungen, 70–95 cm Schulter- A Mittelgross, mit kontrastreicher höhe, Geissen etwas kleiner und zier- Kopfzeichnung und hakenförlicher; raues, fahl- bis ockerbraunes migen Hörnern; Wechsel Fell; Böcke bis 1 m lange Hörner mit zwischen hellerem SommerKnoten, Geissen glatte und kürzere und dunklerem, wärmerem
Winterkleid
B 1600–3200 m, gerne in felsigen B Steilhänge mit Felspartien und Hängen. Im Winter tiefer an sonnen- lockeren Waldbeständen; im exponierten Hängen, teilweise bis Winter bis in die Talböden, aber unter die Waldgrenze auch hoch oben an Sonnenhängen
C Gras, im Winter auch

C Gräser, Kräuter, Blätter, im Polsterpflanzen und Holzgewächse Winter Triebe von Bäumen und Sträuchern, Flechten, Moose (Magenumstellung)

D Dezember–Januar
E Juni; 1, selten 2 Junge
F ca. 18 000 Tiere; nicht gefährdet
D November–Dezember
E Mai–Juni;
1, ausnahmsweise 2 Junge
F ca. 90 000 Tiere; nicht gefährdet
Wer kennt nicht die Gämsen, die uns im Aufstieg aus Distanz beinahe gleichgültig beobachten, oder die Dohlen, die einem auf dem Gipfel aus der Hand fressen? Gewöhnung ist vor allem dort möglich, wo die Präsenz des Menschen gleichartig, konstant und häufig ist – und damit für die Tiere kalkulierbar.
Unerwartete Störungen hingegen lösen Stress aus: Der Puls erhöht sich (bei Fluchttieren) oder erniedrigt sich (bei Tieren, die sich auf ihre Tarnung verlassen), und Stresshormone werden ausgeschüttet.
• Ein Birkhuhn zum Beispiel verharrt bei der Annäherung eines (potenziellen) Feindes so lange wie möglich regungslos in der schützenden Schneehöhle. Dabei fällt der Puls abrupt von 150 – 200 auf 75 – ihm bleibt vor Angst also förmlich das Herz stehen! Dadurch werden körpereigene Geräusche herabgesetzt und die Umweltwahrnehmung gesteigert. Erst bei sehr geringer Distanz der Gefahrenquelle reagiert es mit einer enormen Zunahme von Herz- und Atemfrequenz als Vorbereitung für einen «Blitzstart».
Weil viele Tiere im Winter ihren Stoffwechsel stark drosseln (um Energie zu sparen), wirken sich häufige Fluchten besonders negativ auf die Energiebilanz der Tiere aus. Mögliche Folgen sind ein geringerer Fortpflanzungserfolg, Krankheit oder der Erschöpfungstod.
• Wenn z. B. ein Birkhuhn die isolierende Schneehöhle blitzartig verlassen muss, verliert es durch Anstrengung und Wärmeverlust überlebenswichtige Energie.
• Auch Fluchten von Hirsch, Gämse oder Steinbock brauchen viel Energie –insbesondere im Hochwinter bei tiefem Schnee.
Bei wiederholter Störung verlassen Wildtiere ihre Einstands-, Futter-, Balz- oder Nistplätze. Dies kann zu Schäden in ihren Zufluchtsorten und zu Konkurrenz mit anderen Tieren führen.
• In vielen Gebieten leben derzeit deutlich mehr Hirsche und Rehe, als der Wald verträgt, sodass es zu Verbissschäden kommt. Dies hat negative Auswirkungen auf die Verjüngung und die Biodiversität des Waldes.
• Das Auerhuhn lebt in lichten, strukturreichen Wäldern, deren Fläche in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen hat (und nun wieder gefördert wird). Regelmässige Störung in diesen selten gewordenen Lebensräumen kann zur Aufgabe von Balzplätzen führen und damit die Fortpflanzung gefährden.
Ausbildung
A. Rosenkranz / J. Meyer / M. Lüthi / F. Zoller

sehen – kennen – verstehen
Das Handbuch liefert umfassende Informationen zur alpinen

Tier- und Pflanzenwelt, zur Geologie und zum Leben der Menschen in den Alpen.
Die Kapitel zu Klimawandel und Bergsport mit Rücksicht auf die Natur regen zum genauen Beobachten und Nachdenken an.
Allgemein verständlich, reich bebildert, illustriert und rucksacktauglich – Lebenswelt Alpen ist dein Begleiter für die (Neu)entdeckung der Alpenwelt.
310 Seiten, 330 Illustrationen
3. Auflage
ISBN: 978-3-85902-425-0
Beim Wintersport sollten wir eine Schwächung der Wildtiere durch Flucht und Stress möglichst vermeiden und ihre Lebensräume respektieren. Neben der Berücksichtigung von Wildruhezonen und Wildtierschutzgebieten ist hier auch freiwillige Rücksicht wichtig – damit eben auch weniger zusätzliche Verbote notwendig sind.
Trichterprinzip & Co.
Das Trichterprinzip veranschaulicht die Anpassung unseres Bewegungsspielraumes im Gelände, mit welcher wir auf unseren Touren Rücksicht auf Wildtiere nehmen können.
Wildtiere halten sich im Winter dort auf, wo sie Nahrung finden und geschützt sind. Oberhalb der Baumgrenze sind dies nur selten die schneereichen Hänge, sondern felsige und schneefreie Flächen (Schneehuhn, Steinbock, Gämse). In dieser Höhenlage können wir uns weitgehend frei bewegen. Leider wurde das bei der Festlegung gewisser Schutzgebiete zu wenig berücksichtigt.

An der oberen Waldgrenze (Birkhuhn) und im Wald (Auerhuhn, Rothirsch, Gämse) sind dagegen für viele Wildtiere die Lebensbedingungen im Winter vorteilhaft. Je mehr wir uns dem Wald von oben nähern, desto kleiner sollte darum – wie bei einem Trichter – unser Raumanspruch werden.
Im Wald halten wir uns an Wege, Forststrassen und bezeichnete Routen. Bitte nicht entlang der Waldränder laufen sowie Gebüsche und Baumgruppen umgehen.
Weitere Tipps:
• Sich möglichst ruhig verhalten.
• Beim Betreten einer neuen Geländekammer Ausschau halten und allfällige W ildtiere aus der Distanz beobachten. Den Tieren ausweichen und ihnen genügend Zeit lassen, sich in Ruhe zu entfernen.
• Erhöhte Rücksicht in der Dämmerung. Viele T iere sind im Schutz des schwachen Lichtes am Fressen.
• Im Frühjahr während der Balzzeit (Raufusshühner) und Setzzeit (Schalenwild) besondere Rücksicht nehmen.
Wildruhezonen und Wildschutzgebiete
Zum Schutz der Wildtiere haben die Behörden Schutzgebiete ausgeschieden. Diese umfassen heute 12 % des Schweizer Alpenraumes (10 % rechtsverbindlich, 2 % empfohlen) und dürfen im Winter nur auf den 2200 km erlaubten Skirouten und Wegen betreten werden. Es werden zwei Arten von Schutzgebieten unterschieden:
• «Wildruhezonen» werden von den Kantonen (z. B. NW, OW) oder Gemeinden (z. B. in GR, LU) festgelegt. In rechtsverbindlichen Wildruhezonen gilt im Winter ein Betretungsverbot oder eine Einschränkung auf erlaubte Wege und Routen. Daneben gibt es empfohlene Wildruhezonen.
• Eidgenössische Jagdbanngebiete (auch Wildtierschutzgebiete genannt) verbieten neben der Jagd seit 1991 auch Wintersport «ausserhalb von markierten Pisten, Routen und Loipen...». Zudem ist Zelten und Campieren untersagt, und Hunde sind im Wald an der Leine zu führen. In gewissen Wildtierschutzgebieten werden gezielte Abschüsse vorgenommen, um die Bestände zu regulieren.
Naturerlebnisse stärken die Bereitschaft, Natur und Umwelt zu schützen. Als Schützer und Nutzer der Bergwelt unterstützt der SAC das Instrument der Schutzgebiete, diese sollen jedoch verhältnismässig und breit abgestützt sein. Der SAC setzt sich für rücksichtsvollen Bergsport und den freien Zugang zu den Bergen ein. Um bei geplanten Einschränkungen frühzeitig mitwirken zu können, ist es wichtig, dass Bergsporttreibende die Entwicklung in ihrer Region genau verfolgen. Die SAC-Geschäftsstelle ist auf Hinweise angewiesen, leistet gerne fachliche Unterstützung und vermittelt Kontakt zu Behörden.
Zur Tourenplanung gehört auch, dass wir uns über Schutzgebiete informieren und die Regeln einhalten.
• Im SAC-Tourenportal (www.tourenportal.ch) entsprechen alle Schneeschuhund Skitourenrouten den aktuellen Schutzbestimmungen.
• Die gedruckten Skitourenkarten von Swisstopo zeigen die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung geltenden Wildruhezonen und Wildschutzgebiete inklusive damals erlaubter Routen, und auch die in den Tourenführern des SAC publizierten Routen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erlaubt. Weil sich die Bestimmungen in den letzten Jahren stark geändert haben, müssen wir einen Check mit den neusten Daten machen. Diese finden wir auf: http://map.schneesport.admin.ch.
Die Kampagne «Schneesport mit Rücksicht» steht für ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Wildtier. Im Zentrum stehen freiwillige Massnahmen und Eigenverantwortung. Die vier Regeln der Kampagne sind:
1. Beachte Wildruhezonen und W ildtierschutzgebiete: Sie bieten Wildtieren Rückzugsräume.
2. Bleibe im Wald auf den bezeichneten Routen und Wegen: So können sich Wildtiere an den Menschen gewöhnen.
3. Meide Waldränder und schneefreie Flächen: Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere.
4. Führe Hunde an der Leine, insbesondere im Wald: Wildtiere flüchten vor freilaufenden Hunden.
i Weitere Infos: https://natur-freizeit.ch/schneesport-mit-ruecksicht
i Lernunterlagen für unterwegs zu Natur- und Umweltthemen: www.sac-cas.ch/de/envirotools
E. Landolt / D. Aeschimann / B. Bäumler / N. Rasolofo

Ein Pflanzenführer für Wanderer und Bergsteiger Wer hat nicht schon gestaunt, wie vielfältig die Pflanzenwelt in den Alpen ist. Wie heisst diese Blume mit den gelben Blättern? Wer weiss, welche Gräser im rauen Klima über 3000 m überleben können? Welches sind die giftigen Pflanzen? Dieses Werk lässt uns die Vielfalt der Pflanzenwelt in den Bergen entdecken. Es erklärt, wie sich die verschiedenen Arten an die Bedingungen angepasst haben und auf welch vielfältige Art die Fortpflanzung gesichert ist.

488 Seiten, 9. Auflage
ISBN 978-3-85902-406-9
Die Alpen im Westwindgürtel
Das Temperatur- und Druckgefälle zwischen Tropen und Pol treibt den Westwind an. Quer zum Wind liegende Gebirge (Rocky Mountains, Grönland) zwingen den Westwind auf eine Slalomspur. Diese erhält zusätzlichen Schwung durch die thermischen Gegensätze zwischen kanadischer Arktis und Nordatlantik sowie zwischen Sibirien und dem Nordpazifik. Bedingt durch den Slalom der Westwindzone, trifft die Luft bevorzugt aus Südwest bis Nordwest auf die Alpen. Reine Nord- und Südlagen sind seltener.
Der Luftdruck ist ein Mass dafür, wie viel Luft sich über uns befindet. Änderungen des Luftdrucks bedeuten, dass Luft in unser Gebiet zufliesst oder dieses verlässt.
Im Hochdruckgebiet sinkt die Luft ab. Sie erwärmt sich dabei, kann mehr Wasserdampf aufnehmen und die Wolken lösen sich auf. Im Tiefdruckgebiet steigt die Luft auf, kühlt ab und es bilden sich Wolken.
Die Luft fliesst vom Hoch- ins Tiefdruckgebiet. Auf ihrem Weg wird sie durch die Erdrotation abgelenkt, so dass sie eine gekrümmte Bahn beschreibt. Auf der nördlichen Hemisphäre gilt:
• Die Luft verlässt das Hoch im Uhrzeigersinn.
• Die Luft erreicht das Tief im Gegenuhrzeigersinn.
• In Tälern folgt die Luft der Talachse. Die Windrichtung kann dabei bis zu 180 Grad von jener im Gipfelniveau abweichen.
Steigt die Luft auf (z. B. in Fronten, Quellwolken, Tiefdruckgebieten oder wegen der Topografie), kühlt sie sich ab und kann nicht mehr so viel Wasserdampf aufnehmen. Das überschüssige Wasser kondensiert zu Wassertropfen oder gefriert zu Eiskristallen, es entstehen Wolken. Werden die Wassertropfen oder die Eiskristalle so gross, dass sie von den Turbulenzen nicht mehr in der Schwebe gehalten werden, setzt Niederschlag ein.
Fronten
«Fronten» sind Übergänge von Luftmassen unterschiedlicher Temperatur. Sie bringen Wolken und Niederschlag.
Kaltfronten bringen häufig einen Warmfronten kündigen sich mit schnellen Wetterwechsel. An ihrer Zirren, dann immer dichterer und Vorderseite sind selbst im Winter tieferer Schichtbewölkung an. Der Gewitter möglich. Sie werden vom Wetterwechsel erfolgt langsamer.
Temperatur
Die Temperatur im Gipfelbereich wird vom Wetterbericht sehr genau vorhergesagt.
• Die Schneefallgrenze liegt 200 bis 500 m unter der Nullgradgrenze, je intensiver der Niederschlag, desto weiter darunter.
• Bei klarem Himmel kühlt die nächtliche Abstrahlung die Schneeoberfläche aus. Nasser Schnee gefriert dabei bis ca. 1300 m unter die Nullgradgrenze tragfähig.
Wind Wind führt nicht nur zu Schneeverfrachtungen, sondern zusammen mit tiefen Temperaturen auch leicht zu Erfrierungen. Der Windchill gibt an, wie kalt sich eine Kombination aus Wind und Temperatur auf trockener, ungeschützter Haut anfühlt.
Nasse Haut kühlt schneller aus, von winddichten Kleidern geschützte langsamer.
Bei schönem Wetter verursachen die Sonneneinstrahlung und die nächtliche Abstrahlung folgende Winde:
Talwind Tagsüber erwärmt die Sonne die Luft über dunklen Südhängen besonders stark, so dass sie dort aufsteigt. Aus dem Tal fliesst Luft nach.
Bergwind In der Nacht kühlt die Luft in Bodennähe stärker ab als in der freien Atmosphäre, einige Meter über dem Gelände. Die an den Berghängen abgekühlte Luft sinkt ihrer höheren Dichte wegen dem Gelände nach ins Tal ab. Sie verdrängt dort die wärmere Luft, die sich einige Meter über dem Talboden weniger abgekühlt hat.
Luftdruck

Wichtiger als der absolute Luftdruck ist seine Veränderung. Am Höhenmesser abgelesene Änderungen von mindestens 20 m zeigen eine Tendenz, ab ca. 50 m weisen sie eindeutig auf einen Wetterwechsel hin (siehe S. 31).
Bewölkung
Nebst der Angabe, welcher Anteil des Himmels von Wolken bedeckt ist, interessiert uns Bergsteiger auch die Höhe der Wolkenbasis. Sie wird manchmal im Wetterbericht angegeben.
Für (praktisch) vollständig wolkenverhangenen Himmel verwenden die Meteorologen zwei Wörter: «stark bewölkt», wenn Niederschläge fallen; «bedeckt», wenn es trocken bleibt.
Die Niederschlagsmenge wird heute deutlich genauer vorhergesagt als noch vor wenigen Jahren, variiert aber oftmals stark von einem Ort zum anderen. 1 mm Regen entspricht etwa 1 cm trockenem Schnee.
Bezugsmöglichkeiten verschiedener Wetterberichte siehe S. 283.
Gebietseinteilung

Die «Alpennordseite» des Wetterberichts entspricht etwa dem «Alpennordhang» im Lawinenbulletin, also ohne Wallis, Nord- und Mittelbünden.
Wie zuverlässig ist der Wetterbericht?
Am genausten ist die Prognose des Bodendrucks, am schlechtesten jene der Niederschlagsmenge. Die Trefferquote der kurzfristigen Prognose übertrifft jene der mittelfristigen Vorhersage deutlich, weshalb wir möglichst kurzfristig und mit dem aktuellsten Wetterbericht entscheiden sollten. Zeitungswetterberichte sind oft veraltet, meistens sehr pauschal und nicht aufs Gebirge abgestimmt. Nur selten geben uns die Meteorologen die erwartete Trefferwahrscheinlichkeit an. Trotzdem lässt sie sich abschätzen:
• Wetterbericht verfolgen. Hat er in den letzten Tagen gut gestimmt und schon Tage im Voraus jeweils richtig gelegen, so ist die Chance gross, dass er auch jetzt wieder stimmt. Wurde die Prognose dauernd korrigiert, ist die Trefferwahrscheinlichkeit geringer.
• Erwartete Genauigkeit und andere, mögliche Szenarien bei der persönlichen Wetterberatung erfragen (Tel. siehe S. 283).
Im zentralen Wallis fällt oft weniger Niederschlag als sonst «im Westen». In den Bergen der Ostschweiz und Graubündens erreicht uns eine Wetterverschlechterung oft etwas später als angekündigt, sie bleibt aber meistens auch etwas länger liegen.
Meteo-Modelle sind die Grundlage aller Wetterberichte. Während geschriebene Wetterberichte stark vereinfachen und zusammenfassen, liefern MeteoModelle die Daten in einer hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung – aber unbearbeitet und unkontrolliert. Leider ist nur ein kleiner Teil der Modelldaten frei zugänglich. Die Interpretation der Daten braucht Übung, und oft ist es schwierig, sich in der Datenmenge zu orientieren. Dazu ein paar Tipps:
• Zuerst einen Wetterbericht lesen und erst danach gezielt die interessanten Parameter im Modell anschauen.
• Nicht alle Modelle erreichen dieselbe Qualität. Die höchste Trefferquote haben derzeit COSMO 1E und COSMO 2E von MeteoSchweiz. Ein paar Daten davon finden wir auf www.meteoschweiz.ch und auf der App.
• Insbesondere die Niederschlagsmenge variiert stark von Ort zu Ort, und damit für einen bestimmten Ort oft auch von einem Modelllauf zum anderen. Wir erhalten einen besseren Überblick, wenn wir uns die Niederschläge nicht nur für einen bestimmten Ort anzeigen lassen, sondern die flächige Verteilung auf einer Karte anschauen.
• Modelldaten nicht als exakte Werte nehmen, sondern interpretieren. Zeigt das Modell ein Gewitter, das um 15.30 Uhr 3 km nördlich von uns durchzieht, heisst das in etwa: «Am Nachmittag müssen wir in unserer Region mit Gewittern rechnen. Diese können uns treffen, oder auch nicht».
Hochdruckwetter
Liegen wir im Einflussbereich eines Hochdruckgebiets, haben wir schönes Wetter. Im Winter liegt aber oft Nebel oder Hochnebel über den Niederungen.
Bei einer Inversion liegt warme über kalter Luft. Sie bildet die Nebelgrenze.
Föhn
Föhn entsteht, wenn Luft quer zu den Alpen herangeführt und an diesen gestaut wird. Ist die zugeführte Luft feucht, kühlt sie sich beim Aufstieg an den Alpen mit 0,5 °C pro 100 Höhenmeter ab. Weil kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann als warme, fällt Niederschlag. Auf der Rückseite des Gebirges sinkt die Luft wieder ab. Als trockene Luft erwärmt sie sich um 1 °C pro 100 Höhenmeter und die Wolken lösen sich auf. In den Alpen unterscheiden wir 2 Föhnlagen:
• NW-Staulagen bringen dem Alpennordhang oft bedeutende Niederschläge. Auf der Alpensüdseite und im Engadin herrscht mit Nordföhn schönes, aber windiges Wetter.
• Bei Südstaulagen fallen intensive Niederschläge im Tessin, während es besonders im Norden und Osten der Schweiz mit Südföhn schön und warm ist.
Föhn bedeutet auf den hohen Bergen und am Alpenhauptkamm stürmisches Schlechtwetter. Erst im Tal wird Föhn warm.
Bläst der Föhn? Verschiedene Wetterdienste berechnen dazu einen «Föhnindex».
Bei dieser häufigen Wetterlage folgen sich oft Warm- und Kaltfronten (siehe S. 24) in kurzen Abständen und sorgen für wechselhaftes Wetter mit Niederschlag und Temperaturwechseln. Besonders im Mont Blanc-Gebiet, den Waadtländer und Freiburger Alpen können grössere Niederschlagsmengen fallen. In den übrigen Gebirgsregionen sind die Niederschlagsmengen meistens kleiner als bei Staulagen.
Bise entsteht, wenn der Druck über Deutschland höher ist als im Genferseegebiet. Die von Norden einfliessende Kaltluft schiebt sich infolge ihrer höheren Dichte (kalte Luft ist «schwerer» als warme) dem Boden entlang und verdrängt die warme Luft nach oben. Wie bei winterlichem Hochdruckwetter führen auch ausgeprägte Bisenlagen zu einer Höheninversion und damit einer Hochnebelgrenze auf etwa 1500 bis 2000 m. Im Sommer herrscht bei Bise meistens schönes Wetter.

Eine Wetteränderung kündigt sich meistens an. Um nicht überrascht zu werden, achten wir unterwegs auf folgende Anzeichen:
Cumulonimbus (Gewitterwolke): zieht häufig nach Nordosten.

Zirren und dahinterliegende
Wolkenwand: eine Kaltfront ist im Anzug – höchste Zeit zur Umkehr.


Zirrostratusbewölkung: eine Warmfront ist im Anzug. Allmählich trübt es immer mehr ein.
Halo um Sonne oder Mond: feuchte Höhenluft. Langsame Wetterverschlechterung.

Bei (häufigem) Westwindwetter:
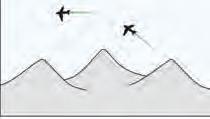
Purpurfarbenes Abendrot: schlechtes Wetter zieht nach Osten ab, klare Nacht.
Purpurfarbenes Morgenrot: Wetterverschlechterung aus Westen.
Kondensstreifen von Flugzeugen lösen sich rasch auf: trockene Höhenluft, stabiles Wetter.

Kondensstreifen bleiben lange am Himmel: feuchte Höhenluft, langsame Wetterverschlechterung möglich.
Besser werdende Fernsicht:
trockenere Luft, Wetterstabilisierung. Schlechter werdende Fernsicht: feuchtere Luft, mögliche Wetterverschlechterung.

(Hoch) Nebel über den Niederungen:
stabiles Hochdruckwetter, sofern
• Obergrenze nicht ansteigt;
• der Nebel sich nicht zu ungewohnter Tageszeit auflöst.
Starkes Auffrischen des Windes in der Höhe, z. B. rascher Wolkenaufzug aus SW: Wetterverschlechterung.
Anzeige des auf gleicher Höhe belassenen
Höhenmessers steigt: Druck fällt -> Wetterverschlechterung.
Anzeige des auf gleicher Höhe belassenen
Höhenmessers sinkt: Druck steigt ->
• langsamer, steter Anstieg: Wetterverbesserung;
• einem raschen Druckanstieg folgen oft Druckfall und Wetterwechsel.
Keine Regel ohne Ausnahme, auch nicht beim Wetter!
Auch wenn wir keinen besonderen Orientierungssinn besitzen, können wir unsere Orientierungsfähigkeit doch weiterentwickeln.
• Zuerst müssen wir uns das Gelände und unsere Route vorstellen können. Dazu beobachten wir das Gelände, verwenden die Landeskarte oder benutzen unsere Erinnerung.
• Unterwegs müssen wir Distanzen, Richtungen, Neigungen, Höhendifferenzen usw. abschätzen können.
• Mit offenen Sinnen vernehmen wir immer wieder nützliche Informationen, z. B. woher der Wind weht, wo ein Bach rauscht, wo der Schnee von der Sonne eine Harschkruste hat usw.
Bei Nebel im verschneiten Gelände können wir uns ohne technische Hilfsmittel kaum orientieren. Verlassen wir die markierten Pisten, sollten wir stets eine Karte und zusätzlich ein GPS oder Kompass + Höhenmesser mitführen und beherrschen.
Für die ganze Schweiz existieren hervorragende Landeskarten, die von der Landestopografie (swisstopo) alle sechs Jahre nachgeführt werden.
Bei der Planung erleichtern digitale Karten auf dem Computer die Übersicht dank Such- und Zoomfunktionen und einer nahtlosen Darstellung über die Blattgrenzen hinweg. Im Internet (www.map.geo.admin.ch) finden wir Landeskarten mit vielen weiteren Funktionen wie z. B. einer farbigen Anzeige der Schutzgebiete und der Hangneigungsklassen (nicht die Karte «Hangneigung» verwenden, diese zeigt nur an, ob der Hang steiler als 30° ist) oder verschiedene Karten mit Darstellung des typischen Lawinengeländes (CAT, ATH und ATHM). Neu gibt es eine Karte im Massstab 1:10 000, bei der Strassen und Häuser jährlich aktualisiert werden. Punkto Felsdarstellung und Äquidistanz entspricht sie der Karte 1:25 000.
Verschiedene Anbieter stellen Touren bzw. Tracks auf den Karten von swisstopo dar, allen voran der SAC mit seinem Tourenportal (für Mitglieder gratis). Nicht so zahlreich sind die Routen auf skitourenguru.ch – dafür sehr genau und erst noch mit dem aktuellen Lawinenbulletin verknüpft. Die klassischen «Skitourenkarten» sind als Kartenblätter im Massstab 1:50 000 und als Layer bei www.map.geo.admin.ch (unter «Schneesport») erhältlich. Sie geben einen guten Überblick über die Tourenmöglichkeiten, sind aber oft nicht so genau.
Für unterwegs empfehlen wir die Karte 1:25 000 (CH: SwissMaps von swisstopo; F: géorando oder geoportail; D, A und Südtirol: Alpenvereinskarten) auf dem GPS-Handgerät oder dem Smartphone, am besten mit eingefärbten Hangneigungsklassen oder (nur in CH) mit einer Klassifikation des Lawinengeländes («CAT», «ATH» oder «ATHM»). So können wir uns vom GPS laufend unseren Standort anzeigen lassen.
Weil Handys v.a. bei kaltem Sauwetter versagen können, empfehlen wir dringend Papierkarten als Backup. Am besten eignen sich die Originalkartenblätter 1:25 000 von Swisstopo mit ihrem widerstandsfähigen Papier. Karten mit Hangneigungsklassen müssen wir selber ausdrucken und unterwegs in einer transparenten, wasserdichten Hülle vor Regen und Sturm schützen.
Auf Smartphones lohnt es sich, die Landeskarte 1:25 000 vorgängig auf dem Smartphone abzuspeichern, damit wir sie jederzeit zur Verfügung haben. Dazu gibt es viele Apps, teils gratis, teils mit einem Jahresabonnement (z. B. «SwissMap Mobile» von swisstopo, «White Risk» oder «Schweiz Mobil»). Karten, die wir laufend aus dem Internet herunterladen, sind nicht zuverlässig, weil die Handynetze nicht die ganzen Alpen abdecken. Google-Maps und dergleichen sind im Gebirge unbrauchbar.
Bei GPS-Handgeräten ist die gewünschte Karte ein zentraler Punkt bei der Wahl des Modells. Die Karte (Pixelkarte) müssen wir separat und passend zum GPSHandgerät kaufen. Vektorkarten, wie wir sie vom Auto-Navi her kennen, sind im Gebirge nicht geeignet.
Wir empfehlen digitale Karten mit Hangneigungsklassen, wie sie z.B. mit «White Risk» auch für Frankreich und Österreich aufs Handy geladen werden können. Während die Höhenkurven meistens relativ gut stimmen, sind Felsschraffuren und Wege im Wald oft ungenau. Bei schlechter Sicht ist in uns unbekanntem Gelände noch mehr Vorsicht geboten.
Bei Papierkarten:
• Fehlt das Koordinatennetz, so kann der Kompass notfalls auch am Schriftzug ausgerichtet werden.
• Die Hangneigungsmessung für die Tourenplanung und die Reduktionsmethode ist weniger genau (siehe S. 100).
• Das Papier ist oft weniger widerstandsfähig.
Transparente, wasserdichte Kartenhülle verwenden.
