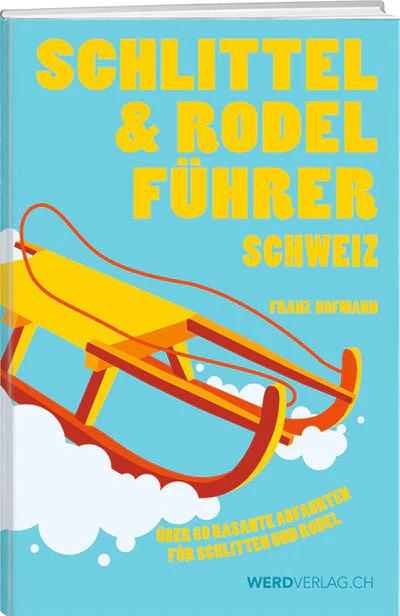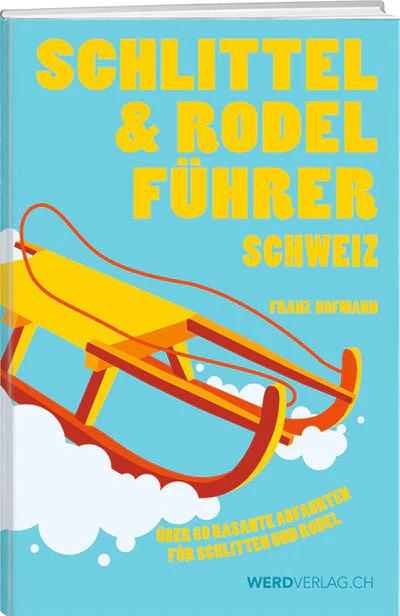
IMPRESSUM
Der Autor hat alle Schlittelbahnen selbst mit einem Rodel erkundet. Alle Angaben in diesem Buch wurden von ihm sorg f ältig recherchiert und vom Verlag geprüft. Für die Vollständigkeit und Richt igkeit der Angaben besteht keine Gewähr, und jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die Leserinnen und Leser unternehmen die Schlittelabfahrten auf eigenes Risiko, haben jede Abfahrt sorgfältig vor z ubereiten und mit der gebotenen Aufmerksamkeit zu befahren. Prinzipiell gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung.
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wieder gabe.
© 2015 Werd & Weber Verlag AG, CH-3645 Thun / Gwatt
Idee, Konzept und Text
F ranz Hofmann, CH-3818 Grindelwald
Fotos Franz Hofmann, CH-3818 Grindelwald Karten Pia Bublies, 22087 Hamburg
Cover-Gestaltung
M iranda Oester, Werd & Weber Verlag AG
Satz
Monica Schulthess Zettel, Sonja Berger und Manuela Krebs Werd & Weber Verlag AG
Lektorat
Madeleine Hadorn, Werd & Weber Verlag AG
Korrektorat
Thomas Kliche, DE-10435 Berlin, www.textbild-berlin.de
ISBN 978-3-85932-756-6 www.werdverlag.ch www.weberverlag.ch
INHALT Vorwort …………………………………………………………………………… 9 Zielsetzung ……………………………………………………………………… 11 Schlitteln in der Schweiz ……………………………………………………… 13 Schlitten oder Rodel – eine Begriffserklärung …………………………… 15 Gegenüberstellung Schlitten – Rodel / Fahrtechnik …………………… 17 Andere Rutschgeräte…………………………………………………………… 29 Geschichte ……………………………………………………………………… 31 Unterschied Kunstbahn – Naturbahn ……………………………………… 39 Unfälle vermeiden ……………………………………………………………… 43 Verhaltensregeln für Schlittler und Rodler ……………………………… 47 Ausrüstung ……………………………………………………………………… 51 Die richtige Pflege ……………………………………………………………… 57 Leicht, mittel oder herausfordernd ………………………………………… 61 Legenden und Hinweise ……………………………………………………… 63 BERN 1 Grindelwald ………………………………………………………………… 71 Kleine Scheidegg – Wengen ……………………………………………… 73 Männlichen – Grindelwald ……………………………………………… 77 Kleine Scheidegg – Grindelwald Eiger Run …………………………… 81 Faulhorn – Bussalp – Grindelwald ……………………………………… 85 Bussalp – Grindelwald …………………………………………………… 89 First – Grindelwald ………………………………………………………… 95 Grosse Scheidegg – Oberer Gletscher ………………………………… 99 2 Adelboden …………………………………………………………………… 103 Adelboden – Tschentenbahnen ………………………………………… 103 Adelboden – Silleren – Bergläger ………………………………………… 107 3 Oeschinensee ……………………………………………………………… 111 4 Kiental ……………………………………………………………………… 115 5 Elsigenalp …………………………………………………………………… 119 3
FRIBOURG 6 Jaunpass …………………………………………………………………… 123 GLARUS 7 Braunwald ………………………………………………………………… 127 8 Elm …………………………………………………………………………… 131 9 Matt …………………………………………………………………………… 135 10 Urnerboden ………………………………………………………………… 139 GRAUBÜNDEN 11 Ftan …………………………………………………………………………… 143 12 Klosters ……………………………………………………………………… 147 Madrisa – Saas ……………………………………………………………… 148 Gotschna – Klosters Platz ………………………………………………… 151 Selfranga – Klosters Dorf ………………………………………………… 155 13 Sarn …………………………………………………………………………… 159 14 Fideris ……………………………………………………………………… 163 15 Savognin …………………………………………………………………… 167 16 St. Moritz …………………………………………………………………… 171 17 Rueras ……………………………………………………………………… 175 18 Davos ………………………………………………………………………… 179 Davos Schatzalp …………………………………………………………… 179 Davos Rinerhorn …………………………………………………………… 183 19 Bergün ……………………………………………………………………… 187 Preda – Bergün ……………………………………………………………… 187 Darlux – Bergün …………………………………………………………… 191 20 Arosa ………………………………………………………………………… 195 Tschuggenberg – Innerarosa …………………………………………… 196 Prätschli – Obersee – Arosa ……………………………………………… 199 Arosa Untersee – Litzirüti ………………………………………………… 203 4
LIECHTENSTEIN 21 Steg ………………………………………………………………………… 207 OSTSCHWEIZ 22 Wangs / Pizol………………………………………………………………… 211 23 Jakobsbad …………………………………………………………………… 215 24 Flumserberg ………………………………………………………………… 219 25 Filzbach ……………………………………………………………………… 223 TESSIN 26 Leontica …………………………………………………………………… 227 URI 27 Andermatt ………………………………………………………………… 231 WAADTLAND 28 Château-d’Œx ……………………………………………………………… 235 29 Les Diablerets ……………………………………………………………… 239 30 La Tzoumaz ………………………………………………………………… 243 WALLIS 31 Bürchen – Unterbäch ……………………………………………………… 247 Brandalp – Unterbäch ……………………………………………………… 248 Moosalp-Bürchen ………………………………………………………… 251 32 Wiler im Lötschental ……………………………………………………… 255 33 Visperterminen …………………………………………………………… 259 34 Saas-Fee ……………………………………………………………………… 263 Saas-Almagell ……………………………………………………………… 267 Saas-Grund ………………………………………………………………… 271 5
6
……………………………………………………………………………
ZENTRALSCHWEIZ 35 Rigi
275
Rigi Kulm – Schwändi – Klösterli………………………………………… 276
…………………
…………………………………………
36
…………………………………………… 287 37 Kriens / Pilatus ……………………………………………………………… 291 38 Engelberg …………………………………………………………………… 295
39 Uetliberg …………………………………………………………………… 299 Glossar …………………………………………………………………………… 303 Schlittel- und Rodelclubs in der
………………………………… 305 Literatur und Links …………………………………………………………… 307
…………………………………………………………………
Dank ………………………………………………………………………………
Bildnachweis ……………………………………………………………………
Schlusswort ……………………………………………………………………… 313
………………………………………………………………… 317 Ø Länge Höhenmeter Durchschnittsgefälle Symbole
einfach/leicht
Rigi Kulm – Rigi Staffel – Des Alpes – Rigi Klösterli
279 Rigi Staffelhöhe – Rigi Kaltbad
283 Rigi Staffel – Wölfertschentäli – Rigi Klösterli………………………… 283
Stöckalp bei Melchsee-Frutt
ZÜRICH
Schweiz
Über den Autor
308
309
311
Ortsverzeichnis
Schwierigkeitsgrad Blau:
Blau/Rot: einfach bis mittelschwer Rot: mittelschwer/mittel Rot/Schwarz: mittel bis schwer Schwarz: herausfordernd/schwer

7

8
VORW ORT
Das Schlitteln oder Rodeln ist seit mehr als hundert Jahren eine beliebte Freizeitbeschäftigung, denn Sport und Bewegung an frischer Luft, speziell im Winter – sei es als Freizeitvergnügen oder als Leistungssport –, haben in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Das Rodeln ist sogar eine richtige Spitzensportart, die es zu olympischen Ehren und Weltcup-Status gebracht hat.
Schlitteln hat sich wegen der Einfachheit seiner Ausführung und des Erlernens, der individuellen Anpassung und seiner langen Tradition sowie seiner unmittelbaren Nähe zur Natur zu einer immer beliebter werdenden Wintersportart für Menschen jeden Alters entwickelt. Denn was gibt es Schöneres, als auf zwei Kufen durch eine verschneite Winterlandschaft zu gleiten? Schlitteln verbindet Spass, Adrenalin, Sport und Genuss in der freien Natur. Schlitteln ist auch gesund und eine der geselligsten Wintersportarten. Vielfach wird Schlitteln in der Familie oder in einer Gruppe mit Freunden oder Kollegen betrieben und erfreut sich seit Jahren einer zunehmenden Beliebtheit.
Kaum fällt der erste Schnee, kommt bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen der Wunsch auf, eine Schlittenfahrt zu unternehmen. Neben den vielen anderen neuen Wintersportarten (Snowboarden, Snowbiken u. a. m.) ist der Reiz des Schlittelns speziell wegen seiner gruppendynamischen Wirkung auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene überaus gross und gewinnt zunehmend Anhänger jeden Alters.
Bequem und schnell hinauf zum Start.
9
Als genussvoller Familiensport stellt Schlitteln eine kostengünstige Alternative zum stetig teurer werdenden Skifahren dar. Immer weniger Kinder wachsen mit «den Skiern an den Füssen» auf. In den Städten und Agglomerationen sind Winterferien als reine Skiferien rückläufig. Als ideale Alternative gewinnt dadurch Schlitteln und Rodeln immer mehr an Bedeutung und Anhängern.
Auch wenn der Schlittler von anderen Wintersportakteuren belächelt und als der «Ewiggestrige» dargestellt werden mag, liegt ein grosses wirtschaftliches Potenzial in der Sportart. Bahnbetreiber, Gemeinden und Tourismusverbände haben diesen Trend schon längst erkannt und bieten eine Vielzahl von Schlittelbahnen in der ganzen Schweiz und im restlichen Alpenraum an. Schlitteln ist die einzige Wintersportart, die in den letzten Jahren Zuwachs erfahren hat und wohl auch in Zukunft wachsen wird. Das Schlitteln ist jedoch auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Viele Bergbahnen und Skigebiete bauen ihr Angebot aus, denn gerade die Schlittler stellen ein künftig sehr interessantes Wachstumspotenzial dar.
«Man muss es einmal gespürt haben, dieses berauschende Gleitgefühl aus dem Beckenboden.
Wie es so sattsam aufsteigt und die Seele frottiert, wenn man den Bock besteigt, in leichter Rückenlage Fahrt aufnimmt und mit fünfzig Stundenkilometern, Schneegischt im Gesicht, Sonne und Tal entgegenreitet.»
Urs Gehriger*
Oder auf den Punkt gebracht: «Schlittelst du noch oder rodelst du schon?»
Franz Hofmann
*Gehriger, Urs. 2014. Märchenstunden in der Jungfrauregion. In: Bergwinter. Weltwoche 13.11.2014
10
ZIELSETZUNG
Zielsetzung dieses Führers ist es, die Kenntnisse über den Volkssport Schlitteln zu erweitern, die Unterschiede zwischen einem Schlitten und einem Rodel zu erklären und aus der Geschichte die Zusammenhänge der olympischen Sportarten Bob und Kunstbahnrodeln darzustellen. Zudem werden viele Tipps und Tricks zur Fahrund Bremstechnik sowie zu Ausrüstung und Pflege der Geräte gegeben. Und schliesslich soll die Sicherheit erhöht und dadurch das Unfallrisiko vermindert werden.
Natürlich fehlt eine ausführliche Vorstellung von verschiedenen Schlittelbahnen in der Schweiz nicht. Bei den über 120 Bahnen in der Schweiz konnte deshalb nur eine Auswahl besonders schöner und interessanter Bahnen getroffen werden. Der Autor stellt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist ihm bewusst, dass es noch viele andere schöne Bahnen gibt, die in einem zweiten Schritt erfasst und beschrieben werden.

11

12
SCHLITTELN IN DER SCHWEIZ
Gemäss einer Studie des Schweizerischen Rodelverbandes sind in guten Wintern mehr als 1,9 Millionen Personen mit einem Schlitten oder einem Rodel unterwegs. Diese Zahlen enthalten jedoch nur erfasste Personen, die auf einer kommerziell betriebenen Bahn unterwegs sind. Darin nicht eingerechnet sind alle diejenigen, die einen Schlitten zur Fahrt ins Dorf, zur Schule oder zur Arbeit benutzen oder einfach so einen verschneiten Hang hinunterrutschen.
Schlitteln ist ein Volkssport in der Schweiz. Nur wird er als solcher nicht erkannt, weder von den Schlittlern selbst, den Bahnbetreibern noch von der Politik. Schlitteln ist lustig, macht Spass und ist ein Freitzeitvertrieb, aber die wenigsten erkennen darin auch eine sportliche Facette. Schlitteln kann jeder, macht jeder und niemand denkt daran, dass man sich auch beim Schlitteln aktiv bewegt und eine körperliche Anstrengung sowie eine sportliche Leistung erbringt.
Dass Schlitteln sehr wohl auch eine sportliche Seite hat, die man als Rodeln bezeichnet, ist im allgemeinen Sprachgebrauch der Schweiz noch nicht angekommen. Man schlittelt lieber über einen unebenen Hang oder eine Schlittelbahn mit einem alten Holzschlitten, «geniesst» die Schläge der Holzleistenbespannung direkt auf die Wirbelsäule (!), anstatt sich ein modernes Gerät anzuschaffen, das nicht nur gesundheitsschonender ist, sondern auch einen Mehrwert an Spass, Fahrfreude und sportlicher Herausforderung bietet. Dieser Führer will nicht nur eine Auswahl der schönsten Schlittelbahnen
Schlitten – Rodel – oder etwas anderes?
13
der Schweiz aufzeigen, sondern auch viel Wissenswertes, Tipps und Tricks von Experten vermitteln, wie Schlitteln besser, schöner und sicherer werden kann. Schlitteln ist die Urform von verschiedenen olympischen Sportarten, und die Schweiz ist das Ursprungsland der ersten internationalen Wettkämpfe. Leider ist dieses Wissen über die geschichtlichen Zusammenhänge aus der Geschichte verloren gegangen und die Schweiz hat die Entwicklung sowohl im Bereich des Breiten- als auch des Spitzensports verschlafen. Solange die Schweizer Alltagsschlittler weiterhin dem «klassischen Holzschlitten-Gedanken» verhaftet bleiben, werden sie den Anschluss an die Moderne verpassen und weiterhin mit museumsreifen Geräten die Schweizer Bergwelt beglücken.
Erfreulicherweise erkennen mehr und mehr Wintersportler, dass der Fahrspass mit einem modernen Gerät, eben mit einem Rodel, im Vergleich zu einem alten klassischen Holzschlitten nicht nur um ein Vielfaches höher ist, sondern dass dadurch auch eine sportliche Facette aufkommt, die ungeheures Potenzial verspricht. Für alle anderen soll dieser Führer den Spass am Schlitteln durch richtiges Verhalten, Informationen über Fahr- und Bremstechnik und vieles mehr steigern, damit man sicher über jede Schlittelbahn kommt – egal mit welchem Gerät.
Ganz gleich, ob Schlitteln als Fun-Aktivität oder Rodeln als sportliche Herausforderung gesehen wird, beide Formen haben ihre Daseinsberechtigung und jeder soll das machen, was ihm gefällt. Nur offen für Neues und probierfreudig sollte man sein. Denn wer einmal auf einem guten Rodel gesessen hat, wird nie mehr auf einen harten Holzschlitten zurückkehren. Beim Skifahren haben sich anfänglich auch viele gewehrt, Carving-Ski zu benutzen. Und wer fährt heute noch mit einem «Spaghetti-Ski»? Beim Schlitteln hingegen ist die Benutzung eines Gerätes, das längst ins Museum gehört, immer noch Standard!
14
SCHLITTENODER RODEL – EINE BEGRIFFSERKLÄRUNG
Die Schweiz ist ein Schlittelland. Die meisten Wintersportler, die schlitteln, benutzen einen klassischen Davoser Holzschlitten. Dass sich in den letzten Jahrzehnten auch das Sportgerät weiterentwickelt hat, zum besser lenkbaren und bequemeren Rodel hin, wissen die wenigsten. Im Gegensatz zum Skisport, bei dem man in der Regel mindestens alle zwei Jahre das Sportgerät, also die Ski, wechselt, benutzt man beim Schlitteln ein seit über 150 Jahren gleich gebliebenes Gerät und ist damit im Vergleich zum benachbarten Ausland über Jahrzehnte im Rückstand.
Unter den Begriffen Schlitteln oder Rodeln ist jene Tätigkeit zu verstehen, bei der man mit einem Gerät auf zwei Kufen einen schneebedeckten Hang oder Berg hinabgleitet. Die Begriffe werden regional und landesspezifisch unterschiedlich verwendet. So spricht man in der Schweiz umgangssprachlich generell vom Schlitten (Gerät) oder vom Schlitteln (Tätigkeit), während in Deutschland/Bayern, in Österreich/Tirol und Italien/Südtirol vom Rodel (Gerät) oder vom Rodeln (Tätigkeit) gesprochen wird.
Unabhängig davon, welches Gerät (Holzschlitten, Rodel, Plastikbob oder ein anderes Rutschgerät) benutzt wird, spricht man in der Schweiz vom Schlitteln oder Schlittenfahren.
15
Ein Vergleich mit dem Velofahren (als Überbegriff) soll die Unterschiede verdeutlichen. Vom Biken spricht man, wenn ein Biker ein Mountainbike zum Fahren den Berg hinauf oder Downhill benutzt. Verwendet ein Velofahrer ein Rennrad, dann wird Rennrad gefahren oder vom «Gümmeln» gesprochen. Benutzt ein Freizeitvelofahrer ein Touren- oder Cityfahrrad, dann spricht man vom Velofahren. Alle diese Tätigkeiten, das Fahren auf der Strasse, Biken oder das Fahren in der Freizeit, werden übergeordnet als Velofahren bezeichnet.
Wenn wir von Schlitteln oder Rodeln sprechen, meint man inhaltlich das Gleiche. Fachspezifisch besteht jedoch ein grosser Unterschied zwischen Schlitteln und Rodeln. Verwendet der Wintersportler einen klassischen Holzschlitten (Davoser, Grindelwalder, Arosa o. ä.), dann schlittelt er. Verwendet er jedoch einen Rodel (Freizeit-, Sportoder Rennrodel), dann rodelt er. Der Unterschied besteht vor allem im verwendeten Gerät. So hat ein Holzschlitten eine starre Holzkonstruktion und ist deshalb nur sehr schwer lenkbar. Vor allem aber hat er eine harte Sitzfläche, die aus längs verschraubten Holzleisten besteht. Ein Rodel hingegen ist beweglich in der Konstruktion, deshalb besser lenk- und manövrierbar und hat eine bespannte und somit weiche Sitzfläche.


16
Sportrodel Davoser Schlitten
GEGENÜBERSTELLUNG SCHLITTEN
RODEL/ FAHRTECHNIK
Bei den Geräten gibt es klare Unterscheide, denn Schlitten ist nicht gleich Schlitten: So wird der klassische Holzschlitten, als das in der Schweiz am meisten verwendete Gerät, als Davoser oder Grindelwalder oder generell als Schlitten bezeichnet.
Der Rodel hingegen ist eine Weiterentwicklung des Holzschlittens für den Freizeitbereich und die sportliche Fahrweise.

17
Alt trifft Neu – Entwicklung bei den Kufengeräten: v. r. n. l. Holzschlitten, Rodel, Pistenbock
–
Schlitten
Die in der Schweiz meistverkauften Holzschlittentypen sind der Davoser und der Grindelwalder. Neben diesen «Massenprodukten» stellen in verschiedensten (vor allem Graubündner) Ortschaften kleine lokale Produzenten ebenfalls qualitativ hochwertige Holzschlitten her, die sich nur in wenigen Details von Ersteren unterscheiden (z. B. Aroser, Bergüner oder Goldiwiler Schlitten).
Davoser
Der Davoser ist der Klassiker unter den Holzschlitten. Als «Vater» gilt der Davoser Wagner Emanuel Heinz Friberg, der schon 1865 am Guggerbach in Davos Platz die ersten Schlitten entwickelt und gebaut hat. Ein Davoser hat, im Gegensatz zum Rodel, zwei in fester Spur laufende Kufen, die mit Schienen aus flachem oder auch leicht gewölbtem Bandstahl beschlagen sind. Der vordere Aufbug kann verschieden geformt sein und hat ein Zugeisen, das die vorderen Enden der Kufen miteinander fest verbindet. Alle Davoser haben eine starre Holzkonstruktion und verbinden – je nach Länge – zwei oder drei Querjoche fix miteinander. Diese Querjoche tragen die äusseren zum Bug verlaufenden Längsholme und die kürzeren Sitzleisten dazwischen; in der Regel sind sie aus Holz gefertigt. Der klas-

18
Davoser Holzschlitten
Grindelwalder Holzschlitten
sische Holzschlitten hat keine abfedernde Sitzbespannung oder bewegliche Lenkhörner.
Traditionell wird ein Davoser aus Eschenholz gefertigt. Billigere Modelle bestehen aus Buche und sind zwischen 80 und 130 cm lang. Der Davoser bietet somit Platz für bis zu drei Personen.
Der klassische Davoser Holzschlitten wurde primär als Transportgerät zum Beispiel für Holz, Milchkannen, Heu verwendet. Erst spät (ab 1883) wurde er unverändert auch als Sportgerät genutzt. Noch heute, nach über 130 Jahren, benutzt die Mehrheit der Schweizer Schlittler weiterhin diesen Holzschlitten, obwohl er eigentlich ein museumsreifes Gerät ist, das ursprünglich nie für eine sportliche Fahrt konzipiert worden war.

Grindelwalder
Bei einem Grindelwalder Holzschlitten sind, im Unterschied zum Davoser, nur die beiden äusseren Sitzleisten auf die Tragjoche geschraubt. Die inneren Sitzleisten sind durch Langlochbohrungen hindurch in die Obergurte der Querjoche eingeschoben, was die Stabilität gegenüber einfach übereinander gelegten Schraubverbindungen enorm erhöht. Sie liegen dadurch etwas tiefer als die äusseren Sitzlatten. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass es weniger zum Abrutschen kommt, da die Sitzposition ein wenig vertiefter ist.
19
– Rodel / Fahrtechnik
Gegenüberstellung Schlitten
Querjoche
Kufe
Fahrtechnik mit einem starren Schlitten
Grundsätzlich wird, im Gegensatz zum Rodel, auf einem Schlitten aufrecht gesessen. Gelenkt wird ein Schlitten durch einseitiges Bremsen, indem zum Beispiel beim Fahren in eine Linkskurve der linke Fuss flach in den Schnee an der linken Aussenkante des Schlittens gestemmt oder gedrückt wird. Bitte nicht nur mit der Ferse bremsen, denn dies erhöht die Verletzungsgefahr an den Gelenken und im Kniebereich. Idealerweise halten beide Hände den Schlitten fest. Die kurvenaussenseitige Hand hält den Schlitten vorne, die kurven-


So fahren viele mit einem Holzschlitten …um die Kurve.

20
Steg
Aufbug
Schiene auf der Kufe
Starre Sitzleisten aus Holz
Horn Zugseil
innenseitige Hand hinten. Viele Schlittenfahrer benutzen auch ein Zugseil, das an den Hörnern befestigt ist, um durch dosierten Zug in die jeweilige Fahrtrichtung den Schlitten leichter steuern zu können.
Bei scharfen Kurven kann es oft auch hilfreich sein, mit der hinteren Hand den Schlitten nach aussen zu ziehen. Für eine Rechtskurve wird der rechte Fuss verwendet und gegebenenfalls zieht die linke Hand den hinteren Teil des Schlittens nach links aussen. Ein Holzschlitten kann auch durch die Verlagerung des Körpergewichts ge-
Zum schnellen Anhalten den Schlitten nach vorne oben ziehen.
lenkt werden. Dies erfordert jedoch einiges an Übung und Erfahrung, da – bedingt durch die starre Bauweise des Schlittens – der Druck mit den Füssen auf die Kufen bei gleichzeitiger Verlagerung des Körpergewichts nicht möglich ist (siehe dazu Kapitel Fahrtechnik bei einem Rodel). Ausserdem besteht die Gefahr, dass der Schlitten kippt und man mitsamt dem Gerät umfällt. Denn durch die hohe Sitzposition auf einem Schlitten erhöht sich der Schwerpunkt des gesamten aus Schlitten und Fahrer(n) bestehenden Systems. Jede vertiefte Sitzposition, am besten mit einer tiefer gelegten Sitzmatte, erhöht nicht nur den Fahrkomfort, sondern auch die Lenkbarkeit des Schlittens in Kurven. Ausserdem werden durch den niedrigeren Schwerpunkt die Gefahren des Umkippens und des Abrutschens vom Schlitten verringert.
Bremstechnik eines starren Schlittens
Man bremst einen starren Schlitten, indem die Knie angewinkelt und beide Füsse rechts und links neben den Kufen flach auf den Schnee gedrückt werden. Diese Bremstechnik setzt jedoch voraus, dass man sehr gute Winterschuhe mit starkem Profil oder eine Bremshilfe benutzt (siehe Kapitel Ausrüstung/Bremshilfen). Mit dieser Technik lässt sich langsam und gleichmässig bremsen. Muss man jedoch schnell zum Stehen kommen, weil eine scharfe Kurve kommt oder ein Hindernis (z. B. ein gestürzter Schlittler) auf der

21
Gegenüberstellung Schlitten – Rodel / Fahrtechnik
Bahn liegt, dann unterstützt man das Bremsen, indem man den Schlitten an den Holmen mit beiden Händen gleichzeitig nach vorne hochzieht. Gleichzeitig verlagert man das Körpergewicht etwas nach hinten, damit sich die Kufenenden tief in den Schnee pflügen.
Die allgemein übliche Bremsweise mit den Absätzen kann zwar wirkungsvoll sein, ist aber auch gefährlich, da es bei den Wellen und Buckeln, die nach kurzem Gebrauch auf einer Schlittelbahn entstehen, zum «Verreissen» der Beine beziehungsweise zu extremen Belastungen der Gelenke und Knie kommen kann. Durch falsche Bremstechniken werden jedes Jahr Tausende vermeidbare Unfälle provoziert.

Rodel
Der Rodel (eigentlich weiblich «die Rodel», in der Schweiz jedoch «helvetisiert» als «der Rodel») stammt ursprünglich aus Österreich beziehungsweise Südtirol / Italien und ist die Weiterentwicklung des klassischen Holzschlittens. Er ist ein spezifisch für die sportliche Fahrweise entwickeltes Gerät, das besser zu steuern, bequemer und vor allem auch schneller ist.
Bei einem Rodel sind die Kufen beweglich montiert und verfügen – je nach sportlichem Verwendungszweck – über eine mehr oder weni-
22
Sportrodel
Bespannte und tiefer liegende Sitzmatte
Kufe
Bewegliche Holme
ger starke Neigung der Schienen nach innen. So weist ein guter Touren- oder Freizeitrodel eine maximale Neigung der Stahlschienen von 18 Grad auf. Bei einem Sportrodel kommt die Neigung auf 24 Grad. Dieser Neigungswinkel kann bei internationalen Sportwettkämpfen mit Rennrodeln – welche auf einer Natureisbahn (Unterschied zwischen den verschiedenen Schlittelbahntypen siehe unten) gefahren werden – bis zu 45 Grad erreichen.
Im Gegensatz zum Schlitten, bei dem beide Kufen durch die Querjoche fest miteinander verbunden sind, hat ein Rodel beim vorderen Querjoch eine bewegliche Verbindung, somit ein flexibles Holzgerüst, bei dem die Kufen lose verbunden sind. Speziell der Sitz besteht nicht aus starren und harten Holz leisten wie bei einem Schlitten, sondern ist mit einem flexiblen Material bespannt. Die Sitzplane ist in der Regel tiefer gesetzt, der Schwer punkt somit ebenfalls tiefer und dadurch kann man nicht vom Sitz rutschen. Ein bespanntes Sitztuch bietet den Vorteil, dass der Rodel Schläge und Wellen der Schlittelbahn besser absorbiert und wie eine Federung funktioniert.
Aufgrund dieser Bauweise bietet ein Rodel ein völlig anderes Fahrgefühl, eine höhere Geschwindigkeit und vor allem aber mehr Sicherheit. Denn durch die tiefer liegende Sitzposition fliegt man nicht vom Schlitten oder rutscht oder driftet in die Kurve, wie auf einem

23
Schiene auf der Kufe
Gegenüberstellung Schlitten – Rodel / Fahrtechnik
Schlitten mit hoher Sitzposition, sondern man nimmt die Geschwindigkeit aus der Kurve mit. Dadurch erhöht sich die Fahrfreude um ein Vielfaches.
Ein Rodel ist nicht nur leichter lenkbar, spurtreuer und schneller als ein Davoser, sondern auch rückenschonender und damit vom gesundheitlichen Aspekt her zu bevorzugen. Ein guter Rodel besitzt mit schräggestellten Kufen, auf denen die Stahlschienen montiert sind, verschiedenste Möglichkeiten, sich dem Fahrbahnbelag einer Schlittelbahn anzupassen. So ist bei einer harten oder teilweise vereisten Bahn eine steilere Kufenneigung für das flottere Fahren entscheidend. Hingegen gleitet es sich bei einer weichen Schneefahrbahn mit einer eher flacheren Kufe oft besser.
Durch Gewichtsverlagerung wird ein Rodel gesteuert.
Eine sportliche Fahrweise bedingt eine gute Technik.
Zum Anhalten stets mit beiden Füssen flach in den Schnee drücken.
Vor der Kurve anbremsen, also mit beiden Füssen flach auf den Schnee drücken.




24
Fahrtechnik eines Rodels
Grundsätzlich ist auf einem Rodel die Rückenlage am besten geeignet. Niemals auf dem Bauch liegend mit dem Kopf voran fahren! Ein Freizeit- oder Tourenrodel kann auf längeren Abfahrten auch sitzend gefahren werden, ein Sportrodel hingegen stets nur liegend.
Die richtige Fahrtechnik beginnt mit der optimalen Sitzposition. Man sitzt eher im hinteren Bereich der Sitzfläche und die Beine werden nach vorne ausgestreckt. Diese liegen locker neben den vorderen Längsholmen des Rodels. Eine Hand hält den Lenkriemen, die andere hält den Längsholm des Rodels. In dieser Sitzposition kann man optimal lenken und bremsen und hat bei Hügeln und Buckeln das Gerät stets im Griff.
Die Kurvenfahrt unterscheidet sich grundsätzlich von derjenigen mit einem starren Holzschlitten. Gelenkt wird durch Gewichtsverlagerung in die jeweilige Richtung. Zusätzlich wird die kurveninnenseitige Kufe mit Hilfe des Lenkseils leicht nach oben gezogen, um den Druck zu vermindern. Gleichzeitig erfolgt mit dem Fuss (im Knöchelbereich) ein Druck auf die Aussenkufe. Das kurveninnenseitige Bein wird leicht gehoben und übt keinen Druck aus. Das Gewicht des Oberkörpers verlagert sich in die Innenkurve und die Hand streift leicht über den Schnee. So bekommt man nicht nur ein Gefühl für die Kurve, sondern hat zusätzlich Stabilität. Die vertiefte Sitzposition erlaubt es, auch mit grösserer Geschwindigkeit die Kurve zu nehmen, denn der Rodel driftet oder rutscht dank seiner geneigten Kufen nicht weg.
Bremstechnik eines Rodels
Die Bremstechnik eines Rodels ist ähnlich der eines Schlittens. Bei der liegenden Fahrthaltung auf einem Rodel ist es wichtig, zuerst den Oberkörper aufzurichten, die Knie anzuwinkeln und beide Füsse flach in den Schnee zu drücken. Für eine Vollbremsung gilt das Gleiche wie bei einem Schlitten. Gebremst wird wie beim Autofahren vor der Kurve und nicht erst mittendrin. Ausserdem fährt man eine Kurve, speziell mit einem Rodel, nicht an ihrer Innenseite an, sondern nützt den vollen, äusseren Kurvenradius – stets von aussen nach innen.
25
/ Fahrtechnik
Gegenüberstellung Schlitten – Rodel

26
Tipp
Bei Vermietstationen werden neben den klassischen Holzschlitten auch vielfach Rodel oder Rennschlitten angeboten. Es gibt verschiedenste Typen von Schlitten oder Rodelschlitten, sei es mit harten Holzsitzen, bespannten oder gepolsterten Sitzflächen. Entscheidendes Kriterium dafür, ob ein Gerät als Rodel bezeichnet werden kann, ist die Beweglichkeit der Kufen. Testen Sie, bevor Sie ein Gerät mieten, mit beiden Händen, ob sich die Kufen im aufrechten Zustand hin- und herbewegen lassen oder ob diese starr sind. Je besser die Beweglichkeit, umso besser sind die Lenkbarkeit, der Fahrkomfort und damit schlussendlich auch die Fahrfreude.
Weitere Tipps
Wenn Sie einen klassischen Holzschlitten mit Holzleisten als Sitzfläche haben oder mieten, achten Sie darauf, eine zusätzliche Polsterung mit einem Kissen oder einer anderen strapazierfähigen, weichen Unterlage zu verwenden. Fixieren Sie diese aber mit guten Riemen oder Bändern am Schlitten, damit sie während der Fahrt nicht verloren gehen oder abrutschen kann.
Achten Sie darauf, dass Zugseil, Lenkriemen oder Lenkseil bei der Abfahrt weder zu lang noch zu kurz sind, denn dies würde rasch eine falsche Sitzposition bewirken.
Für das Ziehen eines Schlittens oder Rodels ist es angenehmer, wenn das Zugseil länger ist. Deshalb sollte ein schnell verstellbares Zugseil montiert sein, welches Sie bei der Abfahrt entsprechend verkürzen und beim Ziehen verlängern können.
27
Gegenüberstellung Schlitten – Rodel / Fahrtechnik
Infobox
Wettkampfmässiges Naturbahnrodeln
Schon von klein auf will man sich mit anderen messen.
Doppelsitzer bei einem Swiss Cup Rennen.


Natureisbahn für Rennsportler.
Es gibt drei Disziplinen beim sportlichen Wettkampfrodeln auf der Naturbahn: Sportrodeln, Rennrodeln und Hornschlittenrodeln. Alle diese Sportarten werden wettkampfmässig auf einer Natureisbahn ausgetragen. Rennrodel und Hornschlitten sind in Form eines Weltcups organisiert. Die wichtigsten Rennen der beiden Disziplinen sind die alle zwei Jahre alternierend stattfindenden Weltund Europameisterschaften in den angrenzenden europäischen Alpenländern. Bei den Sportrodlern sind vor allem die nationalen Rennen und der jedes zweite Jahr stattfindende grosse Preis von Europa von Bedeutung. In der Schweiz gibt es keine Natureisbahn, sodass Schweizer Athleten aller drei Disziplinen nur im benachbarten Ausland trainieren und Rennen fahren können. Im Anhang finden Sie eine Liste von Clubs und Vereinen, die regelmässige Lehrgänge, Trainings und die Teilnahme an nationalen und internationalen Rennen anbieten und organisieren. Jeder Club ist offen für Neumitglieder. Internationale Rennen und Trainings werden über den Rodelverband Swiss Sliding Naturbahn organisiert und koordiniert.

28
RANDERE UTSCHGERÄTE

Es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Hintern einen Hang hinunterzurutschen – von einem simplen Plastiksack über einen quietschbunten Rutschteller bis hin zu Plastik- oder Zipfelbobs. Auch kommen immer mehr neue Rutschgeräte in Mode, wie zum Beispiel der Snowtube, ein aufblasbarer Schwimmreifen.
Alle diese Rutschgeräte haben den Vorteil, dass zum Beispiel ein Plastikbob in der Anschaffung günstig, dank des Steuerrades vor allem für Kinder leicht lenkbar ist und sich allgemein gut bremsen lässt. Andere Geräte hingegen, wie Plastiksäcke oder Rutschteller,
29
Plastikschlitten/Plastikbob.
Snowtubing – bitte nur in dafür vorgesehenen Bereichen.

sollten nur auf absolut sicheren breiten Schneehängen mit grossem Auslauf und keinen festen Hindernissen, wie Bäumen, grossen Steinen oder Mauern oder in dafür vorgesehenen eigenen Bahnen verwendet werden. Denn solche Rutschgeräte sind hochgradig gefährlich, da sie schwer lenkbar sind und über keine Bremsen verfügen. Am besten ist es überhaupt, auf solche Rutschgeräte zu verzichten. «Rutscherli» und Rutschteller haben auf einer Schlittelbahn, erst recht auf einem Schlittelweg, auf dem auch Fussgänger und Wanderer unterwegs sind, nichts verloren. Wegen der oft schmalen Bahnbreite und des Andrangs von Schlittlern sind Rutschteller nicht kontrollierbar – damit gefährdet man sich selbst und andere.
Snowtubes sind zwar lustig, haben aber im eigentlichen Sinne nichts mit Schlitteln oder Rodeln zu tun und sollten auch nur im Bereich der dafür eigens vorgesehenen Bahnen und Parks verwendet werden. Auf alle Fälle haben Snowtubes nichts auf Schlittelbahnen oder -wegen verloren, da sie dort eine grosse Unfallgefahr darstellen.
30