Strassenmagazin Nr. 522
1. bis 21. April 2022

davon gehen CHF 3.–an die Verkäufer*innen
Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Strassenmagazin Nr. 522
1. bis 21. April 2022

davon gehen CHF 3.–an die Verkäufer*innen
Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass
Immer mehr Menschen putzen für andere –zu Randzeiten und schlecht abgesichert.
Seite 8
VOM OBDACHLOSEN ZUM STADTFÜHRER
Eine Podcastserie von Surprise in fünf Teilen
Episode 1
ABSTURZ
Episode 2
AUFSTIEG
Episode 3
CHEFIN
Episode 4
KOMPLIMENT
Episode 5
PREMIERE

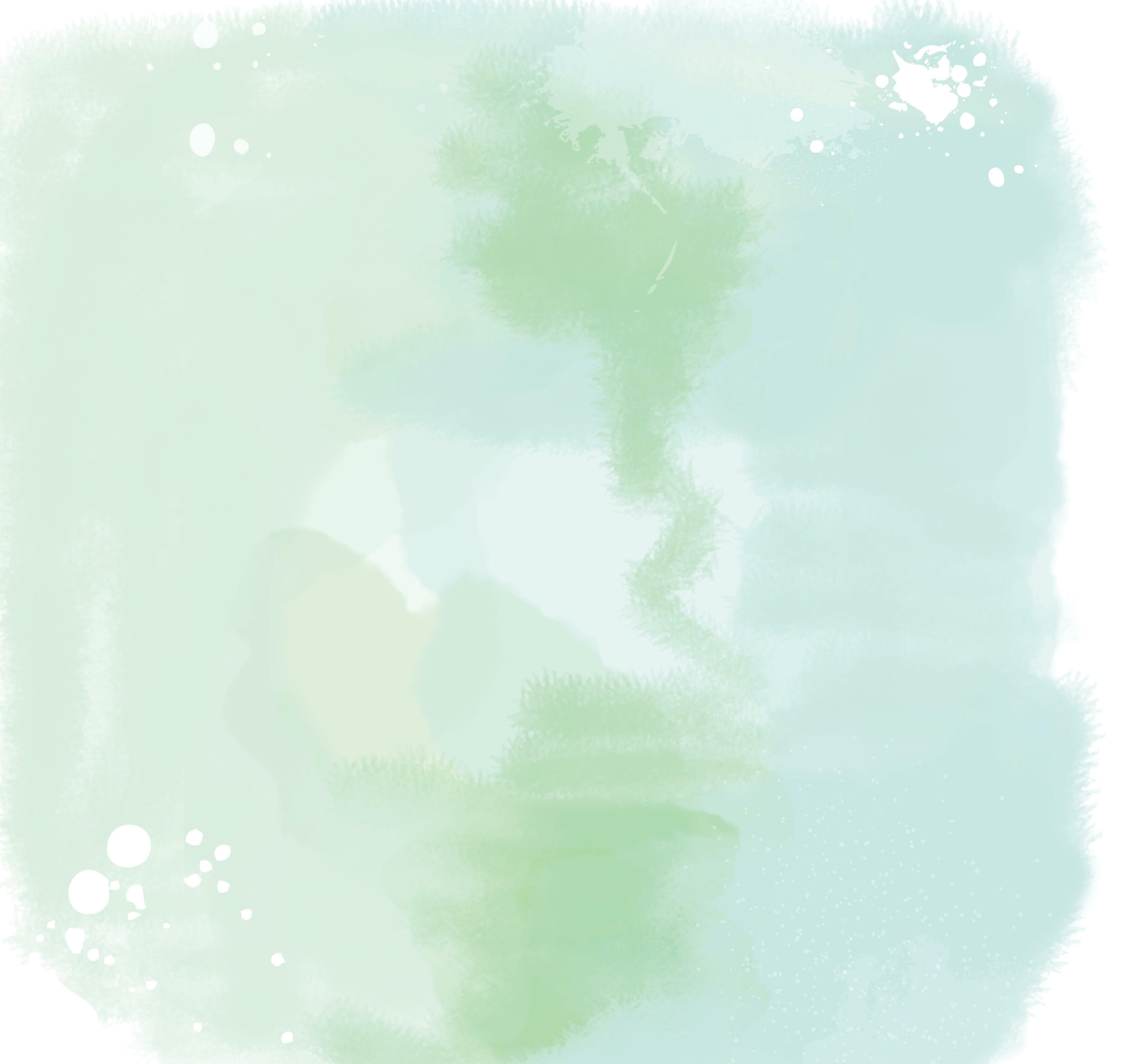
Editorial
Ich bezahle seit über fünfzehn Jahren jemanden dafür, dass meine Wohnung gereinigt wird. Derzeit macht dies eine Frau aus Eritrea. Sie ist bei einer Firma angestellt, die auf die Fairness ihrer Anstellungsverhältnisse achtet. Das war mir wichtig. Sicher auch weil ich damit mein schlechtes Gewissen beruhige, dass ich überhaupt jemanden auf diese Weise für mich arbeiten lasse. Noch dazu eine Schwarze Frau. Das reproduziert koloniale Bilder und das ist falsch. Allerdings hat sie wahrscheinlich aufgrund von Ausbildung, Sprachkenntnissen und rassistischen Strukturen auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen auf einen anderen Arbeitsplatz, und das kann ich nicht im Alleingang ändern. Ein ethisches Dilemma.
Es gehört zu meinem Bild einer emanzipierten Frau, dass ich arbeite und unabhängig bin. Dafür lasse ich mein Kind fremdbetreuen und leiste mir Hilfe im Haushalt. Ich könnte natürlich auch selbst putzen. Auch wenn ich es nicht besonders gern tue und mit meiner Arbeit, den ehrenamtlichen Engagements und dem Kind schon oft am Limit meiner Kräfte bin. Ich rede mir ein, ich würde die Zeit, die ich durch das
4 Aufgelesen
5 Was bedeutet eigentlich …? Sozialpartnerschaft
5 Fokus Surprise Wandel ermöglichen
6 Verkäufer*innenkolumne Ping Pong
7 Die Sozialzahl Gute Betreuung im Alter für alle
8 Serie Die Unsichtbaren
9 Neue Diener*innen
10 Porträt einer Reinigungsfrau
13 Daten und Fakten
14 «Vieles im rechtlichen Graubereich»
16 Biodiversität Der Klimawandel und die Sechsbeiner
Auslagern des Putzens gewinne, sinnvoller investieren. In meiner Welt heisst das meist: in mehr Arbeit. Selten auch mal in Freizeit. In Wirklichkeit kann man sich darüber streiten, ob dies sinnvoller ist – und für wen.
Menschen wie meine Reinigungsfachangestellte arbeiten im Verborgenen. Sie sind zwar systemrelevant, wie wir dies seit Covid-19 nennen, aber ihre Arbeit erhält nur wenig gesellschaftliche Wertschätzung, hat wenig Prestige. Und weil sie noch dazu kaum im öffentlichen Raum stattfindet oder nur zu Randzeiten, werden diese Arbeitnehmer*innen zu Unsichtbaren. Es ist eine Art neo-feudale Struktur, die sich da etabliert, vorangetrieben von einer Mittelschicht, die es sich leisten kann und sich selbst über das gesellschaftliche Ansehen ihres Berufes definiert, und einem Arbeitsmarkt, der diese Möglichkeit bietet.
SARA
WINTER SAYILIR Redaktorin
Wir widmen solchen Arbeitsverhältnissen eine grossangelegte Serie, die monatlich erscheint und in dieser Ausgabe startet. Mehr lesen Sie ab Seite 8.

20 Sozialversicherungen Thomas Gächter zum IV-Skandal
22 Ukraine Unser Bild vom Krieg
24 Kino Kein Raum zum Träumen

25 Buch Erzähltheater auf Papier
26 Veranstaltungen
27 Tour de Suisse Im Egghölzli
28 SurPlus Positive Firmen
29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren
30 Surprise-Porträt «Ich bin lieber unabhängig»
Auf g elesen
News aus den 100 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.


Über 200 000 Menschen sind bereits aus der Ukraine nach Ungarn geflohen. Mitarbeiter*innen der ungarischen Strassenzeitung Fedél Nélkül arbeiten direkt in der Versorgung der Ankommenden mit. «Sich um Obdachlose und um Flüchtende zu kümmern, mag von aussen sehr ähnlich erscheinen. In Wirklichkeit ist letzteres sehr komplex: Wir sprechen meist nicht dieselbe Sprache, die Ankommenden haben noch nie

Eindrücke aus einer behelfsmässigen Notunterkunft in Vásárosnamény an der ukrainisch-ungarischen Grenze von Anfang März.


FEDÉL NÉLKÜL, BUDAPEST
in einer Notunterkunft übernachtet, medizinische Versorgung ist nicht einfach zu bekommen», sagt Chefredaktor Róbert Kepe. «Tausende Bürger*innen kommen zur Grenze, um zu helfen. Das ganze Land hat sich zusammengeschlossen. Da ist es extrem unangenehm, dass unsere Zentralregierung und die politischen Parteien dasselbe machen wie immer: Ineffizient arbeiten und nutzlose Erklärungen abgeben.»
Wörterbuch
Der Staat bezieht verschiedene Verbände in die Gesetzgebung mit ein. Ziel ist es, Interessengegensätze durch Konsens zu lösen. Auch in der Umsetzung können Organisationen behilflich sein, etwa sind die Bauernverbände für den Vollzug der staatlichen Landwirtschaftspolitik zuständig.
Bekannteste Form dieser Zusammenarbeit ist die Sozialpartnerschaft: Um Kampfmassnahmen wie Streiks oder Demonstrationen zu verhindern, suchen der Arbeitgeberverband und Gewerkschaften einen Konsens. Meistens geht es hierzulande um die Ausarbeitung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV). Die Sozialpartner verhandeln dabei weitgehend autonom, der Staat tritt nur als Schlichter auf.
Sozialpartnerschaften gehen zurück auf das 1937 geschlossene Friedensabkommen zwischen Gewerkschaften und den sogenannten Patrons in der Metall- und Maschinenindustrie. Eine weitreichende Folge dieser Annäherung war der Wandel der gewerkschaftsnahen Sozialdemokratischen Partei (SP) von einer klassenkämpferisch-oppositionellen zu einer reformistischen Partei.
Der Einfluss von Interessenverbänden auf die Politik war bis in die 1980erJahre sehr gross. Seither kämpfen die Verbände mit dem Verlust von Mitgliedern. Gewerkschaften leiden an der Individualisierung und der Auflösung von soziokulturellen Milieus. Firmen wiederum setzen in Zeiten der Globalisierung zunehmend auf Lobbying. Trotzdem sind Sozialpartnerschaften in der Schweiz im Vergleich mit dem Ausland nach wie vor stark. Denn die direkte Demokratie garantiert «referendumsfähigen» Interessengruppen grossen Einfluss, selbst wenn deren Mitgliederbasis schwindet. EBA
Quelle: Klaus Armingeon: Korporatismus. In: Wörterbuch der Sozialpolitik. Zürich und Genf, 2020.
«Sichtbarkeit
ermöglicht gesellschaftlichen Wandel»: Nicole Amacher.

Fokus Surp rise
Mit diesem Heft startet Surprise eine Serie über Menschen, die mitten unter uns sind, die wir aber kaum wahrnehmen. Armut macht unsichtbar – das höre ich auch von unseren Surprise-Verkäufer*innen, Stadtführer*innen, Chorsänger*innen und Strassenfussballer*innen immer wieder. Die meisten von ihnen standen einmal mit beiden Füssen mitten im Leben, bis Schicksalsschläge, Krankheit, Sucht, Gewalt oder Krieg sie aus der Bahn warfen. Andere hatten von Geburt an wenig Chancen auf ein Leben in geraden Bahnen. Deshalb hat es sich Surprise zur Aufgabe gemacht, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und Sichtbarkeit zu erzeugen. Sei es auf der Strasse beim Heftverkauf, an den Sozialen Stadtrundgängen, bei Chorauftritten, Fussballspielen oder auch auf Podien, an Hochschulen und in den Medien – «unsere» Leute sprechen für sich selbst und wir unterstützen sie dabei. André Hebeisen beispielsweise hat den Mut, sich auf der Strasse zu exponieren und seine Geschichte zu erzählen. Der Thuner arbeitete jahrelang als Disponent bei einer grossen Baufirma. Die Beförderung zum Abteilungsleiter brachte derart viel Verantwortung und Druck mit sich, dass er versuchte, den Stress mit Alkohol in den Griff zu bekommen. Dann kam das Burnout, die totale Überforderung. Er verlor seinen Job, und es folgten Klinikaufenthalte, Arbeitsin-
tegrationsprogramme und Alkoholabstürze. «Ich war plötzlich ein Niemand», sagt er heute. Und doch: «Die Anonymität hat mir auch geholfen, wieder zu mir zu finden.» Als ihm 2014 der Rausschmiss aus einem betreuten Wohnheim drohte, machte es bei ihm auf einmal klick. Seither trinkt er keinen Tropfen Alkohol mehr, verkauft das Strassenmagazin und arbeitet als Surprise-Stadtführer in Bern.
«Als Strassenverkäufer und Stadtführer ist man ultimativ sichtbar – daran musste ich mich zuerst gewöhnen», sagt Hebeisen. Zu Beginn hatte er Mühe mit den Vorurteilen, mit denen er konfrontiert war. Sein Umfeld machte ihm klar, dass er als Sozialhilfebezüger und Surprise-Verkäufer in der Hierarchie ganz unten sei. Doch damit habe er einen Umgang gefunden. Heute ist er Teil des Berner Stadtbilds – man kennt und schätzt ihn. «Für meine Arbeit erhalte ich viel Lob und Anerkennung. Ich mache niemandem mehr was vor und schäme mich nicht mehr für meine Vergangenheit. Sie gehört zu mir, doch der Weg zurück ist unvorstellbar.»
Kürzlich schrieb uns eine Teilnehmerin: «Andrés Geschichte berührt, und er erzählt, ohne zu beschönigen, aber auch ohne auf die Tränendrüse zu drücken.» Vielleicht ändern solche Begegnungen etwas im Denken und Handeln mancher Zuhörer*innen, vielleicht schlägt sich dies wiederum hier und da als politisches Handeln oder zivilgesellschaftliches Engagement nieder.
Sichtbarkeit ermöglicht gesellschaftlichen Wandel, davon bin ich überzeugt.
NICOLE AMACHER, Co-Geschäftsleiterin Surprise

Verkäufer*innenkolumne
Ping. Pong. Hin und zurück. Nehmen und geben. Ping. Pong. Päng, welch Highlight!
Das sage ich Ihnen, liebe*r Leser*in. Das sage ich mir, Schreiberlehrling. Denn mir obliegt die Umsetzung. Bim Surprise-Värchaufe. Mit Schtammchunde. Stammkunden sind nämlich aus dem Gedächtnis abrufbar. Ich kann fürs Danken denken. Etwas aushecken: Eine Überraschung. Surprise!
Und was gebührt IHNEN nun? Nach zwei Freundlichkeiten: Sie schenken Geld und, mit Lesen, Zeit.
Ihnen gebührt mein nächster Gedanke (den ich noch nicht kenne. Bin sälber gwundrig!).
... wow, ich han’s: «Irgendwo auf dieser Welt ist jemand ausschliesslich für Sie da. Jemand aus Fleisch und Blut. Jemand in Ihrem Bewusstsein. Oder darunter.» Ich schlage vor: Vergegenwärtigen Sie sich das beim nächsten Verfluchen des Lebens.
Ping-Pong. Ich wollte das Spiel vor 16 Jahren bei meinem Surprise-Start konsequent spielen. Die ersten rund 200 Käufer*innen versuchte ich mir zu
merken. Mit Merkstütze auf Papier. Und ich verbrachte die ganze Verkaufszeit mit Erinnerungs-Training. Weniger wäre mehr gewesen. Es hätte genügt, mit einigen wenigen das Spiel zu spielen. So überforderte ich mich. Der Ball ging verloren. Jetzt suche ich ihn wieder. Will mer es Chund*innehäftli zuatue. Für es paar Lüüt wonich märk: Dia bruuchet de Schport genauso wianich.
NICOLAS GABRIEL, 56, verkauft Surprise in Zürich auf der Achse Rudolf-Brun-Brücke/ Uraniabrücke.
Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und Stephan Pörtner erarbeitet. Die Illustration zur Kolumne entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.
Die Schweiz ist von einer guten Betreuung im Alter für alle noch weit entfernt. Es besteht aber spürbar ein öffentliches Interesse, die Unterstützung im Alter für alle zu gewährleisten und neben der Hilfe und Pflege vor allem auch die Betreuung für vulnerable ältere Menschen abzusichern.
Was dies kosten würde, zeigt eine Studie des volkswirtschaftlichen Beratungsbüros BSS, die im Auftrag der Paul Schiller Stiftung erstellt wurde. Gute Betreuung richtet sich konsequent an den Bedürfnissen und dem Bedarf der älteren Menschen aus. Gute Betreuung hilft bei der Alltagsbewältigung, gewährleistet eine psychosoziale Unterstützung und vermittelt Sicherheit. All das braucht Zeit, und die fehlt vielerorts, zuhause und im Heim. Die Untersuchung zeigt, dass rund 157 000 Menschen in stationären Einrichtungen einen Mehrbedarf an guter Betreuung von 50 bis 70 Minuten pro Tag haben. Dies entspricht 6 bis 9 Millionen zusätzlichen Stunden aus Sicht der Leistungserbringer für das Jahr 2018. Auch ältere Menschen, die noch daheim leben, benötigen mehr Betreuung, selbst wenn sie schon Leistungen der Spitex beziehen oder von Angehörigen unterstützt werden. Allerdings hält sich der zusätzliche Zeitaufwand in Grenzen. Er bewegt sich zwischen 8 und 30 Minuten pro Tag und Person. Das ergibt einen Mehrbedarf an Betreuung von 8 bis 19 Millionen Stunden pro Jahr. Geht man davon aus, dass dieser Mehrbedarf im
Einschätzung Mehrbedarf an guter Betreuung
Alter durch gut ausgebildete Fachpersonen geleistet werden sollte, ergibt dies einen zusätzlichen Aufwand für den Sozialstaat von 0,8 bis 1,6 Milliarden Franken für das Jahr 2018.
Die Studie zeigt: Betreuung im Alter kostet. Besonders wenn sie in guter Qualität – also in einem umfassenden und individuell ausgerichteten Betreuungsverständnis – umgesetzt wird und allen älteren Menschen zugänglich sein soll. Wenn diese Kosten vollständig von der öffentlichen Hand übernommen würden, stellt sich die Frage: Ist das viel oder wenig im Vergleich zu anderen Ausgaben, die wir in der Schweiz jährlich tätigen?
1,6 Milliarden Franken für gute Altersbetreuung entsprechen rund drei Prozent aller Ausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden für die Soziale Wohlfahrt oder rund 10 Prozent der Ausgaben für die Langzeitpflege. Anders sehen die Relationen aus, wenn man an mögliche Finanzierungsquellen denkt.
1,6 Milliarden für gute Betreuung im Alter machen dann 50 Prozent der Ergänzungsleistungen zur AHV oder rund 300 Prozent der Hilflosenentschädigung aus. Das wird so nicht kommen. Die älteren Menschen, die es sich leisten können, werden sich an der Finanzierung beteiligen müssen. Doch vulnerablen älteren Menschen sollte die gute Betreuung kostenlos gewährt werden. Die Betreuung im Alter ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung, die mit wachsender Dringlichkeit nach Antworten verlangt.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Ambulant:
Ambulant: Personen ohne Unterstützung, aber mit Bedarf

Serie: Die Unsichtbaren Wer sind die Menschen, an welche die Schweizer Mittelschicht immer mehr Arbeiten dele giert? Und wieso tut sie das?
Eine Artikelreihe über neo-feudale Strukturen und ihre Hintergründe.
TEXT KLAUS PETRUS FOTO DANIEL SUTTER
Zwar sind sie vorbei, die Zeiten von Butlern und Kammerzofen. Und doch tauchen sie in anderer Gestalt wieder auf: als Kinderfrauen, Reinigungskräfte, Pizzakuriere, Altenpflegerinnen, Hausgärtner, Dogwalker oder im Beautybereich. Aber auch als Erntehelfer, Kantinenpersonal, Müllmänner, als Bettenschieber im Spital oder als Billigarbeiterinnen im Onlinehandel. In Zeiten von Corona bekamen manche dieser oft verkannten Arbeiten plötzlich Aufmerksamkeit und den Menschen dahinter wurde applaudiert. In aller Regel aber bleiben sie unsichtbar, viele dieser Jobs werden von Frauen mit migrantischem Hintergrund ausgeführt, sie arbeiten unter prekären Bedingungen, stehen sozial am Rande unserer Gesellschaft. So unterschiedlich die Arbeiten sind, eines scheint ihnen gemeinsam: Es sind Tätigkeiten, die manche Leute nicht selber verrichten wollen, weil sie vielleicht zu bequem sind oder weil sie ihre Zeit in anderes investieren möchten oder vielleicht auch müssen – in ihren «eigentlichen» Job etwa, in die Familie oder den Freundeskreis, in Weiterbildung oder Hobbys. Meist ist damit eine Wertigkeit verbunden: Um uns den vermeintlich wichtigen Dingen zu widmen, lassen wir die angeblich unwichtigen andere erledigen. Das gilt nicht bloss auf individueller, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene: Gerade Tätigkeiten, die mit der Beseitigung von Schmutz zu tun haben – der Ausdruck «Drecksarbeit» zeugt noch davon –, sind für uns oft mit einem sozialen Makel behaftet, und wir schieben sie von uns.
Wir widmen diesem Phänomen der Auslagerung und des Abschiebens von Arbeit diese mehrteilige Serie mit dem Titel «Die Unsichtbaren». Den Auftakt macht der folgende Beitrag über die Reinigungsarbeit in Unternehmen und in privaten Haushalten – ein Sektor, der auch in der Schweiz seit Jahren massiv boomt.
Dabei geht es uns nicht so sehr darum, die Menschen, die derlei Arbeiten verrichten, «sichtbar» zu machen, wie das etwa in den Sozialwissenschaften oft versucht wird. Der Anspruch nämlich, Unsichtbare sichtbar zu machen –
oder ihnen, wie es auch gerne heisst, eine «Stimme zu geben» und «auf Augenhöhe zu begegnen» –, ist in vielen Fällen sowohl vermessen wie auch unangemessen. Denn nicht selten werden damit die gesellschaftlichen sowie politischen Verhältnisse ausgeblendet, die soziale Ungleichheit begünstigen. Wenn, um beim Beispiel zu bleiben, eine «Putzfrau» sichtbar machen einzig bedeutet, dass wir ihr fortan mehr Anerkennung «schenken», so ändert dies noch nichts daran, dass sie eine Arbeit verrichtet, die in den meisten Fällen schlecht bezahlt sowie sozial ungenügend abgesichert ist. Genauso wird damit die Tatsache ignoriert, dass es in unserer Gesellschaft offenbar ein Verlangen nach asymmetrischen Beziehungen gibt, die durch Arbeit definiert sind – hier der Unternehmer, dort die Reinigungskraft – und die eine Spaltung der Gesellschaft in soziale Klassen zusätzlich fördern.
In unserer Serie werden wir demnach nicht bloss fragen, wer diese Menschen sind, welche die ausgelagerten Arbeiten verrichten, und was dies für sie bedeutet, sondern auch: Was heisst es für unsere Gesellschaft, wenn die Mittelschicht immer mehr Tätigkeiten delegiert, und wieso tut sie das? Offenbar spielen hier nicht allein individuelle Motive wie etwa Bequemlichkeit eine Rolle, sondern auch gesamtgesellschaftliche Prozesse. So wird als Grund für die Auslagerung von Tätigkeiten oft Überlastung oder Stress auf der Arbeit oder in der Familie genannt. Dies wiederum hat auch damit zu tun, dass sich die traditionellen Arbeitsmodelle verändern – flexiblere Arbeitszeiten, erhöhte Präsenz –, dass Frauen vermehrt ausser Haus arbeiten oder dass sich die familiären Bande zwischen den Generationen lockern, Grosseltern zum Beispiel die Betreuung der Kinder nicht mehr übernehmen und stattdessen vermehrt Nannys angestellt werden. Erfüllt die neue Dienerschaft hier am Ende infolge knapper oder zu teurer Betreuungsangebote eine kompensatorische Aufgabe, die womöglich der Staat zu übernehmen hätte? Bereits dieses Beispiel zeigt, wie komplex aber auch brisant das Thema der ausgelagerten Arbeiten ist.
«Wo ich arbeite, ist sonst niemand»
Beschäftigte im Reinigungssektor leisten die meiste Arbeit allein und im Verborgenen – und bleiben dadurch gesellschaftlich unsichtbar.
TEXT KLAUS PETRUS FOTO DANIEL SUTTER
Eigentlich kennen sich die beiden schon zwei Jahre, gesehen haben sie einander aber nur drei oder vier Mal: Sven T.*, 31, und Martina S.*, 38. Er ist Unternehmer, sie putzt. Wenn er von ihr redet, so nur in höchsten Tönen: zuverlässig sei sie, ordentlich und unkompliziert. Empfohlen wurde sie ihm von einem Freund, der schwöre auf Spanierinnen, im Internet seien die leicht zu finden, sagt Sven T.
Martina S., die allerdings aus Lissabon stammt, macht sich kaum Gedanken über Sven T. Seine Wohnung ist eine von vielen, die sie zweimal im Monat reinigt: vier Räume, eine grosse, offene Küche, zwei Badezimmer, wenig Möbel, teure Küchengeräte. Er wird viel Geld haben, mutmasst Martina S., die ebenfalls in der Stadt Bern wohnt, bloss ein wenig ausserhalb und bescheidener.
Ganz normal, sagt Sven T. auf die Frage nach dem Lohn: mittleres Kader, knapp 120 000 auf 100 Prozent. Er arbeitet vier Tage die Woche, seine Freundin, 28, mit der er die Wohnung teilt, ist 60 Prozent in der Verwaltung tätig; macht zusammen um die 150 000 pro Jahr. Genug, aber nicht luxuriös sei das: Miete, Steuern, Versicherungen, Klamotten, Ausgang, Auto, Fitness und Ferien, das läppere sich zusammen, rechnet Sven T. vor.
Martina S. bekommt von ihm 23 Franken die Stunde. Das Geld legt er ihr auf den Tisch, meist in einem Couvert. Einen Vertrag zwischen den beiden gibt es nicht. Überhaupt hat Sven T. erst gar nicht realisiert, dass er plötzlich in der Rolle eines Arbeitsgebers ist. All die Formulare, Sozialund Unfallversicherung, Ferien, der 13te: Das war dem Unternehmer zu kompliziert. Also hat er Martina S. schwarz angestellt. «Schliesslich profitiert auch sie davon. Mit den Abzügen käme sie kaum auf zwanzig pro Stunde, was nicht der Haufen ist», sagt Sven T.
92 000 Angestellte, laut Fachleuten verdienen über 200 000 Menschen ihr Geld mit Putzen, Tendenz in den letzten zehn Jahren massiv steigend (siehe Infografik, Seite 13). Diese Art der Auslagerung von Arbeit habe viel mit Wertigkeit zu tun, sagt Bartmann: «Um uns dem Höherwertigen widmen zu können, legen wir das Niedrigwertige in fremde Hände.» Für ihn zeichnet sich hier eine neo-feudale Wohlstandsgesellschaft ab. Dabei geht es ihm um nicht um jene «müssige Klasse», die es sich leisten kann, nicht zu arbeiten. Sondern um Menschen wie Sven T., die ihr Privileg, sich bedienen zu lassen, über Ausbildung und Leistung erworben haben – ein Privileg, das massive Ungleichheiten begünstige und letztlich ein Skandal sei.
Für Sven T. aber geht der Deal auf: «Ich gebe ihr Arbeit, sie verkauft mir Zeit.» Zeit, die er aus seiner Sicht in Wichtigeres investieren kann als in putzen, Hemden bügeln oder einkaufen. Zeit, die er in mehr Arbeit steckt, in seine Beziehung und seine Hobbys, Zeit aber auch, die er nutzt, um mal abzuschalten, um zu gamen, die sozialen Medien zu checken, Filme zu streamen.
«Um uns dem Höherwertigen widmen zu können, legen wir das Niedrigwertige in fremde Hände.»
Dass er eine Putzhilfe hat, findet Sven T. normal, fast all seine Bekannten machen das so. Ihm und seiner Freundin fehle schlicht die Zeit dafür. «Und ja», fügt er an, «wer putzt schon gerne?» Zeit oder, wie er auch sagt, Entlastung erkauft sich Sven T. auch in anderen Bereichen. Er hat für fast alles eine App, kauft online ein – Geräte, ein neues Regal, Lebensmittel beim Detailhändler, manchmal auch Kleider – und bestellt regelmässig Pizza oder Curry beim Kurier. Das meiste, was er braucht, bekommt er «on demand» und «in time». An die Menschen dahinter, das gibt Sven T. zu, denkt er kaum. Er sieht sie ohnehin nicht. Wie er auch Martina S. nie sieht.
CHRISTOPH BARTMANN
Aufreibend und zeitintensiv
Für all das hat Martina S., Mutter von zwei Kindern, kaum Ressourcen. Ihr Leben ist kompliziert, weil ihre Arbeit kompliziert ist. Acht Stunden die Woche ist sie bei einem Reinigungsunternehmen tätig, wo sie einen im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geregelten Mindestlohn von 19.20 Franken bekommt – 2022 und 2024 wird er um je zwei Prozent angehoben –, sie ist sozialversichert und hat Zuschläge auf Nachtschichten und Wochenendeinsätze. Dazu kommt fast ein Dutzend private Haushalte, die meisten reinigt sie zweimal pro Monat, im Schnitt à zwei Stunden. Hier arbeitet sie mehrheitlich schwarz, der Stundenlohn beträgt zwischen 22 und 30 Franken bar auf die Hand. Manche Kund*innen bestehen auf einem regulären Arbeitsvertrag, dann arbeitet sie nach Abzügen schon mal für unter 20 Franken. Früher hat sich Martina S. über Agenturen angeboten. Damit hat sie aufgehört, seit sie von den horrenden Provisionen weiss; einmal verlangte die Agentur vom Kunden 32 Franken, sie selbst hat bloss 21 Franken bekommen. Heute bietet sie sich über Vermittlungsplattformen an oder wird, wie im Fall von Sven T., weiterempfohlen.
Vermutlich ist Sven T. keine Ausnahme, sondern die Regel. Der Historiker Christoph Bartmann redet geradezu von einer Rückkehr der Dienerschaft, an die wir immer häufiger alles Lästige auslagern. Die Zahlen geben ihm recht: Allein im Reinigungssektor gibt es in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik
Diese Minijobs sind aufreibend und zeitintensiv. Teilweise fährt Martina S., natürlich ohne Entschädigung, über eine Stunde von Wohnung zu Wohnung. «Ich bin mal hier, mal dort, meine Tage sind zerstückelt, darunter leiden die Kinder – und meine Ehe.» Weil sie oft früh morgens und am Abend arbeiten muss und ihr Mann, auch er Portugiese, als Lagerist bei einem Grossunternehmen Schichten macht, komme es vor, dass sie einander

tagelang kaum sehen. Ihre beiden Kinder, Buben von 8 und 12 Jahren, gehen zur Schule. Kaum sind sie aus dem Haus, steigt Marina S. ins Auto und macht zwei Wohnungen. Kurz vor Mittag bereitet sie das Essen zu, am frühen Nachmittag macht sie den Haushalt, dann den Einkauf, bevor sie wieder «auf Tour» geht, wie sie das nennt.
Allein auf weiter Flur Druck bei der Arbeit spürt Martina S. vor allem beim Reinigungsunternehmen. Die Zeit fürs Putzen wird oft pro Fläche oder Raum bemessen, egal, wie viel Unordnung und Dreck sie vorfindet. Manchmal geht es lediglich um «Sichtreinigung», wo im Gegensatz zur Vollreinigung bloss grobe und sichtbare Verschmutzungen zu beseitigen sind. Was Martina S. besonders stresst. «So weiss ich nie, ob ich wirklich alles gesehen habe. Dann putze ich lieber gründlich und bleibe halt länger.» Nicht bloss aus Angst vor Kontrollen, die offenbar mit der Anonymisierung der Reinigungsarbeit zugenommen haben, sondern auch aus Stolz, wie Martina S. sagt: «Ich will, dass die Räume sauber sind.»
Am schlimmsten sei die Isolation. «Ich komme kaum noch mit Leuten in Kontakt», sagt Martina S. «Wo ich arbeite, ist sonst niemand.» Ihre beiden engsten Freundinnen putzen ebenfalls, und weil auch sie vor allem an Randzeiten zu tun haben, sehe man sich höchstens am Wochenende oder mal am späteren Nachmittag, vor der Arbeit. Für Nicole Mayer-Ahuja, Soziologieprofessorin an der Universität Göttingen, geht diese Art der sozialen Vereinsamung mit der Privatisierung der Reinigungsarbeit einher. «Früher waren Putzhilfen vor allem im öffentlichen Sektor tätig, in Verwaltung und Schulen etwa, sie arbeiteten zu normalen Zeiten, gehörten zur Belegschaft, wurden zu Firmenessen eingeladen. Heute sind sie bei privaten Firmen angestellt, arbeiten zu Randzeiten oder nachts und stehen unter enormem Zeitdruck» (siehe Interview, Seite 14). Teilweise werben Unternehmen der Branche – inzwischen vergeben 95 Prozent der Schweizer Unternehmen die Reinigung an Privatfirmen – mit «unsichtbarer Reinigung». Dahinter steht das Versprechen, die Kundschaft nicht durch die Anwesenheit der Reinigungsangestellten zu stören. Die Spitze der Unsichtbarkeit sieht Mayer-Ahuja in Privathaushalten, die ihre Putzhilfen unter prekären Bedingungen oder schwarz anstellen. «Wer so arbeiten muss, darf nicht gesehen werden und kommt sozial gar nicht mehr vor.»
Auch Sven T. räumt ein, er fühle sich wohler, wenn er Martina S. nicht begegnet, während sie bei ihm die Küche aufräumt oder das Klo putzt: «Nur, was ist die Alternative?», fragt Sven T. «Ich könnte sie regulär anstellen. Oder ihr mehr Geld geben. Aber sonst? Sicher habe ich dann und wann ein schlechtes Gewissen, und manchmal frage ich mich, ob das wirklich richtig ist: diese Kluft zwischen denen, die die Drecksarbeit machen, und uns, die fein raus sind.»
Martina S. hat sich lange geschämt. «Dass ich putze, wussten nicht einmal Freunde von mir.» Auch den Kindern gegenüber hatte sie ihre Arbeit verheimlicht. Früher wollte sie einmal Coiffeuse werden. Heute stört ihr Beruf sie nicht mehr. «Ich mache eine Arbeit, die für andere wichtig ist. Das ist okay. Und ich verdiene mein eigenes Geld.»
* Namen geändert
Was Privatpersonen tun können, um ihre Reinigungskräfte sozial abzusichern.
Der Reinigungssektor boomt. Auf der schweizweit grössten Onlineplattform «homeservice24» bieten rund 72 000 Menschen ihren Service an, das Unternehmen wächst jährlich um bis zu 20 Prozent. Gerade Plattformen wie diese stehen aber in der Kritik. Der Grund: «Sie treten nur als Vermittler und nicht als Arbeitgeber auf und stehlen sich damit aus der Verantwortung gegenüber den Reinigungsangestellten», so Stefanie von Cranach von der Gewerkschaft UNIA. Das Arbeitsverhältnis wird zwischen Privatperson und Putzhilfe geregelt, was zu Lohndumping führen und die Schwarzarbeit begünstigen kann. Tom Stierli, CEO von «homeservice24», wehrt sich: «Wir informieren sowohl die Privatkund*innen über ihre Pflichten als auch die Putzhilfen über ihre Rechte.»
Von Cranach empfiehlt, sich bei Putzhilfen für Haushalte an Firmen zu halten, die als Arbeitsgeberinnen fungieren und mindestens dem GAV unterstellt sind. Dazu gehört etwa das Unternehmen «putzfrau.ch», der drittgrösste Player auf dem Reinigungsarbeitsmarkt. Andere Beispiele sind «Proper Job», die sich schweizweit für legale und faire Dienstleistungen in Haushalt und Reinigung einsetzen, oder Vermittlungskooperativen wie die 2021 in Zürich gegründete «Autonomia» oder die «Flexifeen» aus Basel, die für Reinigungsangestellte Nettostundenlöhne von 30 Franken, 5 Wochen Ferien, Sozialleistungen sowie ein geregeltes Arbeitspensum garantieren. KP
Die Unsichtbaren — eine Serie in mehreren Teilen
Teil 1/Heft 522: Reinigungspersonal
Immer mehr Menschen lagern unliebsame oder wenig angesehene Arbeiten an andere aus: Putzen, Ernte, Care-Arbeit. Weil sie können oder müssen. Wir möchten wissen, wer nun diese Arbeiten verrichtet und unter welchen Bedingungen. Und was dies für Folgen hat.
Knapp jede*r Achte leistet sich eine Haushaltshilfe.
Viele arbeiten ohne oder mit unzureichender sozialer Absicherung.
INFOGRAFIK MARINA BRÄM
Reinigungskräfte wurden
2019 registriert. Sie reinigen Hotels, Büros und Privathaushalte.
27%
Gutverdienende mit einem Einkommen von über 10 000 CHF pro Monat sind die häufigsten privaten Arbeitgeber*innen.
RestlicheGesamtwirtschaft: 25%
Gründe für Schwarzarbeit
Der Graubereich 72 Prozent arbeiten selbständig. Jedoch nicht korrekt versichert. Dies ist mit Risiken verbunden: für Arbeitnehmende, wie Arbeitgebende.
reinigen ohne Unfallversicherung. 100 Franken würde diese die Arbeitsgebenden im Jahr kosten.
Meinungsumfrage bei Arbeitgeber*innen, 2019 25%
reinigen ganz ohne soziale Absicherung. 50%
Weiblicher Anteil an restlicher Marktwirtschaft: 40%
Fast jede achte Person leistet sich eine Haushaltshilfe.
Zu hoher
Aufwand.
Bewusste unmoralische Handlung.
Illegale Arbeitsermöglichung.
Fehlende finanzielle Mittel.

wird im Durchschnitt für eine Haushaltshilfe monatlich ausgegeben. 250 CHF
Dilemma der Arbeitsmodelle 1 2 3
Agentur als Arbeitgeber*in
1 Stundenansatz für Kund*in: CHF 32–42
2 Stundenlohn für Reinigung: CHF 21–27
Schwarzarbeit:
3 Stundenlohn für Reinigung: CHF 22–30
«Es
Haus- und Familienarbeit an andere abzugeben, ist nicht neu. Nur sei heute der Druck auf die Mittelschicht, sich bedienen zu lassen, grösser geworden, sagt die Soziologin Nicole Mayer-Ahuja.
INTERVIEW KLAUS PETRUS
Nicole Mayer-Ahuja, immer mehr Menschen lagern Tätigkeiten an andere aus – vor allem Arbeiten, die ihnen unbequem sind. Entsteht da gerade eine neo-feudale Gesellschaft mit Heerscharen von Diener*innen?
Nicole Mayer-Ahuja: Dass Menschen es sich leisten können, gewisse Arbeiten nicht selbst zu verrichten, ist eigentlich nichts Neues. Typischerweise waren oder sind das Tätigkeiten, die unter die Haus- und Familienarbeit fallen, wie Putzen, Einkaufen, die Betreuung der Kinder oder älterer Familienmitglieder. Was heute anders ist: Immer mehr Menschen können nicht anders, sie müssen sich eine solche Auslagerung leisten.
Wie meinen Sie das?
Viele haben Jobs mit flexiblen Arbeitszeiten, was bedeutet, dass sie länger arbeiten, immerzu erreichbar sein müssen und so unter hohem Druck stehen. Da bleibt kaum noch Zeit, sich um den eigenen Haushalt, die Kinder oder den Hund zu kümmern. Das ist auch ein Grund, weshalb die Zahl derer, die Sie Diener*innen genannt haben, in den letzten Jahren rapide zugenommen hat. Auf der anderen Seite ist das Phänomen, über das wir hier reden, ein altes: Die Umwandlung von Haus- und Familienarbeit in Lohnarbeit begann bereits mit der Gründung von Krankenhäusern und Kinderkrippen. Allerdings handelte es sich dabei um Arbeit unter geregelten Bedingungen, also mit Arbeitsverträgen, mit einem Lohn, auf dessen Zahlung man sich verlassen konnte, und mit Schutz durch Sozialversicherung und Arbeitsrecht. Was wir heute haben, ist etwas ganz anderes: Viele der ausgelagerten Arbeiten bewegen sich rechtlich in einem Graubereich.
Und diejenigen, die sie verrichten, sind weitgehend unsichtbar. Ja, wobei diese Unsichtbarkeit unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Die Kurier*innen von Lieferdiensten gehören mit ihren Jacken und Rücksäcken bereits zum Stadtbild. Auch der Reinigungsdienst war früher sichtbarer. Die Angestellten waren im öffentlichen Sektor tätig – in Schulen zum Beispiel oder in der Verwaltung –, sie waren zu normalen Arbeitszeiten anwesend, gehörten zur Belegschaft, wurden zu Firmenessen eingeladen. Mit der Privatisierung der Reinigungsarbeit änderte sich alles.
Mit welchen Konsequenzen für die Arbeitenden?
Die Arbeitsbedingungen haben sich verschlechtert, es muss jetzt in kürzerer Zeit für weniger Geld mehr geputzt werden. Und weil die Privatfirmen ihre Angestellten zu Randzeiten oder in der Nacht einsetzen, werden diese immer unsichtbarer – gerade auch für die Leute, deren Räumlichkeiten sie reinigen. Was wiederum dazu führt, dass die Kontrollen zunehmen. So werden bewusst Krümel ausgelegt, um Putzhilfen zu bezichtigen, sie würden ihre Arbeit nicht ordentlich verrichten. Der nächste Schritt der Priva-
tisierung und Auslagerung der Reinigungsarbeit im grossen Stil passiert heute, hin zu den privaten Haushalten. Wer dort zum Beispiel unter prekären Bedingungen und ohne festen Vertrag arbeiten muss, vielleicht an der Steuer vorbei tätig ist oder Probleme mit Arbeits- oder Aufenthaltsgenehmigung hat, darf folgerichtig auch nicht mehr gesehen werden, denn das wäre ja strafbar. Er oder sie kommt sozial also gar nicht mehr vor.
Manchmal kann Unsichtbarkeit auch ein Schutz sein. Das stimmt. Wir reden hier von Arbeiten, die ein geringes gesellschaftliches Ansehen haben, denen teilweise sogar ein sozialer Makel anhaftet. Niemand erzählt gern, dass man putzen geht, man möchte nicht, dass die eigenen Kinder darüber in der Schule reden. Dann ist man vielleicht ganz froh, wenn man bei der Arbeit nicht gesehen wird. Kommt hinzu, dass man kaum jemals dafür gelobt wird, dass man seinen Job toll gemacht hat. Im Gegenteil: Solche Arbeiten fallen uns nur dann auf, wenn sie nicht gut gemacht werden. Das darf nicht sein.
Umso mehr: Woher diese Scham?
Das ist in der Tat eine interessante Frage. Ich denke, es gibt seit jeher und weltweit Tätigkeiten, die mit Scham behaftet sind. Das sind oft Tätigkeiten, die mit Körperlichem zu tun haben, mit Schmutz oder Alter und Tod, Dinge, die wir gerne von uns weisen. Sie werden nach Möglichkeit an andere delegiert, die keine Wahl haben und diese «schmutzigen» Arbeiten verrichten müssen. Und doch, es gibt im gesellschaftlichen Umgang mit diesen Tätigkeiten grosse Unterschiede.
Woran denken sie?
Zum Beispiel an die Müllabfuhr: der Job ist hart, es riecht übel und ist dreckig. Und doch ist diese Arbeit einigermassen anerkannt. Die Müllmänner, wie wir sie nennen, sind sichtbar, sie haben Verträge, Mindestlöhne und eine starke Gewerkschaft hinter sich. Im Vergleich dazu die sozusagen weibliche Variante: eine Frau mit Minijob in einem privaten Reinigungsunternehmen, die sich nachts durch verlassene Gebäude putzt, oder eine Putzhilfe aus Polen oder Portugal, die in einem Privathaushalt für einen miesen Lohn schwarzarbeitet, die dadurch hochgradig abhängig ist und mit niemandem über ihre Arbeit reden darf. Die beiden Beispiele zeigen: Wir gehen als Gesellschaft mit schambehafteten Arbeiten sehr unterschiedlich um.
Und sie zeigen auch, wie man diese Arbeiten aufwerten könnte. In jedem Fall geht es dabei nicht nur um symbolische Anerkennung. Das haben wir jetzt in Zeiten von Corona gesehen, als den Menschen mit sogenannt systemrelevanten Berufen applaudiert wurde. Da ist zwar fortlaufend von Anerkennung die Rede,
Es muss jetzt in kürzerer Zeit für weniger Geld mehr geputzt werden.»

NICOLE MAYER-AHUJA, 49, ist Soziologieprofessorin an der Universität Göttingen mit Schwerpunkt Arbeit und Mitherausgeberin des Buches «Verkannte Leistungsträger:innen» (Berlin 2021).
nur darf diese nichts kosten. Doch auch Lohn ist nicht alles, wenn wir über die Aufwertung solcher Arbeiten nachdenken. Es geht auch um soziale Absicherung und kollektive Interessenvertretung.
Nach wie vor ist die Meinung verbreitet, man könne solche Arbeiten doch gar nicht gern machen – und also sei Wertschätzung auch nicht so wichtig.
Eine sehr verengte Sicht. Nehmen wir erneut den Reinigungssektor. Nicht wenige Frauen, die dort tätig sind, wollen ihre Arbeit ordentlich verrichten, sie möchten, dass die Räume gut aussehen.
Sie reden von Arbeitsethos?
Genau. Und das nutzen gewisse Firmen im Übrigen gezielt aus. Sie setzen ihre Angestellten unter enormen Zeitdruck, was dazu führt, dass diese die Arbeit nach ihren eigenen Standards nicht mehr zufriedenstellend ausführen können – also bleiben sie länger da und putzen ohne Bezahlung weiter.
Zurück zur Scham, nur auf der anderen Seite. Es fällt auf, dass viele Menschen, die unangenehme Arbeiten an andere auslagern, tendenziell ein schlechtes Gewissen haben. Es gibt sicher Leute, denen es unangenehm ist, dass andere Menschen ihre Hausarbeit übernehmen. Im besten Fall schlägt sich das darin nieder, dass sie ordentliche Arbeitsverträge abschliessen, nicht unterhalb des Mindestlohns zahlen, vielleicht sogar nach Wegen suchen, wie eine Haushaltshilfe sozialversichert werden kann. Andere greifen zum günstigsten Angebot, obwohl sie eigentlich mehr bezahlen könnten. Sie bleiben den Lohn schuldig, zahlen nicht weiter, wenn sie selbst in Urlaub fahren oder die Kollegin, die für sie arbeitet, krank wird, usw. Sie wollen ihr Geld lieber für anderes ausgeben und nehmen damit in Kauf, dass Leute unter prekären Bedingungen arbeiten müssen. Dann haben sie in meinen Augen allen Grund, sich zu schämen. Es gibt allerdings noch andere, strukturelle Gründe für diese Scham, und diese sind geschlechterspezifisch.
Was meinen Sie damit?
Die Idee, Frauen müssten zum Beispiel Haushaltsarbeiten unentgeltlich und sozusagen nebenher verrichten, ist nach wie vor präsent. Nun gibt es aber hierzulande immer mehr Frauen, die einer bezahlten Arbeit nachgehen, sei es in Teilzeit oder auch 100 Prozent. Das Eingeständnis, dass sie den Haushalt unter diesen Bedingungen nicht mehr selber machen können oder wollen, kann durchaus zu Scham führen – oder zumindest zu einem Konflikt mit der Rolle, die ihnen die Gesellschaft nach wie vor zuteilt.
Besserverdienende Frauen, die Haushalts- oder Familienarbeiten an andere Frauen auslagern – das soll die Schattenseite der Emanzipation sein? Korrekt ist, dass wir es mit einer Spaltungslinie zwischen Frauen zu tun haben, dass manche Frauen sich auf Kosten ihrer «armen Schwestern» Entlastung verschaffen: die dauerbeschäftigte Managerin hier, die migrantische Putzhilfe dort, um es plakativ zu sagen. Dafür aber die Emanzipation verantwortlich zu machen, wäre doch ziemlich schief. Erstens müssen wir uns dringend darüber Gedanken machen, wie Haushalts- und Betreuungsarbeiten unter den Geschlechtern gleichmässiger aufzuteilen sind. Auch hier stellen sich strukturelle Herausforderungen: Im männlich geprägten Arbeitsmarkt haben die Ausweitung der Arbeitszeiten sowie die Flexibilitätsanforderungen ebenfalls stark zugenommen. Somit wird es auch für Männer schwieriger, neben ihrem Job noch Haushalts- und Familienarbeiten zu übernehmen. Zweitens müssen wir uns ganz grundsätzlich überlegen, was uns Arbeit wert ist.
Und das bedeutet?
Dass viele ausgelagerte Arbeiten unter prekären Bedingungen stattfinden und damit derart günstig sind, hat auch damit zu tun, dass die gesetzlich regulierten, sozial abgesicherten Alternativen knapp sind oder gar nicht bestehen: Es hat keine Kitaplätze, das Pflegeheim ist zu teuer, usw. Im Vergleich dazu ist eine migrantische Putzhilfe oder Pflegerin – sarkastisch gesagt – sagenhaft billig zu haben. Der Staat müsste hier mehr Angebote zur Verfügung stellen oder bestehende besser unterstützen.

Biodiversität Klimaerwärmung, Asphalt und Landwirtschaft bedrohen die Insektenvielfalt. Doch manche Insekten begeben sich erst wegen dem milden Klima in die Schweiz – andere vermehren sich ungebremst. Ein paar warme Worte für die schöne Efeu-Seidenbiene und den oft geschmähten Borkenkäfer.
TEXT BENJAMIN VON WYL ILLUSTRATIONEN CHI LUI WONG
Sie sind einen Grossteil ihres Lebens lebendig begraben, und das ist auch gut so. Oft tief in den Sandkästen von Schweizer Kindergärten, weit tiefer, als Kinder spielen, liegen sie in den Nestern: Efeu-Seidenbienen im Larvenstadium. Zumindest wenn sie Glück haben, sind sie lebendig dort unten: Manche Bieneneier werden verdaut, bevor die Tiere schlüpfen. Denn in den Sandkastentiefen, in die nie Licht dringt, kann auch eine andere Spezies begraben sein: die Larven des Seidenbienen-Ölkäfers. Die Efeu-Seidenbiene hat sich, wie ihr Name schon sagt, auf Efeu spezialisiert. Der Seidenbienen-Ölkäfer hat sich, wie sein Name schon sagt, auf Seidenbienen spezialisiert. Beide Tiere sind erst in den letzten Jahrzehnten in die Schweiz eingewandert – die Biene wahrscheinlich wegen der Klimaerwärmung.
Menschen schauen ihre Katze an und glauben, sich in ihr zu erkennen. Wohl niemand vermenschlicht Insekten. Das hat zur Folge, dass viele Menschen nichts über Insekten wissen, dass auch die Menschheit insgesamt über sehr viele Arten sehr wenig weiss. Man kann nicht schützen und unterstützen, worüber man nichts weiss. Wer sich auf Insekten einlässt, merkt, wie anders diese Form von Leben ist. Jedes Insektenleben findet in Stadien statt. In seiner letzten Form – bernsteinfarbener Hinterleib, schwarzer Kopf – wirkt der Seidenbienen-Ölkäfer für Laien wie eine Kreuzung aus Ameise und Kakerlake. Doch zu leben beginnt er als Kleinsttierchen mit drei Klauen. Diese klammerten sich im letzten Herbst an Efeu-Seidenbienen und liessen sich in die Nester tragen. Dort essen die Ölkäfer erst die Bieneneier, dann deren Futter: ein Gemisch aus Pollen und Nektar, das die Bieneneltern für den Nachwuchs gesammelt haben.
Aus welchem Sandkasten graben sich Efeu-Seidenbienen, aus welchem Seidenbienen-Ölkäfer frei? Das zeigt sich im Spätsommer – wenn überhaupt jemand hinschaut. Besorgte Kindergärtner*innen schauen sicher genau: Die gelben Streifen der Seidenbienen leuchten – ist ihr Stachel wirklich harmlos? Bei den städtischen Betrieben von Schaffhausen winkt man ab. Wie vielerorts hat man dort bereits Erfahrung mit den ungefährlichen, «gern gesehenen» Bienen. Fünf oder sechs Kindergärten hätten vor zwei, drei Jahren gefragt, was sie mit den Sandkastenbienen tun sollen. Die Verunsicherung konnte zerstreut werden: Während der Tage, in denen sich die neue Bienengeneration
freigräbt, wird der Sand einfach für die Menschenkinder gesperrt. Vergangenes Jahr meldeten sich allerdings in Schaffhausen kaum Kindergärten. Hat etwa der Seidenbienen-Ölkäfer die Bieneneier geholt? Den kennt der verantwortliche Beamte noch nicht: «Bei den Insekten gibt es so einiges.» Der Käfer lebt noch nicht lange in der Schweiz. Die Efeu-Seidenbiene ist ebenfalls erst vor einigen Jahren aus Südeuropa zugewandert – und 1993 überhaupt erst als Spezies entdeckt worden. Die ersten Menschen in der Schweiz, vor deren Augen sie summte, dachten sich wohl: Eine Biene halt. Als wäre Biene gleich Biene! Ja, Hummeln – diese Nilpferde der Lüfte – erkennen alle. Aber sonst?
Ebenso still ist der Seidenbienen-Ölkäfer eingewandert. Den Bienen nachgereist, mitgereist, Jahr für Jahr, Generation um Generation aus Regionen, wo sandige Hänge zum Landschaftsbild gehören, in die Schweiz – wo Sand in der Regel eher in Sandkästen lagert. Nun ist auch er hier zuhause. Wie lange er wirklich schon hier ist, weiss niemand genau.
Der Seidenbienen-Ölkäfer folgt seinem Futter
Die Efeu-Seidenbiene und der Seidenbienen-Ölkäfer sind gekommen, weil sie sich im wärmer werdenden Klima wohlfühlen. «Wer hat den Schalter umgelegt?», fragt Urs Weibel, Kurator im Museum Allerheiligen. Niemand weiss, was der Auslöser war, dass sich die gerade erst entdeckte Efeu-Seidenbiene in die Schweiz, nach Deutschland und mittlerweile bis über den Ärmelkanal ausgebreitet hat. In Schaffhausen als Erstes beschrieben hat sie Weibel.
Dass ihr der Seidenbienen-Ölkäfer gefolgt ist, ist hingegen nachvollziehbar: Er ist komplett von ihr abhängig. In der Insekten-Fachzeitschrift Entomo Helvetica schrieb Weibel über seine Beobachtungen der Eiablage des Seidenbienen-Ölkäfers. Es ist ein Haufen Eier, sie sehen ein wenig wie klebrige Reiskörner aus, diese legt das Weibchen des Seidenbienen-Ölkäfers an einen Grashalm. Nach etwa zweieinhalb Wochen schlüpfen die «Triungulinen», die Larven mit den drei Klauen. «Zeitweise waren sie unruhig, streckten ihre Beine und krabbelten übereinander», schreibt Weibel. «Vermutlich» bilden sich aus den Hüllen der Ölkäfer-Eier Fäden. An denen hängen sie zusammengeknäuelt wie ein Pendel. Ob durch Duftstoffe oder über visuelle Anziehung:
Die Efeu-Seidenbiene (Colletes hederae) stammt aus der Gattung der Seidenbienen. Sie wurde erst 1993 als eigenständige Art beschrieben. Das Weibchen ist durchschnittlich 13 mm, das Männchen 10 mm gross. Die Brust ist dicht gelbbraun behaart, der Hinterleib besitzt breite, durchgehende Binden an den Enden der Hinterleibsringe, die bei frischen Tieren gelbbraun gefärbt sind.

Etwas an ihnen macht die Seidenbienenmännchen rollig. 30 von 30 zufällig Gefangenen waren bei Weibels Untersuchung mit der Ölkäferbrut befallen. Bedroht also der neuzugezogene Käfer die neuzugezogene Biene? Weibel verneint: «Das kommt in Wellen –der Bestand wird sich regulieren.» Wenn es in einem Jahr weniger Seidenbienen gibt, schaffen es auch weniger Ölkäfer übers Larvenstadium hinaus.
Menschen mögen Bienen. Vielleicht, weil sich die meisten gerne mit dem Wintervorrat der Honigbienen verköstigen. Menschen mögen keine Motten, die den Spiess umdrehen und ihre Babys mit unserem Mehl füttern. Menschen mögen Käfer. Dass diese als Larven weich und glibberig sind, überlegen sich die zweibeinigen Säugetiere nicht, wenn die hartbeschalten Sechsbeiner im Licht hübsch glänzen. Generell gilt: Menschen denken an Insekten, wenn sie für den Menschen etwas bedeuten. Die Schädlinge und Schönheiten fallen auf: Tagfalter und Kleidermotten; Borkenkäfer und Hirschkäfer. Seltener denken Menschen darüber nach, was ihre Lebensweise für Insekten bedeutet. Dabei verändern Landwirtschaft, Zersiedlung und Klimawandel das Leben von Tieren, die teilweise noch nicht einmal wissenschaftlich entdeckt sind.
In der Schweiz leben 437 Wirbeltiere + 4292 Pflanzen + bis zu 15 000 Pilze = weniger als Insekten. Bis zu 60 000 Insektenarten sind hierzulande zuhause, mehr als das andere Leben zu-
sammen. Allerdings sind wegen uns Menschen viele Insektenarten bedroht. Gemäss der «Krefelder Studie» ist die Anzahl der Fluginsekten in deutschen Naturschutzgebieten von 1989 bis 2015 um 75 Prozent gesunken. Ruhigere Töne entnimmt man der ersten umfassenden Studie zur «Insektenvielfalt in der Schweiz», die im letzten Herbst erschien. Darin werden auch allzu vereinfachende Medienberichte über eine angebliche «Insektenapokalypse» aufgenommen. Zwar lautet der Befund, die Situation sei besorgniserregend und zwei Drittel der Arten mindestens «potenziell gefährdet». Doch bei «einigen wenigen Insektenarten» gebe es «positive Trends» und manche Arten wanderten ein.
Der Sandkasten als Nische
Im Idealfall reguliert die Insektenwelt sich selbst. Sie hat aber weder mit Pflastersteinen gerechnet noch mit Zement, der die Lücken im Pflaster versiegelt. Auch nicht mit Asphalt und Beton. Ebenso kalkulierte sie nicht mit dem Ideal des BürstenschnittRasens, mit Fichtenwäldern im Flachland und dem menschgemachten Klimawandel. Manche Arten finden sich zurecht: Mehlmotten gefällt es in menschlichen Küchen. Die Grosse Holzbiene ist mit bis knapp drei Zentimetern eine der grössten heimischen Bienenarten. Sie galt lange als sehr selten – und ist nun in Mitteleuropa weitverbreitet. Sie nistet gerne im morschen

Holz von Gärten. Noch näher an die menschliche Architektur wagt sich die Töpferwespe, die ihr Nest vertikal an Hauswände zimmert. Die Nester sind massiv, hart, entstehen ganz ohne Baubewilligung.
Dass die Efeu-Seidenbienen statt in Lösswänden auch in Sandkästen nisten, ist ein schöner Zufall. Die Efeu-Seidenbiene hat eine Nische. Ihre Nische kann mit menschlicher Gesellschaft umgehen. Viele Arten aber sehen ihren Lebensraum schwinden: Seit 1900 sind in der Schweiz von 20 artenreichen Trockenwiesen 19 verschwunden. Von den Moorlandschaften ist weniger als ein Fünftel übrig. Ein Grossteil der Gewässer sind auf eine Weise begradigt und genutzt, dass sie Menschen genügen, aber dem tierischen Lebensraum zuwiderlaufen. Die Wälder haben sich im letzten Jahrhundert verändert: Viele Bäume werden lange vor ihrem natürlichen Lebensende gefällt; Fichten in tiefen Lagen angebaut.
Manchmal hat die menschliche Zivilisation die Nische von Insekten aber auch richtig aufgespreizt. Das passierte oft aus Versehen, auch in den Wäldern. Adrienne Frei schält ein Stück Rinde von einem liegenden Stamm. Darunter stehen und gehen sie, obwohl noch Eis auf dem Weiher in der Nähe liegt: die Borkenkäfer. Frei ist Forstingenieurin und spezialisiert auf Xylobionten – Käfer, die im Totholz wohnen. Einer von ihnen ist der Grosse Buchdrucker, Ips typographus, DER Borkenkäfer.
Der Seidenbienen-Ölkäfer oder Schwarze Pelzbienen-Ölkäfer (Stenoria analis) gehört zur Familie der Ölkäfer (Meloidae). In Mitteleuropa kommt er nur lokal vor. Der Käfer ist etwa 12 mm gross und ein Brutschmarotzer. Die Triungulinen (Primärlarven) des Ölkäfers locken Efeu-Seidenbienen mit Sexual-Pheromonen an. Sie heften sich an diese und gelangen so in deren Nesthöhlen, wo sie sich weiterentwickeln.
Frei geht näher hin, betrachtet die Tierchen von nahe. Sie bewegen sich in einem Tempo, das dem menschlichen Auge gefällt. Obwohl auf einem menschlichen Daumen fünf Borkenkäfer Platz hätten, sind ihre pelzigen Härchen erkennbar. «I wetze mini Zähndli am Liebschte amene Tänndli», hörte Frei als Kind Peach Weber über «D’ Borkechäfer» singen. Als Kind stellte sie sich die Tiere monströs vor. Später hat sie gesehen, wie zierlich und hübsch sie sind.
Lieblingsessen und Lebensgrundlage «Manche Förster würden sie sofort zerdrücken», sagt Frei vor den liegenden Stämmen im Zürcher Unterland. Das würde natürlich nichts ändern: Der Borkenkäfer liebt Fichten. Frei erklärt: «In dieser Dichte kommen die Fichten natürlicherweise im Mittelland nicht vor.» Fichten sind die wirtschaftlich wichtigsten Bäume der Schweiz. Sie sind dem Borkenkäfer, was die Seidenbienen-Sandnester dem Ölkäfer sind: Lieblingsessen und Lebensgrundlage.
Darum löst ein Borkenkäferbefall bei den meisten Förster*innen Stress aus: Innert kurzer Zeit kann er grosse Waldbestände abtöten. Fichten leiden in der Klimakrise, kommen mit ihren flachen Wurzeln nicht mehr an die tieferen Wasserspiegel und trocknen schneller aus. Der Borkenkäfer hingegen mag es warm: Seit kurzem entstehen bis zu drei Generationen pro Jahr. Es gebe
eine «Massenvermehrung», heisst es in der «Insektenvielfalt»-Studie. Die Studie würdigt das Tier: Der Borkenkäfer agiere «wie ein Ingenieur auf der Ebene ganzer Ökosysteme». Er verändere Lebensräume so, dass Spechte und andere xylobionte Käfer profitieren. Frei vergleicht seine Rolle mit jener des Bibers.
Schon auf der Hinfahrt ist Adrienne Frei im Element. Sie schildert das Dilemma zwischen Gesellschaft und Käfern bereits an den Bäumen mit toten Ästen entlang der Autobahn: «Die könnten herunterfallen und werden wohl als Risiko gesehen», sagt sie. Gleichzeitig bieten genau solche Äste – stehendes Totholz – wichtigen Lebensraum für viele Xylobionten. Insgesamt gibt es etwa 1400 verschiedene Arten. Viele sind gefährdet, in Deutschland stehen 60 Prozent von ihnen auf der Roten Liste.
Als sie auf der Landstrasse das Tempo drosselt, zeigt Frei auf den frisch entbuschten Waldrand. Wer keine Ahnung hat, meint, dort hat die Abholzungsgier obsiegt – dabei entsteht so ein seltener Lebensraum. «Hirschkäfer sind sehr wählerisch.» Die Weibchen der grössten Käferart Europas graben sich am Fuss alter und besonnter Eichen in den Boden, legen ihre Eier nah zu «bereits abgestorbenem Wurzelwerk». Frei erklärt: «Auf einer alten Eiche kommen bis zu 640 Käferarten vor.» Auf Fichten seien es nur etwa 60 verschiedene. Mehr totes Holz in Wäldern und Gärten findet Frei super – doch es brauche auch tote und halbtote
Bäume in der Vertikalen. Eine Buche kann bis zu 400 Jahre alt werden. Im Studium, vor etwa 20 Jahren, lernte Frei noch, Buchen solle man von 120 bis 140 Jahren wirtschaftlich nutzen. Heute fällt man sie bereits Jahrzehnte früher. Sie werden oft nur noch 100 Jahre alt.
Baumstämme als Fallen
Der Mensch wirkt auf das Klima ein, wirkt auf die Wälder ein, wirkt auf die Insektenvielfalt ein. Momentan ist Umbruch in den Wäldern und unter den Käfern, da ist sich Frei sicher. Wie es wohl in ein paar Jahrzehnten im Wald aussieht? «Die Natur verschwindet nicht», sagt Frei, «Aus menschlicher Perspektive wird sie aber durcheinandergewirbelt. Dass es passiert, müssen wir aushalten. Aber wir sind nicht hilflos.» Was ein Wald braucht, Pflege oder Ruhe, könne man lernen – durch Erfahrung, Austausch mit Expert*innen und genaues Beobachten.
Liegengebliebene Beigen dünner Baumstämme, wie jene, wo Frei die Borkenkäfer unter der Rinde vorfand, können zu regelrechten Fallen werden. Käfer legen ihre Eier hinein, im übernächsten Frühjahr werden die Bäume mit den Larven geschreddert. Sie landen zum Beispiel in Holzschnitzelheizungen. Mit Holzschnitzelheizungen soll der Klimawandel bewältigt werden. Klimaerwärmung und Artenvielfalt, Achtlosigkeit und Wirtschaftsdenken: Es hängt zusammen.
Der Buchdrucker oder Grosser Achtzähniger Fichtenborkenkäfer (Ips typographus) stammt aus der Unterfamilie der Borkenkäfer (Scolytinae). Er legt seine Brutsysteme in der Rinde von Wirtsbäumen an und befällt vor allem Fichten, aber auch Lärchen, Douglasien, Weymouth- und Schwarzkiefern sowie Weisstannen. Bei geeigneter Witterung (optimal: trocken, heiss, windstill) kann es zu einer Massenvermehrung kommen, der dann ganze Bestände zum Opfer fallen können.

Sozialversicherungen Die IV berechnet Renten falsch und Bundesrat Alain Berset redet sich heraus. Rechtsprofessor Thomas Gächter ist entsetzt.
TEXT UND INTERVIEW ANDRES EBERHARD
Unlängst sorgten falsche IV-Gutachten für einen veritablen Skandal. Ärzt*innen verdienten Millionen, indem sie Gefälligkeitsgutachten für die IV erstellten, in denen sie Kranke gesundschrieben. Diesen Vorwurf konnten Anwält*innen und andere Fachleute erhärten. Das Parlament beschloss vor knapp zwei Jahren einige Massnahmen, die das Problem mehr schlecht als recht lösten – etwa die Pflicht zu Tonaufzeichnungen bei den Gutachtergesprächen.
Nun folgt bereits der nächste Skandal: Mit einem Trick rechnet die IV die Renten klein. Massgebend für die Höhe der Renten ist der IV-Grad. Dieser drückt aus, zu wieviel Prozent jemand arbeitsunfähig ist. Der IV-Grad wiederum berechnet sich durch einen Vergleich: Das Einkommen, das die Person als Gesunde*r verdient hatte, wird dem Einkommen gegenübergestellt, das diese trotz Invalidität erreichen könnte. Letzteres muss in aller Regel geschätzt werden. Zu diesem Zweck greift die IV auf Lohntabellen des Bundesamtes für Statistik (BfS) zurück. Diese sind für die IV aber nicht geeignet.
Erstens spiegeln die Tabellen dieser Lohnstrukturerhebung (LSE) die Löhne von Gesunden wider, nicht von Invaliden. Gesunde verdienen 10 bis 20 Prozent mehr als Kranke, wie zwei unabhängig voneinander durchgeführte Studien von 2021 zeigten. Zweitens enthalten vermeintliche Tieflohnkategorien auch verhältnismässig gut bezahlte, körperlich anstrengende Jobs (z.B. Strassenarbeiten). Diese können IV-Bezüger*innen nur sehr selten weiter ausüben. Und drittens weisen die Tabellen erhebliche Mängel auf. So sind Monatslöhne bis 13 000 Franken in der Kategorie der «Hilfsarbeiter*innen» enthalten. Dazu kommt es, weil das BfS die Daten bei den Arbeitgebenden erfragt. Machen diese ungenaue Angaben – wie «Mitarbeiter*in» oder «Angestellte*r» –, landen auch Spitzenverdiener*innen in der Tieflohnkategorie. Die Folge dieser systematischen Rechenfehler: Der IV-Grad sinkt, und damit die Rentenleistungen. Viele Teilrenten sind zu tief, zahlreiche Gesuche werden ganz abgelehnt. Denn erst ein IV-Grad von mindestens 40 Prozent berechtigt zu einer Teilrente. Anspruch auf eine Eingliederungsmassnahme oder Umschulung hat, wer zu mindestens 20 Prozent arbeitsunfähig ist.
Das Problem ist dem Bundesamt für Sozialversicherungen mindestens seit 2015 bekannt. Damals gab das Bundesgericht dem Amt zu verstehen, dass es eine präzisere Methode ausarbeiten solle. Passiert ist bis heute nichts.
Nun, da der Skandal an die Öffentlichkeit kommt, forderte Gesundheitsminister Alain Berset vom Ständerat: «Geben Sie uns jetzt etwas Zeit.» Man müsse, so Berset, erst die Folgen der neuen IV-Verordnung auf die Praxis abwarten. Diese ist seit Anfang Jahr in Kraft, zementiert aber die unfaire Berechnungsmethode. Dabei hatten in der Vernehmlassung sämtliche Parteien, zahlreiche Kantone, Organisationen sowie Wissenschaftler*innen auf den Missstand aufmerksam gemacht.
Thomas Gächter, die IV-Renten sind systematisch zu tief, lautet das Fazit von zwei unabhängigen Untersuchungen. Sie schrieben dem Bundesrat daraufhin einen Protestbrief. Haben Sie eine Antwort erhalten?
Thomas Gächter: Ja, eine sehr freundliche sogar. Inhaltlich waren das allerdings eher Ausflüchte und Nebelpetarden. Bundesrat Berset schrieb uns beispielsweise, dass es künftig häufiger zur sogenannten Parallelisierung von Einkommen kommen soll. Das ist ein Instrument, mit dem die unpräzise Berechnung zumindest bei tiefen Einkommen teilweise korrigiert werden kann. An konkreten Hinweisen, dass dies in der Praxis tatsächlich häufiger gemacht werden soll, fehlt es allerdings. Die Berechnung mittels absurder hypothetischer Einkommensvergleiche hingegen wurde im Verordnungstext ausdrücklich verankert.
Nach politischem Druck sagte Alain Berset im Parlament, eine alternative Berechnung der IV-Renten brauche Zeit. Seit Anfang Jahr gilt eine neue IV-Verordnung, jetzt müssten die Folgen abgewartet werden. Das Problem ist der IV seit vielen Jahren bekannt. Zeit wäre mehr als genug vorhanden gewesen. Und von den Punkten, die wir kritisieren, ist in der neuen Verordnung kein einziger behoben worden. Das Problem wird sich eher verschärfen. Die Zahl jener, bei denen die Rechenfehler direkte Auswirkungen auf die IV-
Weniger IV-Rentner*innen
Die Wohnbevölkerung der Schweiz wuchs in den letzten 20 Jahren um 1,4 Millionen Menschen. Die Anzahl der IV-Rentner*innen veränderte sich jedoch kaum.
Rente haben, wird steigen. Denn beim sogenannten stufenlosen Rentensystem wird neu weniger gerundet, es wird aufs Prozent genau gerechnet.
Kürzlich hat das Bundesgericht die offensichtlich falsche Berechnungspraxis geschützt. Wie kann das sein?
Das Bundesgericht prüft nur Einzelfälle, und dort nur die rechtlichen Grundsätze. Die waren in diesem konkreten Fall offenbar eingehalten worden. Die fraglichen Lohntabellen hat das Bundesgericht im Ausnahmefall stets gebilligt. Das Problem ist, dass die Tabellen in der Praxis nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Das Bundesgericht hätte aber schon Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel den Fall ans kantonale Gericht zurückzuweisen oder, eher ungewöhnlich, gleich selbst einzugreifen.
Die beiden SP-Richter versuchten, Verbesserungen zu erreichen. Sie wurden von den beiden SVP-Richterinnen und dem CVPMann überstimmt. War dies ein politischer Entscheid? Ich denke nicht, dass die Parteien direkt Einfluss nehmen. Es geht um Werthaltungen. Die einen sagen: Zentrale Werte des sozialen Sicherungssystems werden nicht mehr eingehalten. Die anderen argumentieren: Das haben wir schon immer so gemacht.
Als Aussenstehender mutet es seltsam an, dass sich höchste Richter*innen in einer Sachfrage derart uneinig sind. Die Richter*innen wussten, dass eine Praxisänderung bei der IV jährliche Mehrkosten von 300 bis 400 Millionen Franken zur Folge hätte. Da können sie zur eigenen Rechtfertigung mit der Gewaltenteilung argumentieren. Einen solchen Entscheid zu fällen, sei nicht ihre, sondern die Aufgabe des Gesetzgebers.
Sehen Sie das auch so?
Das Bundesgericht hat letztlich die IV saniert. Und zwar in erster Linie mit der restriktiven «Schmerzrechtsprechung» vor etwa fünfzehn Jahren. Diese führte im Endeffekt zu einer Halbierung der Anzahl Neurentner*innen. Das Bundesgericht hatte bislang wenig Hemmungen, die Praxis zu ändern, wenn es darum ging,
Geld zu sparen. Nun aber, da die IV für eine sachgerechte Bemessungsmethode mehr Geld ausgeben müsste, wird Zurückhaltung erkennbar. Das ist ein Widerspruch.
Geht es nur ums Geld?
Offensichtlich. Auch wenn das Bundesamt für Sozialversicherungen das nicht so sagt. Mit dieser fehlenden Offenheit wird die Bevölkerung hinters Licht geführt. Wir zahlen Beiträge ein und gehen davon aus, dass wir anständig versichert sind. Aber viele sind es faktisch gar nicht. So wird jenen, die sich das leisten könnten und wollten, die Möglichkeit genommen, sich privat zu versichern. Denn am IV-Entscheid hängt nicht nur die erste, sondern auch die zweite Säule. Wer abgelehnt wird, hat in der Regel keinen Anspruch auf die entsprechenden BVG-Gelder. Das trifft viele Menschen existenziell.
Was schlagen Sie vor?
Es braucht mehr Redlichkeit. Ich bin froh, dass die Politik das Problem erkannt hat Man muss sich aber bewusst sein, dass eine saubere Berechnung der IV-Renten mehr kostet. Niemand spricht derzeit von Beitragserhöhungen, obwohl die IV immer noch hoch verschuldet ist. Gut möglich, dass die Bevölkerung bereit ist, mehr zu zahlen, wenn sie weiss, warum. Vielleicht kommt die Politik auch zum Schluss, dass es die IV gar nicht braucht. Das wäre zumindest ehrlich. Jetzt erscheint das IV-System manchen Betroffenen als eine Versicherung, die nicht versichert.

Prof. Thomas Gächter, 51, ist Inhaber des Lehrstuhls für Staats-, Verwaltungs- und Sozialversicherungsrecht sowie Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Er ist Mitautor eines Rechtsgutachtens, das auf die Mängel bei der IVBerechnung hinweist. Anfang Januar verfasste er einen Protestbrief an den Bundesrat, den fünfzehn Schweizer Rechtswissenschaftler*innen mitunterzeichneten.
Kommentar
Ukraine Die breite Solidarität mit der Ukraine birgt die Gefahr, kollektiv in eine Freund-Feind-Logik zu verfallen. Wir müssen uns anstrengen, die Fähigkeit zu differenzieren nicht aufzugeben.
Das Video hat mittlerweile wohl jede*r gesehen: Volodymyr Zelensky im Kreise seiner Berater. Die Handyaufnahme, offenbar selbstgedreht, zeigt ernste, smarte Männergesichter, die im Halbdunkel in informell-militärisch-sportlichen Klamotten um den ukrainischen Präsidenten stehen. Zelensky inszeniert sich als einer der Kleineren, steht zwar im Zentrum, aber er holt die Anwesenden der Reihe nach ins Bild. Selbst wenn man nicht direkt versteht, was er sagt, wirken die repetitiven Worte eindringlich: Ich bin hier, meine Berater sind hier, Führung und Volk stehen zusammen, um die Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen. «Ehre den Verteidigern der Ukraine.»
Es ist nichts Heldenhaftes am Töten von Menschen. Das weiss auch Volodymyr Zelensky. Es spielt dabei keine Rolle, ob man sich im Recht wähnt oder nicht. Es macht etwas mit dem Tötenden, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Nicht umsonst bewerten wir Mord in Friedenszeiten als etwas Ungeheuerliches und bestrafen diesen hart. Und doch überhöhen wir Menschen als Held*innen, die in den Krieg ziehen oder daraus zurückkehren – solange sie etwas verteidigen, das wir als verteidigungswürdig ansehen. Wir bezeichnen sie je nach Kontext sogar als Märtyrer, bauen ihnen Denkmäler, verleihen ihnen Medaillen und Orden. Wir versuchen, sie zu entschädigen. Im wortwörtlichen Sinne. Denn sie sind geschädigt, für ihr Leben gezeichnet.
Leben. Nahezu alle möchten vergessen. Nur wenige können. Manch einer wird die Diskrepanz zwischen der Heroisierung durch die Gesellschaft nicht zu vereinen wissen mit den eigenen schrecklichen Erfahrungen. Weil das Töten etwas macht mit den Menschen. Über Generationen. Denn die erlittenen Verletzungen zeitigen Folgen und prägen nicht selten in Form von Gewalt Familien über Generationen.
Ist eine Gesellschaft in der schrecklichen Lage wie nun Millionen von Ukrainer*innen, angegriffen zu werden, haben vor allem die Männer nur wenig Wahl. Es wird erwartet, dass sie den Übertritt der Grenze zum Töten diskussionslos in Kauf nehmen, dass sie zu den Waffen greifen und sich, ihre Familie, ihre Stadt oder ihr Land verteidigen. Natürlich gibt es auch Menschen, die ihre eigene Unversehrtheit (frei)willig eintauschen gegen den Kampf. Dafür gibt es Gründe: von Opferbereitschaft, national(istisch)em Pflichtgefühl, ideologischer Überzeugung, von Fatalismus über Naivität oder den fehlenden Glauben an eine kriegsfreie Lösung, von Rachereflexen und Hass bis zur Flucht vor persönlichem Unglück. Doch auch eine freiwillige Entscheidung für den Kampf hinterlässt versehrte Seelen, so sie denn zurückkehren.
Es werden neue und nur schwer wieder abzubauende Feindbilder zementiert.
SARA WINTER SAYILIR
Hierzulande wissen wir, wie schrecklich Krieg ist. Nur selten aus Erfahrung, sondern aus der Literatur, aus Filmen, aus Erzählungen anderer, vielleicht noch aus der eigenen Familiengeschichte. Was Soldat*innen tun müssen, was sie sehen, aushalten und mitverantworten, können wir kaum erfassen. Aber wir kennen die Geschichten über Veteran*innen, die nicht wieder aus der Kriegswelt herausfinden, die nicht mehr im friedlichen Leben andocken können. Manche machen den Krieg zum Beruf, andere gehen zugrunde oder nehmen sich das
Aufgrund unserer tradierten Bilder von Männlichkeit und der (angeblichen) Unverzichtbarkeit nationaler Identitäten gestehen wir nur denen die legitime Flucht zu, die wir (mit derselben patriarchal geprägten Brille) als zu schwach oder ungeeignet für den Kampf ansehen: Frauen, Kinder, Alte. In der Logik des Krieges wird ausgeblendet, dass es für viele Zivilist*innen im Kriegsgebiet zunächst eine untergeordnete Rolle spielt, was politisch folgt, Hauptsache, der Beschuss und die Bomben hören auf, das Sterben und die rohe Gewalt (siehe Reportagen zur Ostukraine im Surprise Nr. 476 und 521). Je länger die Kampfhandlungen andauern und weil die russische Taktik offensichtlich auch die gezielte Vernichtung ziviler Bevölkerungsteile beinhaltet, werden neue, schwer wieder abzubauende Feindbilder geschaffen und zementiert.
Wir sollten vorsichtig sein mit den romantisiert-heroischen Bildern und Erzählungen – wie denen der heiratenden Ukrainer*innen in Tarnuniformen – und dem unkritischen Mittragen der Mobilisierungskampagne. Vor allem in den Medien, die ja für Einordnung und kritische Distanz zuständig sind, werden sie reproduziert, aber auch im privaten Bereich. Auch
und gerade wenn wir uns solidarisch fühlen mit der Ukraine. Schon ist die ukrainische Fahne zum allgegenwärtigen Symbol eines scheinbar gerechten, «gemeinsamen» Kampfes geworden, zahlreiche Menschen tragen gelb-blau, die Flagge flimmert im Namen von «corporate solidarity» über digitale Billboards und ziert Produkte. Wir haben längst den Überblick verloren, mit wem wir da eigentlich alles Seit an Seit stehen. Angesichts der russischen Kriegsverbrechen ist es vielen verständlicherweise auch erstmal gleich.
Aber Übergriffe auf russischsprachige Menschen in Deutschland zeigen, wie schnell sich Menschen ausserhalb des Kriegsgebiets ermächtigt fühlen, ebenfalls Gewalt anzuwenden. Und wie schnell Hass sich verselbständigt. Schon fällt das Differenzieren schwer, wird mancherorts ein bedingungsloses Bekenntnis gefordert, als befänden wir uns bereits alle im Krieg. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kann seine Botschaft über zahllose Kanäle (fast) ungefiltert verbreiten, Videos, Bilder und Verlautbarungen werden häufig direkt eingebunden in den Strom der Berichterstattung. Schon haben sich selbst die grossen, mächtigen Betreiberfirmen der sozialen Netzwerke in der Mehrheit auf der ukrainischen Seite positioniert und erlauben sogenannte Hassrede, solange sie sich gegen die richtige Seite, gegen den russischen Präsidenten richtet.
zu hören und zu spüren: von dieser schier unbedingten Hilfsbereitschaft Menschen gegenüber, die vor Krieg aus der Ukraine flüchten müssen.
Mich bewegt diese Solidarität, denn ich bin überzeugt: wo Mitgefühl ist, da ist auch Menschlichkeit.
Und doch bleibt ein Unbehagen. Warum eigentlich sind uns Menschen, die wir nie zuvor gesehen haben und denen wir vermutlich auch nie begegnen werden, plötzlich so nah? Geografische Nähe wird es nicht sein. Nicht wenige von uns wussten bis vor drei Wochen nicht genau, wo auf der Landkarte sich diese Ukraine befindet. Liegt es am Lebensstil, der Religion, dem Aussehen der Ukrainer*innen? Man will es nicht glauben, aber genauso stand es in den vergangenen Wochen in internationalen wie auch Schweizer Medien: Die Ukraine ist eben kein «Drittweltland», und die da flüchten müssen sind «Christ*innen wie wir»; sie haben «dieselbe Kultur» wie wir, sind «europäisch» und «zivilisiert»; die Männer gelten als «wehrfähig und stark», die Frauen haben «blondes Haar», ihre Kinder «blaue Augen».
Was ist, wenn die Geflüchteten nicht dem Bild entsprechen, das wir von ihnen zeichnen?
Wir müssen uns anstrengen, eine differenzierte Haltung zu bewahren, während wir uns klar gegen den Krieg positionieren. Und aufpassen, mit wem wir ins selbe Horn stossen. Schon hat der Krieg eine erneute Aufrüstung zur Folge. Nicht nur wer schon lange mit Geflüchteten arbeitet, kämpft damit, diesen Moment nicht zynisch zu betrachten. Wo vorher nur wenig gesellschaftliche Solidarität mit Kriegsgeflüchteten zu spüren war, ist plötzlich ein Überangebot von Hilfe da. Spürbar ist: Vor allem weil wir uns direkt selbst bedroht fühlen, stehen wir so vereint. Wie viel das nun mit der Ukraine und tatsächlicher Solidarität mit den Menschen, die jetzt zu uns kommen und Schutz suchen, zu tun hat, wird sich erst noch herausstellen.
SARA WINTER SAYILIR
Kommentar
KLAUS PETRUS
Braucht es wirklich diese Art von Nähe, damit sich Empathie und Hilfsbereitschaft einstellt: dass die Geflüchteten so sein müssen wie wir, dass sie uns ähneln müssen –und wir ein Bild von ihnen zeichnen, das unser eigenes sein könnte? Was aber ist dann mit jenen, die diesem Bild nicht entsprechen und angeblich anders sind?
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán reiste dieser Tage höchstpersönlich an die ungarischukrainische Grenze, um den Geflüchteten zu versichern: «Wir werden alles tun, um euch zu helfen.» Eine bemerkenswerte Geste, wenn man bedenkt, dass Orbáns Regierung in den vergangenen Jahren eine rigide Migrationspolitik betrieben hat, erst mit dem Bau eines 175 Kilometer langen Zauns an der ungarisch-serbischen Grenze, dann und bis heute mit oft gewaltsamen Rückschiebungen von Geflüchteten. Betroffen sind davon vor allem Geflüchtete aus dem Nahen und Mittleren Osten. Ein Widerspruch? Nein, denn für Orbán ist das zweierlei: hier Ukrainer*innen, die dem ungarischen Volk nah sind und vor Krieg fliehen müssen, dort illegale Migrant*innen, die Europa stürmen wollen. Oder wie er ausdrücklich sagte: «Den Geflüchteten werden wir helfen, die Migrant*innen müssen gestoppt werden.»
Manchmal braucht das Unfassbare ein Bild. Eines, das sich in unseren Köpfen festsetzt, das aufwühlt und uns all das, was wir nicht glauben mögen – weil es so grausam ist oder absurd oder fremd – näherbringt. Diese Tage erreichen uns zehntausende Bilder aus der Ukraine, manche zeugen von Bomben und Trümmern, andere von Angst und Ohnmacht. Sie schaffen Nähe und erwecken unser Mitgefühl. Auch davon ist jetzt viel
Das Beispiel zeigt: Beruht Solidarität auf dem Prinzip der Ähnlichkeit oder einem «wir hier, sie dort », so kann sich Empathie leicht als launisches, willkürliches Gefühl entpuppen. Immerhin war das schon mal, im Herbst 2015: eine Willkommenskultur, die berührte. Heute sind uns die, die uns damals nah waren, wieder fremd geworden. Vielleicht liegt mein Unbehagen genau darin: in der Sorge, dass für uns in ein, zwei Jahren die ukrainischen Geflüchteten die Afghan*innen von heute sein werden. KLAUS PETRUS


Der Lehrer Jean Adamski (Antoine Reinartz) wird zu einer wichtigen Person für den zehnjährigen Johnny (Ilario Gallo). Wenn er nicht in der Schule ist, kümmert er sich – während die Mutter arbeitet – um seine jüngere Schwester.
Kino Das Gefühl sozialer Zugehörigkeit wird einem Kind schon früh vermittelt –was es wagen darf und was nicht. Samuel Theis gibt in seinem neuen Film «Petite Nature» einen Einblick in den Alltag einer prekarisierten Familie.
TEXT GIULIA BERNARDI
«Wo seht ihr euch in 20 Jahren?», fragt Lehrer Jean Adamski seine Klasse am ersten Schultag. Die Antworten füllen den Raum: am Strand in Miami leben, eine Familie haben, Polizistin in Dubai werden. «Warum Dubai?» fragt der Lehrer. «Weil es schön ist.»
Dann ist der zehnjährige Johnny an der Reihe. «Und was ist dein Traum?» Johnny schweigt, überlegt. «Ich weiss es nicht.»
Schon in den ersten Szenen von «Petite Nature» wird spürbar, dass sich die Lebensrealität des jungen Protagonisten grundlegend von jener der übrigen Kinder unterscheidet. Während die anderen Platz zum Träumen haben, kümmert sich Johnny um seine jüngere Schwester. Er wäscht ihr in der Badewanne die langen braunen Haare und zieht ihr frühmorgens die glitzernden Schuhe an, die sie so mag, bevor sie gemeinsam zur Schule laufen. Ihre Mutter ist alleinerziehend und nur selten anwesend, sie versucht den Lebensunterhalt in einem kleinen Tabakladen an der deutsch-französischen Grenze zu verdienen.
In «Petite Nature» wird den Zuschauer*innen vor Augen geführt, wie früh sich das Gefühl sozialer Zugehörigkeit entwickelt. Johnny verinnerlicht dieses Gefühl zunehmend, dazu tragen die Erwartungen und Vorurteile seines Umfeldes bei. «Setzen Sie ihm keine Flausen in den Kopf», erwidert die Mutter auf das Lob
des Lehrers, dass Johnny ein talentiertes Kind sei. «Ich möchte nicht, dass er enttäuscht wird.» Der Dialog ist aufgeladen, Ausweglosigkeit und Scham für die eigene Lebensrealität kommen darin zum Ausdruck. Denn unweigerlich bemerkt Johnny im Verlauf des Filmes den musternden Blick der Nachbarin, wird mit dem Gelächter anderer Kinder konfrontiert. «Warum kaufst du nicht die echte Cola?», fragt er seine Mutter beim Abendessen. «Haben wir nicht genug Geld? Warum sitzen alle nur herum und warten, dass die Zeit vergeht?» Wütend wirft er seinen Stuhl um, während seine Mutter ihn nachdenklich anschaut und schweigt, weil sie keine Worte findet.
Die Resignation der Mutter Ähnliche Verhältnisse hat Regisseur Samuel Theis selber erlebt. Im französischen Forbach aufgewachsen, wo der Film gedreht wurde, schloss er die Schule ab, um danach Regie in Paris zu studieren. «Schon als kleiner Junge spürte ich die Resignation meiner Mutter», erinnert er sich. «Als mir bewusst wurde, dass ich den Ort verlassen musste, um nicht selbst aufzugeben, war ich zehn Jahre alt.» Seine familiäre Situation thematisierte Theis schon in seinem ersten Film «Party Girl», in dem seine damals

60-jährige Mutter sich selbst spielte. «Meine Arbeit hilft mir, meine Vergangenheit zu reflektieren, anders darüber nachzudenken und ein neues Narrativ zu entwickeln. Jede Erinnerung ist gleichzeitig auch eine Fiktion.»
Auch in «Petite Nature» ist die Mutter spürbar präsent. Ebenso die abwesende Vaterfigur, die durch den Lehrer Jean ersetzt wird. Zu ihm baut Johnny ein enges Vertrauensverhältnis auf, das an die für Jean verantwortbaren Grenzen geht. Denn Johnny klopft abends an seine Tür, weil er nicht nach Hause will und nicht weiss, wohin er sonst gehen soll. «Mich interessiert die Frage, wie weit eine Lehrperson gehen kann, um ein Kind zu unterstützen», sagt Samuel Theis. Es erscheint als grenzüberschreitend, als Jean den Jungen auf seinem Motorrad nach Hause fährt und dieser sich im Fahrtwind eng an ihn klammert.
Im Verlauf des Filmes entwickelt Johnny gar Gefühle für seinen Lehrer, versucht sich ihm körperlich zu nähern, worauf ihn Jean schockiert zurückweist. Der junge Protagonist scheitert beim Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen, nach der er sich sehnt. Allerdings fällt die sexuell aufgeladene Annäherung etwas aus der Reihe des ansonsten subtil angelegten Filmes. Es stellt sich die Frage, ob dieser Schwenk notwendig war, er nimmt dem eigentlichen Thema Schlagkraft. Denn letztlich ist es die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, die den Film so sehenswert macht; die spürbaren gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber der alleinerziehenden Mutter und der prekarisierten Familie; die kleinen und grossen Ungerechtigkeiten, die zu so hohen Mauern werden, dass sie unüberwindbar scheinen. All dies findet in der Figur von Johnny, der an diesen Mauern scheitert und nicht zu träumen wagt, beklemmende Zuspitzung.
«Petite Nature», Regie: Samuel Theis, Drama, F 2021, 93 Min. Läuft ab 7. April im Kino.
Buch In «Säwentitu» blickt Bea von Malchus mit ihren eigenen Teenager-Augen auf das Lebensgefühl des Jahres 1972.
«Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?», fragte einst der Philosoph Richard David Precht. Was die Regisseurin und Schauspielerin Bea von Malchus betrifft, so ist sie «sehr viele». In ihren solistischen, wortgewaltigen und humorgetränkten Erzähltheatern schlüpft sie in eine halbe Legion von Figuren. Mal ist sie die Kennedys oder die Nibelungen, mal Mark Twain, Elisabeth I. oder Heinrich VIII., mal spielt sie sich durch das Personal der Bibel oder von Shakespeare. Um nur einige der vielen zu nennen.
Dann kam die Pandemie, und es hatte sich mit den vielen. Sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Also machte Bea von Malchus aus der Not eine Tugend, nutzte die Zeit, schrieb ein Appetit- und Lachmuskel-anregendes Kochbuch und schlüpfte schliesslich literarisch in eine weitere Figur: sie selbst als 13- bis 14-Jährige. Nicht nur als ein Stück Biografie, sondern als ein weiteres Erzähltheater, eines auf Papier. Der Titel des Stücks: Säwentitu. Ort der Handlung: Dortmund, die kohlenverstaubte Stadt im Ruhrgebiet. Zeit der Handlung: das Jahr 1972. Die Zeit von IRA und RAF, von Olympia-Attentat und Vietnam-Krieg, von Willy Brandt, Nixon und Mao. Vor diesem Zeitpanorama entfaltet sich das Leben der Heranwachsenden mit den alterstypischen Problemen in der Schule, mit dem eigenen Körper, dem Sichselberfinden, mit Tanzstunde und Zungenkuss. Und ein Familienkosmos mit allerlei schrägen Figuren. Dem schüchternen Vater, einem Kettenraucher mit Kriegstrauma und Notvorratskeller, der lauten, dauerpolitisierenden und meinungsdominanten Mutter, beide studierte Volkswirt*innen mit Hang zur Dauerpleite. Oder der komplett wahnsinnigen Ilse, die aus Norwegen in die Wohnung schneit und Zigarren, Alkohol und Männer konsumiert.
Auf diese Zeit blickt Bea von Malchus mit ihren eigenen Teenager-Augen, und dabei wird jede Erinnerung zum Sprungbrett für liebevolle, poetische, politische, bissig-witzige und auch traurige Gedanken. Über einen Jahreszyklus hinweg, von Winter zu Winter, reihen sich viele kleine Geschichten aneinander, farbige Miniaturszenen auf der Lebensbühne, die es verstehen, ein Lebensgefühl einzufangen. «Manchmal bin ich krank nach diesem Leben, das in den Himmel reichte und alles mit goldenen Fäden verband», schreibt sie einmal. Denn in diesem Lesevergnügen steckt auch viel Sehnsucht nach etwas, das so nie wiederkehrt. Man möchte viele Stellen laut lesen – oder sich von Bea von Malchus vorlesen lassen. Was zum Glück inzwischen wieder möglich ist.

CHRISTOPHER ZIMMER
Bea von Malchus: Säwentitu. EUR 25 + Porto beavonmalchus.de/saewentitu
Solothurn «Tiefenschärfe. Zwischen Lust, List und Schrecken», Ausstellung, bis So, 24. April, Di bis Fr, 11 bis 17 Uhr, Sa und So, 10 bis 17 Uhr, Kunstmuseum Solothurn, Werkhofstrasse 30. kunstmuseum-so.ch


gica Rajčić Holzner stehen dieses Mal die Texte und Lebensgeschichten der aus Serbien stammenden Ljiljana Pospisek und der aus dem Kosovo stammenden Shqipe Sylejmani im Zentrum. Sie beide blicken schreibend auf ihr Aufwachsen zwischen zwei Kulturen zurück, Pospisek in ihrem mit dem AutobiographieAward 2019 ausgezeichneten Text «Krokodil im Flieder», Sylejmani in ihrem ersten Roman «Bürde & Segen». MBE
Heiden/AR
«Flagge zeigen – Rotes Kreuz auf weissem Grund», Ausstellung, Sa, 9. April, bis So, 30. Oktober, Mi bis Fr, 13 bis 17 Uhr, Sa und So, 11 bis 17 Uhr, Dunant Plaza, Kirchplatz 9. dunant-museum.ch
Lenzbur g

«Geschlecht. Jetzt entdecken», Ausstellung, verlängert bis So, 22. Mai, Di bis So, 9 bis 17 Uhr, Do, 9 bis 20 Uhr, Stapferhaus, Bahnhofstrasse 49, Reservation wird empfohlen. stapferhaus.ch
Nach 24 Jahren beendet Christoph Vögele seine Amtszeit als Konservator im Kunstmuseum Solothurn mit einer Präsentation, die einen Schwerpunkt auf die Gegenwartskunst legt. Der Ausstellungstitel «Tiefenschärfe» stammt aus der Optik. Die Tiefenschärfe legt fest, wie scharf der Bildhintergrund dargestellt wird. Im übertragenen Sinn kann der Begriff aber auch bedeuten, dass unter Einbezug einer Geschichte oder eines historischen Ereignisses neue Schichten eines Werkes freigelegt werden. Die Schau umfasst Werke von Félix Vallotton, Adolf Dietrich, Franz Gertsch, Simone Kappeler oder Bernard Voïta. Viele der Exponate lassen sich auf die Tradition des Trompel’œil beziehen, bei dem die Kunstschaffenden die Tiefenwirkung des Gezeigten ins Zentrum rücken, um das Auge zu täuschen.
St. Gallen
«Perfect Love», Ausstellung, 9. April bis Ende Jahr, Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Mi, 10 bis 20 Uhr, Kunstmuseum St. Gallen, Museumsstrasse 32. kunstmuseumsg.ch

Frühlingsgefühle liegen in der Luft. Passend dazu eröffnet das Kunstmuseum St. Gallen eine Ausstellung mit Werken der hauseigenen
MBE
Sammlung, die die Liebe in all ihren Ausprägungen feiert. Die Werke stammen aus dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. So werden zum Beispiel alte Meister mit zeitgenössischer Kunst in einen Dialog gesetzt. Nächstenliebe, die Liebe zwischen Mutter und Kind, Romantik, Erotik, aber auch die Passion, die für die Wissenschaft oder die Kunst entflammen kann. Sie alle zeugen von der gewaltigen Kraft der Liebe. «Perfect Love» erinnert daran, dass Menschen seit jeher Mut, Inspiration und Hoffnung aus diesem grossen Gefühl schöpfen. MBE
Zürich
«Weltenlesen, mit Shqipe Sylejmani und Ljiljana Pospisek», Lesung, Di, 12. April, 19.30 Uhr, Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62. literaturhaus.ch
Wie sieht das künstlerische Schaffen von ausländischen Autor*innen aus, die in der Schweiz leben und arbeiten? Mit der Reihe «Weltenlesen» sucht das Literaturhaus Zürich Antworten darauf. Moderiert von der Schriftstellerin Dra
Die humanitäre Tradition der Schweiz geht vor allem auf einen Namen zurück: Henry Dunant. Als der Genfer Geschäftsmann und christliche Humanist 1859 die vielen Verwundeten nach der Schlacht im italienischen Solferino sah, half er bei deren Versorgung. Er schrieb ein Buch über seine Idee, wie Kriegsverwundete besser versorgt werden könnten. 1863 initiierte er die Gründung des Roten Kreuzes. Seither steht das rote Kreuz auf weissem Grund für den Schutz und die Hilfe für verletzte Menschen an Kriegsschauplätzen. Die Ausstellung in Heiden, jener Gemeinde, in der Dunant seine letzten Lebensjahre verbrachte, zeichnet die Entstehungsgeschichte dieses so bekannten und respektierten Zeichens nach. Themenstationen, Filme und historische Objekte thematisieren diesen Grundstein des humanitären Völkerrechts MBE
An der Geschlechterfrage erhitzen sich die Gemüter immer wieder –sei es in der Familie, in der Partnerschaft, am Stammtisch oder bei der Arbeit. Bei einem spielerischen Rundgang erfahren die Besucher*innen in einem Animationsfilm, wie Geschlecht in der Zelle entsteht. Neben den biologischen Aspekten zeigt die Ausstellung, wie Kultur, Gesellschaft oder Erziehung den Geschlechtern und ihren Attributen damals wie heute ganz unterschiedlich begegnen. So trug etwa der Sonnenkönig Ludwig XIV. im 17. Jahrhundert Schuhe mit Absätzen, während High Heels heute vor allem von Menschen getragen werden, die sich als Frauen definieren. An verschiedenen Stationen werden Rollenbilder hinterfragt – darunter auch das Bild, das jede*r von sich selber hat. In einem Video erzählt ein Mann mit einem Augenzwinkern, es sei männlich gewesen, als er mit einer Motorsäge Holz zerteilt habe. «Geschlecht» schärft den Blick für diese Klischees und öffnet neue Perspektiven MBE
Wir sind für Sie da.
365 Tage offen von 8-20 Uhr St. Peterstr. 16 | 8001 Zürich | 044 211 44 77 www.stpeter-apotheke.com grundsätzlich ganzheitlich


Tour de Suisse
Surprise-Standort: Migros
Einwohner*innen: 757
Sozialhilfequote (Stadt Bern): 5,1
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 18,5
Bekanntestes Unternehmen: Weltpostverein mit 192 Mitgliedstaaten
Der Egghölzliplatz ist nicht gross, aber vielfältig. Es liesse sich gut verweilen an den bereitgestellten Tischen und Bänken, eine Bäckerei stünde auch zur Verfügung, nur das Wetter macht nicht mit. Neben der Bäckerei gibt es eine «Floral Designerin» und eine «Madame Repair», die Schuhe, Gürtel und Taschen und Textiles reparieren kann. Man merkt, man ist hier in Bern, wo dem Französischen noch Reverenz gezollt wird, zumindest halbwegs, «repair» ist auch schon englisch, und so entsteht ein hübscher Sprachhybrid. Um festzustellen, ob es unter den Pflanzen, die von der Freiwilligengruppe Urbanbiodiv auf diesem Platz gehegt und gepflegt werden, auch Hybriden gibt, bedürfte es besserer biologischer Kenntnisse. Auf alle Fälle sind es nicht weniger als acht Arten, die sich hier einen Lebensraum teilen.
An der Informationssäule werden ausserdem Kinderkrippen, Spieltreffs, Coronaberatung und Gemeinschaftsgärten beworben, und so verwundert es auch nicht, dass hier bärtige Männer mit vor die Brust gebundenen Kindern flanieren. Gegenüber gibt es eine vollausgerüstete Tankstelle mit Tankstellenshop, inklusive Wasser-, Luftund Staubsaugerstation, ein auffälliger Gegensatz zum lauschigen Plätzchen. Wer weiss, ob sich hier bei schönem Wetter verschiedene Bevölkerungssegmente gegenüberstehen und nicht verstehen können, wie man seine Freizeit so verbringen kann: im Auto bzw. auf einem biodiversen Kiesplatz.
Ein Restaurant wirbt mit Schweizer Spezialitäten, der Aussenbereich ist riesig, hier muss etwas los sein im Sommer, ein Spielplatz steht zur Verfügung. Ein
veritables Ausflugslokal, woraus zu schliessen ist, dass es sich beim Egghölzli um ein Ausflugsziel handelt.
Am Strassenrand sind Veloanhänger aufgereiht und angekettet, altmodische Modelle, in denen keine Kleinkinder, sondern Zeitungen transportiert werden. Offenbar befindet sich hier ein Zeitungsvertragungshub.
Gegenüber steht das Gebäude einer grossen Gewerkschaft, die hier vermutlich ihren Hauptsitz hat. Stolze Gewerkschaftsgebäude sind selten geworden, dieses befindet sich an der Weltpoststrasse und beherbergt auch Botschaften. Während Pöstler*innen noch gewerkschaftlich organisiert sind, werden Pakete heute von Subunternehmer*innen und Scheinselbständigen ausgeliefert, was eine gewerkschaftliche Organisation erschwert.
Das Egghölzli ist ein kleiner Wald, in dessen Spitze sich die Residenz des chinesischen Botschafters befindet, ein hochumzäuntes, videoüberwachtes Schlösschen, das früher eine WG beherbergte, wie man hört. Die wichtige und mächtige Nation, die hier ihre Vertretung hat, stand schon im Verdacht, den Weltpostverein zu dominieren beziehungsweise von diesem bevorzugt behandelt zu werden, weil es günstig ist, Waren per Post von China in alle Welt zu verschicken. Dass dieser nur einen Steinwurf entfernt residiert, hat bestimmt schon Verschwörungstheorien gefördert. Das Wäldchen ist zwischen Autobahn und Hauptstrasse eingeklemmt, aber nichtsdestotrotz ein hübscher Ort, ein Naherholungsgebiet für Anwohnerinnen, Ausflügler und das Personal von Botschaften, die über keine eigenen Parks verfügen.

STEPHAN PÖRTNER
Der Zürcher Schriftsteller Stephan Pörtner besucht Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.
Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellscha . Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Breite-Apotheke, Basel
Michael Lüthi Gartengestaltung, Rubigen
Gemeinnützige Frauen Aarau
Kaiser Software GmbH, Bern
Cornelia Metz, Sozialarbeiterin, Chur
AnyWeb AG, Zürich
Ref. Kirche, Ittigen
Farner’s Agrarhandel, Oberstammheim
BODYALARM - time for a massage
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden
WBG Siedlung Baumgarten, Bern unterwegs GmbH, Aarau
Hedi Hauswirth Privatpflege Oetwil a.S. Fäh & Stalder GmbH, Muttenz
Praxis C. Widmer, Wettingen
EVA näht: www.naehgut.ch
Büro Dudler, Raum- und Verkehrsplanung, Biel Evang. Frauenhilfe BL, frauenhilfe-bl.ch
Lebensraum Interlaken GmbH, Interlaken Automation Partner AG, Rheinau
Infopower GmbH, Zürich
Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
Barth Real AG, Zürich
Be Shaping the Future AG
Maya-Recordings, Oberstammheim
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto: PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag Sie erhalten von uns eine Bestätigung.
Kontakt:
Wie viele Surprise-Hefte müssten Sie verkaufen, um davon in Würde leben zu können?
Hätten Sie die Kraft?
Eine von vielen Geschichten
Merima Menur kam 2016 zu Surprise –durch ihren Mann Negussie Weldai, der bereits in der Regionalstelle Bern arbeitete. Zuvor lebten sie fünf Jahre getrennt –er in der Schweiz, sie in Äthiopien. Einige Zeit nach ihrer Ankun in der Schweiz begann Merima auch mit dem Verkauf des Surprise Strassenmagazins und besuchte einen Deutsch-Kurs, mit dem Ziel selbständiger zu werden und eine Anstellung zu nden. Dank Surplus besitzt Merima ein Libero-Abo für die Stadt Bern und kann somit leichter an ihren Verkaufsort reisen. Surplus gibt der 39-Jährigen ausserdem die Möglichkeit, sich einige bezahlte Ferientage zu gönnen.
Das Programm
Wussten Sie, dass einige unserer Verkäufer*innen fast ausschliesslich vom Heverkauf leben und keine Sozialleistungen vom Staat beziehen? Das fordert sehr viel Kra , Selbstvertrauen sowie konstantes Engagement. Und es verdient besondere Förderung.
Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie sind mit Krankentaggeld und Ferien sozial abgesichert und erhalten ein Nahverkehrsabonnement. Bei Problemen im Alltag begleiten wir sie intensiv.

Sie das SurPlus-Programm mit einer nachhaltigen Spende
Derzeit unterstützt Surprise 21 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.
Spendenkonto: PC 12-551455-3
Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
· ½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
· 1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!
#Strassenma g azin
«Helvetische humanistische Folklore»
Frage: Was läuft seit sieben bzw. elf Jahren und ist trotzdem nicht einen einzigen Millimeter weiter gekommen? Antwort: Meine Anmeldung bei der Invalidenversicherung (IV). Sie weigert sich auch dafür zu sorgen, dass die richtigen (oder irgendwelche) medizinischen Massnahmen ergriffen werden. Die IV ist seit sehr vielen Jahren handlungsunfähig. Die Verantwortlichen schauen vorsätzlich weg – verweigern also ihren Job. Ich nenne es Behördenkarussell oder die höchste Form helvetischer humanistischer Folklore: Krankenkasse verweigert Klinikaufenthalt. Anmeldung bei der IV wird abgelehnt. Regierungsrätin schickt Betroffenen zum Sozialamt. Krankenkasse sperrt willkürlich und widerrechtlich ganze Familie, inkl. der Kinder (Widerrechtlichkeit gerichtlich bestätigt). Sozialamt verzögert Anmeldung um 18 Monate, misshandelt Betroffenen. Aufsicht funktioniert absichtlich nicht. Sozialamt schickt Betroffenen zum Arbeitsamt. Dieses würde Betroffenen zur IV schicken. Krankenkasse verweigert lebenswichtige Medikamente (schwarze Liste säumiger Prämienzahler*innen des Kantons; auf die Liste kam der Betroffene wegen Versäumnissen des Sozialamts). Beim Bund schickt man den Betroffenen wieder zum Kanton. Alle übrigen Instanzen zucken mit der Schulter. Der unentgeltliche Anwalt des Betroffenen kaut nun schon sieben volle Jahre an einer Neuanmeldung bei der IV. Der Betroffene musste seine berufliche Selbständigkeit folglich aufgeben. Aus gesundheitlichen Gründen konnte auch nicht die MWST-Abrechnung eingereicht werden (und ein Treuhänder ist nicht finanzierbar), was zu einer Busse in Höhe des zigfach geschuldeten Betrages führte. Alle anderen Täter*innen geniessen Immunität. Allein dieses «Vorgehen» macht den Patienten vollkommen krank, was in einem Rechtsstaat zur Anmeldung bei der IV berechtigen würde. Aber immerhin schafft es die Schweiz global unter die ersten drei Plätze beim Geldwaschen. Die Unfähigkeit und Kompetenzverweigerung sind somit nicht systemisch, sondern gezielt und damit diskriminierend. Die «humane» Schweiz möchte ich nicht erleben, wenn sie mal eine inhumane Phase durchmacht.
L. FRITZE, ohne Ort
Imp ressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Scheibenstrasse 41, 3014 Bern
T +41 31 332 53 93
M+41 79 389 78 02
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78
M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Sara Winter Sayilir (win)
Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea)
Reporter*innen: Andres Eberhard (eba), Anina Ritscher (arr)
T +41 61 564 90 70
F +41 61 564 90 99 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Rahel Nicole Eisenring, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Giulia Bernardi, Marina Bräm, Nicolas Gabriel, Ruben Hollinger, Dina Hungerbühler, Daniel Sutter, Nicole Vögeli, Chi Lui Wong, Benjamin von Wyl Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage 38 200
Abonnemente
CHF 189, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.
Spendenkonto: PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Ich kaufe, wann immer möglich, das Heft in Schaffhausen bei Hans. Er hat immer gute Laune, ist immer sehr freundlich. Ich finde es eine tolle Sache, Menschen zu unterstützen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Was sind schon 6 Franken im Monat für mich? Wenn mit unserem kleinen Beitrag die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit von Hans zu einem kleinen Teil gesichert ist, gibt mir das ein gutes Gefühl. Der Druck in unserer Gesellschaft, Miete, Krankenkasse, Versicherung und Steuern immer termingerecht zu bezahlen, ist immens. Ich wurde letztes Jahr auch unverhofft arbeitslos und erschrak, wie schnell man mit 55 Jahren im Arbeitsmarkt als altes Eisen aufs Abstellgleis geschoben werden kann. Vor allem, wenn man über 25 Jahre im gleichen Fachgebiet gearbeitet hat. Ich hatte Glück und fand eine tolle neue Stelle.
P. GEITLINGER, Schaffhausen
25 Ausgaben zum Preis von CHF 189.– (Europa: CHF 229.–) Verpackung und Versand bieten
Strassenverkäufer*innen ein zusätzliches Einkommen
Gönner-Abo für CHF 260.–Geschenkabonnement für:
Vorname, Name
Strasse
PLZ, Ort
Rechnungsadresse:
Vorname, Name
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift
Bitte heraustrennen und schicken an: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel, info@surprise.ngo
Surp rise-Porträt
«Ich heisse Roma Weldu Gebrihiwet, stamme aus Eritrea und bin ungefähr 56 Jahre alt. Wenn ich mich vorstelle, sind die Leute meistens überrascht, dass ich mein genaues Alter nicht kenne. In meinem Heimatdorf waren Geburtsdaten bis vor wenigen Jahren nicht wichtig. Als ich mir meine Papiere ausstellen liess, konnte ich ein Geburtsdatum wählen. Wahrscheinlich bin ich ein paar Jahre älter, als es in meinen Ausweisen steht, aber ich fühle mich jung und fit, darum passt mir mein ‹ungefähres Alter›. Auf Nachfragen antworte ich darum meistens: ‹Ich weiss nicht, wie alt ich bin – aber das ist auch gut so.›
Ich bin nie zur Schule gegangen, denn kurz vor meiner Einschulung begann der eritreische Unabhängigkeitskrieg. Im Alter von ungefähr elf Jahren wurde ich verlobt. Meinen Mann habe ich erst nach unserer Hochzeit kennengelernt, da er einen langen Militärdienst leistete. Wir waren fünf Jahre verlobt und heirateten ohne sein Beisein. Ein Jahr später kam er schliesslich aus dem Krieg zurück. Unsere Ehe hielt jedoch nicht lange, und so zog ich zu meiner Schwester in den Sudan. Dort habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt, einen begabten äthiopischen Schneider. Er baute ein erfolgreiches Geschäft in Libyen auf und hatte zwanzig Angestellte. Über dreizehn Jahre lebten wir gemeinsam in Libyen – ein Luxusleben im Vergleich zu dem, was vorher war und nachher kam. Ich gebar vier Kinder und konnte mich als gut gestellte Frau ganz auf ihre Erziehung konzentrieren. Doch dann verschwand mein Mann nach einem Familienbesuch in Äthiopien. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war. Erst Jahre später erfuhr ich, dass er bei seiner Einreise in Äthiopien verhaftet wurde und mehrere Jahre im Gefängnis sass. Den Grund für seine Verhaftung kennen wir bis heute nicht. Für mich als Frau allein mit vier Kindern wurde das Leben in Libyen sehr schwer. Nachdem ich ein Jahr lang nichts von meinem Mann gehört hatte, verkaufte ich alle Kleider und Maschinen, um nach Europa zu kommen.
Nun leben wir schon fast sechzehn Jahre in der Schweiz. Meine Kinder konnten hier eine Ausbildung absolvieren, dafür bin ich sehr dankbar. Für meinen Mann, der nach seinem Gefängnisaufenthalt ebenfalls in die Schweiz kommen konnte, ist das Leben hier jedoch sehr schwer. Er ist es gewohnt, ein eigenes Geschäft zu führen, und liebt seinen Schneiderberuf. Die Stellen, die er hier bekommen hat, entsprachen ihm nicht. Sein letzter Job in einer Wäscherei wurde ihm wegen der Corona-Pandemie gekündigt. Das macht ihn noch trauriger und gestresster. Wir leben seit fünf Jahren getrennt, für mich wurde seine Schwermut zu einer grossen Last. Vielleicht finden wir wieder zusammen, wenn er sich etwas fängt.
Im Moment bin ich lieber selbständig und unabhängig. Ich verkaufe sechs Tage in der Woche Surprise. Zum einen schätze ich den regelmässigen Kontakt zu meiner Kundschaft sehr, zum

Roma Weldu Gebrihiwet, Mitte 50, verkauft Surprise in Zug sowie in Unterägeri, Eglisau und Hüntwangen und sucht schon lange eine grössere Wohnung.
anderen kann ich so für mich und meine vier Kinder sorgen. Es macht mich stolz, dass ich seit vier Jahren ohne finanzielle Unterstützung der Sozialhilfe zurechtkomme. Ich hoffe daher auch, dass wir nun endlich eine richtige Aufenthaltsbewilligung erhalten. Der Status als vorläufig aufgenommene Person macht einem das Leben schwer, sei es bei der Stellen- oder der Wohnungssuche. Ich suche schon seit fünf Jahren eine grössere Wohnung. Bezahlen könnte ich sie wohl ohne Probleme, aber wegen meines unsicheren Status ist es sehr schwer, eine anständige Wohnung zu bekommen.
Momentan leben wir in einer ‹Notfallwohnung›. Die Wohnung ist im Vergleich zu unserer letzten Gemeindeunterkunft wenigstens geheizt, die Wände schimmeln aber, und wir müssen uns drei Zimmer teilen. Ich würde mich freuen, wenn meine Kinder ihre Freund*innen ohne Scham mit nach Hause nehmen und wir nach sechzehn Jahren in der Schweiz endlich ein normales Leben in einer normalen Wohnung führen könnten.»
Aufgezeichnet von DINA HUNGERBÜHLER
IN AARAU Rest. Schützenhaus, Aarenaustr. 1 | Rest. Sevilla, Kirchgasse 4 IN ARLESHEIM Café Einzigartig, Ermittagestrasse 2 IN BACHENBÜLACH Kafi Linde, Bachstr. 10 IN BASEL Bäckerei KULT, Riehentorstr. 18 & Elsässerstr. 43 | BackwarenOutlet, Güterstr. 120 | Bioladen Feigenbaum, Wielandplatz 8 Bohemia, Dornacherstr. 255 | Elisabethen, Elisabethenstr. 14 | Flore, Klybeckstr. 5 | frühling, Klybeckstr. 69 | Haltestelle, Gempenstr. 5 | FAZ Gundeli, Dornacherstr. 192 | Oetlinger Buvette, Unterer Rheinweg | Quartiertreff Kleinhüningen, Kleinhüningerstr. 205 | Quartiertreff Lola, Lothringerstr. 63 Les Gareçons to go, Bad. Bahnhof | L‘Ultimo Bacio, Güterstr. 199 | Didi Offensiv, Erasmusplatz 12Café Spalentor, Missionsstr. 1a | HausBAR Markthalle, Steinentorberg 20 | Shöp, Gärtnerstr. 46 | Tellplatz 3, Tellplatz 3 | Treffpunkt Breite, Zürcherstr. 149 Wirth‘s Huus, Colmarerstr. 10 IN BERN Äss-Bar, Länggassstr. 26 & Marktgasse 19 | Burgunderbar, Speichergasse 15 | Generationenhaus, Bahnhofplatz 2 | Hallers brasserie, Hallerstr. 33 | Café Kairo, Dammweg 43 | MARTA, Kramgasse 8 | MondiaL, Eymattstr. 2b | Tscharni, Waldmannstr. 17a | Lehrerzimmer, Waisenhausplatz 30 | LoLa, Lorrainestr. 23 Luna Llena, Scheibenstr. 39 | Brasserie Lorraine, Quartiergasse 17 | Dreigänger, Waldeggstr. 27 | Löscher, Viktoriastr. 70 | Sous le Pont, Neubrückstr. 8 Rösterei, Güterstr. 6 | Treffpunkt Azzurro, Lindenrain 5 | Zentrum 44, Scheibenstr. 44 | Café Paulus, Freiestr. 20 Becanto, Bethlehemstrasse 183 | Phil’s Coffee to go, Standstr. 34 IN BIEL Äss-Bar, Rue du Marché 27 | Inizio, Freiestrasse 2 | Treffpunkt Perron bleu, Florastrasse 32 IN BURGDORF Bohnenrad, Bahnhofplatz & Kronenplatz | Specht, Hofstatt 5 IN CHUR Café Arcas, Ob. Gasse 17 | Calanda, Grabenstr. 19 | Café Caluori, Postgasse 2 | Gansplatz, Goldgasse 22 | Giacometti, Giacomettistr. 32 | Kaffee Klatsch, Gäuggelistr. 1 | Loë, Loestr. 161 | Merz, Bahnhofstr. 22 | Punctum Apérobar, Rabengasse 6 Rätushof, Bahnhofstr. 14 | Sushi Restaurant Nayan, Rabengasse 7 | Café Zschaler, Ob. Gasse 31 IN DIETIKON Mis Kaffi, Bremgartnerstr. 3a IN FRAUENFELD Be You Café, Lindenstr. 8 IN LENZBURG Chlistadt Kafi, Aavorstadt 40 | feines Kleines, Rathausgasse 18 IN LIESTAL Bistro im Jurtensommer, Rheinstr. 20b IN LUZERN Jazzkantine zum Graben, Grabenstr. 8 | Meyer Kulturbeiz & Mairübe, Bundesplatz 3 | Blend Teehaus, Furrengasse 7 | Quai4-Markt, Baselstr. 66 & Alpenquai 4 | Rest. Quai4, Alpenquai 4 | Bistro Quai4, Sempacherstr. 10 | Pastarazzi, Hirschengraben 13 | Netzwerk Neubad, Bireggstr. 36 | Sommerbad Volière, Inseli Park | Rest. Brünig, Industriestr. 3 | Arlecchino, Habsburgerstr. 23 IN MÜNCHENSTEIN Bücher- und Musikbörse, Emil-Frey-Str. 159 IN NIEDERDORF Märtkaffi am Fritigmärt IN OBERRIEDEN Strandbad Oberrieden, Seestr. 47 IN RAPPERSWIL Café good, Marktgasse 11 IN SCHAFFHAUSEN Kammgarn-Beiz, Baumgartenstr. 19 IN STEIN AM RHEIN Raum 18, Kaltenbacherstr. 18 IN ST. GALLEN S’Kafi, Langgasse 11 IN WIL Caritas Markt, Ob. Bahnhofstr. 27 IN WINTERTHUR Bistro Dimensione, Neustadtgasse 25 | Bistro Sein, Industriestr. 1 IN ZUG Bauhütte, Kirchenstrasse 9 Podium 41, Chamerstr. 41 IN ZÜRICH Café Noir, Neugasse 33 | Café Zähringer, Zähringerplatz 11 | Cevi Zürich, Sihlstr. 33 | das GLEIS, Zollstr. 121 | Kiosk Sihlhölzlipark, Manessestrasse 51 | Quartiertr. Enge, Gablerstr. 20 | Quartierzentr. Schütze, Heinrichstr. 238 | Flussbad Unterer Letten, Wasserwerkstr. 141 jenseits im Viadukt, Viaduktstr. 65 | Freud, Schaffhauserstr. 118 | Kumo6, Bucheggplatz 4a | Sport Bar Cafeteria, Kanzleistr. 76 | Zum guten Heinrich Bistro, Birmensdorferstr. 431
Weitere Informationen: surprise.ngo/cafesurprise
Machen Sie sich selbst eine Freude oder überraschen Sie jemanden mit einem passenden Geschenk. Sie unterstützen damit eine gute Sache.

SURPRISE-RUCKSACK CHF 99.– (exkl. Versandkosten)
Modell Ortlieb-Velocity, 24l, wasserfest. Hergestellt in Deutschland. Erhältlich in ultramarin, silber und rot.


SURPRISE-HOODED-JACKE CHF 46.– und SURPRISE-T-SHIRT CHF 26.–(exkl. Versandkosten) Fruit of the Loom, kleines Logo vorne, grosses Logo hinten.

SURPRISE-GESCHICHTEN CHF 27.– (exkl. Versandkosten)
Das Buch «Standort Strasse» porträtiert zwanzig Menschen, die es trotzt sozialer und wirtschaftlicher Not geschafft haben, neue Wege zu gehen und ein Leben abseits staatlicher Hilfe aufzubauen.

SURPRISE-MÜTZE CHF 35.– (exkl. Versandkosten)
100% Merinowolle, hergestellt in der Schweiz von Urs Landis Strickwaren in fünf unterschiedlichen Farben und in zwei Modellen. Links: Modell Knitwear / Rechts: Modell Klappkapp.
Weitere Informationen und Online-Bestellung: T + 41 61 564 90 90 | info@surprise.ngo | surprise.ngo/shop
SURPRISE-T-SHIRT
S M L XL
SURPRISE-RUCKSACK rot ultramarin silber
SURPRISE-BUCH
Herrenmodell Damenmodell
SURPRISE-MÜTZE
SURPRISE-HOODED-JACKE S M L XL Herrenmodell Damenmodell
Modell: Knitwear Klappkapp rot schwarz petrolblau mittelgrau pink