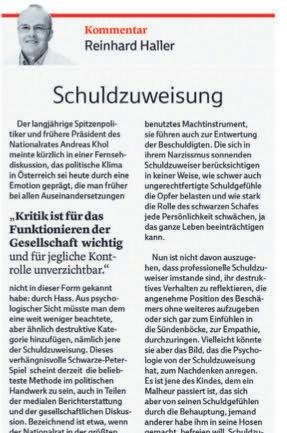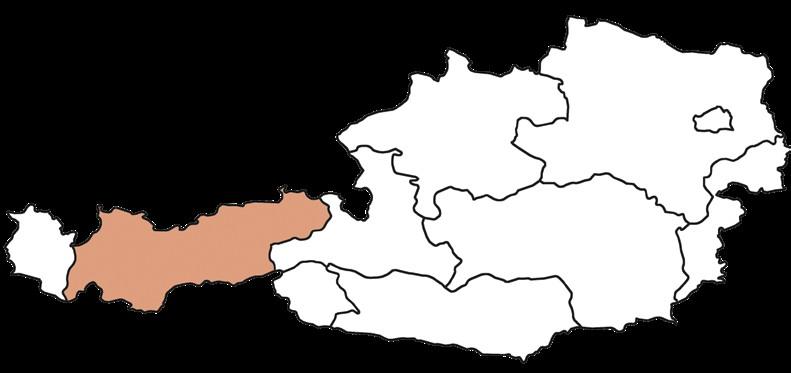www.observer.at
Die Presse Unabhängige Tageszeitung für Österreich Wien, am 19.02.2021, 312x/Jahr, Seite: 8 Druckauflage: 62 876, Größe: 85,66%, easyAPQ: _ Auftr.: 8420, Clip: 13395663, SB: Ischgl
Drei wichtige Erkenntnisse aus der Ischgl-Studie Antikörper-Tests. Wegen der sehr hohen Durchseuchung des Wintersportortes und der gründlich untersuchten Bevölkerung lassen sich relativ verlässliche Rückschlüsse auf die Dauer und Stabilität der Immunität ziehen. VON KÖKSAL BALTACI
Ischgl. Neun von zehn Personen,
die im Frühjahr 2020 nach einer Infektion mit dem Coronavirus Antikörper gebildet hatten, waren auch noch im November vor einer zweiten Ansteckung geschützt. Das ist die Kernaussage der zweiten Runde der Antikörper-Studie aus Ischgl, die am Donnerstag in Innsbruck präsentiert wurde.
Lang anhaltende Immunität 1473 der 1596 Einwohner Ischgls ließen sich Ende April 2020 auf Antikörper testen, mit dem hochgerechneten Ergebnis, dass sich 42,7 Prozent der gesamten Bevölkerung während der ersten Welle angesteckt hatten – der Großteil, ohne es zu merken. Zwei Menschen starben, neun benötigten eine Spitalsbehandlung. Im November wurde erneut zum Test geladen – diesmal mit einer Sero-Prävalenz (Häufigkeit des Nachweises von Antikörpern) von 45,2 Prozent. Untersucht wurden dafür 900 Ischgler ab 18 Jahren, 800 von ihnen nahmen auch schon an der ersten Runde teil – und zwar hauptsächlich jene, die
damals positiv auf Antikörper getestet worden waren. Rund 90 Prozent dieser 800 Personen hatten immer noch – also rund acht Monate nach ihrer Infektion – ausreichend Antikörper im Blut, sodass laut Studienleiterin Dorothee von Laer vom Institut für Virologie der Med-Uni Innsbruck von einer „stabilen Immunität“ ausgegangen werden kann. Zwar sank die Menge an Antikörpern leicht, aber bei den meisten nicht in einem signifikanten Ausmaß. Zudem wurde bei rund 70 Prozent der Genesenen – auf Basis von 93 untersuchten Proben – auch eine zelluläre Immunantwort nachgewiesen. Gemeint sind die sogenannten cytotoxischen T-Zellen, die nicht das Andocken des Virus an Zellen verhindern, sondern bereits befallene Zellen abtöten, damit sich die Viren darin nicht vermehren und sich im ganzen Körper ausbreiten können. Sie sind es also, die nach einer Ansteckung schwere Verläufe verhindern können. Ausgehend davon, dass auch die Wirkung eines Impfstoffs rund ein Jahr anhalten dürfte, geht von Laer davon aus, dass künftig eine Impfung pro Jahr notwendig sein wird – die sehr wahrscheinlich an
die aktuell zirkulierenden Varianten angepasst werden muss, wie das auch bei der Grippeimpfung seit Jahrzehnten der Fall ist.
Rasche „Herdenimmunität“ Um epidemiologisch wertvolle Rückschlüsse aus der sehr hohen Durchseuchung Ischgls zu ziehen, wurde die dortige Ausbreitung des Virus im vergangenen Herbst mit jener in anderen österreichischen Tourismusorten mit ähnlicher Bevölkerungsstruktur und Anbindung verglichen. Während in diesen Gemeinden eine dem BundesSchnitt entsprechende Zahl an Neuinfektionen – mit einem Höhepunkt zwischen 15. und 20. November – registriert wurde, waren es in Ischgl Anfang November nur eine Handvoll, später gar keine mehr. Insgesamt lag die Infektionsrate während der zweiten Welle bei unter einem Prozent. Angesichts dieser Erkenntnisse kann in Ischgl von Laer zufolge zwar nicht mit einer Herdenimmunität gerechnet werden, aber unter Einhaltung von „niederschwelligen Verhaltensregeln“ wie etwa Maske tragen und Abstand halten sollte eine Durchseuchung bzw. Durch-
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at. Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/51414*70). Pressespiegel Seite 8 von 74
impfung von 40 bis 45 Prozent ausreichen, um Infektionswellen wie jene im vergangenen Herbst zu verhindern. Natürlich nur dann, wenn neue resistentere Varianten rechtzeitig erkannt, eingedämmt und mit adaptierten Impfungen unter Kontrolle gebracht werden. Wegen der Südafrika-Mutante etwa beginne der „Schutzwall“ in Ischgl „zu bröseln“.
Verlauf spielt geringe Rolle Zwar gilt grundsätzlich: Je schwerer die Symptome nach der Infektion waren, desto mehr Antikörper wurden auch nach acht Monaten nachgewiesen, aber bereits die erste Runde der Studie ergab, dass der Zusammenhang zwischen der Schwere des Krankheitsverlaufs und den gebildeten Antikörpern nicht überschätzt werden sollte. Auch andere Studien kamen zum Ergebnis, dass milde und sogar symptomlose Verläufe für gewöhnlich ebenfalls zu einer starken Immunantwort führen. Nur ist bei ihnen das Risiko, dass keine verlässliche und anhaltende Immunität aufgebaut wird, etwas höher als bei Genesenen mit schwereren und mittelschweren Verläufen.
Seite: 1/1