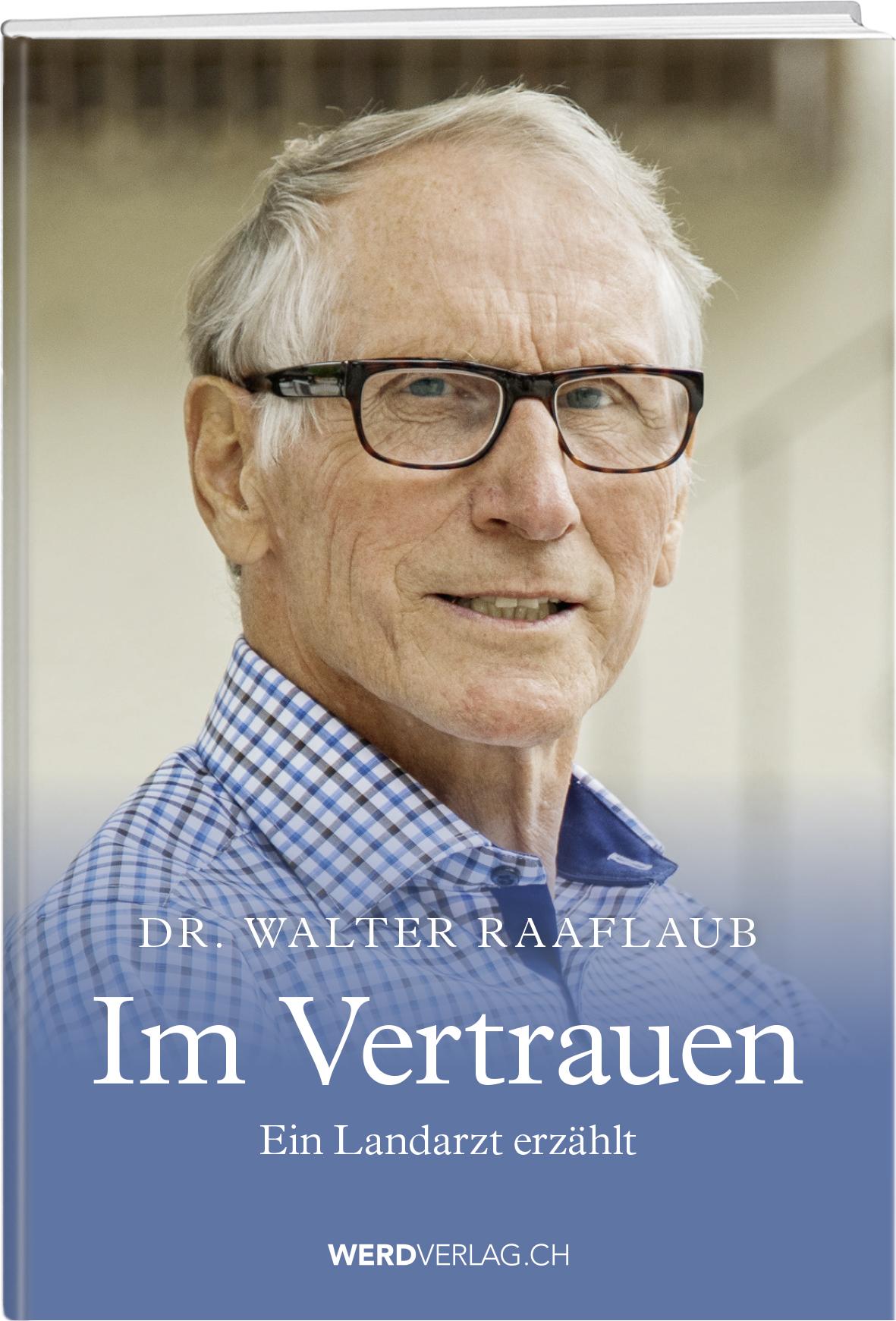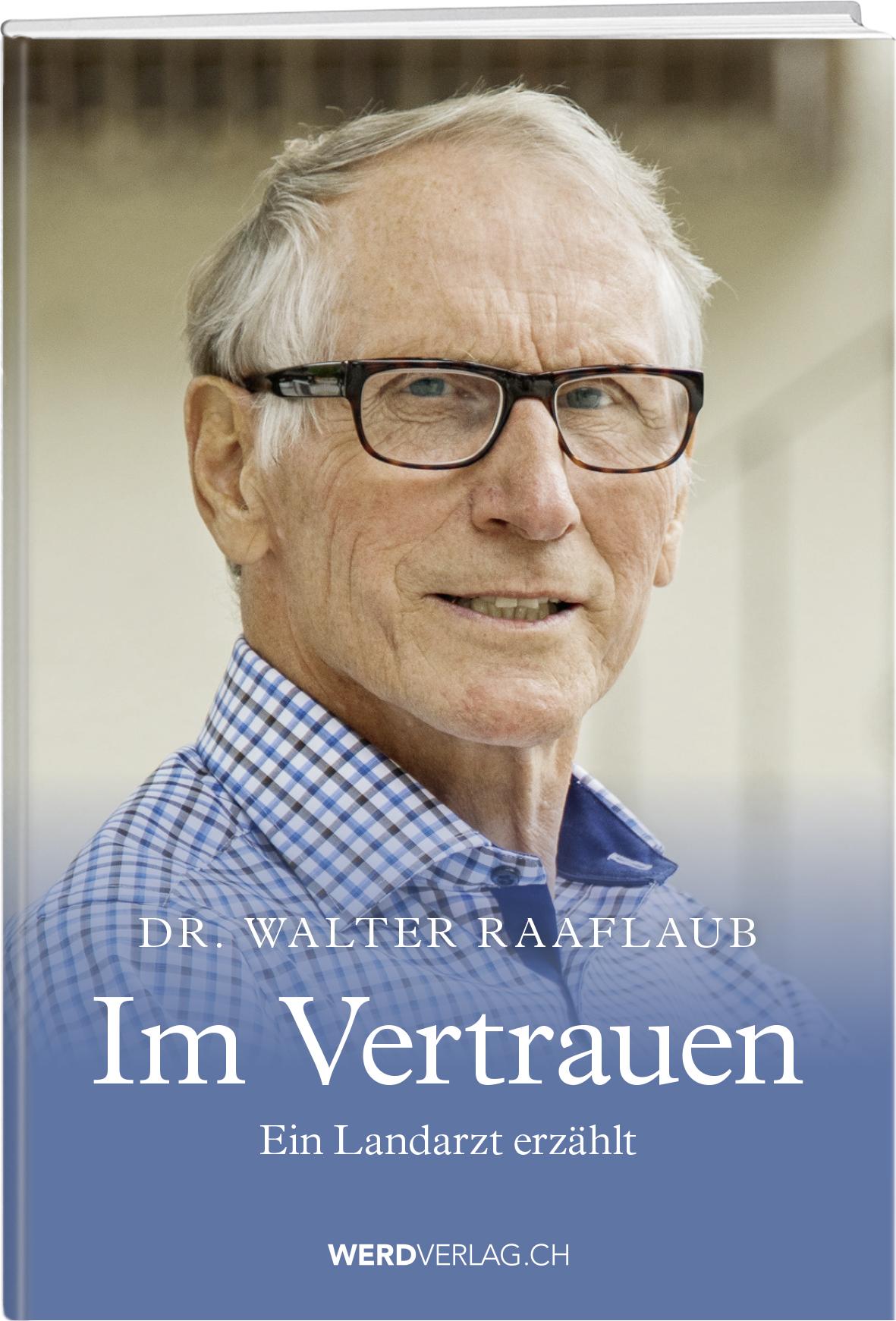
Dieses Buch ist zukünftigen Hausärztinnen und Hausärzten gewidmet. Vielleicht zeigt es ihnen, was sie in einem der schönsten und vielseitigsten Berufe zwischenmenschlich und fachlich erwartet.
Walter Raaflaub
IMPRESSUM
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2017 Werd & Weber Verlag AG, CH-3645 Thun / Gwatt
AUTOR
Walter Raaflaub, CH-3778 Schönried
ILLUSTRATIONEN
Michael Raaflaub, CH-3013 Bern, www.mraaflaub.ch
GESTALTUNG UMSCHLAG
Sonja Berger, Werd & Weber Verlag AG
SATZ
Rahel Gerber, Werd & Weber Verlag AG
LEKTORAT
Madeleine Hadorn, Werd & Weber Verlag AG
KORREKTORAT
Alain Diezig, Werd & Weber Verlag AG
ISBN
978-3-85932-877-8
www.werdverlag.ch
www.weberverlag.ch
INHALTSVERZEICHNIS Liebe Leserin, lieber Leser 9 Die Therapie liegt unter dem Bett 13 Schnitzeljagd um Mitternacht 15 Besuch im Tierheim 17 Nicht der Rede wert? 19 Falsche Messung, richtiger Schluss 21 Die Verwandlung 25 Spitaleinweisung übers Dach 27 Der verräterische Rülpser 29 Krawatten machen Leute 31 Wer fliegt denn da? 35 Schutzengel auch in der Praxis 37 Die Tiere zuerst 39 Duschen und Baden mit Zertifikat 43 Der Koch, der inwendig kochte 45 Kein kalter Kaffee 47 Vertrauen missbraucht? 49 Wirklich aufgeblasen? 51 Wenn Katzen schlaflos machen 53 Auf den Hund gekommen 1 55 Von kleinen und grossen Tieren 59 Ein Sprichwort wird wahr 63 Zum Nulltarif 65 Auf den Hund gekommen 2 67 Von Wanzen und Finanzen 73 Das andere Souvenir 75 Der Kuss in der Kälte 77
Das stichhaltige Argument 79 Alles Ketchup? 81 Aus der Bahn geworfen 83 Nicht mal mehr Stroh im Kopf 85 Das DU 87 Wenn Eidechslein beissen 89 Wer ist da eigentlich krank? 93 Langsam atmen, um schnell zu sein 95 Toller Arzt oder Rossdoktor? 97 Peter Placebo 101 Geburtstag zur falschen Zeit 103 Ein denkwürdiger Handschlag 105 Wie ich dir, so du mir nicht? 109 Such! 111 Der Blick durchs Fenster 115 Fehldiagnose 119 Die-ganz-nebenbei-Klagen 121 Gesund geplappert 123 Der Einspruch des Chirurgen 125 Vergessene Vergesslichkeit 127 Die Cousin-Bakterien 129 O du liebes Vorurteil 131 Leitung dicht – und wieder undicht 133 Hausbesuche – für wen? 135 Familiengeschichten 137 Im WC wird auch genäht 139 Lachen macht gesund 141 Ins neue Jahr gefallen 143 Tausendundein Ratschlag 145 Wer singt, fühlt sich gesund 147 Hedy kauft ein 149
Diagnose unter dem Küchentisch 151 Wenn es ins Auge geht 155 Die Küchen-Konsultation 157 Der Banker korrigiert seine Bilanz 159 Eine Seite genügt nicht 161 Stress für Eltern 165 Glimpflich ausgegangen 167 Wieviel Risiko brauchen wir? 169 Bitte ausziehen! 171 Alles Schwindel? 173 Salben hilft nicht allenthalben 175 Schläfrig oder bloss müde? 177 Der Röntgenblick 181 Atemnot und Lebenskunst 183 Viren regen zum Briefschreiben an 185 Match gewonnen? 189 Kaputtes Thermometer? 193 Noch keine Todesanzeige? 197 Ein Blutbad 201 Der Ärztekoffer macht Freinacht 203 Nicht nur Geld verspielt 205 Ein Arzt auf Abwegen 207 Nur eine rote Zehe 209 Zur Nachahmung empfohlen 211 Abschied 215 Dank 217 Persönlicher Weg 218 Medizinischer Weg 219 Über den Autor 221 Sachwortverzeichnis 223
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Ein früher Freitagabend im Sommer 2005. Ich sass am Schreibtisch im hinteren Sprechzimmer. Soeben hatte ich den letzten Patienten hinausbegleitet. Praxisassistentin Lisa und Lehrtochter Monika waren instruiert, das Telefon ausnahmsweise auf den Anrufbeantworter umzuschalten, sobald niemand mehr angemeldet und das Wartezimmer leer war.
Es war kein besonders anstrengender Tag gewesen. Trotzdem hatte ich es irgendwie nötig, eine Stunde früher nach Hause zu gehen. Ich beendete die Notizen in der Krankengeschichte oder KG, stand auf und öffnete ein Fenster. Die Abendsonne flutete ins Zimmer.
Bald würden mich meine Helferinnen zum Rapport rufen, um die angemeldeten Konsultationen für den Samstagvormittag zu besprechen. Sollte ich jetzt gleich zu ihnen hinausgehen? Ich entschied mich anders. Zog den Kittel aus, hängte ihn an die Tür und liess mich in den Stuhl zwischen Schreibtisch und Fensterfront sinken. Den gemütlichen, tiefen Ledersessel boten wir hauptsächlich Kranken an, die sich für ein längeres Gespräch angemeldet hatten. Aber warum, dachte ich, solltest du dich nicht wieder einmal hineinsetzen dürfen, bloss da sein und dich einige Gedanken lang mit dir selbst unterhalten?
Wie ich nun so dasitze, in die Sonne blinzle und über meine eigene Krankengeschichte und Zukunft sinniere, vernehme ich von draussen Stimmen.
Das Chalet Am Rellerli, in dem sich im Erdgeschoss die Praxis befindet, ist tief in den Hang gebaut. Mein Rückzugsort ermöglicht mir, das Flachdach der Talstation der Gondelbahn zu überblicken. Ein älteres Paar steht zuvorderst am Geländer und schaut den einfahrenden Gondeln zu. Der Betrieb scheint die beiden zu interessieren. Trotzdem zeigen sie wiederholt auch zum Chalet herüber. Und tatsächlich – sie kommen auf unseren Hauseingang zu.
Bevor ich richtig Zeit gefunden habe, aus dem Sessel hochzukommen und nochmals in den Kittel zu schlüpfen, läutet es an der Praxistüre.
Die Frau berichtet nichts Dramatisches. Zweimal kurz hintereinander Durchfall. Kein Bauchweh, keine Übelkeit. Seit mehreren Stunden war es in den Därmen wieder ruhig.
Ob ich ihr den Bauch trotzdem kurz untersuchen könne?
Zu Hause wäre die Unpässlichkeit höchstwahrscheinlich ohne Arztbesuch vorbeigegangen. Auswärts befürchtet man, Krankheit könnte die Ferien unterbrechen oder gar ins Wasser fallen lassen.
Die Untersuchung ergab nichts Beunruhigendes. Ich bot der Frau für Samstagvormittag eine Kontrolle an und Kohletabletten in Reserve, sollte
Im Vertrauen 9
sich der Durchfall wider Erwarten wieder melden. Ihren Dank für die prompte Bedienung schloss sie mit den Worten:
«Wir lesen regelmässig die Kolumne ‹Aus der Praxis› in der Schweizer Familie. Einmal haben Sie geschrieben, die Arztpraxis befinde sich in der Nähe einer Gondelbahn. Daher war es für uns nicht schwierig, den Weg zu Ihnen zu finden.»
Ihr Ehemann ergänzte schmunzelnd: «Gleichzeitig konnten wir uns überzeugen, dass es tatsächlich so ist, wie Sie schreiben … Hoffentlich machen Sie noch lange weiter.»
Liebe Leserinnen und Leser, Sie dürfen beruhigt sein. Hier wird nicht geflunkert. Die Kurzgeschichten aus den Praxisjahren 2001 bis 2006 sind wahr. Fiel während der Sprechstunde und bei Hausbesuchen etwas Ernstes oder Heiteres vor, wovon ich dachte, es könnte auch für Gesunde aufklärend und nebenbei unterhaltend sein, habe ich sogleich nachgehakt, ob ich darüber schreiben dürfe. Einziges Problem: das Arzt-, oder besser gesagt das Patientengeheimnis. Oder noch besser gesagt – einziges Problem: das Vertrauen.
Im Lauf der Jahre hat es sich aus diesem gegenseitigen Vertrauen heraus ergeben, dass mir manchmal das Du angeboten wurde – grad wenn ich ein vermeintlich krankes Herz aushorchen wollte. Also habe ich das Stethoskop wieder von den Ohren genommen und überrascht und gerührt die weibliche oder männliche Hand ergriffen. Seltener kam das Du zuerst von mir – warum das so war, tut hier nichts zur Sache. Das Du hat den gegenseitigen Respekt nie geschmälert – eher war das Gegenteil der Fall. Und da ist mir im Eifer des Schreibens eben passiert, dass ich, ohne zu wollen, geradeheraus «Hansueli Leuenberger» hingeschrieben habe. Korrigieren oder anrufen?
Ich habe mich fürs Anrufen entschieden. Seine Antwort können Sie auf Seite 212 nachlesen.
Also denn: Bei Hansueli Leuenberger nicht; bei allen anderen Patientinnen und Patienten sind Namen und häufig auch die Wohnorte verändert. Aber sagen Sie selbst: Namen und Orte sind hier nebensächlich. Entscheidend war und ist, was sich in der vertrauensvollen und vertraulichen Beziehung zwischen dem Arzt und den Kranken ereignet hat. Behalten Arzt oder Ärztin Augen, Ohren und Herz offen – was ja immer der Fall sein sollte –, liefert der Tagesablauf in jeder Arztpraxis ernste und heitere Episoden genug. Sie müssten bloss als aussergewöhnlich erkannt und festgehalten werden.
In diesem Sinn gebe ich Garantie. Das Leben selbst hat die kleinen Geschichten geschrieben. Ich habe sie dem Leben bloss abgeschrieben.
10
Noch etwas. Was hat jener Ehemann damals gewünscht? «Hoffentlich machen Sie noch lange weiter.»
Ja? Nein? Im Sommer 2005 wusste ich nicht, was ich erwidern sollte; wie lange ich noch «weitermachen» könne – mit dem Kolumnenschreiben und mit meiner Praxis. Drei Jahre zuvor hatte ich die Diagnose Prostatakrebs und nach zwei Operationen störende und bleibende Nebenwirkungen akzeptieren müssen. Da brauchte ich mir wahrlich nichts vorzumachen. Schon als Medizinstudent in den klinischen Semestern, danach in den acht Jahren als Assistenzarzt und vor allem in den zwölf Praxisjahren vor der Diagnose hatte ich an so manchem Krankenbett und bei den vielen Begegnungen in der Praxis zu sehen bekommen und gespürt: Sicherheit im Leben ist ein Hirngespinst, ja, eigentlich ein Witz. Ein gutes Beispiel liefert eben gerade das Prostatakarzinom. Nach Diagnose und Therapie und Kontrollen und erneuten Kontrollen folgen meistens Jahre der Verunsicherung: Komme ich davon – oder gehe ich davon?
Liebe Leserin, lieber Leser! Mein neues Buch beweist Ihnen, dass ich annehmen darf, davongekommen zu sein. Der bisher erfreuliche Verlauf ist zweifellos einer der Gründe, warum diese scheinbar «alten» Kolumnen jetzt in Buchform erscheinen.
Krankheit und Leid altern nicht. Krankheit und Leid begleiten uns alle. Die einen werden häufig, hartnäckig und schmerzlich heimgesucht; andere haben das grosse Glück, selten oder überhaupt nie erleben zu müssen, wie unerwartet und wie brutal eine Krankheit in unser Leben einbrechen kann.
Was ich jedoch allen meinen Leserinnen und Lesern wünsche: Auch Hoffnung und Humor mögen Sie immer begleiten – in gesunden wie in kranken Tagen.
Im Vertrauen 11
Schönried, im Spätsommer 2017 Walter Raaflaub
DIE THERAPIE LIEGT UNTER DEM BETT
Notfalldienst, zwei Uhr nachts. Am Telefon eine kurzatmige Frauenstimme.
«Sie müssen kommen! Es drückt auf der Brust, ich rege mich fürchterlich auf … machen Sie schnell!»
Glücklicherweise war mir bekannt, dass Frau Blumer Nitroglyzerinkapseln auf dem Nachttisch liegen hatte.
«Zerbeissen Sie eines Ihrer Kügelchen und nehmen Sie das Kissen in den Rücken. Aber nicht anstrengen, nicht aufstehen. Ich komme, fahre gleich los.»
Ich war nicht Hausarzt der 79-jährigen ehemaligen Bäuerin. Aber ich kannte sie. Als ich – es sind Jahrzehnte her – noch Lehrer an der neu errichteten Förderklasse in der Gemeinde Saanen war, kam einer ihrer Buben zu mir in die Schule. Lehrer und Schüler waren über die Jahre Freunde geworden. So erfuhr ich von Zeit zu Zeit, wie es seiner Mutter ging. Seit einigen Jahren war sie ganz erblindet und lebte mit der Familie seines Bruders, der den Betrieb übernommen hatte.
Zu dieser Nachtzeit habe ich freie und zügige Fahrt auf der schmalen Grubenstrasse, die Schönried mit Gstaad verbindet. In wenigen Minuten werde ich bei der Patientin sein. Dies ist auch der Grund, weshalb ich mich entscheide, nicht sogleich die Ambulanz auf den Weg zu schicken.
Rund ums Haus stockdunkel. Ich tappe das Tenn entlang. Aufgeregtes Schimpfen weist mir den Weg. In der Schlafkammer ertaste ich den Lichtschalter.
Was mich überrascht: Alle Medikamente, also auch die Nitrokapseln, sind auf dem Nachttisch in unterschiedlich geformte Fläschchen abgefüllt. Weil ja für die Blinde kein Lämpchen nötig ist, bleibt auch für den Telefonapparat genügend Platz. Ein anscheinend nutzloses Plastikschälchen steht auch noch da; wozu es gut sein soll, verstehe ich nicht.
Frau Blumer ist momentan allein. Die Jungen bereiten die Alpfahrt vor. Die Untersuchung muss mich also möglichst rasch ins Bild setzen: Spitaleinweisung ja oder nein? Vorerst lasse ich die aufgeregte Frau Blumer nicht zu Wort kommen. Der Blutdruck ist zu hoch, aber nicht alarmierend hoch. Der Puls schnell, aber regelmässig. Kein kalter Schweiss, beim genauen Nachfragen auch kein Klemmen in der Brust.
«Also, Frau Blumer – jetzt sind Sie dran.»
«Meine neuen Zähne … überall gesucht, sackermänt! Kann sie einfach nicht finden … richtig zum Verzweifeln!»
Im Vertrauen 13
Hatte ich richtig gehört? Ja, ich hatte richtig gehört und auch richtig verstanden.
So kam es, dass ich lang nach Mitternacht in einer einfachen Schlafkammer auf dem rohen, unebenen Holzboden herumkroch. So kam es, dass ich mich endlich auch noch unters Bett zwang – und hinter dem nicht ganz leeren Nachttopf die Teilprothese fand.
Kaum war sie gefunden und lag wieder in dem durchaus nicht nutzlosen Schälchen auf dem Nachttisch, waren die Zeichen eines vermeintlichen Anfalls von Angina pectoris verschwunden.
Einer Zahnprothese sei Dank.
ANGINA PECTORIS
Angina pectoris (siehe auch Seite 38) heisst Beklemmung oder Enge der Brust. Was das Lateinische nicht sagt: Zur Enge in der Brust gehören meist auch Schmerzen, die nicht nur in der Brust auftreten. Angina pectoris ist nur ein Anzeichen, ein Symptom des Leidens koronare Herzkrankheit.
Die Ursache von Enge und Schmerzen ist Sauerstoffmangel in einem Bezirk des Herzens. Blut und damit Sauerstoff werden dem Herzmuskel über kleine Schlagadern zugeführt, die Herzkranz- oder Koronararterien (Kranz oder Korona deshalb, weil sie ähnlich einem Kranz aussen ums Herz herumführen). Sauerstoffmangel tritt ein, sobald die Kranzarterien deutlich zu eng werden, weil sich an und in der Gefässwand Blutfette ablagern. Diese sogenannten Plaques verhärten und können einreissen. An solchen Stellen haften mit der Zeit Blutplättchen und winzige Gerinnsel an, was die Kranzarterien zusätzlich verengt. Für weitere, vorübergehende Verengungen werden auch Krämpfe verantwortlich gemacht.
Der Ort des Brennens, Schmerzes oder Klemmens hängt davon ab, welche Kranzarterie verengt ist. Am häufigsten wird der Druck hinter dem Brustbein verspürt, also mitten auf der Brust. Der Schmerz kann jedoch auch in den Rücken zwischen die Schulterblätter, in die Magengegend, in den linken Arm oder gar in den Unterkiefer ausstrahlen.
Das Risiko für Angina Pectoris ist grösser bei Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und erhöhten Blutfetten. Rauchen und Stress kann Verengungen der Kranzarterien begünstigen. Mein Ratschlag: Lieber einmal zu früh ans Telefon als zu spät.
14
SCHNITZELJAGD UM MITTERNACHT
Wieder einmal Freitag. Wieder 24-Stunden-Notfalldienst.
Überrascht war ich schon, als ich den Namen hörte. Jedenfalls kein Traum – die Uhr zeigte präzis Mitternacht.
Die Ehefrau eines weltberühmten Künstlers wünschte einen Hausbesuch. Ihrem Mann sei übel, er habe erbrochen und Durchfall gehabt. Nein, kein Fieber. Sie hätten an einem Bankett teilgenommen, recht üppig gegessen, höchstwahrscheinlich auch einige Löffel eines Pilzgerichts. Ob ihr Mann sich dabei vergiftet haben könnte?
«Wann hat er von den Pilzen gegessen?»
«Wir sind soeben nach Hause gekommen. Jetzt hören Sie gut zu: Unser Haus ist weitläufig. Ich schliesse Ihnen gleich die Haustüre auf. Danach möchte ich oben bei meinem Mann bleiben. Gehen Sie aussen die Steintreppe neben der Garage hoch und geradeaus zur Türe mit dem Rundbogen. Folgen Sie danach einfach den Spuren. Sie werden uns bestimmt finden.»
Ich hätte ihr noch raten wollen, das Erbrochene nicht wegzuschütten. Aber sie hatte schon aufgelegt.
Was die Frau mit den Spuren gemeint hatte, wurde mir klar, als ich die schwere Holztür aufgestossen hatte. Ausgestreute Papierschnitzel führten mich durch die Eingangshalle des jahrhundertealten, stilvoll renovierten Holzhauses, durch teppichbelegte Gänge, vorbei an Bildern und Fotografien, die jedem Museum zeitgenössischer Kunst gut angestanden wären. Vor allem aber gings schier endlos treppauf – bis vor das Schlafzimmer meines Patienten. Die Türe war bloss angelehnt.
Der Mann sass busper im Bett. Das Erbrechen habe aufgehört. Durchfall sei nur einmal aufgetreten. Sein Gesicht hatte Farbe, sein Händedruck war kräftig. Es wurde bald recht gemütlich. Seine Ehefrau bot mir einen Stuhl an, setzte sich beim Fussende aufs Bett und sah mir bei der Untersuchung zu.
Ich fand nichts Ungewöhnliches. Meine Beurteilung: am ehesten eine Lebensmittelunverträglichkeit. Das Wort Lebensmittelvergiftung vermied ich, empfahl Schwarztee oder Coca-Cola in kleinen Schlucken.
«Dürfen wir Sie den Weg nach unten allein gehen lassen?»
Dank der amüsanten Schnitzeljagd schliefen die Bediensteten ungestört. Und ich fand mühelos zur Haustür zurück. Wie gut, hatte ich als Bub bei den Pfadfindern mitgemacht.
Im Vertrauen 15
PILZVERGIFTUNG
Dies vorweg: Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass es möglich ist, sich in einem Fünfsternehotel eine Vergiftung durch einen Giftpilz zuzuziehen. Die Hotelküche kauft ja die Pilze nicht von Hobbysammlern. Trotzdem an dieser Stelle das Wichtigste:
Die Familie der Knollenblätterpilze verursacht über 90 Prozent der schweren Pilzvergiftungen in der Schweiz (Pilzatlas konsultieren!).
Wichtigste Zeichen: Erbrechen, Durchfall, starkes Bauchweh, jedoch erst sechs bis maximal 24 Stunden nach der Pilzmahlzeit! Trotzdem ist es sinnvoll, bei jedem Verdacht sofort zu reagieren, um den schweren Notfall nicht zu verpassen. Nur scheinbare Erholung nach ungefähr einem Tag, danach zeigt sich bereits die Leberschädigung mit «Gelbsucht». Die Vergiftung reicht von leicht bis tödlich. (Während der 15-monatigen Assistenzzeit im Institut für Rechtsmedizin habe ich leider zwei Todesfälle gesehen.)
Der Fliegenpilz ist für etwa zwei Prozent der Pilzvergiftungen verantwortlich. Innert 30 Minuten können bereits Anzeichen einer Vergiftung auftreten. Sie ähneln insgesamt einem schweren Rausch mit Unruhe und Verwirrung, Angst, gestörtem Gefühl für Ort und Zeit; sogar Halluzinationen kommen vor. Übelkeit und Durchfall sind dagegen eher selten. Anschliessend folgt ein Tiefschlaf. Todesfälle sind äusserst selten.
Merke allgemein: Frühes Erbrechen: eher nicht gefährlich; spätes Erbrechen: vielleicht Lebensgefahr! Erbrochenes aufbewahren.
LEBENSMITTELVERGIFTUNG = LEBENSMITTELINTOXIKATION
Hierbei handelt es sich eigentlich um Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln, die giftige Stoffwechselprodukte von Bakterien enthalten. Theoretisch wäre es möglich, dass eine Zutat des Banketts vor der Verwendung lange ohne Kühlung blieb und sich darin Bakterien vermehren konnten. Kochen tötet sie ab, nicht aber deren Toxine. Je nach Giftstoff kommt es bald zu meist heftigem, aber nur kurz dauerndem Erbrechen und Durchfall bis zu Fieber und Muskelkrämpfen. Dauern Erbrechen und Durchfall an, verliert der Körper innert kurzer Zeit viel Flüssigkeit. Hier drängt sich die Behandlung im Spital schon recht bald auf.
16
BESUCH IM TIERHEIM
Die Miene des Bediensteten, der die gepanzerte Haustür öffnete, wirkte irgendwie säuerlich. Merkwürdig – auch durch das herrschaftliche Treppenhaus wehte etwas undefinierbar Säuerliches, das sich zu einem penetranten Geruch verdichtete, je höher ich stieg.
In einem Zwischengang, wohin mir der Diener vorausging, stand eine WC-Türe offen. Zweimal musste ich hinschauen: Im Lavabo schlief eine Katze. Sie zuckte bloss mit einem Ohr, als ich nähertrat. Aber aufgepasst, du Trampel: Gleich neben der Tür lag mit untergelegten Pfoten ein zweites Büsi. Wie seine Kollegin im Lavabo-Bettchen schien es an Fremde gewöhnt. Träge wandte es das Köpfchen, als ich bei der nächsten Türe anklopfte.
Neben der Dame war der Platz im Doppelbett besetzt. Auf der Bettdecke schlief zusammengerollt ein graues Pudelchen. Eine weitere Katze schmiegte sich schnurrend an meine Beine, eine andere, vornehm getigerte, spazierte auf einer offensichtlich bewilligten Route ungeniert über Kissen und Decken.
Ich stellte den Koffer ab. Kaum klappten die Deckel zurück, angelte ein Büsi – das wievielte? – nach dem Bügel des Stethoskops. Sah ich denn allmählich doppelt? Wer weiss, vielleicht sogar drei- oder vierfach. Im gleichen Augenblick, da ich mich setzte, fand das Tigerli den Ärzte- oder Spielzeugkoffer nicht mehr interessant und sprang mir auf die Knie. Als wüsste es ganz selbstverständlich, wie gern ich Katzen mag.
(Als ich diese Kolumne im März 2004 schrieb, schlief unser Kater Nero neben dem Schreibtisch im Korb, der im Winter auf dem hohen Papierkorb stand. Vom Bürostuhl aus konnte ich den alten Nero bequem streicheln, wenns ihm oder mir gerade guttat.)
Ob ich bei meinem Hausbesuch das Tigerli auf meinen Knien auch gestreichelt habe, weiss ich nicht mehr. Eigentlich war ich ja auf Krankenbesuch und nicht an einer Kleintierschau.
Jedenfalls waren die teils schlafenden, teils aktiven Vierbeiner indirekt schuld daran, dass mir in der Schweizer Familie für einmal der Platz fehlte, in meiner Kolumne auch darüber zu berichten, was der Dame eigentlich fehlte.
Oder hatte ich es zwischen den Zeilen vielleicht doch getan?
Im Vertrauen 17

NICHT DER REDE WERT?
Kari Kappeler liess sich erst in der Praxis blicken, als die Atemnot ihn zwang, bei jedem zweiten Zaunpfahl stehen zu bleiben. Das ärgerte ihn unerchannt. Wie konnte er seinem Bruder in diesem Zustand dabei behilflich sein, noch vor dem ersten Schneefall die Weidezäune umzulegen?
Zweimal habe er eine Lungenentzündung durchgemacht, berichtete Kari ziemlich kurzatmig, während ich Herz und Lunge abhörte. Ich stellte den Kopfteil der Untersuchungsliege höher.
Wann das mit den Lungenentzündungen gewesen sei?
Ach, wie sollte er das noch wissen? Er führe doch kein Sackbüchlein über seine Bresten. Mit dem Schnupper, wie er dem Atmen sagte, gehe es gewöhnlich gar nicht so schlecht. Erst in letzter Zeit habe er deutlich mehr Mühe. Neu sei, dass es ihn zeitweise in der linken Seite zwicke. Aber eigentlich sei das doch nicht der Rede wert.
Mit dieser treuherzig, aber ziemlich zusammenhanglos berichteten Vorgeschichte lenkte mich Kari vorerst auf den Verdacht eines Lungen- oder Herzleidens.
Der Puls in Ruhe normal, Blutdruck und Herztöne ebenfalls, auch keine geschwollenen Knöchel. Fürs Erste keine sicheren Zeichen einer Herzschwäche. Oder doch Überbleibsel alter Lungengeschichten, in letzter Zeit aktiviert durch eine belanglose Erkältung? Über der linken Brustseite schien mir das Atemgeräusch verändert. Aber warum nur links? Hochstehendes Zwerchfell? So oder so: möglicherweise halt doch Flüssigkeit zwischen Brustwand und Lunge. Und weshalb zuckte Kari unmerklich zusammen, als ich die linke Seite abklopfte?
Bevor ich ein Röntgenbild anordnete, bohrte ich nach. Ob etwa ein Unfall …?
«Ach was!» Ungeduldig fiel mir Kari ins Wort und wollte aufstehen. Ich hörte heraus, er wäre am liebsten bereits wieder bei seinem Bruder auf der Weide. Sanft drückte ich ihn auf die Liege zurück.
«Und wenn … sind jetzt bald acht Tage seither …», fuhr er fort. «Aber das ist doch nicht mehr der Rede wert!»
Ich liess nicht locker.
Und siehe da: Kari rückte widerwillig heraus. Er habe lange an einem widerspenstigen Zaunpfahl gerissen. Urplötzlich gebe dieser Laushund nach. «Wie ein Kartoffelsack bin ich rücklings den Hang hinunter … akkurat wie ein Sack!»
Im Vertrauen 19
Sehr vorsichtig, meinen ungeduldigen Patienten genau betrachtend, tastete ich die linke Flanke aus. Er konnte es nicht verbergen. Verzog das Gesicht – es tat ihm weh.
Kari liess sich nur ungern zur sofortigen Untersuchung im Spital überreden.
Die Ultraschalldiagnose «Milzriss» passte dann allerdings nicht zu seiner Lebenseinstellung.
Lassen Sie daher Ihre Ärztin oder Ihren Arzt hie und da mitentscheiden, ob etwas «der Rede wert» sei.
DER MILZRISS – DIE MILZRUPTUR
Wenn der Bauch einem plötzlichen massiven Druck oder Schlag von aussen ausgesetzt ist, spricht man von einer «stumpfen Bauchverletzung»; die Fachleute sagen «stumpfes Bauchtrauma». Am häufigsten wird dabei die Milz geschädigt. Sie liegt im linken Oberbauch unmittelbar unter dem Zwerchfell, ist gut faustgross, zehn bis zwölf Zentimeter lang und vier Zentimeter dick.
Die Milz ist in den Blutkreislauf eingeschaltet und hat die Aufgabe, gealterte rote Blutkörperchen, Blutplättchen und auch Mikroorganismen abzubauen. Andererseits produziert sie kleine, weisse, für die Abwehr wichtige Blutkörperchen, die Lymphozyten.
Die Milz besitzt eine derbe Kapsel. Von blossem Auge betrachtet, besteht dagegen das Innere aus einer weichen, blutigen Masse. Wird durch einen Schlag von aussen dieses weiche Gewebe zerrissen, kommt es zu einer zunehmenden Blutung im Innern der Milz, ohne dass die Kapsel verletzt sein muss. Stunden oder Tage nach dem Schlag oder Stoss reisst die Kapsel unter dem ansteigenden Druck. Dies wird als zweizeitige Milzruptur bezeichnet. Es blutet massiv in die Bauchhöhle. Innert Stunden entsteht Lebensgefahr, wenn die Milz nicht notfallmässig entfernt wird. Ist die Kapsel nur oberflächlich eingerissen und das Innere unverletzt, versucht man, die Milz zu erhalten.
Nach der Milzentfernung verändert sich vorübergehend die Zusammensetzung des Blutes. Gegen verschiedene Bakterien muss geimpft werden, da ja die Produzentin der weissen Abwehrzellen ausgefallen ist. Zudem wird vor kleinen und grösseren Operationen mit Antibiotika gegen Infektionen vorgebeugt.
20
FALSCHE MESSUNG, RICHTIGER SCHLUSS
«Herr Ramseier kommt als Notfall», meldet die Praxisassistentin Eveline. «Eine Blutdruckkrise, wie ich es verstanden habe.»
Also doch weniger harmlos, als ich nach seiner letzten Konsultation vermutet hatte, geht es mir durch den Kopf. Seit etwa zwei Jahren hat Werners Blutdruck bei verschiedenen Besuchen knapp über 150 zu 90 gelegen. Meist brachte der pensionierte und immer noch vielerorts beschäftigte Lehrer gleich auch eine Erklärung dafür mit.
«Wir haben das jüngste Enkelkind während einer Woche gehütet. Es wollte nicht richtig essen und ist doch so ein Sprenzel. Das hat mich beunruhigt und gestresst.»
Ein andermal war es der tagelange Föhn, der Werner nicht schlafen liess. Das mache ihm Kopfweh und rege ihn auf. Und Kopfweh könne doch wohl auch schuld sein, dass der Blutdruck schwanke. Bei der letzten Konsultation entschuldigte er sich, er sei zu spät von daheim abgefahren, den donners Autoschlüssel habe er einfach nicht gefunden.
«Ich rauche nicht, Cholesterin normal, die Eltern zwar lang schon gestorben, aber die sollen auch nichts mit dem Herzen gehabt haben – da magst du mir das bisschen Blutdruck wohl noch gönnen!»
Das war Werners bagatellisierende Einstellung. Ich vermutete, dahinter stecke seine grundsätzliche Abneigung gegen Medikamente –«wenns ja mit Knoblauch und der Schlangenwurzel allermeistens auch geht …!»
Um mir zu beweisen, dass es allermeistens sogar ohne Arztbesuch gut geht, hat mich Werner letzthin aus einem Supermarkt angerufen. Ob ich etwas dagegen habe, wenn er sich so ein Blutdruckapparätli kaufe: «Bedienung absolut fantastisch einfach!» Man lege das Ding ja einfach ums Handgelenk und drücke zweimal – schwupp, der Blutdruck werde angezeigt. Ganz getreu dem Motto: Selbst ist der Mann, selbst ist der Patient.
Jetzt sitzt er bei mir und klagt, das Ding zeige Werte bis 230 zu 110 an. Sein Gesicht verrät: Das findet er nun selbst gar nicht mehr lustig. Er hat auch schon von Leuten gehört, die wegen zu hohen Blutdrucks an einem «Schlegli» gestorben seien.
«Weisst du, einfach so ganz plötzlich … nein, nein, das hingegen will ich nicht. Das macht mir jetzt doch Angst.»
Im Vertrauen 21
Meine Kontrolle mit Oberarm-Blutdruckmanschette und Stethoskop beruhigt die Situation. Dass es heute knapp 160 zu 95 sind, können wir mit der momentan aufgeregten und aufregenden Situation erklären.
Ich schiebe ihm unser Handgelenksapparätli zu. «Jetzt miss du selber auch noch mal …»
Ja klar, ein solches Ding gibts in der Praxis auch, aber eigentlich bloss, um damit instruieren zu können.
Werner legt es bedächtig um. Die Seite mit dem Display, also mit den Zahlen, hinter dem Handrücken. Wie eine Uhr. Also falsch. Der Sensor misst nicht über der Schlagader, sondern über Speiche und Elle.
Wir lachen beide. Beiden tut das Lachen gut.
«Der alte Lehrer hat zwei Dinge begriffen», schmunzelt Werner. «Nicht bloss, wie so ein verflixtes Ding funktioniert. Ich habe auch den Schluss daraus gezogen, dass es vielleicht doch gescheiter ist, von heute an ein Blutdrucktablettli zu akzeptieren.»
BLUTHOCHDRUCK – HYPERTONIE
In industrialisierten Ländern dürfte der Bluthochdruck das wichtigste Problem im öffentlichen Gesundheitswesen sein. In der Schweiz hat knapp jede vierte Person einen zu hohen Blutdruck.
Gemeint ist der Druck des Blutes im Moment, da das Herz das Blut in die Schlagadern pumpt oder auswirft (systolischer Blutdruck) und im Moment, da sich das Herz wieder füllt (diastolischer Blutdruck). Die Zahlen oder Werte bei der Blutdruckmessung beziehen sich darauf, wie hoch die Pumpkraft des Herzens eine Quecksilbersäule drücken kann. 130 mm Hg bedeuten: 13 cm Quecksilber(Hg)-Säule. In den ersten Jahren nach der Praxiseröffnung 1990 habe ich noch ein aufklappbares Quecksilber-Blutdruckgerät verwendet; die Leute konnten ihren Blutdruck noch sehen.
Die Medizin unterscheidet zwei Formen von Bluthochdruck:
Primäre Hypertonie: Dabei ist die Ursache nicht bekannt. Dies betrifft etwa 90 bis 95 von 100 Leuten.
Sekundäre Hypertonie: Bei diesen fünf bis zehn Prozent sind für den Bluthochdruck andere Krankheiten verantwortlich. Sie betreffen vor allem die Nieren sowie Hormonstörungen; aber auch an die Nebenwirkungen von Medikamenten ist immer zu denken.
Versuchen wir es mit Zahlen:
Normal: 120 – 129 zu 80 – 84 mm Hg
Hochnormal: 130 – 139 zu 85 – 89
Leichter Bluthochdruck: 140 – 159 zu 90 – 99
22
Mässiger Bluthochdruck: 160 – 179 zu 100 – 109
Schwerer Bluthochdruck: 180 und höher zu 110 und höher
Etwa zwölf Prozent der Diagnosen in einer Schweizer Arztpraxis betreffen Herz- und Kreislauferkrankungen. Ungefähr jede zehnte Spitaleinweisung erfolgt wegen dieser Diagnosen. Dass davon nur gerade ein halbes Prozent die Diagnose «Bluthochdruck» betrifft, ist damit zu erklären, dass hoher Blutdruck viele andere Krankheiten von Herz und Kreislauf nach sich zieht, die als primärer Einweisungsgrund angegeben werden.
Bei der Untersuchung wegen zu hohen Blutdrucks sollte es darum gehen, herauszufinden, ob es nicht eine sekundäre Ursache der Hypertonie gibt, die sich behandeln lässt – womit auch der Bluthochdruck behandelt wäre.
(Schweizerische Herzstiftung: Zahlen und Daten über Herz-Kreislauf-Krankheiten in der Schweiz, 2012)
Bei der vom Lehrer Ramseier erwähnten Schlangenwurzel handelt es sich um die Rauwolfiawurzel. Sie enthält Alkaloide, zum Beispiel das Reserpin, das auch in einem Medikament gegen Bluthochdruck enthalten ist. Aber aufgepasst: Reserpin kann je nach Dosis schwere Nebenwirkungen haben. Nehmen Sie bitte keine Substanzen aus Schlangenwurzel ein, ohne Ihre Ärztin oder Ihren Arzt zu informieren.
Zum Knoblauch: eine medizinische Wunderwaffe und Wundertüte. Er soll gegen Bakterien und Pilze wirken, die Blutfette senken, die Arterienverkalkung hinauszögern und die Verklumpung der Blutplättchen hemmen. Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen oder Magen-Darm-Beschwerden sind äusserst selten.
Was dagegen äusserst häufig ist, erfahren Sie, wenn Sie sich neben einer Person aufhalten, die frischen Knoblauch gegessen hat.
1997 wurden aus dem Weizmann-Institut in Israel zwei Studien bekannt. Sie klärten die molekularen Mechanismen auf, die für die vielen aus der volksmedizinischen Erfahrung bekannten guten Wirkungen des im Knoblauch enthaltenen Stoffes Alliin verantwortlich sind.
Im Vertrauen 23
(Der Bund Nr. 236, 11. Oktober 1997)
DIE VERWANDLUNG
Nicht immer darf der Arzt nur zum Besten des einzelnen Patienten handeln. Dem Wohl der Allgemeinheit ist er ebenso verpflichtet.
Dieses Dilemma wurde mir jedes Mal bewusst, wenn ich als Kreisarzt zu einer vom Staatsanwalt angeordneten Blutentnahme ins Spital oder auf einen Polizeiposten gerufen wurde. Meist betraf es das «Fahren in angetrunkenem Zustand», im Fachjargon FIAZ. Aber auch das FUD, das «Fahren unter Drogen», nimmt leider zu.
Lässt sich die Person nicht freiwillig Blut abnehmen, muss die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Handlung gar erzwingen.
Nach Mitternacht hat man mich ins Spital gerufen. Um sicherzugehen, dass es bei allfälligem Widerstand nicht zu Sachschaden kommt, soll die Prozedur nicht im Labor, sondern in einem Nebenraum stattfinden.
Bei Armin A. nützt freundliches Zureden, doch bitte den Arm freizumachen, nichts. Die vorgeschriebenen Tests zur groben Beurteilung der Angetrunkenheit und damit auch zur Fahrfähigkeit verweigert er.
Möglichst unauffällig versuche ich, ihn auf andere Gedanken zu bringen und ihn damit zu einem Gespräch zu bewegen. Die Polizisten haben ihm vermutlich schon klargemacht, dass er sich mit seinem Verhalten nur selbst schadet. Trotzdem quittiert er meine Ablenkungsmanöver mit spöttischem Gelächter.
Ein scheinheiliger Siech sei ich, höhnt er. Ich getraue mich ja überhaupt nur, ihn zu stechen, weil die Schmier in der Nähe sei.
Ja, auch die beiden Polizisten bei der Tür werden zünftig abgeputzt. Müssen sie doch noch Zwang anwenden? Der eine greift bereits nach dem Handy, um sich mit der Staatsanwaltschaft verbinden zu lassen.
Lärm vor dem Untersuchungszimmer. Die Tür wird aufgerissen. Die Polizisten springen zur Seite.
Ein Pfleger der Notfallaufnahme steht unter der Tür – in Feuerwehruniform.
«Das Holzbaudepot brennt … meine Vertretung ist organisiert!»
Und weg ist er.
Dem widerspenstigen Armin bleiben die letzten Silben des beleidigenden Gezänks im Hals stecken. Stimme und Stimmung schlagen radikal um.
«Was? Das Depot brennt? Dort habe ich doch jahrelang gearbeitet … das darf doch nicht wahr sein …!»
Er streift den Hemdsärmel hoch. Streckt mir den Arm hin. Zuckt nicht mit der Wimper. Verzieht keine Miene, während sich das Röhrchen mit seinem Blut füllt.
Im Vertrauen 25
Reagieren wir unter gewissen Umständen immer noch wie kleine Kinder? Eben noch Geschrei und Lamento. Etwas ganz und gar Unerwartetes tritt ein – und man weiss nicht einmal mehr, was es zu lamentieren gab. So ist auch der Wochenend-Sünder Armin A. wieder in den verantwortungsbewussten Alltagsmenschen Armin Allmen geschlüpft. Feuersbrunst sei Dank.
FAHREN IN ANGETRUNKENEM ZUSTAND – FIAZ
• Laut dem Bundesamt für Strassen ASTRA und dem Büro für Unfallverhütung starben 2016 in der Schweiz 216 Personen bei Verkehrsunfällen.
• Ungefähr die Hälfte aller Unfälle in der Nacht sind auf Alkoholeinfluss zurückzuführen.
• Jeder zehnte Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen und jeder fünfte tödliche Verkehrsunfall ist auf Alkoholeinfluss zurückzuführen.
• Es gibt ungefähr 15 000 Verurteilungen wegen Alkohol am Steuer pro Jahr.
• Im Kanton Bern werden pro Jahr ungefähr 2100 Abklärungen der Fahrfähigkeit wegen Alkoholeinfluss durchgeführt.
• Jeder vierte Arbeitsunfall ist alkoholbedingt
FAHREN UNTER DROGEN – FUD
Seit 1.1.2005 ist das revidierte Strassenverkehrsgesetz in Kraft: Für Cannabis gilt der Grenzwert 0. Wer THC (Tetrahydrocannabinol) im Blut hat, ist fahrunfähig. Im IRM Bern wurde 2003 bereits bei fast der Hälfte der 800 Urinproben von Fahrzeuglenkenden THC nachgewiesen.
(Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern, Dr. rer. nat. Werner Bernhard)
26
SPITALEINWEISUNG ÜBERS DACH
Ein Sonntagabend im Winter, den ich lieber am Kaminfeuer verbracht hätte als unterwegs zu einem vierzehn Kilometer entfernten Notfall.
Eine besorgte Bäuerin schilderte beim betagten Schwiegerpapa eigentlich alle Zeichen einer Lungenentzündung: Fieber, Husten, Brustschmerz und Mühe beim Atmen.
Beinah meterhoch säumt der Schnee das kurvenreiche Strässchen. Das Bauernhaus am Sonnenhang hoch über Lauenen wirkt wie in Watte eingepackt.
Über eine steile Estrichtreppe klettere ich dem Sohn hinterher in die neu ausgebaute und hübsch eingerichtete, niedrige Schlafkammer des 77-jährigen Seniorbauern. Noch vorgestern Abend sei Papa flink wie sein Kater die leider grausam stotzige Treppe hochgestiegen. Gewöhnlich sei er am Morgen vor allen andern schon wieder im Stall gestanden. Aber gestern sei er liegen geblieben, es habe ihn geschüttelt wie ein pflotschnasser Hund sich schüttle, heute mache es den Anschein, er spucke Blut. Und jetzt?
Der Papa sitzt, zwei Kissen im Rücken, mit bläulichen Lippen, aber feuerrotem Gesicht und heisser Stirn im Bett. Er atmet schnell und kurz.
Der Sohn stellt sich ans Fussende und zieht den Vater an den Händen hoch. Eigentlich könnte ich dem Kranken das Abhorchen der Lunge ersparen. Mein Sprüchlein «Bitte tief ein- und ausatmen!» kommt mir momentan lächerlich vor. Noch bevor ich mit der Untersuchung fertig bin, wird klar: Lungenentzündung. Nach allem, was der Sohn berichtet hat, mit grösster Wahrscheinlichkeit die sogenannt klassische, die meistens einen ganzen Lungenlappen erfasst. Der Mann muss dringend ins Spital.
Nur – wie soll das gehen? Der sonst so rüstige Bauer vermag sich nicht mehr auf den Beinen zu halten. Wie werden es die Sanitäter bewerkstelligen? Weder für Bahre noch Tragstuhl ist die Luke im Fussboden gross genug. Huckepack wird es erst recht unmöglich sein, den Mann herunterzuholen.
Der Sohn deutet auf das neue, grosse, verschneite Dachfenster.
«Sollen wirs probieren?»
Ich nicke. «Gute Idee. Ich denke, wir sollten nicht, wir müssens probieren. Wenn Sie Ihren Papa winterfest einpacken und auch mir eine Schneeschaufel besorgen …»
Nachdem die Ambulanz bestellt und die Situation geschildert ist, streife ich meine schwarze Zipfelmütze wieder über. Ohne sie setze ich im Winter keinen Schritt vor keine Tür. Ich hole die Sauerstoffflasche für den Patienten
Im Vertrauen 27
und für mich die Handschuhe. Erst jetzt fällt mir auf, wie tief das Haus in den Hang hinein gebaut ist. Kurz danach stapfen wir seitlich die Böschung hoch und aufs knietief schneebedeckte Dach. Unter dem sternenfunkelnden Nachthimmel schaufeln wir das Dachfenster frei. Schaufeln auch noch einen Weg übers Dach und seitlich über eine Steintreppe bis zum Vorplatz.
Bald danach fährt die Ambulanz vor.
Ich erinnere mich nicht mehr, wie die Aktion in allen Einzelheiten über die Bühne, das heisst: übers Dach ging. Aber es ging.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auch wenn das Sprichwort offenlässt, ob der Weg nicht auch einmal über ein verschneites Hausdach führen kann.
LUNGENENTZÜNDUNG – PNEUMONIE
Das Wort hat seinen Schrecken weitgehend verloren, seit es das Penicillin und andere Antibiotika gibt. Sind Erkrankte nicht altershalber oder durch andere Leiden geschwächt, ist die Behandlung im Spital oft nicht einmal mehr nötig. Und doch ist die Lungenentzündung in den industrialisierten Ländern immer noch die häufigste Todesursache unter den Infektionskrankheiten.
Pneumonien werden meist durch Bakterien oder Viren verursacht. Selten finden sich Parasiten oder Pilze als Erreger oder eine allergische oder chemisch-toxische Ursache.
Die sogenannt klassische, aber eher selten gewordene Pneumonie wird durch Bakterien verursacht, die bei mindestens der Hälfte aller Leute im Nasen-Rachen-Raum vorhanden sind. Sie befallen häufig einen ganzen Lungenlappen. Typischerweise tritt diese Lungenentzündung bevorzugt zu Hause auf. Im Verlauf der Erkrankung verändert und verhärtet sich das sonst so leichte, weiche, luftgefüllte Lungengewebe durch Eiter und Entzündungsflüssigkeit dermassen, dass es eher einem Stück Leber gleicht. Schüttelfrost, sehr hohes Fieber, häufig rostroter Auswurf und ein schlechter Allgemeinzustand sind neben der Atemnot die typischen Zeichen. Die Rückbildung dieser «Leber-Lunge» kann unbehandelt oder zu spät behandelt bis zu vier Wochen dauern. Wen es wundernimmt, wie eine Lappenpneumonie vor der Antibiotika-Ära verlaufen ist, lese es bei Jeremias Gotthelf nach, zum Beispiel in «Ueli der Pächter», 20. Kapitel. Um den zehnten Krankheitstag herum entschied es sich jeweils, ob die Lungenentzündung überlebt würde.
Andere Bakterien befallen nur einen kleinen Teil der Lunge. Stecken Viren, allenfalls auch Pilze oder Parasiten dahinter, spricht man von atypischen Pneumonien. Die klassischen Zeichen wie Fieber, Husten, Brustschmerz, Auswurf und Entzündungszeichen im Blut sind dann nicht immer vorhanden. Oft führt erst das Röntgenbild zur Diagnose.
28
DER VERRÄTERISCHE RÜLPSER
Schwankend und angeblich ohne Erinnerung, der Kopf blutverschmiert. So fand seine Haushälterin den pensionierten Spenglermeister. Sie meldete ihn als Notfall an – «zum Nähen».
Was es denn zu nähen gebe, wollte Lisa wissen. – Eine Schramme am Kopf. – Und Alkohol? – Das glaube sie nicht, seit bald 20 Jahren nicht mehr.
Auch nach langem Warten traf niemand ein. Wir hakten telefonisch nach. Er weigere sich
Also machen wir uns reisefertig. Lisa packte ein, was uns für eine Wundnaht in der guten Stube dienlich sein würde. Lehrtochter Monika hütete die Praxis.
Es sollte zu keiner Wundnaht kommen. Die Blutspuren und die Auskunft der Betreuerin legten nahe, der Pechvogel habe sich an der scharfen Kante des Wohnzimmerbuffets eine beinah 20 Zentimeter lange, klaffende Wunde in der Kopfhaut zugefügt.
Arbeit für den Spitalchirurgen, entschied ich. Zudem musste die Wundversorgung unter sterileren Bedingungen stattfinden. Was mich störte: das distanzlose Verhalten des Verletzten. Aber eine Alkoholfahne war nicht zu erschnuppern. Hatte der Spengler eine Streifung gehabt? War er deshalb gefallen? Hatte er beim Sturz eine Gehirnerschütterung erlitten oder gar eine Hirnblutung? Oder wars eben doch nur der hochprozentige Geist aus einer gut versteckten Flasche, mit schlechtem Gewissen und in grossen Schlucken hinuntergespült?
Als der Mann «Ambulanz» hörte, begehrte er gewaltig auf. Nicht mit 77 Rossen bringe man ihn in diesen donners Strassenheuler.
Ärgerlich machte ich den Anruf rückgängig. Wir legten dem Widerspenstigen einen Kopfverband an.
«Aber jetzt Marsch! Steigen Sie sofort bei uns ein!»
Wir setzten ihn neben mich. Lisa sass hinter ihm, um notfalls zu verhindern, dass er während der Fahrt zur Seite kippte.
Wir waren noch keine 100 Meter unterwegs, da entfuhr ihm ein gewaltiger schnapsiger Rülpser.
Erfreut über diese Unanständigkeit gab ich Gas.
Zumindest in der Sparte «Vertrauen» wird die Haushälterin umlernen müssen.
Im Vertrauen 29
KÖRPERVERLETZUNG UND ALKOHOL
(siehe auch Seiten 35/36 und 139/140)
Ganz entscheidend ist: Hat jemand die Unfallsituation beobachtet und sind verlässliche Personen da, die Auskunft geben können?
Beim heimlifeissen Spenglermeister und seiner gutgläubigen Haushälterin war der Fall klar. Aber nicht immer liegen die Dinge so einfach.
Eine Wunde im behaarten Kopf, also in der sehr gut durchbluteten Kopfschwarte, kann enorm stark bluten. Bei einer Person, die in einer grossen Blutlache liegt, kann daher eine belanglose Hautverletzung eine lebensgefährliche Situation vortäuschen. Aber aufgepasst: Ob diese Person bloss stark betrunken ist und aus einer harmlosen Hautschramme blutet oder ob sie wegen eines unsichtbaren Schädelbruchs mit Hirnverletzung bewusstlos ist und in Todesgefahr schwebt, darf niemals bloss anhand offensichtlicher Zeichen von Trunkenheit entschieden werden.
Im Zweifel immer alarmieren:
144 Sanität /Ambulanz, 1414 Rega, 117 Polizei
Ein Beispiel aus meiner Assistenzzeit am Gerichtlich-medizinischen Institut in Bern (heute Institut für Rechtsmedizin IRM):
Ein noch nicht 50-jähriger Mann mit einer Platzwunde am Kopf und Schürfungen im Stirn- und Nasenbereich wird nach Mitternacht am Fuss einer Mauer von Passanten bewusstlos aufgefunden. Gemäss der Polizei wurde er drei Stunden zuvor noch in einer Bar gesehen, wo er ziemlich viel getrunken haben soll. Seine Tour per Ambulanz: Bezirksspital – Kantonsspital – Neurochirurgie Inselspital.
Was in den Zwischenstationen zum Vorschein gekommen war: Schürfungen an Stirn und Nase, an Handrücken und Bein; Bruch des Brustbeins, dreier Rippen und eines Halswirbels; Bruch des Schädeldachs und der Schädelbasis beidseits, Hirnblutung.
Und jetzt: Wie hoch war jene Mauer? Sie war 2 Meter und 30 Zentimeter hoch.
30