MAG





Verehrtes Publikum,
heute morgen habe ich eine Orchesterprobe besucht. Auf den Pulten der Philharmonia Zürich lag der zweite Akt aus Richard Wagners Siegfried, am Pult stand unser Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda. Am 5. März hat der dritte Teil des neuen Zürcher Rings Premiere, und im Orchesterprobenraum am Kreuzplatz kann man an diesem Morgen erste Eindrücke sammeln, wie dieser Siegfried wohl klingen wird, den Gianandrea Noseda die sinfonischste Oper des Rings nennt. Mime, Siegfried, Brünnhilde und all die anderen Figuren, die diesen RingTeil bevölkern, sind auf einer szenischen Probe. Der Dirigent vertieft sich mit seinen Musikerinnen und Musikern ausschliesslich in den orchestralen Part der Partitur. Wir sind im tiefsten Wald, gedeckte instrumentale Farben, dunkle Stimmungen, abgründige musikalische Gedanken. Und sofort ist dieser spezifische Wagnerton da, der Nosedas WagnerInterpretation bereits in Rheingold und Walküre ausgezeichnet hat und so wunderbar geprägt ist von Plastizität und zügig fliessenden Bewegungsformen.

Noseda entwickelt die Partitur als ein feinstoffliches, dicht und zugleich durchscheinend gewirktes Motivgewebe. Er dirigiert ungemein energetisch, ohne das Kraftvolle als eine Frage von Lautstärke zu interpretieren. Vor allem aber lässt er die RingMusik einfach nur packende, dramatische Musik sein ohne mythisch raunende Überbedeutung und deutschtiefe Schwere. Vielleicht schlägt da tatsächlich etwas Italienisches durch in seiner Art, Wagner zu interpretieren. Aber das müssen am Ende andere beurteilen. Es stehen ja auch noch einige musikalische Proben auf dem Plan, bevor sich der Vorhang zur Premiere hebt.
Gianandrea Noseda hat im Vorfeld der RingProduktion in einem Interview gesagt, er strebe einen «bellinesken», also auf der Kantabilität und den grossen melodischen Bögen Vinzeno Bellinis aufbauenden Wagner an. Die Zürcher Besetzung der beiden heldischen Hauptfiguren dürften diesem Verständnis entgegenkommen. Als Siegfried gibt Klaus Florian Vogt sein Rollendebüt. Er ist im WagnerRepertoire zu Hause und seit vielen Jahren einer der begehrtesten Lohengrine weltweit – aber kein stählerner Heldentenor klassischer Prägung. Vogt bringt zwar inzwischen das stimmliche Material und die Ausstrahlung mit, um Siegfried auf der Bühne zu verkörpern, aber sein Tenor ist leichter und beweglicher, und das wird ihm Möglichkeiten eröffnen, auch die verletzlichen und zarten Seiten der Figur auszuloten. Ähnliches gilt für Camilla Nylund als Brünnhilde: Auch sie debütiert in ihrer Partie, auch sie ist keine Hochdramatische, verfügt aber über einen hellen Sopran mit ganz grossem Ausdrucksspektrum. Sie können sich also freuen, verehrtes Publikum, auf eine Fortsetzung des Rings mit vielen spannenden musikalischen Aspekten. Selbstverständlich wird auch Andreas Homoki als Regisseur seinen in Rheingold und Walküre so erfolgreich eingeschlagenen Inszenierungsweg fortsetzen.
MAG 99 / Feb 2023
Unser Titelbild
zeigt Wolfgang
Ablinger-Sperrhacke, der den Mime in «Siegfried» singt (Foto Florian Kalotay)
Unsere aktuelle MAG Ausgabe bereitet Hintergrundinformationen, Denkanstösse und Künstlerbegegnungen rund um die SiegfriedNeuproduktion in bewährter Weise für Sie auf. In unserer aktuellen Debatte «Wie toxisch ist das Opernrepertoire?» beleuchten wir die Frage, wie man fremde Kulturen noch auf die Opernbühne bringen kann in einer Zeit, in der die Debatte um die sogenannte kulturelle Aneignung hohe Wellen schlägt.
Claus SpahnDer Podcast des Opernhauses
Weltweit ist er als Wagner-Tenor gefragt, hier am Opernhaus Zürich gibt er sein Rollendebüt als Siegfried. Im Podcast spricht der Tenor Klaus Florian Vogt mit Beate Breidenbach über die Figur Siegfried, die in seiner Interpretation mehr ist als ein tumber Tor und durchaus auch zarte, leise Töne kennt. Ausserdem erzählt er, dass eine Wagnerpartie zu singen für ihn leicht und stimmschonend ist und warum er es vorzieht, auf Reisen im Wohnmobil zu wohnen statt im Hotel.

12 Ein Gespräch mit dem «Ring»-Dirigenten Gianandrea Noseda über musikalische Aspekte in Wagners «Siegfried»
16 Regisseur Andreas Homoki
über seinen Blick auf den Helden
Siegfried 24 Richard Wagner und der Antisemitismus –der Kulturwissenschaftler Jens
Malte Fischer analysiert die Judenfeindlichkeit des «Ring»Komponisten 46 Wie toxisch ist das Opernrepertoire? In der dritten Folge unserer Debatte geht es um kulturelle Aneignung.
Ich sage es mal so – 4, Opernhaus aktuell – 6, Drei Fragen an Andreas Homoki – 7, Wie machen Sie das, Herr Bogatu? – 9, Volker Hagedorn trifft … – 30, Auf dem Pult – 37, Wir haben einen Plan – 38, Der Fragebogen – 44, Kalendarium – 53
Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Christopher Purves, der den Bösewicht Alberich im «Ring des Nibelungen» singt
 Fotos Michael Sieber
Fotos Michael Sieber
Christopher Purves ist Brite und war Chorschüler am King’s College in Cambridge sowie Mitglied der experimentellen Rockband «Harvey and the Wallbangers». Heute singt er ein breitgefächertes Repertoire vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik und tritt an Opernhäusern in London (Covent Garden), Madrid, Houston, München und Paris auf. In Zürich sang er bereits den Dreieinigkeitsmoses in «Mahagonny» und den Alberich im «Rheingold»
Spielen Sie gern den Bösewicht?
Wieviel Alberich steckt in Ihnen?

Möchten Sie mehr komische Rollen singen?



Zeigen Sie uns Ihren britischen Humor!
Wie schwierig ist der deutsche Text im «Ring»?
Das vielleicht bekannteste Duett der gesamten Opernliteratur stammt aus Léo Delibes Oper Lakmé: Das «Blumenduett» ist nicht nur im Konzertsaal beliebt, sondern wurde auch durch Werbespots zu einem regelrechten Hit. Aber auch die «Glöckchenarie» der Lakmé gehört zu den Paradestücken berühmter Stimmvirtuosinnen. Die Titelpartie der Oper ist wie geschaffen für eine der herausragenden französischen Stimmen unserer Zeit: Der Sopran von Sabine Devieilhe vereint glasklare Koloratur-Leichtigkeit mit farbenreicher, lyrischer Wärme. An ihrer Seite tritt der hochgehandelte Belcanto-Tenor Edgardo Rocha als Gérald auf. Mit Philippe Sly (Nilakantha) und Björn Bürger (Frédéric) sind zwei entdeckenswerte Stimmen der jüngeren Generation erstmals am Opernhaus Zürich zu hören. Die musikalische Leitung dieser konzertanten Aufführungen hat der Dirigent Alexander Joel.
Konzertante Premiere: So, 2 Apr, 19.30 Uhr
Weitere Vorstellungen: 8 und 15 Apr, jeweils 19 Uhr, Opernhaus

«Wie auf der Opernbühne ist sie in den Liedern nicht nur Sängerin, sondern Darstellerin, gibt die Trauernde, die sehnsuchtsvoll Liebende oder auch die naturbegeisterte Wanderin», heisst es in der Frankfurter Rundschau über den gefeierten Liederabend von Asmik Grigorian mit Werken von Tschaikowski und Rachmaninow. Seit ihrer Salome bei den Salzburger Festspielen 2019 und umjubelten Debüts in Bayreuth, Wien, London und Mailand gehört die litauische Sopranistin zu den gefragtesten und aufregendsten Sängerinnen unserer Zeit. Zusammen mit dem Pianisten Lukas Geniušas ist sie im März erstmals am Opernhaus Zürich zu erleben.
Montag, 13 März, 19 Uhr Opernhaus
Lunch-/Brunchkonzert
Auszeichnung
Der 1960 in London geborene Komponist George Benjamin wird mit dem hochdotierten Ernst von SiemensMusikpreis ausgezeichnet. Benjamin habe sich nicht von Moden und Strömungen beeindrucken lassen, sondern sei sich stets treu geblieben, begründete die Siemens-Musikstiftung ihre Auswahl. George Benjamin studierte u.a. bei Olivier Messiaen und feierte früh erste Erfolge, etwa als 20-Jähriger mit seinem Orchesterstück Ringed by the flat Horizon bei den BBC Proms. Mit Written on Skin und Lessons in Love and Violence feierte er grosse Opernerfolge. Leztere gelangt im Mai am Opernhaus Zürich zur Schweizerischen Erstaufführung.
Einführungsmatinee
Nur wenige Jahre nach der Uraufführung von Wagners Tristan und Isolde in München kam 1867 Charles Gounods Roméo et Juliette in Paris auf die Bühne. Anders als in Shakespeares berühmter Textvorlage, in der soziale Gegensätze eine grosse Rolle spielen, stehen bei Gounod – ähnlich und doch ganz anders als bei Wagner – die innere Entwicklung des Liebespaars und der gemeinsame Gang in den Tod im Fokus. Vier grosse Duette prägen die Struktur dieser stark religiös gefärbten Oper. Im Gespräch und mit musikalischen Ausschnitten gewähren wir in der Einführungsmatinee erste Einblicke in diese Neuproduktion.
Sonntag, 26 März, 11.15 Uhr Bernhard Theater
Das 1932 vollendete Sextett für Bläser und Klavier von Francis Poulenc katapultiert den Hörer mitten ins pulsierende Leben der Metropole Paris. Collageartig treffen hektische Stimmen und Geräusche der Grossstadt auf sentimentalträumerische Passagen. Wie die anderen Mitglieder der «Groupe des Six» folgte Poulenc damit den Ansprüchen Jean Cocteaus und Erik Saties, Allltägliches, Unterhaltendes und Ironisches in die Musik einfliessen zu lassen. Witzig, quirlig und très français ist auch die Musik von Jean Françaix, von dem ein Quintett für Blasinstrumente erklingt. Es spielen: Seohyeon Kim (Flöte), Clément Noël (Oboe), Filipa Nunes (Klarinette), Elisabeth Göring (Fagott), Irene Lopez del Pozo (Horn) und Ann-Katrin Stöcker (Klavier).
Brunchkonzert, 19 März, 11.15 Uhr Lunchkonzert, 20 März, 12 Uhr Spiegelsaal
Herr Homoki, der Ring ist voll von fantastischen Orten und Kreaturen. Jedes Inszenierungsteam muss sich deshalb fragen: Begegnen wir diesem Kosmos abstrakt, oder eher realistisch? Was haben Sie zum Beispiel beim Drachen Fafner entschieden, der ja in Siegfried auftaucht?
Schon beim Lesen des Stückes waren wir uns sicher: Diesen Drachen wollen wir auf der Bühne sehen, denn er ist wirklich eine Figur und von zentraler Bedeutung im Stück. Theater ist ja eigentlich eine Kunst des Versteckens. Man spielt, indem man etwas nicht zeigt oder nur die Folgen: Fafner in seiner Höhle ist nur Licht und Rauch, man hört vielleicht noch ein Fauchen. So kann man es machen. Aber wir wollten ihn zeigen: gross, furchterregend, aber auch mit augenzwinkerndem Humor. Auf der Bühne gibt es immer Grenzen des Darstellbaren, mit ihnen muss man als Theatermacher spielen. Deshalb zeigen wir nur Teile des Drachens, den Kopf, den Schwanz und alles nur so lange, dass das Auge die Künstlichkeit nicht entlarvt. Das Riesenhafte des Ungeheuers setzt sich in der Fantasie des Publikums zusammen.
Sonst sind Sie ein Regisseur, der die Abstraktion liebt. Viele Ihrer Inszenierungen finden auf nahezu leerer Bühne statt. Warum ist das beim Ring anders? Warum soll es hier ein «echter» Drache sein?

Weil ich Spass daran habe (lacht). Wir fanden es gerade beim märchenhaftmythologischen Ring reizvoll, in die Konkretion zu gehen, mit der Sichtbarkeit der Bildwelt zu spielen und beispielsweise real zu erzählen, dass das Schwert Nothung in der Walküre im Stamm der Weltesche steckt und Siegmund es in einem dramatischen Moment herauszieht. Wenn ich als Zuschauer zu stark damit beschäftigt bin, zu entschlüsseln, was die Bühne bedeutet, geht viel Aufmerksamkeit für
das Eigentliche verloren. Der Ring ist über weite Strecken ein Kammerspiel mit wenigen Figuren auf der Bühne. Ihre Beziehungen und ihre Konflikte bilden den inhaltlichen Kern, und den möchte ich so direkt und plastisch wie möglich herausarbeiten. Mein Spass am Drachen hat aber auch mit dem bühnentechnischen Knowhow unserer Werkstätten zu tun. Ohne die Leidenschaft und den Perfektionismus unserer Theaterplastik wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, den Drachen als reale Puppe bauen zu lassen, denn das ist unser Fafner: eine hochkomplexe, riesige Puppe mit einem professionellen Puppenspieler darin, der die Mechanik bedient und ihn zum Leben erweckt. Ich liebe die Theatralität des Puppenspiels auf der Bühne sehr.
Wovon hängt es ab, dass man als Zuschauer ein Bühnenbildelement «glaubt»? Ist es die Art des Materials? Perfektion in der Herstellung?
Ein ganz wichtiger Faktor ist das Licht. Das vor allem lässt etwa eine Kaschierarbeit glaubhaft erscheinen. Früher konnte man Gazevorhänge mit Laub bekleben, mit den lichtschwachen Scheinwerfern der Zeit hindurch leuchten, und es hat sich Magie eingestellt. Mit unseren modernen Scheinwerfern funktioniert das nicht mehr. Ihr starkes, brillantes Licht stellt viele Materialien bloss. Glaubwürdigkeit liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Manche Illusionen hat man zu oft gesehen, um sie noch akzeptieren zu können. Und es gibt natürlich auch grundsätzliche Entwicklungen und Pendelbewegungen in der Bühnenästhetik. Eine Reaktion auf die frühen naturalistischen Bühnenentwürfe war Abstraktion, denken wir nur an Wieland Wagners leere Bühnenscheiben in Bayreuth. Auf sie folgte dann wiederum eine Konzentration auf lebendig expressive Personenregie. Die Glaubwürdigkeit muss immer wieder neu hergestellt werden.
 Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten für die Münchner Opernfestspiele. Der Online-, Telefon- und Schalterverkauf aller verbleibenden Karten startet am 25. März.
Mo 26.6.23 HAMLET Premiere Brett Dean Vladimir Jurowski, Neil Armfield
Sa 15.7.23 SEMELE Premiere Georg Friedrich Händel Stefano Montanari, Claus Guth
Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten für die Münchner Opernfestspiele. Der Online-, Telefon- und Schalterverkauf aller verbleibenden Karten startet am 25. März.
Mo 26.6.23 HAMLET Premiere Brett Dean Vladimir Jurowski, Neil Armfield
Sa 15.7.23 SEMELE Premiere Georg Friedrich Händel Stefano Montanari, Claus Guth

Im Bühnenbildmodell 1:50 von Gideon Davey sah sie noch niedlich aus und liess sich problemlos herumschieben – die halbkreisförmige Marmorrundwand für Roberto Devereux. 20cm im Durchmesser, 14cm hoch, 6mm dick und 50g schwer. Der Regisseur David Alden sagte damals, dass diese Wand von der Bühnentechnik ins Bühnenbild und auch wieder seitlich hinausgeschoben wird und man die Technikerinnen und Techniker dabei durchaus sehen darf. Ich fand das genial – endlich einmal keine hochkomplexen Antriebe, sondern sichtbare Handarbeit. Hätte ich gewusst, was ich meinem Team damit antue, hätte ich «nein» gesagt: Hinterher ist man immer schlauer. Aber der Reihe nach: An der Rundwand sollten 34 Porträts von Königin Elisabeth I. hängen, die im letzten Akt nacheinander herunterfallen. Im Modell waren diese ca. 3x4cm gross und fest auf die Wand geklebt. Die Bilder bekamen einen Abwurfmechanismus: Man kann solche «Auslösungen» kaufen, die elektrisch einen Haken öffnen und den Gegenstand daran fallen lassen. Davon kauften wir 34 Stück. Dazu bekam jede Auslösung einen Akku und eine Funksteuerung, so dass wir von der Seitenbühne her jedes beliebige Porträt auf Knopfdruck fallenlassen konnten. So ein 3x4cm grosses Porträt im Massstab 1:50 ist aber in Wirklichkeit 1,5 Meter gross und fällt nicht aus 20cm, sondern aus 5 Meter Höhe und knallt – obwohl wir es aus einer leichten Schaumplatte hergestellt hatten – mit einem ordentlichen Krach auf den Boden. Nun sind 34 Bilder schon eine ganz schöne Masse. Die Wand jedoch, an der sie hängen, war im Original 6 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 10 Metern. Leider verhielt sich ihre Masse nicht im Massstab 1:50, sondern erstaunlicherweise im Massstab 1:50.000 und wog zusammen mit den Bildern 2,5 Tonnen. Unsere Bühnentechnikerinnen und -techniker sind es grundsätzlich gewohnt, solche Gewichte beim Auf- und Abbau von Dekorationen zu verschieben, doch der Regisseur hatte sich eine Choreografie der Wand ausgedacht, bei der sie auf die Bühne gefahren wird, sich um die eigene Achse dreht, dann mal wieder von links nach rechts geschoben wird und wie ein Spielvorhang szenische Auf- und Abbauten verdeckt. Und er hatte das auf der Probebühne drei Wochen lang mit einer leichten, niedrigen Probewand geprobt. Die tollen szenischen Vorgänge waren also fertig einstudiert, als es auf die Bühne im Opernhaus ging. Unsere Mitarbeitenden müssen deshalb nun alles geben, um die Wand zu bewegen: Jeweils 8 bis 10 Personen ziehen und stossen sie über die Bühne, bringen sie auf die gewünschten Positionen – und sind berechtigterweise nicht erfreut über das Gewicht und die zentimetergenaue Choreografie. Vor allem waren die Proben hart, bei denen die Fahrten wiederholt und am Timing gefeilt wurde. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich während der Proben auf der Probebühne die vielen und schwierigen Fahrten nicht verhindert habe, denn als das Bühnenbild auf die Bühne kam, war es zu spät, die Choreografie noch zu ändern: Es gab keine Proben mehr, um Neues auszuprobieren. Mir blieb nichts anderes übrig, als zusätzliche Aushilfen für die Fahrten zu organisieren, um unsere Technikerinnen und Techniker etwas zu entlasten. Positiv allerdings ist, dass die Fahrten einen grossen Effekt in den Vorstellungen erzielen.
Das mit den Auslösungen funktionierte übrigens ganz gut, doch nach einigen Proben mit runterkrachenden Bildern entschieden sich Regisseur und Bühnenbildner, die Porträts nicht mehr fallen zu lassen, sondern sie in der Pause gegen verblasste auszutauschen, die das Publikum erst mit der Schlussdrehung der Wand zu Gesicht bekommt. Die Wirkung ist wesentlich besser als die der fallenden Bilder. Hinterher ist man immer schlauer.



Mit der Premiere von «Siegfried» geht der neue Zürcher «Ring des Nibelungen» in die nächste Runde. Ein Gespräch mit dem Dirigenten Gianandrea Noseda über den sinfonischen Ton in der «Siegfried»Partitur, düstere Farben und lebensbejahendes C Dur
Die Entstehungsgeschichte von Wagners Ring des Nibelungen ist lang und komplex; alles in allem beschäftigte ihn die Tetralogie über 25 Jahre seines Lebens. Mitten in der Komposition des Siegfried hat Wagner seine Arbeit am Ring 1857 unterbrochen und erst 12 Jahre später – nach der Komposition des Tristan und der Meistersinger – wieder aufgenommen. Spüren Sie diese Unterbrechung in der Musik?
Ich würde nicht sagen, dass ich nach dem zweiten Akt einen starken Bruch empfinde. Aber ich glaube sehr wohl zu spüren, dass Wagner zwischen dem zweiten und dritten Akt den Tristan komponiert hat. Der dritte Akt von Siegfried ist – im Vergleich zu Rheingold und Walküre, aber auch im Vergleich zum ersten Akt von Siegfried – sehr viel komplexer in der Orchestrierung. Nicht nur in der Musikgeschichte gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach Tristan; auch in Wagners eigener kompositorischer Entwicklung markiert der Tristan einen grossen Entwicklungsschritt. Die unglaublich kühne Art zu schreiben, die er im Tristan erreicht hatte, bleibt für seine nächsten Opern erhalten.
Der Schweizer
Graphic Novel Künstler
Thomas Ott hat für diese MAG-Ausgabe seine subjektive Sicht auf den Helden Siegfried gezeichnet, der furchtlos in die Neidhöhle eindringt und den Drachen umbringt.

Meinen Sie mit kühn vor allem die harmonische Ebene?
Ich meine die Komplexität der Partitur insgesamt. In gewisser Weise ist es ein Wunder, dass Wagner nach so langer Unterbrechung überhaupt zu seinem Material zurückkehren und die Erzählung fortsetzen konnte. Denn das musikalische Material bleibt dasselbe! Tristan ist harmonisch komplexer als Siegfried, aber auch die Art und Weise, wie hier die Leitmotive untereinander verbunden sind, und die Transformation dieser Leitmotive zeugt von einer sehr viel grösseren kompositorischen Reife. Das hängt mit den Erfahrungen zusammen, die er bei der Komposition der Meistersinger gesammelt hat, die man ja fast als eine Übung in Polyphonie bezeichnen kann. Dadurch hat er zu neuen Möglichkeiten im Umgang mit den Motiven gefunden, die bis zum zweiten Akt des Siegfried nur andeutungsweise zu finden sind. Aber auch die Instrumentation ist im dritten Akt im Vergleich zu den ersten beiden Akten sehr viel raffinierter geworden. Für mich ist Siegfried die sinfonischste Oper der Tetralogie, auch was die Orchestrierung und die Klangfarben angeht. Auch die Tempi sind hier feiner aufeinander abgestimmt, was von grosser kompositorischer Reife zeugt. Für mich als Dirigent heisst das: Wenn ich zu Beginn der Oper das richtige Tempo anschlage und die Temporelationen stimmen, ergibt sich die Architektur des Werks fast von selbst. Die Struktur von Siegfried scheint mir besonders klar zu sein.
Vielleicht empfindet man auch deshalb keinen so starken Bruch, weil uns der dritte Akt in eine ganz andere Welt führt – Siegfried erweckt Brünnhilde, lernt die Sexualität kennen und wird erwachsen...
Genau, deshalb steht eine andere, komplexere Kompositionsweise zumindest nicht im Widerspruch zur inneren Logik des Werks. Wagner war ja zudem um 1856 in Folge seiner SchopenhauerLektüre in eine Art Sinnkrise geraten, was sich sehr gut an seinem Herumbasteln am Schluss der RingDichtung ablesen lässt. Er hat nämlich eine ziemlich lange Passage aus Brünnhildes letzter Rede in der Götterdämmerung durch eine Neudichtung ersetzt. Der ursprüngliche Text fasst auf ziemlich tendenziöse Weise die feuerbachische Grundidee des Rings zusammen, also dass die Welt durch die Liebe erlöst werden kann und muss. Der zweite Entwurf des Textes ist eine ebenso tendenziöse Zusammenfassung, nun aber im Sinne Schopenhauers und eines Gemischs aus jeweils halb verstandenem Hinduismus und Buddhismus, das Wagner ihm entnommen hatte.
Auf ähnliche Weise hat er versucht, den Holländer seinen späteren Überzeugungen anzupassen, als er den «Erlösungsschluss» dazu komponierte. Aber im Falle des Rings hat er zum Glück gemerkt, dass das nicht geht, und die ganze Passage gestrichen. Dieser Entschluss zeigt, dass er die Krise produktiv überwunden hat: Der Theatermann war stärker als der Ideologe. Sicher hat auch hier die Erfahrung mit dem Tristan geholfen. Er hat diese neuen, aus der SchopenhauerBeschäftigung entstandenen Ideen dort ausgiebig entwickelt, wusste nun, dass sie hier nicht am Platz sind, und konnte zu seinem ursprünglichen Plan zurückkehren: Das Schlussduett von Brünnhilde und Siegfried, der nach der Erweckung Brünnhildes endlich das Fürchten lernt, ist jedenfalls ähnlich schön und ähnlich komplex wie der zweite Akt des Tristan, aber auch deutlich lebensbejahender.
Siegfried wird oft als Scherzo der Tetralogie bezeichnet. Wie sehen Sie das? Es gibt viele komische Elemente in dieser Oper. Zum Teil entsteht Komik aus Missverständnissen, nicht nur zwischen Siegfried und Mime, sondern auch zwischen Wotan und Erda; da gibt es Elemente von Ironie, die man nicht unbedingt erwarten würde. Diese komischen Elemente entdecke ich übrigens jetzt ganz neu. Als ich früher Aufführungen des Rings besuchte, schien mir der Siegfried immer am sperrigsten. Das lag vielleicht auch daran, dass es so lange dauert, bis wir im zweiten Akt mit dem Waldvöglein endlich eine Frauenstimme hören... Aber seit ich mich intensiv mit Siegfried beschäftige, scheint mir, dass diese Oper mir fast noch besser liegt als die beiden vorangegangenen. In der Walküre muss man bereit sein, die Kontrolle auch mal abzugeben und die Dinge einfach laufen zu lassen, im Siegfried muss man immer dran bleiben.
Das Waldvöglein, das Sie gerade erwähnt haben, ist Teil der Naturdarstellung im Siegfried, zu der auch das berühmte Waldweben gehört. Das Rheingold beginnt mit dem Vorspiel in den Tiefen des Rheins; in derWalküre werden wir dann schon mit dem Orchestervorspiel in eine ganz andere Welt hineingeschleudert, in die Welt der Menschen und der Zivilisation. Siegfried spielt zu grossen Teilen auch wieder in der Natur, der Held wächst in einer Höhle beim Zwerg Mime auf, fernab der Zivilisation, und ist der Natur eng verbunden. Das Waldweben im Siegfried ist musikalisch aus dem Motiv des Rheins aus dem Rheingold abgeleitet. Die Motive beschreiben fliessende Bewegungen – im Rheingold ist es die Bewegung des Wassers, im Siegfried die der Luft: der Wind, der die Blätter und Zweige im Wald in Bewegung versetzt. Die Naturschilderung im Siegfried scheint mir – auch wegen der kompositorischen Entwicklung Wagners, die dazwischen liegt – avancierter. Man sieht das Leben im Wald vor sich – die Insekten, die Blätter, die sich im Wind bewegen, Sonnenstrahlen, die durch das Dunkel brechen.

Das Vorspiel zum zweiten Akt weist dagegen auf düstere, todbringende Momente in der Handlung hin.
Siegfried bringt zuerst den Drachen um und dann Mime – aber er hat kein Bewusstsein dafür, wie dramatisch seine Handlungen sind. Er denkt nicht darüber nach. Das Vorspiel zum zweiten Akt beginnt mit den dunkelsten Orchesterfarben, die überhaupt möglich sind, und der Tritonus, der «diabolus in musica», spielt eine zentrale Rolle. Das Vorspiel evoziert sofort eine sehr düstere Atmosphäre. Ich liebe diese mysteriösen, geisterhaften Vorspiele zum ersten und zweiten Akt sehr, sie sind Beispiele für Wagners unglaublich raffinierte Instrumentationskunst.
Sie haben gesagt, Siegfried versteht nicht, was er da tut, wenn er Fafner und Mime umbringt; ist er wirklich so naiv?
Er ist sehr jung und begreift die Konsequenzen seiner Handlungen noch nicht. Ihm fehlt ein Wertesystem, ein moralischer Kompass; den hat ihm Mime in seiner Isolation nicht vermitteln können. Er tötet den Drachen, weil es eine Herausforderung für ihn ist – und weil Mime ihm gesagt hat, er würde so endlich das Fürchten lernen. Wenn Siegfried den Drachen tötet, dann tötet er zum ersten Mal nur, um zu zeigen, dass er stärker ist – anstatt wie bisher ein Tier zu jagen und zu töten mit dem Zweck, sich zu ernähren. Das hinterlässt einen Fleck auf seiner Seele, oder anders gesagt: Er verliert seine Unschuld. Durch den Genuss des Drachenbluts versteht er, dass Mime ihn anlügt und in Wahrheit vergiften will. Und das zweite Mal, bei Mime, fällt ihm das Töten schon leichter.
Siegfried ist zugleich auch der Held, der eine Utopie verkörpert – die Hoffnung und die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt.
Das war, wie wir auch an anderen Opern wie Lohengrin und Parsifal sehen, Wagners grosse Sehnsucht – ein Mensch, der die Welt durch die Liebe zum Besseren verändern kann. Wenn Siegfried im dritten Akt Brünnhilde geweckt hat, dann strahlt die Musik in reinstem C Dur – Siegfried hat das Licht gebracht. Wir sind hier, auch im Vergleich zu den beiden Vorspielen zum ersten und zweiten Akt, musikalisch in einer vollkommen anderen Welt angekommen. Die Harmonik mit deutlich weniger MollKlängen und auch die Instrumentation zeigen es deutlich: Dies ist der Moment, in dem wir innerhalb des Rings der Utopie von einer besseren Welt am nächsten sind. Doch diese Utopie wird in der Götterdämmerung scheitern, weil Siegfried zu wenig auf die Welt um ihn herum vorbereitet ist.
Sie haben während Ihrer Arbeit an Rheingold und Walküre betont, dass Ihnen der schlanke, durchhörbare Orchesterklang wichtig ist. Mit Klaus Florian Vogt debütiert ein Sänger als Siegfried, der über eine eher leichte, hell timbrierte Stimme verfügt. Passt er besonders gut in Ihr musikalisches Konzept? Es ist nicht so einfach herauszufinden, an welche Art von Stimme Wagner dachte, als er den Siegfried komponierte. Was wir aber wissen, ist, dass im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Stimmfächer nicht so eng gedacht wurden wie heute. Enrico Caruso sang an einem Tag Nemorino aus Elisir d’amore und am nächsten Tag Cavaradossi in Tosca. Hier im eher kleinen Zürcher Opernhaus brauchen wir für den Siegfried eine Stimme mit sehr guter Projektion und ausgezeichneter Technik, mit guter Höhe und genügend Flexibilität für die schnellen Tempi, die Wagner im ersten Akt vorgibt. Es muss nicht unbedingt der Heldentenor im klassischen Sinne sein. Klaus Florian Vogt bringt alles mit, was man für den Siegfried braucht, und er passt wunderbar zur Brünnhilde von Camilla Nylund. Ich freue mich auf die Rollendebüts der beiden. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die zarten, leisen Momente, von denen es viel mehr gibt in dieser Oper als man annimmt, mit Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt besonders anrührend gelingen werden.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Im dritten Teil von Richard Wagners «Ring des Nibelungen», der am 5. März Premiere hat, steht Siegfried im Mittelpunkt. Für Regisseur
Andreas Homoki ist er kein dumpf-deutscher Schlagetot, sondern Hoffnungsträger für eine bessere, liebevollere Welt
Fotos Danielle Liniger
In der Literatur zu Wagners Ring taucht immer wieder der Vergleich der Tetralogie mit einer Sinfonie in vier Sätzen auf. Aus diesem Blickwinkel wird dem Siegfried die Rolle des Scherzos zugewiesen. Kannst du mit dieser Betrachtungsweise etwas anfangen?
Ich glaube, es bringt nichts, die Tetralogie in ein solches Formschema zu pressen. Aber wenn man das denn tun will, ist die Zuordnung schon richtig, denn der Siegfried ist zweifellos eine Komödie, wenn man so will, das Scherzo.
Findest du das Stück wirklich lustig?
Wenn man den Zyklus im Zusammenhang und in seinen Kontrasten betrachtet, stellt er sich etwa so dar: Das Rheingold ist ein leichtfüssiges Konversationsstück, fast so etwas wie Boulevard-Theater. Im denkbar schärfsten Kontrast dazu kommt die Walküre als eine fast übermenschliche, monumentale Tragödie daher. Siegfried ist eine Komödie, die gleichermassen von grotesken Momenten und Situationskomik wie auch von rührenden und die Tragödie streifenden Szenen geprägt ist. Die Götterdämmerung fasst als Abschluss Elemente aus den Vorgängerstücken zusammen: Tragisches, Groteskes, Rührendes und Ironisches. In allen vier Stücken finden sich, wie immer bei Wagner, durchaus auch humoristische Momente, aber in keinem dominieren sie so stark wie in Siegfried. Nehmen wir nur den Drachenkampf, der im Mittelpunkt des Stücks steht, oder den sprechenden Vogel, der in die Handlung eingreift, oder den Zwerg, der so gern die Welt beherrschen würde –das alles sind Elemente, die deutlich genug zeigen, dass in diesem Stück spielerischer Witz und ironischer Spass eine grosse Rolle spielen. Solche Dinge kann man schliesslich nur ernsthaft anbieten, wenn man sie mit einem Augenzwinkern nimmt.
Betrifft das auch den Titelhelden? Den blonden, blauäugigen Helden des Nordens?
Auf jeden Fall! Wir erleben die Geschichte eines Knaben, der mitten im Wald, fern aller Zivilisation, aufwächst und deshalb vollkommen unwissend ist. Er kennt den Wald und die Tiere und hat dort viel beobachtet, aber er weiss gar nichts von Menschen und Göttern, ja, nicht einmal, dass es ausser Mime noch andere Menschen gibt, von Frauen ganz zu schweigen. Das allein bietet schon viel Material für komische Situationen. Er ahnt aber, dass hier etwas nicht stimmt, und hat eine tiefe Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe. Er hat das nie erfahren, aber bei den Tieren des Waldes gesehen, dass es so etwas gibt. Wenn man ihm zuhört, wie einfühlsam er diese Beobachtungen beschreibt, merkt man, dass er keineswegs der brutale Schlagetot ist, als der er traditionell gesehen wird. Wagner hat einen Siegfried geschaffen, der sich ganz erheblich von den traditionellen Darstellungen dieser Figur unterscheidet. Er schildert seine Unwissenheit und seine Liebessehnsucht mit liebevoller Ironie. Das ist oft gleichzeitig ebenso komisch wie rührend, aber es führt auch direkt zum utopischen Kern der Figur, auf den es Wagner ankam: Der Held aus dem Wald, der von der Zivilisation unberührt ist und die Liebe nur als natürlichen Trieb kennt, ist der Einzige, der die Überwindung der korrumpierten Welt anzustossen vermag und den Keim einer besseren, weil liebevolleren Welt in sich trägt.
Allerdings hat dieser utopische Komödienheld immerhin zwei Tote auf dem Gewissen. Ist Siegfried ein Mörder? Eigentlich nicht, denn einmal handelt er in Notwehr, einmal tötet er im Affekt: Der Lindwurm will ihn fressen, Mime will ihn vergiften. Er muss sich gegen diese Angriffe zur Wehr setzen, und wie soll er das denn tun, wenn nicht mit seinem Schwert?
Nichtsdestoweniger fallen ihm zwei Leben zum Opfer. Taugt er damit noch zur Identifikationsfigur?
Es gibt ein traditionelles Bild dieser Figur, das genau besehen gar nicht stimmt. Dieser Auffassung nach ist Siegfried ein mehr oder weniger debiler Schlagetot, der die antisemitischen Klischees Wagners sozusagen verinnerlicht hat und loszieht, die Welt von allem Abweichenden zu reinigen. Dieses Bild, egal, ob es positiv oder negativ bewertet wird, ist so allgemein herrschend, dass man genau hinschauen muss, um wirklich die Figur zu sehen und nicht das Klischee. Ein solcher Titelheld wäre aber – zumindest für mich – kaum zur Identifikationsfigur geeignet.
Und wie siehst du ihn? Magst du ihn? Willst du, dass das Publikum ihn mag? Ja, ich mag ihn. Und zwar um so mehr, je genauer ich ihn durch diese Arbeit kennenlerne. Wenn man sich bemüht, der Musik so vorurteilsfrei wie es eben möglich ist zuzuhören, merkt man irgendwann, dass sie gar nicht so massiv «deutsch» ist, wie es zu diesem Bild passt. Natürlich gibt es gewaltige emotionale Ausbrüche, aber denen stehen mindestens ebenso viele, wenn nicht mehr, Passagen von berührender Zartheit gegenüber. Wenn man die Partie des Siegfried so betrachtet, entdeckt man ihn als einen sensiblen, liebesfähigen jungen Menschen, der in schrecklichen Verhältnissen aufwächst: bei Mime, der ihn fortwährend belügt und nur für seine Zwecke ausnutzen will. Er spürt die Lieblosigkeit und hat nur einen Wunsch: so schnell wie möglich da wegzukommen. Siegfried zeigt sich also wie alle grossen Komödienfiguren als eine Verbindung von komischen und tragischen Elementen, und gerade deshalb kann er einem so ans Herz wachsen. Mir ist er jedenfalls ans Herz gewachsen, und ich möchte, dass es den Zuschauern auch so geht.
Wo immer man Darstellungen dieses Helden sieht, ist er von seinem Schwert nicht zu trennen. Allerdings muss er sein Schwert erst herstellen, der erste Akt handelt fast ausschliesslich davon. Was ist daran so bedeutend?
 Klaus Florian Vogt und Camilla Nylund
Klaus Florian Vogt und Camilla Nylund
 Regisseur Andreas Homoki
Regisseur Andreas Homoki
Dass und wie Siegfried sein Schwert schmiedet, hat mit dem utopischen Potenzial der Figur zu tun. Auch hier gibt wieder die Musik den entscheidenden Hinweis: Wenn Siegfried die Bruchstücke des alten Schwerts nicht zusammenklebt, wie es Mime versucht hat, sondern schreddert und neu einschmilzt, spielt das Orchester eine Musik von geradezu apokalyptischer Gewalt, die den Vorgang weit über eine simple Schmiedearbeit hinaushebt. Sie lässt hinter Siegfried den Anarchisten Bakunin aufscheinen, Wagners Freund aus seiner Dresdner Zeit, der forderte, alles Alte müsste zerstört werden, damit aus den Trümmern Neues hervorgehen kann. Die Schmiedemusik, die quasi die ganze Welt überwältigt und im Feuer reinigt, verweist auf die Revolution, für die Wagner gemeinsam mit Bakunin in Dresden auf die Barrikaden gegangen ist. Gleichzeitig und damit in engem Zusammenhang kann man die Szene auch als Metapher für den Umgang mit der Tradition lesen: Wagner lehnt ein Traditionsverständnis der sorgfältigen Konservierung des brüchigen Alten ab und plädiert nachdrücklich für einen radikalen Umgang mit dem Überlieferten, das nur bewahrenswert ist, insofern es erneuert werden und dem Neuen nützen kann.
Gilt das auch für den Umgang mit alten Stücken? Nimmst du den Rat an und schredderst sie?
Wenn man etwas schreddert, sollte man das nur tun, wenn man sicher ist, hinterher etwas Besseres hervorzubringen. Was aber in diesem Falle gar nicht erforderlich ist. Das Stück ist keine Sammlung von unbrauchbaren Bruchstücken, sondern ein sehr kraftvoller Organismus. Um den zu erschaffen, hat Wagner mit der Kühnheit seines Siegfried die altnordische Überlieferung sozusagen selbst geschreddert, eingeschmolzen und etwas Neues, ganz Zeitgenössisches daraus geschmiedet.
Und wir stehen in einem lebendigen Dialog mit diesem Werk, in dem es heutige Antworten auf bedeutende Fragen gibt. Wagner hätte den bekannten Ausspruch von Jean Jaurès bestimmt gern unterschrieben: «Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.»
Wotan und Alberich sind die beiden Hauptkontrahenten der Tetralogie. Um so verwunderlicher ist es, dass beide im Siegfried so gut wie nichts zur Entwicklung der Handlung beitragen. Wotan hat zwar in der Walküre erklärt, auf seine Macht verzichten zu wollen, tut sich aber offenbar schwer, tatsächlich aus dem aktiven Geschehen auszuscheiden –ein allzu bekanntes zeitloses Phänomen gerade bei dominanten Führungspersönlichkeiten. Aber man muss ihm zugutehalten: Er fühlt sich verantwortlich, Alberich davon abzuhalten, durch den Ring doch noch die Weltherrschaft zu erlangen. Zu Anfang des zweiten Aktes lässt Wagner die beiden Antagonisten ein letztes Mal aufeinander los – eine Begegnung, die überdeutlich zeigt, dass beider Zeit eigentlich abgelaufen ist. Es ist ein schöner Zug, dass sich der tragische Verfall beider Figuren in einer wirklich komischen Szene offenbart. Das Stück ist eben tatsächlich eine richtige Komödie. Wotans eigentliches Augenmerk gilt nunmehr vor allem Siegfried, denn der steht ja endlich für den «freien Helden», den er sich seit langem gewünscht hat. Leider geht die Begegnung mit seinem sehnsuchtsvoll erwarteten Enkel aufgrund eines dummen Missverständnisses denkbar schief. Es kommt zum Streit, denn der freie Held respektiert und fürchtet den Gott nicht. Sein neu geschmiedetes Schwert zerschlägt den Speer, der die alte Ordnung symbolisiert. Erst da erkennt Wotan, dass er ausgespielt hat, und tritt endgültig von der Bühne: In der Götterdämmerung werden wir ihn nicht mehr sehen.
Wenn Siegfried Wotans Schwert zerschlägt und zu Brünnhilde gelangt, scheint es aber mit der komödiantischen Leichtigkeit vorbei zu sein. Das letzte Bild lässt selbst eingefleischte Wagnerianer seufzen, weil es sich so endlos hinzuziehen scheint. Warum dieser lange Weg zum Happy End?
Siegfried Oper von Richard Wagner
Musikalische Leitung
Gianandrea Noseda Inszenierung
Andreas Homoki
Ausstattung
Christian Schmidt
Künstlerische Mitarbeit
Bühnenbild
Florian Schaaf
Lichtgestaltung
Franck Evin
Video
Tieni Burkhalter
Dramaturgie
Werner Hintze, Beate Breidenbach
Siegfried
Klaus Florian Vogt
Mime
Wolfgang AblingerSperrhacke
Der Wanderer
Tomasz Konieczny
Alberich
Christopher Purves
Fafner
David Leigh
Erda
Anna Danik
Brünnhilde
Camilla Nylund
Stimme des Waldvogels
Rebeca Olvera
Philharmonia Zürich
Premiere 5 März 2023
Weitere Vorstellungen
9, 14, 18, 22, 26 März 2023
Mit freundlicher
Unterstützung der Freunde der Oper Zürich
Es lässt sich nicht leugnen: Die letzte Szene ist eine harte Nuss, an der sich schon viele die Zähne ausgebissen haben. Sie dauert nicht nur fast doppelt so lange wie das zweite Bild von La bohème, sondern hat anscheinend auch gar keine Handlung. Aber wenn man die Länge der Szene mit der Uhr misst, hat man eigentlich nichts erfahren, weil Wagners Musik eine ganz eigene Zeitstruktur erschafft. Sie ermöglicht eine Dehnung aller Vorgänge, die zu einer erheblichen Verstärkung der emotionalen Wirkung führt, so dass die gedehnte Zeit doch gefüllt ist. Das kann, wenn es gelingt, eine geradezu rauschhafte Wirkung entfalten, und zweifellos hat die nahezu religiöse Wagner-Verehrung ihren Ursprung genau in diesen ekstatischen Erlebnissen, die Wagner mit solchen Szenen kreiert. Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere, für das Theater wichtigere, tritt hervor, wenn man die Musik in ihrer theatralischen Bedeutung genau betrachtet. Aus diesem Blickwinkel offenbart sie auch in dieser Szene eine grosse Vielfalt, eine immer wieder verblüffende Präzision in der Formung des jeweiligen Gestus. Tatsächlich handelt es sich um eine der wichtigsten Szenen der ganzen Tetralogie, deren Grundkonflikt der zwischen Macht und Liebe ist. Bis zu diesem Moment zeigte sich immer wieder, wie die Liebe der Macht zum Opfer fällt und die Liebenden untergehen, während die Machtgierigen triumphieren. Nun, auf dem Walkürenfelsen, im Niemandsland ausserhalb der Welt kann die Liebe endlich zu ihrer vollen Entfaltung kommen: in der Begegnung zweier Menschen, die den Weg von anfänglicher Fremdheit über das erotische Begehren zur vollständigen Hingabe vollziehen. Die erkennen, dass sie sich selbst aufgeben müssen, um sich in der Gemeinschaft mit dem geliebten Menschen neu und reicher zu finden. Das aber ist, auf die knappste Formel gebracht, das Ideal der künftigen Menschheit, wie sie Wagner vorschwebte, das ist der utopische Kern der gesamten Tetralogie.
Was erwartet das Publikum, wenn sich am 5. März der Vorhang zur SiegfriedPremiere hebt? Wird die Bühne wieder so ähnlich aussehen wie bei Rheingold und Walküre? Oder gibt es eine Überraschung? Überraschung ist die Seele des Theaters. Nichtsdestoweniger erfordert ein so umfangreiches und vielgestaltiges Werk eine starke formale Lösung, damit kein unüberschaubares Wirrwarr entsteht. Wir werden also der grundlegenden RaumKonzeption treu bleiben, aber sie wieder dem Stück entsprechend modifizieren. Der Bühnenraum der Walküre unterschied sich vom Rheingold vor allem durch Szenen, die im Freien spielten. Dafür hatten wir fast naturalistisch gestaltete Bäume und Schnee, was im Rheingold nicht vorhanden war. Nun spielt Siegfried durchgehend im Freien und auch fast immer im Wald. Dennoch schien es uns nicht richtig, dafür die Waldräume der Walküre wieder aufzunehmen. Denn dort waren wir in der Welt der Menschen, in der wirklichen, sozusagen bürgerlichen Welt, während wir hier wieder weit davon entfernt sind. Diesen Unterschied wollen wir deutlich hervorheben. Wir befinden uns hier in der Welt des Nibelungen Mime, der Siegfried aus höchst eigennützigen Motiven bei sich aufgenommen hat. Darum haben wir uns entschlossen, auf die dunkle Bilderwelt von Nibelheim, wie sie schon im Rheingold vorkam, mit den verbrannten Möbeln und Wänden zurückzugreifen und einen Bühnenraum zu schaffen, der sozusagen ganz von der Machtgier der beiden Nibelungen bestimmt ist. Ausserdem gibt es natürlich einen Lindwurm. Diesmal ist er entsprechend seiner grösseren Bedeutung noch viel grösser als der Riesenwurm in Rheingold, und er kann auch viel mehr. Unsere Werkstätten haben sich so einige Tricks ausgedacht, damit er so lebendig, so lustig und so gruselig wie möglich aussieht.
Das Gespräch führte Werner Hintze

Siegfried über Mime im «Ring des Nibelungen»
Man kann Richard Wagners Hauptwerk nicht aufführen, ohne nach der Judenfeindlichkeit des Komponisten zu fragen und danach, wie sie sich auf den «Ring des Nibelungen» ausgewirkt hat. Ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler und Wagnerkenner Jens Malte Fischer
Richard Wagner schrieb den Ring des Nibelungen zum grossen Teil in Zürich; während der neun Jahre, die der Komponist als Flüchtling hier in der Stadt verbrachte, entstanden auch einige seiner wichtigsten Schriften, darunter der berüchtigte Aufsatz Das Judentum in der Musik. Worum geht es darin? Diese Schrift erschien 1850 zum ersten Mal in der Neuen Zeitschrift für Musik in Leipzig unter dem Namen K. Freigedank, einem sehr sprechenden Pseudonym. Wagner versucht hier, die grundsätzliche Unfähigkeit der Juden nachzuweisen, in der Kultur derjenigen Nationen, in denen sie sich vorgeblich assimiliert haben, wirklich schöpferisch tätig zu sein. Sie hätten, so Wagner, nur ein nachahmendes Talent, und zwar aufgrund der Eigentümlichkeiten, die ihnen als Juden anhaften. Wagner spricht nicht von der «jüdischen Rasse» – die Rassentheorie war um 1850 zwar ansatzweise vorhanden, aber noch nicht sehr verbreitet. Seine Äusserungen sind aber durchaus protorassistisch zu nennen, denn es geht ihm nicht um irgendwelche Ad hoc-Adjektive, die äusserliche Dinge beschreiben, sondern eben um Eigentümlichkeiten, die nicht zu ändern sind, es sei denn, die Juden würden aufhören, Juden zu sein. Wagner schreibt, die jüdische Musik hänge einerseits mit dem Synagogengesang zusammen, den er sehr negativ charakterisiert, wobei nicht klar ist, ob Wagner jemals in einer Synagoge war, und andererseits mit der jüdischen Sprache, die er als «schrillenden und murksenden Lautausdruck» beschreibt. Juden können laut Wagner nicht ins Herz der deutschen Nation und der deutschen Kultur eindringen und sind deshalb nicht in der Lage, wirklich schöpferisch musikalisch tätig zu werden. Stattdessen würden sie sich im Nachahmen eine Kultur aneignen, die nicht die ihre ist, sondern nur – wenn auch durchaus raffiniert –assimiliert wird und nicht aus der Tiefe der Seele kommt.
Man hat in der Vergangenheit das Argument gehört, Wagner sei in Paris von Meyerbeer nicht in dem Masse unterstützt worden, wie er sich das erwartet hatte, und sein Misserfolg als Komponist in dieser Stadt sowie seine miserable finanzielle Lage habe zu dem Pamphlet gegen die Juden geführt; es sei also eine Jugendsünde und deshalb entschuldbar. Die Tatsache, dass er den gleichen Text 19 Jahre später unter seinem eigenen Namen noch einmal veröffentlicht und seine Aussage sogar noch verschärft hat, zeigt, dass eine solche Argumentation keinesfalls haltbar ist.
Von einer Jugendsünde kann man bei dem 37jährigen Verfasser kaum sprechen, und es ist belegt worden, dass Meyerbeer ziemlich viel für ihn getan hat, wenn auch ohne grossen Erfolg, was Meyerbeer nicht angelastet werden kann. Man kann ziemlich genau nachweisen, dass Wagners antijüdische Ressentiments schon lange
vorher existierten. Es gibt in Briefen und Äusserungen gegenüber Freunden immer wieder Passagen, in denen er sich beispielsweise über einen jüdischen Wucherer beklagt, bei dem er Geld geliehen hatte und dann Probleme bekam. Wagner war ja, bis Ludwig II. ihn zu unterstützen begann, als Pumpgenie bekannt und musste gelegentlich auch vor seinen Gläubigern fliehen. Diese Probleme bezog er nicht auf die Person des Wucherers, sondern meinte: Der ist ja Jude, da muss man sich nicht wundern. Diese Ressentiments haben sich langsam gesteigert und brechen erstmals 1850 aus. Auch in seiner Schrift Oper und Drama sind sie nachzuweisen. Wagners Haltung den Juden gegenüber setzt sich kontinuierlich fort bis 1869, als Das Judentum in der Musik zum zweiten Mal erscheint, und wird auch danach nicht etwa besser, sondern immer aggressiver. Wenn man die Tagebücher seiner Frau Cosima anschaut, sieht man, dass sie, die völlig seiner Meinung war, etwa alle 14 Tage eine antisemitische Bemerkung Wagners notierte. Er hat sich zwar nicht vereinnahmen lassen, aber doch mit Befriedigung beobachtet, dass sich etwa zehn Jahre nach der zweiten Edition seiner Schrift der Antisemitismus in Berlin und in ganz Deutschland immer stärker verbreitet hat; Wagner selbst sieht sich da am «Anfang der Bewegung», die jetzt ganz gross rauskommt. Es gibt eine leichte Distanzierung, die von Wagnerianern gern zitiert wird, aber das ist zweideutig und lasch formuliert, so dass man genau merkt, er will es sich nicht mit dem jüdischen Publikum in den Opernhäusern verderben. Er war viel zu sehr grosser Künstler, als dass er antisemitische Opern geschrieben hätte; das war nicht seine Intention.
Stand Wagner mit seinem Text Das Judentum in der Musik tatsächlich «am Anfang der Bewegung»?
Das ist der grosse Vorwurf, den man ihm machen muss: Er hat den Antisemitismus in gewisser Weise hoffähig gemacht; er hat Leute, die sich im Bierkeller Judenwitze erzählten, in ihren Ressentiments bestätigt. Es entstand der Eindruck: Wenn der berühmte Opernkomponist Richard Wagner so etwas sagt, und zwar in der zweiten Fassung seiner Schrift mit erheblicher, geradezu weltweiter Resonanz, dann müssen wir uns nicht mehr verstecken und können laut und deutlich sagen, was wir vom jüdischen Einfluss überhaupt und speziell in der Kultur halten. Man muss es so drastisch sagen: Richard Wagner ist bis heute im Kulturbereich der berühmteste Antisemit geblieben. Er ist seit über 100 Jahren ein Weltphänomen, sein Ruhm ist kontinuierlich angestiegen. Einen Antisemiten auf diesem Niveau des schöpferischen Genies gibt es sonst nicht.
Der Schluss von Das Judentum in der Musik wurde häufig als Aufforderung zur Vernichtung der Juden gelesen; dort heisst es: «Aber bedenkt, dass nur Eines Eure Erlösung von dem auf Euch lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers: Der Untergang!» Das klingt in der Tat grauenhaft. Es gibt Antisemitismus-Forscher, die sagen: Hier scheint die Ermordung der europäischen Juden am Horizont schon auf. Ich sehe das nicht so. Der Schluss des Textes ist vieldeutig. Aber das ist auch zugleich das Problem – man kann ihn als Aufforderung zur Vernichtung der Juden lesen. In der Zweitfassung der Schrift spricht Wagner von der «gewaltsamen Auswerfung» der Juden, in späteren Texten von einer «grossen Lösung» des Judenproblems, da wird es viel problematischer. Der Schluss des Judentum-Aufsatzes meint: Die Juden müssen aufhören, Juden zu sein, sie müssen als Juden untergehen und dann gemeinsam mit den anderen, die auch neu geboren werden müssen, zu neuen Menschen werden. Bevor die Juden in diesen gemeinsamen Regenerationsprozess hineingehen, müssen sie sich von ihrem Judentum lösen. Wie das allerdings auszusehen hat, darüber sagt Wagner nichts Konkretes. Die christliche Taufe reicht dafür jedenfalls nicht aus, denn die Juden haben, das betont er immer wieder, unveränderliche Eigenschaften, die Nichtjuden widerlich finden. Dennoch bin ich nach langem Studium dieser Schrift der Meinung, dass hier nicht die Andeutung der physischen Vernichtung der europäischen
Juden intendiert ist. Aber leider hat die Schrift in dem Prozess, der zu den Grauenhaftigkeiten im 20. Jahrhundert geführt hat, einen nicht unwichtigen Stellenwert.
Inwiefern?
Die Linie der Nachwirkungen lässt sich verfolgen von der antisemitischen Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts über Richard Wagners Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain, über den antisemitischen Philosophen Otto Weininger und antisemitische Publikationen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zu Adolf Hitler, der, wie bekannt, Wagnerianer war – der einzige Nationalsozialist übrigens, der wirklich fanatischer Wagnerianer war, die anderen waren das ja gar nicht und sind in Bayreuth eingeschlafen, was Hitler sehr geärgert hat. Hitler hielt 1929 in München eine Rede, in der er über den jüdischen Regisseur Max Reinhardt schimpft Wenn man das liest, dann hört man bis in die Formulierungen hinein Richard Wagner. Da merkt man die Kontinuität. Und wenn man Kritiken aus den 1950er Jahren über Gustav Mahler anschaut, dann findet man gegen den immer wieder als Jude diffamierten Komponisten Mahler noch die gleichen Argumente.
Dass Wagner Antisemit war, ist mehr oder weniger Konsens. Ob und wie diese Einstellung auch Eingang in sein Werk gefunden hat, darüber herrscht jedoch Uneinigkeit. Die klarste Meinung dazu hatte Theodor W. Adorno; für ihn war Mime ebenso wie Beckmesser eine Judenkarikatur. Wie sehen Sie das? Als ich begann, mich mit Wagner zu beschäftigen, gab es über die Tatsache, dass Wagner Antisemit war, noch gar keine Diskussion. Wagner-Forscher haben gesagt: Ja, den Antisemitismus bei Wagner gab es, das war damals eben so üblich. Dieses Argument habe ich nie teilen können. Bei Wagner ist der Antisemitismus eine regelrechte psycho-pathologische Obsession. Sein Antisemitismus ist stärker und radikaler als bei allen anderen Zeitgenossen, die man mit ihm vergleichen könnte. Insofern ist er ein Phänomen, mit dem man sich befassen muss; das ist allgemein anerkannt und wird zumindest öffentlich nicht mehr angezweifelt. Die Frage, ob dieser Antisemitismus im Text oder in der Musik vorkommt, ist in der Tat nach wie vor heftig umstritten. Wenn man diese Frage bejaht, so wie ich das tue, ist man bis heute in der Minderheit. Hier bin ich ganz auf der Seite von Autoren wie Paul Bekker und Adorno. Das Problem ist: Die Musikdramen sind kein eindeutiger Text, und es ist nicht so einfach, das klarzumachen. Es gibt einen antisemitischen Code, der dem Publikum des 19. Jahrhunderts imprägniert war. Man wusste, was gemeint war, wenn ein Mime des 19. Jahrhunderts in einen Watschelgang verfällt. Und wenn ein Schauspieler in einer Posse zu «mauscheln» anfängt, also Deutsch mit jiddischem Akzent spricht, muss er nur eine Zeile sagen, und das Publikum fängt an zu wiehern. Jede Woche gab es in manchen Zeitungen antisemitische Karikaturen. Das ist heute – mit Recht – tabuisiert. Auf diesen Code kann man sich heute nicht mehr verlassen. In der Salome von Richard Strauss findet sich das berühmte Judenquintett. Wenn man sich die Stimmführung darin anschaut – es sind vier Tenöre und ein Bass, kurios –, dann hört man in diesem kreischenden, keifenden Gesang genau den Ausdruck des jüdischen Gesangs und der jüdischen Sprache, den Richard Wagner in der Judentum-Schrift andeutet. Die kannte Strauss natürlich. Strauss war trotz einiger unerfreulicher Äusserungen in frühen Briefen kein Antisemit, aber er karikiert hier ganz offen auf musikalische Weise jüdisches Sprechen und Singen. Wenn man davon ausgehend schaut, wie die Partie von Beckmesser im zweiten Akt komponiert ist, wird man die Ähnlichkeiten mühelos feststellen. Das lässt sich vor Gericht nicht beweisen. Aber für meine Ohren ist es eindeutig, dass hier jüdische Musik parodiert wird. Dem Publikum wird unterschwellig zugetragen: Wenn ihr genau hinhört, wisst ihr schon, was ich meine.
Und wie steht es mit der Figur des Mime?
Natalie Bauer-Lechner, die ausserordentlich präzise Gespräche Gustav Mahlers
notiert hat und als sehr zuverlässige Quelle gilt, erinnert sich, wie Mahler nach einer Aufführung des Siegfried in geselliger Runde sagt, seiner Meinung nach wäre der Mime «die leibhaftige, von Wagner gewollte Persiflage eines Juden». Aber man dürfe es nicht so übertreiben, wie der Sänger es an diesem Abend getan habe. Für Mahler war ganz klar: Mime ist eine Judenkarikatur. Wagner wollte keine antisemitische Oper schreiben. Aber er gibt Signale, die darauf hindeuten, dass Mime jüdische Elemente auf eine unterschwellig karikaturistische Weise in sich trägt. Wenn Sie lesen, wie Wagner Mime in seinem Textentwurf von 1851 beschreibt, dann ist klar, was hier gemeint ist. Und wenn Siegfried singt «seh ich dich stehn, gangeln und gehn, knicken und nicken, mit den Augen zwicken...», dann ist das im Verständnis des 19. Jahrhunderts die Beschreibung des Bewegungsprofils eines Juden.
Lässt sich das auch konkret in der Musik festmachen?
Wenn Sie – mit dem Judenquintett aus der Salome im Ohr – den Streit von Mime und Alberich vor der Fafner-Höhle anhören, wie Mime schreit und in die höchste Tenorlage geht, dann ist das meiner Meinung nach eindeutig. Nicht in dem Sinne, dass Wagner sagen will: Ihr müsst begreifen, das ist ein Jude – wie sollte ein Jude auch in den germanischen Wald kommen? Aber für den Kenner des Themas im 19. Jahrhundert und darüber hinaus ist klar zu erkennen, was gemeint ist; für das heutige Publikum ist das schon schwerer verständlich. Man kann aber trotzdem nicht so tun, als ob das nicht existent wäre. Es gibt übrigens auch eine Kritik vom ersten Ring in Bayreuth 1876, die das genau so benennt.
Trotz all dieser Erkenntnisse gehören Wagners Werke heute zu den meistgespielten. An anderer Stelle haben wir gerade unter dem Titel «Wie toxisch ist das Opernrepertoire?» eine Debatte angestossen, in der wir der Frage nachgehen, wie wir in der Oper mit diskriminierenden Stücken umgehen wollen und ob man sie noch spielen soll. Wie sehen Sie das bei Wagners Werken? Das ist eine schwierige Frage. Ich warte darauf, dass Otello-Aufführungen von Shakespeare und Verdi nicht mehr möglich sind, eine beängstigende Perspektive; denn hier ist ja das Blackfacing-Problem offensichtlich. Bei Wagner sehe ich das anders, weil seine Figuren nicht so deutlich fixiert sind, etwa durch die Hautfarbe. Klar ist, man kann nicht einfach die Augen vor dieser Problematik verschliessen. Klar ist aber auch, ein Wagner-Verbot auf den Opernbühnen der Welt wäre absurd. Ich denke, die Verantwortlichen an den Häusern haben die Verpflichtung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man kann im Programmheft einen Text abdrucken und so zeigen, dass man sich des Problems bewusst ist. Man kann die Sache auch auf die Bühne bringen, wie Barrie Kosky das in Bayreuth in den Meistersingern getan hat. Genauso legitim ist es, wenn Regisseurinnen und Regisseure sich dieses Aspekts bewusst sind, ihn aber nicht in den Vordergrund rücken wollen. Da gibt es kein Patentrezept.
Wichtig ist ja, festzuhalten, dass die Aussage des Rings insgesamt keine antisemitische ist.
Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es gibt im Ring schon sehr krasse Gegensätze.
Wie Thomas Mann sagte: Es gibt die sonnigen, die heldischen Figuren, die die Welt erlösen sollen – manche scheitern dabei –, und es gibt die dunkle Gegenwelt, und dazu gehören Alberich, Hagen, Mime. Die Dunklen haben immer wieder jüdische Untertöne in der Figurenzeichnung, und das fällt dann doch auf. Dazu lässt sich nur sagen: Wie kann man annehmen, dass eine so zentrale Obsession wie der Antisemitismus, die Wagner bis in die tiefsten Tiefen geprägt hat, in seinem Werk, das so sehr Bekenntniswerk ist, keine Rolle spielt? Das war tief in ihm drin – und nicht nur Mode oder ein Ressentiment gegen den Konkurrenten Meyerbeer.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
Jens Malte Fischer war Professor für Theaterwissenschaft an der Universität München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Kultur der Jahrhundertwende um 1900 sowie die Geschichte der deutsch-jüdischen Kultur und des Antisemitismus. 2015 erschien von ihm «Richard Wagners ‹Das Judentum in der Musik›. Eine kritische Dokumentation».
Er ist ausserdem Autor zahlreicher weiterer musikwissenschaftlicher Publikationen wie «Gustav Mahler. Der fremde Vertraute» (2003) und «Richard Wagner und seine Wirkung» (2013).
Siegfried über Mime im «Ring des Nibelungen»
Camilla Nylund gehört zu den international gefragtesten lyrischdramatischen Sopranistinnen und debütiert in Zürich im «Ring des Nibelungen» als Brünnhilde. Bei den Bayreuther Festspielen sang sie Elisabeth, Elsa, Sieglinde und Eva, in Zürich war sie bereits als Elsa und Isolde sowie als Brünnhilde in der «Walküre» zu erleben.
Sie war fünfzehn, als sie ihre erste grosse Reise machte, nach Rom zu einem Meisterkurs für Sänger. Dazu musste sie erstmal ein Schiff nach Stockholm besteigen, knapp 500 Kilometer südwestlich ihrer finnischen Heimatstadt Vaasa. «Meine Gesangslehrerin ist auch mitgefahren und ein paar ältere Mädchen», sagt Camilla Nylund, «aber es gab keine Handys.» 1983 war das. «Dass meine Eltern keine Angst hatten, mich da losziehen zu lassen! Meine Mutter hat dann in der Pension in Rom angerufen und wollte wissen, wie es mir geht, und die Wirtin hat abgenommen und pronto, pronto gesagt, und meine Mutter fragte sich, was sie damit meint, bråttom, bråttom? Das heisst auf Schwedisch schnell.»
Diese Reise ist der Schlüssel zu vielem, was Camilla Nylund bei unserem Treffen erzählt, rund um ihre Arbeit an der Brünnhilde im Zürcher Siegfried und an der Katerina Ismailowa in der Hamburger Lady Macbeth von Mzensk. Wir sitzen in der Wohnung ihrer Hamburger Freundin, deren grosse Gemälde uns umgeben. Jetzt wallen ihre blonden Haare ungebunden, abends werden sie für Katerina wieder streng hochgesteckt. Auf der Bühne der Oper Hamburg macht sie die lebenshungrige Ehefrau, die zur Mörderin wird, derartig glaubhaft, so stark, flexibel, leuchtend, nuanciert im Gesang, so präsent in der ganzen Gestalt, dass man in keiner Sekunde über das Alter der Darstellerin nachgrübelt. Und über ihr Russisch ebenso wenig. Sie selbst aber schon. «Ich könnte viel Zeit damit verbringen, das zu perfektionieren», meint sie. «Ich kann kyrillisch nicht lesen, ich habe den Text der Oper im Klavierauszug mit Lautschrift gelernt und das natürlich mit einer Russin durchgesprochen. Es hat aber gut funktioniert, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich eine Finnlandschwedin bin. Das Slawische liegt mir.» Sie kommt aus der schwedischsprachigen Minderheit am Küstenstreifen entlang des Österbotten, St. Petersburg ist von der Hafenstadt Vaasa kaum weiter entfernt als Stockholm, und in so einer Lage wird das «Sprachohr» gut geschärft, das eine so vielseitige Sängerin braucht.
Camilla Nylund wusste ziemlich früh, dass sie Sängerin werden wollte. Aufgewachsen im Dorf Kvevlax östlich von Vaasa, Tochter eines Technikers und einer Krankenschwester, sang sie gern, wie ihre Eltern. Es gab eine Musikschule dort, staatlich finanziert, «jeder konnte sich das leisten». Sie lernte Blockflöte, Querflöte, Klavier, sang im Chor, sie wollte «überall dabei sein». Mit vierzehn bekam sie in Vaasa klassischen Gesangsunterricht, mit fünfzehn stand sie erstmals als Solistin auf der Bühne. Ein Musiklehrer des Gymnasiums hatte für das Musical Jesus Christ Superstar alle verfügbaren Kräfte vereint, Camilla durfte die Maria Magdalena singen, auf schwedisch. «Ein unglaubliches Erlebnis mit Kostüm und Maske und Orchester, ein Riesenerfolg.»
Die Reise nach Rom im selben Alter gab ihr zusätzlichen Rückenwind. «Es war unglaublich heiss und eine fantastische Woche. Ich hatte danach nie mehr Angst vor etwas Neuem. Ich musste mich ja zurechtfinden in der Welt, und das hat mir in diesem Beruf viel geholfen. Ich habe immer gedacht, ich muss es irgendwie schaffen.» Dass und wie sie es geschafft hat in eine internationale Karriere, macht sie vielleicht erst recht sensibel für die Hürden, an denen eine so starke und lebensfrohe Frau wie Katerina Ismailowa in Schostakowitschs Oper scheitert. «Sie ist kein Monster. Es sind die Umstände, die sie zur Mörderin machen. Wenn man in so einer schrecklichen Umgebung lebt… Es ist ein total aktuelles Stück, denn die Situation, der Machtanspruch von Männern, hat sich für viele Frauen nicht verändert.» Darum ist sie froh, dass eine Frau das Stück inszeniert hat, die Filmemacherin Angelina Nikonova.
Nylund, die mit ihrem Mann in Dresden lebt und dort die beiden Töchter grosszog, wurde von Anfang an ermutigt. Es gab auch glückliche Fügungen, und eine davon veranlasst sie zu glauben, «dass es höhere Mächte gibt, die etwas für uns regeln.» Als sie sich am Salzburger Mozarteum um einen Studienplatz bewarb, «da hätte so viel schiefgehen können. Und da gab es eine Lehrerin, die an mich geglaubt hat. Ich wusste nicht, wie man einen Ton stützt und einen hohen Jubelton singt. Éva Illés hat zu mir gesagt, ‹Sie kamen auf die Bühne und hatten eine Ausstrahlung›.» Eine schwierige Lehrerin sei sie gewesen, aber sie legte die technische Basis.
In Salzburg und dann beim ersten festen Engagement in Hannover, dem eines in Dresden folgte, wurde Deutsch für Camilla Nylund zur zweiten Muttersprache, und bald auch zur ersten Bühnensprache. Denn Rollen in den Opern von Richard Strauss und Richard Wagner hat sie besonders oft gesungen. Als Salome steht sie seit bald zwanzig Jahren auf den Bühnen, als Elisabeth im Tannhäuser fast schon ebenso lange, «im Ring habe ich alle Partien gesungen, die man singen kann. Woglinde, Freia, Gutrune, Sieglinde…» Dass allerdings noch Brünnhilde dazukommen könnte, hat sie sich bis vor fünf Jahren nicht träumen lassen. Brünnhilde, ein Achttausender für Sängerinnen! «Als Andreas Homoki mir das anbot, habe ich ihn zuerst für verrückt erklärt und dann gedacht, ich habe doch oft verrückte Sachen gemacht und vieles gewagt. Zürich ist nicht so ein riesengrosses Haus, und in eine Neuproduktion kann ich mich reinknien. Durch meine Kontinuität, durch die Arbeit an so verschiedenen Partien kann meine Stimme das mitmachen. Ich habe ein Fundament, auf dem ich stehen kann, das ist, wie wenn man ein Haus baut. Ich habe keine hochdramatische Stimme, sondern mache das mit meinen Mitteln. Es gibt verschiedene Techniken, wie man die Stimme über das grosse Orchester projiziert. Eine bombensichere Technik habe ich bei Irmgard Boas gelernt.»
Diese jetzt 90 Jahre alte Lehrerin lernte Nylund 2003 in Dresden kennen, und es ist dieselbe Zaubermeisterin, der auch Klaus Florian Vogt vertraut. Er singt in Zürich seinen ersten Siegfried an Nylunds Seite, die ihm schon ein RingStück voraus ist. In der Walküre ist Brünnhilde von der Göttin zum Menschen gemacht worden, jetzt, in Siegfried, «wacht sie auf, hat Siegfried vor sich und weiss gar nicht, was das Menschsein bedeutet. Er spricht von Liebe, aber er kennt die Liebe auch nicht. Da ist die Verzweiflung von Brünnhilde, die versucht zu erklären, woher sie kommt, was sie für eine Frau ist, und er versteht überhaupt nichts. Das ist interessant, typisch Mann und Frau. Spannend, auch wenn dieser Text so kompliziert ist.»
Solche Menschlichkeiten sind es, die sie interessieren, «ich bevorzuge auch grosse Rollen, weil ich die einen ganzen Abend lang entwickeln kann.» Und natürlich in den Proben. «Es ist toll, wie Homoki diese Figuren sieht. Wir kamen auch mal an einen Punkt, wo wir merkten, nein, so kann die Person nicht sein. Wir entwickeln das dann zusammen. Was ich sage, was ich tue, da muss ich wirklich dahinterstehen.» Und nun steht sie zeitgleich hinter zwei sehr verschiedenen Gestalten, Brünnhilde und Katerina, beides neue Rollen, wie hält sie das aus? «Das war natürlich ein Wahnsinn, gleich nach der Premiere in Hamburg mit Brünnhilde in Zürich anzufangen, und deren Partie habe ich gelernt, während ich Proben mit Katerina hatte. Aber es ging halt nicht anders.» Es ging nicht anders, weil Siegfried schon fest stand und die Lady Macbeth sie «irrsinnig gereizt» hat, auch wenn Nylunds Ehemann, ebenfalls Sänger, meinte: «Das ist zuviel für dich.» Es geht, aber andere würden durchdrehen. «Ich ruhe in mir», sagt sie schlicht. Und dann erzählt sie noch etwas von früher und von jetzt. Sie wollte nach dem Abitur in Helsinki Gesang studieren, an der SibeliusAkademie. Abgelehnt. «Da hat man nicht an mich geglaubt. Ja, eine gute Stimme, aber nicht gut genug. Ich hab’ da nie studiert. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit dem Leiter der Opernausbildung dieser Akademie. Ich gebe im November den Meisterkurs.» Sie lacht sehr froh. «So kann’s gehen.»
Volker Hagedorn
Mime gehört zu den Paraderollen des österreichischen Charaktertenors
Wolfgang AblingerSperrhacke. Für ihn ist diese Figur mehr als ein machtgieriger, hinterlistiger Zwerg, der den Helden Siegfried vergiften will. Er entdeckt in ihr auch Facetten von Zärtlichkeit, Sehnsucht und Zuneigung
Foto Florian KalotayWann immer Wagners Ring auf dem Spielplan eines wichtigen Opernhauses steht, kann man wetten, dass man deinen Namen dort auf dem Besetzungszettel findet, sei es etwa in Amsterdam, Toronto, Madrid, Mailand, Berlin, Wien, München – und nun auch in Zürich. Wie oft bist du schon im Ring aufgetreten?
Das weiss ich nicht genau, aber wenn man alle drei Partien im Ring, die ich singe, also Loge und Mime in Rheingold und Siegfried, zusammen nimmt, müssen es um die hundertwanzig Mal gewesen sein.
Wird es nicht irgendwann langweilig, eine Partie so oft zu singen?
Überhaupt nicht, denn ich befinde mich doch immer wieder in ganz unterschiedlichen Konstellationen – ein anderer Dirigent, ein anderer Regisseur, andere Partner auf der Bühne, ein anderes Bühnenbild usw. Dadurch ergeben sich ständig neue Anregungen und Ideen für die eigene Interpretation, vorausgesetzt, es handelt sich, wie in diesem Falle, um ein wirklich grosses Kunstwerk. Denn die grossen Kunstwerke sind unerschöpflich. Zum Beispiel habe ich kürzlich den Herodes fast gleichzeitig in Zürich und in Mailand gesungen. Das waren zwei ganz verschiedene Aufführungen, ja fast zwei verschiedene Stücke, und darum war auch der Herodes, den ich gespielt habe, jeweils ganz verschieden. Nein. Es wird nie langweilig, vielmehr finde ich es immer interessant, eine Partie, die ich schon lange kenne, neu zu erarbeiten und neue Möglichkeiten zu finden. Das ist immer wieder eine Entdeckungsreise, sonst würde es vielleicht wirklich irgendwann langweilig.
Wie machst du es, dass du die verschiedenen Inszenierungen nicht verwechselst? Hast du dich schon mal geirrt und dich plötzlich am falschen Ort wiedergefunden?
In der Probenarbeit versuche ich zu erreichen, dass alles, was ich szenisch und musikalisch mache, für mich einen logischen Zusammenhang bildet. Das ist dann wie ein fester Rahmen, in dem ich mich bewege. Und wenn der wirklich gut ausgearbeitet ist, gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als das jeweils so zu singen und zu spielen, wie es verabredet ist. Ich hatte in meinem Studium einen Professor, der mir die FelsensteinMethode vermittelt hat, die ich bis heute anwende. Das bedeutet vor allem, dass ich in jedem Moment mit sogenannten «Untertexten» arbeite. Das sind fiktive Texte, die in meinem Kopf ablaufen und beinhalten, was die
Figur jeweils gerade denkt, woraus sich dann ergibt, was sie gerade tut. Sie entstehen aus einer genauen psychologischen Durchleuchtung der Motivation der Figur, sie beinhalten also, was sie denkt, ohne es zu sagen, was sie wirklich beabsichtigt. Diese Untertexte sind notwendigerweise in jeder Inszenierung anders, und man kann sie nicht verwechseln. Mir ist das jedenfalls noch nie passiert.
Du singst den Mime im Siegfried deutlich häufiger als den im Rheingold. Woran liegt das?
Vor allem daran, dass der SiegfriedMime musikalisch erheblich anspruchsvoller ist, weshalb ihn viele Häuser nicht, wie den RheingoldMime, aus dem Ensemble besetzen können. Um das zu verdeutlichen, genügt schon die simple Tatsache, dass die Partie genauso lang ist wie die des Tristan und einen Stimmumfang von mehr als zwei Oktaven verlangt, von der Vielzahl unterschiedlicher Farben und Ausdrucksnuancen, die auch gesangstechnisch dem Sänger viel abverlangen, gar nicht erst zu reden. Aber die grösste Schwierigkeit liegt darin, dass fast der ganze erste Akt sehr tief liegt, fast in der BaritonLage, während der Rest der Partie dann in die Tenorlage wechselt. Das ist ein schöner Ausdruck für die wachsende Bedrängnis, in die Mime gerät, aber stimmtechnisch ist das das sehr anspruchsvoll. Tatsächlich ist der Mime in Siegfried eine der ganz grossen Herausforderungen und darum auch gleichzeitig eine Traumpartie für jeden Charaktertenor. Ich habe lange, bevor ich ein Engagement hatte, mit der Arbeit daran begonnen, und es hat schliesslich vier Jahre gedauert, bis ich mir die Partie angeeignet hatte. Nun habe ich sie drauf und geniesse sie jedes Mal, wenn ich sie singe.
Unter einer Traumpartie für einen Tenor stellt man sich aber eigentlich etwas anderes vor, als so ein verschlagenes Schlitzohr, das den Haupthelden der Oper umbringen will…
So einfach ist das ja aber nicht. Mime ist eben kein schablonenhafter Bösewicht. Der ganze erste Akt der Oper dient eigentlich dazu, seine Lebenssituation zu schildern, erfahrbar zu machen, wie er zu dem geworden ist, was er ist, und zu zeigen, warum er so handelt, wie er handelt. Es wäre doch einfach langweilig, wenn man die ganze Zeit nur dem Brunnenvergifter zusieht, der immerzu listig, bösartig, geldgierig und was nicht noch alles ist. Ich glaube auch gar nicht, dass er von Anfang an darauf aus ist, Siegfried zu töten. Das kommt erst, wenn er begreift, dass er keine andere Wahl hat, wenn er seinen grossen Plan verwirklichen will, nämlich in den Besitz des Rings zu kommen und so doch noch etwas aus seinem mickrigen Leben zu machen. Wenn er diesen Plan aufgibt, weil er nicht zum Mörder werden will, wäre das lange mühselige Zusammenleben mit diesem Halbstarken, die ganze jahrelange Quälerei, von der uns der erste Akt einen Eindruck gibt, umsonst gewesen. Ausserdem gibt es noch einen ganz anderen Aspekt: Mime hat Siegfried aufgenommen und siebzehn Jahre lang wie seinen Sohn grossgezogen; ohne ihn hätte Siegfried nicht überlebt. Wenn einer ein Kind bei sich aufnimmt, es nährt und pflegt, es heranwachsen sieht, seine ersten Schritte beobachtet und seine ersten Wörter hört, entsteht zwangsläufig eine gewisse Zuneigung, wie zwielichtig sie immer sein mag. Und es ist auch ganz unmöglich, dass sie nicht wenigstens teilweise erwidert wird. Tatsächlich gibt es in der Musik immer wieder Momente einer anrührenden Zartheit zwischen den beiden. Mime ist nicht zum heimtückischen Mörder, Siegfried nicht zum brutalen Totschläger geboren. Beide habe im Grunde ihres Charakters eine tiefe Sehnsucht nach Glück und Liebe, so verdreht sie sich auch äussern mag. Mime ist ein ganzer Mensch, und ein zutiefst unglücklicher Mensch. Ein Täter und ein Opfer.
Das hört sich so an, als würdest du ihn mögen.
Ja, ich mag diesen Kerl. Das ist eben das Grossartige bei Wagner, dass er keine einseitigen Figuren geschaffen hat. Wir wissen von den antisemitischen Konnotatio
nen, die für Wagner mit Mime verbunden waren. Aber selbst wenn er die Absicht gehabt haben sollte, eine antisemitische Karikatur und sonst nichts zu schaffen, ist es ihm nicht gelungen. Er war einfach zu sehr Theatermann, um nicht zu wissen, dass die Widersprüche eine Figur interessant machen und dass ein böser Bösewicht so langweilig ist wie ein guter Gutmensch. Ich möchte sogar so weit gehen, Mime die menschlich nachvollziehbarste Figur der ganzen Tetralogie zu nennen. Ein Mensch mit grossen Schwächen und Stärken, ein Feigling und ein Kämpfer, er ist hinterlistig und zärtlich, bösartig und humorvoll, Vater und Mutter… Er ist ein ganzes Universum.
Nichtsdestoweniger gehört er im Ensemble des Rings zu den negativen Figuren. In deinem Fach gibt es ja ohnehin kaum positive Identifikationsfiguren. Oder?
Eigentlich nur eine: Wenzel in Smetanas Die verkaufte Braut – dieser Aussenseiter, den alle auslachen, der es aber im Laufe des Stücks schafft, sich von der dominanten Mutter und der Bosheit seiner Umgebung zu emanzipieren und zu seinem eigenen Leben zu finden. Das ist eine sehr anrührende Geschichte, und ich habe den Wenzel immer sehr gern gespielt. Aber ansonsten habe ich es immer mit Figuren zu tun, deren Schattenseiten deutlicher hervortreten als ihre hellen, um es mal so auszudrücken.
Und spielst du diese Bösewichter gern?
Ja, das ist ganz wunderbar. Denn die Bösen sind eben meistens die vielfältigeren Charaktere. Der Siegfried ist natürlich auch eine Figur mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten, aber sehr oft sind diese Liebhaber doch ein wenig langweilig, weil so voraussehbar ist, wie es mit ihnen gehen wird. Die Gegenspieler haben eben gerade, weil sie nicht auf das Gutsein festgelegt sind, alles, was ein Mensch an Eigenschaften haben kann. Diesen ganzen Reichtum auf die Bühne zu bringen, ist eine grosse Herausforderung für einen Sänger und Darsteller. Einem Rodolfo fliegen die Herzen des Publikums immer zu, und selbst wenn man es wollte, wäre es schwer, wenn nicht unmöglich, ihn um die Sympathie des Publikums zu bringen. Aber Mime den Leuten so nahe zu bringen, dass sie, vielleicht ohne es zu merken, Mitgefühl mit ihm haben und ihn sogar für einen Moment bedauern, wenn sein trostloses Leben so schrecklich zu Ende geht – das ist eine grosse und schöne Aufgabe, und der stelle ich mich immer, wenn ich die Partie singe.
Das Gespräch führte Werner Hintze

LICHTSPEKTAKEL ZUM ZÜRCHER RING
2, 3, 4 MÄR 2O23, AB 18.3O UHR, ALLE 45 MIN.
AUF DER FASSADE DES OPERNHAUSES
EINTRITT FREI


Siegfrieds Hornruf gibt es sogar als Klingelton. Ihn zu spielen, ist für uns Hornist:innen eine Herausforderung, und er ist eine viel gefragte Probespielstelle. Für mich ist es eine grosse Freude, dieses lange Solo in einer Aufführung spielen zu dürfen, denn so oft bekommt man diese Chance nicht. Aufgeregt zu sein gehört natürlich dazu, aber den Druck ist man in unserem Job gewöhnt. Die grösste Herausforderung dabei wird sein, dass man ganz alleine und ohne Orchesterbegleitung spielt. Dazu kommt, dass der Ruf hinter der Bühne erklingt und eine ganz andere Konzentration und Wahrnehmung gefordert ist als im Graben. Auch technisch ist die Stelle anspruchsvoll, denn sie ist lang, und am Ende folgt mit dem C im Fortissimo einer der höchsten Töne für das Horn überhaupt. Die charakteristischen ersten drei Takte leiten eine längere Passage ein, die später als grosses Crescendo gespielt werden muss und immer schneller wird. Dieses pausenlose Accelerando mit Kulmination im hohen C macht es hier nicht leicht, durchzuhalten. Die Komponisten und Komponistinnen wissen für gewöhnlich um diese Problematik, und so gibt es in der Musik nur sehr selten längere Passagen für Horn ohne Pausen. Richard Wagner hat sehr genau geschrieben, wie die unterschiedlichen Töne zu artikulieren sind: Eine «Triangel» über dem zweiten Ton bedeutet zum Beispiel, dass er etwas stärker akzentuiert wird als die Töne, über denen kleine Keile stehen. Durch diese Akzente entsteht ein fast schwebendes Metrum, wodurch die Musik ihren RufCharakter bekommt. Eine grosse Besonderheit unserer Aufführung wird sein, dass auch der Siegfried auf der Bühne einige Takte übernimmt: Klaus Florian Vogt war ursprünglich Hornist. Ich habe riesigen Respekt vor ihm, dass er sich auf dieses Abenteuer einlässt, und bin mir sicher, dass Wagner seine wahre Freude daran gehabt hätte!
Joan Bernat Sanchis


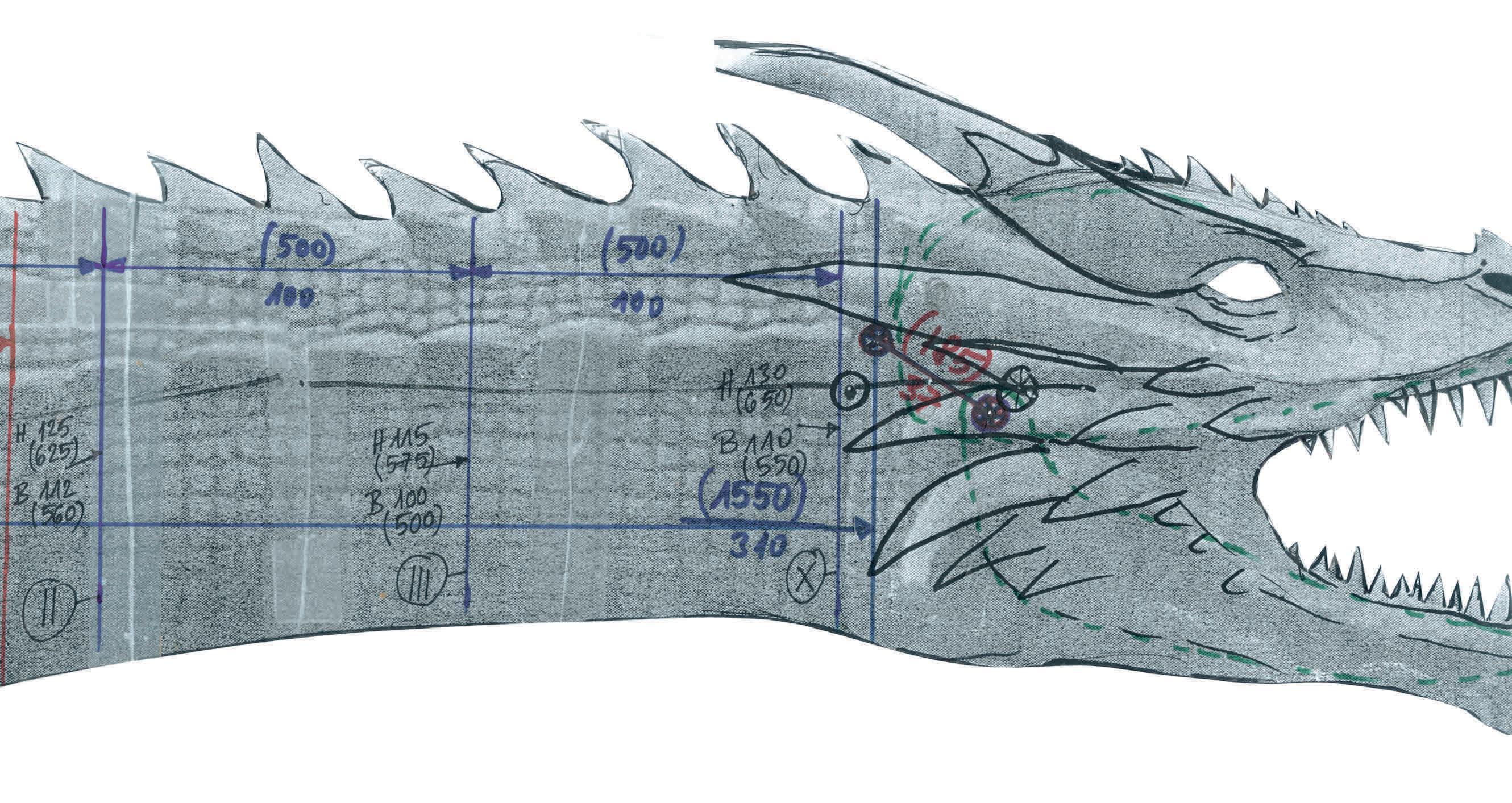
Vor der Neidhöhle sehen Wotan und Alberich zunächst nur den Schwanz des Lindwurms, der noch nicht sehr bedrohlich wirkt; später erscheint auch der Kopf des wilden Wurms, von dem Siegfried das Fürchten lernen soll. Dieser Kopf kann sich nicht nur hoch und runter, sondern auch von links nach rechts bewegen, um Siegfried zu verfolgen. Gesteuert wird er – verborgen hinter der

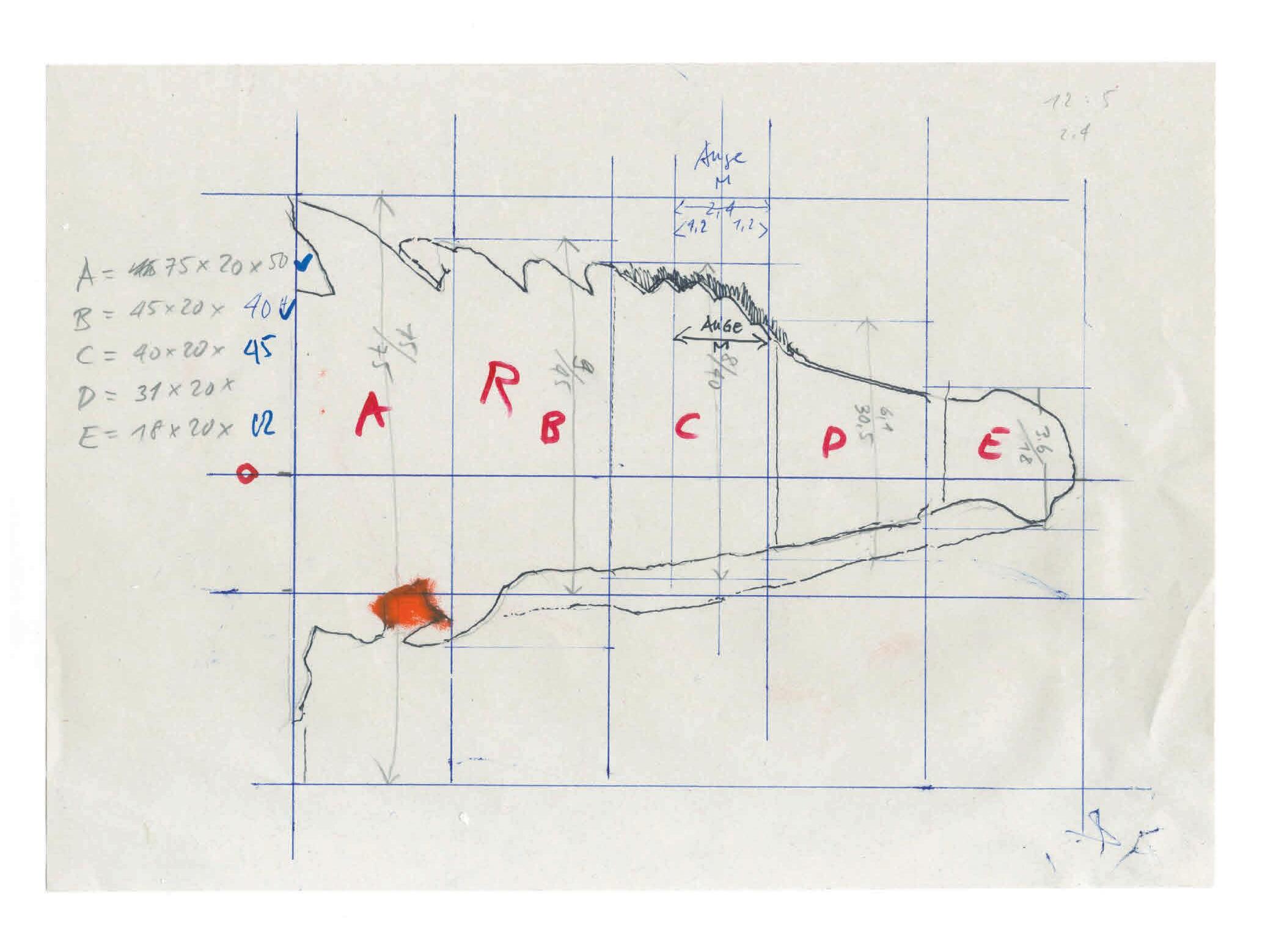

Wand – von einem Puppenspieler über eine Bewegungsmechanik, die Theaterplastiker Andi Gatzka erdacht hat, ähnlich der, die auch schon beim riesigen Puma für «Belshazzar» zum Einsatz kam. Auch sein grosses Maul kann der Lindwurm aufreissen, seine spitzen Zähne zeigen, Rauch und giftigen Geifer speien. Für das äussere Erscheinungsbild hat sich Theaterplastiker Moises Bürgin von Bildern und Zeichnungen der Film- und Game-Industrie inspirieren lassen. Schliesslich sollte der Lindwurm möglichst gefährlich aussehen. Das ist zweifellos gelungen – so manche Hollywood-Filmausstattung wäre stolz darauf. Nur Siegfried lernt das Fürchten auch von unserem Lindwurm nicht. Er stösst ihm kaltblütig sein Schwert ins Herz.

Die Liaison mit dem leichtlebigen Offizier Wronski wird der verheirateten Anna Karenina zum Verhängnis. Ihre Liebe scheitert an der herrschenden Moral. Christian Spuck hat die anspruchsvolle Romanvorlage von Lew Tolstoi für die Ballettbühne adaptiert.


Vorstellungen: 19, 23, 25 März; 1, 2, 5, 6 Apr 2023
 Fotos: Gregory Batardon
Fotos: Gregory Batardon


Wie integriere ich mich in eine Gruppe, und welche Kraft lässt sich aus unserer Erinnerung gewinnen? Das sind nur zwei der Fragen, mit denen sich die Stücke im Ballettabend «Horizonte» beschäftigen. Shaked Heller, Samantha Lynch und Vittoria Girelli haben ihre Choreografien eigens für das Junior Ballett kreiert.
Vorstellungen: 12, 25 März 2023



Aus welcher Welt kommst du gerade? Gerade ist die letzte Vorstellung von On the Move über die Bühne gegangen. Die Choreografien von Hans van Manen, Louis Stiens und Christian Spuck haben mir die Möglichkeit gegeben, mich in drei ganz verschiedenen Tanzsprachen auszudrücken. Unser Probenalltag ist zurzeit wirklich intensiv. Neben Angels’ Atlas und Anna Karenina arbeiten wir auch an Christians grossartiger Interpretation von Verdis Messa da Requiem, mit der wir Anfang März beim Adelaide Festival in Australien gastieren. Darauf freue ich mich schon sehr.
Was bedeutet es dir, in einer Rolle wie Anna Karenina aufzutreten?
Es ist eine wunderbare Aufgabe, mit Tolstoi eine Zeitreise zu unternehmen und diese bewegende Geschichte von Liebe und Verlust zu erzählen. Annas Geschichte ist voller Mehrdeutigkeiten. Mir gefällt, wie Christian Spuck in seinem Ballett die Spannung und Komplexität der Situationen zeigt, die Anna Karenina durchlebt. Die atemberaubenden Kostüme von Emma Ryott tragen dazu bei, die Verwandlung in diese faszinierende Figur perfekt zu machen.
Welches Bildungserlebnis hat dich besonders geprägt?
Die grossen Schritte in meinem beruflichen und persönlichen Leben gingen immer mit Ortswechseln einher. Mein Weg hat mich von Charkiw nach Perm und von dort schliesslich nach Zürich geführt. Ich hatte das Glück, unglaubliche Lehrer zu haben, die mir geholfen haben, zu der Person zu reifen, die ich heute bin.
Von welcher Musik bekommst du nie genug?
Klaviermusik mag ich sehr. Ich versuche, so oft wie möglich ins Konzert zu gehen, um den magischen Klang dieses Instruments live zu hören. In Frédéric Chopins Kompositionen kann ich mich
versenken. Seine Musik ist für mich sehr berührend und inspirierend.
Welches Buch würdest du niemals aus der Hand geben?
Erich Maria Remarque ist mein absoluter Lieblingsautor. Romane wie Arc de Triomphe oder Drei Kameraden könnte ich immer wieder lesen. Das ist mir vorher mit keinem anderen Autor passiert.
Welchen überflüssigen Gegenstand in deiner Wohnung liebst du am meisten?
Ein paar Kerzen sind bei mir immer zu finden. Ich liebe es, ins Feuer zu schauen, und irgendwann einen Kamin zu haben, wäre mein grosser Traum.
Mit welchem Künstler, welcher Künstlerin würdest du gern essen gehen?
Ich habe nie Ballett-Idole gehabt, weil ich immer die Gefahr sehe, jemanden aus Bewunderung zu imitieren. Aber in diesem Fall wäre es wohl Darcey Bussell vom Royal Ballet. 2007 hat sie ihre aktive Karriere beendet und ist heute Präsidentin der Royal Academy of Dance Ich wünschte, ich hätte sie noch live tanzen sehen können. Die wenigen existierenden Video-Aufnahmen sind atemberaubend. Mit ihr über Tanz zu sprechen, wäre sicher eine tolle Erfahrung.
Gibt es drei Gründe, warum das Leben schön ist?
Weil nach der Nacht immer wieder ein Morgen kommt. Weil wir fähig sind zu lieben. Weil das Leben fortwährende Bewegung ist.
Inna Bilash stammt aus der Ukraine. Nach ihrer Ballettausbildung in Charkiw und Perm war sie Solistin im Ballett Perm. Seit der Saison 2018/19 ist sie Mitglied des Balletts Zürich. Hier war sie u.a. als Giselle und erst jüngst im Ballettabend «On the Move» zu erleben. Jetzt tanzt sie die Titelrolle in Christian Spucks «Anna Karenina».

Die Mauern der Kaiserstadt. Massige Zinnen umschliessen fast die ganze Szene. Rechts wird der Kreis durchbrochen von einem Laubengang voller Skulpturen und Schnitzereien, die Ungeheuer, Einhörner, Phönixe darstellen, während die Laubenpfeiler auf dem Rücken gewaltiger Schildkröten ruhen. Zu Füssen des Laubenganges ein gewaltiger bronzener Gong. Auf den Zinnen sieht man Pfähle, auf die die Köpfe der Hingerichteten gespiesst sind. Links und im Hintergrund drei riesige Tore in der Mauer. Wenn sich der Vorhang hebt, geht die Sonne gerade unter. Das

 Giacomo Puccini: Turandot, Regieanweisung zum Ersten Akt
Giacomo Puccini: Turandot, Regieanweisung zum Ersten Akt
Die Diskussion um sogenannte kulturelle Aneignung erregt zur Zeit die Gemüter. Die einen finden es nicht in Ordnung, Attribute und Ausdrucksformen fremder Kulturen unreflektiert zu übernehmen, und würden am liebsten Winnetou und das Indianerspielen abschaffen. Die anderen empören sich über den Tugendterror einer überempfindlichen Kulturkritik. Ist kulturelle Aneignung auch in der Oper ein Problem?
Darum geht es in der dritten Folge unserer Debatte zum Thema: Wie toxisch ist das Opernrepertoire?
Der deutsch-indische Komponist Sandeep Bhagwati ist in der abendländischen und in aussereuropäischer Musik zu Hause. Ein Gespräch über die Sehnsucht nach Exotik in der Oper, kulturelle Aneignung und die Frage, ob Puccinis Opern ein Fall von Raubkunst sind.
Herr Bhagwati, Sie sind Komponist, Kurator, Professor für interkulturelle Kunstpraxis und – verkürzt gesagt –ein Künstler, der die Musik und ihre Erscheinungsformen nicht nur aus dem Blickwinkel der abendländischen Kultur betrachtet.
Ich bin bi-kulturell mit mehreren Sprachen und Musiktraditionen aufgewachsen. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Inder. Wir haben bis zu meinem fünften Lebensjahr in Indien gelebt. Dann sind wir nach Europa gezogen. In Deutschland bin ich zur Schule gegangen und habe Komposition und Dirigieren studiert.
Wir wollen über das Thema der sogenannten kulturellen Aneignung sprechen, über das im Moment vielerorts hitzig diskutiert wird. Es geht darum, ob und wie wir fremde Kulturen in unseren westlichen Kunstformen noch darstellen können, ohne sie herabzusetzen. Die Oper ist voll von Stoffen, die sich in exotische Welten träumen. Sie spielen in China wie Puccinis Turandot, in Japan, im Orient oder in Afrika wie Verdis Aida. Ist dieser westliche Blick auf fremde Kulturen heute grundsätzlich zum Problem geworden?
Man muss immer genau hinschauen, bevor man pauschal wertet, und sich etwa vor Augen führen, wie die Opernstoffe entstanden sind. Viele haben relevante Themen ihrer Zeit aufgegrif-
fen wie etwa Die Entführung aus dem Serail von Mozart. Die Bedrohung durch das Osmanische Reich, aber auch die systematischen Entführungen von Europäern durch die von diesem Reich unterstützten Korsaren waren im 18. Jahrhundert ein grosses Thema. Deshalb war der Blick auf die orientalische Kultur zu gleichen Teilen geprägt von Furcht und Anziehung. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen gespürt, dass im fernen Osten mit China ein faszinierendes, aber nur wenigen Europäern bekanntes Reich von weltpolitischer Bedeutung existiert, also wurde es in der Kunst thematisiert. Die Motivation, sich fremden Kulturen in Opern zuzuwenden, war also nicht arrogantes Vertrauen in die eigene Überlegenheit, sondern eher so etwas wie bange Neugier.
Die Kritiker kultureller Aneignung würden hier einwenden, dass die Darstellung fremder Kulturen immer aus der Haltung kolonialer, westlich arroganter Überlegenheit erfolgt ist, weil das Verhältnis zwischen den verschiedenen Teilen der Welt eben von dieser Haltung geprägt war. Ich glaube, das greift zu kurz. Es gibt interessanterweise gar nicht so viele Opern, die in den Kerngebieten kolonialistischer Eroberungen spielen, also in Südasien, in Afrika oder in den frühkolonialen Eroberungsgebieten von Süd- und Mittelamerika. Die tauchen vermehrt erst später in der postkolonialen Zeit des 20. Jahrhunderts auf. In England etwa sind im 19. Jahrhundert kaum Opern entstanden, die fremde Kulturen thematisieren. Das ist ja auch klar: Wenn man als Kolonialmacht ein unterjochtes Land entwürdigend als niedere Kultur etablieren will, schreibt man nicht gerade eine Oper darüber. Das macht man auf anderen Wegen. In Opern wird ja eher die starke Lebenskraft der fremden Kulturen gefeiert, die Begeisterung für das Exotische ist Ausdruck eines Überdrusses an der eigenen Kultur. Das Bürgertum des 19. Jahrhunderts projizierte Fantasien von Despotie, erotischer Libertinage und Farbigkeit des Lebens auf nichteuropäische Kulturen. In Bezug auf Musik liegen die negativen Folgen des Kolonialismus für mich eher darin, mit welcher Dominanz die westliche Musik in die meisten Regionen der Welt Einzug gehalten hat.
«Wenn man sich nicht in andere hineinversetzen darf, braucht man gar nicht erst auf die Bühne zu gehen.»
Hätten nicht Kanonenboote mit Gewalt die technische Überlegenheit westlicher Zivilisation demonstriert und damit suggeriert, dass diese auch im Kulturellen «besser» aufgestellt sei, hätten sich manche kolonialisierten Länder vielleicht auch ein stärkeres Selbstbewusstsein für die eigenen, reichen Traditionen bewahrt.
Trotzdem stellt sich die Frage, wie man heute ein OpernChina oder einen OpernOrient auf die Bühne bringen kann, ohne sogenanntes «Othering» zu betreiben, also die fremde Kultur von der eigenen abzugrenzen?
Ich glaube, ohne «Othering» gäbe es gar kein Theater. Wenn man sich nicht in andere hineinversetzen darf, braucht man gar nicht erst auf die Bühne gehen. Im Theater will man nicht nur sich selber sehen – und wenn, dann in Formen, die einem tiefere Schichten seines Selbst zeigen. Das kann man nur, indem man sich im Anderen veräussert. Auch in der griechischen Tragödie legte man Masken an, um ein Anderer zu sein. Wenn Kinder Theater spielen, wollen sie sich verkleiden, und der Antrieb ist dabei meist nicht, sich über die Verkleidung lustig zu machen. Natürlich gibt es auf der Bühne Darstellungen anderer Kulturen, die diskriminierend, verkürzend, beleidigend sind. Der Protest dagegen ist berechtigt. Aber jeder Darstellung einer anderen Lebensform durch jemanden, der sie selbst nicht lebt, von vornherein negative Intentionen zu unterstellen, ist mir zu undifferenziert. Ich stehe der Debatte um kulturelle Aneignung auch deshalb skeptisch gegenüber, weil in ihr mit dem Begriff der Identität operiert wird. Als ob klar wäre, was die Identität des Menschen ist. Was bin ich? Inder? Deutscher? Kanadier? Künstler? Mann? Vater? Die Frage nach meiner «Positionalität», wie es jetzt ja heisst, könnte ich mir jeden Tag neu stellen – und immer eine andere Antwort bekommen. Identität ist eine komplexe Mischung verschiedenster Zuordnungen und Selbstzuordnungen. Jeder Mensch steht in der Schnittmenge un-
terschiedlicher Kreise von Gemeinschaft, Herkunft und Gesellschaft. Ich mache Dinge, die mich interessieren, und diese Interessen bestimmen, wer ich bin. Das Argument, dass irgendjemand irgendetwas im Blut habe, hat noch nie gegriffen. Eine der weltweit besten Schulen für indische Musik gibt es beispielsweise in Basel.
Können Sie die Skepsis gegenüber dem Begriff der Identität an Ihrem eigenen Beispiel veranschaulichen? Irgendwann ist mir als in Europa lebender Komponist klar geworden, dass mich mein Name nie loslassen wird. Immer wurde ich mit der Frage konfrontiert: Wo ist denn das Indische in Ihrer Musik, Herr Bhagwati? Ich stand zwar schon immer etwas schräg zu den gängigen Praktiken der mitteleuropäischen zeitgenössischen Musik, habe am Anfang aber gar nicht recht verstanden, warum. Erst durch intensive Beschäftigung mit indischer Musik wurde mir klar, dass vieles von dem, was ich komponiert habe, tatsächlich seine Wurzeln in indischen Klangverfahren, indischer Rhythmik und indischem Zeitverständnis hat. Von dem Zeitpunkt an hat es mich interessiert, wie Mischungen verschiedener Kulturen entstehen – und zwar nicht aus dem Wunsch heraus, etwas anderes machen zu wollen, also nicht aus der Sehnsucht nach Aneignung von Exotischem, sondern aus der Lebensrealität, in der sich Menschen befinden. Ich nenne das Postexotismus. Im 19. Jahrhundert konnte man vielleicht noch davon ausgehen, dass alle an
ihrem Lebensort durch die selbe Art von Kultur sozialisiert waren. Das hat sich aber heute völlig verändert. Ich klingele in der Stadt bei meinem Nachbarn und stelle fest, dass er sich nicht für westliche klassische Musik interessiert, aber Reisen nach Asien unternommen hat und nun balinesische Gamelanmusik macht. Wir können uns Musiktraditionen zugehörig fühlen, die nicht die «ethnisch» eigenen sind. Und mehr noch: Auch unsere vermeintlich «eigene» Kultur beruht auf bewussten Entscheidungen. Nicht jeder Bayer pflegt bekanntlich die Tradition des Schuhplattelns, sondern nur einige. Man muss sich für eine Tradition immer bewusst entscheiden – und es gibt heute an jedem Ort viele Traditionen, die man annehmen kann. Auch wer sich als Mitteleuropäer mit der abendländischen zeitgenössischen Musik beschäftigt, betritt ein fremdes, exotisches Terrain, denn fast niemand ist mit Boulez, Stockhausen oder Ligeti von Kinderzeiten an aufgewachsen. Unsere Musik der Vergangenheit ist ebenfalls ein fernes, exotisches Land. Wer vermag schon wirklich zu fühlen, was Monteverdis oder Mozarts Musik zu ihrer Zeit «authentisch» bedeutete? Man projiziert immer das Eigene ins Andere.
Auch Aufführungen von Monteverdi oder Mozart müssten wir also kritisch auf unreflektierte kulturelle Aneignung untersuchen?
Die Erwartungshaltungen, die gerne an Operninszenierungen gerichtet und für «richtig» gehalten werden, sind oft nichts anderes. Wer allen Figuren in einer Mozartoper eine Puderperücke aufsetzt und meint, das reiche aus, um der Entstehungszeit des Werks gerecht zu werden, läuft Gefahr, Mozart zu simplifizieren und zu diskreditieren. Man muss das ganz klar so sehen: Wir exotisieren nicht nur fremde Kulturen, sondern auch unsere eigene Vergangenheit – manchmal sogar brutaler.
Wie denken Sie über kulturelle Aneignung auf der Ebene des musikalischen Materials? Was ist mit Komponistinnen und Komponisten,
«Die Empörung ist berechtigt. Es gab hierzulande keine Sensibilität für die Ausbeutung anderer Völker»
die in ihre Opern Chinesisches oder Arabisches integrieren?
Auch da muss man genau hinschauen. Es gab und gibt jene, die von einer bestimmten musikalischen Ästhetik beeindruckt sind, sich mit ihr auseinandersetzen und sie dann in reflektierter Form übernehmen. Es gibt aber leider auch andere, die einfach nur sagen: Das klingt toll, das mache ich jetzt auch. Diese oberflächliche Variante ist natürlich problematischer, weil überhaupt nicht ergründet wird, was das Übernommene bedeutet. Das ist wie bei den Leuten, die sich chinesische Schriftzeichen auf ihren Körper tätowieren lassen, ohne zu wissen, was sie bedeuten, und deshalb mit absurden Statements auf ihrem Körper herumlaufen. Derlei Ignoranz ist nie gut im Austausch zwischen Kulturen. Man sollte schon in eine ernsthafte Auseinandersetzung einsteigen. Es gibt da ja interessante frühe Beispiele in der westlichen klassischen Musik wie etwa Claude Debussy, bei dem überhaupt nicht klar ist, ob er die balinesische Gamelanmusik, die ihm begegnet war, zu imitieren versucht hat, ob sich sein kompositorisches Denken durch diese neue Erfahrung verändert hat, oder ob sich sein Komponieren schon vor dieser Erfahrung in eine Richtung entwickelt hat, die er durch die Gamelanmusik nur bestätigt fand. Olivier Messiaen untersuchte Ende der 1940er bestimmte rhythmisch-mathematische Verfahren – und entdeckte genau diese in der indischen Musik. Das bestärkte ihn darin, dass sie auch musikalisch nutzbar waren. Er schrieb damit Musik, die ohne diese indischen Modelle nicht entstanden wäre, die dennoch keine naive Aneignung bedeutet.
In der bildenden Kunst gibt es den Tatbestand der Raubkunst. Kann es das auch in der Musik geben –geraubte Musik?
Ja, es gibt eine Debatte darum, und ich selbst spreche in Vorträgen auch von Raubmusik, aber ich meine damit die aufgezeichnete Musik, die die Ethnologen von ihren Expeditionen mitgebracht haben und die jetzt in Form von
Mitschnitten in westlichen Archiven liegt und nicht zurückgegeben wird.
Worin besteht der Raub? Darin, dass diese Musik ihres ursprünglichen Kontextes beraubt wurde und von den Riten abgekoppelt ist, in die sie eingebunden war?
Ja. Man hat diese Musiken oft in dem guten Willen aufgenommen, sie vor ihrem Untergang zu retten. Man ahnte, dass sie nicht mehr lange lebendig sein würden, weil der koloniale Zugriff die fragilen, meist nur oral überlieferten Traditionen plattmachte. Die Haltung der Ethonologen war: Lasst uns noch schnell die Gesänge der Einheimischen aufnehmen, bevor sie endgültig verschwunden sind. Das war zwar irgendwie ehrenwert, aber trotzdem ein Raub. Man wollte sich sozusagen noch schnell die Juwelen sichern, bevor der Tempel einstürzt. Die Musik, die jetzt in den westlichen Archiven lagert, müsste eigentlich wiederbelebt zurückgegeben werden, indem man sie mit Vertretern oder Nachfolgern der Traditionen aufarbeitet und wieder zu einer aktiven Praxis werden lässt. Das passiert zum Glück auch ab und zu, aber nicht oft genug.
Könnte man auch bei einem Komponisten wie Giacomo Puccini von Raubmusik sprechen? Er hat ja gerne mit exotischem Kolorit in seinen Opern gespielt.
Weil er Pentatonik in Turandot verwendet hat und Gregorianik in seiner Tosca? Ich weiss nicht. Da sind wir wieder beim Theater: Auch die Musik zieht Gewänder an, um Theatralität zu erzeugen. Hans Pfitzner adaptiert Palestrinas Musik in seiner Oper. Gustav Mahler
verwendet böhmische Volksmusik, die in der Sinfonik des späten 19. Jahrhunderts auch ein exotischer Fremdkörper war. Solche Formen der kulturellen Aneignung waren gängig –und schon zu ihrer Entstehungszeit tobte ein Machtkampf um absolute oder theatralisierte Musik. Darf Musik etwas anderes sein als sie selbst? Manche sagen «nein», andere «na klar, ist sie sowieso immer». Dieser Streit ist älter als die ihm stark ähnelnde Debatte um kulturelle Aneignung.
Welcher Art ist Ihr eigener Umgang mit Musiktraditionen?
Ich habe beispielsweise vor zehn Jahren begonnen, postexotistische Ensembles zu gründen, in denen Musikerinnen und Musiker zusammenkommen, die alle in einer Stadt leben, aber in völlig verschiedenen Traditionen zu Hause sind. Wir machen zusammen nicht das, was man «Weltmusik» nennt, wir jammen nicht fröhlich vor uns hin. Wir versuchen in die Tiefen der jeweiligen Traditionen vorzudringen und die gemeinsame Musik als eine Erscheinungsform sehr unterschiedlicher Faktoren zu verstehen. In dieser transkulturellen Praxis wird Musik durchsichtig für andere Prozesse, die hinter der Musik ablaufen. Sie eröffnet Möglichkeiten, ganz neue Verbindungen einzugehen und den selben Klang etwa in fünf oder zehn verschiedenen Varianten auszulegen, je nachdem von welcher Seite man kommt und aus welcher Perspektive man ihn betrachtet.
Steht die Debatte um kulturelle Aneignung, in der es ja immer auch darum geht, was man nicht mehr dürfen darf, Ihrer Vision von einer transkulturellen Musik im Weg?
Ich glaube, dass die Rigorosität, mit der die Debatte an manchen Stellen geführt wird, nicht von Dauer ist. Ich sehe in ihr ein Moment erster emotionaler Annäherung, in der die Initiativen schon mal über das Ziel hinausschiessen. Wir sind sozusagen noch in der ideologischen Phase. Gerade in den sozialen Medien funktioniert ja Emotionsaufwallung nur in der Überzeichnung. Mir
«Auch die Musik zieht Gewänder an, um Theatralität zu erzeugen.»
kommt das vor wie jemand, der einen anschreit, obwohl er im Recht ist –eben weil er sehr aufgewühlt ist. Im Moment kommt man da nicht weiter. Am besten wartet man, bis die Aufwallung vorbei ist – und kann dann die Sache wirklich verhandeln. Die Empörung ist ja vollkommen verständlich: Es gab hierzulande halt sehr lange keine Sensibilität für Rassismus, die Ausbeutung anderer Völker oder für die soziale Herabwürdigung von Frauen. Es gab kaum ein kritisches Bewusstsein für die Wurzeln des eigenen Reichtums, der eben nicht nur darauf basiert, dass man selbst hart gearbeitet hat. Die Engländer spüren gerade schmerzhaft beim Brexit, wie sehr ihr Wohlstand davon abhängt, dass andere hart für sie arbeiten. Die Aufmerksamkeitsdichte, die vor allem die sozialen Medien für wenige Tage erzeugen, mag Schaden anrichten, aber nicht permanent. Ich finde es erstmal gut, dass eine Sensibilität auf beiden Seiten erwacht ist. Die Gefühle sind echt und roh, die Wunden noch offen. Aber beide Seiten – die über das Unrecht Empörten und die über den Verlust ihrer Macht Empörten – können einander auf lange Sicht finden, da bin ich optimistisch. Man kann die Realität ja nicht einfach abschaffen. Und diese lautet nun mal, dass es verschiedene Kulturen gibt, dass Menschen verschiedenster Kulturen miteinander leben –und voneinander lernen.
Was zählt mehr: Die Freiheit der Kunst oder die Freiheit derer, die sich durch stereotype Darstellungen in Kunstwerken diskriminiert fühlen? Natürlich weder ausschliesslich das eine noch das andere. Am lautesten nach «Freiheit» rufen ja immer die politisch Rechten. Sie setzen die Freiheit absolut und beziehen sie auf sich selbst. Es geht um «meine» Freiheiten. Ich will so schnell auf der Autobahn fahren wie ich will. Ich will keine Maske aufsetzen. Ich will mir den Waffenbesitz nicht verbieten lassen usw. Freiheiten sind im Kontext einer komplexen Gesellschaft aber immer durch andere bedingt. Sie bauen darauf auf, dass die Rechte anderer nicht beeinträchtig werden.
Dies bedeutet eben auch, Rücksicht auf Gefühle von Diskriminierung zu nehmen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es gerade in kulturellen Konflikten oft schon ausreicht, die sich verletzt Fühlenden anzusprechen und dadurch ein Verständnis für beide Seiten anzubahnen. Auf der anderen Seite erwarte ich aber auch, dass die herabwürdigende Typisierung Anderer, die zu Recht von diskriminierten Menschen beklagt wird, auch bei ihnen keinen Nährboden findet, denn nicht jeder «weisse alte Mann» hält Frauen für mindere Wesen und denkt wie ein kolonialer Herrenmensch – auch wenn dies noch immer auf erstaunlich viele in der Kulturszene zutrifft! Freiheit ist eben nicht «meine» oder «deine» Freiheit, sondern ein gemeinsames, fast künstlerisch-visionäres Projekt.
Die Kunstform Oper ist in ihren Grundfesten tief in der abendländischen Hochkultur verankert. Sollte man sie aus Ihrer Sicht daraus lösen und mehr für andere Musiktraditionen öffnen?
Nicht unbedingt, nicht reflexhaft. Sie steht nun mal für ein in Europa gewachsenes Kulturverständnis und hat darin auch ihre Existenzberechtigung. Es hat ja auch wenig Sinn, Institutionen des japanischen Nō-Theaters mit der Forderung nach kultureller Öffnung zu konfrontieren. Aber wenn die Kunstform heute als zu unbeweglich wahrgenommen wird, müssen sich diejenigen, die diese Institutionen prägen und tragen, schon mal fragen, warum eine der bedeutendsten Kunstformen ihrer Kultur eine vor allem bewahrende Rolle spielt und sich nur wenig weiterentwickelt. Das Zukunftszugewandte und Schöpferische gerade im Zusammenbringen verschiedener Künste und menschlicher Perspektiven war in ihrer Geschichte immer eine Stärke der Oper – und das erfordert Mut zu den vielstimmigen, vielfarbigen Realitäten unserer Gesellschaften. Nicht nur auf der Bühne und im Orchestergraben, sondern in ihrem gesamten Organismus.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Sandeep Bhagwati
ist ein weltweit aktiver Komponist, Musikforscher, Publizist, Dichter und Theatermacher. Er hat in Salzburg, München und Paris Dirigieren, Komposition und Computermusik studiert. Ab 2000 war er Professor für Komposition und Multimedia an der Musikhochschule Karlsruhe, bevor er 2006 als Canada Research Chair an die Concordia University Montréal wechselte. Dort gründete er das matralab, ein Labor für künstlerische Forschung in den LiveKünsten. Er hat wesentliche theoretische und prak tische Ansätze zur Dekolonisation Neuer Musik und zur künstlerischen Forschung entwickelt. Sandeep Bhagwati lebt in Montreal und Zürich.
Drei Freunde und ein Jubilar: Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra spüren den Verbindungen zwischen Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin und Robert Schumann nach. Und Igudesman & Joo gratulieren, gemeinsam mit Yuja Wang, Sergej Rachmaninow zum 150. Geburtstag.
Fr 31.03.
Lucerne Festival Orchestra | Riccardo Chailly | Rafał Blechacz Chopin, Schubert und Mendelssohn
Sa 01.04. Igudesman & Joo mit Special Guest Yuja Wang «Happy Birthday, Sergej Rachmaninow!»
So 02.04.
Lucerne Festival Orchestra |
MDR-Rundfunkchor | Riccardo Chailly | Pablo Ferrández | Regula Mühlemann | Simona Šaturová | Allan Clayton Schumann und Mendelssohn

Herzlich willkommen im ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel. 120 Mitarbeitende und die Schweizer Besitzerfamilie heissen Sie herzlich im ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel willkommen. Treten Sie ein in das Chalet-Resort in Gstaad-Schönried, das mit einem Frei- & Hallen-Solbad, 10 Saunen / Dampfbädern, begleiteten Ausflügen in die Natur (Mo–Fr) und einer heimeligen Atmosphäre punktet.


3 Übernachtungen inklusive ERMITAGE Kulinarik
1 saisonaler Cocktail
1 aus 3 Anwendungen nach Wahl:
→ Cellcosmet Gesichtsbehandlung à 75 Minuten
→ Aromaöl Massage à 50 Minuten
→ Exklusives Fondue-Picknick mit Wein
Ab CHF 840.– p.P. im Zweibettzimmer Nord. Die Preise variieren nach Saison. Gültig bei Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag.
Reservationen: 033 748 04 30 oder welcome@ermitage.ch.
März
1 Mi Jewgeni Onegin
19.00 Oper von Pjotr Tschaikowski
4 Sa Familien-Workshop
Horizonte
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Märchen auf dem Klangteppich
Gian und Giachen
15.30 Für 4- bis 6-Jährige und ihre Eltern Studiobühne
Roberto Devereux
20.00 Oper von Gaetano Donizetti
5 So Familien-Workshop
Horizonte
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Märchen auf dem Klangteppich
Gian und Giachen
15.30 Für 4- bis 6-Jährige und ihre Eltern Studiobühne
Siegfried
16.00 Oper von Richard Wagner Premiere
7 Di Roberto Devereux
19.00 Oper von Gaetano Donizetti
open space stimme
19.00 Chor-Workshop für alle ab 16 Jahren Dienstags
8 Mi La Cenerentola
19.30 Oper von Gioachino Rossini
9 Do Siegfried
17.00 Oper von Richard Wagner
1O Fr La Cenerentola
19.30 Oper von Gioachino Rossini
11 Sa overdress!
20.30 Das Kostümfest
12 So Horizonte
13.00 Choreografien von Vittoria Girelli, Samantha Lynch und Shaked Heller Zürich-Premiere
La Cenerentola
19.30 Oper von Gioachino Rossini
13 Mo Liederabend Asmik Grigorian
19.00 Lukas Geniušas, Klavier
14 Di Siegfried
17.00 Oper von Richard Wagner AMAG Volksvorstellung
15 Mi La Cenerentola
19.00 Oper von Gioachino Rossini
17 Fr Roberto Devereux
19.00 Oper von Gaetano Donizetti
18 Sa Familien-Workshop
La Cenerentola
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Siegfried
17.00 Oper von Richard Wagner
19 So Jazz in Paris
11.15 Brunchkonzert Spiegelsaal
Anna Karenina
14.00 Ballett von Christian Spuck
Familien-Workshop
La Cenerentola
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
La Cenerentola
20.00 Oper von Gioachino Rossini
2O Mo Jazz in Paris
12.00 Lunchkonzert Spiegelsaal
21 Di La Cenerentola
20.00 Oper von Gioachino Rossini
22 Mi Siegfried
17.00 Oper von Richard Wagner
23 Do Anna Karenina
19.00 Ballett von Christian Spuck
24 Fr La Cenerentola
19.00 Oper von Gioachino Rossini
25 Sa Horizonte
11.00 Choreografien von Vittoria Girelli, Samantha Lynch und Shaked Heller
Die Welt der Mozart-Opern
15.30 ab 7 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Anna Karenina
19.00 Ballett von Christian Spuck
26 So Einführungsmatinee
Roméo et Juliette
11.15 Bernhard Theater
Siegfried
14.00 Oper von Richard Wagner
imprO-Opera
Die Welt der Mozart-Opern
15.30 ab 7 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
3O Do Angels’ Atlas
20.00 Choreografien von Crystal Pite und Marco Goecke
31 Fr Angels’ Atlas
19.00 Choreografien von Crystal Pite und Marco Goecke
1 Sa Anna Karenina
19.00 Ballett von Christian Spuck
2 So Anna Karenina
14.00 Ballett von Christian Spuck
Lakmé
19.30 Oper von Léo Delibes, Konzertante Aufführung Premiere
4 Di open space stimme
19.00 Chor-Workshop für alle ab 16 Jahren Dienstags
5 Mi Anna Karenina
20.00 Ballett von Christian Spuck
6 Do Anna Karenina
19.00 Ballett von Christian Spuck
8 Sa Lakmé
19.00 Oper von Léo Delibes, Konzertante Aufführung AMAG Volksvorstellung
1O Mo Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod Premiere
13 Do Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod
14 Fr Viva la mamma
19.00 Oper von Gaetano Donizetti Zürich-Premiere
15 Sa Musikgeschichten
Die Werkstatt der Schmetterlinge
15.30 Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
Lakmé
19.00 Oper von Léo Delibes, Konzertante Aufführung
16 So Viva la mamma
13.00 Oper von Gaetano Donizetti AMAG Volksvorstellung
Musikgeschichten
Die Werkstatt der Schmetterlinge
15.30 Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne
Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod
19 Mi open space tanz
19.00 Tanz-Workshop für alle ab 16 Jahren Mittwochs
21 Fr Viva la mamma
20.00 Oper von Gaetano Donizetti
22 Sa Märchen auf dem Klangteppich
Honk!
15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod
23 So Bernstein Copland Sibelius
11.15 5. Philharmonisches Konzert Yutaka Sado, Musikalische Leitung
Einführungsmatinee
The Cellist
11.15 Bernhard Theater
Märchen auf dem Klangteppich
Honk!
15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Viva la mamma
19.00 Oper von Gaetano Donizetti
25 Di Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod
28 Fr Roméo et Juliette
19.30 Oper von Charles Gounod
29 Sa Die Zauberflöte
19.30 Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
So
19.00 Ballett von Cathy Marston Premiere
Mai
4 Do Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod
5 Fr Die Zauberflöte
19.30 Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
6 Sa The Cellist
19.00 Ballett von Cathy Marston
19.00 Oper von Georg Friederich Händel Theater Winterthur, Premiere
7 So Einführungsmatinee Lessons in Love and Violence
11.15 Bernhard Theater
Roméo et Juliette
13.00 Oper von Charles Gounod
Familien-Workshop
The Cellist
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
20.00 Oper von Christoph Willibald Gluck AMAG Volksvorstellung
Zürich 24.2.–21.5.23
Unterstützt durch:
9 Di open space stimme
19.00 Chor-Workshop für alle ab 16 Jahren Dienstags
1O Mi Serse
19.00 Oper von Georg Friederich Händel Theater Winterthur
open space tanz
19.00 Tanz-Workshop für alle ab 16 Jahren Mittwochs
11 Do Orphée et Euridice
20.00 Oper von Christoph Willibald Gluck
12 Fr Die Zauberflöte
19.00 Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Serse
19.00 Oper von Georg Friederich Händel Theater Winterthur
13 Sa Familien-Workshop
The Cellist
14.30 ab 9 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
imprO-Opera
«Die Welt der Händel-Opern»
15.30 ab 7 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
Roméo et Juliette
19.00 Oper von Charles Gounod
14 So Ballettgespräch
11.15 Zu Themen aus der Welt des Tanzes Treffpunkt Billettkasse
Klavierquartette II
11.15 Brunchkonzert Spiegelsaal
Orphée et Euridice

14.00 Oper von Christoph Willibald Gluck
Albers & Co AG
Serse
14.30 Oper von Georg Friederich Händel Theater Winterthur
imprO-Opera
«Die Welt der Händel-Opern»
15.30 ab 7 Jahren, Kinder in Begleitung von Erwachsenen Treffpunkt Billettkasse
The Cellist
20.00 Ballett von Cathy Marston
15 Mo Klavierquartette II
12.00 Lunchkonzert Spiegelsaal
Liederabend Aleksandra Kurzak und Roberto Alagna
19.30 Marek Ruszczyński, Klavier
17 Mi Serse
19.00 Oper von Georg Friederich Händel Theater Winterthur
Die Zauberflöte
19.30 Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
18 Do The Cellist
13.00 Ballett von Cathy Marston AMAG Volksvorstellung
Roméo et Juliette
19.30 Oper von Charles Gounod
19 Fr Orphée et Euridice
19.00 Oper von Christoph Willibald Gluck
2O Sa The Cellist
19.00 Ballett von Cathy Marston
21 So
19.00 Oper von George Benjamin Premiere
23 Di Orphée et Euridice
19.00 Oper von Christoph Willibald Gluck
25 Do Lessons in Love and Violence
19.00 Oper von George Benjamin
26 Fr Monteverdi
19.00 Ballett von Christian Spuck
27 Sa Lessons in Love and Violence
20.00 Oper von George Benjamin
29 Mo Monteverdi
14.00 Ballett von Christian Spuck AMAG Volksvorstellung
Don Pasquale
20.00 Oper von Gaetano Donizetti
31 Mi Monteverdi
19.00 Ballett von Christian Spuck
Führung Opernhaus 4,
Guided Tour Opera House
5, 12, 18, 26 März; 1, 16, 22, 30 Apr 2023
Familienführung Mittwochnachmittags
8, 22 März; 12, 26 Apr 2023
Führung Bühnentechnik
3 März; 14 Apr 2023
Führung Maskenbildnerei
22 Apr 2023
Tickets für die Führungen sind im Vorverkauf erhältlich
Unter opernhaus.ch/fuer-alle gibt es Angebote für jeden Geldbeutel
Das Kalendarium mit Preisangaben finden Sie auf der Website
Magazin des Opernhauses Zürich
Falkenstrasse 1, 8008 Zürich www.opernhaus.ch
T + 41 44 268 64 00
Intendant
Andreas Homoki
Generalmusikdirektor
Gianandrea Noseda
Ballettdirektor
Christian Spuck
Verantwortlich
Claus Spahn
Sabine Turner
Redaktion
Beate Breidenbach
Kathrin Brunner
Fabio Dietsche
Michael Küster
Claus Spahn
Gestaltung
Carole Bolli
Sandi Gazic
Fotografie
Danielle Liniger
Florian Kalotay
Michael Sieber
Bildredaktion
Christian Güntlisberger
Anzeigen
Linda Fiasconaro
Schriftkonzept und Logo
Studio Geissbühler
Druck
Multicolor Print AG
Illustrationen
Anita Allemann
MAG abonnieren
MAG, das OpernhausMagazin, erscheint zehnmal pro Saison und liegt zur kostenlosen Mitnahme im Opernhaus aus. Sie können das OpernhausMagazin abonnieren:
zum Preis von CHF 38 bei einer inländischen Adresse und CHF 55 bei einer ausländischen Adresse senden wir Ihnen jede Ausgabe druckfrisch zu.
Bestellungen unter:
T +41 44 268 66 66 oder tickets@opernhaus.ch.
Unsere Vorstellungen werden ermöglicht dank der Subvention des Kantons Zürich sowie den Beiträgen der Kantone Luzern, Uri, Zug und Aargau im Rahmen der interkantonalen Kulturlastenvereinbarung und den Kantonen Nidwalden, Obwalden und Schwyz.
Partner
Produktionssponsoren
AMAG
Atto primo
Clariant Foundation
Freunde der Oper Zürich
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Projektsponsoren
René und Susanne Braginsky-Stiftung
Freunde des Balletts Zürich
Ernst Göhner Stiftung
Hans Imholz-Stiftung
Max Kohler Stiftung
Kühne-Stiftung
Marion Mathys Stiftung
Ringier AG
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung
Hans und Edith Sulzer-Oravecz-Stiftung
Swiss Life
Swiss Re
Zürcher Kantonalbank
Gönnerinnen und Gönner
Josef und Pirkko Ackermann
Alfons’ Blumenmarkt
Familie Thomas Bär
Bergos Privatbank
Margot Bodmer
Maximilian Eisen, Baar
Elektro Compagnoni AG
Stiftung Melinda Esterházy de Galantha
Fitnessparks Migros Zürich
Egon-und-Ingrid-Hug-Stiftung
Walter B. Kielholz Stiftung
KPMG AG
Landis & Gyr Stiftung
Fondation Les Mûrons
Neue Zürcher Zeitung AG
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
StockArt – Stiftung für Musik
Else von Sick Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Elisabeth Weber-Stiftung
Förderinnen und Förderer
CORAL STUDIO SA
Theodor und Constantin Davidoff Stiftung
Dr. Samuel Ehrhardt
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Garmin Switzerland
Stiftung LYRA zur Förderung hochbegabter, junger Musiker und Musikerinnen
Irith Rappaport
Richards Foundation
Luzius R. Sprüngli
Madlen und Thomas von Stockar
