Nr. 12a/23
Bücher-Frühling 2023
ILLUSTRATION: GEORG FEIERFEIL

Belletristik: 11 Seiten Österreich-Spezial +++ Karin Peschka, Teresa Präauer und Tonio Schachinger im Gespräch +++ Literatur aus Polen, Rumänien und Belarus +++ Kinder: Bilderbücher und Umweltkämpfer +++
Sachbuch: Millionen Menschen auf der Flucht +++ Ukraine, Iran, China +++ Wie Sklaven Europas Wohlstand schufen +++ Essays von Siri Hustvedt +++ Verunglimp e Frauen +++ Kochbücher
Ostern wird bunt. Vor allem im Kopf.
Welt, bleib wach.



Exklusiv
Im März spendet Thalia 1€ pro gekauftem Exemplar an ein Leseförderungsprojekt.
15,–
Kirsten Boie, Cornelia Funke, Astrid Lindgren, Paul Maar u.a. Mein großer Vorleseschatz



Dieser einzigartige Erzählband ist ein wahrer Vorleseschatz, an dem die ganze Familie für lange Zeit Freude hat. 27 Geschichten bekannter und beliebter Autor*innen. Exklusiv erhältlich bei Thalia. Ab 4 Jahren.
-20

auf Spiele und Spielwaren*
Barbara Illand-Olschewski
Endlich Ostern!
15,–






Wer ndet das beste Osterversteck? Klar, die Hasenkinder! Und damit die Hasenkinder Laura, Leon und die kleine Liliana Freude an der Aufgabe haben, macht Mama Osterhase ein Spiel daraus. Ab 4 Jahren.

11,–





Katja Reider Bildergeschichten zum Mitmachen: Hier kommt Finni Fuchs
Wichtige Gefühle wie Freude oder Angst erleben die Kleinsten mit Finni auf spielerische Weise. Mit Finni lernen sie Wichtiges aus dem Alltag kennen und können z. B. beim Einkaufen oder Tischdecken helfen. Ab 2 Jahren.
22,99** 18,39 Aktionstage*

26,99** 21,59 Aktionstage*

gültig von 23.–26.3.2023 24/7 online einkaufen. thalia.at I Thalia App












Ravensburger Tempo, kleine Klapperschlange!

Hasbro Twister Junior











*Gültig von 23.– 26.3.2023 in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich, online auf thalia.at und in der Thalia App auf lagernde Spiele und Spielwaren. Nicht mit weiteren Aktionen und Rabatten kombinierbar. Diese Preisangabe entspricht dem niedrigsten von uns in den letzten 30 Tagen vor Beginn dieser Aktion verlangten Preis.






Sechs Klapperschlangen machen ein Wettrennen in der Wüste. Mal klappern sie und mal nicht. Wer behält den Überblick und sammelt bis zum Ende des Spiels die meisten Karten der Gewinnerschlange? Ab 4 Jahren. Für 2 - 4 Spieler*innen.
Mit einer doppelseitigen Matte und einer doppelseitigen Drehscheibe bietet Twister Junior gleich doppelten Spaß. Auf der einen Seite der Matte können die Kinder Tiersafari spielen und auf der anderen Seite Tierparty. Ab 3 Jahren. Für 2 - 4 Spieler*innen.
 emp ehlt: Bücher & Spiele. Schlaues fürs Nest.
bei Thalia
emp ehlt: Bücher & Spiele. Schlaues fürs Nest.
bei Thalia
Klaus Nüchtern ist für die schöne Literatur zuständig
Bei der Leipziger Buchmesse, die heuer nach drei pandemiebedingten Ausfällen wieder stattfindet, allerdings unüblich spät (27.–30.4.), ist Österreich Gastland. Wir tragen diesem Umstand Rechnung und bespielen diesmal die Belletristik-Strecke zum Großteil mit Literatur aus heimischem Anbau.
LITERATUR
AUFMACHER Ösis unter sich: Karin Peschka, Teresa Präauer und Tonio Schachinger im Gespräch der Generationen
Gerlinde Pölsler kümmert sich um die Sach- und Kinderbücher
Diesmal beschä igen uns vor allem die internationale Lage – Ukraine, Iran, China – und die vielen Menschen, die auf der Flucht sind, und wie Europa damit umgeht. Außerdem schauen wir auf den langwierigen Abschied vom Fossilen und auf Frauen, die immer noch schamlos öffentlich bloßgestellt werden.
KINDER- UND JUGENDBUCH
Bilderbücher
Bunte Bücher mit Botscha , aber ohne Zeigefinger 22
Kinderbücher
Eine junge Umweltkämpferin und ein Umzugsdrama 24
Jugendbücher Von Glück, Verlust, Verantwortung 25
SACHBUCH
AUFMACHER
Flucht: Franziska Grillmeiers Reportagen über das Ende der Menschenrechte an Europas Rändern; Ruud Koopmans
über Europas ungerechtes Asylsystem 26
INTERNATIONALE LAGE
Russland und die Ukraine: Warum Krieg? 28
China: Ein schockierendes Buch über die Uiguren-Politik 29
Marlene Engelhorn
Sarah Altenaichinger
Maria Muhar
Norbert Gstrein
Marlene Streeruwitz
Donia Ibrahim
Da Wastl
Klaus Lederwasch

RäumeGRAZ:der Literatur
Amir Gudarzi
Martin G. Wanko
ChantalFleur Sandjon
Raphaela Edelbauer
Nach neun Jahren legt Daniel Gla auer seinen neuen Roman „Du spürst sie nicht“ vor
Moderner „Klassiker“, neu aufgelegt: „Die Schwerkra der Verhältnisse“ von Marianne Fritz (1948–2007)
Im Iran passiert „feministische Weltgeschichte“ 29
GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT
Vom Verschwinden der bäuerlichen Welt 30
Ökologie: So schwer wird der Abschied vom Fossilen 31
Den Kapitalismus vom Sofa
Satire „Glory“ von NoViolet Bulawayo
PARDON MY FRENCH
„Der perfekte Schuss“ von Mathias Enard
Éric Vuillard erzählt vom Vietnamkrieg
GO EAST!
Eva Vie ž naviec aus Belarus: „Was suchst du, Wolf?“
Den Bug entlang: „Grenzfahrt“ von Andrzej Stasiuk
„Der Scha en im Exil“ des Rumänen Norman Manea
ILLUSTRATIONEN

Schorsch Feierfeil ist Illustrator, Grafiker und Animationsfilmemacher. Seit vielen Jahren zeichnet er regelmäßig für den Falter. Zudem gestaltet er Albumcovers und animiert Musikvideos. Einen Überblick seines künstlerischen Schaffens und die Möglichkeit einen Kunstdruck zu erwerben, bietet seine Homepage: www.schorschfeierfeil.com
IMPRESSUM
Falter 12a/23 Herausgebe r: Armin Thurnher Medieninhaber : Falter Zeitschri en Gesellscha m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Str. 9, T: 01/536 60-0, F: 01/536 60-912, E: wienzeit@falter.at Redaktion: Klaus Nüchtern, Gerlinde Pölsler Herstellung: Falter Verlagsgesellscha m.b.H.; Layout: Barbara Blaha, Reini Hackl ; Korrektur: Helmut Gutbrunner, Rainer Sigl; Geschä sführung: Siegmar Schlager; Anzeigenleitung: Ramona Metzler
Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau DVR: 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Die O ff enlegung gemäß § 25 MG ist unter www.falter.at/off enlegung/falter ständig abru ar Bücher-Frühling ist eine entgeltliche Einschaltung aufgrund einer Subvention durch das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öff entlichen Dienst und Sport.
Daniel Glattauer
Gregor Stäheli
Egyd Gstättner
Samuel Richner
Lydia Mischkulnig
Raoul Schrott
Dževad Karahasan
Mario Tomić
Cordula Simon Ana Marwan
plattform
Bodo Hell
Gerhard RothSymposium
Ursula Wiegele
Grundbücher
Clemens J. Setz
Michael Köhlmeier
Judith Nika Pfeifer
Irene Diwiak
Robert Prosser
Arno Geiger
Bruno Pisek
Birgit Birnbacher
omas Stangl
Poetry Slam Graz vs. Schweiz
Franzobel Vea Kaiser
Susanne Kristek
Lisz Hirn
Konrad P. Liessmann
Zoran Ferić
Ferdinand Schmatz
Giovanna Giordano
Erwin Einzinger
Science meets Poetry
Ingrid Wiener Esther Kinsky Günter Eichberger
Teresa Präauer Nava Ebrahimi

omas Eder
Insa
Wilke
Günther Eisenhuber
Erica Fischer
Junges Literaturhaus Literarische Soiree
Luna Al-Mousli
Renate Welsh
David Schalko Lisa Eckhart
Robert Pfaller
Grazer Vorlesungen FranzNablPreis
Daniela Strigl
Katja
Gasser Ann Cotten
Erstes Halbjahr 2023
„Ein hartes Business für sensible Seelen“
Österreich ist Gastland bei der Leipziger Buchmesse. Auch Karin Peschka, Teresa Präauer und Tonio Schachinger werden ihre soeben erschienenen Romane präsentieren. Ein Gespräch über das Schreiben, die Medien und über Rückenschmerzen
Unter dem vom Schri steller Thomas Stangl ersonnenen Claim „mea ois wia mia“ präludiert und begleitet eine ganze Offensive von Veranstaltungen und medialen Formaten den Au ritt Österreichs bei der Buchmesse in Leipzig (27.– 30.4.). Aus diesem Anlass bat der Falter zwei Autorinnen und einen Autor zu einem Gespräch über das Schri stellerdasein und den Literaturbetrieb heute.
Alle drei haben soeben ihr jüngsten Romane vorgelegt, blicken aber auf unterschiedliche Schreibbiografien zurück. Die in Eferding als Wirtstochter aufgewachsene Karin Peschka (Jg. 1967) hat die Sozialakademie absolviert und ist erst spät mit ihrem im Nachkriegswien spielenden Debütroman „Watschenmann“ (2014) hervorgetreten, der dann gleich mehrere Prei-
»Österreich ist ein Nest, in dem man sich’s gemütlich macht. Deutschland ist stärker international orientiert
se gewann. Seitdem hat Peschka beim Salzburger Otto Müller Verlag einen Erzählband und drei weitere Romane veröffentlicht, zuletzt „Dschomba“, der Autobiografisches mit Historischem verknüp
Ebenfalls aus Linz gebürtig hat Teresa Präauer (Jg. 1979) Germanistik studiert und eine Ausbildung als bildende Künstlerin absolviert. Das Romandebüt „Für den Herrscher aus Übersee“ (2012) und alle nachfolgenden Bücher sind im deutschen Wallstein Verlag erschienen. Präauer, die unter anderem mit dem Erich-FriedPreis ausgezeichnet wurde, hat die Cover ihrer Romane von Anfang an selbst gestaltet – auch jenes von „Kochen im falschen Jahrhundert“, das von einem Abendessen unter Freunden handelt.

Tonio Schachinger: Echtzeitalter.

Roman. Rowohlt, 368 S., € 24,70
Karin Peschka: Dschomba. Roman. O o Müller, 378 S., € 26,–

Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert. Roman. Wallstein, 198 S., € 22,70
Tonio Schachinger (Jg. 1992), als Sohn eines Diplomaten und einer Künstlerin in Neu-Delhi geboren, hat Germanistik, Romanistik sowie Sprachkunst an der Hochschule für angewandte Kunst studiert. Sein Debüt „Nicht wie ihr“ (2019) über einen jungen Profifußballer schaffte es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Mit „Echtzeitalter“, dessen Protagonist ein 15-jähriger weltberühmter Online-Gamer ist, wechselte er von Kremayr & Scheriau zum deutschen Rowohlt Verlag.

Wenn Sie Ende April auf der Buchmesse sind, liegt die Finalisierung Ihrer Bücher ja zumindest ein halbes Jahr zurück. Wie ist das, wenn man das nun präsentieren muss?
Tonio Schachinger: Es sind eigentlich zwei verschiedene, voneinander entkoppelte Jobs: zuhause zu schreiben und auf Lesungen gehen.
Karin Peschka: Mein Lektor hat einmal gemeint, dass erst die Leserinnen und Leser das Buch zum Buch machen, und das stimmt schon. Man lernt noch viel über das, was man selber geschrieben hat.
Schachinger: In Filmen über Schristeller geht es immer um den Moment des Abschließens. Den gibt es aber eigentlich gar nicht. Bis man die letzten Fahnen durchgesehen hat, ist man im anderen Sinne „fertig“, nämlich so, dass man das gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Teresa Präauer: Es ist auch nicht der glücklichste Moment; das ist im besten Falle schon das Schreiben selbst.
Ist das der berühmte „Flow“, in dem man gerät?
Präauer: Es ist jedenfalls eine Form von Konzentration plus Selbstvergessenheit: Man vergisst alles, was am Hirn dranhängt, auch den Körper. Allerdings zulasten desselben. In meiner Schulter macht sich schon ein Impingement spürbar.
Peschka: Ich habe manchmal einen Thermophor im Rücken.
Schachinger: Und ich habe einen wahnsinnig unergonomischen Schreibtisch. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich diesen Sommer zwei Monate woanders gearbeitet habe – ganz ohne Rückenschmerzen; wohingegen mich in Wien das Computerspielen an meinem eigenen Schreibtisch an den Rand eines Hexenschusses gebracht hat. Das wird hier langsam zum Lazarett!
Peschka: Ja, ein trauriges Gespräch!
Dann sprechen wir doch über Ihre beglückendsten Lesungserfahrungen!
Peschka: Ich lese total gerne dort, wo ich herkomme: in Eferding und Umgebung. Ich mag den Begriff „Provinz“ nicht, finde aber, dass die Leute am Land o nicht so einen Stecken im Hintern haben und einfach sehr neugierig und aufmerksam sind. In Wien hingegen habe ich mitunter den Eindruck, dass das Publikum mit so einer „Schau’n wir einmal, ob wir das gut finden können“–Haltung im Saal sitzt.
Präauer: Ich mag sowohl kleine Theater mit einer guten Technik und Akustik als auch die O-Töne, wo einfach sehr viele Leute kommen. Das ist richtig berauschend.
Schachinger: Ich hatte schon Lesungen, bei denen hundert Stühle aufgestellt waren und nur acht Leute gekommen sind. Trotzdem war es wahnsinnig nett.
Peschka: Ich kenne einen Kollegen, der eine Mindestanzahl an Zuhörern verlangt. Da müssen sich die Veranstalter hinters Telefon klemmen und die Leute vergattern.
Präauer: Es hängt überhaupt sehr viel vom Enthusiasmus der Veranstalter ab. Aber wenn die wissen, wie man eine Lesung auch als Fest zelebriert, kommen die Leute auch.
Peschka: Zum Beispiel nach Schlierbach.
Präauer: Schlierbach ist sooo lustig! Die ganze Truppe ist super.
Der Slogan, unter dem der Au ritt der Literatur in Leipzig stattfindet, lautet „mea ois wia mia“. Wie empfinden sie den?
Schachinger: Ich finde ihn ein bisschen peinlich. Aber in seiner Peinlichkeit passt er wahrscheinlich zu Österreich.
Peschka: Ich finde ihn nicht peinlich, habe aber die Bildmarke mehr im Kopf als den phonetischen Satz.
Präauer: Grafisch ist der schon sehr gut gelöst: Vier Zeilen mit je einem Wort, das drei Buchstaben und davon zwei Vokale hat!
»Das Publikum am Land hat o nicht so einen Stecken im Hintern und ist einfach sehr neugierig und aufmerksam
KARIN PESCHKAIn Deutschland finden ihn viele grad gut, weil man ihn nicht versteht. Jedenfalls nicht sofort.
Peschka: Das „mea ois wia mia“ müsste halt nicht nur für Leipzig gelten. Was mich ärgert, ist, dass österreichische Literatur hierzulande im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so gut wie nicht vorkommt.
Ist die Inszenierung von Literatur im TV nicht o auch etwas daneben? Autorinnen müssen dann versonnen durch die Landscha schnüren oder auf der Schreibmaschine tippen … Präauer: Ich habe gar nicht getippt, die schneiden die Schreibmaschine im Vorspann einfach rein.
Offenbar ist es nicht möglich, dass einfach nur ein Gespräch stattfindet?
Peschka: Das wär’s doch: eine Sendung zu einer vernün igen Zeit, in der über die Bücher gesprochen wird.
Was bringt die mediale Präsenz von Literatur?
Präauer: Ich glaube, dass das Fernsehen noch immer mehr bewirkt als jedes Printmedium. Wobei mich die Auseinandersetzung in Zeitungen am meisten interessiert, weil die unter Umständen dieselbe Genauigkeit und Ruhe haben kann wie ein literarischer Text.
Schachinger: Am besten gefällt mir eine ganz traditionelle Literaturkritik, der man den Platz einräumt, den sie braucht. Wobei eine gute Rezension in einer großen deutschen Tageszeitung dann vielleicht 50 mehr verkau e Bücher bringt. So viel ist das also auch wieder nicht.
Peschka: Wenn man medial präsent ist, kriegt man aber mehr Einladun-
gen zu Lesungen. Nachdem ich 2017 beim Bachmannpreis angetreten bin, hatte ich schon viele Anfragen.
Schachinger: Der Mangel an medialer Präsenz betrifft auch nicht nur die Literatur, sondern Kultur generell. Im „Kulturmontag“ werden ja hauptsächlich aktuelle politische Themen verhandelt, aber nicht die Kultur.
Es braucht jedenfalls eine „Debatte“, in der man Stellung beziehen kann. Ist das Störende an der Literatur vielleicht die Literatur selbst?
Peschka: Den Eindruck kann man schon gewinnen. Ich habe das bei „Erlesen“ erlebt (von Heinz Sichrovsky moderierte Büchersendung auf ORFIII, Red.) …
Präauer: Ja, die ist der absolute Tiefpunkt, das ist literaturfreie Zone!
Peschka: Ich wurde jedenfalls eingeladen – gemeinsam mit Helena Adler und Franz Schuh. Habe ich mir gedacht: „Leiwand!“ Die Helena Adler mag ich total gern, den Franz Schuh wollte ich schon immer einmal kennenlernen. Dann kam die Pandemie dazwischen, und als der verschobene Termin nachgeholt werden sollte, waren die anderen Gäste auf einmal Hans Bürger und Toni Innauer. Da habe ich unter einem Vorwand abgesagt und mich dann geschämt, es nicht direkt angesprochen zu haben.
Muss man also nicht alles mitmachen und kann sich auch verweigern?
Präauer: Ich versuche, so viel wie möglich in der Hand zu behalten. Aber natürlich funktioniert das nur eingeschränkt – ein hartes Business für sensible Seelen.
Schachinger: Es ist ein Lernprozess. Gewisse Interviews, die ich bei meinem ersten Buch gegeben habe und die einfach nicht professionell geführt wurden, würde ich heute nicht mehr machen. Aber so schlau ist man eben erst im Nachhinein.
»Deutsche Verlage haben weniger Probleme mit dem Österreichischen als die sich anbiedernden österreichischen Verlage
TONIO SCHACHINGERWie sehr sind Sie eigentlich mit dem Label „Österreichischer Autor“ / „Österreichische Autorin“ einverstanden?
Präauer: Ich sehe mich als deutschsprachige Autorin, die in Österreich lebt und sozialisiert wurde und die sich auf bestimmte österreichische Traditionen bezieht.
Schachinger: Der Kanon in Deutschland sieht schon ziemlich anders aus und umfasst Autoren, die mir weder in der Schule noch später untergekommen sind. Dass man Österreicher ist,
fällt einem ja erst in Deutschland so richtig auf, wo man mit einer ambivalenten Haltung wahrgenommen wird: ein bisschen idealisiert, aber auch ein bisschen belächelt. Wobei die österreichische Literatur dort sehr gut vertreten ist – sehr im Unterschied zu jener aus der Schweiz.
Vielleicht ist die österreichische Literatur auch einfach interessanter?
Schachinger: In der Schweiz ist jeder Debütpreis besser dotiert als die größten Literaturpreise in Österreich, und trotzdem dringt dort nur sehr wenig Literatur über die Landesgrenzen. Die müssen das aber auch gar nicht, weil die in der Schweiz ohnehin mit Geld zugeschüttet werden.
Präauer: Durch Pro Helvetia werden allerdings Übersetzungen in der Schweiz besser gefördert, als das bei uns der Fall ist. Österreich ist ein bisschen ein Nest, in dem man sich’s gemütlich macht, während der Blick in Deutschland und der Schweiz schon stärker international ausgerichtet ist.
Schachinger: Wobei eine spezifische österreichische, mit Hochdeutsch nicht identische Sprache auch schwerer zu übersetzen ist.
Wird man als österreichischer Autor „ins Hochdeutsche übersetzt“?
Schachinger: Interessanterweise haben deutsche Verlage viel weniger Probleme mit dem Österreichischen als österreichische Verlage, die sich o in einer Art vorauseilendem Gehorsam dem vermeintlichen deutschen Geschmack anbiedern.
Peschka: Ich hatte diese Diskussionen nicht, ganz im Gegenteil. Mein Lektor hat mich dazu angehalten, stimmig und konsequent zu bleiben. Seitdem achte ich darauf, dass ich „auf Österreichisch“ schreibe – mit dialektalen Einsprengseln.
Wir haben Sie drei auch eingeladen, weil Sie unterschiedlichen Generationen angehören. Die Frage ist, wie sehr man sich selbst überhaupt als einer bestimmten Generation zugehörig empfindet?
Präauer: Für mich spielt das beim Schreiben schon eine Rolle: In der Häl e des Lebens kann ich sicher auf eine ganz andere Weise voraus- und zurückschauen, als ich das mit 30 getan habe.
Peschka: Ich bin immer ein bisschen nervös vor öffentlichen Au ritten und habe mich beim Hergehen beruhigt, indem ich mir gesagt habe: „Du wirst in ein paar Jahren 60, du brauchst nicht mehr nervös zu sein.“
Schon gar nicht in so einer Runde!
Peschka: Das weiß ich schon – vom Verstand her. Aber was mich interessiert und was ich bleiben lasse, ist sicher auch eine Frage des Alters. In meinen Büchern kommen halt relativ viele ältere Menschen vor, und die jungen Themen überlasse ich anderen.
Was wären solche „jungen Themen“?
Präauer: Erste Menstruation?
Peschka: Ist noch nicht vorgekommen, aber ich werd’s mir merken. Erste Ejakulation wäre auch ein spannendes
Thema. Ich habe aber zum Beispiel derzeit nicht vor, über den Klimawandel zu schreiben – auch wenn das in dem Sinne kein „junges Thema“ ist, weil es uns alle betrifft.

Mutterscha wäre auch gerade ziemlich angesagt.
Peschka: Nein, das hab ich hinter mir und in „FanniPold“ auch schon literarisch abgehandelt.

Schachinger: Ich denke darüber eigentlich nicht nach. In der Literatur ist man ja bis 50 jung, und die Menschen, die das beurteilen, sind 60 plus.
Die Frage ist, wie sehr man die eigene Biografie als Ressource nutzen kann und will. Sie haben ja jetzt auch gerade einen autobiografischen Roman herausgebracht, Frau Peschka?
Peschka: Das wollte ich schon schreiben, als ich noch am „Watschenmann“ gesessen bin. Es gibt bei uns eben diesen „Serbenfriedhof“, auf dem über 7000 Menschen liegen, von denen 5362 Serben sind. Als Kind bin ich da vorbeigeradelt, ohne mir was zu denken. Als ich dann als Erwachsene meinen Vater, der damals um die 80 war, gefragt habe, was es damit auf sich hat, meinte er: „Habt ihr das nicht in der Schule gelernt?“ Hatten wir nicht. Im Ersten Weltkrieg gab’s da ein riesiges Kriegsgefangenenlager. Ich wollte meine Biografie um dieses Wissen korrigieren.
Präauer: Mich interessiert vor allem die Bewegung zwischen Biografie und Fiktion. Ich möchte die Berührung beim Schreiben und Lesen schon zulassen, zugleich aber die Gemachtheit von Literatur reflektieren und mitbedenken.

Marlen Haushofer hat einmal gemeint, dass sie gar nichts erfinden könne.
Schachinger: Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß auch noch genau, wie ich als Teenager Murakami gelesen und mir gedacht habe: Sowas könnte ich mir nie ausdenken; ich habe wohl nicht genug Fantasie, um zu schreiben.
Präauer: Murakami ist es aber auch nur einmal eingefallen, und dann hat er es mit jedem Buch noch einmal durchgespielt.
Schachinger: Ja, das wusste ich damals noch nicht. Ich würde mich dir jedenfalls anschließen: Interessant ist der Bereich zwischen Biografie und Fiktion.
Geht es nicht auch darum, sich selbst zu überraschen?
Präauer: Unbedingt.
Schachinger: Ja, das ist das Schöne am Schreiben. Wenn mir Leute sagen, dass sie das Buch schon vorher im Kopf hatten, glaub ich das einfach nicht.
Die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben?
Präauer: Da ist was Wahres dran.
Denkt man beim Schreiben an „die Leser“ oder „den Markt“?
Schachinger: Im Gegensatz zur bildenden Kunst, wo’s reiche Sammler gibt, sind in der Literatur die Leserinnen und Leser der Markt. Aber beim Schreiben ist es kontraproduktiv, an die zu denken. Umgekehrt ist es auch problematisch, das vollkommen zu ignorieren. Dann schielt man nur noch auf den „Markt“ der Literaturförderung, die genau diese Attitüde belohnt.
Peschka: Auf der Sozialakademie habe ich mal ein Referat gehalten und jemand meinte: „Karin, du erklärst dir immer alles selbst, und es ist schön, dass wir da dabei sein dürfen.“
Das war aber süffi sant gemeint?
Peschka: Sehr süffisant.
Ist aber eigentlich ein total guter Zugang!
Präauer: Ja, weil ja ein Erkenntnisinteresse vorhanden ist. Man ist als Schristellerin immer auch eine Privatgelehrte, die ihr Wissen mit anderen teilt.
Was die verschiedenen Generationen von Schri stellern unterscheidet, ist der Akt des Schreibens selbst: Es gibt solche, die eine handschri liche Sozialisierung haben und es gibt Digital Natives.

Schachinger: Ich schreibe schon auch noch auf Papier. Nicht alles, aber doch einiges. Beim Schreiben muss ich aus dem Internet, damit ich mich konzentrieren kann. Ich weiß nicht, ob mich das zum „Digital Native“ macht?
Präauer: Das ist eher das neue Detox. Schachinger: Genau.
Peschka: Ich brauch das überhaupt nicht. Ich mache mir schon handschri liche Notizen, dür e aber eine leichte Form von Legasthenie haben, die sich allerdings nur in der
Handschri manifestiert. Am Computer schreibe ich recht schnell und muss danach halt viel streichen. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht sehr groß, das war schon in der Schule so. Ich habe 50-Minuten-Slots, dann muss ich zehn Minuten Pause machen.
Das wäre dann aber eh Schulstundenlänge.
Peschka: Ja. Eine volle Stunde ist jedenfalls zu lang.
Präauer: In meinen späten Zwanzigern habe ich mit der Hand geschrieben, es dann in den Computer übertragen, das ausgedruckt, wieder handschri lich korrigiert … Heute schreibe ich ausschließlich am Computer, sitze aber relativ lang an jedem einzelnen Satz.
Der dann aber so bleibt?
Präauer: Ja. Das Verhältnis von Geschriebenem zu Gedrucktem ist bei mir fast eins zu eins.
Peschka: Das würde ich gerne können. Ich lasse meine Sachen aber auch niemanden lesen, bevor ich nicht sieben Mal drübergegangen bin.
Ein Buch ist auch ein physisches Objekt. Welchen Wert legen Sie auf die physischen und ästhetischen Qualitäten Ihrer Veröffentlichungen?
Schachinger: Als ich 2012 in der Buchhandlung Anna Jeller war, hat sie mir „Für den Herrscher aus Übersee“ von Teresa Präauer empfohlen. Das hattest du selber gestaltet, oder?

Präauer: Ja.
Schachinger: Da hat mich jedenfalls das Cover davon überzeugt, dass das das richtige Buch für mich ist.
Präauer: Ich habe schon o ein Buch by its cover gejudged, und da liegt man schon o auch richtig.

Schachinger: Und manchmal ist es auch umgekehrt: Man liest ein Buch und merkt erst dann, was für ein Verbrechen das Cover ist. F
Daniela Strigl und Klaus Nüchtern betreiben seit 2004 die Literatur-Talkshow „Tea for Three“. Die nächste Ausgabe findet am am 14. April um 19.30 Uhr in der Hauptbücherei am Gürtel sta Zu Gast ist die Schri stellerin Cornelia Travnicek
»Dieses epische, verrückte, schockierende, überwältigende, brutale, zärtliche, herzzerreißende Buch ist eines der besten, die ich je gelesen habe.«

Eine Strumpfhose ist kein Keilriemen
Autofiktion in der Autowerksta : Cornelia Hülmbauer ist ein so poetisches wie präzises Romandebüt geglückt
Als Schauplatz der Literatur spielt die Autowerkstatt nicht eben eine herausragende Rolle. So ist es ein Glücksfall, dass Cornelia Hülmbauer 1982 in ein solches Ambiente hineingeboren wurde und nun, Jahrzehnte später, als Autorin von ihrem Aufwachsen zwischen Motoröl und Mechanikern erzählen kann: „früh lernte ich, dass man keilriemen nicht durch damenstrump osen ersetzen kann, wie man es in filmen sah.“
Die Kfz-Werkstätte, die direkt an das Elternhaus anschließt, gehört dem Vater. Die Mutter ist die „frau chef“. Zu ihrem jüngeren Bruder pflegt die Protagonistin eine typische Geschwisterliebe: „später half ich dem bruder manchmal bei den hausaufgaben. wenn er etwas länger nicht verstand, schrie ich ihn an.“
Hülmbauer, die bisher als Lyrikerin in Erscheinung getreten ist, hat ihren Debütroman „o manchmal nie“ konsequent in Kleinschreibung verfasst, was seit den Arbeiten der „Wiener Gruppe“ oder den frühen Romanen Elfriede Jelineks für eine „progressive“, anti-konventionelle Haltung steht.
Auch Hülmbauers kindlichem und jugendlichem Ich eignet etwas Aufsässiges; zunächst noch in Form von ausgeprägten Trotzreaktionen, später dann – im Schatten von Klosterschule und Fronleichnamsprozessionen –als Au egehren gegen das provinzielle Leben.
„o manchmal nie“ fügt sich in die österreichische Tradition formbewusster und sprachkritischer Prosa. Der Roman besteht aus kurzen und sehr kur-
Zwischen Mehlwurm und 24-Stunden-Pflege
Alina Lindermuth erzählt in „Fremde Federn“ von Care-Arbeit und Insekten-Start-ups
«Ein Therapeutikum gegen all jene infamen Verwässerungstendenzen in Ost und West, die Putins Brutalität der Kriegsführung zu relativieren versuchen.»
Wolfgang Paterno, profil
«Erklärt, was für ein Regime das heute in Russland ist.»

Paul Lendvai, ORF
zen Abschnitten, die selten länger als eine Seite sind. Es sind bruchstückha e Eindrücke eines auf den ersten Blick wenig spektakulären, von Bauernregeln dominierten Familienlebens am Land.
In zarten, poetischen Bildern und Szenen – wie etwa dem Drachensteigen mit dem Vater oder Beschreibungen von Mutters Kochkünsten („beuschl und erdäpfelschmarrn“) – gelingt Hülmbauer eine kurzweilige literarische Selbstbetrachtung, in der Fragen der Geschlechteridentität und die Mechanismen von Zugehörigkeit und Ausschluss ernstha , aber nicht ohne eine gehörige Portion trockenen Humors verhandelt werden.
Leitmotivisch fährt das Auto durch den Roman. Für die Erzählerin, deren erstes Wort natürlich „auto“ war, wird dieses Gefährt nach der Mopedzeit zu einem Vehikel in die große Freiheit: „wir fuhren zu einem hiphop-konzert“. Schließlich verliert sie langsam das Interesse am Auto, sodass am Ende gar die zeitgemäße Überwindung des Individualverkehrs obsiegt. Das letzte Wort des Romans lautet denn auch: „aufgehört“.
SEBASTIAN GILLI
Nach dem schlampigen Ende einer Beziehung zieht der 30-jährige Tom ins großelterliche Einfamilienhaus im Randbezirk einer nicht konkretisierten Hauptstadt.
Beim Schnitzelessen versucht er seiner Oma Rosmarie, die früher in der Fleischerei gearbeitet hat, die Vorteile des Mehlwurmverzehrs und seines neuen, „superspannenden“ Projekts zu erläutern: In einem Start-up will er Convenience-Produkte aus Insekten zur Marktreife bringen.
In der Freizeit schneidet Tom die alten Obstbäume, pflanzt Radieschen und baut ein Hühnerhaus. Doch das prekäre Idyll der generationenübergreifenden WG währt nicht lange.
Als sich Rosmarie den Oberschenkelhals bricht, tritt ihre mühsam überspielte Demenz zutage. Wegen der krä eraubenden Suche nach einer 24-Stunden-Betreuerin bekommt Tom schnell Probleme in der Arbeit.
Die 1992 in Villach geborene Alina Lindermuth schreibt über die bizarre kognitive Dissonanz, dass wir alle so leben, bauen und wählen, als könnten wir das Thema Pflege nie am eigenen Leib erfahren. „Und warum um alles in der Welt hatte noch niemand Altenbetreuung so benutzerfreundlich gestaltet, wie es sonst bei absolut jedem Lebensbereich der Fall war?“
die Frauen sind, die Rosmarie pflegen und das Mehlwurm-Müsli mischen. Lindermuth, die 2020 ihr Romandebüt „Die Wahrscheinlichkeit des Zufalls“ vorgelegt hat und im Vorjahr Writer in Residence auf Sri Lanka war, verfügt über eine genaue Beobachtungsgabe. In ihrem zweiten Roman hat sie sich eines wichtigen Themas angenommen – womit weniger die Mehlwürmer gemeint sein sollen (das mag Geschmackssache sein) als die „systemrelevante“ Arbeit der Pflegerinnen aus dem Osten.
Die beiden Figuren Josipa und Kata geraten allerdings erst spät in den Fokus. Zwar beginnt jedes Kapitel mit Einträgen aus ihrem Übergabeprotokoll, aber mehr als über ihr Leben erfährt man, wie es in Toms Start-up zugeht.
Dass gehäu BWL-Phrasen vorkommen, mag daran liegen, dass Lindermuth Gründerin eines Unternehmens für wirtscha liches Storytelling ist. Dafür könnte man sich nach ihrer Anleitung im Roman gleichsam selbst mit fremden Federn schmücken und gleich ein Mehlwurmmehl-Unternehmen gründen.
DOMINIKA MEINDL
Cornelia Hülmbauer: o manchmal nie. Roman. Residenz, 192 S., € 24,–




Es ist eine vife Idee, dass Lindermuth die Care-Arbeit einem jüngeren Mann au ürdet, denn träfe es die Tochter der dementen Frau, wär’s trauriger Alltag, nicht der literarischen Rede wert. Die Federn im Titel deuten an, dass es am Ende immer noch
«Giuliano da Empoli hat einen sensationellen Roman geschrieben über den Putinismus und die Dynamik der Macht im Kreml.»
Neue Zürcher Zeitung
«Ein sachlich fundierter und glänzend erzählter Pageturner.»
Ronald Düker, Die ZEIT


«Die Tragödie der Macht besteht darin, dass man sie verliert. Im Roman kann man das nachlesen.» ORF,

Alina Lindermuth: Fremde Federn. Roman. Kremayr & Scheriau, 256 S., € 24,–






Gendern in der Postapokalypse
Elisabeth Klar lässt in „Es gibt uns“ die Menschheit und die Leserinnen hinter sich
Triggerwarnung: Für diesen Roman sollte man sich ein ganzes Wochenende freihalten oder jedenfalls mehr Zeit veranschlagen, als man gemeinhin für einen knapp 160 Seiten umfassenden Roman braucht. Bei der Lektüre wird man immer wieder zurückblättern, manche Passagen drei, vier Mal lesen müssen.
So etwa ab Seite drei beschleicht einen der Verdacht, dass die Autorin, die Wienerin Elisabeth Klar (Jg. 1986), vorsätzlich alles vernebeln und ins Ungewisse führen will, indem sie sich einer fremdartigen Sprachkunst bedient, die unsereins gar nicht recht verstehen kann.
Das hat insofern eine gewisse Logik, als die posthumanistische Erzählung von „Es gibt uns“ in der Zukun spielt. Nicht Roboter haben die Menschheit überdauert, sondern schleimige Kreaturen. Mikroorganismen und tierische Mischwesen bevölkern die Erde.
Nach einem apokalyptischen Ereignis ist die Stadt Anemos verstrahlt. Die Gemeinscha aus Mutantinnen kämp mit Tumoren und unfruchtbarer Natur, der Tod kommt schnell. Um ihr Überleben und die Wasserversorgung zu sichern, bedürfen die Bewohner der Hilfe eines krakenha en Wesens namens Oberon. Als Oberon im Liebesspiel stirbt, muss das Müxerl übernehmen, ein Tierchen mit langer Leidensgeschichte und prallem Bauch.
Formal erinnert diese Dada-Geschichte an eine griechische Tragödie: Ausgerechnet das aktuell wieder einmal gerne totgesagte Theater existiert in Klars Science-Fiction noch, wie folgende Passage belegt: „,Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene?‘ fragt der Chor. Die Menge antwortet: ,Ins Thea-
zehn exemplarischen Analysen erkundet Klaus Kastberger den Eigensinn der österreichischen Literatur.
Anton Wildgans: Zu Recht vergessen
Richard Billinger: Bewegungslosigkeit als Karriere
Ödön von Horváth: Sich ins Exil schreiben
Acte und Akten: Archive der Avantgarde
Die Hungerkünstlerin: Elfriede Gerstls kleine Literatur
Oswald Wiener: Schreibszenen zwischen Literatur und Wissenschaft
Lesen und Schreiben: Peter Handkes Theater als Text
Friederike Mayröcker: Werkstatt der Dichterin
Wir Kinder der Toten: Spektren bei Elfriede Jelinek
Thomas Bernhard: Read after Burning

www.sonderzahl.at
ter!‘ ,Du hast zerrissene Stiefel?‘ Und wieder tönt es: ,Ins Theater‘ ,Du hast nichts zum Tauschen und doch Hunger?‘ ,Ins Theater!‘ ,Du legst Vorräte an und versteckst sie gut?‘ ,Theater!‘“
So folgt der ganze Roman einer Theaterveranstaltung. In der Eingangsszene strömt die Bevölkerung zum großen Fest Walpurgis zusammen, ergötzt sich gemeinsam am Spektakel. Spiel und Ekstase schweißen die posthumane Gesellscha zusammen. Die im Drama geleistete Katharsis, so die Botscha des Buchs, ist das Lebenselixier der Zukun
Auch die Namen der Protagonisten erinnern an Fabeln, Sagen oder keltische Mythen. Sie heißen Iubdan, Selkie oder Kaguya und tragen ihre Geschichten mit viel Pathos vor.

Auf der Bühne müssen sie ihr Pronomen angeben, deren Anzahl sich in der Postapokalypse vervielfacht hat, ob sie nun er, es, nin, per oder hän lauten. Oberon wir mit „xier“ und „xiem“ angesprochen.
Die Autorin selbst akzeptiert für sich selbst – so kann man auf ihrer Website nachlesen – alle Pronomina. Elisabeth Klar hat Vergleichende Literaturwissenscha und Transkulturelle Kommunikation studiert und arbeitet hauptberuflich in der So wareentwicklung. Es ist ihr zweiter Roman, der sich mit einer trans- bis posthumanen Utopie beschä igt.


Schon „Himmelwärts“ (2020) handelt von einer Welt, in der Mensch und Tier nicht mehr zweifelsfrei zu unterscheiden sind. Eine Füchsin namens Sylvia schlüp in eine Menschenhaut und gibt sich als Frau aus. Der Mensch ist in Klars Werken nicht mehr das Zentrum der Welt, Sprache und Kreativität sind auch auf andere Wesen übergeschwappt.
Bereits in „Wie im Wald“ (2017) legen die Protagonistinnen tierisches Verhalten an den Tag, wenn auch rein rhetorisch. Klars Debüt bescherte ihr begeisterte Kritiken und mehrere Literaturpreise. Der noch vergleichsweise konventionelle Roman handelt von zwei Schwestern und deren Machtspielen. Aus der Ich-Perspektive erzählen beide Frauen vom Kotzen, Bluten und vom Schmerz.

Diese körperfixierte Sprache findet sich auch in „Es gibt uns“ fort. „Denn gegriffen soll werden und geschleckt und gebissen und gerieben und gestreichelt und gekratzt“, singt der Chor, der Titania, Herrscherin von Anemos, huldigt. Mit schweren Hufen und geschmücktem Geweih umhegt sie die Pflanzen, die in der abweisenden Umgebung einer Industrieanlage erblühen. Titanias Knospen sind pure Lust, im Spiel sehnen sich die Bewohner nach dem „lebenden Fleisch der Pflanze“.
Die Autorin findet immer wieder auch pointierte Formulierungen –„Nicht alles will man essen, was man lecken will“ –, der Inhalt und Sinn der Geschichte erschließen sich aber nicht.
„Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren“, ru der Chor, frei nach TanzIkone Pina Bausch. Verloren in der sprachlichen Wirrnis, das sind die Leserinnen und Leser leider ohnehin.
LINA PAULITSCHElisabeth Klar: Es gibt uns. Residenz Verlag, 192 S., € 24,–
In
Treapn, Tscholdra, Tschoppale
Drei Frauen stehen im Mi elpunkt von Silvia Pistotnigs starkem Roman „Die Wirtinnen“
Bei Büchern mit mehreren Erzählsträngen passiert es häufig, dass sich einer spannender liest als die anderen. Silvia Pistotnig hat mit „Die Wirtinnen“ einen bemerkenswerten Roman geschrieben, bei dem man jeder Geschichte gleich gerne folgt und keine der Figuren dominiert.
Im Mittelpunkt stehen drei Frauen aus drei Generationen: Großmutter, Mutter und Tochter. Jede von ihnen verfügt über eine besondere Begabung: Bei Johanna ist es die Musik, bei Gertrud das Fußballspielen, und Marianne liegen die Zahlen. Aber keine wird mit ihrem Talent wirklich etwas anfangen können; die Zeit, die Umstände, ihr Geschlecht hindern sie daran.
„Die Wirtinnen“ umfassen einem Zeitraum von insgesamt 86 Jahren, konzentrieren sich aber vor allem auf die 1930er-, 50er- und 90er-Jahre. Wir befinden uns in Kärnten auf dem Land, genau genommen in Erblach. Keine der Frauen arbeitet wirklich gerne im Eckwirt, wo sich die Männer halb zu Tode saufen, aber es sichert ihre Existenz.
Mit Begriffen wie Treapn (dumme Frau), Tschoppale (dümmliches Wesen), Tscholdra (schwerfälliges, weibliches Wesen), Tschoda (Haare) oder Tetschn (Ohrfeige) bleibt Pistotnig, selbst gebürtige Kärntnerin, nah am Idiom ihrer Heimat und sorgt so für einen authentischen Ton.
Johannas Geschichte beginnt im Jahr 1936. Die junge Frau steht im Stall und hält sich mit den Händen die Ohren zu. Die Mutter reißt sie ihr herunter. „Die Schweine schrein so laut“, sagt die Tochter leise. „Eine Sau schreit nicht, du Treapn“, kei die grantige Mutter. Der Ton ist rau und Johannas Ohren hören besonders
gut. Das Orgelspiel in der Kirche erfüllt das Mädchen mit Glück, aber die Musik ist nicht für Bauersleut wie sie gemacht. Dennoch bringt der Organist Franz „dem Weibsbild“ mit den schlanken Fingern das Spielen bei.
Auch später, nachdem Johanna von ihrem Schwager vergewaltigt, geschwängert und von der Mutter nach Wien geschickt wurde, um dort als Dienstmädchen zu arbeiten, spielt die Musik eine tragende Rolle. Wenn Johanna Putzdienst hat, setzt sich der Hausherr ans Klavier und spielt: „Dann erkannte sie die Noten. Sie sahen aus wie alte Bekannte, irgendwie war es beruhigend, sie zu betrachten, wie ein vor langer Zeit begangener Weg, den man wiedererkannte. […] Die Noten gaben ihr Selbstvertrauen.“

Zurück in Kärnten heiratet Johanna den Eckwirt. Aus dieser Ehe geht Marianne hervor. „Manche Leute hatten Hobbys. Sie hatte Arbeit“, heißt es über die Wirtstochter, die immerzu zählen muss: die Knöpfe, die Münzen, die Gäste. Ihr Lieblingstag ist der Donnerstag, weil sie da die Buchhaltung fürs Gasthaus macht, das sie als Erwachsene gemeinsam mit ihrer Mutter betreibt.
Mariannes Tochter Gertrud wiederum schämt sich für ihr Zuhause: „Meine Oma ist peinlich und in einem Gasthaus wohnen auch.“ Anstatt beim Servieren auszuhelfen, bearbeitet Trudi bevorzugt den Fußball: „Ich möchte lieber ein Bub sein. Die haben es viel lustiger.“ Auch als Grunge-Fan in der Kärntner Einschicht hat sie, die Geri genannt werden möchte, nicht leicht: Die Ausgehmöglichkeiten sind begrenzt. Vor allem in den Szenen rund um die jüngste Wirtin beweist der Roman Humor, etwa wenn das Scheidungskind Geri mit seinen Freundin-
nen eine Grunge-Party im Gwölb des Gasthauses veranstaltet und sich die Oma als coole Alte erweist, die einem übergriffigen Typen eine Kartoffel an den Schädel knallt.
Pistotnig versteht es, politische Ereignisse auf subtile Weise mit den Biografien ihrer Figuren zu verschränken. Als Hitler an die Macht kommt, arbeitet Johanna in Wien, der Geliebte des Hausherrn ist Jude. Das Führerbild im Gasthaus hat einen weißen Fleck an der Wand hinterlassen. Besonders tragisch ist die Geschichte vom „Tschoppale“: Johannas kleiner Bruder, mit Trisomie 21 geboren, überlebt das Euthanasieprogramm der Nazis nicht.
Selbst in dramatischen Momenten erzählt Pistotnig unaufgeregt und klar, jegliches Pathos liegt ihr fern. Manchmal ha et der Erzählung fast etwas Dokumentarisches an, so nahe bleibt sie an ihren Protagonistinnen. Eine weitere große Stärke des Romans besteht darin, dass er seine Protagonistinnen nicht verklärt. Mit „Die Wirtinnen“ ist Pistotning ein glaubha es, vielschichtiges Familienporträt gelungen, das zum Schluss, als die frisch geschiedene Marianne ein „Tschoppale“ auf die Welt bringt, mit einer überraschend optimistischen Note endet.
 SARA SCHAUSBERGER
SARA SCHAUSBERGER
Silvia Pistotnig: Die Wirtinnen. Roman. Elster & Salis, 360 S., € 24,70



»Wenn Glattauer hinter die Masken schaut, tut sich das pure Leben in seiner Tragik und amüsanten Absurdität auf.«
Als hätte die Stadt gerade Sex gehabt
Ihr Romandebüt weist die Kabare istin Maria Muhar auch als gewitzte und formal kühne Autorin aus
Romane, in deren Zentrum Autoren oder Autorinnen stehen, die einen Roman schreiben, von dem einem bald dämmert, das es sich vermutlich um jenen handelt, den man gerade liest, stehen allgemein und o nicht zu Unrecht im Ruf papierener, überkünstelter Leblosigkeit. Aber wer diesen Roman aus diesem Grund nicht liest, verpasst was.
Ebenfalls verpasst etwas, wer „Lento Violento“ wegen des übel ranschmeißerisch formulierten Klappentextes meidet; der noch dazu die Bedeutung der Musikrichtung „Eurodance“ im Buch betont, was all jene, die der bescheiden dimensionierten Schnittmenge von Gegenwartsliteratur-Interessierten und Autodromtechno-Nostalgikern nicht angehören, ebenfalls abschrecken könnte. Was, wie gesagt, schade wäre.
Die drei Hauptpersonen, WG-Genossen und allesamt ungefähr der Generation der 1986 geborenen Autorin angehörig, trudeln planlos durch ein Jungerwachsenenleben, das vorrangig von Geldsorgen, Depressionen, vergeudeter Zeit, Drogenproblemen, Tics und allgemeiner Perspektivlosigkeit geprägt ist.
Dass daraus immer wieder Szenen von funkelnder Komik entstehen, ist bemerkenswert, überrascht aber nicht, wenn man weiß, dass Maria Muhar jüngst auch ein zu Recht hochgelobtes Kabarett-Debüt auf die Bühne gebracht hat (Falter 2022/40).
„Lento Violento“ ist kein realistischer Coming-of-Age-Roman. Obwohl Maria Muhar, beziehungsweise ihre mit dem Schri stellerin-werden-
Anheber, Freerider und Tourismus-Dropouts
In „Verschwinden in Lawinen“ erzählt Robert Prosser klischeefrei von Außenseitern in den Tiroler Bergen
Wollen kämpfende Protagonistin Alex Perner, atmosphärisch präzise zu beschreiben weiß – etwa eine Silvesternacht: „Die Lu ist voll Schwefel. Nach einer halben Stunde Geballer liegt die Stadt erschöp und rauchend neben sich, als ob sie gerade Sex gehabt hätte.“
Formal aber ist das Buch von einer Probierfreudigkeit, die man früher, zur Hochblüte des Eurodance, wohl noch avantgardistisch genannt hätte: ein ständiges Schlenkern zwischen Tagebuchauszügen, auktorialer Erzählung, Youtube- und Lebenshilferatgeber-Exzerpten, absurd korrekten Fußnoten, Songtexten und Was-auchimmer-das-jetzt-genau-sein-soll.
Dass obendrein kaum je ausgeschildert wird, was nun Realität, literarischer Versuch, Drogenwirkung, Gebrauchsanweisung, Wunschvorstellung oder Paranoia ist, funktioniert erstaunlich gut und sorgt für unmittelbare Nachvollziehbarkeit der deliriösen Grundstimmung. Und zwischendrin bekommt man auch noch Sätze fürs Leben: „Von außen betrachtet ist das hier vielleicht okay. Leider bin ich nicht von außen.“
THOMAS MAURER
So kurz vorm Ende der Wintersaison passiert noch ein Unglück. Zwei Einheimische sind beim Skifahren im freien Gelände von einer Lawine erfasst worden. Die junge Frau dür e es überleben, ihr Freund ist vorerst unauffindbar. Eine große Suchaktion wird gestartet.
Dieser Stoff ließe sich zu einem Epos über Schönheit und Gewalt der Natur von Ransmayr’schem Pathos formen oder auch als Abrechnung mit der Tiroler Tourismusindustrie niederschreiben. Doch beides scheint Robert Prosser (Jg. 1983) nicht übermäßig interessiert zu haben. Er erzählt mit „Verschwinden in Lawinen“ lieber eine etwas andere Berggeschichte über Außenseiter, Einsiedler und abgelegene Orte.
Die österreichische Literatur kennt den Heimatroman und den Anti-Heimatroman der 1970er. In den letzten Jahren wurde es zusehends unübersichtlich.
Da erschienen plötzlich Anti-AntiHeimatromane, deren Verfasser die Provinz wieder irgendwie super fanden, sowie neue Anti-Heimatromane, und manche Bücher wurden von der Kritik gar als Anti-Anti-Anti-Heimatliteratur klassifiziert.
Als Guide fungiert der Protagonist, ein Mittdreißiger namens Xaver, ehemaliger Koch und eine Art Tourismus-Dropout, bloß dass er sich das bisschen Geld, das er braucht, als Li wart verdient. In seiner Freizeit hängt Xaver mit seinem alten Kifferfreund ab und träumt von einer Schauspielkarriere.
Die Erzählung führt uns durch unwegsames Gelände, wir begegnen einem „Anheber“, einem Naturheiler, der als Einsiedler in den Bergen lebt, auch Xavers Mutter hat sich auf eine Hütte zurückgezogen. Die Suche nach dem jungen Freerider weckt in Xaver Erinnerung an dessen Opa (Markenzeichen: Kosakensprung), der einst selbst in den Bergen verschwand. Prosser ist ein kurzer Roman von beträchtlicher Sogwirkung gelungen, der durch genaue Beobachtungen und seinen angenehm ruhigen Ton besticht. Geschickt wechselt er zwischen Rückblenden in Xavers Jugend und der Gegenwart, in der Xaver das Versagen von einst zu korrigieren trachtet. Die Suche nach dem Vermissten gerät auf diese Weise auch zum Versuch, sich selbst zu retten.
SEBASTIAN FASTHUBERMaria Muhar: Lento Violento. Roman. Kremayr & Scheriau, 208 S., € 22,–

Anna Herzig
12 Grad unter Null
Roman
19,90 €, Hardcover


ISBN 978-3-7099-8192-4
erscheint am 18.04.2023
Prosser nun, der in Alpbach aufgewachsen, in jungen Jahren weit gereist ist und sein Leben heute sowohl in Wien als auch in Tirol verbringt, nimmt eine selten gewählte literarische Route durchs Gebirg: Wertungsfrei und abseits von Klischees erzählt er von einer geradezu archaisch wirkenden Welt, die kaum jemandem bekannt sein dür e.
Robert Prosser: Verschwinden in Lawinen. Roman. Jung und Jung, 180 S., € 22,–

„Aber Sandburg, so der Ort des seltsam vertrauten Geschehens zwischen Vater und Mutter, zwischen Töchtern und Schwestern, ist auf Sand gebaut. Wie ein weiblicher Thomas Bernhard von heute, so schonungslos erzählt Anna Herzig von Kunst und Macht, von Vätern und Mütern, von oben und unten.“
Gudrun Seidenauer
www.haymonverlag.at

LiebesEinritzungen und AnwesenheitsAufschriften
Der Schri steller, Senner und geländegängige Polyhistor Bodo Hell wird 80 und legt in Text und Ton zwei Neuerscheinungen vor


Begabte Bäume“ von Bodo Hell ist ein hinreißendes Buch. Es erfrischt, als schritte man selbst an Hells Seite Naturund Kulturlandscha en ab. Was er im Buch an einer Stelle über Ernst Bloch sagt, nämlich, dass der uns „spurenlesend auf eine Vielzahl von Fährten“ führt, gilt in gleicher Weise seit jeher für den 1943 in Salzburg geborenen Bodo Hell, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Unverwechselbar wie er selbst – in der hageren, käppi-tragenden Erscheinung eines veritablen Karikaturistentraums – sind auch die Texte dieses Enzyklopädisten mit Orgel-, Philosophie-, Germanistik- sowie Film- und Fernsehstudium.

Als Avantgardist in seiner umweltoffensten Form schreibt Bodo Hell hochrhythmische, häufig grafisch gestaltete Texte, die sich vergnügt irgendwo zwischen Prosa und Lyrik ansiedeln, von starker Naturaffinität geprägt sind, und die er selbst, als würdigster Ernst-Jandl-Erbe, am allerbesten vorträgt – mit hochelaborierten Tempowechseln, die den gelernten Musiker ausweisen. Und voller Fakten, die einen akribischen Rechercheur verraten.



„Begabte Bäume“ handelt von ebendiesen titelgebenden Bäumen, von ihrem Leben in der Natur, ihrer Nutzung und dem ganzen assoziativen Klangraum an Fakten, Kuriosa und Beobachtungen, der stets den besonderen Reiz von Hells Schreiben ausgemacht hat – egal ob es sich dabei um Essays handelte, um Filmisches, Hörspiele, Lyrik oder Prosa. Ums Ergehen von Landscha en und Kulturräumen zwischen Salzburgerland, Waldviertel, Südtirol und dem Dachstein, wo Hell seit 1979 auch als ziegenhütender und käseproduzierender Senner tätig ist, geht es in dieser Sammlung von Texten ebenso.
Man lernt jede Menge und staunt immer wieder aufs Neue über die Detailkenntnis, Beschreibungsgenauigkeit, den Humor und die tief im Konkreten wurzelnde Sprachfantasie des Autors.
Vom „bei Berührung blütensternchenregnenden“ Holunder über die Lärche, „deren SamenstaubAusstreu wie Schwefelregen niedergeht“ oder eine baumbestandene Blockheide „mit feuchtelndem RiesenplotschenBewuchs“ bis zur Wand einer Fischerhütte mit ihren „LiebesEinritzungen und AnwesenheitsAufschri en“.
All das hat man schon selbst häufig gesehen, aber noch nie so betörend genaue Worte und Bilder dafür gefunden. Schieflachen könnte man sich über manche Formulierungen, wie die über den baumhöhlenbewohnenden Kauz, wobei „kauzbezüglich“, nämlich für die nächtliche Beobachtung des Vogels, „absolute Bewegungslosigkeit des Lauernden“ geboten ist. „Kauzbezüglich“ –ein herrliches Hell-Wort: „Schutz Schmutz Nichtsnutz Aufputz Trutz Liegestütz pardauz Kauz…“ beginnt der Kauz-Text mit einem reimreichen lexikalischen Spiel.
Ein richtiggehender Flow erfasst einen – um nur ein Beispiel zu nennen – beim Lesen von Texten wie „Schimmelsprung (Waldviertel/Itinerar)“, einer Kamptal-Wanderung, die sprachlich fröhlich dahineilt und -mäandert, gerade so wie es auch die Gedanken beim Gehen tun.
In ihrer Detailverliebt- und versessenheit entwickelt „Schimmelsprung“ Wanderkartenqualitäten, und es drängt sich einem die Frage auf, ob Hell seine ungezählten Wahrnehmungen – „Siamkatze balanciert äugend am Dachfirst gegenüber“ – stets sofort in seinem Notizbuch festhält und also hunderte Male unterwegs stehenbleiben muss (eher nicht, er käme ja aus dem Rhythmus!) oder ob er frohgemut ausschreitet und sich auf ein phänomenales Gedächtnis verlassen kann?
In jedem Fall könnte man selbst, mit seinem Kamptal-Text bewaffnet, sofort umstandslos zum Wanderstock greifen und bestens geführt au rechen.
Man verliert sich bereitwillig in Bodo Hells rhythmischen Erzählungen und Betrachtungen. Verirren allerdings wird man
Bodo Hell: Begabte Bäume. Mit Zeichnungen von Linda Wolfsgruber. Droschl, 216 S., € 25,–

sich, von ihnen angeleitet, garantiert nicht. Im Gegenteil: Man sieht mehr, als man sonst wahrgenommen hätte. Dank des Adlerauges des Autors entgehen einem nicht die unscheinbarsten landscha lichen Phänomene, über deren regional-, bau-, kunstund alltagsgeschichtliche Hintergrund man darüber hinaus wertvolle Hinweise erhält. Das Beste aber ist, wie Bodo Hell seiner elementaren Naturverbundenheit, die sich andernorts literarisch viel zu o im Schwärmerisch-Biederen au ält, Bodenha ung gibt. Er tut das, ohne ihr für eine Sekunde Schönheit und Faszination auszutreiben. Nur Naturkitsch ist da weit und breit keiner auszumachen. Vielmehr verhält es sich so, wie es Klaus Nüchtern in einem Geburtstagsgruß zu Hells Siebziger ausgedrückt hat, dass nämlich „eine Kuh ihre alpenpanoramaha e Aura verliert, sobald sie in einem Text von Bodo Hell vorkommt“.
Gleiches gilt natürlich auch für Ziegen, Zaunammern und Zikaden, welche zu den Protagonistinnen einer weiteren Neuerscheinung gehören, die anlässlich des runden Geburtstags des Autors erschienen ist, dem Klangbuch „Natur Aufnahme“ mit CD nämlich, für das Hell mit dem Tonmeister Martin Leitner und dem Musiker Georg Vogel zusammengearbeitet hat – wie er ja ganz generell und seit jeher ein Freund der künstlerischen Kooperation ist.
Martin Leitner, Bodo Hell, Georg Vogel: Natur Aufnahme. Von Ziegen, Zaunammern und Zikaden. Klangbuch mit CD. Mandelbaum, 32 S., € 25,–

Eine Liebesgeschichte von Martin
Suter
Ein Mann verliert seine große Liebe und sucht sie ein Leben lang.
Der Student Tom gewinnt das Vertrauen des inzwischen betagten Liebhabers und versucht sich einen Reim auf Melodys Verschwinden zu machen. Dabei stößt er auf Widersprüche, Geheimnisse und Überraschungen.
Diogenes
Töne, Geräusche und Natur-Gesänge aus verschiedensten Weltecken stehen auf der CD im Mittelpunkt, dazwischen mischt sich Bodo Hell mit „enzyklopädischen Text-Einschüben und assoziativen Unterfütterungen“, was natürlich insgesamt als Konzept kaum mehr zu toppen ist.
Wie gesagt: Die reale Umwelt lacht einen allenthalben aus Hells Literatur an, ob’s –wie in „Begabte Bäume“ – um die „BalzTaubheit“ des Auerhahns, ums HolzknechtWerkzeug Sappel, um die barttragende katholische Heilige Corona oder das richtige Aufschichten eines Holzstoßes geht. JULIA KOSPACH
Martin Suter

Vom Hundertsten ins Tausendste und weiter
Den Abschweifungskünstler Erwin Einzinger zieht es mit einem „Rucksack voller Steigeisen“ ins Gebirge
Erwin Einzinger, der im Mai seinen 70er begeht, ist ein Mann der Peripherie. Das Werk dieses stillen Giganten hält sich ein wenig versteckt vor einer breiteren Leserscha und vom Marktplatz der literarischen Eitelkeiten. Nicht dass der Autor sich bewusst am Rand positionieren würde. Sein Literaturverständnis führt ihn zwangsläufig dorthin.
Der Germanist Wendelin SchmidtDengler hat es einmal so formuliert: „Einzinger nimmt nicht an der Autoren-Rallye teil, die zu allen Punkten gängiger Themen wie Ichverlust, Beziehungsproblematik, Krise des Intellektuellen führt. Er gehört zu jenen, die wissen, dass ernstzunehmende Literatur sich nicht durch den abgehaspelten Katalog der Konversationsthemen ausweist, sondern durch reflektierte Gestaltung.“
Wer eines von Einzingers Büchern aufschlägt, darf keinen linearen Plot erwarten. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Oberöster-
Ein Roman ergibt sich aus der Fülle an Bildern, Figuren, Details und o schrägen Fakten nicht. Sei’s drum!
reicher schwierige, experimentelle Literatur produzieren würde, vielmehr hat er eine eigene, fragmentha e und doch schillernde Form des Erzählens kultiviert.
Das Werk dieses Abschweifungskünstlers, der vom Hundertsten ins Tausendste und noch weiter kommt, basiert auf Notizbüchern, in denen er auch, ja gerade die scheinbar nebensächlichsten Beobachtungen festhält.
Es braucht einen bestimmten Impuls, dann durchforstet der Autor die Notizen nach brauchbarem Material zu einem Thema. Daraus entstehen Erzählbruchstücke von meist nicht mehr als einer Seite Umfang.
So war es beim Meisterstück „Aus der Geschichte der Unterhaltungsmusik“ (2005), und so ähnlich dür e es sich auch beim neuen Buch „Ein Rucksack voller Steigeisen“ verhalten haben, in dem es den im Kremstal lebenden Autor und passionierten Waldgänger in die Berge zieht.
Das Wandern und Bergsteigen, Natur, Tier und Mensch sind die losen thematischen Fäden, die die Ab-
folge von Kürzestgeschichten miteinander verbinden. Ein Roman ergibt sich aus der Fülle an Bildern, Figuren, Details und o schrägen Fakten nicht. Sei’s drum!
Einzingers langjähriger Verleger Jochen Jung pflegte den Autor immer wieder anzuspornen: „Du musst eine Straße bahnen, die man weitergehen will.“ Darauf dieser: „Das ist das größte Problem bei meinen Schreibabenteuern. O geht der Text den Weg, den man überhaupt nicht erwartet.“
Einzinger hat andere Trümpfe im Ärmel. Seine Texte sind so voller Welt, dass sie den Wunsch nach einer welthaltigen Literatur geradezu übererfüllen. Diesmal beginnt der Streifzug mit einer Beerdigung in heimatlichen Gefilden. Bergkameraden haben sich am Grab eines Lawinenopfers zusammengefunden. „Bayrisches Sauerkrautpathos“ umflort die Worte des Trauerredners. Es sind nicht zuletzt solche Details und Wendungen, die Einzingers Texte auszeichnen.
Danach geht es nach Afrika, die USA und noch weiter. Hin und wieder wendet sich Einzinger mit schalkha en Einwürfen und poetologischen Bemerkungen an die Leser.
Etwa so: „Die wirklich kostbaren Momente drängen sich in Wahrheit nur sehr selten auf. Sie zusätzlich zu polieren, ist in den meisten Fällen gar nicht nötig, denn auch das Ungeschliffene hat seinen Reiz, und manchmal ist sogar das Quietschen eines rostigen Garagentors am Rand von Kennewick ein heimliches Signal.“
Der Sprung von einer allgemeinen Überlegung zu einem konkreten, überraschenden Objekt verleiht dieser Passage eine eigentümliche Poesie. An seinen besten Stellen beginnt der Text zu leuchten oder ein wenig zu schweben. Dann wieder erinnern die zusammengetragenen Begebenheiten, die Berufe der Beteiligten und aufgelesenen Ortsnamen ein wenig an ein Kuriositätenkabinett.
Bei hastigem Genuss kann diese Prosa die Wahrnehmung überreizen. Am besten liest man nicht mehr als drei, vier Seiten auf einmal. Der Autor wird über dieses Lob nicht böse sein: „Ein Rucksack voller Steigeisen“ ist erstklassige Klolektüre.
SEBASTIAN FASTHUBER
Lügen haben starke Beine
Drei Frauenschicksale aus der Nachkriegszeit stehen im Zentrum des jüngsten Romans von Gudrun Seidenauer
Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Drei junge, knapp zwanzigjährige Frauen haben ihn überlebt: Mali flieht aus ihrer Heimat, kurz bevor die deutschsprachige Bevölkerung vertrieben wurde, mit einem Kind im Bauch; Vera geht vom Land in die Stadt, nachdem ein amerikanischer GI versucht hatte, sie zu vergewaltigen; Grete stellt sich mit den Besatzern gut und träumt sich aus dem grauen Nachkriegs-Wien nach New York. „Die amerikanischen Soldaten sind noch jung. Nicht so kaputt vom Krieg.“
Erst allmählich beginnt sich die Literatur mit jener Generation zu befassen, die zu jung war, um sich wirklich schuldig zu machen, aber nicht jung genug, um Gewalt und Verfolgung nicht mitzubekommen, kurz: die um eine unbeschwerte Jugend gebracht wurde und damit ein Leben lang zu kämpfen hatte.
2022 schloss Ralf Rothmann die Roman-Trilogie über seine Eltern als junge Erwachsene im Finale des Zweiten Weltkriegs mit „Die Nacht unterm Schnee“ ab. Gudrun Seidenauers Roman „Libellen im Winter“ gehört ebenfalls in diesen Kontext. Seine Protagonistinnen haben im Vergleich zu ehemals politisch aktiven Nationalsozialisten wenig zu bereuen, tragen aber trotzdem schwer an der Vergangenheit.
„Manches kann man keinem erklären, egal, wie wahr es ist“, denkt Vera und versucht, „darum herum zu leben“. Alle drei Frauen fühlen sich „wie auf Eis“. Trotzdem unterstützen und vertrauen sie sich zumindest gegenseitig.
Im kleinen Österreich gibt es eine Viertelmillion mehr Frauen als Männer, versucht Tante Ada Mali einzuschärfen, als diese die Ehe mit einem Briten ausschlägt. Die drei Freundinnen kommen gut ohne Männer aus. Nicht nur weil die Kriegsheimkehrer im Schlaf vor Angst schreien und tagsüber Frau und Kinder herumkommandieren, hin- und hergerissen zwischen jäher Wut und tagelangem Brüten.
Auch eine vierte junge Frau, die Mali erst an ihrem Lebensende im Pflegeheim mit über 90 Jahren kennen lernt, vertraut ihren Freundinnen mehr als den Männern.
Auch in ihrem fün en Roman erweist sich Gudrun Seidenauer als herausragende, feinsinnige Erzählerin. Sie beherrscht die Kunst, menschliche Dramen ohne Pathos darzustellen, dafür aber mit einer wohldosierten Portion philosophischer Reflexion zu unterfüttern. Die bedächtige Mali, die schweigsame und praktische Vera und die lebenslustige, scharfsinnige Grete, die sich aus allem herauszuhalten versucht, „sogar aus sich selbst“, sind komplex herausgearbeitet. Wien in der zweiten Häl e der 1940er- und in den 1950er-Jahren, „ein kaputtes Drecksloch“, bleibt keine schablonenha e Kulisse, sondern erwacht zum Leben.
Malis Sohn Robert, der, umsorgt von „drei Müttern“, nicht ohne Schwierigkeiten zum Mann heranrei , gewinnt mit der Zeit ebenfalls Konturen. Auch in die Männerschicksale haben sich Krieg und NS-Zeit eingeschrieben, auch sie müssen einen Modus finden, damit umzugehen. Roberts Verhältnis zum Vater lässt sich nicht mehr wiederherstellen. Und das zu seiner Mutter? „Dass sie und ihr Sohn einander verstehen, wäre zu viel gesagt. Aber sie verständigen sich. Und sie wissen voneinander, worüber sie hinweggekommen sind und worüber nicht. Das genügt, findet Mali.“
Die Autorin misstraut Binsenweisheiten wie der, dass Reden die Dinge erträglicher macht. „Ich würde so gerne nie mehr lügen“, sagt Grete. „Vergiss das schnell wieder“, meint Mali: „Die Wahrheit vertragen die wenigsten. Egal, um was es geht.“ Manchmal müsse man eben vergessen – oder auch lügen. „Lügen machen manches erst erträglich.“
Die Vergangenheit bleibt ohnedies aufdringlich genug. Und sie ist längst nicht vorbei, wie Grete bitter erfahren muss, als sie ihr lesbisches Begehren entdeckt und sich im intoleranten Klima der Nachkriegszeit Hass und Häme ausgesetzt sieht. „Libellen im Winter“ lässt sich als Hommage an die stille Kra und Solidarität von Frauen lesen – sowie an kreative, offene Formen von Familie und Zusammenleben. Die Vergangenheit ist nie vorbei, aber es gibt eine Möglichkeit, mit ihr umzugehen, sagt dieses kluge und, ja, auch tröstliche Buch.
KIRSTIN BREITENFELLNERErwin Einzinger: Ein Rucksack voller Steigeisen. Jung und Jung, 328 S., € 24,–

Als sie aus ihrer Heimat, dem Irak, ausreist, ist Manal so alt wie seinerzeit Mali. Die Jesidin, die von den Milizen des IS entführt und missbraucht wurde, spiegelt das Universale dieser Frauenschicksale – eine überraschende, gelungene erzählerische Wendung, die eigentlich eine Wiederholungsschleife darstellt: Die Gewalt – gegen Frauen – stirbt nie aus.
Gudrun
Seide nauer: Libellen im Winter. Roman. Jung und Jung, 434 S., € 24,–

Mit dem Schrecken nicht davongekommen
In seinem ersten Roman seit neun Jahren versucht Daniel Gla auer, schwere Kost leicht verdaulich zu servieren
Schon der Klappentext verrät, dass es zu einer Katastrophe kommen wird. Nach wenigen Seiten kann man sich denken, zu welcher, auf Seite 34 ist es dann so weit. Dann genügt dem Autor ein kurzes Kapitel mit lapidarem Ende, um den Verlauf des Unglücks zu schildern. Es geht alles so schnell wie manchmal im echten Leben, beim echten Sterben.

Drei Familien werden in ihren Grundfesten erschüttert. Eine davon, eine somalische Flüchtlingsfamilie, hatte zuvor schon unaussprechliches Leid erfahren, die beiden anderen waren bislang von gröberen Schicksalsschlägen verschont geblieben. Die aufstrebende Wiener Grünpolitikerin und der besserwisserische Universitätslektor, der joviale Starwinzer und die tüchtige Marillenkönigin, für sie und ihre behüteten Kinder ändert sich von einem Tag auf den anderen alles: „Keiner der Beteiligten ist mit dem Schrecken davongekommen. Das Unglück hat sich in die Hinterköpfe gegraben und dreht dort Endlosschleifen.“
Daniel Glattauer packt in seinem neuen Roman ein aktuelles Thema an, es geht um eine klare Botscha , ein hehres Anliegen. Den Ungehörten eine Stimme zu verleihen. Die Idee, so enthüllte Glattauer in einem Interview, sei ihm bei einem Toskana-Urlaub mit zwei befreundeten Familien gekommen, in den er auch sein afghanisches Patenmädchen mitnahm: „Wenn man sich eine lang ersehnte Reise gedanklich ausmalt, mischen sich in die Vorfreude immer auch blitzartige Schreckensvisionen.“
Genau so eine Schreckensvision wird im Roman Realität. Der Autor hat die Arbeit an diesem als „stilistische Abenteuerreise“ bezeichnet und setzt alles daran, seine Leser nicht zu langweilen. Zu Beginn fängt er die Szenerie wie mit einer Kamera ein, findet daneben aber durchaus eigentümliche Bilder: „Da schmiegen sich lebensdurstiger Himmel und abenteuerhungriges Meer in üppigen blauen Streifen aneinander.“
Es folgen Kapitel im Stil von Pressetexten und Online-Zeitungsmeldungen, inklusive Leser-Postings, die den grassierenden Wahnwitz im Leserforum der Online-Ausgabe einer renommierten österreichischen Tageszeitung sehr gekonnt persiflieren. Einer dieser fiktiven Poster schreibt hellsichtig: „Die sogenannten ‚Qualitätsme-
dien‘ holen sich den Boulevard halt durch die Hintertür herein, mit den anonymen Postings, wo jeder seinen Dreck absondern kann.“




Dann gibt es noch einen Kunstgriff mit einem ungeöffneten Brief, der am Anfang des Romans in eine Schublade gelegt und erst am Schluss endlich gelesen wird (und dessen rechtzeitige Lektüre das Drama, das sich dazwischen ereignet hat, verhindert hätte); weiters den Austausch zweier verliebter junger Menschen in einem OnlineForum, der an die gewitzten, flotten Dialoge aus Glattauers Bestseller „Gut gegen Nordwind“ erinnert; es gibt ein Radiogespräch, eine Gerichtssaalreportage und ein Interview mit dem Reporter einer Straßenzeitung. Der Autor zieht also etliche Register und überzeugt damit mal mehr und mal weniger. Neben dem gesellscha spolitischen Anliegen ist auch für Banalitäten Platz: „Warum weiß man erst, wie sehr man jemanden liebt, wenn man ihn verloren hat?“
Eine der gelungensten Romanfiguren ist ein kauziger alter Rechtsanwalt, nach dessen denkwürdigem ersten Au ritt man erstmals nicht sofort weiß, in welche Richtung die Handlung geht, wofür man recht dankbar ist. Leider nimmt man ausgerechnet dieser gut gezeichneten Figur ihre große Offenbarungsrede vor Gericht dann doch nicht ganz ab, sondern hört den Autor dozieren. Glattauers Roman hat 300 Seiten, und erst am Schluss wird auf nur 15 davon die Geschichte erzählt, um die es dem Autor wirklich geht, der er Gehör verschaffen möchte. Es ist eine furchtbare Geschichte von Flucht, Tod und Trauer. Es ist gut, dass sie erzählt wird, weil sich solche Geschichten tatsächlich tausendfach zutragen. Wer sie nicht hören will, wird auch das Buch nicht lesen wollen.
CHRISTINA DANYIHR THERAPIESYSTEM FÜR ALLE SCHWEREGRADE DES TROCKENEN AUGES


















Daniel Gla auer: Die spürst du nicht. Roman. Zsolnay, 304 S., € 25,70





Intensive und langanhaltende Befeuchtung dank hochwertiger Hyaluronsäure* Hoch ergiebig (mind. 300 Tropfen*) – garantiert niedrige Therapiekosten


Konservierungsmittel- und phosphatfrei
6 Monate nach Anbruch verwendbar




In der Irrenanstalt von Donaublau
Der neu aufgelegte Roman „Die Schwerkra der Verhältnisse“ ist der beste Einstieg in das Werk von Marianne Fritz (1948–2007)
Später wird die österreichische Autorin Marianne Fritz (1948–2007) noch zehntausend Seiten schreiben; über mehrere Bücher hinweg bis hin zu dem Werkkomplex „Naturgemäß“, der nur noch als Faksimile gedruckt werden konnte, weil allein schon die Komplexität des Typoskripts – hergestellt in nächtelangen Ekstasen der Kugelkopfmaschine – die Normen des deutschsprachigen Literaturbetriebs sprengte.
In ihrem Erstling aus dem Jahr 1978 aber schaut das Werk von Marianne Fritz noch so aus, als würde es in eine Nussschale passen. Dieser kleine Happen, „Die Schwerkra der Verhältnisse“, kaum mehr als 100 Druckseiten stark, erfährt im Augenblick ein Revival.
Am Akademietheater in Wien – Martin Kušej sei gedankt! – läu seit Ende 2021 eine glanzvolle Dramatisierung. Die Bühne ist in ein Schwarzweiß aus Licht und Schatten getaucht, und die Figuren turnen in engen (auf einer Küchenkredenz) oder weiten Räumen (im Zimmer eines Irrenhauses) herum.

Schroffe Konturierung ist ein Charakteristikum ihres Schreibens. Marianne Fritz war eine Gnostikerin der Literatur. Gegensätze wurden ins äußerste Extrem getrieben, und Erkenntnisse ergaben sich vor dem Hintergrund von Daseinsschlachten, o auch direkt im Krieg.

Nun erinnert sich auch der SuhrkampVerlag seiner Autorin. In einem 104-seitigen Brief, der keine Seite der Psyche Siegfried Unselds unbearbeitet ließ, hatte Marianne Fritz im Jahr 1993 dem damaligen Verlagschef klar gemacht, dass es für ihn einfach keine Option sei, ihr Werk fallenzulassen.
Nach Unselds Tod ist genau das geschehen. Man hielt Marianne Fritz fortan eher schlecht als recht im Programm, in Wien kümmerten sich währenddessen einige spezifisch interessierte Germanisten und ein Theaterkollektiv mit dem schönen Namen
fritzpunkt um das Werk. Im Verlag selbst aber glaubte niemand mehr an die Bedeutung dieses literarischen Kontinents.










Das hat sich jetzt geändert. Im Nachwort zur Neuausgabe baut Daniela Strigl Barrieren ab und gibt dem bundesdeutschen Lesepublikum eine Warnung mit auf den Weg. Man dürfe die österreichische Walzerseligkeit, die in der „Schwerkra der Verhältnisse“ auch zu finden sei, keinesfalls als Zeichen von Gemütlichkeit verstehen.
Genau so ist es: Das „Land des Chen und Lein“, als das die Autorin Österreich mit seinem Hang zu Diminutiven und doch langer und blutiger Geschichte später bezeichnet, erscheint schon im Erstling als ein einziges Schmerzgebiet. Nicht „Wahlverwandtscha en“ herrschen hier, sondern eine einzige Qualverwandtscha






Wie in Goethes Roman, in dem zwischen den vier Hauptfiguren Eduard, Charlotte, Ottilie und Otto chemische Anziehungs- und Abstoßungsreaktionen herrschen, zeigt sich auch in der „Schwerkra der Verhältnisse“ ein Kleeblatt kreuzweiser Bindungen. Berta Faust (Goethe, schau oba!), die in den „Aquarellen-Walzer“ von Josef Strauss verliebt ist und von diesem ein trügerisches Glücksgefühl bezieht, wird von dem Musiklehrer Rudolf schwanger.
Statt diesem kommt jedoch dessen Freund Wilhelm Schrei aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Er hat versprochen, sich um Berta und das Kind zu kümmern. Wilhelms Freundin, Wilhelmine, geht leer aus. Sie wird zur großen Gegenspielerin der Protagonistin, die nach ihrer Verehelichung dann tatsächlich Berta Schrei heißt. Die Gewalt der sprechenden Namen aber setzt sich auch bei den Kindern des Ehepaars Schrei fort: Sie heißen Klein-Rudolf und Klein-Berta.
Marianne Fritz präsentiert diese Begebenheiten in kürzesten Kapiteln. Die einzelnen Textstücke wirken wie grelle Aufblenden und tragen apodiktische Titel, von „Papperlapapp! Krieg!“ über „Es trieb mich
»Eine glanzvolle Dramatisierung von Fritz’ Debütroman am Akademietheater hat zum Revival dieser Autorin entscheidend beigetragen
geradezu zu euch“ bis hin zu „Ein Mann, ein Wort, und du bist verloren“. Ort der Handlung ist Donaublau, ein Name, in dem gleichermaßen die Stadt Wien als auch der Walzer steckt.
Etwas sehr Schweres lastet auf den Verhältnissen. Fassbar ist es in einer überallhin wirkenden und fast schon naturgesetzlichen Kra . Wilhelm und Wilhelmine erweisen sich als typische Exponenten der österreichischen Nachkriegsgesellscha : Er ist Chauffeur, sie eine Putzfrau. Tempo und Sauberkeit, so könnte man die Paradigmen beschreiben, die in den ersten Jahrzehnten nach 1945 herrschten.
Berta Schrei wiederum ist auch eine Medea und tötet ihre eigenen Kinder. Auf die Frage nach dem Grund antwortet sie nicht viel mehr, als dass die beiden „misslungen“ wären – so wie die ganze Schöpfung. Fortan fristet Berta ihr Dasein im Zimmer Nummer 66 in der Irrenanstalt von Donaublau, die „Festung“ genannt wird. Dieser Name wird dem unvollendeten Romanzyklus der Autorin den Titel und ein ungemein kravolles metaphorisches Zentrum geben. Das mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnete Debüt von Marianne Fritz „Die Schwerkra der Verhältnisse“ ist ein hervorragender Einstieg in ein zentrales Werk der österreichischen Nachkriegsliteratur. Nach dem Kindermord lässt Wilhelm sich von Berta scheiden, und Wilhelmine bekommt den Mann, der schon immer in ihrem Namen steckte.
Marianne Fritz: Die Schwerkra der Verhältnisse. Mit einem Nachwort von Daniela Strigl. Roman. Suhrkamp, 148 S., € 20,60



Im Krankenzimmer gesellt sich der Berta Schrei eine mythische Figur zu, von der es in den späteren Festungsbauten von Marianne Fritz aberhunderte geben wird. Das „weise Mütterchen“ umschwirrt Berta Schrei und beginnt mit ihr einen Dialog jenseits der Räume und Zeiten, in denen hier noch die meisten Figuren stecken. Zentrales Thema ist die „Wunde Leben“. Zu dieser wird bei Marianne Fritz später noch sehr viel mehr zu lesen sein.
KLAUS KASTBERGERDieses scharf gestellte, frostige Schlaglicht
Judith Hermann gibt in ihrer Poetikvorlesung Auskun über ihr Leben und Schreiben und nimmt der Ga ung den Schrecken
Da gab es zu ihrem Roman „Aller Liebe Anfang“ (2014) diese unsägliche Kritik von Edo Reents in der FAZ, Judith Hermann habe „zwei Probleme“: „Sie kann nicht schreiben, und sie hat nichts zu sagen.“ Hermann zitiert die Rezension ohne Namensnennung leicht abgewandelt: „ich könne nicht schreiben und ich hätte nichts zu erzählen. Ersteres beiseitegelassen, enthält die zweite Anmerkung eine eigenartige Wahrheit. Ich habe nichts zu erzählen, weil ich das, was ich eigentlich zu erzählen habe, nicht erzählen kann.“ Folgerichtig hat „Wir hätten uns alles gesagt“ den Untertitel „Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben“. Aber Judith Hermann hat natürlich sehr wohl etwas zu erzählen und darüber hinaus auch etwas zu sagen. Ja, dank ihrer Lust am Erzählen verliert die gefürchtete Gattung der „Poetikvorlesung“ einiges von ihrem Schrecken.
Hermann denkt hier nicht nur anschaulich über die Voraussetzungen des eigenen Schreibens und das Gelingen von Literatur generell nach, über Turgenjew und Carver, sie erzählt auch von ihrem produktiven Rückzug während der Lockdowns und der vorsichtigen Annäherung an einen Fotografen namens Jon und vor allem vom Aufwachsen in einer Familie, die dysfunktional zu nennen ein Euphemismus wäre: „Ich bin das traumatisierte Kind eines depres-
siven Vaters, ich komme aus einer Familie von Verrückten, ich muss die vielfältigen Symptome der Krankheiten des Geistes vor der Welt verbergen, zumindest denke ich, ich müsste das tun“.
Das antwortet Judith Hermanns Ich, als Jon ihr Geheimniskrämerei vorwir ; sie verrät ihm ihr Geheimnis, das sie noch niemandem verraten hat. So tritt die Autorin in diesem Buch die Flucht nach vorne an: Sie beschwört den Reiz des Verschweigens, um eine Menge von sich preiszugeben. „Wir hätten uns alles gesagt“, lautet Hermanns Resümee, als sie und Jon übers Wochenende beinahe in einem Schlossmuseum eingesperrt worden wären. Sie hätten, doch sie haben nicht, und es wird nicht geklärt, was „alles“ sein könnte. In der ganzen Geschichte bleibt so ein Rest im Dunkeln, aber für Hermanns Stammleserscha erhellt sich mancher Zusammenhang, und die Neulinge werden neugierig gemacht.
Dass Judith Hermann schreiben kann, weiß man seit ihrem Debüt „Sommerhaus, später“ (1998), dessen sensationeller Verkaufserfolg das ewige Mantra des Buchhandels widerlegt, die Leute würden keine Erzählungen lesen wollen. Die Geschichten um einen jugendlichen Freundeskreis, in dem man viel raucht, trinkt und in pathetischer Ratlosigkeit schwelgt, treffen das Lebensgefühl der Jahrtausendwende: „Alles war traurig und erleuchtet.“ Nun liefert
Judith Hermann: Wir hä en uns alles gesagt. Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben. Frankfurter Poetikvorlesungen. S. Fischer, 187 S., € 23,70

Hermann einige Realien zur Ersatzfamilie nach, zu Marco, dem malenden Eigenbrötler, und zur charismatischen Ada. War die Autorin mit ihr befreundet? Hat sie sie „gekannt“? –„Einfacher wäre es zu sagen, ich habe Ada geliebt.“
Hermann erzählt vom Sommerhaus der ebenfalls depressiven russischen Großmutter, von der verwinkelten, staubigen Wohnung der Eltern, vom Vater, der entweder schluchzte oder tobte und der Tochter wunderbare Puppenhäuser baute, die die vielen Kisten und Verschläge in ihrem famosen jüngsten Roman „Daheim“ in einem anderen Licht erscheinen lassen. Klug und uneitel macht Hermann die Magie der Leerstelle im Leben wie in der Literatur begreiflich und baut mit Zauberhand immer wieder die Kulissen um.
Am Beginn der Erinnerungsspirale steht die unverhoffte Begegnung mit ihrem einstigen Analytiker an der Kneipentheke. Wie auf die Fiktion das Brennglas des Realen gerichtet wird, so erscheint die Realität plötzlich in der Fragwürdigkeit des Ausgedachten: „Es war ein wenig so, als stünden wir in diesem speziellen, scharf gestellten, frostigen Schlaglicht einer Short Story, die irgendwo beginnt, etwas einfängt, wieder abbricht, bevor es zu Conclusion und Fazit kommen kann.“
DANIELA STRIGL
Wenn das Leben geht und die Liebe bleibt
„Der heutige Tag“ von Helga Schubert geht der Frage nach, was im hohen, gebrechlichen Alter von einer Ehe übrigbleibt
In der klösterlichen Tradition gliedern Gebete den gesamten Tag. Die Texte dieser Tageszeitliturgie finden sich im Stundenbuch. Den Betenden ist es darum zu tun, sich die Gegenwärtigkeit Gottes bewusst zu machen. Was aber ist damit gemeint, wenn die deutsche Schri stellerin Helga Schubert, Jahrgang 1940 und vor drei Jahren älteste Teilnehmerin und Gewinnerin des Klagenfurter Ingeborg BachmannWettlesens, ihrem neuen Buch „Der heutige Tag“ den Untertitel „Ein Stundenbuch der Liebe“ gibt? Geht es um die Gegenwärtigkeit eines geliebten Menschen? Um die Beschwörung seiner Anwesenheit?
Tatsächlich wird genau das thematisiert. Und zwar unter den prekären Bedingungen von Alter, Demenz und Todesnähe: „Wir sind seit 58 Jahren zusammen. Zwei alte Liebesleute.“ Helga Schuberts Mann ist seit Jahren ein multimorbider Pflegefall und zunehmend dement, sie selbst – bis auf gelegentliche Halbtage mit professioneller Hilfe – seine einzige Betreuerin. „Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle, ob die Windel nass ist. Ich liebe ihn sehr.“ Das ist die Spannung, die hier ausgehalten werden muss.
„Der heutige Tag“ behandelt denn auch „das Absurde, das Erbarmungswürdige, das Rührende, das Furchterregende, das Komische, das Egoistische, das unmaskiert in mein
Leben einbrach“. Auch durch Sätze wie diesen, die ihr Mann mit steigender Häufigkeit zu ihr sagt: „Dann bist du meine Frau, aber wo sind die anderen beiden, die so aussehen wie du?“ Bald wird sie für ihren Mann „nur eine austauschbare Hilfe“ sein und „nicht mehr die Einzige, die unverwechselbare Geliebte“. Nacht für Nacht denkt sie beim Schreiben und Schlafen – mehrmals von der Babyphone-Verbindung mit ihrem Mann unterbrochen – darüber nach, wie dieses Loslassen, Annehmen und Friedenschließen gehen soll, wenn man immer damit befasst war, sich und das Leben ändern zu wollen.
In ihrem letzten Buch „Vom Aufstehen“ (2021) hat Helga Schubert das eigene, acht Jahrzehnte erlebte Zeitgeschichte umspannende Leben beschrieben; als Kriegswaise und Flüchtlingskind; als bespitzelte DDRAutorin; als hadernde Tochter einer von Krieg und Zwang hart geworden Mutter; schließlich das Ankommen in einem mecklenburg-vorpommerischen Dorf als Ort fürs Schreiben und das Leben in einer glücklichen Ehe.

Die symbiotisch-glückliche Ehe mit ihren wechselha en Anfangsjahren steht nun ganz im Mittelpunkt des neuen Buchs. Erneut erzählt Schubert in Vor- und Rückblenden, dieses Mal aber ganz besonders auch von ihrer Gegenwart und dem Rin-
gen ums eigene Überleben und gleichzeitig dem tiefen Wunsch, ihrem Mann widrigen Umständen zum Trotz nahe zu sein, ihn ernst zu nehmen und die Würde zu lassen.
Das ist alles andere als leicht. Da sind das „Mitleid und Gesättigtsein vom Samariterleben“ und das „schlechte Gewissen, wenn ich an mich selbst denke“. Da sind die Gedanken, „dass eine Zeit kommen könnte, in der ich über mein Leben verfügen kann“ und zugleich das innere „Verbot, über positive Folgen seines Todes nachzudenken“. Da sind Erschöpfung und Groll, Verzweiflung und Selbstbeschwörung und vor allem die Einsicht, dass man niemals Herr über sein Leben ist, auch wenn man sich noch so sehr darum bemüht hat. Doch gelingt es der Autorin an hellen Tagen auch, sich vom „Fluch der falschen Harmonie“ zu lösen und immer wieder Momente der Ruhe zu finden in Gegenwart ihres Mannes, den sie beobachtet: „Ein bisschen Sahnejoghurt im Schatten, eine Amsel singt, Stille. So darf ein Leben doch ausatmen.“
Der Glaube an den Wert der Schöpfung besitzt in diesem Buch eine ziemlich selbstverständliche, allgegenwärtige Präsenz. So klingt es beinahe nach Erlösung, wenn Helga Schubert mit dem vertrauensvollen Satz schließt: „Und der morgende Tag wird für das Seine sorgen.“
JULIA KOSPACHMein Papa war in der Napola
Im Medium der (Auto)Fiktion arbeiten Ulrike Draesner und Paul Brodowsky ein Stück deutscher Vergangenheit auf

Deutschland, so behaupten böse Zungen, wurde nach dem Krieg von den Flüchtlingen aus den Ostgebieten wiederaufgebaut. Wurden die Tragödien aus Ostpreußen und Schlesien lange Zeit nur in einschlägigen Kreisen erzählt, so befassen sich gleich zwei aktuelle Romane von Autoren aus der Kinder- und Enkelgeneration mit den langen Schatten der Vergangenheit: deutsch-polnische Familiengeschichten, in deren Zentrum Napola und Lebensborn stehen, von denen zwar jeder schon gehört hat, über deren Untaten aber niemand so recht Bescheid weiß.
Ulrike Draesner, 1962 in München geborene Lyrikerin, Schri stellerin und seit 2018 auch Professorin am Leipziger Literaturinstitut, hat bereits in „Sieben Sprünge vom Rand der Welt“ (2014) von Flucht und Vertreibung aus Schlesien erzählt, woher auch ihr Vater stammte.
Dorthin, nach Wrocław/Breslau, führen auch „Die Verwandelten“. Kinga, Alleinerzieherin der Adoptivtochter Flummy, ist Expertin in Sachen Leihmutterscha und Erbrecht, reist im Zug, um einen Vortrag zu halten, und sinniert: „Auch Mutter hatte geerbt. Sie war, wie man so sagt, nach
Ulrike Draesner: Die Verwandelten. Roman. Penguin Verlag, 608 S., € 27,50

oben gefallen. Doch nicht durch eine Heirat, sie hatte nie geheiratet, sondern als Kind. Auch darüber wollte, ja musste ich heute Abend sprechen. Deutschland. Polen, Lebensborn.“
Aufgabe des Nazi-Vereins Lebensborn, der in ganz Europa Kinderheime unterhielt, war es, die Geburtenzahl „arischer“ Kinder zu erhöhen – Menschenmaterial für kün ige Kriege. Kingas Mutter Alissa war als Tochter eines von ihrem Dienstherren geschwängerten Mädchens in einem Lebensbornheim in Bayern zur Welt gekommen. Sie wurde von den braven Nazis Gerda und Gerd Schücking adoptiert, die sie Gerhild nannten.So weit nur ein kleiner Ausschnitt aus der komplizierten Familiengeschichte und dem nicht weniger verwirrenden Romanau au – in der Folge werden die einzelnen Kapitel aus der Perspektive der Protagonisten erzählt.
Kingas „Überraschungsverwandte“
Weltherrscha sicherzustellen. Auch er floh – wenn auch aus Ostpreußen – zu Kriegsende in den Westen.
Paul Brodowsky: Väter. Roman. Suhrkamp, 304 S., € 24,70

Dorota, geborene Dombrowska, vermittelt einen Besuch in Wrocław, wo Alissa bei einem Strick- und Stickkränzchen auf Walla trifft. Auch sie ist ein Lebensbornkind, entpuppt sich darüber hinaus aber noch als Alissas Halbschwester, die einst Renate Valerius hieß. Als die deutschen Eltern bei Kriegsende aus Breslau vertrieben wurden, verweigerte sie die Flucht und wurde zur „Vollpolin“, die schließlich vier Kinder von mehreren Männern gebar, eines davon die besagte Dorota.
Auf Ulrike Draesners Roman passt Musils Wort über den „Zauberberg“: „Ein Haifischmagen, der alles verschlingt“. In diesen Magen passen: die Biografie von Alissas Nazieltern (in aller Ambivalenz); Betrachtungen über ein Bild des aus Breslau stammenden Malers Adolph Menzel; Berichte von Krieg und Vertreibung; Reflexionen über patriarchale Gewalt und Mutterscha – das Ganze durchsetzt mit schlesischen Ausdrücken samt Worterklärungen.
Draesner beschreibt die Exzesse des Jahres 1945 nie direkt, bedient sich stattdessen wortgewaltig bei Ovids Metamorphosen, was zu manch kühner Metapher führt: „Die Geschändete trug eine schwarze Sonne im Mund. Jeden Augenblick konnte sie explodieren.“ Letztes Bild des kunstvoll-gewichtigen Romans: Eine Frau sitzt am Ufer der Weichsel, ein Tag beginnt, Singvögel legen sich mächtig ins Zeug.
Fast eine Generation jünger als Draesner ist der 1980 geborene Paul Brodowsky, Mitbegründer der Literaturzeitschri BELLA triste, Theaterautor und mittlerweile ebenfalls Lehrer – an einer Berliner Schreibschule. Seine Recherche zu seinem aus Masuren stammenden Senior ist aber nicht weniger schillernd. Der alte Brodowsky, Jahrgang 1932, war Schüler der Nationalpolitischen Lehranstalt, kurz Napola, die gegründet worden war, um den „nationalsozialistischen Führernachwuchs“, die Elite der kün igen Nazi-
Paul Brodowsky erzählt in „Väter“ unverhüllt autobiografisch: Noch nie habe er den Vater so ausgelassen tanzen gesehen wie bei dieser Hochzeit. Schnitt. Der Erzähler führt im Ferienhaus in D. ein Interview mit seinem Vater und bekommt dessen Ahnenpass zu sehen. En passant wird auch erwähnt, dass es in der Familie eine jüdische Großmutter gegeben habe. Schnitt. Der Wecker klingelt, nein, es ist Julias Handy, aber nicht die Ehefrau liegt neben dem Erzähler im Bett, sondern Tochter Anouk. „Ich schalte das Küchenradio an, Deutschlandfunk, setze den Kaffee auf, gieße Sojamilch in den Milchschäumer, gehe ins Arbeitszimmer und wecke Julia.“ Windel wechseln, Sohn Milan spielt mit Feuerwehrautos, Anouk weigert sich, ihre Seidenleggings und das Wolle-Seide-Shirt anzuziehen.
Auf den folgenden 300 Seiten erfahren wir noch viele mehr oder weniger interessante Details aus dem autofiktionalen Schri stelleralltag. Brodowksy erzählt gleichförmig solide, o bis zu lähmender Ermüdung. Kein Wunder, dass im Corona-Alltag härterer Stoff vonnöten ist, eine Nazigeschichte, die bis in die nächste Generation nachwirkt: „Eigentlich möchte ich wissen, was für Prägungen mein Vater als Kind bekommt, welche Traumata er erfährt, um für das Buchprojekt, an dem ich arbeite, zusammenzutragen, wie ich selbst durch diese Traumata geprägt bin, auch wenn ich ihm das so nicht sage.“
Die endlosen Reflexionsschleifen des Erzählers, das systematische Durchforsten der eigenen Kindheit und Jugend nach etwaigen Traumata, werden allerdings allmählich durch Selbstironie abgelöst. Das führt zu pointierten Beobachtungen, etwa wenn es über den bundesrepublikanischen Umgang mit der Nazivergangenheit heißt, dass die Leute meist ganz erpicht darauf seien, „irgendwo in der Vorgeschichte jüdische Vorfahren zu entdecken oder zu konstruieren, um sich gewissermaßen reinen Gewissens auf die Seite der Opfer oder Nachfahren der Opfer schlagen zu können.“
Bei den Brodowskys läu es freilich anders. Da findet Paul nun heraus, dass Onkel Walter Mitglied der NSDAP und an einer Ermordung beteiligt war, und auch der Vater erinnert sich daran, dass er damals in seinem ostpreußischen Heimatdorf sprachlos dabei zusehen musste, wie ein junger Mann, den er für einen Juden hielt, von den Nazis aus einem Geschä hinausgeprügelt wurde.
„Väter“ endet fast so, wie es begonnen hatte: Der Erzähler verfällt wieder in Dauerreflexion, das Vorhaben, das Buch abzuschließen, sei undurchführbar. Und: Er beginnt zu weinen.
ERICH KLEINWie man zum Mann wird
In „Young Mungo“ erzählt Douglas Stuart eine schwule Coming-of-Age-Geschichte – deprimierend und grandios zugleich

odie und ihr jüngerer Bruder haben die Ohren am Teppich, die Hintern in der Höhe. Aus der Wohnung unter den Hamiltons dringt das Wimmern von Mrs. Campbell, die gerade von ihrem betrunkenen Mann verprügelt wird, nachdem die Rangers das Derby gegen Celtic verloren haben. „Mach was, Mungo!“, fleht Jodie den 15-Jährigen an, dessen Ratlosigkeit sie auf die Palme bringt: „Kannst du nicht einmal deinen Mann stehen?“
Es wird wieder an der ebenso smarten wie beherzten Jodie sein, deeskalierend einzuschreiten und die misshandelte Nachbarin mit einer List aus der Reichweite ihres prügelnden Mannes zu locken. Also Jodie sich über diese Manifestation toxischer Männlichkeit echauffiert, kriegt sie aber was zu hören: „So naw, Jodie Hamilton, it’s not about the fitba. It’s not about if he likes a wee drink, or doesnae like ma cookin’. Ye’re nothin’ but a pair of da weans.“
So liest sich die Tirade, in der Mrs. Campbell ihren Mann verteidigt, der 27 Jahre lang in der Wer einer lebensbedrohlichen Arbeit nachgegangen war, ehe diese geschlossen und er entlassen wurde, im englischen Original. Glaswegian ist die vielleichst sperrigste Spielart des an sich schon nicht ganz unsperrigen schottischen Idioms, aber es hat seinen eigenen Charme; und hat man erst einmal geschnallt, dass mit „fitba“ „football“ gemeint ist, hat man den Sound bald im Ohr. Die Übertragung ins Deutsche kann da nur scheitern: „Und was hamse gekriegt für die ganze Maloche? Sind auffe Straße gesetzt worden von irgendwelchen Anzugsheinis aus Westminster, die Glasgow nich mah auf der Landkarte finden.“
Wie seine Protagonisten stammt der heut in New York lebende Douglas Stuart aus Glasgow und wuchs in dem Milieu auf, das er schon in seinem grandiosen, 2020 mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman „Shuggie Bain“ beschrieben hat. „Young Mungo“ spielt ein paar Jahre später in den frühen 1990ern, bleibt aber nicht nur dem

Die hohe Kunst Douglas Stuarts und das Ethos seines Schreibens besteht darin, sich nie dem sauren Kitsch dunkelschwarzer Desillusioniertheit zu überlassen
Schauplatz, sondern auch der familiären Konstellation treu: Wieder ist der Titelheld das jüngste von drei Geschwistern, Sohn einer schwer alkoholkranken, alleinerziehenden Mutter; schuld an der Abwesenheit des Vaters trägt diesmal freilich kein Beziehungsdrama, sondern schlicht der Tod: Kurz, nachdem er mit seiner Frau zusammengezogen war, wurde er von den blutjungen Angehörigen einer Gang abgefeitelt; Mungo hat nicht einmal ein Foto von ihm zu Gesicht bekommen.
Fast hat es den Anschein, als wäre Stuart dem Motto von Leonard Cohens Abschiedsalbum gefolgt: „You want it darker? We’ll kill the flame.“ Ein viel düstereres und grausameres Setting hätte sich der Autor für seinen Titelhelden nicht ausdenken können – einen san mütigen Burschen, der sich mehr fürs Zeichnen als für Fußball und nicht sonderlich für Mädchen interessiert; etwas, was die Mutter, Mo-Maw genannt, „ernstha beunruhigt“, wohingegen ihr der Umstand, dass ihr Ältester eine 15-Jährige geschwängert hat und die Tochter womöglich von der Schule fliegt, herzlich egal zu sein scheint.
Also verfällt Mo-Maw auf die Idee, Mungo der Obhut zweier Ex-Knackis zu überlassen, die sie von den Anonymen Alkoholikern kennt, damit die gemeinsam „Männersachen“ unternehmen. Der Plan erweist sich als genauso bescheuert, wie er klingt, ja schlimmer noch. Der gemeinsame, von reichlich Whisky und Dosenbier begleitete Angelausflug gerät zum Horrortrip nicht nur, weil es Katzen und Hunde regnet und die drei Hobbyfischer hoffnungslos schlecht ausgerüstet sind, sondern auch, weil sich die beiden kaputten Typen sexuell an Mungo vergehen – was sie selbstverständlich noch lange nicht zu „Schwuchteln“ macht.
Die hohe Kunst von Doulas Stuart und das hohe Ethos seines Schreibens besteht darin, sich nie dem sauren Kitsch dunkelschwarzer Desillusioniertheit zu überlassen. So beschert der in eine Spirale der Ge-
walt mündende Ausflug, bei dem Mungo nicht nur zum ersten Mal in seinem Leben einen See sieht, sondern überhaupt aus Glasgows Eastend rauskommt, auch Momente euphorischer Exaltation und den Lesern Landscha sschilderungen von leuchtender Erhabenheit.
Auf der zweiten, dem Angelausflug vorausgehenden und diesen überhaupt erst initiierenden Erzählebene spinnt sich – zögerlich und zart – eine Liebesgeschichte an. Es handelt sich quasi um einen Romeound-Julius-Plot, denn James Jameson, so sein tatsächlicher Name, widmet sich nicht nur mit einiger Passion der nicht eben als hyperviriles Hobby geltenden Taubenzucht, er ist zu allem Überfluss auch noch Katholik und eines der bevorzugten Opfer von Mungos älterem Bruder Hamish, einem brutalen und sadistischen Tunichtgut, der mit Suppenwürfeln gestreckte Drogen an ahnungslose Erstsemestrige mit zu viel Taschengeld vercheckt.
Gewalt ist in „Young Mungo“ nicht nur allgegenwärtig, sie ist ein Freizeitvergnügen und für Typen wie Hamish, der von den Chargen der protestantischen Gang, die er befehligt, nur „Ha-Ha“ genannt wird, so ziemlich das einzige. In der streng binären Welt, die er und seinesgleichen aufrechtzuerhalten suchen, gibt es stets nur zwei Optionen: Mann oder Schwuchtel, Protestant oder Katholik, Rangers oder Celtic (kleine konfessionsballesterische Eselsbrücke: Celtic = c atholic).
So ziemlich alles, was schlimm ausgehen kann, geht in „Young Mungo“ auch schlimm aus. Und dennoch wird man in der zeitgenössischen Literatur nicht viele Romane finden, die so subtil und hartnäckig an die Kra von Liebe, Empathie und Solidarität festhalten wie jene von Douglas Stuart –und nicht viele Figuren, die einen so berühren wie Jodie Hamilton. Neben allem anderen ist „Young Mungo“ nämlich auch noch ein großer Schwesternroman.
Die Ho nung stirbt zuerst
„Glory“ ist eine orwelleske Satire auf die postkoloniale Geschichte der Heimat der Autorin NoViolet Bulamayo
J
idada ist der Name für ein Tierreich, das – inspiriert von George Orwells
„Animal Farm“ – Züge einer politischen Farce trägt. Die seit 1999 in den USA lebende, aus Simbabwe stammende Autorin NoViolet Bulawayo arbeitet in ihrem Roman die postkoloniale Geschichte ihrer Heimat auf: Das „Alte Pferd“ ist ein Despot, der glaubt, sogar die Sonne befehligen zu können, während dessen „Erstes Waipchen“ sich dank eines als „Geschenk“ eingeforderten Doktortitels „Dr. Sweet Mother“ nennen lässt.
Der „Vater der Nation“ wird nach Jahren des Leids durch einen Staatsstreich abgesetzt, das Volk der vielen verschiedenen Tiere jubelt. Die manipulierten Wahlen bescheren aber nicht den Oppositionskrä en den Sieg, sondern dem auch von der Kirche hofierten „Erlöser“ Tuvius Delight Shasha, der davor das Amt des Vizepräsidenten innehatte.
Alle zuvor gemachten Versprechungen auf „Business“ und Demokratie entpuppen sich als heiße Lu Die alten Muster, verkörpert durch Minister für Korruption, Desinformation, Plünderung oder auch für nichts kehren in der fleißig beworbenen „Neuen Ordnung“ zurück und befeuern bald wieder die Unzufriedenheit der Massen, die nun – schon wieder – mit einer maroden Wirtscha konfrontiert sind.
Die Rhetorik des mit viel Spo gezeichneten ruinösen Polizeistaats mit mafiösen Strukturen changiert zwischen ritueller Verteufelung der verjagten Kolonialmächte, Beschwörung der Revolution und Umgarnung auslän-
Eine kurze Geschichte
über das Töten
Mathias Enard erzählt seinen frühen Roman „Der perfekte Schuss“ aus der Perspektive eines Snipers
discher Investoren. In dieses Panorama fügt sich eine Figur ein, die man als Stellvertreterin der Autorin lesen könnte: Destiny, eine junge Ziege, kehrt aus dem Exil zurück und erforscht die mörderische Gewalt, die die als Hunde vorgestellten Schergen des Regimes ihrer Familie angetan haben.
Erzählt werden diese Traumata in einer vibrierenden, aufrührerischen Form, die vor dem Elend, der Wut und den Lebenslügen einer Gesellscha nicht kapituliert. „Glory“ entwickelt einen fiebrigen, überschäumenden Sound, in dem Kühe twerken, Gerüchte trenden und Tote nicht tot sind. Durchwirkt wird dieser wilde Mix von eingeschobenen politischen Meinungsgefechten aus den sozialen Netzwerken. Dazu gesellen sich teils ins Absurde lappende Aufzählungen oder seitenlange Wiederholungen hervorgehobener Satzteile, die zumeist etwas ziemlich Üblem Nachdruck verleihen.
Einmal ist auch von einem ausländischen Video die Rede. Fast eine ganze Seite lang wird daraus, stellvertretend für alle Jidadas dieser Welt, ein Satz zitiert: „I can’t breathe“.
THOMAS EDLINGER

Mit zwei gewichtigen und virtuosen Werken hat Mathias Enard, Jahrgang 1972, in den letzten Jahren Publikum und Kritik überzeugt. Für den verspielten Gelehrtenroman „Kompass“ erhielt er 2015 den Prix Goncourt. Bereits 2008 hatte er in dem mindestens so beeindruckenden, interpunktionslosen Erzählfluss „Zone“ den Mittelmeerraum als eine „ausgeweitete Kampfzone“ dargestellt. Der nun in deutscher Übersetzung, im französischen Original bereits 2003 erschienene Text „Der perfekte Schuss“ kann als Präludium zu dieser breiten Kriegsschilderung verstanden werden.
Der Scharfschütze, der als Protagonist und Ich-Erzähler im Zentrum des Geschehens steht, könnte eine Figur aus den Balkankriegen sein. Die Biografie des Autors legt allerdings nahe, ihn im Libanon zu verorten: Enard hat jahrelang im Nahen Osten, und da vor allem in Damaskus und Beirut gelebt. Erzählt wird also aus der Innensicht eines Snipers; eines verkommenen Individuums, geformt durch eine von Gewalt und den Wahnsinn der Mutter bestimmte Kindheit.

des geduldigen Zielens, der lautlose Tod des anvisierten Objekts. Die brutale Perversität des Erzählers macht beim Lesen zunächst wenig Freude, durch die konsequent eingehaltene Ich-Perspektive besteht die Versuchung, den Autor dafür verantwortlich zu machen. Und bei der bloßen Inhaltsangabe könnte leicht der Verdacht entstehen, man hielte ein Landser-He in der Hand, das Hardcore-Gelüste für Sex and Crime bedient.
Nach vollbrachter Lektüre scheint die Veröffentlichung dieses Prosaerstlings allerdings als gerechtfertigt: eben als „Vorschau auf die „Zone“, aber auch im Hinblick auf die ihm eigene literarisch Qualität. Der Text beweist Enards Gefühl für Struktur und Rhythmus, das sich auch der Beschä igung mit Lyrik verdankt, gleich mit dem ersten Satz: „Das Wichtigste ist der Atem. Das ruhige und langsame Ein- und Ausatmen, die Geduld des Atems.“ Es lohnt sich also genauer hinzusehen, auch, weil es Sabine Müller gelingt, in ihrer Übersetzung das pneumatische Pulsieren des Originals nachfühlbar zu machen.
Noviolet Bulawayo: Glory. Roman. Aus dem Englischen von Jan Schönherr. Suhrkamp, 460 S., € 25,70
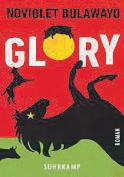
Die desaströse familiäre Situation ist eingebettet in die hysterische Atmosphäre eines chaotischen Mehrfrontenkampfes. Kurz scheint ein 15-jähriges Mädchen menschliche Regungen zu wecken. Doch auch in dieser Situation obsiegt die Gewalt. Die einzige Ordnung, die der Protagonist kennt, ist die (militärische) Unterordnung, seine einzige Freude die „Vollkommenheit des Schusses“ –der kontemplative Akt des Anlegens,
Ich würde so weit gehen zu behaupten, dass Ich wünschte der bewegendste Liebesroman ist, den ich je gelesen habe. Selten hat mich ein Stück Prosa so durchstrahlt, so erschüttert und beglückt.
– Clemes J. Setz –
Cooper ist ein brillianter, außergewöhnlicher und provokanter Autor sowie ein äußerst origineller, eleganter Stilist, dessen Prosa klug und kühn ist. Er ist vielleicht auch der letzte literarische Outlaw in der amerikanischen Mainstream-Literatur.
– Bret Easton Ellis –
THOMAS LEITNERMathias Enard: Der perfekte Schuss. Roman. Aus dem Französischen von Sabine Müller. Hanser Berlin, 192 S., € 24,70

Aus dem amerikanischen Englisch von Raimund Varga Roman, Hardcover, 144 Seiten ISBN 978-3-903422-21-6

Zwischen Mittagspause und Apokalypse
Éric Vuillards Kurzroman „Ein ehrenha er Abgang“ inszeniert den Vietnamkrieg als Wimmelbild
Offenbar misstraut Éric Vuillard der Geschichte und glaubt eher an die Literatur. Historiografie ist, und meint sie es noch so ehrlich, immer parteiisch; literarisch in Szene gesetzt, vermitteln Täter und Opfer, Schuld und Verhängnis zumindest eine Ahnung höherer historischer Wahrheit und moralischer Gerechtigkeit.

Vuillard nun hat in den letzten Jahren eine Reihe kurzer, konzertierter Romane geschrieben, die von Wendepunkten und Katastrophen der Weltgeschichte handeln: Der Bogen spannt sich von der Eroberung des Inkareichs durch Francisco Pizarro über die Französische Revolution und die Berliner Kongokonferenz bis zur quälend langen Niederlage Frankreichs und der USA in Vietnam. Davon handelt sein jüngster Roman, sarkastisch betitelt „Ein ehrenha er Abgang“.
In seiner Bauweise ähnelt der Roman seinen Vorläufern: Der Erzähler durchschaut die Machenschaften der Mächtigen und gibt sie der Lächerlichkeit preis, während seine ganze Empathie den Opfern der Geschichte gilt. Das passt nicht schlecht zu einem Autor des Jahrgangs 1968, der von sich erzählt, dass er noch ein Baby war, als ihm seine Eltern die Barrikaden der Demonstranten auf den Straßen von Lyon zeigten. Solchermaßen engagierte Literatur ist nicht neu. Man sollte ihr au lärerisches Potenzial ganz bestimmt nicht überschätzen.
Bei Vuillard kommt allerdings noch mehr dazu als der Anspruch, den Opfern der Geschichte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: Er kann verdammt gut schreiben, und dass ihm hier und da sein geschichtspädagogischer Ehrgeiz in die Quere kommt, sieht man ihm bald nach.
Am 19.Oktober 1950, ein gutes Vierteljahrhundert vor der Niederlage der Amerikaner in Saigon, debattiert die Assemblée Nationale über die Lage in Vietnam, und zum ersten Mal werden Stimmen laut, die das koloniale Unrecht einräumen, Friedensverhandlungen mit der vietnamesischen Unabhängigkeitsbewegung ins Spiel bringen – und damit den Zorn der nationalen Rechten auf sich ziehen.
Fast ein Viertel des Buchs nimmt die Schilderung dieser Debatte ein,
die Mittagspause in einem edlen Restaurant eingeschlossen. Die Abgeordneten, die Vuillard ans Rednerpult treten lässt, beschreibt er mit einem Witz, mit einer Genauigkeit und einer sprachlichen Virtuosität, die an Daumier ebenso wie an Zola denken lässt. Die wenigsten werden die Namen der damaligen Akteure kennen, aber dem Autor gelingen derart einprägsame Porträts, dass die historischen Figuren als Romanpersonal von eigener Kra durchgehen.
„Es ist so schwer, ein Gesicht zu beschreiben, diese Mischung aus Fleisch und Denken“, heißt es an einer Stelle. Vuillard fällt das gar nicht schwer, und er hat auch ein besonderes Auge für die Körper, für die fülligen der französischen Bourgeoisie („Endlich im Restaurant angelangt, quetscht das alte Bison nach einigen pantagruelischen Bewegungen des Oberkörpers seinen fetten Popo zwischen die Sesselhenkel und käut wieder“) und für die gequälten ihrer Opfer („Der Vietnamese war ausgemergelt, dem Tode nahe, gezwungen, sich zwischen den Direktoren und zwei Unbekannten, deren Sprache er nicht beherrschte, aufrecht zu halten“).
Vor dem inneren Auge erscheinen bei solchen Schilderungen spätmittelalterliche Wimmelbilder der Apokalypse. Auch diese visuell hoch aufgeladene Sprache verdichtet sich zu Gemälden, die die Ungeheuerlichkeiten der modernen Gewaltgeschichte –nicht nur der Kriege in Indochina –in sich aufnehmen.
Vuillard wird immer wieder dafür gerühmt, den Opfern der Geschichte zur Sprache zu verhelfen. Damit ist er nicht allein. Man wird aber lange nach einem literarischen Werk suchen, das auf die Sprachlosigkeit angesichts historischer Gewalt mit derart schlüssigen Bildern antwortet.
TOBIAS HEYL„Was suchst du, Wolf?“ von Eva Viež naviec liefert eine kurze Geschichte der Gewalt ihrer Heimat Belarus
Der erste Satz gibt den Takt vor: „Wenn du in der öffentlichen Toilette den Korken der Weinflasche mit dem Schlüssel eindrückst und ihn ableckst, damit kein Tropfen verloren geht, brauchst du dich vor nichts mehr fürchten.“ Die belarussische Schri stellerin Eva Viežnaviec schreibt, als würde sie Pflöcke in die Erde schlagen. Präzise und mit voller Kra . Die Sätze sind unverrückbar, lassen weder Abschwächung noch Missverständnis zu. In „Was suchst du, Wolf?“ jagt die Autorin die Leserinnen und Leser durch die belarussische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig eröffnet sie dem Publi-
»Die Geschichten und die Toten, die der Sumpf birgt, sind allgegenwärtig. Doch das Böse lauert anderswo
kum eine mythenverhangene Welt aus Hexereien und Heilungen.
Ryna, über 40, kehrt in ihr Heimatdorf Nauhalnaje zurück, das in einer mittlerweile trockengelegten Sumpflandscha im Südwesten von Belarus liegt. Ihren Job als Altenpflegerin in Deutschland hat sie wegen des Trinkens verloren. Dann starb ihre Großmutter, die Heilerin Darafeja, bei der sie aufgewachsen war.
Der Sumpf ist gleichsam der stille Protagonist des Romans: Seine Weite, seine Gefahren, die Geschichten und die Toten, die er birgt, sind allgegenwärtig. Doch das Böse lauert anderswo: „Unsere Sümpfe waren zwar furchteinflößend, doch sie haben nie so viele Menschen geholt wie die Menschen selbst“, sagt die Großmutter.
Da Marjanka und Darafeja übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben wurden, blieben sie von der Brutalität der Männer weitgehend verschont. Man fürchtete ihre Krä e und war auf sie als Heilerinnen angewiesen.
Darafeja erzählt ihrer Enkelin von den wechselnden Machthabern nach dem Ersten Weltkrieg, etwa den Deutschen, den Polen, den Russen und ihrem Vater, dem grausamen Sauka Bahalewitsch. Der Antisemitismus einte sie alle. „Lesjar aus Asnitschki wird sagen: ‚Sieben Mächte, dicht an dicht, die Knochen der Juden zählst du nicht‘.“ Darafeja und ihre Großmutter versteckten eine Jüdin und deren Sohn im Keller.
„Glücklich waren die, die einfach eine Kugel in die Stirn bekamen! So ist das hier bei uns in Lipjen Mode – wenn was ist, dann wird misshandelt: Arme und Beine ausrenken, dass es knirscht, Augen ausstechen, Haut streifenweise abziehen und Salz darüberstreuen.“
Dann kamen die Sowjets, danach die Nationalsozialisten. Ihre Widersacher gingen als Partisanen in die Wälder. „Sie holten alle Ochsen, Kühe und Pferde – was die Deutschen nicht nahmen, nahmen die Partisanen“, erzählte die Großmutter. „Als Mann konnte man nur im Wald überleben. Wir, die Frauen, Alten und Kinder, waren für alle Futtervieh.“ Überall grassierten Geschlechtskrankheiten, Frauen suchten Marjanka und Darafeja auf und baten um einen Abtreibungstrank.
Eva Viežnaviec erzählt mit „Was suchst du, Wolf?“ nicht nur die Geschichte ihrer Heimat, die hierzulande weitgehend unbekannt ist, sondern auch eine universelle Geschichte der Gewalt und Unterdrückung. Jedoch nicht der Hoffnungslosigkeit. Ein Roman der Stunde.
STEFANIE PANZENBÖCKÉric Vuillard: Ein ehrenha er Abgang. Aus dem Französischen von Nicola Denis. Ma hes & Seitz, 139 S., € 20,60
Viežnaviec lässt in „Was suchst du, Wolf?“ die Frauen zu Wort kommen: die Großmutter Darafeja, in deren Erzählung wiederum deren eigene Großmutter Marjanka eine wichtige Rolle spielt, und Darafejas Enkelin Ryna.

„Wenn was ist, dann wird misshandelt“Eva Vie ž naviec: Was suchst du, Wolf? Aus dem Belarussischen von Tina Wünschmann. Roman. Zsolnay, 144 S., € 22,70
An der Grenze Polens stinkt es ganz gewaltig
In seiner „Grenzfahrt“ entlang des Bug verbindet Andrzej Stasiuk Reportage und Fiktion, Gegenwart und Vergangenheit
Juni 1941 im Osten Polens, am Ufer des Bug. Seit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt verläu hier die Grenze zwischen den von Deutschland und den von der Sowjetunion besetzten polnischen Gebieten.
Kurz vor Beginn des deutschen Angriffskrieges am 22. Juni herrscht am Bug nervöse Ruhe. Die Landscha liegt schläfrig da wie immer, aber die Einschläge kommen näher. Der Fährmann Lubko bringt, wenn der Mond nicht zu hell scheint, zahlende Kundscha über den Fluss. Doris und Max sind auf der Flucht, sie wollen nach Birobidschan, in die jüdische autonome Region in Sibirien. Aber Lubko findet die Überfahrt zu gefährlich.

Diesseits des Flusses hat sich deutsche Artillerie in Stellung gebracht. Durchs Gelände streifen polnische Partisanen und jagen Spione, am russischen Ufer herrschen der NKWD und ein großes Durcheinander. Die Kleinbauern finden es auf der deutschen Seite noch erträglicher. Hier können sie wenigstens Fisch, Speck und Milch gegen deutsche Zigaretten und Kaffee tauschen. Nicht weit entfernt sind auch die deutschen Vernichtungslager Sobibór und Treblinka, aber davon wissen die Figuren in Andrzej Stasiuks Roman „Grenzfahrt“ wenig. Wie kann es sein, dass sie den Geruch der „brennenden, schwarzen Gruben“ nicht wahrgenommen haben, fragt sich der Erzähler.
Die Zeugen sind tot, sie haben nichts hinterlassen, und in seiner väterlichen Familie, die am Fluss lebte, hat man, wie der Erzähler sich erinnert, zwar manchmal über den Krieg gesprochen, aber nie über den Geruch der Krematorien. Der Vater ist inzwischen 84, er leidet an Demenz und will über gar nichts mehr reden. Wie kommt man dann erzählerisch in die Situation am Bug im Jahre 1941 hinein? Oder anders: Wie kommt man raus aus der polnischen Situation des Corona-Jahres 2020, wenn man nach dem Lockdown dringend mal wieder eine Ausfahrt braucht?

Andrzej Stasiuk hat in den letzten Jahren einige Bücher geschrieben, in denen er, allein im Auto, mit wenig mehr als Zelt, Campingkocher und gelegentlich einem Dosenbier, abgelegene Gegenden wie die Mongolei erforschte. Hier nun verbindet er das Reportage-Element mit der historischen Fiktion. Ein Mann, der wenig Gesellscha braucht, streunt auf den Spuren der familiären Erinnerung am Ufer des heimatlichen Flusses herum und stößt dabei auf wenig mehr als auf die Banalitäten der Gegenwart. Die Vergangenheit erschließt sich, wenn überhaupt, nicht durch Spurensuche, sondern nur durch eine träumerische Einbildung.
In Stasiuks Zugriff entfaltet sich an den Ufern des Bug eine gespannte Atmosphäre, in der das zarte Dasein der Bäume und Wolken überfallartig von Gewalt und Gräueln unterbrochen wird. Aber auch die Natur ist nicht freundlich, der Fluss schlammig, übelriechend und tückisch wie ein böser Styx, der die eine Unterwelt nur von der nächsten trennt.
Stasiuk ist kein Anwalt der Psychologie, des Gesprächs und der friedlichen Umgangsformen. Die mehr oder minder uniformierten Männer im Roman sind impulsgesteuert, ihr Modus ist die Attacke, ob sie nun Schweine schlachten, Spione hängen oder Frauen vergewaltigen – ehe dann Stasiuk auch die Brutalität wieder durch überraschend zarte Momente bricht. Die Männerfiguren reden nur das Nötigste miteinander, deshalb muss man ihnen ihre Motive und Gedanken geradezu hinterhertragen.
Andere Autoren hätten für solche Zwecke lang verschollene Kriegstagebücher eroder gefunden, aber solche erzählerischen Manöver interessieren Stasiuk nicht. Das lange und lose Monologisieren der Figuren hat manchmal etwas Satirisches, etwa wenn ein sturzbetrunkener polnischer Partisanenhauptmann am Wirtshaustisch über Polens historischen Au rag ins Schwadronieren gerät: „Unsere Mission! In der barba-
Andrzej Stasiuk: Grenzfahrt.

Roman. Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall. Suhrkamp, 355 S., € 26,50
rischen Steppe. Zwischen den teutonischen Barbaren und den tatarischen Wilden.“
In solchen Passagen sendet Stasiuk Signale in die polnische Gegenwart. Vom neu erwachten Polentum der PIS-Regierung wendet er sich mit Grausen ab, mit der eher liberale Opposition fängt er auch nichts an. Auf seinen Reisen wird der Erzähler Zeuge des polnischen Präsidentscha swahlkampfs 2020. Auf den Plakaten werben zwei Kandidaten für sich, die Stasiuk nur den „Schönling“ und den „Tölpel“ nennt.
Man wird schwer einen Roman finden, in dem es so andauernd und vielfältig stinkt wie hier, in dem ein solcher Reichtum übler Gerüche erzeugt wird. Mal riecht man den kleinstädtischen „Rauch, den Schweinemist, den Gestank der Aborte, den Staub“, dann sind es Schweiß, Schweine- und Menschenblut, Innereien und Dreck aller Art.
Nur den fettigen Geruch aus den Gruben riechen die Figuren nicht. Warum nicht? Obwohl es doch, so drückt es der Erzähler in einer seiner fiebrigen Suaden aus, „polnische Huren“ gewesen seien, die „die Nachrichten aus der Hölle verbreiteten“: „Halbnackt, gefickt, blind vor Grauen, Schnaps und Erregung, sagten sie die Wahrheit.“ Aber diese Wahrheit ist bei seiner Familie nicht angekommen, sein Vater will sich an nichts mehr erinnern, und das Land hat sich eine historische Teil-Amnesie verordnet. Es will von seiner Geschichte nur noch in der heroischen Version wissen.
Auf seinen Reisen fallen dem Erzähler neue Denkmäler auf: Sie ehren jetzt das Andenken der „verfemten Soldaten“ des antikommunistischen Nachkriegs-Widerstands. Was wollen die Deutschen eigentlich am Bug, wo es hier doch gar nichts gibt, fragt ein polnischer Partisan einmal den anderen. Sie seien hier, weil sie es können, entgegnet der andere. „Weil es draußen still ist und in den Häusern stinkt.“ Diese Stille und diesen Geruch nimmt Andzej Stasiuk noch immer wahr.
CHRISTOPH BARTMANNKann man das Leben anderer zum Guten wenden, während das eigene entgleitet?
Schrecken, Schnecken und Schlemihls Schatten

Mit „Der Scha en im Exil“ ist dem Rumänen Norman Manea ein bewegender Roman über ein beschädigtes Leben geglückt
Peter Schlemihl verkau dem Teufel seinen Schatten gegen einen stets vollen Beutel Gold. Die Schattenlosigkeit aber macht ihn zu einem Ausgestoßenen. Seine Seele gegen den Schatten einzutauschen, wie ihm der Teufel vorschlägt, lehnt Schlemihl ab. Stattdessen erwirbt er Siebenmeilenstiefel und eilt um die Welt. Der Mann ohne Schatten geht schließlich ganz im Studium der Natur auf.
Diese 1814 erschienene Erzählung Adelbert von Chamissos dient dem rumänischen Schri steller Norman Manea als partielle Matrix für seinen großen Roman. Wie Chamisso, der französische Flüchtling vor den Stürmen der Französischen Revolution, der die Sprache seines Zufluchtslandes annahm, sieht sich Manea, geboren in der Bukowina, Überlebender der Shoah in Transnistrien, als Schri steller zwischen den Welten: seiner rumänischen Heimat, die seiner Familie Grauenha es angetan hat, und den Vereinigten Staaten, in die er 1986 emigriert ist.
Der collageartig angelegte Roman kreist um den Schrecken der Shoah, den der Protagonist, N. M. genannt, ein zurückgezogen lebender Gelehrter, Spezialist für die Geschichte des Zirkus, nur in seltenen Momenten zu benennen vermag – und dann ist es der infernalische Geruch in den rumänischen Deportationszügen. Er und seine Halbschwester überlebten den Massenmord.
Die beiden verschmelzen in einer inzestuösen Beziehung miteinander, die auch von dem kommunistischen Geheimdienst Securitate nicht entdeckt wird. Schließlich gelangt N.M. mit Hilfe der Schwester in die Vereinigten Staaten, wo beide aber nicht mehr wirklich zueinanderfinden. Der Protagonist erhält nach längerer Su-
che eine Stelle an einem College. Die Schwester nimmt sich schließlich das Leben.
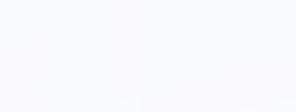
So weit das Skelett einer Handlung, die schnell erzählt ist. Dem Roman geht es aber um anderes: um die Grunderfahrung des Exils, um das Schicksal des Judentums, die Fremde. Meditationen kreisen um das Thema des Schattens: in fiktiven Essays von College-Studenten, die Chamissos Erzählung ausdeuten, oder in einem komplexen Gewebe literarischer Bezüge, das sich von Pindar bis Pessoa spannt.

Es wird viel geschwiegen. Die intensivsten Gespräche werden mit Toten geführt, etwa am Grab der Dante-Forscherin Irma Brandeis, die den Dichter Eugenio Montale zur Figur der Clizia inspiriert hat. Clizia ist so präsent, dass nicht immer klar ist, ob sie nicht doch lebt. Eine weitere Figur, der Rumäniendeutsche Günther, versucht, durch die begeisterte Unterstützung des Kommunismus die Schuld der Deutschen zu sühnen. Wie der Protagonist scheitert aber auch er am byzantinischen Marxismus Rumäniens und geht nach West-Berlin ins Exil. Günther bleibt letztlich ebenso schattenha wie Oberst Tudor, der zynische Securitate-Offizier, der selbst den Therapeuten des Protagonisten als Spitzel rekrutiert hat.



Schemenha bleibt auch die rumänische Heimat. Sie taucht als Schrecknis im Exil des Protagonisten auf: Ceauşescus farbloser Enkel und seine Mutter versuchen, den Exilanten als Integrationshelfer zu gewinnen. Es bleiben vage Bilder von einem Land, dessen Exotik dem Emigranten immerhin ermöglicht, die Aufmerksamkeit amerikanischer College-Präsidenten zu wecken. Vor allem aber bleiben die Trauer und die Angst vor der Ab-

gründigkeit eines Landes der faschistischen Mörder und kommunistischen Spitzel.
Die fast meditative Stimmung des Romans wird immer wieder jäh unterbrochen: durch die Erinnerung an die Shoah, den 11. September, den Selbstmord der Halbschwester. Insgesamt aber dominiert die bewusste Verlangsamung, für die sinnbildlich die Schnecken stehen, an denen der Protagonist geradezu obsessiv interessiert ist. Wie Schlemihl, der sich ebenfalls in die Naturbetrachtung rettet, findet N.M. Phasen der trügerischen Ruhe: Die Schnecken beeindrucken ihn durch die Kunst ihres Liebesspiels, noch mehr aber durch ihre Fähigkeit, sich durch einen ausgedehnten Dämmerschlaf der Realität zu entziehen.
Der Roman strahlt eine tiefe Traurigkeit und Müdigkeit aus, was indes nicht bedeutet, dass der Eros aus dem Leben des Exilanten verschwunden ist. Im Gegenteil, die abgründige Liebe zur Halbschwester, die Innigkeit des Zwiegesprächs mit Clizia, die real existierende Eva Lombardini loten dessen Möglichkeiten in einem durch die Shoah zutiefst verletzten Leben aus. Norman Manea ist ein bewegender Roman über das Ich und dessen Schatten in einem Zeitalter der Verwüstung gelungen.
OLIVER JENS SCHMITTNorman Manea: Der Scha en im Exil. Roman. Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Hanser, 320 S., € 28,80

Roman.“ Tess Gerritsen
Nicht einmal Bilderbücher mit Botschaft brauchen
Eine Leopardin als Busfahrerin, ein Dachs, der seine Höhle ausmistet, Sandkuchenrezepte von John Cage, Hymnen an die Nacht, den Mond und eine nicht zu bändigende

Fantasie: Ein bunter, abwechslungsreicher Bilderbuchfrühling wartet auf Entdeckung
Der Dachs mistet seine Höhle aus und findet so manches, was er nicht mehr braucht: ein Spiel, einen Stein, eine Feder, ja sogar einen Schlüssel. Ob er weiß, dass es dazu einen globalen Trend gibt?
Jedenfalls lösen alle Dinge Erinnerungen aus, trotzdem beschließt der Dachs, sich von ihnen zu trennen. Draußen findet er genug Tiere, die damit noch etwas anfangen können.
Wie bei Natalia Shaloshvili (s.o.) ist auch hier die pädagogische Botscha so gut verpackt, dass sie nicht sauer aufstößt. Der Bär nimmt etwa das geschenkte Spiel zum Anlass, neue Regeln dafür zu erfinden, die Heuschrecke nutzt den Stein, um sich darauf zu sonnen. Ein herzerwärmendes, aber auch philosophisches Bilderbuch von dem kongenialen Duo Lorenz Pauli und Kathrin Schärer. KB
Natalia Shaloshvili ist eine Kinderbuchautorin und -illustratorin aus der Ukraine, die in Großbritannien lebt, einen georgischen Nachnamen trägt und auf Russisch schreibt.

Das klingt wie eine personifizierte Völkerverständigung, und um Gemeinsamkeit statt einem Gegeneinander geht es auch in ihrem liebenswerten, Hoffnung machenden Bilderbuch. Im Original heißt es „Leoparda“. Das erklärt beinahe, warum seine tierische Heldin aussieht wie ein Tiger mit schwarzen Flecken.

Nachts schlä Frau Leo auf einem Baum, tagsüber arbeitet sie als Busfahrerin und kutschiert die Tiere zu ihren „Tierterminen“. Alle sind zu-
frieden, bis der Bus von einem Auto überholt wird. „Sensationell!“, finden das alle.
Und bald sitzen weniger Tiere im Bus und mehr im eigenen Gefährt. Was folgt, scheint unausweichlich: Stau, Gestank und Gezänk. Frau Leos Baum wird gefällt, sie schlä nun im Bus.
Als aus dem Ast, den Frau Leo gerettet hat, ein erstes Blättchen wächst, hat sie eine Idee. Die glücklicherweise wieder ansteckend wirkt: Sie steigt aufs Rad um.
KIRSTIN BREITENFELLNER
Die Abbildung oben stammt aus dem besprochenen Buch (Copyright: Natalia Shaloshvili / Knesebeck Verlag)
Der Komponist John Cage (1912–1992) hat Schlüsselwerke der Neuen Musik geschaffen, darunter das berühmte Stück „4’33“, in dem für genauso viele Minuten nichts zu hören ist. Sein mit der befreundeten Designerin Lois Long verfasstes Kinderbuch handelt von dem, was den Kleinsten alles bedeutet: Matsch.
Entstanden in den 1950er-Jahren, wurde es nun zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Der Untertitel „Das Backbuch“ deutet auf das Kunstwerk Matschkuchen hin, für den man nur Sand, Wasser und Sonne braucht. Die Anleitungen sind durchaus detailliert, die Illustrationen berückend simpel und vorwiegend, ja, matschfarben.
Für Fortgeschrittene gibt’s dann die „Matschtorte“ – mit Pusteblumenkerzen auch für Geburtstage geeignet. Köstlich! KB

einen moralischen Zeigefinger



Bilderbücher für die Allerkleinsten sind o aus Pappe, so wie dieses. Daniela Kulot dekliniert darin nächtliche Aktivitäten durch. Was der Mond, die Katze, die Eule, das Gespenst oder das Schiff in der Nacht machen, wird mit je einem kurzen Reim beantwortet, der sich auf diesen Zeitabschnitt reimt. „Was macht das Gespenst in der Nacht? Es geistert, da ist es – hab Acht!“

Mit beinahe 40 eigenständigen Büchern und über zehn mit Illustrationen für andere Autorinnen und Autoren zählt Kulot zu den fixen Großen des Genres. Aber sie legt nie Dutzendware vor.
Hier überzeugen die simplen Reime, die auch schon Zweijährige erfreuen können, und die nicht unterkomplexen dazugehörigen Bilder, die nie süßlich oder lieblich daherkommen, sondern knuffig sind mit einem Hang zum Frechen.
„Was macht das Kind in der Nacht?“, lautet die letzte Frage. „Es staunt über all die nächtliche Pracht.“ Ein Gutenachtbuch im wörtlichen Sinne! KB
Wenn Kinder in der Natur bauen, nehme sie ihre Werke anders wahr, als sie in Wirklichkeit aussehen. Und die Geschichten, die sie dazu erfinden, erscheinen ihnen real. Mit dieser Grundidee arbeiten der Schweizer Autor und die italienische Illustratorin. Drei Kinder bauen einen Damm am Abfluss eines Sees, der sogar Schiffe au alten kann. Zuerst erscheint die Flotte des Königs, dessen Männer in historischen Uniformen sogar beim Bauen helfen. Wie die Kinder in der Fantasie sehen die Leserinnen und Leser sie nebeneinander werkeln.

Plötzlich tauchen Piraten auf, aber solche von der guten Sorte. „Hier wird nicht geraubt, hier wird gebaut!“, das lassen sie sich nicht zweimal sagen. Doch dann will der kleine Bruder einen Stein aus der Mitte des Damms „zurückhaben“. Oh weh, denn dieser bricht.

Damit endet dieses Bilderbuchkunstwerk, das die Fantasie neben der Realität gleichberechtigt ins Bild setzt, aber nur kurz in einem Desaster. Es geht gut aus! KB
Emilio besucht seinen Opa in einer Blockhütte in den Bergen, mitten im Wald, wo die Stille viel lebendiger ist als in der Stadt. Wenn es dunkel wird, erzählt Opa Geschichten.
Eines Abends fragt er Emilio, ob dieser den Mond besuchen möchte. Mit dem Rucksack gehen sie los. Emilios Fantasie ist erweckt. Er sieht Opa als Bären und sich selbst als Tiger, der dem Bären folgt. Schließlich sind sie da – und sehen den Vollmond in einem See gespiegelt. Sie springen hinein und bestaunen die von diesem beschienene Unterwasserwelt. Dann übernachten sie im Freien: unter dem Mond. Das ist genauso gut, wie wirklich dort gewesen zu sein!
Die Spanierin Ana Sender findet zu dieser berührenden Geschichte über die Kra der Imagination und die Liebe zur Natur, erdacht vom Argentinier Nicolás Schuff, bezaubernde Bilder. Und schafft so ein Bilderbuchjuwel, in dem ein sattes Dunkelgrün und die Blau- und Silbertöne der Nacht dominieren. KB
Wenn Eltern „Aber“ und danach den Vornamen ihres Kindes sagen, sind sie meistens nicht zufrieden. „Aber Luise!“ Diesen Satz kann die Angesprochene sich dauernd anhören.

Sie ist ja „ein ganz besonderes Kind“, vielleicht „sogar das ungewöhnlichste Kind auf der ganzen Welt“. Als Kleinkind löst Luise durch Schaukeln die Bremsen des Kinderwagens, später vergisst sie, nach dem Ponyfüttern das Gatter zu schließen. Beim Besuch einer Raketenstation drückt sie einfach den Starthebel der Rakete und startet mit ihr ins Weltall.







Und damit beginnt jetzt erst das richtige Abenteuer dieses übermütigen Buchs. Mittels Schleudersitz landet Luise auf einem kleinen Planeten – und trifft dort auf Luis, den seine Eltern auf dem Weg zum Ende der Milchstraße hier abgesetzt haben.
Ein schräges Buch mit Happy End, dessen witzige Holzschnitt-Illustrationen einen riesigen Spaß machen! KB

Verlag
»Dieser Roman zählt zum Herausragendsten des Bücherfrühlings.«
Ein Mädchen kämpft für
verfolgte Tiere
„Willodeen“ erinnert an Klimaaktivistin Greta Thunberg
W illodeen mag merkwürdige Tiere. So wie die Kreischer. „Sie schrien nachts wie die verrückten Hähne. […] Sie stanken zum Himmel.“ Ärgerte man einen Kreischer, so verbreitete er einen Gestank, übel wie ein Plumpsklo. „Und verärgert waren Kreischer so gut wie immer.“
Nicht nur wegen dieser Vorliebe finden die Menschen Willodeen merkwürdig – eine Eigenbrötlerin, die am liebsten durch Wälder strei und der Gesellscha von Menschen jene ihres Summbärchens Duuzu vorzieht. Genau wie sie ging es versehrt aus dem großen Brand hervor: Das Feuer machte Willodeen zur Waisin, Duuzu versengte es die Flügel.
Das Mädchen will nicht hinnehmen, dass die Kreischer einfach abgeschossen werden, nur weil sie den Menschen nicht gefallen. Die niedlichen Summbärchen hingegen, die hier immer überwinterten und neuerdings ausbleiben, wollen sie wiederhaben. Vielleicht hat das Ausrotten der einen ja mit dem Verschwinden der anderen zu tun – weil alle Lebewesen Daseinsberechtigung haben?
So blöd ist das hier ja gar nicht
„Der Wald heult“ ist ein Umzugsdrama plus Tierschutzkrimi
Die US-Jugendbestseller-Autorin
Katherine Applegate erhielt für „Der einzig wahre Ivan“ über einen gefangenen Gorilla die Newbery Medal. Auch „Willodeen“ ergrei Partei für die Natur – und erinnert an Greta Thunberg. „,Und wessen Schuld ist das?‘, schrie jemand. Wie es aussah, war ich dieser Jemand.“ Ein Buch für die nachkommende ökobewegte Generation. GERLINDE PÖLSLER

Das soll wohl ein Witz sein? Aufs Land sollen Martha und Mischa ziehen – in irgendein Gruselhaus in einem öden Kaff. Die Zwillinge sind grundverschieden und streiten o Martha redet gern, hat viele Freundinnen und spielt Theater, Mischa mag lieber Zeichnen und Fußball, „da muss man nicht viel reden“. Jetzt sind die beiden sich aber einig: Diesen Umzug finden sie blöd. Und das lassen sie ihre Eltern auch spüren.

Das versprochene „Schloss“ ist auf den ersten Blick ja wirklich eine Zumutung. „Ein finsteres Haus mit geschlossenen Fensterläden, einem Dach, auf dem Moos wächst, und rundherum ein verwilderter Garten.“ Na gut, jedes Kind hat jetzt endlich ein eigenes Zimmer. Okay, das Schwimmbad und die Pommes dort sind auch nicht übel. Und ein paar Kinder aus dem Dorf sind echt in Ordnung. Bald schon tun die Zwillinge ganz neue Dinge: sich im finstren Weinkeller Gruselgeschichten erzählen, im Garten zelten. Als aus dem Wald regelmäßig ein unheimliches Geheul dringt – das muss
Was geschieht in der Nacht?

Ein Einschlafbuch für Aufgeweckte!
Was macht die Katze in der Nacht? Sie sitzt auf dem Dach und wacht. Und was macht die Eule in der Nacht? Und das Schiff, das im Hafen liegt? Es gibt so vieles zu entdecken in der Nacht! Viele Tiere sind nachts unter-
Daniela Kulot | In der Nacht

wegs, aber es wird auch gearbeitet. Ewig könnte man aus dem Fenster sehen und dabei fast das Zubettgehen vergessen. Ein Pappbilderbuch zum Immer-wieder-Ansehen, bis dann doch das Bett ru
Pappbilderbuch | 22 x 15,5 cm | 26 Seiten durchgehend farbig | ISBN 978-3-8369-6199-8








12,40 € [AT]
ein Wolf sein! –, beschä igt das bald die ganze Kindertruppe.
Gemeinsam mit Hubert Flattinger hat Petra Hartlieb, Wiener Autorin und Literaturexpertin – sie bestreitet auch den Falter-Buchpodcast –, einen fröhlichen Kinderroman erschaffen, der Stadt und Land versöhnt. Und am Ende macht Krimiautorin Hartlieb auch noch eine Detektivgeschichte daraus. GP
Schöner einschlafen
mit Erwin Moser
Erwin Mosers tierische Gute-Nacht-Geschichten führen durchs gesamte Jahr: Im Sommer werden abenteuerliche Behausungen und Baumhäuser gebaut, im Herbst schipert der Pandabär in einem ausgehöhlten Kürbisboot übers Wasser und im Winter fahren Bären und Katzen Schlittschuh. Knapp 80 fantasievolle, warmherzige Gute-Nacht-Geschichten von Erwin Moser, wunderschön illustriert vom Autor selbst.
„Wir müssen klarkommen. Irgendwie.“
REZENSIONEN: KIRSTIN BREITENFELLNER

die „Aufgaben“, die die Freunde füreinander erfinden, werden zusehends waghalsiger.

Bei Sascha zuhause sieht es ganz anders aus. Wenn seine Mutter, eine Krankenschwester, ihre Schichten hat, muss er sich um seine kleine Schwester Jacky kümmern. Hier mutiert der Pubertierende zur nicht einmal unwilligen, fürsorglichen Aufsichtsperson. Von Jackys Vater lebt die Mutter getrennt, Saschas Vater starb bei einem Autounfall, als dieser zwei Jahre alt war. Wir sind in den 1990er-Jahren, Schauplatz ist eine ostdeutsche Stadt. Aber diese spannende Geschichte könnte an vielen Orten spielen.
de im Laufe der Handlung einen dramatischen Verlust zu verarbeiten, von dem sie nicht wissen, ob er auf ihre Kappe geht. Das hat mit einem neuen Mitschüler namens Marcel zu tun, einem schweigsamen Jungen, den Sascha in die Gruppe zu integrieren versucht. „Nichts, aber auch gar nichts war noch gültig“, scheint es Sascha danach. Er fällt in ein schwarzes Loch aus Ohnmacht und Zorn.
In seiner Freizeit lungert der 16-jährige Sascha mit seinen Freunden Timo, Jarno und Engel in einem Abbruchhaus herum. Es fließt viel Bier, Joints machen die Runde, und um sich ihrer Freundscha als würdig zu erweisen, muss jeder der vier regelmäßig eine Mutprobe bestehen. Sascha etwa soll eine Rauchbombe im Papierkorb des Schulhofs zünden. Die Sache geht glimpflich aus, aber
Das Sprachniveau und das Reflexionsvermögen des jugendlichen Icherzählers Sascha scheinen zunächst etwas hoch gegriffen, erst zum Schluss begrei man, dass Sascha seine Geschichte nach einem gewissen Abstand, sich selbst reflektierend, in Worte zu fassen versucht. Und das ist angesichts der verstörenden Ereignisse gar nicht so leicht.
Als ob Sascha nicht so schon genug Schatten auf seinem Herzen zu ertragen hätte, haben er und seine Freun-
Der unbekannteste Mensch der Welt



Wie ist es, Mitglied einer bürgerlichen Familie zu sein?



Heldinnen und Helden aus privilegierten Verhältnissen sind im Jugendbuch rar, was vermutlich einem Drang nach sozialer Gerechtigkeit seitens der Autorinnen und Autoren geschuldet ist. Tatsache bleibt, dass jeder Stoff sich für Literatur eignet. Hier lernt man eine bürgerliche Wiener Familie mit einem gewissen Dünkel kennen, der sich vor allem daran festmacht, historisch auf der „richtigen Seite“ gestanden zu sein, sprich dem Nationalsozialismus widerstanden zu haben.










Vorgeführt wird sie auf dem 100. Geburtstag der Urgroßmutter des Icherzählers Ben, der alt genug ist für L17-Lehrfahrten, aber seinen Platz im familiären Gefüge sowie im Leben noch nicht gefunden hat. Als Gliederung dient die Menüabfolge, dazwischen gibt es Exkurse in die Biografien älterer Familienmitglieder, erzählt von der Urgroßmutter, womit ein gutes Stück heimischer Geschichte abgehandelt wird. Das Kriegsende 1945, als der Urgroßvater gegen das NS-Regime opponierte, oder das längst historische „Protestjahr“ 1986 kommen dabei zur Spra-
che. Seine Verwandten sieht Benjamin durchaus auch kritisch: „Die Heldentat des Urgroßvaters ist wie ein Honig, den sie sich zufrieden auf ihr Brot schmieren.“
Er selbst wäre manchmal am liebsten „der unbekannteste Mensch der Welt“ und beneidet seine Freundin Toni, die „nur“ eine Mutter hat. Ein philosophisches und humorvolles literarisches Debüt.

Dass er dort wieder herausfindet, hat auch mit seiner guten Beziehung zu seiner Mutter zu tun, einer Figur, die schwer schu et und gerne viel Bier trinkt, aber das Herz am rechten Fleck hat und ihrem Sohn die notwendige Geduld und Unterstützung zukommen lässt. Damit demonstriert der vielfach ausgezeichnete Autor Johannes Herwig, dass auch Familien in einer nicht klassischen Konstellation und ökonomisch unkomfortablen Situationen für die Probleme ihrer Kinder da sein können.










In seinem dritten Jugendroman gelingt es Johannes Herwig – der ebenfalls im deutschen Osten aufgewachsen ist –, eine teils atemberaubende Geschichte zu erzählen und die ihr zugrundeliegenden Lebensthemen auf
unaufdringliche Weise mitzureflektieren. „Alle sahen mich an und ich spürte, dass etwas vorbei war. Nicht mehr in Ordnung gebracht werden konnte. Wir waren irgendwo falsch abgebogen“, denkt Sascha nach dem Unglück. Er hatte erwartet, dass die Zeit, wie es so schön heißt, alle Wunden heilen würde, begrei aber, dass das nicht stimmt. „Dass es Wunden gab, die blieben, und dass man diese Verletzungen mit Vorsicht behandeln musste, wenn man mit ihnen weiterleben wollte.“ Er lernt, dass es unmöglich ist, die Geschichte mit Marcel ungeschehen zu machen.

Und er ist nun bereit, sich auch mit dem Tod seines Vaters auseinanderzusetzen, an dem der an dem Unfall beteiligte Lenker schuld war. Verlust, Verantwortung und Vergebung bilden den Basso continuo der hier versammelten Handlungsstränge.
„Wir müssen klarkommen. Irgendwie.“ Mit dieser realistischen Botscha setzt sich dieses gut zu lesende, poetische Buch wohltuend vom Anspruch so mancher pädagogisch wohlmeinender Jugendliteratur ab, die glaubt, für alles eine Lösung bieten zu müssen.




Alexandra Holmes: Einfach mehr Lu . Jungbrunnen, 145 S., € 17,– (ab 13)






„Wir waren irgendwo falsch abgebogen“: Ein atemberaubender Jugendroman, in dem nicht alles wieder gut wird
Die letzten Tage Europas
Flucht: In „Die Insel“ erzählt die deutsche Journalistin Franziska Grillmeier von der schri weisen und systematischen Abschaff ung der Menschenrechte an Europas Rändern
GEORG RENÖCKL
Während Sie diese Rezension lesen, ertrinken gerade zwei Flüchtlinge im Mittelmeer. Vielleicht auch 73 oder 41, wer weiß das schon so genau, außer der FPÖ Salzburg, die mit ähnlichen Zahlenspielereien Angst vor „Illegalen“ schürt. Seit wann fürchten wir uns eigentlich vor den Schutzsuchenden, statt ihnen zu helfen? Warum sehen europäische Grenzschützer Kindern beim Ertrinken zu, statt sie zu retten? Und wann haben wir uns an die „hässlichen Bilder“ zu gewöhnen begonnen, die der damalige Außenminister Sebastian Kurz 2016 ankündigte?

Die Antworten darauf stehen in Franziska Grillmeiers Buch „Die Insel“. Die freie Journalistin aus Deutschland hat dafür Flüchtlingslager auf griechischen Inseln, aber auch provisorische Notunterkün e an der kroatisch-bosnischen und der polnisch-belarussischen Grenze besucht. Ausgangspunkt ihrer Recherchen ist das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Dem Zynismus vieler europäischer Entscheidungsträger im Umgang mit den Geflüchteten setzt sie profundes Fachwissen, Empathie und präzise Analysen entgegen. Zum Weinen ist einem beim Lesen dadurch freilich erst recht o zumute.
Etwa, wenn Grillmeier von der aus Afghanistan geflüchteten Familie Mahmoodi berichtet, die ins Visier der Taliban geraten war. In einem Flüchtlingslager an der türkisch-iranischen Grenze bringt Maleka ein drittes Kind zur Welt, ein Kaiserschnitt ist nötig, die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Im griechischen Lager Mavrovouni erneut schwanger, zündet sich die von der vorangegangenen Geburt Traumatisierte selbst an. Sie überlebt schwer verletzt. Statt psychologische Hilfe zu erhalten, wird sie als Brandsti erin angeklagt.
„Wenn den Leuten die Lager nicht passen, sollen sie wieder nach Hause gehen“, kommentiert der von Grillmeier befragte Polizeichef von Lesbos den Fall. „Nach Hause“, das hieße zurück zu den Taliban, die den ältesten Sohn der Familie bereits einmal entführt und nur gegen Lösegeld wieder herausgegeben haben. Das Leid der Familie Mahmoodi ist Kalkül: „Wenn diese Leute sehen, wie die Lebensbedingungen auf den Inseln sind, werden sie es sich zweimal überlegen, ob sie ihr Leben aufs Spiel setzen, um nach Europa zu kommen, oder ob sie nicht doch daheimbleiben“, zitiert Grillmeier den Vizechef der in Griechenland regierenden konservativen Nea Dimokratia, Adonis Georgiadis.
Wie kein zweiter Ort steht das 2020 abgebrannte Flüchtlingslager Moria für die Strategie der Abschreckung durch hässliche Bilder, die Europa nach der großen Fluchtbewegung von 2015 in die Tat um-
setzte. 2018 mietete die Journalistin eine Wohnung auf der Insel, ohne zu wissen, dass diese für die kommenden Jahre zu ihrem Lebensmittelpunkt werden sollte.
„Als ich versuchte, die Ereignisse in diesen Tagen aufzuschreiben, rangen die deutschen Redaktionen noch mit der Frage, ob sie ein weiterer Text über Moria interessieren sollte oder nicht. Was hatte sich seit dem letzten Bericht verändert? Die Situation schien
kleine Schritte vom deutschen „Wir schaffen das“ bis zum deutschen Überwachungszeppelin, der über technisch hochgerüsteten Grenzanlagen schwebt. 2016 werden die Bewohner der Insel Lesbos wegen ihrer Hilfsbereitscha noch für den Friedensnobelpreis nominiert. Zwei Jahre später verteilen sie Kekse nicht mehr an die Gestrandeten, sondern an die Grenzschützer. Bald darauf empfangen sie ankommende Flüchtlingsboote mit Stöcken und Tritten, um sie am Landen zu hindern. Wieder etwas später machen maskierte Männer Jagd auf Flüchtlinge, die es an Land geschafft haben, zerren sie auf Rettungsflöße und ziehen diese aufs Meer hinaus.
festgefahren, und die Lage der Flüchtenden und Inselbewohner:innen vor Ort war für viele auserzählt“, schreibt Grillmeier. Selten steckt so viel Medienkritik in einem einzigen Wort wie in diesem „auserzählt“.
Einige Reportagen Grillmeiers erschienen dann aber doch, etwa in der Schweizer Wochenzeitung WOZ, in der Zeit, der taz, der Süddeutschen Zeitung. Sie bilden den roten Faden dieses Buches, das aber viel mehr ist als nur eine Sammlung brillant erzählter Reportagen. Grillmeier erkannte früh, dass auf Lesbos und an vielen anderen Orten an der europäischen Außengrenze „der systematische Abbau des Rechts auf Asyl und die Aushöhlung rechtsstaatlicher Strukturen entlang der europäischen Grenzen in vollem Gange“ waren.
Mit ihren Reportagen und Berichten von 2018 bis 2022 protokolliert Grillmeier vier entscheidende Jahre, in denen in Europa eine tiefgreifende Veränderung stattfand. Wer erinnert sich noch an die Schlagwörter des Sommers von 2015, die nach dem Prinzip „Irgendwas mit Hope“ gebildet wurden? Die Hoffnung von damals ist längst Verzweiflung, Frust, Aggression, Scham oder Abstumpfung gewichen, je nach Situation und Standort. Europäische Werte wie Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte wurden an den Grenzen Europas stillschweigend und doch vor aller Augen außer Kra gesetzt. Ständig neue hässliche Bilder führten zu immer noch hässlicheren Taten.
Freilich nicht von heute auf morgen, und auch das zeigt Grillmeiers Buch so deutlich: Es braucht viele
„Wieder brachten sie uns auf die Mitte des Meeres und durchsuchten uns“, beschreibt eine junge Mutter aus Kamerun einen dieser Pushbacks. „Ich musste meinen BH durchschneiden. Sie tasteten meine Vagina und meinen Anus ab, um zu sehen, ob dort Geld versteckt war. Dann zwangen sie mich auch, mein Baby auszuziehen. Es war sechs Monate alt. […] Einer der Männer warf das Kind in das andere Boot, so als würde er Müll wegwerfen.“ Als türkische Grenzschützer die auf dem Meer Treibenden retten, atmet das Kind nicht mehr, kann aber wiederbelebt werden. „Ich bin doch von zu Hause weggelaufen, aus Kamerun, mit einem Kind in meinem Bauch, weil das Kind dort in Gefahr war“, klagt die Mutter. „Wenn ich hierherkomme, tue ich das, weil ich Sicherheit für mein Kind will, aber auch hier will man mein Kind töten.“
Was man 2016 noch empört als völlig übertriebene Schwarzmalerei zurückgewiesen hätte, wundert uns 2023 längst nicht mehr. Die an Europas Grenzen begangenen Verbrechen sind „keine bloße Aushebelung von Recht mehr“, urteilt Grillmeier, vielmehr habe eine „Verrechtlichung des Unrechts“ stattgefunden.
Die Journalistin erklärt die Eskalation der Gewalt gegenüber Flüchtlingen sowohl aufseiten der Behörden als auch durch lokale Schlägerbanden mit der Planlosigkeit der europäischen Politik. Man ließ die Sache laufen, statt die Krise zu managen. Dafür überwies Europa hunderte Millionen Euro für das sogenannte „Migrationsmanagement“ an Griechenland. Den Milliarden, die sich die EU ihre von Rüstungskonzernen auf den neuesten Stand gebrachten Grenzschutzanlagen mittlerweile kosten lässt, steht das Elend der Menschen in den Lagern gegenüber. Als 2020 die Pandemie ausbrach, mussten sich in Moria 167 Menschen eine Toilette teilen. Die Müllabfuhr funktionierte nicht, für fün öpfige Familien waren drei Quadratmeter Zeltboden vorgesehen. Das einzige menschenwürdige Lager, das Franziska Grillmeier auf Lesbos
kennenlernt, wird von den Behörden kurz nach dem Brand von Moria geschlossen: Die Bilder, die es produziert, sind nicht hässlich genug.
Franziska Grillmeier liefert in „Die Insel“ Hintergründe, Zahlen und Fakten, die es braucht, um die Tragödie zu verstehen, die sich an den Rändern Europas abspielt. Vor allem aber erweist sie sich als große Erzählerin, die anhand von Einzelschicksalen historische Wendepunkte erlebbar macht. Ein wenig fühlt man sich nach der Lektüre des Buches wie die Frau aus Somalia, die Grillmeier über die Jahre begleitet hat und die eines Tages endlich im Rückblick von der Insel sprechen darf: „Die Zeit hier hat mein Herz gebrochen, aber meinen Blick auf die Welt geschär .“ F
Franziska Grillmeier: Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. C.H. Beck,

»Die Zeit hier hat mein Herz gebrochen, aber meinen Blick auf die Welt geschär
Migrationsforscher Koopmans: Europas Asylsystem ist extrem ungerecht
Niemanden lassen die Bilder los: Weit mehr als 20.000 Menschen verloren allein im vergangenen Jahrzehnt ihr Leben im Mittelmeer, weil sie sich ein besseres Leben in Europa versprachen. Die lebensgefährliche Passage wagen kann nur, wer mobil, risikobereit und fähig ist, der Schlepperindustrie mehrere tausend US-Dollar für ihre düsteren Dienste zu zahlen. Die Mehrheit wurde nicht persönlich verfolgt, die aus Westafrika stammenden Menschen sind fast nie Flüchtlinge nach UN-Konvention. Dennoch suchen sie im Schengen-Raum um Asyl an, weil europäische Werte es mehrheitlich verbieten, Menschen in Herkun sländer zurückzubringen, wenn dort ihre Unversehrtheit nicht gesichert ist, Transitländer die Rücknahme ablehnen oder wenn sich die Identität wegen fehlender Ausweispapiere nicht klären lässt.
Um in der EU Zuflucht zu erlangen, ist laut Ruud Koopmans vom Wissenscha szentrum Berlin nicht der Grad der Schutzbedür igkeit entscheidend, sondern Risikobereitscha , physische Stärke, Zufall und
Geld, denn fast alle, die den SchengenRaum betreten, dür en auch bleiben. Jenen hingegen, die zu schwach, zu krank oder zu arm sind, um die Grenzen der EU zu überschreiten, komme niemand zu Hilfe. „Weil die europäischen Länder – anders als zum Beispiel Kanada, die Vereinigten Staaten, Australien und zum Teil auch Großbritannien – keine proaktive, planmäßige Flüchtlingspolitik betreiben, ist die Asylpolitik in Europa immer ein Spielball internationaler Ereignisse, die dazu führen, dass manchmal kaum jemand Europa erreicht, und zeitweise die Zahl der Flüchtlinge, die Europa erreichen, dramatisch zunimmt.“ Hohe Flüchtlingszahlen in kurzen Zeiträumen aber würden die Aufnahmegesellscha en überfordern.
Koopmans wurde Deutschlands führender Migrationsforscher, weil er geduldig gesichteten Daten folgt und sich dabei ebenso von Mitgefühl und Fairness wie vom Sinn für das Machbare leiten lässt. Sein letztes Buch, „Das verfallene Haus des Islam“, zeigte frei von Moralismen auf, dass muslimische Migrationsgemein-
scha en weltweit zu jenen gehörten, die statistisch gesehen die geringsten Erfolge bei Bildung und Arbeit auch in der zweiten und dritten Einwanderungsgeneration erzielen und höhere Gewaltbereitscha und Intoleranz zeigen. Ausführlich analysierte Koopmans auch die Gründe und Lösungsmöglichkeiten dafür.
Wie eine Neuregelung der Zuwanderung in die EU aussehen kann, das zeigt Koopmans in seinem neuen Buch in wiederum idealer Balance von ideologiefreier Datensichtung, Philanthropie und Sinn für das politisch Notwendige und Machbare. Er plädiert für eine Variante des australischen Modells: Asylverfahren sollen demnach außerhalb des Schengenraums durchgeführt werden; das macht irreguläre Zuwanderung unattraktiv. Das UNFlüchtlingshilfswerk etwa solle jene auswählen, die die Hilfe am dringendsten brauchen.

Mit kooperationswilligen Ländern seien Rücknahmeverträge für irreguläre Migranten auszuhandeln, indem man im Gegenzug anbietet, Kontin-
gente an Arbeitskrä en und Auszubildenden legal und mit den Garantien des Wohlfahrtsstaates versehen nach Europa zu holen.
Ziel von Koopmans’ Modell ist nicht eine Reduktion von Zuwanderung, sondern Gerechtigkeit und Humanität. An dieser mangelt es einer Mehrheit der Deutschen nicht, wie die „Willkommenskultur“ für Syrer und jüngst für die Ukrainer bewies. Ihr fehlt lediglich der institutionelle Rahmen: „Wir können es viel besser, und wir sind es sowohl den Flüchtlingen als auch den eigenen Bürgern schuldig, endlich über unseren Schatten zu springen.“
SEBASTIAN KIEFER
Ruud Koopmans: Die Asyl-Lo erie. Eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg. C.H. Beck, 269 S., € 26,80

Russland im Fangeisen
Ukraine-Krise: Es herrscht Krieg und alle fragen, warum. Zwei deutsche Autoren versuchen eine Antwort
Nicht die Putinversteher, die Russlanderklärer haben jetzt das Wort. Olaf Kühl, Autor und Übersetzer, kommt in seiner „Kurzen Geschichte Russlands von seinem Ende her gesehen“ rasant auf den Punkt. Am Cover prangt ein „Z“, das abstruse Hoheitszeichen von Putins Invasionsarmee in die Ukraine. Russland, das bedeute Krieg. Zurückhaltender gibt sich der Historiker und Journalist Gerd Koenen, der seine RusslandAnalyse immerhin als „Widerschein des Krieges“ versteht.
Wie bei vielen Westlern stand am Anfang des Russland-Interesses für Olaf Kühl, den langjährigen Osteuropa-Referenten im Berliner Bürgermeisteramt, die Lektüre Dostojewskis. Der literarische Apokalyptiker sei der Kronzeuge jenes Nihilismus, der sich über die Bolschewiki bis in die Gegenwart durchziehe. Dem gelte es entgegenzutreten: „Für dieses Russland ist es die einzige Rettung, endgültig besiegt zu werden.“
Argumentativ noch dür iger als derart markige Kriegsbegeisterung, die man fast als Kriegstreiberei bezeichnen könnte, fallen die folgenden vier Dutzend Essays aus. Eben noch vom Flair einer ossetischen Tanzgruppe auf Berlin-Besuch angetan, gaben Kühl bereits die vielen russischen Veteranen zu denken, die im Lauf der Jahre beim Weltkriegsverlierer Deutschland um Unterstützung ansuchten.
Russischer Antifaschismus stelle nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine eine „verrottete Ikone“ dar: „Deutschland muss heute innerlich zur Möglichkeit, ja Notwendigkeit eines Sieges aufrufen.“ (Zum Glück, möchte man einwerfen, gibt es in Deutschland einen Kanzler, der weniger mit dem Säbel rasselt!) Olaf Kühl rekapituliert alles an Fakten, Mythen und
Klischees, was das Horrorkabinett der jüngeren russischen Geschichte anzubieten hat: von Stalins Geheimdienstschlächter Wassili Blochin bis zur Ermordung des abtrünnigen KGBlers Alexander Litwinenko. Alles, was man woanders über die „mangelnde ideologische Abfederung“ der postsowjetischen Reformen mittels radikaler wirtscha licher „Schocktherapie“ und der folgenden Massenverarmung der Bevölkerung besser beschrieben fand, wird durchgehechelt.
Oligarchen und Geheimdienst dürfen ebenso wenig fehlen wie Putins Uhrensammlung und seine obskuren Vordenker. Schließlich liefert Kühl einiges an Insiderinfos: wie ihm Michail
»Jetzt sitzt Russland in der Ukraine fest wie der sprichwörtliche Problembär im Fangeisen
GERD KOENEN
Gorbatschow die Nähe der russischen und deutschen Seele erklärte, was der letzte Staatschef der DDR, Erich Honecker, auf dem Flug aus dem Moskauer Exil ins deutsche Gefängnis von sich gab und, last but not least, Reiseeindrücke aus Sibirien. Am Ende steht die Warnung davor, Kompromisse mit Russland einzugehen oder die russischen Verbrechen in der Ukraine zu „rationalisieren“: „Die Welt würde damit das Böse assimilieren, in sich aufnehmen und damit den ersten Schritt zu ihrer eigenen Auflösung tun.“ Besser bedient ist man mit Gerd Koenens’ „Im Widerschein des Krie-
ges“. Dem Kommunismus-Forscher gelingt es – aufgrund seiner „Langzeitbeobachtungen über drei Jahrzehnte“ – zumindest halbwegs, den „tieferen Motiven und Gründen sowie den mentalen oder materiellen Bedingungen dieses von Putin als Letztentscheider unprovoziert vom Zaun gebrochenen, an Wahnwitz grenzenden Krieges nachzuspüren“.
Er holt dabei bis zur quasi-theologischen Vorstellung von „Moskau als drittem Rom“ aus, die schon im 16. Jahrhundert propagiert wurde. Bisweilen geraten die Vergleiche ein wenig zu essayistisch üppig, etwa jene des Zaren Iwan Grosny „der Schreckliche“ mit Putin. Mit der fehlerha en Erinnerungspolitik Russlands nach dem Untergang der Sowjetunion 1991 berührt Koenen allerdings einen zentralen Punkt: die Wiederkehr russischer Großmachtgelüste. Entstalinisierung hatte unter Chruschtschow, im Machtkampf um die Nachfolge Stalins, immerhin die Freilassung von Millionen Lagerhä lingen bedeutet und zu einem ideologischen „Tauwetter“ geführt. Unter Gorbatschow und Jelzin wurde erstmals frei über die Verbrechen des Stalinismus gesprochen, in der Folge vergaß man aber, eine entsprechende Erinnerungspolitik zu institutionalisieren. Stattdessen begann man, das ideologische Vakuum mit einer staatstragenden „russischen Idee“ zu füllen.
Besonders gelungen sind die Einzelporträts sowjetischer und russischer Systemkritiker und Dissidenten. Gulag-Autoren wie Alexander Solschenizyn und Warlam Schalamow kommen ebenso zu Ehren wie Arseni Roginski, Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial.
Koenen analysiert die Angst des Kreml vor Massenprotesten der Op-
Meine vielen Väter
Hamed Abboud, der seit Ende 2014 in Österreich lebt, ist als Geschichtenerzähler ein Kulturenverbinder par excellence. In »Meine vielen Väter« berichtet er von seinem Aufwachsen in der syrischen Provinzstadt Deir al-Zor, wo sein Vater als Mathematiklehrer und Bäcker tätig war. Aus erinnerten Episoden webt er einen zauberha en Geschichtenteppich, der das Leben der Familie Abboud wie kleine Filmszenen vor unseren Augen aufscheinen lässt.

Im Mittelpunkt des erzählerischen Mosaiks steht der umsichtige Vater, der mit besonderem Humor die Geschicke
position sowie die Bedeutung der Kriege in Tschetschenien und Georgien, der Beziehungen zu China und der Corona-Epidemie im Vorfeld von Putins Angriff auf die Ukraine. Dessen Vorgeschichte grei mit der Erklärung eines „Phantomschmerzes“ allerdings zu kurz.
Die grau schillernde Eminenz des Kreml, Wladislaw Surkow, steht am Ende des gut lesbaren Versuchs zu verstehen, „wie es geschehen konnte, dass sich dieses Land mit all seinen reichen menschlichen und natürlichen Potentialen abermals in einen Malstrom destruktiver und autodestruktiver Gewalt hineinstürzt“. Eine Antwort bleibt Gerd Koenen letztlich schuldig und begnügt sich mit der eher flapsigen Beschreibung des IstZustandes: „Jetzt sitzt Russland in der Ukraine fest wie der sprichwörtliche Problembär im Fangeisen.“
ERICH KLEINOlaf Kühl: Z. Kurze Geschichte Russlands von seinem Ende her gesehen. Rowohlt, 223 S., € 24,70

Gerd Koenen: Im Widerschein des Krieges. Nachdenken über Russland. C.H.Beck, 217 S., € 20,60

der Bäckerei und der Familie zu verbinden weiß. Entscheidende Fäden hält freilich die Mutter in der Hand, die als »Ausbildungskreuzritterin« die Zimmerwände mit Lehrsto bekritzelt, um den schulischen Erfolg ihrer Kinder zu be ügeln, und so die Wohnung zu einem »Matura-Trainingslager« macht.

Neuauflage des Totalitären


China: „Der Hightech-Gulag“ über die chinesische Parteipolitik gegenüber den Uiguren schockiert
Gerade als man dachte, China habe sich ein für alle Mal von einem der düsteren Kapitel seiner Geschichte distanziert – den Umerziehungslagern für „Konterrevolutionäre“, die die Zeit von Maos Kulturrevolution geprägt hatten –, tauchten um 2017 erste Berichte über die massenha e Inha ierung von Uiguren in der autonomen Region Xinjiang auf. Seither haben geleakte chinesische Dokumente, Recherchen von NGOs und Berichte von Uiguren im Ausland ein Bild der Vorgänge entstehen lassen, das der deutsche Sinologe, Journalist und langjährige China-Korrespondent Mathias Bölinger in seinem neuen Buch unmissverständlich so zusammenfasst: „Der Hightech-Gulag, den China in Xinjiang errichtet hat, ist die Neuauflage der totalitären Unterdrückungsmethoden des 20. Jahrhunderts mit den technischen Mitteln von heute.“
„Der Hightech-Gulag“ lautet folgerichtig auch der Titel von Bölingers Buch, für das er mit vielen Augenzeugen über das gesprochen hat, was in Xinjiang passiert, seit das kommunistische Parteiestablishment unter Xi Jinping seine Politik der gewaltsamen Assimilierung ethnischer Minderheiten beschlossen hat, darunter die muslimischen Turkvölker Xinjiangs. Innerhalb kürzester Zeit, so schildert Bölinger, begann die Han-chinesische Parteiverwaltung von Xinjiang ab 2016 die Region nicht nur mit einem Netz von Gefängnissen und Umerziehungslagern zu überziehen, sondern auch „mit einem dystopischen Überwachungsapparat“, dessen Maßnahmen bis ins Innerste des Privaten reichen: flächendeckende Straßenkameras, Auslesen von Mobiltelefonen, elektronische Erkennungssysteme an Wohnanlagen, Gesichtserkennung, unzählige Checkpoints, Fingerabdruck-, Augenscan- und Stimmpro-

„Das Regime hat schon verloren“













Iran: Hier passiert „feministische Weltgeschichte“, so Gilda Sahebi. Sie bietet einen erschü ernden Überblick
benerfassung und ein geradezu lückenloses Parteikader-Kontroll- und Spitzelsystem.
Die Terrorbürokratie der Partei, der ethnische Minderheiten zunehmend als Schwachpunkte eines Han-chinesisch dominierten Nationalismus gelten, regiert willkürlich. Religiosität ist ihr ebenso verdächtig und Verhaftungsgrund wie das Beantragen eines Passes, zu hoher Stromverbrauch oder zu viel Besuch. Aus „Deradikalisierungs“- und Umerziehungslagern, in denen Uiguren und andere „vertrauensunwürdige“ Angehörige von Minderheiten durch Mandarin-Kurse und Parteipropaganda auf Linie gebracht werden sollen, werden rasch MassenGefangenenlager mit Gewaltexzessen, Folter, Vergewaltigung und Hunger. Nach Schätzungen waren seit 2017 zwischen sieben und 15 Prozent der Erwachsenen in Xinjiang inha iert.
Bölinger skizziert nicht nur detailreich die Orwell’sche Logik der paranoiden chinesischen Parteipolitik, er zeichnet auch die Vorgeschichte all dessen sehr genau nach, vom Kaiserreich über die wechselvollen Jahre der chinesischen Republik bis zur Machtübernahme der Kommunisten 1949 und der Ära Xi Jinping: Es ist die Geschichte einer langsamen Radikalisierung des Han-chinesischen Parteiapparats gegenüber den Minderheiten des Landes, die in den Massenverha ungen der letzten Jahren gipfelte.
JULIA KOSPACHDas ist ein Schlachtfeld“, rappt Toomaj Salehi, „unser Schwert ist Liebe.“ Im Oktober wurde der iranische Rapper verha et und Berichten zufolge schwer gefoltert. „Sein Bein und seine Finger sollen gebrochen worden sein, sein Gesicht verletzt und sein Auge so schwer beschädigt, dass er seine Sehkra verloren haben soll.“
Von dem Rapper hat sich Gilda Sahebi den Titel für ihr neues Buch „Unser Schwert ist Liebe. Die feministische Revolte im Iran“ geliehen. Sahebi, 1984 im Iran geboren und in Deutschland aufgewachsen, ist Journalistin und Expertin für Menschenrechte und die Lage der Frauen im Iran. Auch im Podcast „Das Iran Update“ informiert sie aktuell über die Situation im Land. In ihrem Buch will sie die Geschichten der Menschen im Land erzählen, damit „sie nicht mehr im Dunkeln verschwinden“.
Und so nennt sie Inha ierte und Hingerichtete beim Namen: zum Beispiel Mohammad Mehdi Karami, der im Dezember zum Tode verurteilt wurde.
war, laut Regierung nach ihrer Festnahme an einer Herzerkrankung gestorben sein. Jedoch: „Geleakte CTAufnahmen und Fotos aus dem Krankenhaus zeigen starke Verletzungen im Kop ereich. Die junge Frau muss massive Gewalt erfahren haben.“ Jegliche Opposition gegen die Regierung werde zudem als verdorben betrachtet und sexualisiert, erklärt Sahebi. So habe ein islamischer „Intellektueller“ erklärt, die Forderung der Protestierenden „Frau, Leben, Freiheit“ bedeute in Wirklichkeit „Frau, Prostitution, Unzucht“. In den Gefängnissen werde „systematisch sexualisierte Gewalt ausgeübt“.
Sahebi gibt auch Menschen eine Stimme, die das Regime mit besonderer Härte verfolgt, wie einer non-binären Transfrau. Mit historischen Abrissen zeigt sie außerdem, dass „es nie ruhig war in diesem Land“. Sie berichtet etwa von Verha ungen und Massenhinrichtungen in den ersten Jahren der Islamischen Republik.
Mathias Bölinger: Der HightechGulag. Chinas Verbrechen gegen die Uiguren.
C.H. Beck, 256 S., € 18,50
Der 22-Jährige soll seinen Vater noch aus dem Gefängnis angerufen und gebeten haben, der Mutter nicht zu sagen, dass er die Todesstrafe bekommen hat. Sahebi berichtet über die Gräueltaten der Regierung: „Es sind Polizisten und die berüchtigten BasijMilizen, die die Proteste niederschlagen und die Menschen auf den Straßen des Landes töten. Sie gehen mit gnadenloser Härte auch gegen Kinder vor.“ Im Anhang des Buches findet sich eine „Liste der Todesopfer“ mit 489 Namen, beginnend mit „1 Jina Mahsa Amini (22) † 16. 9. 22, Teheran, in Ha gestorben“.
Sahebi deckt die Mechanismen eines Regimes auf, das leugnet und Falschmeldungen verbreitet. So soll auch Mahsa Amini, deren Tod Auslöser der aktuellen Protestbewegung
In einer reichlich unübersichtlichen Lage bietet die Autorin so einen erschütternden Überblick. Das Buch empfiehlt sich für alle, die die aktuelle Protestbewegung und die lange Geschichte der Unterdrückung in der Islamischen Republik besser verstehen wollen. Sahebi ist sicher: „Es kann Monate dauern. Jahre. Aber das Regime hat schon verloren. Die Menschen. Seine Existenzberechtigung.“
DONJA NOORMOFIDIGilda Sahebi: Unser Schwert ist Liebe. Die feministische Revolution im Iran. Fischer, 256 S., € 24,70


Du hast eine Idee für ein Buch? Oder dein Manuskript ist schon fast fertiggeschrieben? Wir helfen dir dabei, dein Buch im Selfpublishing zu veröffentlichen.


In der Buchschmiede kümmern wir uns darum, dass aus deinem Text dein Buch entsteht. Wir unterstützen dich persönlich. Kapitel für Kapitel. Von der Gra k zum Druck bis zum Verkauf.
Gemeinsam realisieren wir mit dir deinen Traum vom eigenen Buch!
Abschied ohne Trauer
Sozialgeschichte: Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Großfamilie vom Verschwinden der bäuerlichen Welt seiner Kindheit

Wenn anlässlich von Namenstagen, die im katholischen Münsterland wichtiger waren als Geburtstage, die Geschwister von Ewald Fries Eltern auf Besuch kamen, gingen die Männer nach dem Kaffee in den für diese Anlässe blitzblank hergerichteten Stall oder auf die Wiese, um dort aus Züchtersicht über Rinder und Kälber zu fachsimpeln. Die Frauen gingen derweil in den Garten, der die Familie zu einem Gutteil ernährte, und in den Keller, wo sie Apfel- und Kartoffelvorräte sowie alles in Gläsern Eingekochte in Augenschein nahmen. Sie tranken Wein und Likör nach dem Essen, das über Tage von vielen Händen vorbereitet worden war. Die Männer spielten bei Bier und Schnaps das Kartenspiel Doppelkopf, und zwar stets um Geld. Denn ohne Geld, so Ewald Fries Vater, fehle dem Spiel die „Andacht“.
Hoch ritualisiert, nach Geschlechtern in Zuständigkeitsbereiche geschieden, tief religiös, im Familienverband mit Eltern, Kindern und Hilfskrä en, tagein, tagaus im Feldanbau, in Haus und Hof und mit Pferden, Rindern, Schweinen und Hühnern am Arbeiten: So lebte die Bauernscha jahrhundertelang und noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Auch auf dem wohlhabenden Hof im Münsterland, wo Ewald Frie als neuntes von elf Kindern einer alteingesessenen katholischen Bauernfamilie aufwuchs. In seinem neuen Buch nach dem Bestseller „Die Geschichte der Welt“ erzählt der Historiker und Professor in Tübingen die Geschichte seiner Herkun sfamilie als „Tor zu einer Geschichte der Bundesrepublik“. „Ein Hof und elf Geschwister“ heißt der schmale Band, in dem Frie aus vielen Szenen nicht nur bäuerlichen Alltag mit Hofarbeit, Großfamilie und All-
Bodo Hell Begabte Bäume
»Bodo Hell ist ein Chronist, ein Sammler, ein Aufzeichner, ein Bewahrer von Belebtem und Unbelebtem, das ohne ihn vielleicht dem Vergessen anheimfallen würde. Bodos Texte sind ausnahmslos Liebeserklärungen, gelegentlich an Menschen, oft an Flora, Fauna, Dinge, Namen: Es gibt wohl nichts, das seiner literarischen Sammelleidenschaft entkommen kann.«

(Wolfgang Kühn, Wiener Zeitung)
Mit 23 Zeichnungen von Linda Wolfsgruber gebunden, mit Lesebändchen
216 Seiten, 25 €

tagsreligiosität modelliert, sondern entlang der unterschiedlichen Erfahrungsräume von Eltern und Kindern auch im Kleinen den großen gesellscha lichen Wandel sichtbar macht.
Vor allem aus den Erinnerungen seiner zehn Geschwister, die der Historiker für sein Buch interviewt hat, werden die gewaltigen Umbrüche anschaulich. Während der älteste Bruder und Hoferbe noch im Zweiten Weltkrieg auf die Welt kommt, wird die jüngste Schwester mitten ins bewegte Ende der 1960er- Jahre hineingeboren. Eindrucksvoll schildert Frie, wie sich in dem Vierteljahrhundert dazwischen praktisch alles ändert: Die „knochenbiegende Landarbeit“, die den Vater schon mit 50 zum gebeugten Mann gemacht hat, geht mit Traktor und Landmaschinen langsam zu Ende. Zwischen 1949 und 1960 verschwindet die Häl e der Pferde von den westfälischen Bauernhöfen, während sich die Zahl der Traktoren verzehnfacht. Parallel dazu geht mit den Wirtscha swunderjahren und ihren wachsenden Löhnen und Jobmöglichkeiten auch die Zeit der Mägde und Knechte zu Ende. Deren Arbeitskra müssen Eltern und Kinder durch Mehrarbeit ersetzen. „Arbeit war immer“, sagt eine der mittleren Schwestern.


Ewald Frie beschreibt, wie trotz Hofmodernisierungen die einst selbstbewusste Bauernscha mit Ansehensverlusten kämp . In den Gemeinderäten drängt der aufstrebende Mittelstand die Bauernscha in den Hintergrund. Die jüngeren Kinder schielen in Richtung Dorfleben mit seinen Freizeitangeboten. Geldmangel wird ein Thema. In der Schule schämen sich die jüngeren Kinder plötzlich ihres kärglichen Taschengelds.
Zugleich ermöglicht eine sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil öff-
nende Kirche eine individuellere Religiosität, während die neue katholische Jugendarbeit für einige Geschwister Perspektiven jenseits der bäuerlichen Welt eröffnet. Auch erleichtert der Sozialstaat mit seinen neuen Leistungen und Förderungen nicht nur die Hofübergabe, sondern auch den Zugang zu höherer Bildung.
„Die immer weiter auseinander klaffenden Welten von Zuhause und Draußen“ musste jedes Kind für sich in Einklang bringen. Das spiegelt sich auch in ihren Erzählungen wider, die Frie mit viel Feingefühl verwebt. Ebenso ordnet er sie auf sehr kluge Weise in die Zeitläu e ein, spielt sie aber nie gegeneinander aus. Diejenigen seiner Geschwister, die die bäuerliche Welt hinter sich gelassen haben, wissen bis heute das Mehr an Freiheit zu schätzen, das damit einherging, ohne ihre Herkun missen zu wollen. Dass sich alle elf Frie-Kinder seit frühester Jugend stets in Gruppen bewegten, ließ sie sich in den neuen Umfeldern schnell zurechtfinden und aktive Rollen einnehmen. Frie beschreibt das als einen der Vorteile seiner Herkun . Auch sonst ist er ohne Bedauern. „Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben war für uns kein trauriger Abschied. Er bot Chancen, die meine Mutter nicht hatte und mein Vater wahrscheinlich nicht hätte haben wollen.“

 JULIA KOSPACH
JULIA KOSPACH
Ewald Frie: Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. C.H.Beck, 191 S., € 23,70
Das wird noch dauern mit der grünen Wende
Ökologie: Der Abschied von fossilen Brennstoff en wird viel langwieriger als angenommen, warnt Vaclav Smil
Wenn Vaclav Smil eins nicht leiden kann, dann spektakuläre Langfristprognosen, die auf wackligen Annahmen gründen. Genüsslich zählt er Irrtümer der Vergangenheit auf: etwa jenen aus dem Jahr 1960, als die Menschen sich wegen der rasch zunehmenden Weltbevölkerung sorgten. Wenn der aktuelle Trend sich fortsetze, werde deren Wachstumsrate am 13. November 2026 den Wert „unendlich“ erreichen, war in der angesehenen Zeitschri Science zu lesen.
Ebenso Abstand von Prognosen nimmt der Autor beim Thema Erderwärmung: freilich von jenen, die behaupten, diese gebe es gar nicht, aber auch von einem angeblichen „Hang zum Katastrophismus, verkörpert von denen, die behaupten, es blieben uns nur noch ein paar Jahre, bis sich der letzte Vorhang über die moderne Zivilisation senkt“. Ebenso nichts abgewinnen kann er dem „Techno-Optimismus“, wonach „die Zauberkrä e der technischen Innovation“ alles lösen würden. Was Smil sagt, hat Gewicht: Der tschechisch-kanadische Forscher hat mehr als 40 Bücher über Energie und Umweltfragen verfasst, von keinem anderen lebenden Wissenscha ler wurden mehr Bücher in der Zeitschri Nature besprochen.
Smils Haup hese: Der Abschied von den Fossilen wird viel langwieriger als angenommen. Schließlich gehe es um viel mehr als „nur“ grünen Strom und Treibstoff: Es gehe auch um Alternativen bei der Herstellung von Zement, Stahl, Plastik und Dünger. Sie alle seien so schnell nicht ersetzbar, schon gar nicht in den Dimen-
Michael Girkinger
sionen, die für acht Milliarden Menschen und mehr vonnöten sind. Jene, die nun etwa einwenden, Dünger gehöre ohnehin reduziert, mahnt Smil: Solche Optionen hätten nur wohlhabende Länder. Andere hätten Au olbedarf, auch bei Energie und anderen Gütern. Das Wissen, das er hier ausbreitet, überzeugt und macht das Buch absolut lesenswert.
Was irritiert, zumal von einem solchen Kapazunder, sind die polemischen Kommentare zu jenen, die wegen der Klimakrise warnen. Diese malten in „apokalyptischem“ und „hysterischem“ Tonfall an die Wand, dass „unser Planet gleichzeitig abbrennen und im Wasser versinken werde“. Dabei sagt Smil selbst, wir hätten schon längst viel mehr gegen die Erderwärmung tun müssen. Unklar bleibt, was genau er an seriösen Klimaszenarien anzweifelt und was die erdrückende Abhängigkeit vom Fossilen nun heißt: Was sollen wir und unsere Regierungen tun? Am Ende beruhigt er mit der Abgeklärtheit des 79-Jährigen: „Der wahrscheinlichste Gang der Dinge wird eine gemischte Abfolge von Fortschritten und Rückschlägen […] sein.“
GERLINDE PÖLSLER
Vaclav Smil: Wie die Welt wirklich funktioniert.
C.H. Beck, 392 S., € 28,80
ALLES. IMMER. BESSER
Ob durch Werbung, Ratgeber oder digitale Hilfsmittel – wir werden unablässig dazu animiert, uns selbst zu optimieren. Glück und Erfolg scheinen nur eine Frage der bewussten Einstellung und des richtigen „Mindsets“.


Michael Girkinger analysiert den ambivalenten Trend zur Selbstoptimierung zwischen eigenem Antrieb und gesellschaftlichem Druck.
ISBN 978-3-85371-517-8, 176 Seiten, broschiert, 20,00 Euro E-BooK: ISBN 978-3-85371-910-7, 15,99 Euro


Vorschrift
Heute machen wir mal Dienst nach
Gesellscha : Nadia Shehadeh will den Kapitalismus mit Faulheit und Solidarität in die Knie zwingen
Das äußere Erscheinungsbild trügt o , auch bei Büchern. Äußerst selten gehen ein flottes Cover als Werbemaßnahme und die Botscha , die zwischen den Buchdeckeln steht, so perfekt zusammen wie im Fall von Nadia Shehadehs vergnüglichem Manifest „Anti-Girlboss. Den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen“.

„Was störst du mich, elender Ausbeuter?“, scheint die gründlich gechillt wirkende und gleichzeitig latent aggressiv dreinblickende Cover-Katze zu sagen. Kann dieses Haustier das neoliberale Wirtscha ssystem zu Fall bringen?
Wohl kaum. Mit Faulheit allein ist es natürlich nicht getan. Aber bei aller popkulturellen Leichtigkeit und lässigem Aufgreifen von Internetsprache hat die deutsche Soziologin Shehadeh in ihrem Buch über weite Strecken recht, wenn sie für mehr Freizeit und weniger Overachievertum plädiert.
Kopfnicken und Schmunzeln begleiten die Lektüre. Kaum eine Arbeit sei so dringend, dass man sie sofort verrichten müsste, rät die Autorin. „Wenn es also heute etwas gibt, das du auf morgen verschieben kannst: Nur zu. Solange keine_r stirbt und du nicht im Gefängnis landest, kann es so schlimm nicht sein!“
Oder, aus feministischer Sicht: „Dass Frauen, die keine Kinder haben, vielleicht auch keine Karriere haben möchten, scheint eine komplett absurde Idee zu sein. Richtig faule Frauen? Frauen, die nur machen, was sie müssen? Oder sogar weniger? Kann es die geben? Ich vermute: Sie existieren wahrscheinlich noch nicht
in Massen, aber sie machen sich auf den Weg. Und das ist gut so.“
Der Begri ff Girlboss war vor ein paar Jahren kurz im Trend. Karrierefrauen mit Social-Media-Präsenz führten vor, dass alles möglich ist. Shehadeh geht ihren Geschichten nach: Sie waren als Chefs genauso schlimm wie cholerische Männer und stammten in der Regel schon aus gutem Hause.
In jeder Erwerbsbiografie spielt auch der Background eine Rolle. Nadia Shehadeh war zwar in der Schule das „Ausländerkind“, wie sie ausführt, aber ein strebsames, deren 1968 aus dem Westjordanland nach Deutschland gekommener Vater es geschafft hat und als Gemeindearzt hohes Ansehen genoss. Ihre Herkun beschreibt sie als relativ privilegiert.
Mit einer neoliberalen Ausprägung von Feminismus kann sie dennoch überhaupt nichts anfangen. Vom Erfolg einiger weniger Frauen hätten nur genau diese etwas, so Shehadeh. Sie plädiert stattdessen für mehr „Sisterhood“ und Solidarität. Und: Lieber ö er Dienst nach Vorschri machen und mehr private Interessen kultivieren als ausbrennen!
SEBASTIAN FASTHUBERLicht und Schatten der Selbstoptimierung
Baumwolle, Zucker und Blut








Globalgeschichte: Noch immer verdrängt: Afrikanische Sklaven schufen in Amerika Europas Wohlstand
Afrika war für den deutschen Philosophen Hegel ein „Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichten in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist“. Heutzutage gilt der sogenannte „dunkle Kontinent“ vielen als Garant für schlechte Nachrichten; Korruption, Bürgerkrieg und Hungersnot scheinen endemisch zu sein. Geschichte, so der häufige Tenor, habe sich anderswo ereignet, an Afrika sei der Fortschritt vorbeigegangen.
Wie soll man einem solch metaphysisch verkleideten Rassismus entgegentreten?

Howard W. French liefert mit „Afrika und die Entstehung der modernen Welt“ eine argumentationsstarke Gegenerzählung. Wobei das erste Wort des Titels zu präzisieren wäre. „Afrika“ steht hier für die Westküste von Ghana bis Angola, wo die Europäer zunächst ihre Gier nach Gold und dann nach Sklaven befriedigten. French erzählt keine afrikanische, sondern eine transatlantische Geschichte. Gut so!
Damit folgt er nämlich dem Tenor der neueren Globalgeschichte. Demnach verstellt der Blick auf einzelne Nationen oder Regionen den Blick auf dynamische Wechselwirkungen zwischen den Kontinenten, die seit dem 15. Jahrhundert das Zeitalter der ersten Globalisierung einläuteten. „Die Entstehung der modernen Welt“ lässt sich ohne die intensiven wirtscha lichen Verflechtungen zwischen Westeuropa, Westafrika und Amerika, insbesondere der Karibik, nicht verstehen.
Die Schaffung eines ungeheuren Reichtums basierte auf der gewaltsamen Verschleppung von etwa 12,5 Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert die Überfahrt über den Atlantik überlebten. Das Buch ist gespickt mit Wirtscha sdaten, die einen staunen lassen. Zucker aus Brasilien, Jamaika und Haiti machte lange Jahre einen Großteil der Staatseinnahmen in Portugal, England und Frankreich aus und übertraf im Wert die Edelmetallimporte aus Südameri-
ka. Oder die Steigerung der amerikanischen Baumwollproduktion: 1790: 680 Tonnen; 1800: 16.500 Tonnen, 1820: 76.000 Tonnen, 1860: 900.000 Tonnen. Das weiße Gold aus den Südstaaten wurde zum Turbo für die industrielle Revolution in den Fabriken Großbritanniens. Diese „afrikanischen“ Produkte trieben also die Integration der Weltwirtscha entscheidend voran. French betont auch die „Modernität“ der ausbeuterischen Plantagenwirtscha
Gerade kleine Inseln wie São Tomé oder Barbados spielten eine entscheidende Rolle für die Herausbildung kapitalistischer Wirtscha sformen: Arbeitsteilung, Spezialisierung, Synchronisierung der Abläufe und Buchführung.
Der Atlantikhandel wurde einerseits zur Geißel Afrikas (durch Bevölkerungsverluste und politische Fragmentierung) und andererseits zum Wohlstandsmotor und Modernitätsbeschleuniger für Europa. Er prägte über Jahrhunderte maßgeblich die europäische Kultur und Politik. Der karibische Zucker etwa veränderte die europäischen Konsumgewohnheiten im 17. und 18. Jahrhundert grundlegend. Ein Großteil der militärischen Auseinandersetzungen der westeuropäischen Mächte drehte sich um die fetten Erträge der amerikanischen Kolonien und den dafür notwendigen „Nachschub“ an afrikanischen Menschen.
French, ein afroamerikanischer Autor und preisgekrönter Journalist, war lange Jahre Auslandskorrespondent der New York Times, unter anderem in Westafrika und der Karibik. Er beklagt eindringlich, dass afrikanische Geschichte in diesem transatlantischen Sinne in den Schulbüchern kaum vorkommt: „Der Westen erklärt seinen Weg in die Moderne, indem er Afrika aus dem Bild tilgt.“ French sagt dies mit Blick auf die USA, aber in Europa sieht es diesbezüglich wohl noch schlechter aus. Es fehle auch an einer materiellen Erinnerungskultur. Bei seinen Besuchen in Elmina (Ghana), auf Sao Tomé, in Nordbrasilien und im Missis-
»Der Westen erklärt seinen Weg in die Moderne, indem er Afrika aus dem Bild tilgt
sippi-Delta stößt French kaum auf explizite Hinweise, etwa Denkmäler, die das begangene Unrecht dokumentieren. Stattdessen wird etwa auf der Evergreen Plantation in Louisiana – jener Farm, auf der Quentin Tarantino „Django Unchained“ drehte, also der ausbeuterische Rassismus gezeigt wird – den Touristen weiterhin das Bild des harmonischen Miteinanders von weißen Herren und schwarzen Sklaven vermittelt.
Eindringlich schildert French das unsägliche Leid der versklavten Menschen. Von dem Moment an, ab dem sie auf einer Zuckerplantage zu arbeiten begannen, hatten sie im Schnitt nur noch fünf bis sieben Jahre zu leben. Er betont aber auch immer ihre Handlungsmöglichkeiten. Die Sklaven wussten dank ihrer transatlantischen Kommunikationsnetzwerke über politische Ereignisse o schneller Bescheid als ihre Peiniger. Sie waren immer mehr als nur Opfer und erhoben sich häufig. French hebt den erfolgreichen Aufstand der Sklaven in Haiti hervor (1791–1804), die nacheinander mehrere französische und englische Heere schlugen und die zweite Republik in der westlichen Hemisphäre gründeten – im Gegensatz zu den USA aber die Gleichheit der Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe postulierten.
Howard W. French: Afrika und die Entstehung der modernen Welt. Eine Globalgeschichte. Kle -Co a, 512 S., € 36,–

French stützt sich auf die neueste Literatur und hat eine Unmenge an Daten und Fakten zusammengetragen, doch manchmal verliert er sich ein wenig in Details. Auch läu er mitunter Gefahr, alles durch seine transatlantische Interpretationsschablone verstehen zu wollen, also monokausale Erklärungen hervorzubringen. Asien kommt in seiner Globalgeschichte praktisch nicht vor. Hier kommen politischer Aktivismus (Anklage) und Geschichtswissenscha (Analyse) einander ins Gehege. An Frenchs These, der kardinalen und nach wie vor weitgehend ignorierten Bedeutung der Afrikaner für die Entstehung der modernen Welt, ändert das nichts.
 OLIVER HOCHADEL
OLIVER HOCHADEL
Rosa Pock legt nach zweieinhalb Jahrzehnten eine Fortsetzung ihrer Prosa Ein Halbjahr im Leben einer Infantin vor. Journalartige Einträge wie Traumprotokolle, Mikroerzählungen oder (Selbst-) Beobachtungen ö nen einen ebenso individuellen wie universalen Denk- und Emp f indungsraum zwischen Kunst und Wissenschaft, Alltag und Entgrenzung. Ein grandioses poetisch-philosophisches Werk von verblü ender Prägnanz und feinem Humor. www.ritterbooks.com

will
erleben, wird aber nicht gefragt.
Phantombilder und „Cop“-Kino

Rassismus: Georgiana Banita ergründet, warum so viele Opfer tödlicher Polizeieinsätze schwarze Männer sind
Seit vielen Jahren forscht die Kulturwissenscha lerin Georgiana Banita von der Universität Bamberg zum Thema Polizeigewalt. In „Phantombilder. Die Polizei und der verdächtige Fremde“ versucht sie zu verstehen, warum so viele Opfer von tödlichen Polizeieinsätzen junge, schwarze Männer sind. Eine mögliche Antwort findet sie im häufigen Gebrauch des Phantombildes.
Dieses sei aus vielerlei Hinsicht problematisch. So belegten zahlreiche Studien, dass Augenzeugenberichte in der Regel wenig aussagekrä ig sind und sich zumeist sogar als fehlerha erweisen. Ein erster, leicht zu erklärender Grund liegt darin, dass Zeugenaussagen o zu lange nach dem eigentlichen Tathergang aufgenommen werden. Also dann, wenn wichtige Gedächtnisspuren nicht mehr zugänglich sind oder durch Nachinformationen verfälscht wurden.
Von größerem Interesse ist für die Kulturwissenscha lerin jedoch eine zweite, komplexere Erklärung: und zwar, dass unser Gedächtnis maßgeblich auch von unserer eigenen Voreingenommenheit beeinflusst wird. Sich an eine Person zu erinnern, von der man annimmt oder sogar weiß, dass sie eine Stra at verübt hat, trübt unterschwellig auch diese Erinnerung. Und hierin liegt die zentrale Aussage dieses Bandes. Demnach geben Fahndungsfotos in ihrer Gesamtheit mehr Aufschluss darüber, welche moral-kriminologischen Denkweisen in einer Gesellscha vertreten sind, als dass sie zuverlässig zur Au lärung von Verbrechen beitragen. Dass die
Das Porträt eines Anti-Machiavelli
Philosophie: In Zeiten von Krieg und Seuche dachte Montaigne gegen Gewalt und Korruption an
amerikanische Polizei praktisch permanent nach einem „African-American male“ Ausschau hält, während in Europa nach „nordafrikanischen“ und „arabischen“ Männern gefahndet wird, hat laut Banita auch etwas mit rassistischen Vorurteilen über vermeintlich kriminelle Fremde zu tun.
Diese würden Ängste in den Köpfen von Polizisten verstärken. Das mache das Eskalationspotenzial selbst bei harmlosen Kontrollen unverhältnismäßig hoch. Muss eine Polizeikra im Bruchteil einer Sekunde die Gefährlichkeit einer Situation bewerten, dann können diese Bilder zu tödlichen Fehleinschätzungen führen.
„Phantombilder“ ist aber weit von einem Polizei-Bashing entfernt. Die Autorin beteuert ihre Wertschätzung für alle Polizistinnen und Polizisten, die sich täglich verantwortungsbewusst für unsere Sicherheit einsetzen. Ihre Analyse überzeugt jedenfalls mit wissenscha lich fundierten Argumenten und statistisch belegten Beobachtungen. Gerade deshalb könnten manche Leser sich am Ende schwer tun, Banitas Glauben an die Reformierbarkeit der Polizei zu teilen. NICOLLE ADHIAMBO ODONGO
Für den Historiker Volker Reinhardt hat er sich aufgedrängt: Nach Monografien über Renaissancepäpste und -künstler sowie Philosophen der Au lärung (zuletzt Leonardo, Voltaire) lag Michel de Montaigne in vielfacher Hinsicht in der Mitte. Vom Aufstieg aus dem Besitzbürgertum über den Amtsadel bis zur Würde der Erbaristokratie: Zu Beginn zeigt der Autor den Denker und Politiker (1533–1592) als Kind der Zeit, eingebettet in ihre hierarchischen Kämpfe. Da hat es den Anschein, als würde Reinhardt das wenig sympathische Bild eines Arrivisten zeichnen. Aber nicht Eitelkeit treibt Montaigne um, sondern das Bemühen um Konfliktvermittlung. Ein mühsames Geschä : In Rom ist Gegenreformation angesagt. Inquisition, Ketzerverfolgung und Hexenverbrennung stehen in ihrer „Blüte“, Montaigne selbst ist als Agnostiker dem Atheismusverdacht ausgesetzt. Auch den Protestanten in seiner Heimat Bordeaux mangelt es nicht an Fanatismus.
stehen. (Reinhardt vermutet dahinter ein Ausweichen vor der Inquisition.) Nicht nur erkenntnistheoretisch verzichtet Montaigne auf festen Boden, auch in der Moralphilosophie liebäugelt er zunächst mit stoischem Gleichmut und epikureischer Genügsamkeit, findet aber angesichts von Alter, Krankheit und Tod Mut zur gänzlichen Trost-Losigkeit.
Als Berater zweier gegensätzlicher Könige (Heinrich III., Sohn der Katharina von Medici, und Heinrich IV., zunächst Protestant, dann Gründer der Bourbonendynastie) hatte Montaigne durchaus politischen Einfluss. Das zeigt das Edikt von Nantes: Es legt für rund 100 Jahre die Duldung der protestantischen Minderheit fest. Die Ablehnung der Todesstrafe und jeglicher Gewalt in der Herrscha sausübung freilich fand kein Echo.
Georgiana Banita: Phantombilder. Die Polizei und der verdächtige Fremde.
Edition Nautilus, 480 S., € 24,70
295 Seiten, englische Broschur EUR 24,90
ISBN 978-3-99029-577-9

PROF. DR. MANFRED

MATZKA
Jurist, Historiker, Autor, der seit fünfzig Jahren Istrien erlebt und erkundet, hat in seinem vierten Buch über die Halbinsel 20 Entdeckungsfahrten zusammengestellt. „Unser Steinhaus steht am Kvarner, aber unsere kleinen Reisen führen meine Frau Anica und mich durch ganz Istrien – und zwar über die geogra sch de nierte Region zwischen Rijeka und Triest, nicht nur durch die kroatische Gespanschaft gleichen Namens. Und an diesen Reisen, die ich so gerne mache, seit ich ein kleiner Bub war, will ich gerne teilhaben lassen.“
Wıeser

◆ A-9020 Klagenfurt/Celovec • 8.-Mai-Straße 12 Tel. +43 (0)463 37036 • Fax +43 (0)463 37635 office@wieser-verlag.com
Montaignes radikales Gegenrezept: der Zweifel. Nicht nur stellt er alle überkommenen Wahrheiten und jede scheinbare sinnliche Gewissheit infrage, er ist auch der eigenen Erkenntnis gegenüber skeptisch: „Erst verwirren, danach zu eigenem Denken anregen“ ist das Programm des „Virtuosen des Alles-Hinterfragens“. Er weiß, dass er nichts genau weiß. Folgerichtig nennt er sein Hauptwerk „Essais“, Versuche der Annäherung an eine Wahrheit. Jede neue Auflage „korrigiert“ die früheren, hebt sie aber nicht auf; alte Formulierungen bleiben also be-
Letztendlich war Montaigne in den Augen des Biografen kein bloßer Karrierist. Einfühlsam würdigt dieser ihn als Weisen seiner Zeit: „Wahre Gerechtigkeitspflege tötet nicht, sondern schlichtet friedlich und einvernehmlich.“ Nun warten wir auf seinen Heinrich IV.!
THOMAS LEITNERVolker Reinhardt: Montaigne. Philosophie in Zeiten des Krieges. C.H.Beck, 330 S., € 30,80

In Istrien reist man gemächlich, auf kurze Distanz, schaut bei jedem Palazzo um die Ecke, hat nur den nächsten Ort zum Ziel, macht Augen, Ohren, Nasen weit auf, freut sich am Kleinen, sieht das Besondere, entdeckt und gustiert, hat Zeit, Lust und Neugier, lässt sich ein, redet mit den Leuten. Die Routen in diesem Buch sind so gewählt. Man kann sie mit dem Auto jeweils in einem halben Tag gut scha en; nimmt man sich viel Zeit für Details und Genuss, wird auch ein ganzer Tag daraus werden.
Bei den einzelnen Stationen gräbt der Autor – Kulturmensch, sorgfältiger Rechercheur, Olivenbauer und Ehrenbürger von Opatija – ziemlich in die Tiefe, spart aber auch nicht mit Witz und Anekdotischem. Fürs Einkehren unterwegs oder nach der Fahrt gibt er Hinweise – aber bewusst nie mehr als zwei pro Ort und nur solche, die er selber kennt.
In jede Reise ist obendrein ein Tipp des Insiders verpackt, den man wahrscheinlich sonst nicht bekommt, und dazu noch eine gute Geschichte oder ein Rezept Anicas, jeweils zur Gegend passend. Karten, Stadtpläne, Fotos der Plätze abseits der Touristenpfade, Literaturhinweise, ein historischer Abriss und ein übersichtlicher Index runden das Ganze ab.
Der Einzel-Attentäter
Der Historiker Wolfgang Benz würdigt den Schreinergesellen Georg Elser, der 1939 ganz allein einen Anschlag auf Hitler verübte
Auch in ihrer sogenannten Erinnerungskultur erweisen sich die Deutschen als obrigkeitshörig: Das fehlgeschlagene Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 – ausgeführt von adelsblütigen Wehrmachtsoffizieren unter der Leitung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, die jahrelang das Unrechtsregime durch ihr Zögern und Mittun gestützt hatten – ging irgendwann nach dem Krieg als wesentlichster Akt der Auflehnung ins kollektive Gedächtnis ein. Die Verschwörer des 20. Juli wurden zu Helden: Es gab ja doch aufrechte Offiziere!
Der Historiker Wolfgang Benz hält diesem Putschversuch – in dem Moment, als der Krieg verloren war – in seinem Buch „Allein gegen Hitler“ einen anderen Protagonisten entgegen: Georg Elser plante sein Attentat auf Hitler bereits im Jahr 1938, als immer klarer wurde, welche Ziele dieser verfolgte. Elsers Anschlag auf die NS-Führungsriege am 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller war eine logistische und technische Meisterleistung – und eine moralische Überzeugungstat. Zufälle vereitelten das Gelingen des Tyrannenmords, der möglicherweise der Geschichte einen anderen Verlauf gegeben hätte. Elser verschwand in Konzentrationslagern und wurde kurz vor Ende des Krieges hingerichtet.
Nach 1945 gab es wilde Spekulationen über den Einzeltäter. Teils wurde die NS-
Propaganda reproduziert, Elser sei ausschließlich ein Instrument ausländischer Mächte gewesen; teils die These vorgetragen, die Nazis selbst hätten das Attentat inszeniert: um dem Volk zu demonstrieren, dass die „Vorsehung“ den Führer gerettet habe und um Vorwände für den bevorstehenden Westfeldzug zu liefern. Erst in den 1980er-Jahren setzte ein Umdenken ein, unter anderem mit Klaus Maria Brandauers Spielfilm „Einer aus Deutschland“. Georg Elser hatte alleine gehandelt und ging dabei professioneller vor als später die militärische Elite des Reiches. Eine Gleichstellung mit den Helden des 20. Juli aber gelang nie zur Gänze.
„Stets und ständig“ werde Elser „als schwäbischer Schreinergeselle tituliert, als müsse ein Makel konstatiert werden, da er weder von Adel noch aus dem Militär, nicht einmal aus dem Bildungsbürgertum stammte“, stellt Wolfgang Benz ernüchtert fest. „Deshalb wird er über die Region und durch die kleinen Verhältnisse, aus denen er kam, definiert und – bewusst oder absichtslos, aber stets eindeutig – auch stigmatisiert, denn das Attribut ‚schwäbisch‘ konnotiert die Herkun mit Charaktereigenscha en wie Einfalt, Unbildung, Provinzialität, beschränktem Horizont, Naivität.“
Der Antisemitismus- und Widerstandsforscher ist freilich nicht der Erste, der über
Wolfgang Benz: Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elser. C.H. Beck, 224 S., € 27,80

Der leidenschaftliche Zeitgenosse
Georg Elser schreibt. Und auch nicht der Erste, der ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Aber er tut das auf überzeugende Weise, was vielleicht auch mit einer heimatlichen Verbundenheit zu tun hat: Benz, nur unweit von Elsers Heimatort Königsbronn geboren, erörtert dessen Widerstandsgeist aus den regionalen Besonderheiten heraus, gibt tiefe Einblicke in das Milieu, dem Elser entstammte. Und er versucht, die charakterlichen Dispositionen des Widerständlers aus den wenigen erhaltenen Dokumenten zu entwickeln, vor allem den Vernehmungsprotokollen, Zeugenaussagen und Erinnerungen von Zeitgenossen.
Weil es kaum einen besseren Kenner der Hitlerzeit gibt, lässt Benz en passant das Klima dieser Jahre und die politischen Hintergründe einfließen – und all das auf lesenswerte, profunde Weise. Detailliert schildert er die Planungen Elsers, die Ausführung des Attentats sowie die Zufälle, die zu seiner Ergreifung geführt haben. Und die Folgen, die der Anschlag hatte – samt allen internationalen Reaktionen.
Deutlich wird in Benz’ „Allein gegen Hitler“ die Einzigartigkeit dieser couragierten Tat: Der Handwerker Elser folgte keiner Philosophie, keiner Staatsräson, keiner Ideologie, sondern ausschließlich seinem Gewissen.
ULRICH RÜDENAUER
Literatur: Zwei neue Bücher arbeiten sich an Leben und Werk von Thomas Mann ab – und könnten unterschiedlicher nicht sein
Wer hätte das gedacht? Thomas Mann findet heute größere Aufmerksamkeit als etwa Bertolt Brecht, er hat sich als die übergroße Figur der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts durchgesetzt.
Es sind die Widersprüchlichkeiten, das Schlachtfeld der geistigen Kämpfe, die Kälte seiner Beobachtungen und Personenbeschreibungen, die nicht nur eine akademische Leserscha in seinen Bann ziehen. Auch in der aktuellen Burgtheateraufführung des „Zauberbergs“ (empfehlenswert!) kann man erleben, wie sehr der Nobelpreisträger nach wie vor fasziniert.
Die Spezialität seines riesigen belletristischen Lebenswerkes war die Ironie, mit der er die bürgerlichen Verfallsgeschichten ummantelte und dabei das Kunststück zuwege brachte, dass der gebrochene Realismus seiner Romane auch die großen geistigen Auseinandersetzungen der Zeit integrierte.
Ebenso imponiert die politische Lernkurve seines langen Lebens. Früh studierte Thomas Mann den Faschismus („Mario und der Zauberer“) und analysierte in vielen Essays, weshalb sich das Bürgertum ihm so schnell ergab. Die spezifische deutsche Tradition, schrieb er, mache anfällig für die „machtgeschützte Innerlichkeit“.
Jetzt sind (wieder einmal) gewichtige Bücher über Thomas Mann erschienen, die
unterschiedlicher nicht sein könnten und einander doch ergänzen. Zwei Bücher, die auf langjährige Vorarbeiten und Beschäftigung au auen und von sehr verschiedenen Temperamenten und Schreibweisen geprägt sind.
Zwei Biografien, die den Zugang zum „Zauberer“ komplett anders anlegen: Dieter Borchmeyer schießt gleich im Vorwort kräftig gegen einen weit verbreiteten ThomasMann-Biografismus, der Leben und Werk angeblich unlauter vermengt (und sich allzu gern auf die homophilen Neigungen des Meisterschri stellers stürzt).
Allein die Seitenanzahl ist imponierend. Borchmeyer, der den Anspruch hat, die „erste große Werkbiographie“ zu schreiben (was Thomas Mann-Auskenner wohl für übertrieben halten), konzentriert sich ganz auf die „mythisch-kulturgeschichtlich-philosophischen Bezüge“.
Hier waltet eine detektivische Philologie, die alle Arten von Quellen aufspürt. Sehr lehrreich die ausführlichen Passagen über die enorme Bedeutung von Musik in Manns Werk; er befand sich nicht nur „Im Banne Wagners“ (so ein Kapitel). Und dann sind da noch viele Seiten reserviert für die ausführliche Präsentation und kundige Analyse seiner politisch-philosophischen Essays und Mahnreden. Ein monumentaler Reader, eher für den Spezialisten.
Hanjo Kesting: Thomas Mann. Glanz und Qual. Wallstein Verlag, 400 S., € 28,80


Die so unterschiedliche Konzeption der beiden Bücher ist sicherlich auch den Branchen geschuldet, in denen die beiden Autoren gearbeitet haben. Dieter Borchmeyer legte als Germanist und Theaterwissenscha ler im akademischen Betrieb große Arbeiten über die Weimarer Klassik und Richard Wagner vor. Hanjo Kesting war jahrzehntelang Kulturredakteur des Norddeutschen Rundfunks und publizistisch sehr rührig.
Gemäß seiner Schulung pflegt er mehr den pointierten, publizistischen Zugriff, bekennt gleich in der Einleitung, dass er nicht immer ein besonderer Verehrer des Nobelpreisträgers war. Sein Buch verfährt nicht systematisch, sondern schlägt eklektizistische Schneisen ins Werk.
Dieter Borchmeyer: Thomas Mann. Werk und Zeit. Insel, 1552 S., € 59,70
Klar, dass „Die Buddenbrooks“, „Der Zauberberg“, „Joseph und seine Brüder“ eigene Kapitel bekommen, aber vieles andere fällt weg. Hanjo Kesting tut in gewissem Sinn genau das, was Borchmeyer anprangert, widmet einzelne Kapitel dem MannClan (Heinrich, Klaus), wertet genussvoll Thomas Manns Tagebücher als Quelle aus und erzielt so erfrischende, unheroische Innenansichten in „Glanz und Qual“ (so der Untertitel seines Buchs) des Meisterschri stellers.
Diejenigen, die eine Einführung wollen, sind hier gut aufgehoben. ALFRED PFOSER
Die Bausteine für eine mögliche Revolution

Medizin: Der Pulitzer-Preisträger und Krebsforscher
Siddhartha Mukherjee erzählt die Geschichte der Zelle
Antoni van Leeuwenhoek entdeckte Ende des 17. Jahrhunderts Zellen als Bausteine aller Organismen. Das Mikroskop dafür hatte er gebastelt, um die Qualität von Stoffen zu prüfen; denn er war kein Wissenscha ler, sondern Tuchhändler.
1906 erhielten Santiago Ramón y Cajal und Camillo Golgi gemeinsam den Nobelpreis für die Au lärung der Struktur des Nervensystems, obwohl ihre Erklärungsmodelle komplett konträr waren. Erst später konnte Cajals Ansatz bewiesen werden.
Die kleine Emily wäre gestorben, hätte ihr Arzt nicht die verwegene Idee gehabt, ihr statt ihrer Leukämietherapie jene Entzündungshemmer zu geben, die seine eigene Tochter zufällig gerade nehmen musste.
Ganz unterschiedlich klingen die Geschichten, die Siddhartha Mukherjee hier erzählt. Doch zwei Dinge haben sie gemeinsam: Der Autor interpretiert sie auf einer beachtlichen Bandbreite von zutiefst empathisch bis höchst wissenscha lich; und sie kreisen alle um die menschliche Zelle. Der indisch-US-amerikanische Biologe und Arzt arbeitet als Krebsforscher und erfolgreicher Wissenscha svermittler. Sein Buch über den Krebs – „Der König aller Krankheiten“ – bescherte ihm 2011 den Pulitzer-Preis.
Im aktuellen Werk schöp er aus vielen Quellen: Fallbeispiele von Patient:innen, Interviews mit Fachleuten, historische Anekdoten und Experimente verwebt er mit aktuellen Studien und persönlichen Erlebnissen zu einer großen Komposition mit klarem Au au. In sechs Abschnitten
Ebenen der Wirklichkeit
Naturwissenscha : Gerd Ganteför meint, die Physik könne keinesfalls Allwissen beanspruchen
stellt er verschiedene Aspekte der Zelle vor, vom Anfang der Forschung bis zu gegenwärtigen medizinischen Anwendungen – und mit Ausblicken, wie wir uns mit dem Wissen über unsere Bausteine sozusagen neu zusammensetzen könnten, um gesund zu bleiben.
Ein Abschni ist der Corona-Pandemie gewidmet, die wütete, während Mukherjee das Buch schrieb. Er würdigt die Triumphe der Messenger-RNATechnologie, gesteht aber ein: „Die Pandemie hat der Immunologie einen neuen Schub verliehen, aber auch klaffende Lücken in unseren Kenntnissen offengelegt. Sie hat uns ein notwendiges Maß an Demut gelehrt.“
Sprachlich bleibt Mukherjee bei all dem vermittelten Fachwissen stets einfach und klar. Die Balance zwischen stringenter Schritt-fürSchritt-Erklärung und anekdotischer Abschweifung beherrscht er virtuos. Nur manchmal kann die Fülle des Materials etwas müde machen. Was der Autor so poetisch als „Lied der Zelle“ betitelt, ist ein Orchesterwerk für viele Stimmen, die sich auf fesselnde Weise ineinander ranken und ein großes Thema erhellen.
ANDREAS KREMLA
Die Physik ist die Paradedisziplin der exakten Wissenscha en, deren Weltbild sich auf mathematisch beweisbare Gesetze stützt. Ihre teils hochabstrakten Theorien können zwar allermeist nur noch Experten und Expertinnen nachvollziehen – sie werden aber o als ebenso unverrückbare Wahrheiten dargestellt wie die Erkenntnis, dass die Erde rund und Teil unseres Sonnensystems ist. Den Glauben an die Allmacht dieses Denkens diskutiert und hinterfragt nun ausführlich der emeritierte deutsche Physikprofessor Gerd Ganteför in seinem neuesten Buch.
Der Experte für Nanotechnologie und Clusterphysik, der immer auch wissenscha spolitisch engagiert auftritt, rekapituliert zuerst das Wissen seiner Disziplin über Raumzeit, Elementarteilchen, Krä e, Gesetze oder Naturkonstanten sowie die Vorstellung, wie das Universum entstanden ist. Ausführlich diskutiert er dann alle offenen Fragen in seiner Disziplin, von Gravitationswellen und Gammablitzen über Antimaterie oder Dunkle Energie bis zur Quantentheorie der Gravitation. Als interessierter Laie erhält man so einen gut verständlichen Physik-Schnellkurs, der bereitstellt, was den Forscher gedanklich umtreibt.
die Existenz „potenziell gewaltig großer Zonen der Realität aus, über deren Beschaffenheit sich bestenfalls mutmaßen lässt“. Und er fragt sich, ob schwierig zu definierende Begriffe wie Information, Wissen und Geist als Brücke hin zu anderen Ebenen der Wirklichkeit dienen könnten.
Mit solch abstrakten Gedanken steht er nicht allein. Auch der Wiener Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger bezeichnete Information schon als „Urstoff “ des Universums. „Wir tun noch immer so“, sagte er 2013 in einem Interview mit dem ORF, „als ob Raum und Zeit ein Theater wären, in dem sich die Dinge abspielen. Raum und Zeit sind aber von den Dingen in ihnen nicht unabhängig.“ Information könne „nicht unabhängig von dem gedacht werden, dessen Information sie ist“. Und wenn das stimme, so Zeilinger, „behandelt die Physik nicht alleine die Welt ,da draußen‘, sondern besitzt eine subjektive Komponente“.
Gerd Ganteförs Buch bietet Hilfe, um solch merkwürdig anmutende Ideen besser nachvollziehen zu können.
ANDRÉ BEHRSiddhartha Mukherjee: Das Lied der Zelle. Ullstein, 672 S., € 34,–


Dies ist die Geschichte der Halben Welt, die Utopie wurde Wirklichkeit. Die Grenzen sind gezogen, das Territorium geräumt, Menschen dürfen nur noch in ihrer Hälfte der Erde leben, die andere Hälfte wurde zum Naturschutzgebiet erklärt. Ein interessanter Roman über Moral und Wissenschaft, der die Geschichte der Gegenwart fortspinnt und die Zukunft in einer geteilten Welt entwirft.

Die Halbe Welt verwebt Fakten und Fiktion. Wer darf bestimmen, wie das Zusammenleben auf Erden aussehen soll? Liegt die Zukunft darin, dass Menschen zugunsten der Natur in ihrem Lebensraum und ihren Aktivitäten beschnitten werden? Wie es das „Half-Earth-Projekt“ des weltberühmten Biologen Edward O. Wilson plant? milena-verlag.at
Die zentrale Botscha des Buchs lautet: Die Physik kann keinesfalls Allwissen beanspruchen. Die Theorie eines „Urknalls“ beispielsweise, aus dem unser Universum entstanden sein soll, erklärt laut Gerd Ganteför „zwar vieles, nur eben den Urknall nicht“. In unserem Universum macht er Indizien für
DAS HALBE-ERDE-PROJEKT. EINE HÄLFTE FÜR DIE NATUR UND DIE ANDEREN HÄLFTE FÜR DIE MENSCHEN. EIN ABSOLUT AKTUELLER UND ZU DISKUSSIONEN ANREGENDER ROMAN.
David Bröderbauer
DIE HALBE WELT Roman ISBN 978-3-903460-08-9

Gerd Ganteför: Das rätselha e Gewebe unserer Wirklichkeit und die Grenzen der Physik. Westend, 204 S., € 24,70

Trauma, Sex und Therapie
Psychologie: Die Analytikerin Galit Atlas über vererbte Traumata und Möglichkeiten, diese zu überwinden
Die Menschen, die wir lieben und die uns großgezogen haben, leben in uns; wir erfahren ihren emotionalen Schmerz, wir träumen ihre Erinnerungen, wir wissen Dinge, die uns nicht explizit übermittelt wurden, und all dies prägt unser Leben auf eine Weise, die wir nicht immer verstehen“, schreibt die aus Israel stammende Psychoanalytikerin Galit Atlas in ihrem Buch „Emotionales Erbe“. Gleich vorweg: Eine schlüssige Erklärung für diese rätselha en Phänomene kennt auch die Autorin nicht. Dafür zeigt sie Möglichkeiten auf, mit dem Wissen um diese Übertragung konstruktiv umzugehen.

Die mittlerweile in den USA forschende und praktizierende Analytikerin, bekannt für ihre Publikationen zur Sexualität, erzählt in ihrem Buch die Fallgeschichten einiger Patienten. Benjamin etwa hatte schon als Kind o Albträume, in denen er beinahe erstickte, und leidet seit dem Teenager-Alter an Klaustrophobie. Die privat und beruflich überaus erfolgreich wirkende Eve hat sich Hals über Kopf in eine Aff äre gestürzt, durch die sie die Kontrolle über ihr Leben verliert. Leonardo gelingt es auch nach Jahren nicht, mit dem Schmerz nach einer Trennung fertigzuwerden.
„Wir erben Familientraumata – selbst jene, von denen uns niemand etwas erzählt hat“, ist Galit Atlas überzeugt. Die Geschichten von Benjamin, Eve, Leonardo und vielen anderen ihrer Patienten zeigen, wie selbst mehrere Generationen zurückliegende Traumatisierungen, aber auch Gewalterfahrungen in der frühen Kindheit oder der Tod von Familienmitgliedern ein Leben prägen können. „In der Tat hat alles, was wir nicht bewusst über uns wissen, die Macht, unser Leben zu kontrollieren und zu bestimmen, genau wie die Brandungsrückströme unter der Meeresoberfläche ungeahnte Krä e darstellen“, so Atlas.
Benjamin erfährt, dass sein jüdischer Großvater während der Shoah lebendig begraben wurde. Eve wird bewusst, dass ihre Mutter mit zwölf Jahren ihre eigene sterbende Mutter pflegen musste und emotional daran zerbrach. Der homosexuelle Leonardo findet heraus, dass sein Großvater vom Konflikt zwischen seiner Homosexualität und der Unmöglich-
Zu fake, zu fad, hysterisch oder eiskalt
Gesellscha : Beate Hausbichler und Noura Maan rücken die Biografien öff entlich verunglimp er Frauen zurecht
keit, diese auszuleben, in den Suizid getrieben wurde.
Die Traumata der Eltern und Großeltern, so Galit, führen bei Enkeln und Kindern zu Albträumen, psychischen Krankheiten, körperlichen Symptomen oder dem Zwang, bestimmte Muster zu wiederholen. Ähnlich verhalte es sich mit kollektiven Traumata, wie Atlas am Beispiel Israels zeigt, das als Nation von Holocaust-Überlebenden gegründet wurde, die keine Opfer bleiben wollen. Auch ein militärischer Sieg ist für die Psychoanalytikerin stets nur „eine Wiederholung des zugrunde liegenden Traumas, das er eigentlich hätte heilen sollen“.
In die Geschichten ihrer Patienten lässt Atlas neben Ausflügen in die Geschichte der Psychoanalyse auch aktuelle Erkenntnisse zur Epigenetik einfließen. Eine letztgültige Erklärung für all die überraschenden Zusammenhänge bietet freilich auch diese nicht.
Besser erforscht ist hingegen der Weg zur Überwindung der Traumata und ihrer Folgen: Wird die Ursache erkannt und kann dadurch Teil einer Erzählung werden, muss das Trauma nicht aufs Neue durchlebt werden. Seit Benjamin um den grausamen Tod seines Großvaters weiß, kann er endlich „au ören, diese Tatsache in seinem Körper mit sich herumzutragen und sie immer wieder von Neuem zu erleben“. Eve erkennt, dass ihre Affäre ein Versuch war, gegen ihre von der Mutter geerbte innere Leblosigkeit anzukämpfen, und kann sich wieder ihrer Familie zuwenden. Seit Leonardo den Grund für die Verzweiflung seines Großvaters verstanden hat, kann er den eigenen Schmerz überwinden. Galit Atlas’ Schlussfolgerung: „Wenn wir uns bewusst erinnern, wird unser Körper befreit und darf vergessen.“ GEORG RENÖCKL
Bitch, Bimbo, Blow-Job-Queen wurde Monica Lewinsky in den Medien genannt. Ihren eigenen Namen solle sie aufgeben, legte man ihr nahe. Tatsächlich ist er bis heute verknüp mit dem sogenannten „Lewinsky-Skandal“ auch „MonicaGate“ genannt, als wäre sie und sonst niemand verantwortlich. Lewinsky war 22 Jahre alt und Praktikantin im Weißen Haus, als sie sich 1995 in ihren Chef verliebte: Bill Clinton, damals Staatsoberhaupt der USA und verheiratet. Clinton begann mit der
duellen Schicksale wird das misogyne Muster sichtbar, das tief in unserer Gesellscha verankert ist. Frauen werden gemaßregelt, bestra und gedemütigt. Permanent. Vor unser aller Augen. Eine ganze Industrie lebt davon: Klatschmagazine, Frauenzeitschri en, Boulevardmedien. Das Internet hat eine neue Dimension eröffnet. Es scheint normal, dass Frauen beobachtet, bewertet und beurteilt werden. Ob Herrenwitz oder existenzvernichtende Verleumdung – ist sie nicht selbst schuld? Sie drängt sich in die Öffentlichkeit, hat sich schon mal vor einer Kamera ausgezogen, ist zu fake, zu fad, zu sexy, zu unweiblich, hysterisch oder eiskalt. „Wie sie es auch macht, es ist verdammt falsch“, bringt Hausbichler es im klugen Vorwort auf den Punkt. Und schließlich hat schon Eva das Paradies zerstört, Yoko Ono die Beatles und Meghan Markle beinahe die britische Monarchie.
27 Jahre jüngeren Untergebenen eine Beziehung – was er, als Gerüchte für Unruhe sorgten, vorerst abstritt: „I did not have sexual relations with that woman.“
Über Lewinsky brach „eine Lawine öffentlicher Erniedrigung“ herein, die ihr Leben für immer veränderte. Clinton blieb im Amt und Ehemann, sein Name unangefochten. „Dass Lewinsky so verurteilt wurde, obwohl sie weder als Präsident unter Eid gelogen noch ihre:n Partner:in betrogen hatte, spricht nicht nur Bände über die unterschiedlichen Maßstäbe, die an Frauen und Männer in puncto Moral gelegt werden“, stellt Autorin Noura Maan fest, Redakteurin der Tageszeitung Der Standard. Gemeinsam mit ihrer Arbeitskollegin Beate Hausbichler hat sie das Buch „Geradegerückt“ herausgegeben.
Neben dem Porträt von Monica Lewinsky finden sich darin 27 weitere Biografien prominenter Frauen, darunter Marie Antoinette, Paris Hilton, Romy Schneider, Courtney Love und Natascha Kampusch; die meisten verfasst von Kolleginnen vom Standard, wo die Beiträge als Serie erschienen sind.
Die Sammlung ist bunt, aber keineswegs willkürlich. Über die indivi-
Anders als Männer wie Clinton schützen Stand, Position und Geld Frauen nicht. Im Gegenteil: Privilegierte Frauen fallen zu sehen scheint von besonderem Reiz. Mit Mitgefühl dürfen sie nicht rechnen. Das ist (mehr oder weniger) tragisch für jede einzelne prominente Betroffene. Darüber hinaus aber dient es als Lehre für alle Mädchen und Frauen. Denn, so sind die Autorinnen überzeugt, „wie die Öffentlichkeit mit Frauen umgeht, bleibt vor allem bei den Jüngeren hängen: als Bild, wie sie später (nicht) zu sein haben oder wie man Frauen zu behandeln hat. Völlig egal, was sie tun, wie sie aussehen oder was sie leisten. Für künftige Generationen von Mädchen ist es wichtig, dass sich diese frauenverachtenden Erzählungen nicht mehr durchsetzen – und sie einfach Menschen sein können.“
FELICE GALLÉBeate Hausbichler, Noura Maan (Hg.): Geradegerückt. Kremayr & Scheriau, 224 S., € 24,–
Der Online-Shop mit Prinzipien. Über 1.5 Mio. Bücher, DVDs & CDs mit gutem Gewissen bestellen.

»Wie sie es auch macht, es ist verdammt falsch
Das Ungesagte spricht ebenso laut wie das Gesagte
Essay: Siri Hustvedt schreibt über ihre Lebensthemen Kunst und Misogynie und plädiert für mehr O ff enheit
Zu Siri Hustvedts philosophischen Lebensthemen gehören die Kunst, das Gehirn und seine Funktionsweise sowie Misogynie. Diese äußert sich für sie etwa darin, dass Aussagen und Werke von Frauen weniger Respekt erfahren als jene von Männern. Oder dass die Fähigkeit, Kinder zu gebären, nur allzu gern „weginterpretiert“ wird.
Zwischen ihren großen Romanen hat die US-Autorin immer wieder Essaybände vorgelegt. Auf Deutsch erschien 2018 „Die Illusion der Gewissheit“, eine Abrechnung mit der Künstlichen Intelligenz als männlicher Wunschfantasie von der Selbstreproduktion ohne Embryonalentwicklung und Mutter-Kind-Dyade, kurz: ohne Frauen. 2019 folgte „Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Essays über Kunst, Geschlecht und Geist“.
Hustvedts neuer Band verrät schon im Titel, dass sie ihren Lebensthemen treu zu bleiben gedenkt. „Mütter, Väter und Täter“ beginnt mit einer autobiografischen Verortung: ihrer Beziehung zu den verstorbenen Eltern, die ihre Wurzeln in Norwegen hatten, zu ihren Großeltern sowie ihrem Aufwachsen in einer bürgerlichen Familie im entlegenen Minnesota der 1960er-Jahre.
einer Kindheit
50er-Jahren und die Vater aus
Der ideale Vater dieser Kindheitswelt: „eine ferne, aber zuverlässige Gestalt, die nach der Arbeit rechtzeitig vor dem Abendessen für ein formal vertrauliches Gespräch mit Sohn oder Tochter nach Hause kam, aber trotzdem genug Autorität bewahrte, um seinen Kindern Angst zu machen“. Die Mutter hingegen sei „chronisch hilfsbereit und pathologisch fröhlich“ gewesen und habe ihr erst Jahre nach dem Tod des Vaters gestanden, dass es sie gekränkt habe, von diesem ständig unterbrochen worden zu sein.
„Mutterscha war und ist in so viel rührseligen Unsinn getaucht, mit so vielen Vorgaben für das, was man zu tun und zu fühlen hat, dass sie, sogar heute noch, eine kulturelle Zwangsjacke bleibt“, folgert die Autorin. Auch in den Instagram-Postings, in denen schlanke, glamouröse Mütter vor glänzenden Küchen mit dem Nachwuchs kuscheln, sei das noch sichtbar.
Für Hustvedt gibt es keine banalen Fragen oder Gefühle bzw. Fantasien: Sie geht alle Themen mit dem Ernst der Geisteswissenscha lerin und dem Wissen der naturwissenscha lich Gebildeten an, ohne jedoch in akademischen Jargon zu verfallen. Das macht die Texte dieser laut Selbstbezeichnung „intellektuellen Vagabundin“ nicht nur lehrreich, sondern auch gut lesbar.
Dem Unbekannten misst Hustvedt ebenso viel Bedeutung bei wie dem Bekannten. Denn das, worüber nie geredet wurde, spreche in Familiengeschichten und Erinnerungen genauso laut wie das Gesagte. Erinnerungen können von Familienmitgliedern übernommen werden und sich im Laufe des Lebens ändern. Kurz: Die Vergangenheit ist fluide – genauso wie die Gegenwart.
Der Mensch sei weder als Persönlichkeit noch als Körper eine geschlossene Entität. Das beginne schon im Bauch der Mutter, auch wenn die männlich dominierte Wissenscha darauf beharre, das Genom als festgelegten Plan zu interpretieren. „Die tiefe Ironie ist hier, dass es in der Embryologie selbst um Vermischung geht. Spermium und Ei schaffen gemeinsam eine Zygote mit der DNA beider Eltern, und die folgende Gestation im Körper einer Frau ist ein Tanz von zellulärem Austausch, Verquickungen und noch kaum erforschten Mustern eines regen Ver-
DIE SCHUHE
DER VÄTER


ROMAN
Der tief berührende Roman einer Kindheit und Jugend in den 50er-Jahren und die große Recherche über einen Vater aus Siebenbürgen.
kehrs, an dem die Mutter, die Plazenta und der Embryo beteiligt sind.“

Wir seien offene Wesen, betont Hustvedt, die in und mit Abhängigkeit von anderen geboren werden und leben. Der Frauenhass in der entwickelten Welt führe hingegen zu „fundamentalen Falschdarstellungen“ der Rolle der Mutter während der Schwangerscha . Passend dazu stelle die Geburt in der abendländischen Kunst – im Gegensatz etwa zur indischen – kein Motiv dar. Sie glänze durch Abwesenheit.

Reflexionen über Kunst und Kunstwerke nehmen auch im neuen Band breiten Raum ein. Diese begrei Hustvedt ebenfalls als radikal offen: zum Konsumenten hin. Lesen und Schreiben bedeuten für sie Formen des Dialogs. „Jedes Buch wird erfunden, nicht nur von dem, der es schreibt, sondern auch von seinem Leser.“ Und auch Bücher, stellt sie fest, überschreiten ihre (papierenen) Grenzen: „Ein geliebtes Buch bleibt wie ein Geist im Leser, mit bewussten und unbewussten Resonanzen.“ Aber auch das Gegenteil gilt: „Leser aller Art unterdrücken Komplexität und ersetzen sie durch eigene Plattitüden, um das Unbehagen der Ungewissheit zu vermeiden.“
Mit der Lektüre von Siri Hustvedts Texten kann man sich in diese erkenntnisreiche Ungewissheit einüben. KIRSTIN BREITENFELLNER
Siri Hustvedt: Mü er, Väter und Täter. Essays. Rowohlt, 445 S., € 28,80





Die Liebe der Kochschulen zur Geschwindigkeit
Die neuen Kochbücher dieses Frühjahrs folgen drei Trends: jenen zur Schnelligkeit, zur Systematik und zum
Die Kochbuch-Trendshow verzichtet diesmal auf Monumentales. Der Kochbuchrezensent hat (fast) nichts gefunden. An den Trends kommt er nicht vorbei; außer an einem, denn all die ins Kraut geschossenen Kräuter- und Grünzeugbücher hat er durchwatet, aber weitgehend ignoriert. Drei Trends sind nicht zu übersehen: jene zur Digitalisierung (alle kommen aus ihren Lockdowns), zu selbst gemachtem Fast Food und zum Asiatischen. Mittlerweile streut jeder, der sich bereits als Koch fühlt, weil er eine Knackwurst erwärmen kann (auch das will gelernt sein), über die Knacker eine Handvoll Koriander und verschafft sich den Exotismus-Kick. Am wachsenden Angebot an Zutaten in Supermärkten erkennt man, dass in den Küchen zuhause fest asiatisiert wird. Der entlegenste Waldviertler Supermarkt kommt nicht mehr ohne Soyasauce, Wasabipaste und Miso aus. Diese Art von Globalisierung ist zu begrüßen, sofern sie die hiesigen Speisen nicht verdrängt, sondern ebenfalls zu Renaissancen anregt (wovon in dieser Frühjahrssaison wenig zu bemerken ist).
Sophia Giesecke und Uri Triest betreiben unter dem Titel Shemesh Kitchen einen erfolgreichen Foodkanal. Wer sie auf Tiktok und Instagram nicht entdeckt hat, kann sich an dieses Buch halten. Shemesh Kitchen ist ein bisschen von allem, was dieses Semester auf dem Lehrplan steht: gesunde Küche, mediterrane und israelische Einflüsse (Uri ist Israeli) und überkünstelt soll es auch nicht sein. Shemesh heißt auf Hebräisch übrigens Sonne. Wer aber mediterranes Durcheinander erwartet, täuscht sich. Da wird von der Basis an, über Kochbegriffe, den Au au der Gerichte und Zutaten, genau systematisiert. Zuletzt ist das Buch auch noch nach Tageszeiten geordnet. Interessant. Allerdings schleicht sich zwischen Inspiriertes auch Banales, etwa die Zucchinipuffer mit Kräuterquark.

Stevan Paul ist nicht mehr so jung, hat aber ebenfalls einen Hang zur Systematik. Zur sinnvollen. So spontan sein Buch Einfach Urlaub daherkommt, so klug ist es aufgebaut. Nützlich für Camping oder Trekking, versucht es mit minimalen Mitteln in kürzester Zeit Resultate zu liefern. Auf die naheliegende Idee, eine Ajvar-Pastasauce zu machen, muss man erst einmal kommen. Auch Extras wie ein knapper WildkräuterGuide erfreuen; im Großen und Ganzen ist das Buch vor allem supermarkttauglich. Die


spinatgefüllten Frischravioli nimmt jeder Koch einmal zur Hand, Stevan Paul gibt noch als Extra grünen Spargel in die Sauce. Etwas Misstrauen bringe ich dem Wunderblitzteig für die Focaccia entgegen, aber Anregungen für den Urlaub (oder die Blitzküche zuhause) gibt’s jede Menge.

Gordon Ramsay, englischer Starkoch und TVStar, hat aus seiner Geschwindigkeit eine Youtube-Show gemacht. Ramsey in Ten heißt sie und gibt vor, Gerichte in zehn Minuten herstellen zu können. Aber die Vorbereitung zählt nicht mit. Also hält Ramsey im Buch Meine 10-Minuten-Rezepte fest, man müsse die Vorheizzeiten von Herd und Pfanne miteinbeziehen, wodurch aus zehn Minuten gleich einmal zwanzig oder mehr werden. Auch der Tipp, man möge sich fertig geriebenen Käses oder vorgekochten Gemüses bedienen, erfreut nicht wirklich. Andererseits hil Ramseys Zugang zu strukturiertem Kochen; die Abläufe müssen sitzen, wenn es schnell gehen soll, und manche Zutaten für ö ers Zubereitetes kann man selbst einfrieren. Die Rezepte sind international und de ig.

Das Gegenteil von De igkeit ist das Ziel dieses charmanten Buchs. Nistisima bedeutet auf griechisch Fastenspeise. Georgina Hayden, durch Verwandtscha mit der Kultur der orthodoxen Kirche und deren Mönchen vertraut, liefert einen Blick in eine ganz andere Kultur des Fastens als unsere moderne. Zwar wird man überall auf spirituelle Wurzeln des Fastens stoßen; orthodoxe Gläubige fasten fast 200 Tage im Jahr. Da braucht es eine entsprechende (vegetarische) Kultur der Küche: Hier ist sie zu besichtigen.
Das Gegenteil eines Fasters ist der Amerikaner Tim Anderson. In seinem Buch Izakaya befasst er sich mit der Welt der japanischen Izakaya (wörtlich I-Zaka-Ya, Verweilen-Sake-Geschä ), ihren Imbissen und ihrer Atmosphäre, die Anderson mit diesen Rezepten ins Heim tragen will. Es handelt sich bei diesen Gerichten um alkoholbegleitende Häppchen. „Als großer, dummer Amerikaner habe ich einen großen, dummen amerikanischen Geschmack“, sagt Anderson, der Humor hat. „Daher sind vermutlich genau das meine Lieblingsspeisen in Japan.“ Die Vielfalt und Pracht der Gerichte stra ihn Lügen. Ein feines Kochbuch.

Der Wok stammt aus China (das Wort bedeutet Topf). Der Wok ist aber von Indien
Fernen Osten
bis Japan in der asiatischen Küche wichtig. Jeremy Pang gründete eine Kochschule in London, aus der die School of Wok erwuchs, eine physisch und online erfolgreiche Ausbildungsstätte, aus der wiederum dieses Buch entstand. Methodisch und schnell, clever aufgebaut und mit guten Rezepten, ist School of Wok ein guter Einstieg in asiatische Küchen. Die von Pang erfundene „Wok-Clock“ hil , Zutaten in der Reihenfolge ihrer Verwendung einzusetzen, und ist wirklich hilfreich.

Die Japanerin Maori Murota zeigt uns im wunderbaren Buch Japan Home Kitchen, was sie von Mutter und Großmutter gelernt hat. Sie führt uns ernstha in die japanische Küche ein, auf verständliche und nachvollziehbare Weise. Auf unaufdringliche Art wäre uns dann doch so etwas wie ein monumentales Buch untergekommen. Die Kapitel Mehl (Ramen, Okonomiyaki und Dumplings), Reis (Sushi, Donburi und Onigiri), Fermentieren (Natto, Miso und Nakazuke), Gemüse (Salat, Korokke-Sandwich und Frühlingsrollen), Fisch (Dashi, Chawanmushi und Oden), Fleisch (Tonkatsu, Bento und Karaage), Tee und Desserts (Matcha, Castella und Daifuku) öffnen Wege. Schön fotografiert, gehört in jeden Haushalt.


Nun noch zu drei ganz anderen Büchern. Alexandra Maria Rath legt in Süßes wildes Wien ein Sequel vor; einen Stadtführer, der zeigt, was wo wächst. Manchmal wirkt es etwas gezwungen, aber manchmal funktioniert’s. Ob im Türkenschanzpark genügend Maulbeeren wachsen, um all die Rouladen und Maulbeer-Joghurt-Torten herzustellen? Egal, jetzt wissen wir, dass die Maulbeere von den Türken mitgebracht wurde. Es ist nicht Tradition dieser Seite, Firmenbücher vorzustellen. Ausnahme: Jakob Glatz besitzt die portugiesische Traditionsfirma Conserveria Pinhais, die seit mehr als 100 Jahren Nuri-Sardinen produziert. Das von ihm herausgegebene Kochbuch berichtet von der Herstellung, bringt aber auch lustige Rezepte und ist sehr schön gemacht. Nuristas werden Das große Nuri Sardinen Kochbuch haben wollen.
Paul Hollywood – Nomen est Omen. Der Kerl, ins Backgewerbe hineingeboren, ist Showtalent, aber auch Spitzenbäcker, in England gefeierter TV-Star und Autor eines Dutzends von Backbüchern. Dieses, schlicht Bake genannte, ist praktisch, rechteckig und schön. ARMIN THURNHER

Die Falter-Buchbeilage erhalten Sie gratis in folgenden Buchhandlungen
Wien
1. Innere Stadt
A. Punkt | Fischerstiege 1–7
Aichinger Bernhard | Weihburgasse 16
ChickLit | Kleeblattgasse 7
Die Fachbuchhandlung | Rathausstraße 21
Facultas im NIG | Universitätsstraße 7
Freytag & Berndt | Wallnerstraße 9
Frick | Graben 27
Herder | Wollzeile 33
Thalia Kuppitsch | Schottengasse 4
Leo & Co. | Lichtensteg 1
Leporello | Singerstraße 7
Morawa | Wollzeile 11
ÖBV | Schwarzenbergstraße 5
Schaden | Sonnenfelsgasse 4
Tyrolia | Stephansplatz 5
2. Leopoldstadt
facultas.mbs an der WU | Welthandelsplatz 1/D2/1
Im Stuwerviertel | Stuwerstraße 42
Lhotzkys Literaturbuffet | Taborstraße 28 tiempo nuevo | Taborstraße 17a
3. Landstraße
Laaber | Landstraßer Hauptstraße 33
Thalia | Landstraßer Hauptstraße 2a/2b
4. Wieden Jeller | Margaretenstraße 35 I
NTU.books | Wiedner Hauptstraße 13
5. Margareten
Buchinsel | Margaretenstraße 76
6. Mariahilf
Analog | Otto-Bauer-Gasse 6/1
Thalia | Mariahilfer Straße 99
7. Neubau
Audiamo | Kaiserstraße 70/2
Hintermayer | Neubaugasse 27
Posch | Lerchenfelder Straße 91
Walther König | Museumsplatz 2
8. Josefstadt
Bernhard Riedl | Alser Straße 39
Eckart | Josefstädter Straße 34
Lerchenfeld | Lerchenfelder Straße 50
9. Alsergrund Buch-Aktuell | Spitalgasse 31
Facultas am Campus | Altes AKH | Alser Straße 4
Hartliebs Bücher | Porzellangasse 36
Löwenherz | Berggasse 8
Oechsli | Berggasse 27
Orlando | Liechtensteinstraße 17 Yellow | Garnisongasse 7
10. Favoriten Facultas | Favoritenstraße 115
12. Meidling
Frick | Schönbrunner Straße 261
13. Hietzing
Kral | Hietzinger Hauptstraße 22
14. Penzing
Morawa Auhof Center | Albert Schweitzer Gasse 6
15. Rudolfsheim-Fün aus Buchcafé Melange | Reindorfgasse 42 Buchkontor | Kriemhildplatz 1 Thalia Bahnhof CityWien West | Europaplatz 1
16. O akring Margaritella | Ottakringer Straße 109
17. Hernals Book Point 17 | Kalvarienberggasse 30
18. Währing Hartliebs Bücher | Währinger Straße 122
19. Döbling Baumann | Gymnasiumstraße 58 Georg Fritsch | Döblinger Hauptstraße 61 Stöger-Leporello | Obkirchergasse 43 Thalia Q19 | Kreilplatz 1
20. Brigi enau Hartleben | Othmargasse 25
21. Floridsdorf Bücher Am Spitz | Am Spitz 1 Kongregation der Schulbrüder | Anton-Böck-Gasse 20
22. Donaustadt
Freudensprung | Wagramer Straße 126 Morawa V.I.C. | Wagramer Straße 5
Seeseiten | Janis-Joplin-Promenade 6
Thalia | Donauzentrum | Wagramer Straße 94
23. Liesing Lesezeit – Liesing | Breitenfurter Straße 358
In Mauer | Gesslgasse 8A
Frick EKZ Riverside | Breitenfurter Straße 372
Niederösterreich
Korneuburg | Stockerauer Straße 31, 2100 Korneuburg
Am Hauptplatz | Hauptplatz 15, 2320
Schwechat
Morawa | SCS, Galerie 27, 2334 Vösendorf
Kral | Elisabethstraße 7, 2340 Mödling
Valthe | Wiener Gasse 3, 2380 Perchtoldsdorf
Riegler | Kirchengasse 26, 2460 Bruck an der Leitha
Bücher-Schütze | Pfarrgasse 8, 2500 Baden
Papeterie Rehor | Theodor-KörnerPlatz 6, 2630 Ternitz
Hikade | Herzog-Leopold-Straße 23, 2700 Wiener Neustadt
Thalia | Hauptplatz 6, 2700 Wr. Neustadt
Mitterbauer | Wiener Straße 10, 3002 Purkersdorf
Sydy’s | Wiener Straße 19, 3100 St. Pölten
Thalia | Kremser Gasse 12, 3100 St. Pölten
Fragner | Hauptplatz 12, 3250 Wieselburg
Schmidl | Obere Landstraße 5, 3500 Krems/Donau
Murth | Wiener Straße 1, 3550 Langenlois
Rosenkranz | Els 127, 3613 Els
Kargl | Hauptplatz 13–15, 3830 Waidhofen/Thaya
Spazierer | Budweiser Straße 3a, 3940 Schrems
Stark Buch | Bahnhofstr. 5, 3950 Gmünd
Oberösterreich
Fürstelberger | Landstraße 49, 4013 Linz
Alex | Hauptplatz 17, 4020 Linz
Buch plus | Südtiroler Str. 18, 4020 Linz
Bücher & Mehr | Klosterstraße 12, 4020 Linz
In der Freien Waldorfschule | Waltherstraße 17, 4020 Linz
Neugebauer | Landstraße 1, 4020 Linz
Thalia | Landstraße 41, 4020 Linz
Buchhandlung Auhof | Altenbergerstraße 40, 4045 Linz-Auhof
Wolfsgruber | Pfarrgasse 18, 4240 Freistadt
Wurzinger | Hauptplatz 7, 4240 Freistadt
Obereder | Markt 23, 4273 Unterweißenbach
Ennsthaler | Stadtplatz 26, 4400 Steyr
Hartlauer | Stadtplatz 6, 4400 Steyr
Michael Lenk | Vogelweiderplatz 8, 4600 Wels
SKRIBO GmbH | Stadtplatz 34, 4600 Wels
Thalia | Schmidtgasse 27, 4600 Wels
Schachinger | Untere Stadtplatz 20, 4780 Schärding
Kochlibri | Theatergasse 16, 4810 Gmunden
Thalia | Pfarrgasse 11, 4820 Bad Ischl
Michael Neudorfer | Hinterstadt 21, 4840 Vöcklabruck
Schachtner | Stadtplatz 28, 4840 Vöcklabruck
Bücherwurm | Bahnhofstraße20, 4910 Ried
Thalia | Wohlmeyrgasse 4, 4910 Ried/Innkreis
Der Buchladen | Stadtplatz 15-17, 5230 Mattighofen
Salzburg
Bücher-Stierle | Kaig. 1, 5010 Salzburg
Motzko | Elisabethstr. 24, 5020 Salzburg
Facultas NAWI-Shop | Hellbrunner Straße 34, 5020 Salzburg
Höllrigl | Sigmund-Haffnergasse 10, 5020
Salzburg
Morawa SCA | Alpenstraße 107, 5020 Salzburg
Rupertusbuchhandlung | Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg
Thalia | Europastraße 1, 5020 Salzburg
Morawa Shoppingcity Seiersberg | Top 2/2/12, 8055 Salzburg
Riepenhausen | Langer Graben 1, 6060 Hall in Tirol
Riepenhausen | Andreas-Hofer-Straße 10, 6130 Schwaz
Steinbauer, EKZ Cyta | Cytastraße 1, 6167 Völs
Zangerl | Salzburger Straße 12, 6300 Wörgl
Lippott | Unterer Stadtplatz 25, 6330
Kufstein
Tyrolia | Rathausstraße 1, 6460 Imst
Jöchler | Malserstraße 16, 6500 Landeck
Tyrolia | Rosengasse 3-5, 9900 Lienz
Vorarlberg
Ananas | Marktplatz 10, 6850 Dornbirn
Brunner | Marktstraße 33, 6850 Dornbirn
Rapunzel | Bahnhofstraße 12, 6850 Dornbirn
Brunner | Rathausstraße 2, 6900 Bregenz
Ländlebuch | Strabonstraße 2a, 6900 Bregenz
Brunner | Konsumstraße 36, 6973 Höchst
Burgenland
s’Lesekistl | Obere Hauptstraße 2, 7122 Gols
Pokorny | Schulgasse 9, 7400 Oberwart
Wagner | Grazer Str. 22, 7551 Stegersbach
Steiermark
Bücherstube | Prokopigasse 16, 8010 Graz
ÖH Unibuchladen | Zinzendorfgasse 25, 8010 Graz
Moser | Am Eisernen Tor 1, 8010 Graz
büchersegler | Lendkai 31, 8020 Graz
Morawa | Lazarettgürtel 55, 8025 Graz
Plautz | Sparkassenplatz 2, 8200 Gleisdorf
Morawa | Wiener Straße 2, 8230 Hartberg
Buchner | Hauptstraße 13, 8280 Fürstenfeld
Morawa | Hauptplatz 2, 8330 Feldbach
Morawa | Hauptplatz 6, 8530 Deutschlandsberg
Morawa | Mittergasse 18, 8600 Bruck/ Muhr
Mayr | Kurort 50, 8623 Aflenz
Kerbiser | Wiener Straße 17, 8680 Mürzzuschlag
Morawa | Hauptplatz 19, 8700 Leoben
Morawa | Burggasse 100, 8750 Judenburg
Hinterschweiger | Anna Neumannstraße 43, 8850 Murau Buch + Boot | Altausse 11, 8992 Altaussee
Kärnten
Heyn Johannes | Kramergasse 2, 9020 Klagenfurt
Tirol
Haymon | Sparkassenplatz 4, 6020 Innsbruck
Studia | Innrain 52f, 6020 Innsbruck
Wagner’sche | Museumstraße 4, 6020 Innsbruck
Tyrolia | Maria-Theresien-Straße 15, 6020 Innsbruck
Die Kärntner Buchhandlung | Wiesbadener Straße 5, 9020 Klagenfurt Besold | Hauptpl. 14, 9300 St. Veit/Glan
Die Kärntner Buchhandlung | Bahnhofsplatz 3, 9400 Wolfsberg
Die Kärntner Buchhandlung | 8.-Mai-Platz 3, 9500 Villach
Spittaler Stadtbuchhandlung | Tiroler Straße 12, 9800 Spittal am Millstätter See
VIEL
Geheimnisvolles, verstecktes und schönes Wien
FALT
BEZAUBERNDE ZIEGEL

Viola Rosa Semper | Charlotte Schwarz
Quer durch Wien zu den eindrucksvollsten Backsteinhäusern und Sichtziegelbauten.

256 Seiten, € 29,90
VERLOCKENDE OASEN
Viola Rosa Semper | Charlotte Schwarz
Eine Entdeckungsreise zu den schönsten öffentlich zugänglichen Grünanlagen Wiens.
248 Seiten, € 29,90
FASZINIERENDE WEGE
Gabriele Hasmann | Charlotte Schwarz
Die schönsten, geheimnisvollsten, verborgensten Stiegen und Brücken.
248 Seiten, € 29,90
GEHEIME PFADE

Gabriele Hasmann | Charlotte Schwarz
Verborgene Kleinode in Durchhäusern, Innenhöfen und Gassln entdecken.
248 Seiten, € 29,90


