Bücher-Herbst 2022



Mitten in den einsamen North York Moors fährt eine junge Frau allein durch eine kalte Dezembernacht. Am nächsten Morgen ndet man sie in ihrem Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg steht, ermordet auf. Könnte ein unbekannter Beifahrer involviert sein?
Das große Brotbackbuch

Warmen Teig unter den Hand ächen spüren, an knusperfrischem Brot schnuppern ... wer das Brotbacken einmal erlebt hat, kann nicht mehr genug davon bekommen.
eBook:
24/7 online einkaufen.
Andreas Gruber Todesrache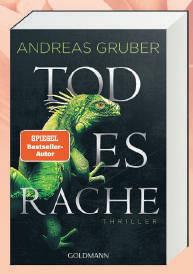
Ein neuer Fall für BKA-Pro ler Maarten S. Sneijder. Unter Hochdruck muss er nun ein neues Team zusammenstellen, um die Verstrickungen eines hochkomplexen Falles zu lösen und Kollegin Sabine Nemez zu retten.

eBook: € 10,99 | Digitales Hörbuch: € 9,89













Die junge Hofdame Adela, verheiratet mit einem Ritter des Königs, verliebt sich unsterblich in einen leibeigenen Bauer des Königs. Als die Situation unerträglich wird, ieht er, nicht ahnend, dass Adela von ihm schwanger ist. Dann bricht Krieg aus! eBook: € 20,90 | Digitales Hörbuch: € 24,99

Messner spricht o en von Krisen und Enttäuschungen, von Trennung und Neuanfang. Eine wichtige Rolle kommt dabei seiner Frau Diane zu, die ihren eigenen Blick auf ihren berühmten Mann hat.
eBook: € 18,99 | Digitales Hörbuch: € 12,–

Leichtfüßig und fundiert wird erklärt, warum Glücksgefühle unsere Lebensdroge sind, wie subjektiv die Wahrnehmung von der Welt ist und wie sich durch Erziehung und Erfahrungen das Selbstbild formt.
eBook: € 17,99 | Digitales Hörbuch: € 10,95
Neben dem Schwerpunkt zur spanischen Literatur (Spanien ist Gastland bei der Frankfurter Buch messe) gibt es gleich noch eine Strecke mit Büchern über (das historische) Wien. Überhaupt bleiben his torische Romane ein boomendes Genre, so wie auch Autofiction stark vertreten ist.

„Die Liebeslieder von W. E. B. Du Bois“ von Honorée Fanonne Je
ers
„Along the color line“ von W. E. B. Du Bois 5
„Zami“, die Autobiografie der Audre Lorde 6 „Der verbotene Bericht“, ein Roman von Laila Lalami 7
„Rückläufiger Merkur“ von Emily Segal 8
Hernan Diaz’ 1920er-Jahre-Roman „Treue“ 8
Almudena Grandes’ „Die drei Hochzeiten von Manolita“ 9 „Tomás Nevinson“, der letzte Roman von Javier Marías 10 Fernando Aramburu: „Die Mauersegler“ 11 „Die Wunder“, Romandebüt von Elena Medel 12
Mircea C ărt ărescu: „Melancholia“ 12
„Schauergeschichten“ von Péter Nádas 13
Drei Romane dreier junger Schri stellerinnen: Hanna Bervoets, Lieke Marsmann und Lize Spit 14
„Wer hat Bambi getötet?“ von Monika Fagerholm 15
„Die Kinder des Ho uweliers“ von Gunnar Bolin 16 Stephen Spenders Langgedicht „Vienna“ 16 Eine Begegnung mit dem Flaneur Oskar Aichinger 17 Ernst Strouhal über seine Mu er und seine Tanten 18–19 Bücher von Vera Ferra-Mikura und Franziska Tausig 20
Romane von Elisabeth R. Hager und Helena Adler 21 Martin Mosebachs „Taube und Wildente“ und „Emil“ von Mariam Kühsel-Hussaini 22 Jan Faktors Schelmenroman „Tro el“ 23 Nicolas Mathieu: „Connemara“ 24 „Steinway“ von Rongfen Wang 25
Drei Grad mehr: Das wäre eine Welt, wie wir sie nicht kennen wollen. Klimabücher zeigen aber auch Auswege auf. Außerdem beschä igen uns Russ land und Putins Invasion der Ukraine. Und die Sci ence Busters huldigen seit 15 Jahren dem wissen scha lichen Hochamt: Zeit für ein Jubelbuch.
Suchen und finden, Räuber und Ri er 26 Kinderbücher
Krimireihe mit Katze, eine Oma-Geschichte und die Sams 28 Jugendbücher Science-Fiction-Liebes-Story und wahre Jugendgeschichte 30
Klimabücher: „3 Grad mehr“, „Earth for All“ des Club of Rome und „Sturmnomaden“ 32 Charles Foster über „Jagen, sammeln, sessha werden“ 34 Biodiversität, von Jasmin Schreiber persönlich erklärt 35 Philipp Blom über die Unterwerfung der Natur 36
Der Homo Sapiens in der Digitalisierung 37 1923, ein Schlüsseljahr deutscher Geschichte 38 Freud, Frankl, Adler: die Urväter der Psychotherapie 40
„Die längste Buchtour“ der Ukrainerin Oksana Sabuschko 41 Putin, der „Killer im Kreml“, und die russische Geschichte 42 Historiker Manfred Hildermeier: Russland und der Westen43 Was das Jüdische für Marcel Proust bedeutete 44
„Isidor“: Das Ende eines jüdischen Geschä smanns 44 Ian Mortimer führt ins England um 1800 45
15 Jahre und ein Jubelbuch: Science Busters im Interview 46 Vom Rätsel der Zeit und dem Traum von Unsterblichkeit 48
Die Entwicklung des Wissens bis zum Anthropozän 49 Was wir von Primaten über Gender lernen können 50
Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten 50 Graphic Novel: Kinder überleben den Holocaust 51 Biografie: Amartya Sen ist „zuhause in der Welt“ 52
Fußball: Messi, Ronaldo und das große Geld 52 Mode und Geschlecht: Barbara Vinken übers Ver-Kleiden 53 Armin Thurnher kennt die neuen Kochbücher 54
Schorsch Feierfeil ist Illustrator, Grafiker und Animationsfilmemacher. Er lebt und arbeitet in Wien, wo er seine Leidenscha für Grant und Schmäh gut aufgehoben weiß. Dem FALTER ist er seit vielen Jahren zeichnerisch eng verbunden. Zudem ist er stolzer Besitzer einer eigenen Homepage:
Palm
Eva Rossmann Helena Adler
Anna Kim Hervé Le Tellier
Antonic
Stermann
Lisz Hirn
Heinrich Steinfest
Yoko Tawada Dieter SperlInsa WilkeMaja Haderlap
Andreas Unterweger Esther Kinsky
Tim Wol

Raoul Schrott Barbara Frischmuth
Erica Fischer Josef Winkler Olga Flor
Günter Eichberger
Outof Joint Yvonne VölklNils Jensen
Kurt Fleisch Denis Scheck Johannes Silberschneider
Valerie Fritsch
Felix Mitterer Cornelia Travnicek Jurij Andruchowytsch
Robert Menasse Michael Ostrowski Christoph W. Bauer Angelika Stallhofer
Siljarosa Schletterer Maria Muhar
Martin G. Wanko
Timo Brandt Sebastian SchmidtMichael Köhlmeier
Nnebedum
Takoua Ben Mohamed
Norbert Gstrein Fiston Mwanza Mujila
omas Stangl

Cometogether– Grazer schreiber:inStadt
Tausendseitige Romane sind im mer eine Anmaßung. Sie bean spruchen schon qua Umfang eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit, und die hat das Romandebüt der bis dahin vor allem als Lyrikerin in Er scheinung getretenen Honorée Fa nonne Jeffers, Jahrgang 1967, in den USA auch zu lukrieren vermocht: „Ein brillantes Epos, wie es nur einmal in zehn Jahren erscheint“, urteilte etwa die Washington Post
Die „Epos“-Assoziation drängt sich auf, beginnen „Die Liebeslieder von W. E. B. Du Bois“ doch vom ersten Satz an mächtig und bedeutsam zu orgeln: „Wir sind die Erde, das Land. Die Zunge, die spricht und die stol pert über die Namen der Toten, wenn sie sich herantraut an die Ahnen einer Frau und an ihre Geschichten. An ihre Vorfahren, ihren Boden, ihre Bäume, ihr Wasser.“

Als „Song“ sind jene Abschni e ausge wiesen, in denen – immer wieder in der ersten Person Plural – die Ge schichte einer zunehmend blutigen Landnahme nachgezeichnet wird, in der die englischen Kolonisten und deren Nachfahren die indigene Be völkerung verdrängen, vertreiben und niedermetzeln, um durch den Skla venhandel der rassistischen Gewalt schließlich auch noch eine transkon tinentale Dimension zu eröffnen.
Man könnte Jeffers’ Roman auch als eine Art literarischer Ahnenfor schung bezeichnen. Denn tatsächlich
beschä igt sich die 1973 geborene Ai ley Pearl Garfield, auf welche die im „Song“ abgespulte Linie der Vorfah ren zuläu , im Rahmen ihrer verspä teten akademischen Karriere genau mit einem solchen Projekt und wird dabei Zusammenhänge aufdecken, die für sie und ihre Familie überra schend, wenn nicht schockierend aus fallen. Darüber hinaus kommt ihr als Ich-Erzählerin der gewichtigste Part innerhalb des polyphon konzipierten Romans zu.
Irgendwann und irgendwie sind schließ lich alle mit allen verwandt und ha ben indigenes, weißes und schwarzes „Blut in den Adern“, was sich aller dings nicht notwendigerweise in der Hautfarbe als vermeintliches Indiz der ethnischen Abkun manifestie ren muss.
„Brown sugar lassie, / Caramel tre at, / Honey-gold baby / Sweet enough to eat. / Peach-skinned girlie, / Coffee and cream, / Chocolate darling / Out of a dream.“ So hat der selbst über vieler lei Vorfahren verfügende Harlem-Re naissance-Dichter Langston Hughes die erotische Attraktivität unterschied licher Schattierungen der Haut in sei nem Gedicht „Black and Beautiful“ be sungen. Bei Jeffers wird die Kulinarik des Spektrums noch erweitert: „Ihre Haut hatte die Farbe eines mit reich lich Butter zubereiteten Mürbteigs.“
So g’schmackig und harmlos geht es freilich nur selten zu, denn Hautfar be als Distinktionsmerkmal produ ziert eine ganze Reihe von Sichtwei sen und Praktiken der Segregation, die
im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden und keineswegs nur weiße Rassisten affiziert.
In „The Souls of Black Folk“ (1903) hat W. E. B. Du Bois (siehe auch Rezen sion auf Seite 5) seine Theorie vom „doppelten Bewusstsein“ entwickelt, die besagt, dass Schwarze sich selbst auch durch die Brille der Weißen be trachten und deren Stereotypen über nehmen. Exemplarisch kommt dies im Roman in jener Szene zum Aus druck, in der sich Aileys „Nana“ über den „schrecklich dunklen“ Freund von deren Schwester Lydia auslässt und der Enkelin ins Gewissen redet: „Frau en verhelfen der Familie zum Aufstieg, Ailey, nicht zum Abstieg. Du bist sehr, sehr braun. Du musst also jemand deutlich Helleren finden.“
Das so genannte „Passing“, also die „Chance“, als „weiß“ wahrgenom men zu werden, ist ein zweischneidi ges Schwert: Es mag vor der Zwangs arbeit auf den Plantagen bewahren, aber die Angst aufzufliegen, bleibt auch nach Abschaffung der Sklave rei virulent. Das erfährt etwa Aile ys hellhäutiger Großonkel, als er sich einmal in der „weißen“ Schlange fürs Brot anstellt und glatt von einem der Franklins verpfiffen wird, die im Ro man generationenübergreifend für jene Weißen stehen, die ihre vermeintliche Zukurzgekommenheit durch übelsten Rassenhass kompensieren.
Der ein biblisches Alter erreichende „Uncle Root“ aber ist so etwas wie das personifizierte Gravitationszentrum des Romans. Er verkörpert den nicht
nur intellektuell integren, sondern ge nerell gütigen und solidarischen „Neg ro“, der es vorzieht, an einem College für Schwarze in Georgia zu unterrich ten, statt Karriere an einer der pres tigereichen Ivy-League-Universitäten im Norden des Landes zu machen.
In der deutschen Übersetzung wird der historische, als Selbstbezeichnung verwendete Begriff im Englischen be lassen, weil das deutsche Äquivalent eindeutig rassistisch konnotiert ist. Darüber hinaus haben sich die bei den Übersetzerinnen, Maria Hum mitzsch und Gesine Schröder, dazu entschlossen, immer wieder einzelne Sätze, Halbsätze oder Begriffe (wie etwa „brother“ und „sister“) im Eng lischen zu belassen, um das im Roman gesprochene African American Verna cular English nicht in einen deutschen Dialekt oder Slang übertragen zu müs sen, der bloß nach „fehlerha em Eng lisch“ klänge.
Das funktioniert über weite Strecken so gar besser, als ein Deutsch à la „Die Tussi ist so krass schräg“ („That girl is so damned weird“) oder das ener vierend o gebrauchte „Spätzchen“ für „darling“. Der Umstand aber, dass die Sprache des Romans vor allem im den mythisch-pathetisch raunenden „Song“-Passagen immer wieder in blühenden Kitsch kippt und keinen konsistenten Ton findet, ist nicht der Übersetzung anzulasten, sondern ein entschiedenes Defizit des Originals, das seine hohen Ambitionen nicht li terarisch tri ig umzusetzen vermag. Am stimmigsten sind „Die Liebes
lieder des W. E. B. Du Bois“ noch dort, wo sie aus der Perspekti ve Aileys dialoglastig und ziemlich konventionell eine Coming-of-AgeGeschichte erzählt, die von dem Um stand überschattet wird, dass nicht nur diese, sondern auch ihre beiden älte ren Schwestern vom eigenen Groß vater sexuell missbraucht wurden. Während Lydia ihrer ausführlich dargestellten Crack-Sucht erliegt, hat Coco auf Seite 637 ihren einzigen be deutsamen Au ritt und muss sich an sonsten mit der Rolle der Quotenlesbe bescheiden.

Der Roman ist eine Mogelpackung inso fern, als der ahnenforscherische Auf wand mit seinen endlos verzweigten und in alttestamentarischer Mono tonie ausgebreiteten Stammbäumen außer Verwirrung und Ennui lediglich die fragwürdige Erkenntnis produziert, dass die vor Inzest und Pädophilie nicht zurückschreckende sexualisier te Gewalt eine Art kolonialer Erbsün de darstellt.
Überzeugender, wenn auch nach „Intersektionalismus“-Seminar-Ma sche gestrickt sind jene Passagen, in denen der Machismo der „brothers“ aufs Korn genommen wird, die den „sisters“ nur an die Wäsche oder schlicht bekocht werden wollen. Er stehle ihr nur die Zeit, in der Hoff nung „auf einen Nachschlag von mei ner Schwarzen Frauenmuschi“, faucht Ailey einen Lover an. Die Frage, wel che Geschlechter über eine Muschi verfügen, wird dann allerdings nicht mehr erörtert. F
»W. E. B. Du Bois’ Theorie vom „doppelten Bewusst sein“ besagt, dass Schwarze sich selbst auch durch die Brille der Weißen betrachten und deren Stereotypen übernehmen
ILLUSTRATION: GEORG FEIERFEIL„Die Wiener Fröhlichkeit, ihren Witz, ihr Pariser Flair gibt es immer noch. […] Bevor ich hierherkam, dachte ich, ein Zusammenschluss von Österreich und Deutschland wäre am Ende un vermeidlich. Heute bin ich da nicht mehr so sicher. Österreich hat eine eigene Persönlichkeit, die sich nicht so leicht vereinnahmen lässt.“
Das schreibt William Edward Burg hardt Du Bois, wie er mit vollem Na men hieß, in seiner Kolumne vom 9. Jänner 1937. Davor hatte der Soziolo ge, Historiker, Publizist, Schri steller und Bürgerrechtler, der als erster Af roamerikaner in Harvard promovier te, Belgien und England bereist und sich mehrere Monate in Deutschland aufgehalten. Offizieller Anlass war ein Stipendium zum Zweck, die Berufs ausbildung in der Industrie zu stu dieren – wovon er sich nach einem Besuch der Siemensstadt durchaus beeindruckt zeigt –; tatsächlich geht es in du Bois’ Berichten, die er für den Pittsburgh Courier, die zeitwei se auflagenstärkste afroamerikani sche Tageszeitung der USA, verfass te, um eine Auseinandersetzung mit dem „Rassenproblem“.
Dass die Kategorie der „Rasse“ wis senscha lich längst als Mythos ent larvt wurde, weiß du Bois; der Rassis mus aber sei damit längst noch nicht aus der Welt geschafft und das „Prob lem einer Gruppe, die wir aus sprach licher Notwendigkeit eine Rasse nen nen müssen und deren historische Bezeichnung ,Negro‘ lautet“ und letzt endlich eine Angelegenheit „der far bigen und schwarzen Arbeiterklasse“.
Europa ist für den 1868 in Great Bar rinton, Massachusetts „frei“ gebore nen Nachfahren sowohl von Sklaven als auch von Sklavenhaltern immer auch die Kontrastfolie zur US-ame rikanischen Heimat, die der während der McCarthy-Ära Gegängelte und als „ausländischer Agent“ Angeklag te 1961 Richtung Ghana verlässt, wo er 1963 im Alter von 95 Jahren ver stirbt – einen Tag vor dem „Marsch auf Washington“, bei dem Martin Luther King seine berühmte Rede („I have a dream“) halten sollte. Der studierte Altphilologe und glühende Wagner-Bewunderer zeigt sich einem klassisch-humanistischen Bildungs ideal verpflichtet und darob begeis tert, dass jede größere deutsche Stadt über ein Theater und Opernhaus ver fügt, wo man „das Beste aus Musik und Theater“ zu sehen bekomme und

zwar „zum Preis eines Damen-Som merhutes für die Spielzeit“.
Auch werde man als Person of Color – sofern man über „gute Ma nieren“ verfüge – stets unvoreinge nommen und höflich, allenfalls mit freundlich Neugier behandelt; wenn gleich der durchschnittliche Europäer, wie du Bois im Zusammenhang mit den Olympischen Spiele in Berlin sar kastisch anmerkt, davon ausgehe, „die Hauptbeschä igung schwarzer Ame rikaner bestehe darin, sich lynchen zu lassen“.
Der Antisemitismus der Nazis entgeht dem Europareisenden freilich nicht und gilt ihm als „Angriff auf die Zi vilisation, vergleichbar lediglich mit den Schrecken der spanischen Inqui sition und des afrikanischen Sklaven handels“. Womit du Bois’ Beobachtun gen, wie Herausgeber Oliver Lubrich in dem mustergültig edierten und kommentierten Band im Nachwort anmerkt, direkt auf den „Zweiten His torikerstreit“ der Gegenwart verweist, die Frage nämlich, ob die Shoa einzig artig oder ihrerseits Teil einer globa len Kolonialgeschichte sei.
Die Erfahrungen von Schwar zen und Juden begrei du Bois, in den Worten Lubrichs, als „vergleich bar, aber nicht gleich“. Seine Kolum nen aus den Jahren 1936/37 müssen heute selbstverständlich historisch ge lesen werden. Aus der Distanz wirkt sein Glaube an die Macht der Bildung vielleicht etwas naiv, seine Auffassung, dass Nazi-Deutschland und die Sow jetunion als „die beiden größten sozia listischen Staaten der modernen Welt“ zu gelten hätten, befremdlich. Abgese hen davon aber erweisen sich du Bois’ Beobachtungen und Analysen durch wegs als hellsichtig und präzise; etwa wenn er die Bedeutung des Rundfunks für die Verbreitung der Nazi-Ideolo gie betont und Propaganda generell als „[d]ie größte Erfindung des Welt kriegs“ bezeichnet – womit naturge mäß der Erste gemeint ist. KN
W.E.B. Du Bois: „Along the color line“. Eine Reise durch Deutschland 1936. Hg. v. Oliver Lubrich. Aus dem Engl. von Johanna von Koppenfels. Ch. Beck textura, 168 S., € 21,50

Die US-amerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde legt in „Zami“ ihr Leben als schwarze, lesbische Frau off en

Ihre erste Liebe stirbt tragisch früh. Als sich die Schulfreundin mit Arsen vergif tet, ist Audre gerade 16 Jahre alt. Den Ver lust muss sie alleine bewältigen. Die El tern haben andere Sorgen, ihre Mutter sagt: „Sieh vor, mit wem du dich einlässt!“












„Zami“, so sagt man auf der karibischen Insel Carriacou zur Freundscha unter Frauen. Frauen, die zusammenhalten, wäh rend ihre Ehemänner auf hoher See sind. Frauen, die sich lieben. Und „Zami“ lautet auch der Titel des autobiografischen Ro mans der schwarzen US-Amerikanerin Au dre Lorde. Erschienen war das 400 Seiten starke Memoir bereits 1983. Dreißig Jahre nach Lordes Tod kommt das bereits 1983 erschienene Buch nun in einer aktualisier ten Neuübersetzung.


Der Roman puzzelt Lordes Leben aus Begegnungen mit Frauen zusammen. Am Anfang steht die Ur-Beziehung zur stren gen, namenlos bleibenden Mutter, die aus der Karibik in die USA emigriert ist. Be tritt sie den Raum, stockt der Tochter der Atem vor Furcht und Ehrfurcht. Audre ver ehrt ihre Mutter zwar, ihre Beziehung zu ihr bleibt aber distanziert bis unterkühlt. Zeit für Zuwendung gibt es keine.

Audre Lorde gilt als bedeutende Dichterin der USA. Ihre Lyrik verstand sie als politisch, sie kämp e als Aktivistin gegen Rassismus, Klassismus und Homophobie. Sie studierte Bibliothekswissenscha in New York, ver brachte einige Zeit in Mexiko und verfass te später auch theoretische Schri en zum Feminismus. 1992 verstarb sie an Brust krebs. Eine besondere Beziehung verband sie zu Deutschland, wo sie wiederholt als Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin lehrte und in den 1980er-Jahren zur Pionierfigur der schwarzen Community der Hauptstadt wurde.
In „Zami“ grei Lorde auf ihre ersten Erinnerungen als kleines Mädchen zurück. Sie wächst im New Yorker Stadtteil Harlem auf. Die Eltern sind Einwanderer, schwarz und trotz erfolgreicher Geschä igkeit Bür
ger zweiter Klasse. „Meine Mutter und mein Vater glaubten, dass sie ihre Kinder am besten vor der rassistischen Realität in Amerika schützen könnten, indem sie die se weder beim Namen nannten noch je über ihr Wesen sprachen.“
Nur ja nicht auffallen, nicht anecken, so trichtern es die Eltern den drei Töch tern ein. Audre ist schwer kurzsichtig und beinahe blind. Erst als sie mit vier Jahren eine dicke Brille bekommt, entdeckt sie Nu ancen und Details ihrer Umgebung. Diese frühkindlichen Jahre rücken sie ins Abseits der Normalität. Zeit ihres Lebens wird sie sich als Außenseiterin begreifen, eine Rol le, die sich „stets richtig anfühlt“. „Zami“ erzählt von Einsamkeit und dem verzwei felten Wunsch, sich einer Gemeinscha zu gehörig zu fühlen.

Als schwarzes Mädchen ist Audre Lorde nicht nur „anders“, ihr sind viele Dinge verbo ten. Etwa Eis im Eisgeschä zu essen. Oder sich im Bus hinzusetzen. Mit zwölf Jah ren kommt sie auf eine neue Schule, sie ist dort die einzige Schwarze. Die Familie zieht um, kurz darauf erhängt sich der jü dische Vermieter der Wohnung im Keller. Die Daily News berichtet, er habe es aus Verzweiflung getan, da er an Schwarze habe vermieten müssen. In der Schule macht der Zeitungsbericht schnell die Runde. „Er war Jude gewesen, ich war schwarz. Das mach te uns beiden zu Freiwild für die grausame Neugier meiner vorpubertären Klassenka meradinnen und -kameraden.“
Die Härte jener Zeit schildert die Auto rin in unverblümtem Stil. Ihr Memoir be schwichtigt nichts, ist frei von Jammer. Ge rade deshalb rückt die rassistische Realität beim Lesen bedrückend nahe.
An der Schule ist Audre Lorde die Klas senbeste. Sie möchte sich als Klassenspre cherin aufstellen lassen, in der Überzeu gung, den Posten verdient zu haben. Doch weder wird sie von der Lehrerin unter stützt noch von ihren Mitschülerinnen ge wählt. Tränenüberströmt läu sie nachhau
Audre Lorde: Zami. Eine neue Schreibweise meines Namens. Aus dem Englischen von Karen Nölle. Hanser, 416 S., € 26,80








se. „Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht in die Angelegenheit anderer Leute einmischen!“, herrscht sie die Mutter an und gibt ihr eine Ohrfeige.
Dergleichen Diskriminierungen wecken Au dres aktivistischen Geist bereits im Kindes alter. Mit 17 Jahren zieht sie von zuhau se aus, finanziert sich das College selbst, steht auch eine gefährliche Abtreibung al leine durch. Es sind Frauen, die ihr helfen und von denen sie angezogen wird.
Ihre erste Liebhaberin heißt Ginger. Die beiden arbeiten gemeinsam in einer Fabrik für Röntgengeräte. Mit Ginger macht die Autorin ihre erste sexuelle Erfahrung, die sie poetisch lustvoll verdichtet. „Ich tauchte hinunter in ihre Nässe, ihren Du ; die sei dige Insistenz der Rhythmen ihres Körpers weckte meine eigenen Gelüste.“
Als schwarze Lesbe fällt Audre Lorde doppelt aus der Norm. Und auch die Su che nach Zugehörigkeit ist für sie schwe rer. Viele schwarze Lesben, so erklärt Lor de, hätten ihre Sexualität versteckt, da sich die Schwarze Community nicht für sie in teressierte. In einer weißen Umgebung habe es genügend andere Probleme gegeben. Lie be oder Sex auszuleben war damals ein Lu xus, den sich viele nicht leisten konnten.





Lorde lebt ihre lesbische Identität auch mit weißen Frauen. Sie erblickt darin ein gesellscha spolitisches Potenzial. Vielleicht, so mutmaßt sie, waren lesbische Frauen in den 1950er-Jahren die ersten, die sich von der Frage der Hautfarbe lösten. Ihre Sexua lität hätte sie verbunden, ins Gespräch ge bracht und über Rassismen hinweggesetzt.
Wie „seelische Tattoos“ brennen sich die Begegnungen mit Frauen ein. Sie formen Lordes Charakter und geben Antwort auf ihre eingangs gestellte Frage: „Wem verdan ke ich die Frau, zu der ich geworden bin?“
Audre Lordes „Zami“ ist ein eindrucks volles Zeugnis einer Zeit voll haarsträuben der Ungerechtigkeit, dessen Lektüre nichts destotrotz zur sinnlichen Erfahrung wird.
 LINA PAULITSCH
LINA PAULITSCH
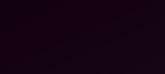
Eine Frau lebt auf einer tropischen Insel. Berichtartig gibt sie Auskunft über unheimliche Dinge, die plötzlich passieren. Bäume, die sich schwarz färben und massenhaft tote Fische am Strand. Und in ihr wächst die Angst vor denen, die im Norden der Insel leben. Sie baut ihr Haus zu einer Festung aus, ständig gefasst auf den Angri ihrer Feinde. Eine hochspannende Parabel.
A m 17. Juni 1572 stach der Konquista dor Pánfilo de Narváez in See. Er hat te eine Rechnung zu begleichen mit Hernán Cortés, dem Herrscher von Mexiko, und der spanische König unterstützte ihn dabei ger ne, wenn er sich außerdem bereiterklärte, Florida und die Gebiete nördlich des Golfs von Mexiko bis hinüber zum Rio Grande für die spanische Krone zu sichern.
Im April 1528 landete die Flotte in Flo rida. Es dauerte nur ein paar Tage, bis eine Standarte in den Boden gerammt war und ein mitgereister Notar das Land zum Besitz des spanischen Königs erklärt hatte. Nun konnte man sich auf den Weg nach Mexi ko machen, wobei der Konflikt mit Cortés nur als Vorwand diente. Viel stärker trieb die Gier nach Gold. Unglaubliche Mengen davon, so wussten es Gerüchte, seien hier zu holen.
Mit dabei war ein Offizier, der in Spa nien viel Geld verloren hatte und nun hoff te, sich als Gefolgsmann von Narváez wie der sanieren zu können. Standesgemäß hatte er auf die Reise einen Sklaven mitge nommen, Estevanico aus Nordafrika. Die kommenden acht Jahre – der Weg nach Me xiko entwickelte sich zum veritablen Hor rortrip hätte er ohne ihn kaum durch gestanden. In einem offiziellen Bericht an Kaiser Karl V. wird er nur einmal als einer von vier Überlebenden genannt: Estevanico, es negro alárabe, natural de Azamor – Este vanico, ein arabischer Neger aus Azemmour.
Laila Lalami, 1968 in Rabat geboren, seit 1992 in Los Angeles und in den USA eine viel fach preisgekrönte Autorin, erteilt nun ihm das Wort in einem Roman, der sich als ver spätete, postkoloniale Erwiderung auf den Bericht an Karl V. versteht. Estevanico er zählt die Geschichte der kläglich gescheiter ten Expedition aus seiner Perspektive – der Perspektive eines Mannes, der, selbst Opfer der Kolonialisierung Nordafrikas, unfreiwil lig an der Kolonialisierung Mittelamerikas mitwirkt. Wäre seine Figur nicht historisch verbürgt als der erste Afrikaner auf ameri
Laila Lalami: Der verbotene Bericht. Roman. Aus dem Ame rikanischen von Michaela Grabinger. Kein & Aber 493 S., € 28,50


kanischem Boden, als ein Mensch, der sich der indigenen Bevölkerung gegenüber un gewöhnlich offen und verständnisvoll zeig te: Man würde ihn wohl einfach als post koloniale Kopfgeburt abtun.
Der Estevanico, wie ihn sich Lalami aus gedacht hat, ist eine widersprüchliche Fi gur. Seine marokkanische Heimat musste er verlassen, weil er sich leichtsinnig um sein Geld gebracht hatte. Am Ende beteiligte er sich selbst am Sklavenhandel, doch das rettete ihn nicht vor dem Bankrott, durch den er dann selbst in die Sklaverei gezwun gen wurde.
Die Europäer beobachtet er mit großem Er staunen. Durch den schieren Akt der Be nennung machen sie sich die Welt untertan. Das beginnt mit der Zwangstaufe in Sevilla, bei der eine einzige Geste genügt, ihn, den seine frommen Eltern Mustafa ibn Muham mad ibn Abdussalam al-Zamor nannten, in den Katholiken Esteban zu verwandeln und den sein späterer Herr Estevanico rufen wird. Das setzt sich fort in der Gewohnheit der Kolonisatoren, Länder, Flüsse, Berge und Städte neu zu benennen und sie damit der indigenen Kultur zu entreißen. Die ein heimische Bevölkerung sieht Estevanico auf der feindlichen Seite der europäischen In vasoren, von denen er sich allerdings durch die Farbe seiner Haut unterscheidet – ein Europäer, der aber kein Europäer ist.
Opfer und Täter zugleich, dazu wohl außerordentlich intelligent und sozial hoch begabt, ist Estevanico die Rolle des Ver mittlers auf den Leib geschrieben. Verblüf fend schnell lernt er die Sprachen der Ein heimischen und ist bald der Einzige unter den Invasoren, dem diese Vertrauen ent gegenbringen. Ungewollt und eher zufällig gerät er auch noch in die Rolle eines Medi zinmanns – fortan zieht er mit großem Ge folge von Dorf zu Dorf, um die Menschen von allen möglichen Krankheiten zu hei len, mit Methoden übrigens, die er nicht aus Europa mitgebracht, sondern sich vor Ort angeeignet hat.


Doch damit ist schon fast das Ende der Handlung erreicht, von der bis jetzt nur in Andeutungen die Rede war. Von Flori da also bricht die Expedition Richtung Rio Grande auf, anfangs noch mit Schiffen ent lang der nördlichen Ufer des Golfs von Me xiko, später, als diese verloren und unzäh lige Männer umgekommen sind, zu Fuß durch Urwälder, Sümpfe und reißende Flüs se. Irgendwann geht es nur noch ums blan ke Überleben.
Lalami lässt Estevanico im Stil eher konventioneller Abenteuerromane er zählen, wie man sie vor ungefähr fünfzig Jahren jungen Menschen zu Weihnach ten geschenkt hat. Eine verschämte No tiz im Impressum weist darauf hin, dass der Sprachgebrauch dem historischen Kon text des Inhalts folgt, womit wohl gemeint ist, dass Indianer hier immer noch India ner heißen. Sie liefern sich mit den Inva soren grausame Schlachten, zwischenzeit lich müssen sich die Spanier bei ihnen mit harter Arbeit ihr Essen verdienen.
Diese Verschiebung der Machtverhältnisse, die zunächst schleichende, dann unauf haltsame Niederlage der Europäer, die –man darf es wohl so nennen – Resilienz der Einheimischen, schließlich die So Pow er, mit der sich Estevanico durch alle Kon flikte hindurch manövriert, ohne dabei im mer frei von Schuld zu bleiben: Das sind die großen Bögen, die diesen Roman sou verän zusammenhalten.
Dass er in einer großen, transkulturel len Vision endet, entspricht der Logik des Genres: ein Breitwandepos, wie es eigent lich Werner Herzog gefallen müsste, das menschliche Tragödien genauso kunstfertig entwickelt, wie es in eindrucksvollen Na turschilderungen schwelgt, das pittoreske Kulissen mit quirligem Leben füllt und für die geschichtliche Gerechtigkeit Partei er grei : Mit Laila Lalami ist der Historienro man nun auch in der postkolonialen Gegen wart angekommen.
TOBIAS HEYLEin ganzes Lebenvor dem Hintergrund der großen Ereignisseunserer Zeit.
Ian McEwans bewegender, zutiefst menschlicher Roman über Liebe, Verlust, Kunst und Versöhnung.
Mehr unter: diogenes.ch/ianmcewan
Emily Segal sucht die Zone auf, in der Start-up-Unternehmer und Post-irgendwas-Künstler obskure Allianzen eingehen
Peter Thiel ist nicht nur der aktuelle Arbeitgeber von Sebastian Kurz, sondern spielt auch in „Rückläufiger Merkur“ als umschmeichelter Investor eine Rolle. Sei ne Gunst lockt ein Start-up-Unternehmen durch einen Post-Internet-Künstler an, der die Anbiederung hinter trendigen Formen zu tarnen weiß.
Die Autorin Emily Segal, die mittlerwei le selbst ein Unternehmen gegründet und ihren neuen Roman durch Kryptowäh rungsspekulationen finanziert hat, fragt in ihrem autobiografisch gefärbten Roman nach dem Verhältnis von unternehmerischer Kreativität und künstlerischen Lebensent würfen, die vom Treiben der Start-up-En trepreneure und ihrer Lust an der irgend wie avantgardistisch gelesenen Disruption fasziniert sind.
Im Zentrum steht die Ich-Erzählerin Emily, eine New Yorker Vertreterin der Ge neration Z plus, die, wie es einmal ein biss chen arg klischeeha heißt, „ein bisschen verrückt“ ist und als Absolventin der Ver gleichenden Literaturwissenscha en so wohl „Nullautorenscha “ anstrebt wie auch „die einzig wahre Autorin“ sein will.
Emily ist meistens schlecht drauf und wird we gen ihrer prognostischen Fähigkeiten und ihrem Mut zu Antiimage-Imagekampagnen von einer Start-up-Firma namens eXe um
worben. Weil die Koketterie mit der Verwei gerung einfach dazugehört, lässt sie sich vom Firmengründer Seth ziemlich lange bitten, bevor sie schließlich – nicht zuletzt von Existenzsorgen angetrieben – doch als Kreativdirektorin einsteigt und ihr Wirken in dem nach einem Ketamin-Kater benann ten Kunstkollektiv K-HOLE in die Sphäre der New Economy übersetzt. eXe plant, das Internet mit einer Art Hypertext zu überziehen, was zunächst heißt: Es gibt nur ein Versprechen an die Investoren, aber kein Produkt, das es zu be werben gälte. Das trifft sich gut mit den In teressen von Emily, die das Tech-Unterneh men als Spielwiese für Fiktionen versteht, die ähnlich wie Konzeptkunst keinen Ge brauchswert liefern müssen.
Mit ihrer „postironischen“ Einstellung zur Arbeit gelingen ihr o scharfsichtige Be obachtungen einer doch o ganz altmo disch sexistischen Unternehmenskultur, in der der Chef, der zuvor im Ruf stand, der beste Junghypnotiseur der Stadt zu sein, durch den abrupten Wechsel von Nähe und Rückzug so etwas wie „intermittierende Be stätigung“ schafft, die seine Angestellten „abhängig“ macht. Wie selbstverständlich streut sie auch das Raunen der Esoterik zwischen Yoga-Retreats und Auralese-Prak tiken ein, das die Geheimniskrämerei der Tech-Gurus umspült.
Emily Segal: Rückläufiger Merkur. Roman. Aus dem Englischen von Cornelia Röser. Ma hes & Seitz, 221 S., € 23,50

Doch abseits von kreativitätsförderlichen Drogenpartys, der schlaumeierischen Ab feierung von Normcore als Zurückweisung individueller Großartigkeit oder der Er findung eines Logos, das das Neue an der Firma in Form von krabbelnden Babys in szeniert, findet auch ein anderes Leben vol ler Selbstzweifel statt. Dort „funktionierte [ich] bereits nach Skripten, die nicht mei ne eigenen waren, will sagen, als Arbeitneh merin und Subjekt im Spätkapitalismus“.
Diese Wirklichkeit in einem New York, das Se gal in der Tradition tausender Pop-Auto rinnen als „komplexes Porridge“ der coo len Distinktionshuberei beschreibt, besteht aus teuren Mieten, Depressionen, beschä digter Kommunikation und handfesten Intrigen, die nicht nur zu persönlichen Zerwürfnissen führen, sondern auch zur Au ündigung der fragilen Beziehung von autonomem Kunstwollen und spekulativem Unternehmergeist.
So gesehen ist das titelgebende astro logische Bild des rückläufigen Merkur gut gewählt. Es bezeichnet in dem Zusam menhang eine Informationsökonomie im Dauerkrisenzustand, in der die Autorin selbst eingebettet ist. Sie weiß also, dass ihr Anliegen, „auf der Membran der Wirk lichkeit selbst zu schreiben“, einem Anfall von „Größenwahn“ geschuldet ist.
THOMAS EDLINGERHernan Diaz konstruiert ein raffiniertes Verwirrspiel um einen Spekulanten der Roaring Twenties – und verliert sich darin

Hernan Diaz versteht sich auch auf gro ße Gesten. Und die größte Geste, die einem Autor zur Verfügung steht, ist der erste Satz eines Buches. Insbesondere ame rikanische Schri steller machen da ein gro ßes Gewese darum. Hernan Diaz beginnt seinen Roman „Treue“ so: „Da er von Ge burt an annähernd jeden erdenklichen Vor teil genossen hatte, blieb Benjamin Rask als eines von wenigen das Privileg eines heldenha en Aufstieges versagt: Seine Ge schichte war keine zäher Hartnäckigkeit, keine Chronik eines unbezwinglichen Wil lens, der sich aus wenig mehr als altem Blech ein goldenes Schicksal schmiedete.“
Die Botscha ist klar: Dem Leser wird eine epochale Geschichte angekündigt, voll sprachlicher Gewandtheit und dennoch mit einer Portion Understatement, präsentiert er seinen Protagonisten doch als Antihel den. Aber Obacht: Der Schein trügt, und das Puzzlespiel, das Hernan Diaz hier aus legt, gibt erst nach und nach preis, was dar auf tatsächlich zu sehen ist. Der in Argenti nien geborene, in Schweden aufgewachsene und in den USA lebende Diaz hat keiner lei Scheu, die großen Genres des amerika nischen Kulturkanons aufzugreifen. Sei nen ersten Roman „In der Ferne“ legte er als Western an. In „Treue“ (im Original: „Trust“, also „Vertrauen“) widmet er sich den USA zur Zeitenwende der 1920er-Jahre.
Vier verschiedene Textsorten bilden die Ba sis des Buches: Memoiren, ein Tagebuch, eine Autobiografie und ein Roman – alle verfasst von je einem anderen (fiktiven) Verfasser.
Zunächst schildert Harold Vanner, Au tor des Romans im Roman mit dem Titel „Verpflichtungen“, den Aufstieg des Speku lanten Benjamin Rask zu einem der reichs ten Männer Amerikas. „Die Verrenkungen des Geldes faszinierten ihn immer mehr –es ließ sich so im Kreis biegen, dass man es mit seinem eigenen Körper mästen konn te“, heißt es über Rask in etwas manierier ter Sprache.
Die de ige, aber auch zusehends abge schmackte Story erzählt, wie Rask im Al leingang die Finanzwelt aus den Angeln hebt, während Helen dem Wahnsinn ver fällt und in ein Schweizer Sanatorium ein gewiesen wird. Spätestens als ein Schar latan mit dem leicht zu dechiffrierenden Namen Dr. A us Helen behandelt, beginnt man den Autor oder besser gesagt beide Au toren zu hassen: den fiktiven für seine Mit telmäßigkeit und den tatsächlichen, weil er diesem so viel Platz einräumt.
Diaz hat sichtlich großes Vergnügen, hinter Harold Vanner zurückzutreten, und zieht noch eine zusätzliche fiktive Ebene ein, in dem er diesen Anleihen bei F. Scott Fitzge rald nehmen lässt. „Denk daran, dass unter
all den Menschen auf dieser Welt niemand solche Vorzüge genossen hat wie du“, lau tet der väterliche Rat am Beginn von „Der große Gatsby“, auf den der oben zitierte An fangssatz aus Vanners Roman klar anspielt. Wie bei Fitzgerald steht auch bei Diaz das kühl-distanzierte Verhältnis des Börsen maklers zu seiner mysteriösen Ehefrau im Zentrum.
Diaz’ vier Autoren gehen bei der Beschreibung dieses Verhältnisses sprachlich wie formal eigene Wege: Der zweite Teil bleibt eine ba nale, unfertige Memoiren-Skizze inklusive stichwortartigen Anweisungen wie „Seinen Pioniergeist veranschaulichen“ oder „Mehr über Mutter“.
Hier wendet Diaz einen weiteren forma len Kunstgriff an und wechselt, sprachlich am Tiefpunkt angelangt, von einer männ lichen in eine weibliche Erzählperspekti ve. Die Frau ist nicht mehr nur Anhäng sel oder für Wohltätigkeitsveranstaltungen zuständig, sondern entwickelt ein Eigen leben und einen eigenständigen Ausdruck, der sich gegen Ende des Buches in fragmen tarischen Tagebucheinträgen manifestiert. Schicht für Schicht entwickelt Diaz sei nen Plot und eröffnet mit jedem Abschnitt eine neue Sichtachse, wobei die Verfasser der Texte schrittweise zu deren Protagonis ten werden.
JOSEF REDLA ls in ihrer Familie die Schönheit zuge teilt wurde, stand Manolita nicht ganz vorne in der Reihe. Während das unver schämt gute Aussehen ihres Vaters Antonio und ihres älteren Bruders Tonito nachgera de legendär sind in der Madrider Nachbar scha , fällt Manolita, an der irgendwie al les zu klein und zu kurz geraten ist, nicht weiter auf. Auch ihr Naturell scheint vorerst das von jemanden zu sein, der mehr oder weniger unbemerkt mitläu . Mehr noch: Manolita hält sich gern heraus. „Zähltnicht-auf-mich“ ist der Spitzname, den ihr ein Freund ihres allseits bewunderten Bru ders verpasst.
Und doch ist gerade diese Senorita „Zählt-nicht-auf-mich“ die Figur, die im Zentrum von Almudena Grandes’ dicht be völkertem jüngstem Roman steht, der auch ihr letzter ist – die spanische Erfolgsauto rin, Jahrgang 1960, verstarb im November 2021 an einem Krebsleiden. Er heißt „Die drei Hochzeiten von Manolita“, umfasst fast 700 Seiten und ist einer der gewichtigen Romanziegel dieser insgesamt an Roman ziegeln reichen Büchersaison. Die anfangs so farblose Manolita macht darin eine ra sende Entwicklung durch. Sie ist weniger eine Antiheldin als vielmehr eine Heldin wider Willen, die sich verwandelt und un vermutete Krä e mobilisiert, weil ihr nichts anderes übrig bleibt.
Grandes’ Roman spielt im und in den Jahren nach dem Spanischen Bürgerkrieg. Kurz nach dessen Ende, im Frühjahr 1940, ist Manolita gerade 17 und von einem Tag auf den anderen für vier jüngere Geschwister zuständig. „Diese Aussicht war derart er schreckend, dass ich nachts keinen Schlaf mehr fand.“ Ihr Vater, Gewerkscha er und Sympathisant der Sozialisten, sitzt im Ge fängnis, ebenso die dünkelha e Stiefmut ter, „eine echte Gaunerin“. Und ihr Bruder Tonito, der einer aktiven Gruppe von Kom munisten und Anarchisten angehört, ist an gesichts des Sieges der Franquisten dauer ha in den Untergrund abgetaucht.
Erschöpfung, Überforderung, Angst, Hun ger, Not und Mangel sind die Krä e, die Manolita in der Folge formen. Grandes entwir ein gewaltiges Panorama von Kriegsfolgeschäden.
Es sind einfache Frauen, viele von ih nen blutjung, die in diesem Pandämonium im Alltag über sich hinauswachsen müs sen und die in diesem Roman die eindring lichsten Charaktere stellen. „Der Krieg hat te das Beste, aber auch das Schlechteste in uns allen hervorgebracht. Am Ende waren wir alle andere Menschen als die, die wir gewesen wären, hätten wir weiter in Frie denszeiten gelebt.“
Diese Sätze, die eigentlich ein Gemeinplatz sind, stehen gleich am Beginn des Ro mans und werden in der Folge auf hunder ten Seiten und an einem Dutzend von Fi guren durchdekliniert. Manolita selbst lässt sich schließlich von ihrem Bruder als Botin für den Widerstand rekrutieren. Sie schleust Botscha en ins und aus dem Gefängnis, gibt vor, mit einem der Insassen, dem stot ternden Manitas, liiert zu sein und lernt die von Bestechung und Demütigungsritualen bestimmten Regeln kennen, die an den Be suchstagen zur Geltung kommen, an denen die Angehörigen der Insassen Schlange ste hen. An diesem unwahrscheinlichsten aller Orte lernt sie aber auch Solidarität.
Der Roman macht die Verheerungen von Krieg und Diktatur in all ihren Facetten sichtbar. Da ist der ehemalige Sympathi sant des Widerstands, der zum Denunzian ten wird und schließlich in Francos Dikta tur als Folterknecht Karriere macht. Da ist die schöne, zornige Flamencotänzerin Ela dia, die ihren Geliebten Tonito versteckt. Da ist der traurige, schwule Marquis de Hoy os, der mit der Linken sympathisiert, in seinem Palais Orgien veranstaltet und sich weigert, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Da sind die spanischen Wider standskämpfer im französischen Exil, die von jenseits der Grenze Sabotageakte gegen Francos Spanien durchführen.
Almudena Grandes: Die drei Hochzeiten der Manolita. Aus dem Spanischen von Roberto de Hollanda. Hanser, 672 S., € 30,90

Man verirrt sich leicht in diesem Roman, dessen Personal farbig und stark, des sen Struktur allerdings vom Wechsel der Handlungsebenen, von Zeit- und Perspek tivsprüngen geprägt ist, was die Orien tierung in diesem Gewusel aus Schicksa len und Ereignissen gelegentlich ziemlich schwer macht.
Worum es sich bei den drei Hochzeiten von Ma nolita handelt, die dem Roman den Titel ge ben, kann nicht verraten werden, ohne die sem viel von seiner Spannung zu nehmen. Im Spanien nach dem Bürgerkrieg stehen Manolita und die Ihren jedenfalls auf der falschen Seite.
Dass sich unter den qualvollen Umstän den von Willkürherrscha , Gefängnisstra fen und Straflagerleben für sie am Ende doch so etwas wie ein Happy End ergibt, ist eine der erstaunlichen Volten dieses Ro mans, dessen Haupthandlung in den Jahren nach dem Spanischen Bürgerkrieg spielt, der sich aber bis weit in die zweite Häl e des 20. Jahrhunderts erstreckt.
Auch im Rückblick von Jahrzehnten bleibt der spanische Alltag vom Kriegsge schehen geprägt und vergi et. Die Leserin nen von Grandes’ Roman wissen sehr bald, wer der Denunziant in der Widerstands gruppe rund um Tonito ist. Ihre Figuren erfahren es erst nach Jahrzehnten.
Eines der großen Themen dieses spani schen Geschichtspanoramas ist die Liebe in Zeiten des Krieges. Die Zeitläu e die ses Romans lassen den Liebespaaren darin wenig Handlungsspielraum – umso mehr spielt sich das Sehnen und Begehren in de ren Köpfen ab.
Die große Liebe, die Manolita schließ lich beschieden ist, wäre unter den Bedin gungen des Friedens wohl niemals zustan de gekommen. Wenn Manolita auf den Satz „Du hast etwas Besseres verdient“ mit „Ich habe nichts Besseres gefunden“ antwortet, wird das im Kontext dieser Erzählung von der Bankrott- beinahe zur Liebeserklärung.
JULIA KOSPACHWir sind reicher denn je. Zumindest gemessen an jener freien Zeit, die als Grundvoraussetzung menschlichen Fortschritts gilt. Doch wir laufen Gefahr, diesen kostbaren Schatz an die Verlockungen der digitalen Welt zu verlieren.
«Jede Menge Anregungen, um der grassierenden digitalen Paranoia mit etwas mehr Gelassenheit gegenüberzutreten.»

Gregor Szyndler, NZZ
Der Physiker und Schriftsteller Guido Tonelli erzählt in seinem spektakulären Buch die lange Geschichte der Zeit, ihre rasende Geburt und bizarre Entwicklung.
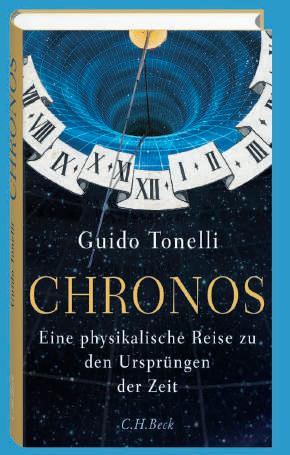

verrät, warum es ohne Einstein kein Navi gäbe, wie aus der Leere ein Kosmos entsteht und ob sich die Zeit zurückspulen lässt.» Karl Gaulhofer, Die Presse

Am 11. September dieses Jahres ist in Madrid der große Javier Marías ge storben. Seinen 16. und letzten Roman, der 2021 in Spanien erschienen ist, hal ten manche Kritiker für seinen besten. Viel leicht weil es Marías hier gelungen ist, sei ne Neigung zum Reflektieren, Moralisieren und zu metaliterarischen Umwegen mit einer atemberaubend spannenden Hand lung zu verbinden.
„Alte Schule“, der Ausdruck findet sich gleich im ersten Satz des Romans, und er charakterisiert das Œuvre dieses Autors nicht schlecht. Wenn aber Marías „alte Schule“ war, dann als Modernist, etwa als unbedingter Verehrer Prousts. „Ich wur de nach alter Schule erzogen“, so der ers te Satz zur Gänze, „und hätte nie gedacht, dass man mir eines Tages au ragen wür de, eine Frau umzubringen.“
Mit Klarnamen, wenn man es so nen nen will, heißt das Ich dieses Eingangssat zes Tomás Nevinson. Als langjähriger Ge heimagent ihrer Majestät hat der Mann mit dem spanischen Vor- und dem englischen Nachnamen sein Handwerk zur Perfektion entwickelt. Nach eher öden Undercover-Jah ren in der englischen Provinz ist der Mitt vierziger nun ins heimische Madrid zurück gekehrt. In der britischen Botscha hat man ihm einen unauff älligen Posten zugewie sen. Nevinsons Doppelexistenz scheint an ein Ende gekommen zu sein.

Auch die Beziehung zu Berta, seiner, wenn man will, echten Ehefrau, der er sei ne Berufsgeheimnisse stets vorenthalten musste, blüht wieder auf.
Marías-Leser werden sich erinnern: „Berta Isla“ hieß der Vorgänger-Roman, so wie Nevinsons Frau. Mit dem vorliegenden bildet er, wie Marías schreibt, ein „Paar“. Der frühere Roman erzählte von Bertas Le ben mit einem Mann, der sich entzog und verstellte, wann immer der Dienst es von ihm verlangte.
Der neue Roman nimmt die Perspektive des Ehemannes ein. Erzählt wird von einem Ex-Agenten, der sich wieder im bürgerli chen Leben eingerichtet hat und der dann, nicht widerstrebend, doch wieder ins Feld zieht, um eine Frau umzubringen oder viel leicht auch drei. So sieht – in gera ff ter Form – die Ausgangs lage von „Tomás Nevinson“ aus. Bei Ja vier Marías selbst indes wird nichts gerafft. Die Umgangsformen, deren sich der IchErzähler eingangs rühmt, erfordern, dass man sich Zeit lässt. Nicht nur Zeit beim Töten, sondern auch beim Erzählen. Zeit für vergleichende Betrachtungen des Engli schen und des Spanischen; Zeit für literari sche Referenzen von Shakespeare bis Yeats, Eliot und Baudelaire; Zeit für eine genüss liche Streckung des Plots bis zum finalen Paukenschlag.
Die Handlung selbst ist so einfach wie ef fektvoll: Nevinson soll seinem ehemali gen Chef einen Gefallen erweisen, womit der wiederum seinen spanischen Kolle gen einen Gefallen tut. Er soll eine irgend wo im spanischen Nordwesten lebende hi spano-irische Schläferin liquidieren, die an den Anschlägen der baskischen ETA in den 1980er-Jahren beteiligt war und die gute Kontakte zur irischen IRA unterhält. Drei Frauen kommen infrage, so wird es ihm beim Zusammentreffen in Madrid – dessen Schilderung die ersten gut hundert Seiten in Anspruch nimmt – sein alter Führungs offizier erläutern.
Nevinson soll inkognito in die Provinz stadt im Nordwesten ziehen, die Frauen überwachen und kennenlernen, den Ver dacht erhärten und sodann diskret und prä zise zuschlagen. Welche der drei Frauen ist die gesuchte, und warum? Wird Nevinson seine gute Erziehung so weit hintanstellen können, dass er den Au rag wirklich aus führt? Was, wenn die tatsächlich Gesuchte inzwischen ihr eigenes „Todesprojekt“ ent wickelt, und zwar gegen ihren Jäger?
Weil Marías weiß, dass er seine Leser von Beginn an am Haken hat, kann er sich nun erst recht dem Spiel mit Verweisen hin geben. Der kulturelle Kanon bietet reiches Material, was moralische Dilemmata be trifft. Was könnte, lässt Marías seine Figur grübeln, die Ermordung einer oder mehre rer Personen rechtfertigen, die möglicher weise ja alle unschuldig sind und die nur durch ihre auff ällige Unauff älligkeit ins Vi sier der Dienste geraten sind?
Das professionelle Töten von Menschen ist schwierig, das hat Nevinson selbst erlebt, technisch, moralisch, aber noch mehr, was den richtigen Zeitpunkt angeht. Der Kai ros des gelingenden Anschlags kann im Nu vorüber sein.
Marías bringt Fritz Langs Antinazifilm „Man Hunt“ aus dem Jahr 1941 ins Spiel. An dessen Anfang hat ein britischer Hob byjäger nahe dem Berchtesgadener Berghof unversehens Adolf Hitler im Fadenkreuz und würde gerne die seltene Chance nut zen. Dann aber schwebt ein Blatt auf sein Zielfernrohr herab, und im nächsten Au genblick stürzt sich schon ein Wachsoldat auf ihn. Die Chance ist vertan. Mit solchen Analogien rückt Marías die geheimdienstli che Aktion seines Helden in die Nähe des Tyrannenmordes.
Die furchtbaren Anschläge der baski schen Befreiungsorganisation in Madrid und Barcelona, mit Dutzenden von Toten und Hunderten Verletzten, liegen zur Er zählzeit des Romans ein Jahrzehnt zurück.
Die ausführenden Täterinnen und Täter sit zen in Ha , die Drahtzieher aber sind viel fach auf freiem Fuß und pflegen ihre inter nationalen Netzwerke, vor allem die zur
»Wahrscheinlich keit ist nicht die oberste Maxime von Marías’ Erzählkunst. Er bedient sich nach Gutdünken bei der Realität, um diese in Literatur zu verwandeln
politisch befreundeten IRA. Der staatliche Anti-Terror-Kampf ist infolge illegaler Ak tionen diskreditiert. Deshalb der Gedanke, die Jagd nach verdächtigen Subjekten qua Amtshilfe an die Briten auszulagern, die dann wiederum den Ex-MI6-Mann Nevin son aktivieren.
Marías’ Roman ru Traumata der spa nischen Gesellscha wach. Der ETA-Terror ist überall gegenwärtig im Spanien des Jah res 1997. Nevinsons Job hat eine erhebliche politische Tragweite, man merkt es an der wachsenden Nervosität seiner Vorgesetzten. Nevinson soll reale Gefahren von Spanien abwenden, aber weder seine Chefs noch er selbst wissen, ob er dazu noch das Zeug hat.
Derweil führen die verdächtigen Drei ihr gewohntes und deshalb vielleicht be sonders perfides Schläferinnen-Leben im über-provinziell geschilderten Städtchen Ruán. In ihrer Verstellungskunst – wenn sie sich denn überhaupt verstellen – glei chen sie dem Spion, der sie aus der Reser ve locken will.
Als Englischlehrer Miguel Centuríon hat sich Tomás Nevinson für den Aufenthalt eine Fake-Identität aufgebaut, in die er rasch eintaucht. Daraus, dass er ein Schnüffler ist, angeblich, um für einen Roman zu re cherchieren, macht Nevinson alias Centu rión (mal ist er ein „Ich“, im nächsten Satz schon wieder ein „Er“) kein Geheimnis. Müsste dann nicht die Inhaberin des gutge henden Restaurants am Fluss, die sich all mählich als Hauptverdächtige herausschält und sich ohne Zögern auf eine sexuelle Be ziehung mit Nevinson einlässt, müsste die se Inés nicht, wenn sie denn die gesuchte irisch-baskische Terroristin namens Mad die Orúe O’Dea wäre, augenblicklich Ver dacht schöpfen und ihrerseits Nevinson aus dem Verkehr ziehen wollen? Oder ist es Teil eines noch größeren Plots, wenn sie ihn bei der Vorbereitung seiner Tat einfach ge währen lässt?
Wahrscheinlichkeit ist nicht die oberste Maxime von Marías’ Erzählkunst. Er be dient sich nach Gutdünken bei der Rea lität, um das dieser Entnommene in eine Literatur zu verwandeln, die den eigenen Gesetzen stets den Vorrang gibt vor den Forderungen der Wirklichkeit. Das war in manchen von Marías’ früheren Büchern ein Problem, in seinem letzten Roman geht die Rechnung auf: Wie noch nie zu vor schafft es der Autor hier, essayistische Umständlichkeit und plotgetriebene Span nung zusammenzubringen.
Wenn Marías vorsätzlich langatmige, mitunter auch leicht altherrenmäßige, ein wenig zu bildungssatte, dann aber auch schlaue und bewegliche Prosa „old school“ war, dann ist „Tomás Nevinson“ ein letzter Triumph der alten Schule.
CHRISTOPH BARTMANNIn seinem letzten Werk verknüp Javier Marías die Spannung eines Thrillers mit essayistischer Reflexion auf meisterha e WeiseJavier Marías: Tomás Nevinson. Roman. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. S. Fischer, 736 S., € 33,50
Wer kann, der kann: Fernando Aramburu hält die Leser 800 Seiten lang mit einem zu Tode gelangweilten Ungustl bei der Stange
Ein guter Roman sollte bereits auf den ersten paar Seiten einen Satz au ie ten, der seinem Leser oder seiner Lese rin kurz die Gesichtszüge entgleisen lässt. Hier ist es auf Seite zwölf so weit. „Tatsäch lich wünschte ich mir schon als Kind, spä ter einmal Vater zu sein, um meine Kinder schlagen zu können.“
Und es kommt noch dicker, es wird un säglich traurig und tragisch, brutal komisch und abgründig, kurz, es werden alle Regis ter gezogen. Fernando Aramburu hat nicht nur eine gute Story, er hat unzählige Ge schichten parat. Und er will sie uns alle er zählen. Sein desillusionierter Held Toni be kommt über 800 Seiten Platz, um ein Jahr seines Lebens in Tagebuchform abzuhan deln. Und zwar jenes, das sein letztes auf Erden sein soll.

Toni, der als Gymnasialprofessor lust los Philosophie unterrichtet, ist nach 16 Jahren unglücklicher Ehe endlich geschie den, resignierter Vater eines leicht minder bemittelten Sohnes, den er, anders als er es sich vorgenommen hatte, nie geschla gen hat, und lebt mit seiner Hündin Pepa nun wieder allein.
Gesellscha leistet ihm eine Sexpuppe, die er seinem einzigen Freund, einem aus tragischen Gründen gehbehinderten Im mobilienmakler, den er insgeheim Hum pel nennt, abgekau hat.
Zuvor war er jahrelang zu Prostituier ten gegangen, nachdem seine Frau nach der Geburt ihres einzigen Kindes kein Interesse mehr am Geschlechtsverkehr zeigte. Blieb ihm ja nichts anderes übrig. „Da Amalia mir verwehrt war, hatte ich keine weibli che Körperöffnung zur Verfügung, in die ich mich gratis und ehelich ergießen könnte.“
Toni kommt, man merkt es bald, nicht son derlich sympathisch rüber. In seiner scho nungslosen Offenheit legt er es aber auch überhaupt nicht darauf an, denn: „Nichts von dem, was um mich herum geschieht, interessiert mich. Nicht einmal ich selbst interessiere mich.“
54 Jahre auf diesem Planeten sind genug, findet er: „Was einem das Leben bis da hin noch nicht gegeben hat, wird es wohl auch jenseits der fünfzig nicht mehr herausrücken.“ Man kann diesbezüglich allerdings auch Überraschungen erleben.
Aramburu gibt sich in seinem neuen Roman, im spanischen Original fünf Jah re nach seinem noch etwas umfängliche ren Welterfolg „Patria“ (2016) erschienen, erneut ungezügelter Erzähllust hin. Er tut dies mit erheblichem handwerklichen Ge schick und dem Willen zum großen Bogen. Der Trick mit der Tagebuchform ist clever, nahezu jedes der 365 Kapitel wartet mit einem starken Schlusssatz auf, der entwe der amüsiert oder schockiert, jedenfalls ver lässlich zum Weiterlesen animiert.
Hohe schreiberische Kunstfertigkeit ist auch vonnöten, wenn man seine Leser und ins besondere seine Leserinnen nach 300 Sei ten noch für weitere 500 begeistern möch te, in denen der trübsinnige Toni sich mit Sätzen wie diesem offenbart: „Das intime Leben mit einer intelligenten Frau habe ich als unablässige Strapaze empfunden.“
Aramburu lässt sich Zeit. Die titelgeben den Mauersegler tauchen erst nach hun dert Seiten das erste Mal auf. Man erfährt, dass Toni gern so wie sie wäre, er sucht sie mit seinen Blicken am Himmel, er träumt von ihnen. In Rückblenden erzählt er sei ne Familiengeschichte, dunkle Geheimnis se werden angedeutet, Rätsel nicht gelöst, Abgründe erkennbar.
Die Gegenwart schildert er meist emo tionslos, den selbst auferlegten Schluss strich stets im Blick. Die Spannung re sultiert daraus, dass man den Suizid abwechselnd für durchaus möglich, sogar wahrscheinlich, nachgerade unausweichlich hält – und dann wieder nicht. Irgendwann mittendrin hat man aber von dem ganzen Nihilismus und Zynismus langsam genug und würde dem Protagonisten gerne nahe legen, es doch mal mit Antidepressiva oder einer Therapie zu versuchen.
Die ganze Zeit über kreist das Denken die ses Mannes nur um seine eigene Befindlich keit. Die Lebensrealität der Frauen in seiner Umgebung, über die Generationen hinweg, bleibt ihm, so ausführlich er auch davon be richtet, in Wahrheit verborgen, oder bes ser gesagt: Auch sie interessiert ihn nicht.
Dabei kommen in Tonis Aufzeichnungen viele Frauen vor, sogar mehr, als in dem Perso nendiagramm am Anfang verzeichnet sind –und bis auf ganz wenige Ausnahmen leiden sie alle, was dem Erzähler in den seltens ten Fällen zu denken gibt. Seine Ich Bezo genheit ist grenzenlos, die Selbstverständ lichkeit, mit der er nimmt und nichts gibt, erschütternd.
Aramburus Meisterleistung besteht da rin, vor dem Hintergrund der egozentri schen, biografischen Erzählung seines Anti helden die Geschichten all dieser Frauen dennoch plastisch hervortreten zu lassen. Zwar ist immer nur der lebensmüde Ma cho am Wort, doch während dieser durch aus gebildete, umfassend belesene Mann sich in niemanden hineinversetzen kann –weder in seine Mutter, deren spätes Lebens glück er zerstört hat, noch in die Frauen, die ihn lieben oder einmal geliebt haben –, beschreibt er, beständig mit sich selbst be schä igt, die Tragik all dieser Frauen, ohne es selbst zu bemerken.
Eine geradezu unheimlich treue Seele, die Jugendfreundin Águeda, taucht nach 27 Jahren plötzlich wieder auf, und es dauert eine Weile, bis Toni klar wird, dass er in ihrem Leben eine größere Rolle gespielt hatte, als er dachte, worauf nicht nur hin deutet, dass sie in der langen Zeit der Tren nung drei Hunde hintereinander nach ihm benannt hat.
Gegen Ende hin kommt es zu erwartba ren Zweifeln und unerwarteten Wendungen, bitteren Erkenntnissen und zagha en Zu geständnissen. Ein Vorhaben wird wie ge plant in die Tat umgesetzt, ein anderes ver eitelt. Es bleibt spannend bis zu Schluss. CHRISTINA DANY

Fernando Aramburu: Die Mauersegler. Roman. Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Rowohlt, 832 S., € 29,50
Das Romandebüt „Die Wunder“ der Lyrikerin Elena Medel ist eine suggestive Parabel auf die jüngere spanische Vergangenheit
Als „Las maravillas“ 2020 erschien, überschlug sich die spanische Kritik vor Begeisterung: Medel war bis dahin als kompromisslose Dichterin und Verlegerin der kleinen Lyrikedition La Bella Varsovia bekannt. In elf Kapiteln auf unterschied lichen Zeitebenen durchmisst Medel in ihrem Debütroman das Leben dreier Frau en aus einer Familie, deren Freiheiten nur allzu deutlich eingehegt werden: von der späten Etappe des Franquismus 1969 bis zur jüngsten, noch von der Eurokrise be lasteten Vergangenheit, die Medel bis 2018 verfolgt. Zwischen María und ihrer Enkelin Alica bleibt Marías Tochter Carmen der er zählerische Scheitelpunkt zwischen den bei den: Opfer der Älteren und Täterin gegen über der anderen.
Der Ursprung dieser gehörig zerrütte ten Konstellation ist bereits im patriarcha len, nationalkatholischen Moralverständ nis des spanischen Faschismus angelegt. Als Jugendliche wird María in ihrer Hei matstadt Córdoba schwanger. Ihre Fami lie drängt sie, sich in Madrid eine Arbeit zu suchen, während ihre eigene Tochter bei den Großeltern aufwächst.
María ist die personifizierte Systemerhalte rin, erst Kindermädchen, dann Altenpflege rin, schließlich Putzfrau. Zugleich vollzieht sie eine langsame Emanzipation, engagiert sich in einer Bürgerinitiative, reduziert den
Kontakt zur Familie, die sie verstoßen hat, auf ein Minimum. Zugleich macht Me del mit geschickt über die Jahrzehnte ver teilten Schlaglichtern deutlich, wie prekär diese Freiräume bleiben und zu welchem Preis María diese verteidigt: Die Entfrem dung von ihrer Tochter geht so weit, dass sie ihre Enkelin nie zu sehen bekommt; und auch im fortgeschrittenen Alter muss sie ihre Entscheidung, allein zu wohnen, noch gegen ihren Partner verteidigen.
Man kann sich das Verhältnis der drei Frauen generationen wie eine Sinuswelle vorstel len, die den sozialen und ökonomischen Status beschreibt: Während María beim Minimum startet, um sich hinaufzuarbei ten, wird Carmen, die die Geschichte ihrer Mutter zu wiederholen scheint, durch ihren Mann Teil der prosperierenden oberen Mit telklasse, wodurch die Enkelin Alicia in ein neureiches Setting geboren wird.
Eine Tragödie in der Familie offenbart freilich, dass dieser Wohlstand nur auf Sand gebaut war; auch das ein Befund, der sich weit über das Einzelschicksal hinaus auf die gesamte Gesellscha übertragen lässt, so wie hier jedes Schicksal emblematisch auf Umbrüche in Spanien hin lesbar ist.
Dabei bleibt die subtile sprachliche Bril lanz der Lyrikern Medel immer spürbar: „Die Wunder“ liest sich leicht und flüssig, jeder Satz ist rhythmisch durchkomponiert.
Elena Medel: Die Wunder. Roman. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Suhrkamp, 221 S., € 24,50

Wobei erst der Blick auf das spanische Original die außergewöhnliche Qualität von Susanne Langes Übersetzung wirk lich erschließt: Nur selten gelingt es, so nahe am Klang der Ausgangssprache zu bleiben.
Alicia arbeitet als Verkäuferin, lebt in einer unspektakulären Ehe und vertreibt sich die Zeit mit spontanen Aff ären, die ihr ein Gefühl von Freiheit vermitteln. Die gekonnt konstruierten Korrespondenzen zwischen ihr und ihrer Großmutter er hellen die Unterschiede: Während es für María ein Sieg war, mit den Männern der Bürgerbewegung in einer Bar zu disku tieren, hat Alicia keine Lust, mit ihrem Mann und dessen Freunden auszugehen – lieber will sie Zeit für sich selbst haben. Und während Sexualität für María ein Element der Unterdrückung darstellt, ist sie für Alicia eine Waffe, die sie – wenn auch im Stillen – zur Rebellion nutzt.
Der Sukkus dieses politischen Spiels des Auf und Ab, der Parallelen und Ver schiebungen ist allerdings bitter: „Es geht nicht um Familie, nicht um Liebe: Es geht um Geld“ – Freiheit ist gekop pelt an Liquidität. Oder wie es das vor angestellte Motto des englischen Dichters Philip Larkin formuliert: „Clearly money has something to do with life.“
FLORIAN BARANYIIn „Melancolia“ wahrt Mircea C ărt ărescu den gewohnten Ton, trägt aber dicker auf als in seinen großen Romanen
Nach der monumentalen Orbitor-Trilo gie und dem Monolithen „Solenoid“ begnügt sich Mircea Că
rescu, Rumäniens größte Nobelpreishoffnung, dieses Mal mit knapp 270 Seiten. Er grei dabei auf eine Form zurück, deren er sich, mit einem ver wandten Titel („Nostalgia“), bereits 1993 bedient hatte: Zwei Gleichnisse rahmen, wie Ouvertüre und Coda, drei Stimmungs bilder, die aneinandergereiht wie langsame Musiksätze eines Schostakowitsch-Quar tetts Szenen kindlicher und jugendlicher Isolation au auen.
Die Spiegelfechterei des Selbst in der Eingangsparabel könnte man mit einem Rilke-Vers auf den Nenner bringen: „So lang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles Ge schicklichkeit und lässlicher Gewinn.“ Im Schlussabschnitt nimmt die Darstellung des solipsistischen Ich noch dunklere Far ben an, muss das Ego konzentrische Krei se durchstoßen, um vom Claustrum, dem Innersten des menschlichen Hirns, bis zur realen Welt vorzudringen.
Cartarescus Kinder weinen viel in ihren Ein samkeiten. In der ersten Erzählung findet sich ein Fün ähriger ohne seine Mutter wieder. Spielzeug ist der einzige Zeitver treib: ein weißes Pferd, eine blaue Katze und ein Clown; Letzterer übernimmt, sei nem Wesen entsprechend, die Rolle des Störenfrieds. In gefühlten Jahrhunderten
der Abgeschiedenheit entwir sich das Kind Brücken und Stege aus seinem Gefängnis.
Sie führen ihn zur überlebensgroßen Fi gur des immer schon abwesenden Vaters, zu dessen Füßen er den Clown begräbt. Zu rück im Haus muss er feststellen, dass das nun ungestörte Spiel jeden Reiz verloren hat – eine Einladung zur tiefenpsychologi schen Deutung.
In der Folgeerzählung „Die Füchse“ wird der Ton noch märchenha er. „Einstmals lebten in einer fernen Stadt, in der sich die Häuser wie blaue Flecken auf der blassen Haut des Himmels ausnahmen, zwei Ge schwister […]. Marcel zählte acht Jahre und ging schon zur Schule, Isabel war ein Mäd chen von drei Jahren.“
Wie der Grimm’sche Hänsel tritt der große Bruder als Beschützer auf, sein Rettungs werk gelingt allerdings nur, solange die angreifenden Füchse imaginiert sind. Als ein reales Tier au ritt – Symbol für die le bensbedrohliche Krankheit des Mädchens –, wird die Lage prekär. Die Schilderung der geschwisterlichen Angst um die nun tat sächlich mit dem Tod Kämpfende gehört zum Stimmungsvollsten und Dichtesten, was dieses Buch zu bieten hat.
Der dritte Teil ist bei weitem der längs te. Überbordend von Symbolen und Me taphern schildert er das Seelenleben eines 15-jährigen Jünglings, der sich zum Dich
Mircea C ă rt ă rescu: Melancolia. Erzählungen. Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Zsolnay, 272 S., € 25,–

ter berufen fühlt. Von der Mauser ist hier die Rede, die ihm das Federkleid und die Schwingen eines Poeten verleiht. Beein druckt findet man sich in halb ruinö sen Stadtlandscha en wieder, von den gleichen Straßenbahnen durchquert, wie sie schon Cărtărescus frühere Wer ke befuhren.
Häutungen bestimmen das Heranwach sen der männlichen Jugend. Bei ersten Kontakten mit Mädchen macht der Pro tagonist die Geschlechterdifferenz er schrocken daran fest, dass jene keine abgestrei en Häute im Schrank haben, also wohl anders reifen müssen. Als er im Inneren einer Riesenstatue des Litera ten Solitude hoch steigt, gerät er in einen Zustand der Levitation. Man kennt das bereits aus „Solenoid“; dort wirken die se „Ekstasen“ im großen Erzählfluss fas zinierend, in „Melancolia“ dick aufgetra gen; dort changierten die Bilder zwischen Piranesi und de Chirico; hier wirken sie nur gewollt und manieristisch.
Die sichtlich autobiografisch motivier te Schilderung eines „Porträts des Künst lers als junger Mann“ ist schlichtweg überfrachtet. Sie wirkt, als hätte man ein ursprünglich kammermusikalisch konzi piertes Werk im Nachhinein für großes Orchester instrumentiert.
THOMAS LEITNERIn seinem Roman „Schauergeschichten“ identifiziert der ungarische Dörfler Péter Nádas das Dorf als Epizentrum des Bösen
In einem Essay mit dem Titel „Behutsa me Ortsbestimmung“ hat Péter Nádas das westungarische Dorf Gombosszeg, in dem er seit fast 40 Jahren lebt, einer eben solchen Ortsbestimmung unterzogen, wobei er tief in archaische Schichten hinabstieg, um die Dorfwelt zu verstehen.


Sein Resümee: Die Dörfler sind von magischen und mythischen Vorstellun gen geprägt, denken und handeln als ent persönlichtes Kollektiv; darüber, was jeder im Dorf weiß, wird geschwiegen; außer halb des Dorfwissens existiert kein Wis sen und außerhalb des Dorfes keine Welt. Das Dorf ist gleichbedeutend mit tout le monde. Die Dörfler führen keine Dialoge, sie hören einander nicht zu, sondern reden unausgesetzt parallel übereinander hin weg, o sehr lautstark, in unpersönlichen Monologen erzählen sie eine einzige gro ße Geschichte. „Es entsteht ein fürchterli ches Stimmengewirr.“
Es empfiehlt sich, das reale Dorf Gom bosszeg im Kopf zu behalten, wenn man sich auf das fiktive ungarische Dorf nahe dem Donau-Knie einlassen will, den Schau platz (und Helden) des neuen Romans von Péter Nádas. In „Schauergeschichten“ sucht Nádas das fürchterliche Stimmengewirr der Dörfler literarisch nachzubilden und ihm eine höchst eigenwillige und innovative Form zu geben. Der Roman ist eine furio se und ästhetisch riskante Tour de force, die der Konzentration und kombinatorischen Beweglichkeit aufmerksamer Leser einiges abverlangt und zumutet.
Mit 80 Jahren begibt sich Nádas hier auf neu es und ziemlich verstörendes sprachliches Terrain und setzt damit einiges aufs Spiel: seinen gefestigten Ruf als einer der großen Autoren Europas und die Gefolgscha sei ner Lesergemeinde, die er mit diesem Ro man vor den Kopf stoßen dür e. Doch dieses ästhetische Wagnis erweist sich bei genauerer Lektüre als von Nádas präzise durchdacht. Die feinmechanische Struktur des Ganzen ist sprachlich peni


bel austariert. Sein Thema: die dämoni sche Macht des kollektiven Unbewussten, in dem dumpfes Triebleben und mythische Erinnerungsreste brodelnd regieren. In mo ralische Begriffe übersetzt: Der Roman ist eine Untersuchung über das Böse im Men schen in vielerlei Gestalt, vor dem zerstöre rischen Hintergrund scheinbar ewiger kom munistischer Gewaltherrscha in Ungarn.
Sprachlich manifestiert sich das Böse zunächst in hundsgemeinem Dor ratsch, einem vielstimmigen Chor anonymer Dörf ler, die vor allem über bestimmte Dörflerin nen gehässig herziehen. Ihre Rede ist Kloa ke, ihre Niedertracht stinkt zum Himmel. Mit dreckigem Geschwätz, gewirkt aus Bosheit und Unwissenheit und durchsetzt mit gotteslästerlichen Flüchen und zoti gen Beschimpfungen aus dem Fäkal- und Sexualbereich, schneidet das Chor-Kollek tiv einigen Frauen, die irgendwie auff ällig und daher als Außenseiterinnen gebrand markt wurden, die Ehre ab, verhöhnt und verleumdet sie.
Frau Teres, eine ehemals adelige alte Grundbe sitzerin mit einem unehelichen Sohn, wird als Hexe diffamiert und zur Zielscheibe all gemeiner Missgunst und Häme. Ihre Tage löhnerin Rosa, die epileptische Tochter des Gemeindehirten, gilt als Dor ure, die jeden drüberlässt und den Bankert dann weggibt, die Frühgeburt hingegen im Mist verscharrt. Und der kleinwüchsigen Thekenhilfe des Kneipenwirts, allgemein nur „das Zwerg lein“ genannt, wird nachgesagt, dass sie es hinterm Plumpsklo mit jedem Mann treibt. Endlos der Spott der Dörfler, weil ihr ledi ger Sohn Imre ein großgewachsener junger Mann ist, bei dem sich körperliche Schön heit mit dumpfer Brutalität paart. Außer den Frauen mit ihren Bastardsöhnen gilt die üble Dorfnachrede dem Potenzneid auf dauergeile Männer, vor allem auf den Ge meindehirten und den Bienenzüchter, die angeblich jede Frau bespringen.
Doch dabei belässt es Nádas nicht. Sein raffiniertes, multiperspektivisches Erzähl
werk wechselt unentwegt den point de vue, o von einem Satz auf den nächsten, in har ten Schnitten. Der Text wird ständig mo duliert und variiert, springt abrupt von der gehässigen Außen- auf die selbstreflexive Innenperspektive und retour, spielt mit Vor griffen und Rückverweisen und führt früh Motive ein, etwa die afrikanischen Hornis sen, deren mörderisches Treiben, aufgeladen mit metaphorischer Bedeutung, viele hun dert Seiten später zum katastrophischen Fi nale des Romans beitragen wird.
Aus dem bösen chorischen Sprachunflat tönen allmählich personal erzählende Einzelstim men heraus, die in erlebter Rede oder inne rem Monolog die eigene Herkun aus dem entmachteten Adel oder aus Restbeständen einstigen Großbürgertums ansprechen und die geisterha en Tiefenschichten rudimen tärer historischer Erinnerung anklingen lassen. Die wichtigste Stimme ist die der Frau Teres, die als junge ledige Mutter von ihrer adeligen Familie verstoßen und ent erbt wurde und sich und ihr Söhnchen in Schande durchbringen musste. Der dezent wienerische Tonfall des Übersetzers Hein rich Eisterer lässt in Timbre und Wortwahl die kakanische Vergangenheit dieser Region charmant anklingen.


In der zweiten Romanhäl e geht es dann um prämodernen Aberglauben, um das potenzielle Böse in Gestalt eines triebhaf ten Liebeswahns, den der katholische Dorf pfarrer als teuflische Besessenheit missdeu tet und dem großen Sohn des Zwergleins rituell auszutreiben sucht. Damit beschleu nigt der Priester die Tragödie, auf die der Roman mit Mord und Selbstmord melo dramatisch zusteuert.
Die Schilderung eines Exorzismus hät te man in einem Nádas-Roman vielleicht nicht unbedingt erwartet. Aber da es hier um lauter grausige Schauergeschichten geht, nimmt man auch diesen schrägen Exkurs in die katholische Gespensterfol klore in Kauf.
SIGRID LÖFFLER
Péter Nádas: Schauer geschichten. Roman. Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer. Rowohlt, 576 S., € 31,50
»Eine superbe Erzählung vom kleinen Leben in der großen Geschichte.«
Wolfgang Paterno, profil
»Ein famoses Buch.«
Andrea Seibel, Literarische Welt
416 Seiten mit Abbildungen und Register Gebunden und als E-Book. zsolnay.at
Drei junge, risikofreudige niederländischsprachige Schri stellerinnen weisen den Weg aus der Sackgasse der Selbstbeschau
Es beginnt ganz harmlos. Eines Nachts ist Simon verschwunden. Was ihm nicht ähnlich sieht. Dann kommt er nach hause zu seiner Freundin Leo, wirkt eupho risch und überdreht, berichtet von dubiosen Begegnungen und Projekten für eine strah lende Zukun . In den nun folgenden Ta gen und Wochen aber ist Simon nicht wie derzuerkennen: Er ist dünnhäutig, schlä kaum und schlittert in den Wahn, über wacht und in seinen Karriereplänen ge hindert zu werden. Der vormals zarte Si mon, für Leo ein Fels in der Brandung, rast ungebremst hinein in eine Psychose und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück. Die Situation eskaliert. Bis Leo schließlich kurze elf Minuten bleiben, um eine Tragö die zu verhindern.
„Ich bin nicht da“ nennt Lize Spit ihren zweiten Roman. Die 34-jährige Belgierin gilt seit Erscheinen ihres Erstlings „Und es schmilzt“ als Senkrechtstarterin. Über 200.000 verkau e Exemplare, Auszeich nungen und Ausgaben in den wichtigsten
müdender Details. Und auch die Sprache gerät außer Kontrolle, verrennt sich in ver queren Bildern. „Wir waren“, so Leo über die Statik ihrer Liebe, „die beiden schiefge sackten Säulen, die, sobald man sie anein anderlehnte, fester stehen würden als eine unversehrte, für sich stehende Säule es je könnte.“ Und als Simon im Krankenhaus sediert dahinvegetiert, heißt es über ihn, er sei „schlaff und bleich wie eine Nudel, die eine Nacht in der Spülmaschine ver bracht hat“. Na ja. Nach knapp 600 Seiten ist das furiose Finale fast schon ein Aufat men: Geschafft!
Viel gewagt, zu wenig gewonnen: Das ist diesmal der Preis für den Mut zum Risiko. Sei’s drum. Die couragiertesten Stimmen der niederländisch-flämischen Literatur –und das ist in diesem Herbst gleich dreifach belegt – gehören jungen Frauen. Schri stel lerinnen wie Hanna Bervoets, 1984 gebo ren, oder Lieke Marsman, Jahrgang 1990. Sie geben Ton und Richtung vor: pfeifen auf die Empfindlichkeiten der Selbstbeschau, richten sich im Wildwuchs ein und werfen sich auf alles, was ihnen die gesellscha lich brennenden Diskussionen zuspielen. Vor allem aber getrauen sie sich, Beherzt heit und Tempo vorzulegen, auf die Gefahr hin, hochkant aus der Kurve zu fliegen.
Sprachen der Welt haben sie in die Top-Li ga der flämischen Autorinnen katapultiert und ihren Ruf als literarische Grenzgänge rin gefestigt, die Gefühle bis ins unerträg lich Drastische hinein auslotet.
Angesichts des Erfolgs ihres exzentri schen Erstlings lag die Latte hoch. Und vielleicht hat sich Spit gerade deshalb neu erlich zu einem höchst dramatischen Stoff hinreißen lassen, einem filmisch gestalteten Psychogramm einer Beziehung mit gefähr lich destruktivem Potenzial. Die Liebenden geraten in eine Horrorshow, als Simon im mer tiefer in seiner Paranoia versinkt. Leo, ohnedies eine nicht eben in sich ruhende Persönlichkeit, deckt und beschützt ihren Freund bis hin zur Einweisung in die Psy chiatrie. Nach der Therapie begleitet sie Si mon bei der Rückkehr in den Alltag und muss zusehen, wie ihn die Krankheit ein holt – und sie gleich mit. Die zwei sitzen gemeinsam in der Falle.
Lize Spit beherrscht ihr Handwerk, das ist of fensichtlich, und sie hat in Helga van Be uningen eine souveräne Übersetzerin ge funden. Der Roman fährt so ziemlich alles auf, was in den Meisterklassen der Film hochschulen in Sachen „Suspense“ gelehrt wird. Doch je weiter die Autorin ihren auf mehreren Erzählebenen dahinjagenden Thriller vorantreibt, umso stärker entglei tet er ihr, rauscht ungebremst dahin, ufert aus und verfängt sich in einer Abfolge er
Was Hanna Bervoets in ihrem Roman „Dieser Beitrag wurde entfernt“ vorführt: ein formal und sprachlich konzentriertes, kühnes und zugleich subtiles Buch über den Fluch der Social Media. Auf einer der international agierenden Plattformen wachen ContentModeratoren darüber, welche Fotos und Videos gerade noch legal sind und welche entfernt werden müssen. Ein diffiziles Ab wägen: Einem Pädophilen den Tod zu wün schen ist erlaubt, bei einem Politiker hin gegen geht das nicht; Fotos aus dem KZ dürfen bleiben, sofern keine minderjährigen unbekleideten Opfer zu sehen sind. Porno, mit oder ohne Gewalt – sofort löschen. 500 Beiträge täglich, das ist die Marke, die es zu erreichen gilt, für jeden einzelnen Be schä igten. Da muss man sich ranhalten.
Ein andauernder Angriff auf die Psyche. Kaum jemand verkra et es auf Dauer, mit den verstörenden Bildern klarzukommen. Alkohol und Drogen werden dagegen aufge boten oder exzessives Masturbieren wie bei der Ich-Erzählerin Kayleigh. Sie hat Schul den, der Job ist gut entlohnt. Wie teuer sie dafür bezahlt, will sie lange nicht wahrha ben. Zumal sie in jener Gruppe, der sie zu geordnet ist, Sigrid kennenlernt. Die zwei werden ein Paar. Doch unmerklich stellen sich bei Sigrid und den Freunden aus dem Team Veränderungen ein: ein Hang zu Eso terik und Heilslehren, gefolgt von höchst dubiosen politischen Aussagen.
Der schmale Band, eigentlich ein Brief an einen Anwalt, schildert packend, wie das Denken in seltsame Richtungen ab biegt – bis die Erde zur Scheibe gewor den ist und die CIA uns wie Statisten in einer gigantischen Hollywood-Kulisse hin und her schiebt. Und der Holocaust ist ein Märchen. Hanna Bervoets beschreibt, wie subtil sich die Manipulationen der Sozia len Medien entfalten. Und selbst jene, die das Internet zensieren, verlieren jedes Maß für richtig und falsch. Womit das ohne
Lize Spit: Ich bin nicht da. Roman. Aus dem Niederländischen von Helga van Be uningen. S. Fischer, 571 S., € 27,50

hin schon fragile gesellscha liche Werte system noch zerbrechlicher wird. Ein gro ßes Thema, gebündelt in einem verhaltenen und gerade dadurch aufwühlenden Stück Literatur.
Um brüchige Wertesysteme kreist auch Lie ke Marsmans Roman „Das Gegenteil eines Menschen“. Es ist die Geschichte einer jun gen Klimatologin, die ihren Platz sucht in Zeiten, da die Menschheit auf den Abgrund zutaumelt. Zwischen Angst und Hoffnung bestehe kein Unterschied, so Ida: Beide ha ben mit Zukun zu tun, und die bekom me man selten zu fassen. An guten Tagen glaubt sie mit ihren Daten und Tabellen mithelfen zu können, um einen Weg aus der drohenden Natur- und Nuklearkatastro phe zu finden, an schlechten steckt sie den Kopf in den Sand und schiebt die Schuld für ihren Fatalismus auf ihre Elterngenera tion, die die Welt in jenen Zustand manö vriert hat, an dem Ida so schwer trägt. Ret tung ist keine in Sicht, die Politik versagt. Ida scheint jede Perspektive, die ihr unter kommt, „ein bisschen so wie das Wetter: heute ziemlich entscheidend für meine täg lichen Aktivitäten […], morgen egal“.
Zwischen den Polen von Au ruch und Resignation dri et die Ich-Erzählerin da hin, gefangen in den Zweifeln ob ihrer se xuellen Identität. Der Roman zeichnet diese Orientierungslosigkeit in kurzen Sequenzen und mit ständig neuen Wendungen nach. Der Text wirkt kursorisch, manchmal un fertig und vorläufig. Was Idas desperatem Denken und Tun entspricht. Ihr Schreiben avanciert zur Selbstanalyse. Dafür durch forstet sie das Netz und plündert Biblio theken, schwingt sich zu philosophischen Diskursen auf, lässt Zitate, Gedichte und Tagebuchnotate einfließen. Es geht dabei kreuz und quer durch Wissenscha , Litera tur und Poesie, in einem breiten Bogen von Robert Creeley und Naomi Klein bis hin zu Blaise Pascal oder Anne Carson.
Hanna Bervoets:
Dieser Beitrag wurde entfernt. Roman. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Hanser Berlin, 110 S., € 21,50
Das Konvolut an Schnipseln ist wild in den Text montiert, bricht ihn auf und bil det so die Ratlosigkeit der heute 20- und 30-Jährigen ab, die nicht wissen, woran sie sich halten sollen. „I am fluid“, wie Joni Mitchell sagt, „Everything I am, I’m not.“ Und selbst die Liebe ist kein sicherer Hafen, wenn das Lebensgefühl im Vagen wurzelt. Was sich zuspitzt, als Ida von ihrer Freun din verlassen wird. „Bin eine Gurke“, so ihr Mantra als kleines Mädchen: wächst, aber empfindet nichts. Eine Form der Kapitula tion schon in jungen Jahren.
Lieke Marsman: Das Gegenteil eines Menschen. Roman. Aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt und Stefanie Ochel. Kle Co a, 185 S., € 23,50


Marsman nimmt abgehobene Sujets eigen- und hintersinnig auf und holt sie auf den Boden. Ihr schmaler Band, den Christiane Burkhardt und Stefanie Ochel fein übersetzt haben, hat seine prätentiö se Seiten. Doch er ist ein Versprechen, weil er forsch nach vorne sprintet, vieles aus probiert und sich den Bedrohungen durch Untergangsszenarien auf originelle Weise annähert.
Lieke Marsman, Lize Spit und Han na Bervoets riskieren einiges, jede auf ihre Weise. Sie beweisen Mut und liefern da mit etwas, was gerade in Tagen wie diesen nottut und überzeugt: eine Literatur, die sich exponiert.
SUSANNE SCHABER»Spit, Bervoets und Mars mann werfen sich auf alles, was ihnen die gesellscha lich brennenden Diskussionen zuspielen


A m Beginn – „Man kann hier anfangen“ – steht ein Rückblick: Gusten Grip pe, Jungstar der Immobilienbranche, gerät beim Joggen in das Villenviertel am „Kalt see“. Eigentlich wollte er den noblen Vor ort von Helsinki, in dem er gemeinsam mit Nathan Häggert aufgewachsen ist, nach der „Katastrophe“ und seinem Weggang von dort meiden. Das war 2008, jetzt haben wir 2014: „Ja. Katastrophe. [...] Alles kracht zu sammen und geht kaputt. Für immer. Und, ebenso unausweichlich: Das ist seine Schuld. Und Nathans (vor allem).“

Gleich am Anfang erfährt man, was ge schehen ist: Vier Burschen haben eine Mit schülerin vergewaltigt, im Keller der Häg gerts, während oben die Party lief, Nathan, dessen Schuld hier in Klammern steht, war der Rädelsführer, Gusten hat mitgemacht.
Man kann hier anfangen – oder auch an derswo. Die Autorin nähert sich dem Ge schehen, Beteiligten und Unbeteiligten von verschiedenen Zeitebenen und Perspekti ven aus, sie entfernt mit unerhörtem Raf finement Schale um Schale, bis am Ende der Kern sichtbar wird: ein Tableau des Sadismus, das an Musils „Zögling Törleß“ erinnert.





Da ist der brillant begabte Nathan, Produkt einer toxischen Wohlstandsverwahrlosung, unfähig, mit der narzisstischen Kränkung durch seine Freundin fertig zu werden; ein
„Funny Games“-Typ, charismatisch, dä monisch, empathiebefreit. Und da ist Gus ten, der ihn bewundert, aber schließlich die Phalanx des Schweigens durchbricht und (Selbst-)Anzeige erstattet, obwohl das Op fer das nicht will. Er ist der einzige Täter, an dem, trotz Freispruch, die Schuld nicht abperlt, der realisiert, dass die Anführungs zeichen in der Prozess-Berichterstattung –die „Stra äter“, das „Opfer“, „sich vergehen“ – eine „nackte Wahrheit“ verhüllen, „eine, mit der man nicht wirklich leben konnte, obwohl man es musste“.
Der Ton macht die Musik bei Monika Fagerholm, die hier virtuos vielstimmig den Drive der Bewusstseinsströme inszeniert, mit Thema und Variation und allen Zwi schentönen der Selbstbeschwichtigung und Erkenntnis. Dass die in Skandinavien be rühmte finnlandschwedische Autorin mit diesem fulminanten Buch endlich im deut schen Sprachraum erscheint, ist ihrer Über setzerin Antje Rávik Strubel zu danken, die das Stürmende und Drängende, aber auch das Tänzerische und Subtile des Textes meisterha zum Klingen bringt.




Die Musik ist aber auch Bezugsfeld: „Who Killed Bambi?“, die Nummer der Sex Pistols, soll einem Film den Titel geben, den ein Mitschüler über das Verbrechen dre hen will. Es wird anders kommen. „Sign O’ The Times“, die halbversteckte morbi de Grundmelodie des Romans, stammt von
Monika Fagerholm: Wer hat Bambi getötet? Aus dem Schwedischen von Antje Rávik Strubel. Residenz, 256 S., € 25,–




Nathans Liebling Prince: „At home there are seventeen-year-old boys and their idea of fun / Is being in a gang called ‚The Di sciples‘ / high on [...]“. Bei den Sex Pistols heißt es „Someone should be angry“, doch die reichen Eltern schieben alles auf den Alkohol und machen sich zu Komplizen.

„Wer hat Bambi getötet?“ ist auch die kunst voll verzweigte Geschichte mehrerer Lie ben: Gusten ist nicht einfach nur ein Täter; er joggt am See, weil er hofft, Emmy zu be gegnen, mit der er nach seinem Zusammen bruch die große Lovestory erlebte. Seit sie ihn verlassen hat, tröstet er sich mit ihrer besten Freundin Saga-Lill. Die wiederum will von ihm mehr als sexuelle Lustbarkei ten (ein Wochenende in Wien). Bald sarkastisch, bald verständnisvoll widmet sich Fagerholm den Herzensver wicklungen vor der Folie eines wölfischen Kapitalismus, den Nathans Mutter Anne lise mit Hingebung verkörperte, das Wirt scha swunderkind aus dem Heim, Ge schä sfrau des Jahres, entthront durch Gustens Verrat. Er, der Schauspieler wer den wollte, geht schließlich ihren Weg und irgendwie bewahrheitet sich doch, was sie nach dem Urteil vorhersagte: „Jetzt blättern wir die Seite um, und eines schönen Tages werden wir so viele Seiten umgeblättert ha ben, dass nichts von alldem passiert ist.“
 DANIELA STRIGL
DANIELA STRIGL
Mit dem furiosen Roman „Wer hat Bambi getötet?“ stellt sich Monika Fagerholm einem deutschsprachigen Publikum vor
Der Schwede Gunnar Bolin dringt tief in die österreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts ein
Was Familiengeschichten anbe langt, herrscht in der Litera tur kein Mangel. Die Beschä igung mit der eigenen Herkun kommt nicht aus der Mode. So hält auch der Schwede Gunnar Bolin seine Familie für erzählenswert.
In Schweden ist Gunnar Bolin, Jahrgang 1957, ein bekannter Radio journalist und Produzent; noch be rühmter aber ist die Familie selbst: Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts versorgten die Bolins die russische Zarenfamilie mit Geschmeide und beliefern bis in die Gegenwart das schwedische Königshaus.
„Die Kinder des Ho uweliers“ ist denn auch der etwas fantasiearme Titel der chronologisch aufgebauten Familiensaga, für die Bolin sehr um fangreich und genau recherchiert hat. Zu Beginn überwiegt eine rein sach liche Journalistensprache. Man kann das auch als langsame Annäherung des Autors an seine Altvorderen lesen, deren intime Lebensgeschichten of fen und schonungslos zu zeigen auch mit Hemmungen einhergeht und Mut abverlangt.
Insofern kommt der ausgewiesene „Roman“ dem Sachbuch sehr nahe. Weil Archive aber Lücken und Fami liengeheimnisse offenlassen, grei der belesene Bolin auch auf die Mittel der Literatur zurück. Die Zeichnung der einzelnen Charaktere, vor allem der divenha en Großmutter Karin oder des ambivalenten Vaters Gerhard, der in der deutschen Wehrmacht diente, belegen die sprachliche Gewandtheit des Autors.


Zuweilen wähnt man sich allerdings auch im Seminar; es ist quasi eine Einheit in österreichischer Geschichte vom Ersten Weltkrieg über den Austrofa schismus und die Nazizeit bis in die Zweite Republik. Neben den histori schen Standardwerken hat Bolin auch die maßgeblichen Autoren jener Zeit
gelesen: Robert Musil, Elias und Veza Canetti, Joseph Roth, Karl Kraus ...
Auf Interesse stößt die verwandt scha liche Verbindung besagter Ka rin mit ihrem Onkel Karl Seitz, der ab 1923 als Wiener Bürgermeister maß geblich die Blütezeit des Roten Wien prägte. Karins Ehe mit Ernst Hof fenreich, der aus dem Wiener Groß bürgertum stammt, aber als Sozialist die burgenländische Politik gestaltet, steht unter keinem guten Stern. Das Leben in Wiener Neustadt ist für Ka rin ob der Enge und der ständigen Abwesenheit ihres Mannes schreck lich. Sie, die nicht die erwartete Mut terrolle einnimmt, fährt nach Wien, wo sie Karl Seitz trifft, der ihre Be geisterung für das Großstadtleben weckt.
Innerhalb der kosmopolitischen und polyglotten Familie Bolin, deren Wur zeln nach Russland, Schweden und Österreich reichen, herrscht ein Span nungsverhältnis zwischen aristokra tischem Gehabe und sozialistischem Engagement. Vertreibung und Verfol gung durch die tödlichen Ideologien des 20. Jahrhunderts beeinflussen die Figuren, die auch so manche Schrul le aufweisen: Gunnars Vater Gerhard etwa ist äußerst geizig, außerdem wa ren ihm die Handtücher nach dem Duschen immer zu nass: „Er zeig te uns, wie man das Wasser mit den Händen von den Beinen streichen konnte, ehe man sich abtrocknete.“ SEBASTIAN GILLI


1934 kommt der junge Stephen Spender nach Wien, verliebt sich erstmals in eine Frau – und in die Stadt
D er englische Dichter Sir Stephen Spender (1909–1995) war eine der schillerndsten Figuren der Litera tur des 20. Jahrhunderts. Der Spross eines liberalen Londoner Journalis ten geht nach dem Studium in Ox ford nach Deutschland – sein 1928 entstandener Roman „Der Tempel“ wird zu einem Klassiker der Schwu lenliteratur. Als Kurzzeitkommunist zieht Spender in den Spanischen Bür gerkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg wird er zu einem der bekanntesten Wortführer des Antikommunismus. Die Queen erhebt Stephen Spender 1983 schließlich in den Adelsstand.

Mit 25, als Spender im Mai 1934 mit seinem Geliebten, der sich als Sekretär des Dichters ausgibt, nach Österreich kommt, ist er noch voller Ambivalenzen. Erst kürzlich war der Februaraufstand der Arbeiter blutig niedergeschlagen worden; währen des Krankenhausaufenthalts des Gefähr ten beginnt Spender eine Aff äre mit der amerikanischen Medizinstuden tin Muriel Gardiner.
Spender, der bis dahin nur Män nerbeziehungen unterhalten hatte, ge steht Muriel seine Verlegenheit und dass er noch nie in eine Frau verliebt war. Mit ihr, die heimlich Botendiens te für die emigrierten Führer der So zialdemokratie durchführt, gerät er ins Zentrum der politischen Ausei nandersetzung und beginnt im Som mer in einem Blockhaus im Wiener wald das vierteilige Großgedicht mit dem Titel „Vienna“ zu schreiben, um „die öffentlichen Turbulenzen mit meinem eigenen Leben in Beziehung zu setzen“.
ein wachsendes Licht.“ In freien Ver sen wird ein erster Gang durch Wien beschrieben; Gesprächsfetzen bei einem Krawattenkauf, die Beschwö rung des toten Kanzlers und Stadt ansichten verdichten sich zu einer ex pressionistischen Bilderfolge.
Die „verdammte Bande“ der Austro faschisten wird der Welt der Arbei ter gegenübergestellt, auch die Kir che darf nicht fehlen: „Der Kardinal erfreut uns mit einem Hauch von Scharlach. / Bombe, Bombe, Bom be, Trompeten, Trommeln, Flöten. / Oh Lamm Gottes, verschone uns.“ Spender besingt den Gemeindebau des Roten Wien kryptisch, leichter identifizierbar sind die Arbeitslosen auf der Parkbank und die Bettler. Im Teil „Tod der Helden“ wird der Feb ruarkämpfe im Karl-Marx-Hof und in Floridsdorf und der Hinrichtung Ko loman Wallischs gedacht.
Das ganze Gedicht ist überschat tet von der rasch beendeten Liebesbe ziehung zu Muriel, die den revolutio nären Sozialisten Buttinger heiraten wird. „Ich denke o an eine Frau, / Vernachlässigt mit dunklen Augen, mit einer fordernden Drehung des Kopfes / Und Haar von schwarzseide nen Tieren.“ Die jungen Männer aber, deren Körper er beim Schwimmen be wundert, werden bald zu Kanonenfut ter. Stephen Spenders „Vienna“ ist das bizarrste Liebesgedicht, das über die se Stadt je geschrieben wurde.
Gunnar Bolin: Die Kinder des Ho uweliers. Roman. Aus dem Schwedischen von Jürgen Vater. Czernin, 368 S., € 28,–

Der sogenannte Röhm-Putsch, die Ermordung von Engelbert Dollfuß und die Toten des Februars 34 erge ben ein wilde Mischung. Es beginnt pompös: „Wiewohl der Mensch lebt oder stirbt, / […] Ist sein wahres Le ben ein erlöschendes, sein wahrer Tod
Stephen Spender: Vienna / Wien.
A Poem / Ein Gedicht. Aus dem Englischen von Karoline Pilcz. Karolinger, 75 S., € 19,95


Gebunden mit Schutzumschlag, 416 Seiten, 26,80 €
Das von der Autorin eingelesene Hörbuch erscheint bei tacheles! / ROOF Music.

»Als Kaiserin bin ich in eine Ebene aufgestiegen, wo mir das normale Menschsein nicht mehr möglich ist.«
Karen Duves hinreißender Roman über Sisi zwischen Zwang und Freiheit© Kerstin Ahlrichs
Wikipedia hat was verschlafen. Weil sich Oskar Aichinger in seinen Bü chern als ein Meister der Entschleunigung erweist, ist es aber schon fast wieder pas send, dass die Online-Enzyklopädie aus gerechnet bei ihm nicht auf dem neuesten Stand ist: „Oskar Aichinger (* 1956 in Vöcklabruck) ist ein österreichischer Kom ponist und Pianist des Modern Creative Jazz“ steht dort zu lesen.
Das ist zwar nicht falsch, aber eben höchst unvollständig, hat sich der Schwer punkt in der Arbeit des Wahlwieners zuletzt doch immer mehr aufs Schreiben verlagert. Drei Bücher hat er in den letzten fünf Jah ren vorgelegt, eines schöner als das andere.
Das jüngste davon trägt den passenden, gleich auf den Rhythmus des Texts einstim menden Titel „Ich steig in den Zug und setz mich ans Fenster“ und liefert auch die Er klärung dafür, warum Aichinger zum Ge sprächstermin deutlich zu früh erscheint: Als regelmäßiger Zugfahrer von klein auf ist er es gewohnt, einige Minuten vor der Abfahrt am Bahnsteig zu sein – und ge nauso pflegt er es auch bei Verabredungen zu halten.
Dass der Musiker und Autor ein großer Fußgänger ist, war bereits aktenkundig. In zwei Bänden hat er von seinen Streifzügen erzählt. Vor fünf Jahren legte er sein Buch debüt „Ich bleib in der Stadt und verreise: Vom Gehen und Verweilen in Wien“ vor. Im Nachfolger „Fast hätt ich die Stadt verlas sen“ bewegte er sich an den Rändern von Wien. Die charmanten Beschreibungen und freien Assoziationen vermochten ebenso zu bezaubern wie der leicht schwingende, mu sikalische Schreibstil.

Dass Aichinger nun eine Liebeserklärung an das Zugfahren vorlegt, hat auch biografi sche Gründe: Beide Großväter waren Eisen bahner, die Familie lebte unweit des Bahn hofs Attnang-Puchheim, und weil der Vater ein strenger Autoverweigerer war, wurden praktisch alle Wege mit dem Zug zurück gelegt. In seiner Kindheit und Jugend sei
das nicht immer nur schön gewesen, erin nert sich Aichinger. „Damals kam es mir ein bissl ärmlich vor, dass wir kein Auto hat ten. Aber mein Vater war sehr prinzipien treu, eigentlich ein früher Grüner. Fernse her hatten wir auch keinen. Das war noch bitterer, weil man in der Schule nicht mit reden konnte.”
Dennoch ist Aichinger dem Bahnfahren immer treu geblieben. Am meisten schätzt er heute Fahrten ohne zwingenden Grund. Neben Reisen, um von A nach B zu gelan gen, hat er in den letzten Jahren das Fahren um des Fahrens und Schauens willen kulti viert und zunehmend verfeinert – wohlge merkt bereits vor Corona und der Einfüh rung des Klimatickets.
Das Prinzip ist so unspektakulär wie überzeugend: Er sucht sich eine Strecke aus, steigt ein, sucht sich einen Platz mit gutem Blick und schaut zum Fenster raus. Unter wegs wird beobachtet, nachgedacht, Erinne rungen nachgehangen und auch ein wenig historisches Wissen zu den gerade durch fahrenen Orten durchgegangen. Ah ja, wich tige Durchsage: „Um wirklich schauen zu können, muss man alleine reisen.“
Wo es ihm gefällt, steigt Aichinger aus, durch strei eine Kleinstadt, kau sich eine Le berkäsesemmel und ein Bier, kehrt vielleicht noch in einem Café ein und überzeugt sich von der Qualität der Cremeschnitten, ehe es wieder zurück zum Bahnhof geht.
„Ich steig in den Zug“ ist vielleicht kein hochspannender Pageturner, aber enorm anregende Lektüre. Denn Aichinger schal tet beim Flanieren das Hirn nicht aus, im Gegenteil: In seinen Büchern wird anhand des Beobachteten andauernd reflektiert, über Änderungen im Sozialverhalten in der Stadt und auf dem Land, über die Na mensgebung von Wirtshäusern, die Herlei tung von Ortsnamen oder die Verschande lung durch Bausünden.
Apropos: Gleisanlagen sind Straßen äs thetisch haushoch überlegen, ist Aichinger überzeugt. „Eine Bahnlinie zerschneidet die
Ob per pedes oder per Bahn: Der Komponist und Jazzpianist Oskar Aichinger erweist sich als Meister der Entschleunigung
Landscha nicht. Sie fügt sich besser ein.“ Unterwegs entsteht dann bei ihm eine Art Film im Kopf. Notizen hingegen macht er sich nur wenige. „Ich stehe auch nicht am Bahnsteig und fotografiere irgendwelche Loks.“ Weil er von vornherein mit der Hal tung einsteigt, etwas aufnehmen zu wollen, bleibt auch viel hängen.
Schon in sehr jungen Jahren, als er die grö ßeren Klavierwerke Beethovens zu spielen begann, ereilte Oskar Aichinger die plötz liche Eingebung, er wäre ein Künstler. An der praktischen Umsetzung musste er län ger arbeiten und Hartnäckigkeit beweisen. Der Vater bestand auf einem technischen Studium, der Sohn wählte etwas möglichst Exotisches und kam auf Hüttenwesen, also Metallverarbeitung.
Nach zwei Jahren in Leoben haute er den Hut drauf („Ich war sogar ein guter Stu dent, aber es war nicht meins“) und ging ans Mozarteum. Es sollte lang dauern, ehe die Eltern die Berufswahl Musiker akzep tierten. Erst als der Name ö er im Radio zu hören war, wurde es besser.
Es ist eine schöne Pointe, dass Aichin gers eigener Sohn die Familientradition wieder aufleben ließ und Lokführer wur de. Im Buch schildert der Papa auch eine Fahrt mit ihm. „Es ist ein abwechslungs reicher und anstrengender Job. Er bekommt ständig Informationen und Signale, muss schnell reagieren und flink sein im Kopf. Das hat schon eine Ähnlichkeit mit dem Improvisieren in der Musik.“
Oskar Aichinger: Ich steig in den Zug und setz mich ans Fenster. Vom Schauen, Denken und Wien-Ver lassen. Picus, 232 S., € 22,–

Mit der hat Oskar Aichinger natürlich keineswegs abgeschlossen, nur müsste er die in den letzten Jahren geschriebenen Lie der halt endlich einmal aufnehmen. Beim Schreiben tut sich mehr. Der erste fiktiona le Text liegt in der Schublade, würde aber noch einiges an Arbeit benötigen. Aichin ger hält inne, schaut unschlüssig und muss schließlich lachen. „Wenn man was Neues beginnt, glaubt man ja immer eher, es ist ein Blödsinn.“
SEBASTIAN FASTHUBER HARALD DARER

Pointiert und berührend. Sandra Krieger, ORF ZiB
Preisverdächtig gut.
Buchhandlung Tyrolia Innsbruck
Aufregend, berührend, erhellend.
ORF Steiermark
Katia Schwingshandl, Literaturhaus Wien
Der Wiener Publizist Ernst Strouhal erzählt sachlich-einfühlsam das Leben seiner Mu er und ihrer begabten Schwestern
Im selbstbewussten Leben der Wiener Ärztin Ilse Benedikt (1918–1969) gab es eine große Demütigung. Nachdem sie 1938 vor den Nazis geflüchtet war, studier te sie in Zürich Medizin. Als sie nach dem Krieg in ihre Heimatstadt zurückkehrte, musste die fertige Medizinerin Prüfungen ablegen – vor ehemaligen Nationalsozia listen. „Diese Nostrifikation hat sie Öster reich nie vergessen“, meint Ilse Benedikts Sohn Ernst Strouhal.
Der Wiener Kulturwissenscha ler und Publizist hat ein Buch über seine Familie geschrieben. Im Zentrum stehen die aus einer jüdisch-großbürgerlichen Familie stammende Mutter und ihre drei Schwes tern: Gerda, Jg. 1915, wurde Sozialarbeite rin in New York, die 1916 geborene Friedl Schri stellerin. Susanne, Jg. 1923, wurde Journalistin in Paris.
Lokalaugenschein in der Himmelstraße. Das ehemalige Haus der Familie Benedikt auf Nummer 55, eine inzwischen stark verän derte gründerzeitliche Villa, liegt an einem steil vom Zentrum Grinzings zum Wie nerwald aufsteigenden Fahrweg. Fast je des Haus hat eine prominente Geschichte.
Rechter Hand liegt die ehemalige Villa der Schauspielerdynastie Hörbiger-Wesse ly, schräg gegenüber ließ der Maler Alois Delug eine private Malakademie errich ten. Hier wohnte auch ein Mieter, der in Strouhals Buch eine wichtige (Neben-)Rol le spielt, der spätere Literaturnobelpreisträ ger Elias Canetti (1905–1994).
Das Haus der Benedikts wurde 1938 „arisiert“ und erst 1951 nach langwierigen Prozessen restituiert. Die Eltern hatten den Krieg in Schweden überlebt. Das Vermögen war aber aufgebraucht, sodass sie die Im mobilie nach der Rückstellung sofort ver kaufen mussten, nicht zuletzt, um die an gehäu en Schulden zu decken.
„Für die vier Schwestern war die Him melstraße ein Ort von Geborgenheit“, sagt Strouhal im Interview. Die Eltern stritten zwar häufig, und die Kinder waren o wie
Ernst Strouhal:
„Die Frauen
keine
Opfer, sondern führten ein
nomes Leben“

Hund und Katz. Nach der Flucht wurde die Villa dennoch zum Sehnsuchtsort. „Auch wenn das eine Illusion war, haben sie die se verteidigt.“
Vom ersten bis zum letzten Brief ist von Sehnsucht die Rede: Sehnsucht nach den gemeinsamen Mittag- und Abendessen, den Rodelpartien und dem großen Garten, dem gemeinsamen Musizieren und Malen. „Du hast keine Ahnung, was ich für Sehnsucht habe“, schreibt Ilse 1941 aus Zürich an die Mutter in Stockholm. „Mein Geliebtes, Blö des“, heißt es in einem späten Brief Gerdas an Susanne in Paris, „Du fehlst mir derart, dass es zum Kotzen ist.“
Strouhal sichtete in Wien, London, Pa ris und Zürich 15.000 Seiten Dokumente, vor allem Briefe der Schwestern, 400 davon hat er transkribiert. Der Autor nimmt sich als Erzähler zurück, seine kompilatorische Tätigkeit vermittelt eher distanzierten Res pekt als intime Identifikation, was die bio grafische Arbeit angenehm versachlicht. Aus Briefausschnitten und historischer Recher che entstand eine eindrucksvolle Geschich te über Emigration und Emanzipation. So sticht „Vier Schwestern“ aus den vielen Pu blikationen heraus, die die Tragödie jüdi scher Familien im Holocaust beleuchten.
Natürlich war die erzwungene Flucht vor den Nazis die bedeutendste Zäsur in ihrem Le ben, aber die Frauen waren keine passiven Opfer, sondern führten ein enorm aktives und autonomes Leben“, befindet Strouhal, der das Projekt lange vor sich hergeschoben hat, schließlich aber einsehen musste, dass er der einzige Nachkomme war, der die Ge schichte der vier Benedikt-Töchter schrei ben konnte. Neffen und Nichten in Paris und New York wären an der Sprachhür de gescheitert.
keine Bedenken, keine Angst“, charakte risiert Susi ihre Schwester Friedl in ihren Erinnerungen.
Strouhals Mutter Ilse war die dritte Tochter von Ernst Benedikt (1882–1973), dem Chefredakteur und Eigentümer der Neuen Freien Presse. Ernst Benedikt stand im Schatten seines mächtigen, ja übermäch tigen Vaters Moriz Benedikt (1849–1920), der die Neue Freie Presse zur wichtigsten Zeitung der k.u.k. Monarchie gemacht hatte.
Nach ihrer Rückkehr aus dem Exil eröffne te Ilse 1948 im Goethehof, einer roten Hochburg in der Donaustadt , eine Or dination. Die Kommunistin engagierte sich für Frauen, half ihnen bei ungewoll ten Schwangerscha en und publizierte Au lärungsbroschüren.
Ilse war eine der wenigen praktischen Ärzte im Bezirk und hatte rasch mehrere tausend Patientinnen und Patienten. „Ich glaube an das Leben und den Kampf“, schrieb sie in einem Brief. Auch ihrem Sohn Ernst galten die Benedikts als Großbürger, vor allem aber war der Urgroßvater Bene dikt das Feindbild des von Strouhal ge schätzten Publizisten und Sprachkritikers Karl Kraus (1874–1936).
Kraus wiederum hatte einen prägenden Einfluss auf Elias Canetti, der 1935 mit sei ner Frau, der Schri stellerin Veza Canet ti, in die Himmelstraße zog und Strouhals Tante Friedl Benedikt kennenlernte.
Ernst Strouhal: Vier Schwestern. Fernes Wien, fremde Welt. Zsolnay Verlag, 416 S., € 28,80



„Die vier Schwestern entsprachen in nichts den herkömmlichen Klischees von Frauen im Exil. So verschieden sie waren, sie waren alle vier sehr selbstbewusst und hatten wenig Zweifel an dem, was sie ta ten“, führt Strouhal aus. „Keine Vorsicht,
Friedl wollte Schri stellerin werden, Ca netti gab ihr Ratschläge und machte die elf Jahre jüngere Schülerin zu seiner Gelieb ten bzw. sie ihn zu ihrem Geliebten; das schwierige und ambivalente Verhältnis fand nach beider Flucht nach London eine Fort setzung. Veza Canetti duldete und förderte die außereheliche Verbindung.
In England schrieb Friedl unter dem Künstlernamen Anna Sebastian vielbeach tete Romane, ein Erfolg, der die Dreiecks beziehung belastete. Die Lektüre der Briefe brachte Strouhal letztlich doch noch dazu,
HERIBERT CORN
Maria Lassnig zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Ihr erstes eigenes Atelier hatte sie in Klagenfurt, an diesem Ort begann ihre Weltkarriere.
Von hier aus, einem improvisierten Nachkriegssalon großer Strahlkraft, erkundet dieses Buch Aspekte der Kunst und des Lebens der Künstlerin. Eine Hommage an Maria Lassnig aus dem Land ihrer Herkunft.

in die lange gemiedene bürgerliche Welt sei ner Vorfahren einzutauchen. Die jüdische Identität der Familie war erst durch die ras sistische Politik der Nazis überhaupt zum Thema geworden.




Das Schreiben von Briefen eröffnete den Schwestern im Exil einen Resonanz raum, den es im Alltag nicht gab. Die auf vier Länder verteilten Frauen beklagten die Abwesenheit der anderen, kamen nach 1938 aber kein einziges Mal mehr vollzäh lig zusammen. Der Ton war nie sentimen tal, sondern mitunter he ig schnörkellos. Auch vor den Eltern nahmen sie sich kein Blatt vor den Mund. Die Anreden lauteten manchmal liebevoll „Gelieb tes altes Schweinchen“ oder rotzig „Tepperte, alte Drecksau“.





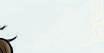


Als einzige Schwester war Ilse nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien zurückgekehrt. Die Eltern wohnten, nun fast mit tellos und angewiesen auf die Unterstützung ihrer Töchter, in einer kleinen Wohnung in der Nähe des Grinzinger Friedhofs. Bei ihren sonntäglichen Besu chen lernte der Autor auch den Großvater kennen. „Ich möchte nicht sagen, dass die Begegnun gen des Kindes mit den Groß eltern immer friktionsfrei verlie fen, um es höflich auszudrücken. Ich war ein zorniges Kind.“


Die Schri stellerin und CanettiFreundin Friedl Benedikt kam nur mehr für kurze Aufenthalte nach Ös terreich. Eine Reisereportage führte sie 1950 auch in die Himmelstraße, wo fol gende sehnsüchtigen Zeilen entstanden: „Während ich höher und höher hinauf gehe, erhebt sich die Stadt zu meinen Füßen, halb aus der Erde und halb vom grenzenlosen Himmel und den süßen, schweren Wein trauben geschaffen. Auf der trockenen Erde der Weingärten liegen die Liebenden in stil ler, hitzedurchfluteter Umarmung.“
Ilse starb 1969, kurz vor ihrem Tod kauf te sie sich noch ein Klavier. Keinen Stein way-Flügel wie in ihrer Kindheit, sondern ein Pianino, das ins Schlafzimmer der Ge meindebauwohnung passte. „Sie hat den Umstieg nie bedauert“, sagt Strouhal.





„Die Sackgasse“ (1947) von Vera Ferra-Mikura ist der einzige „Erwachsenenroman“ der Kinderbuchautorin

Die Wiener Autorin Vera FerraMikura (1923–1997) ist vor al lem als Kinder- und Jugendbuchau torin bekannt; „Die drei Stanisläuse“ sind nach wie vor beliebt. Wiewohl sie heute in der Literaturgeschichte als Vertreterin eines „Magischen Rea lismus“ gilt, hat sie zu Beginn ihrer Schri stellerlau ahn auch ganz an dere Schreibstile ausprobiert. „Die Sackgasse“, jetzt bei Milena wieder aufgelegt und erstmals 1947 publi ziert, huldigt einem sozialen Realis mus, mit einem Schuss Kolportage.
Der Roman arbeitet mit vielen Dialogen, streut krä ige Adjektive, starke Lyrismen oder schwülstige Formulierungen als Würze ein. Am Ende fühlt sich die Autorin geradezu verpflichtet, uns nicht ohne positiven Abschluss zu entlassen. Im letzten Satz glüht der letzte Rest der Sonne „wie eine Verheißung“ am Horizont.

Schauplatz ist eine Mietskaser ne in der „Sackgasse“. Auf engstem Raum entsteht viel Reibung, gedeihen Missgunst und Neid, blühen Tratsch und soziale Kontrolle. In einer star ken Passage führt uns der Roman, wie in einem Film, kursorisch in das Le ben aller Hausbewohner ein, in deren Schilderung die Autorin einen beina he satirischen Ton anschlägt.
Mi endrin befindet sich die Familie Kleist, mit der sich das Romande büt näher beschä igt: Der Vater ist verstorben, die Mutter, eine veritable Bissgurn, kämp jeden Monat ums Überleben, die drei Kinder, 17 bis 23 Jahre alt, sind im Au ruch und ver suchen den Absprung.
Das Ziel ist klar: Ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben soll es sein. Das kann nicht gutgehen: Sowohl im Arbeits- und Liebesleben als auch im künstlerischen Milieu, in das sie stre ben, geht es härter zu als erwartet. Ohne Opfer kommt dieses Drama nicht aus.
Zwischendurch überrascht uns Fer ra-Mikura mit schrägen Szenen und bizarren Typen: Rupert, der Sohn mit der poetischen Mission, ver schreibt sich einem harten Sportpro gramm, um seinen Körper zu züch tigen; in einer beengten Wohnung erweist sich dies als kompliziertes und ziemlich komisches Vorhaben. Wie aus der Zeit gefallen auch das Au reten eines schrulligen Alten, der Alkohol und Nikotin, Milch und Käse ablehnt und Nüsse als Fleischersatz preist. Er hat die Rolle des Weisen vom Dienst, der Rupert beherzt zu setzt und ihm als „Kaltwasserfreund“ eintrichtert, nicht wie „ein alter Du delsack“ zu jammern.
Dem Text ist anzumerken, dass die Au torin ihre eigene Suche, ihre eigene Emanzipationsgeschichte und das ihr vertraute Milieu einbringt. Fer ra-Mikura arbeitete als sogenanntes „Laufmädchen“ in einem Warenhaus, verdingte sich als Stenotypistin, hat te sicherlich genug Schwierigkeiten, nach 1945 in ihre Rolle als Schri stellerin zu finden. Die entspre chenden Lebenserfahrungen finden sich unverkennbar im Roman wie der. Obwohl Ort und Zeit nicht ge nannt und obwohl der Krieg und seine Folgen ausgespart werden, lo kalisieren das äußere Ambiente, die Armut und Trostlosigkeit, den Schau platz relativ eindeutig als das Wien der Nachkriegszeit.
ALFRED PFOSERMit „Shanghai Passage“ der Wienerin Franziska Tausig wurde ein Klassiker der Exilliteratur neu aufgelegt
Entschuldigen Sie, gnädige Frau, sind Sie vielleicht meine Mama?“
Mit dieser Frage ihres Sohnes Otto enden Franziska Tausigs bewegen de Erinnerungen „Shanghai Passa ge“. Das Wiedersehen findet nach neun Jahren der Trennung im Win ter 1947 am Bahnhof Wien-Meidling statt. Otto Tausig, der spätere Volks schauspieler, war dem Nazi-Terror als 16-Jähriger mit einem Kindertrans port nach England entkommen. Fran ziska und ihr Mann, der Rechtsanwalt Aladar Tausig, hatten sich im Mai 1939 nach Shanghai retten können; die übrige Familie wurde ermordet.
Der überwiegende Teil des Buches erzählt von der Zeit in der erzwun genen Emigration. Die „unbeschwer ten Jahre“ davor handelt die 1895 aus Temeswar gebürtige Wienerin Tausig zügig ab: wie sie ihren Mann ken nenlernte, sich verliebte, ihn im Ers ten Weltkrieg beinahe verloren hätte – und wie sie nach dem Zusammen bruch der Monarchie ihr gemeinsa mes Zuhause im ungarischen Teil Sie benbürgens verlassen mussten, um sich in Wien ein neues Leben auf zubauen. Diese erste Entwurzelung wirkt in der Rückschau wie eine Ge neralprobe für die zweite.
Schon die mehrwöchige Überfahrt nach Shanghai – der Dampfer Usaramo war von der Gestapo gechartert, die Passage ein profitables Geschä mit den Flüchtlingen – erweist sich als strapaziös. „Schlechte Nachrichten wurden immer geglaubt“, erinnert sich Tausig; so auch das Gerücht, dass dieser „port of last resort“ inzwischen gesperrt worden sei. Tatsächlich je doch bot Shanghai rund 3000 öster reichischen Juden eine Zuflucht.
mehr. Rasch findet sie Anstellung in einem Restaurant, indem sie vor ver sammelter Küchenbrigade (neugierig „starrten mich 14 ,Schlitzaugen‘ an“) einen Apfelstrudel zubereitet. Später führt das Ehepaar kurze Zeit sogar ein eigenes „Wiener Café“, das zum Treffpunkt für viele Emigranten wird.
Franziska Tausig erweist sich als Über lebenskünstlerin. Allen bitteren Er fahrungen zum Trotz – ihr Mann stirbt 1943 an Tuberkulose im Ghet to Hongkew – steckt ihr Buch voller heiterer Vignetten. Etwa die Beschrei bung des Reiskochs Rudi, vormals Schuhfabrikant, der aussieht wie Hans Moser und diesen auch perfekt imitiert: „Wie er so dastand, schmat zend, nuschelnd, raunzend, dachte man kaum daran, dass man nicht in Wien war, dass es noch Krieg gab und dass er nicht der echte Moser war.“
„Shanghai Passage“ wurde 1987, zwei Jahre vor Tausigs Tod, erstmals veröffentlicht und seither mehrfach aufgelegt (worauf die aktuelle Aus gabe jeden Hinweis vermissen lässt).

Dass die Autorin lieber „kleine Bröt chen“ buk, statt Zeitzeugenscha für sich zu beanspruchen, begründet sie mit der Erinnerung an einen alten Museumsdiener, der sagte: „Wenn S’ Ihnen so nahe zu dem Bild stellen, werden S’ gar nix sehen.“ Was damals wirklich in der Welt geschah, resü miert Tausig, davon hatten die Emi granten in China keine Ahnung.
MICHAEL OMASTABei ihrer Ankun sind die Tau sigs völlig mittellos. Die juristische Expertise des kränkelnden Aladar ist hier nichts wert, die Backkünste der
gen Franziska dafür umso
individuelle Schicksale:

Der fulminante neue Roman von Robert Menasse über die Erweiterungspolitik der Europäischen Union verknüpft Weltgeschehen

Elisabeth R. Hager ist in ihrem Roman „Der tanzende Berg“ dem Zusammenhang von Heimat und Tierpräparation auf der Spur
D ie Geschichte beginnt mit ihrem Ende: Sprengt Marie die dekadente Pyjama party mit einer in der Literaturgeschichte einzigartigen Bombe – oder ist das nur das Feuerwerk zur Mitternacht? Relativ einzig artig ist jedenfalls der Beruf der Mittdreißi gerin, der wir einen denkwürdigen Tag lang folgen: Sie hat ihren Job beim „Kultursen der“ in Wien (die Auswahl ist ja nicht groß) geschmissen und versucht, die Tierpräpara tionswerkstatt ihres verstorbenen Onkels weiterzuführen.
Der hatte ihr, die früh Waise geworden war, das Handwerk beigebracht, und sie hat es zu schätzen gelernt: „Der vom Willen verlassene Körper breitete sich vor Marie aus und wurde zum Material, das sie nach Belieben formen konnte.“
Aber trotz der Hilfe ihrer resoluten Tan te gehen die Geschä e schlecht, das Pat riarchat sitzt am Fuße des Wilden Kaisers noch fest im Sattel und würde seine Tro phäen nie einer Frau anvertrauen.
Also verschwendet Marie ihre Kunstfertigkeit an Wolpertinger, die sie Touristen andreht. Oder sie konserviert die Haustiere der Hautevolée – etwa den Chihuahua „King“, den sie binnen zwölf Stunden in lebendi ge Form gebracht haben soll, damit ihn die Hotelerbin noch pünktlich zum Höhepunkt ihrer 30er-Feier überreicht bekommt. Der Countdown beginnt.

Während sie das Hündchen aus der Decke schlägt, hadert Marie damit, wie viel Geld und Liebe die Reichen in ihre Tiere inves tieren, während es allen egal ist, dass ihre Jugendliebe Youni vor sechs Wochen unter ungeklärten Umständen ums Leben gekom men ist. Als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling war er ins Dorf gekommen und hat trotz zäher Versuche nie eine Chance be kommen – außer als Drogendealer. Wegen seines in der Werkstatt gebunkerten Mari huanas steht nun auch plötzlich Younis Ge schä spartnerin Butz vor der Tür, ein „un bändiges Weib“, das noch einmal Schwung in die Handlung bringt.
„Der tanzende Berg“ ist Elisabeth R. Hagers dritter Roman. Die Schri stellerin und Klangkünstlerin stammt selbst aus St. Jo hann, pendelt mit ihrer Familie zwischen Berlin, Tirol und Neuseeland. Ihre Kri tik an der Verkommenheit Kitzbühels hat nichts von der „Pie e Saga“. Die schreibt mit einem Quantum Humor, aber defini tiv keine drollige Anti-Anti-Heimatlitera tur im Stil von „Blasmusikpop“. Es lebte sich gut hier zwischen den Bergen, wären da nicht die depperten autochthonen Herren und die dummen Reichen mit ihren dum men Streichen.

Es wird schon nicht allzu fiktiv sein, dass die Zweitwohnsitzler glücklosen Bergbau ern, wie etwa dem Vater der Butz, deren
Höfe zum Spottpreis abknöpfen und sich statt des Viehs verwöhnte Doggen zulegen, die täglich Filet mignon fressen. „Die Welt von denen, die man so gut sehen kann, steht auf dem Schutthaufen von denen, die’s zer bröselt hat“, sagt die Butz.
Wie man einen Hund präpariert (nennen Sie es nie „ausstopfen“!), hat Hager augenschein lich genau recherchiert. Den für viele un gustiösen Vorgang schildert sie so, dass es bei der Lektüre nicht zu sehr graust. Man gewinnt einen Eindruck von der Kunst fertigkeit, die es braucht, damit das Tier nicht zu einer unheimlichen Karikatur sei ner selbst wird.
Wer das Tote so darstellen möchte, dass es nicht befremdlich wirkt, muss ein schar fes Auge für alles Lebendige haben – was ja auch für die Literatur gilt. Was Hager anhand der Taxidermie über den Gegen satz von Schönheit und Lebendigkeit, Natur und Kunst, Konkretheit und Abstraktion festhält, besitzt hohe ästhetische Qualität. Hagers Roman geht, no na, unter die Haut, aber die Autorin arbeitet so kunst fertig wie ihre Hauptfigur. Der Titel indes führt ein wenig in die Irre. Die Berge tanzen nicht, sie bröckeln. Was tanzen soll, sind die versteinerten Verhältnisse, um Marx zu bemühen. Das Alpen-Patriarchat soll zur Schutthalde werden, auf dem Neues wächst. DOMINIKA MEINDL
Die Infantin, Teil zwei: In „Fre en“ beeindruckt Helena Adler wieder mit Sprachgewalt – trotz Abzügen bei den Haltungsnoten
M it „Die Infantin trägt den Scheitel links“ hat die Salzburgerin Helena Adler den erfrischendsten Roman des Jah res 2020 geschrieben. Ihre halb autobio grafische, halb hemmungslos geflunkerte Coming-of-Age-Story zeigt, was sich aus dem doch schon sehr verbrauchten Genre Anti-Heimatroman noch rausholen lässt, wenn man derart originell und bildha zu schreiben versteht wie sie.
Adler kommt von der Malerei und hat jedes Kapitel in dem Buch nach einem Bild benannt – von Bruegel bis Kiefer. Dennoch sei anlässlich ihres neuen Romans „Fretten“ eine Analogie aus der Musik gestattet: Nach einem Hit müssen sich Bands entscheiden, ob sie diesem Sound treu bleiben oder sich neu erfinden wollen – der Ansatz von Wan da vs. das Modell Bilderbuch.
Adler geht den Wanda-Weg und lässt „Fretten“ wieder auf dem ärmlichen Bauernhof spie len, auf dem die Infantin in einer dysfunk tionalen Großfamilie aufwächst: der Vater Biobauer mit missionarischen Tendenzen; die Mutter ebenso wahnha religiös wie die Großmutter väterlicherseits, die im Alltag den Ton angibt, während die älteren Zwil lingsgeschwister der Ich-Erzählerin das Le ben zur Vorhölle machen.
So weit, so bekannt. Die ersten 30 Sei ten könnten auch aus der „Infantin“ stam men; und die Kapitel sind wieder nach Ge
mälden benannt. Warum nicht? Auch zwei Ahnherren, die bisweilen aus Adlers Texten winken, haben sich in puncto Stoff, Motiven oder Handlungsort wiederholt. Mit Thomas Bernhard verbindet die Autorin der böse Blick auf die Umgebung sowie der Hang zur Übertreibung. Die Katholiken und Bauern und Fleischhauer auf dem Land – durch die Bank sind sie schlecht und hinterfotzig.
An den Kärntner Josef Winkler wieder um erinnert das beständige Abarbeiten an der Kindheitslandscha , die der Ich-Erzäh lerin verhasst ist und von der sie doch nicht loskommt.
Die Infantin braucht den Mist, der sie umgibt und in dem sie sich auch ausgiebig suhlt, als Dünger für ihre ins Kraut schießenden Wortschöpfungen. Und der Furor der zu nächst noch jugendlichen Erzählerin ist enorm. Sie schließt sich einer Bande an derer Außenseiter an, es wird mit Fleisch und Drogen gedealt und in den Häusern der Reichen gefeiert und randaliert – mit einer unglaublichen Wut, die die Heldin zum Teil auch gegen sich selbst richtet.
Das liest sich über weite Strecken beein druckend und verfügt über einen mitreißen den Rhythmus. Um bei der Musik zu blei ben: Die einzige wirkliche Schwäche des Texts besteht darin, dass der Pegel fast im mer im roten Bereich ist. Adler spielt am liebsten mit voller Lautstärke.
Der Hang zur Alliteration wirkt geradezu manisch. Auf einer einzigen Seite im Buch finden sich folgende Konstruktionen (Lis te unvollständig!): „Ratten-Resort“, „War zenwahrzeichen“, „Bonzenbordell“, „Koks kapazunder“, „Grottengru “, „Heroin für die Heroen“, „Wirtscha swichte in Win deln“, „Luxuslagerhaus“.
Das ist zu viel des Guten, und der Effekt der in Maßen genossen sehr witzigen Neuprägun gen nutzt sich ab. Und doch wird man die sem Sprachkunstwerk, dessen Wirkung ir gendwo zwischen Achterbahnfahrt nach zu viel Langos und Geisterbahnbesuch chan giert, nicht gerecht, wenn man es kleinkrä merisch zerpflückt. Man sollte sich darauf einlassen und die Fahrt genießen.
Denn Adler betritt auch Neuland. Plötz lich ist ein Kind an der Seite der Infantin, was deren Wahrnehmung beinahe komplett verändert. Muttergefühle schießen ihr ein, und obwohl die Sprachmachine immer noch hochtourig läu , finden sich in der zweiten Häl e des Romans vermehrt zarte Töne.
Die Autorin beweist, dass sie weder One-Hit-Wonder noch One-Trick-Pony ist; auch wenn sie das Schimpfen und Wü ten immer noch am besten beherrscht. Al lein die Geburtsszene, in der es die Infantin mit einer grausamen Hebamme aufnehmen muss, ist den Kauf des Buches wert.
SEBASTIAN FASTHUBEREs gibt keine einzige Figur in die ser kleinen Gesellscha , die sym pathisch wäre. Das ist man von Mar tin Mosebach so gewöhnt. Der hat sich auf den Verfall spezialisiert, auf moralisch Anrüchiges, auf bürgerli che Dekadenz – allerdings stets in einer kostbaren Sprache und in aus gewählter Kulisse, mit Sinn für er lesene Details und guten Geschmack. „Grausamkeit. Zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird“, lautet der ers te, durchaus programmatische Satz, notiert von einer der Hauptfiguren, dem Verleger Ruprecht Dalandt, der in einem Landhaus in der Provence beobachtet, wie eine Katze mit einer Zikade spielt und diese genüsslich tötet.

Dalandt, Mitte 60, trägt das silber ne Haar halblang. Er leitet den Ver lag Papyros Press, der sich mit feinen Bildbänden und hermetischer Lyrik Renommee und kulturelles Kapital erarbeitet hat. Verkau arkeit ist nicht so wichtig, denn Dalandts Frau Mar jorie ist Erbin eines beträchtlichen Fa milienvermögens, das ein paar Gene rationen zuvor mit der Ausbeutung von Bodenschätzen und Arbeitern im Kongo erworben worden ist. Seit her gibt es nichts mehr zu tun, als den Reichtum zu verwalten. Dabei ist Marjorie jedoch an eine Sti ung ge bunden, der auch das Haus in Süd frankreich gehört.
Außer dem sich in langjährig ein geübter Äquidistanz kaum noch ver bundenen Ehepaar versammeln sich dort Marjories unnahbare Tochter Paula mit Enkelin Nike und deren unbedar em Freund, dem Möch tergernpianisten Max; die Verlags mitarbeiter Fritz Allmendinger und Sieglinde Stiegle, die sich schließlich aus nichts als karrieristischen Grün den im Dienst einer Großintrige ver heiraten; ein englischer Maler, der Ce zanne-Skizzen für Touristen kopiert und im Haus an den Wänden herum marmoriert; sowie das etwas muffige portugiesische Hausverwalterehepaar Dos Santos.
All diese von Neid, Missgunst und Lieb losigkeit gezeichneten Figuren sind damit beschä igt, sich zu belauern und in fragwürdige amouröse Bezie hungen zu verstricken, denen jede emotionale Tiefe abgeht. Im Zent rum der Aufmerksamkeit aber steht „Taube und Wildente“, ein Stillleben des eher unbedeutenden Malers Otto Scholderer, das zu der von Marjories Großvater angelegten Kunstsamm lung gehört und in das sich Ruprecht – die Grautöne! – verliebt hat. Doch um die notwendige Dachreparatur be zahlen zu können, will Marjorie aus gerechnet dieses Bild – Spielball und Einsatz der Eheentfremdung – veräu ßern, sodass Ruprecht beschließt, es
selbst zu kaufen – mit Geld, das als Förderung für ein Verlagsprojekt ein geworben worden war.
Die eigentliche Tragödie dieser Figuren ereignet sich aber nicht auf der Handlungsebene, sondern be steht darin, dass jedes Bemühen um Distinktion vergeblich ist. All die kulturvollen Anstrengungen, was unternommen wird, um sich einen kulturvollen Raum zu schaffen, ist längst spießig geworden: das Reisen und der Aufenthalt im Mittelmeer raum – Mosebachs bevorzugter lite rarischer Region – sowieso, aber auch das Verlegen hochgeistiger Margina lia und das Sammeln von Kunst, das eher einer Kapitalanlage gleicht, als dass es etwas mit Ästhetik und Ge schmack zu tun hätte.
Das Bedauern über den Verlust von Schönheit prägt Mosebachs Stil. Er schreibt gewissermaßen mit Einsteck tüchlein und manikürten Fingernä geln. „Beträchtlich“ ist eines der Wor te, die er bevorzugt. Ob Wertzuwachs, Altersunterschied, Prestige oder Dis tanzen – alles ist so „beträchtlich“ wie diese Prosa selbst. Mosebachs stets auf Vornehmheit bedachten Sätze leuchten wie der Samtbeschlag an der Wand, den Ruprecht anbringen lässt, um „Taube und Wildente“ besser zur Geltung zu bringen.
Die Spannung dieser Prosa liegt in der Sprache selbst, weil nicht zu unterscheiden ist, ob Mosebach das wirklich so meint oder ob er damit seine Figuren kennzeichnet; ob der Ekel, den er damit hervorru , beab sichtigt oder unfreiwillig ist. Stil und Inhalt entsprechen sich vollständig.
Die Dekadenz ist diesem Stil eben so eingeschrieben wie die emotiona le Distanz, an der noch die größten Gemeinheiten und Katastrophensze narien abperlen. Es geht den Prota gonisten und mit ihnen Martin Mo sebach um „Haltung“, und so ist es schon der Gipfel der Gefühlsausbrü che, wenn Marjorie am Ende, als sie dann doch noch einmal, allerdings ohne ihn zu berühren, neben Rup recht liegt und meint, ein Lächeln bei ihm identifiziert zu haben. Man kann das für große Kunst oder für großen Kitsch halten. Reizlos ist es nicht –genau wie „Taube und Wildente“ von Otto Scholderer.
JÖRG MAGENAUNazi-Sympathisant Emil Cioran und Gestapo-Chef Rudolf Diels sind die Protagonisten in Kühsel-Hussainis „Emil“

Wahrheit oder … Fiktion? Schon mit ihrem Roman „Tschudi“ (2020) hat sich Mariam Kühsel-Hus saini für ein spannendes Dazwischen entschieden. Darin setzt sie eine rea le Persönlichkeit ins Zentrum ihrer Geschichte und ergänzt mit erzäh lerischer Verve die uns unbekannten Stationen. Die Rede ist vom einsti gen Direktor der Berliner Nationalga lerie, Hugo von Tschudi, der um 1900 subversiv die weltanschaulich vereng te Kunstpolitik des Kaisers zuguns ten einer weltoffenen Werkschau zu unterlaufen wusste.
Nun bringt uns die Autorin er neut zwei historische Personen nä her, nämlich den Philosophen Emil Cioran und den ehemaligen Chef der Gestapo (1933–1934), Rudolf Diels, beides überzeugte Faschisten – soll te man meinen. In Kühsel-Hussainis Annäherung werden allerdings die unterschiedlichen Schattierungen der Charaktere deutlich.
Der rumänische Essayist, den es 1933 anlässlich eines Alexander-vonHumboldt-Stipendiums nach Ber lin verschlug, gilt als Antisemit und zeitweise verblendeter Faschist. Die se Einordnung grei der Autorin al lerdings zu kurz, sie entwir stattdes sen das Porträt eines über den Dingen schwebenden Decadents.
licher Reichsfeind Nummer 1“.
Die Aussage hinter der nicht un problematischen Figurenkonstella tion? Sowohl die erratischen Auffas sungen weiter Teile der Intellektuellen als auch das Versagen politischer und administrativer Akteure trugen erheb liche Mitverantwortung für den Auf stieg des Bösen – eine letztlich bana le Einsicht, kaum dazu angetan, ein neues Licht auf längst erforschte Tat sachen zu werfen. Ähnlich wenig er tragreich fallen die Introspektionen in die Täter aus. Soll man Diels, dessen Vergehen trotz all seiner Beschwich tigungsversuche in der Nachkriegszeit allesamt offenbar wurden, nach die sem Buch etwa doch „nur“ als Oppor tunisten ansehen?
Noch kruder muten die amateurpsy chologischen Deutungen mancher Nebenfiguren an, darunter auch ein so prominenter Verbrecher wie der KZArzt Josef Mengele. In einem Kapi tel zu seinen grausamen Versuchen an Zwillingen heißt es, dass sich dieser „überaus christlich“ vorgekommen sei – „und so fiel ihm auch nicht auf, dass die Biologie der Untermenschen doch eigentlich nicht seiner herrenmensch lichen Körperkunde dienen konnte“.
Ob ironisch gebrochen oder ernst gemeint – Kühsel-Hussainis Bestre ben, uns die Widersprüche im Natio nalsozialismus aus dem Inneren der Figuren heraus vor Augen zu führen, überzeugt nicht. Angesichts ihrer Ver suche, sich in die Protagonisten hin einzudenken und deren Motive ver stehen zu wollen, drängt sich die Frage auf, wie weit ein solches Ver stehen von einer Exkulpierung noch entfernt ist.
„Ich habe zu viel erblickt, habe zu viel gefunden, alle Einsichten, alle See len-Karten abgenagt“, beschreibt sich der Denker in den Worten der Auto rin. Und überhaupt erscheint ihm die „ganze Materie“ als „einziger Skan dal aus dem Schoß des Nichts“. Wäh rend manche seiner Zeitgenossen im Führer die große Erneuerungskra sehen, erblickt sie Cioran im Tod, als dem einzigen Ereignis in einer ent leerten Welt.
Zumindest unbotmäßige Gewalt zu verhindern ist hingegen parado xerweise der Wunsch Diels’. Zuneh mend geht er auf Distanz zum Terror von SA und SS, gebärdet sich gar als Opponent im Unterdrückungsstaat, ja erscheint in seiner Selbstdarstellung bei den Nürnberger Prozessen, wo er als Zeuge au ritt, geradezu als „heim
Abgesehen von diesen Unzuläng lichkeiten scheitert der Roman aller dings auch auf literarischer Ebene, indem er unzählige, mitunter unfrei willige Komik produzierende Stilblü ten hervortreibt. Zum Worst-of gehört etwa die „Gi mischung“ aus Hitler und Goebbels, die „von solcher ÜberExplosion“ war, „dass der Augen blick selbst ohnmächtig wurde und kollabierte“. Bei Passagen, in denen vom „Eingang in ein ortloses Zelt“ die Rede ist oder von „trunken rau nenden, neblig wippenden Bäumen“ drängt sich wieder einmal die Frage auf: Wo war der Lektor?
BJÖRN HAYERMartin Mosebach zelebriert den Verfall kunstsinnigen Bürgertums auf gewohnt kunstsinnige Weise
Zwei, die irgendwie dabei gewesen sindMartin Mosebach: Taube und Wild ente. Roman. dtv, 336 S., € 25,50
Mariam Kühsel-Hussaini: Emil. Roman. Kle -Co a, 320 S., € 24,70
»Die Introspektion der Täter wir die Frage auf, wie weit diese von der Exkulpierung noch entfernt ist
Ein Trottel ist ein Idiot ist ein Privat mann. Dostojewskis Fürst Mysch kin und der brave Soldat Schwejk zählen ebenso dazu wie die Komiker aller Herren Länder gegen den Geist ihrer Zeit. Vor al lem, wenn sie sich an Robert Musil hiel ten: „Das Dumme, worüber ich mich lus tig mache, bin auch ich selbst.“ Aus dem Kampf mit der Welt geht nur kein Trottel unbeschädigt hervor. Für Jan Faktor gilt das allemal und ganz besonders für sei nen jüngsten Roman „Trottel“. Diesem vo rangestellt ist ein Motto aus eigener Feder: „Was ist der Grund meiner guten Laune? Einfach Alles.“
Der 1951 in Prag geborenen Faktor übersiedelte 1978 nach Ostberlin, wo er bald Zugang zur literarischen Subkultur in Prenzlauer Berg fand. Obschon mit der Tochter von Christa Wolf verheiratet, zog er die dissidente Existenz als Kindergärtner und Schlosser den Privilegien des sozialis tischen Dienstadels vor und schrieb experi mentelle Literatur: „Ich bin als ein Trottel auf die Welt gekommen, bin wie ein Trot tel aufgewachsen und musste folgerichtig einer bleiben – zu retten oder gutzureden war da nichts.“
Dieses Eingangsstatement wird al lerdings wie fast alles, was auf knappen 400 Seiten und 262 Fußnoten folgt, un zählige Male unterlaufen und überboten: „Überraschenderweise kam alles anders.“ Man könnte „Trottel“ als zeitgenössischen Schelmenroman bezeichnen, voller Witz und sarkastischen Wortspielen, stünde da nicht auch eine Tragödie im Hintergrund dieser höheren, quasi autobiografischen Blödelei. „Manche Erkenntnisse habe ich in meinem Leben spontan im Terrain ge wonnen, ohne sie später mühsam aus einem Prostata- oder Nasensekret extra hieren zu müssen.“
Schon die zwei Dutzend barocken Kapitel überschri en darf man sich auf der Zun ge zergehen lassen: „Patschulischock im Anmarsch“ oder „Karpfen- und Forellen teich – Ein Ödem auf Schmetterlingsratten, Darmhornissen, Ameisenhornochsen, Aug apfelwürmer und Zungenbrecher“.
Aufgerollt, zerrissen und verquer wieder zusammengefügt werden noch einmal ei nige tschechoslowakische Kindheits- und Jugenderinnerungen, um die es in Fak tors „Georgs Sorgen um die Vergangen heit oder Im Reich des heiligen Hoden sack-Bimbams“ schon einmal ging. Dann stehen wir am Prager Altstädter Ring vor den Trümmerresten des russischen Ein marsches von 1968. Auf Anraten seiner Tante, die den merkwürdigen Posten einer Abteilungsleiterin für „Marketing im So zialismus“ innehat, beginnt der Erzähler ein Studium der Computerwissenscha en, was in der Praxis bedeutet: Erkenntnisse über „die führende Rolle der KPdSU bei der Berechnung des Toilettenpapierbedarfs der befreundeten Bruderstaaten im alltäg lichen Katastrophenmodus“.
Dieser will allerdings überwunden wer den, etwa durch „Standsaufen“ in Pra ger Weinschenken. Trotz strebenden Be mühens wird der Protagonist nicht zum studentischen „Jungalkoholiker“, schär vielmehr seine Beobachtungsgabe, wovon der Erzähler noch ein halbes Jahrhundert













»Bei Jan Faktor ist für alles Platz: vom Gruppensex im Sozialismus über illegale Wohnungsdurch brüche bis zur Hässlichkeit des Alexanderplatzes
später profitiert. Männer saßen da „halb arsch“ auf Barhockern und starrten ins Nichts. Das war die „sozialistische Peep show“! Ausgeschenkt wird ein mährischer Tropfen und dazu gesellt sich eine „Mäh rin“, die sich später als „vulval“ trocken erweist.
Der Erzähler gebietet seinem glitschigen Alt herrenwitz rasch Einhalt, wechselt das The ma und erzählt etwa aus der Zeit, als das sozialistische Kantinenessen so manche Überraschung bot: einen filzigen Wischlap pen, der in den Soßenkessel gefallen und stundenlang mitgekocht worden war. „Ich hatte aber Hunger und konnte trotz meiner relativ klaren Spontandiagnose nicht auf hören zu essen.“





Die Übersiedelung in die DDR erfolgt aus amourösen Gründen; was als mehrjäh rige Aff äre mit einer Ostberlinerin beginnt, die von ihrem Ehemann ständig betrogen wird, endet mit einer Hochzeit – selbst redend an einem 1. April. Die „Deutsche rundumordnungsliebende Republik“ ist für den Undergroundautor wie geschaffen: „Die Schäbigkeit des Landes wurde mein For schungsthema, und ich fühlte mich in Ost berlin sofort wie zu Hause, obwohl ich dort lange Zeit überhaupt kein Zuhause hatte.“ Schon an der Grenze hat er seine Freude an den Männern in Naziuniform: „Passkontrr rolle … -olle, -olle! PersonaldokumenTE … -enTE, -enTE, bütte!“
Als „Deutsche Reichsbananenrepublik“ wird das bezeichnet, und dennoch kommt die DDR bei Faktor nicht nur schlecht weg: Ostdeutsche machen aus einfachen Lat ten neue Möbel; ein Lob ergeht an klo bige DDR-Fahrräder; der oppositionel len Dreifaltigkeit von Pfarrer, Kirche, Pogo fühlt sich der Erzähler ohnedies nahe, auch wenn den nachgeborenen Kindern des Wes tens erst der Sinn von „Underground“ er klärt werden muss: Es hatte eben nichts mit „radikaler Abgrenzung, konsequenter Kommerzferne oder einfach der Kampfan sage an den Mainstream zu tun“, sondern bedeutete vielmehr, mit einem Fuß im Ge fängnis zu stehen.
In Jan Faktors „Tro el“ ist für alles Platz: vom Gruppensex im Sozialismus („die vier te Matratzeninternationale“) über illegale Wohnungsdurchbrüche bis zur Hässlich keit des Alexanderplatzes. Und auf beina he mysteriöse Weise fügen sich all diese Ab schweifungen zu einem Roman. Der Grund dafür ist nicht der Zwischenruf des Erzäh lers in eigener Sache, nur ja keinen „Wen deroman“ zu schreiben, sondern vielmehr die tragische Geschichte des Sohnes, der als junger Mann Selbstmord beging. Die das ganze Buch in immer neuen Anläu fen durchziehenden Versuchen, darüber zu schreiben, sind das Auge im Sturm einer Erzählung von absoluter Phrenesie.

 ERICH KLEIN
ERICH KLEIN






Medizinprodukt: Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Mit
erzählt
Faktor „Tro el“ als einen sozialistischen Schelmenroman vor tragischem HintergrundJan Faktor: Tro el. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 399 S.,
Nicolas Mathieu bleibt mit „Connemara“ auf dem Terrain seines fulminanten Gesellscha sromans „Wie später ihre Kinder“
Nein, mit Irland hat der jüngste Ro man von Nicolas Mathieu so gut wie gar nichts zu tun. Der Titel spielt auf Mi chel Sardous „Les Lacs du Connemara“ an. Das bombastische Chanson von 1981 – auf Youtube (inklusive Cover-Versionen): knapp 130 Millionen Klicks – ist eines jener Mu sikstücke, das einen für Minuten zum Teil eines von Weltumarmungsgefühlen eupho risierten Kollektivs werden lassen oder noch tiefer in die kalte Hölle einsamer Depres sion stürzen kann: „[E]r hatte den Kleinen schon bei seiner Mutter abgeladen, da skan dierte die Stimme, autour des lacs, c’est pour les vivants, und allein am Lenkrad wusste er weder, wo er essen sollte, noch mit wem, so weit war es gekommen, die Haare spär lich, das Hemd spannte am Bauch […]. Das Gefühl von Verschwendung, Verdrossenheit, unmöglicher Wiedergutmachung.“
Die Rede ist von Christophe Marchal: um die 40, Beziehungswrack, teilzeiterzie hender Vater und ehemaliger Eishockey crack in der Mannscha von Épinal, dem Geburtsort des Autors. Nach gescheiterten Versuchen als Hotelier und Betreiber eines Café-Restaurants arbeitet er mittlerweile als Vertreter für Hundefutter und ist nach der Trennung von seiner Frau bei seinem ver witweten Vater eingezogen. Aus dem fik tiven Kaff Cournécourt in der Nähe des realen Épinal ist er sein Leben lang nicht rausgekommen.
Mathieu, Jahrgang 1978, grei in „Conne mara“ die Themen, Konstellationen und Motive wieder auf, die man bereits aus sei nem vor vier Jahren erschienenen und völ lig zurecht mit dem Prix Goncourt ausge zeichneten Roman „Wie später ihre Kinder“ kennt. Das Lothringen der fiktiven Stahl stadt Heillange, in der dieser spielt, wur de 2016 mit Elsass und Champagne-Arden ne zur Region Grand-Est fusioniert – ein Vorgang, der nun in „Connemara“ zur Spra che kommt: „Eine Region zu erfinden, dazu brauchte man schon eine gewisse Dreistig keit und eine Menge Unwissenheit darüber, was im Leben der Menschen los war, […] die über ihrem Teller vor sich hin grummel ten, sich ungehört, unverstanden, nicht res pektiert und vom Monatsende, der Migra tion und den Bossen bedroht fühlten und sich seit gut fünfzig Jahren in ihrem pat riotischen Stolz und in ihrem Fortschritts glauben gekränkt sahen.“

Kränkung, Ehrgeiz, Wut und Scham liefern wie schon im Vorgängerroman den Brenn stoff, der die Protagonisten antreibt. An der Schnitt- und Bruchlinie all dieser Affekte und Ambitionen hat der Autor diesmal Hé lène platziert. Als Tochter einer Sekretärin und eines ehemaligen Fabrikarbeiters hat es die begabte und ambitionierte Schülerin zu einem gut dotierten Posten in einer Consul ting Firma, zu einem noch besser gestellten
»Nicolas Mathieu ist ein Schri steller, der sehr vieles, ja fast alles kann: Sex, Land scha , Dialoge, Innenschau und Totale
Mann, zwei Töchtern und einem luxuriö sen Haus in der Nähe von Nancy gebracht. Nichtsdestotrotz erlebt sie ihr Dasein als „ein ständiges Zuviel und Zuwenig“.
Hélène ist die klassische Aufsteigerin, die es geschafft und dabei Klassenverrat began gen hat. Darin erinnert sie an die Autofic tion eines Didier Eribon („Rückkehr nach Reims“) oder der frischgebackenen Litera turnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Aber obwohl sie noch keine 40 ist, verspürt sie bereits den Druck der nachfolgenden Ge neration im Rücken. Verkörpert wird diese von ihrer ebenso jungen wie abgebrühten Arbeitskollegin Lison, von der sie sich über „die neuen Regeln des Fickens und Fühlens“ au lären lässt und die später eine Sexint rige gegen ihre Vorgesetzten einfädelt, die auch Hélène zum Verhängnis werden wird.
Es herrscht ein beständiger Kleinkrieg zwischen den Klassen, Generationen und Geschlechtern, und die Ausweitung der Kampfzone droht alle Augenblicke zu eska lieren. „Und wählt richtig!“ lautet das Man tra jener, die in der bevorstehenden Stich wahl von 2017 auf der Seite von Marine Le Pen stehen.
Wie seinem Landsmann Michel Houel lebecq geht es auch Nicolas Mathieu dar um, nicht bloß ein Milieu darzustellen, son dern mit soziologisch informiertem Blick das große Ganze, die Gesellscha im Auge zu behalten, so fragmentiert diese auch sein mag. Alle sind letztendlich Gefangene ihrer Familien und Milieus, aber zugleich verfügt der Autor über hinreichend Empa thie, um seinen Protagonisten auch Ver schnaufpausen, kleine Triumphe und Eks tasen zuzugestehen.
Alle zwei Wochen führt die Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb Gespräche mit Autorinnen und Autoren über das Lesen, das Schreiben und das Leben an sich.
Alle Folgen auf falter.at/buchpodcast und überall dort, wo Sie Podcasts hören.
Die A ff äre etwa, die Hélène mit ihrem Jugend schwarm Christophe – der seinerzeit frei lich ihre beste Freundin gevögelt hat – an fängt, ist zwar von allerlei Asymmetrien gekennzeichnet, aber der episch und en de tail beschriebene Sex ist toll, sorgt für gu ten Schlaf, Muskelkater und Blasenentzün dung. Und bei aller Scheu, sich mit einem jener „Allerweltsdeppen, die auf Fußball, große Karren und Ärsche standen“, ernst ha einzulassen, finden die beiden für Mo mente dann doch zu einem „Wir“, das über die keuchende und schwitzende Zusam menkun in Hotelzimmern hinausgeht.
Nicolas Mathieu ist ein Schri steller, der sehr vieles, ja fast alles kann: Sex, Land scha , Dialoge, Innenschau und Totale. Wenn er eine Schwäche hat, dann ist es die, durch mitunter etwas ausufernde und mei nungsstarke Erzählkommentare noch ein mal zu erklären, was Sache ist, anstatt es anhand seines Personals vorzuführen bezie hungsweise darauf zu vertrauen, dass es die Leserinnen und Leser auch selber zu ent schlüsseln vermögen.
Als Sequel von „Wie später ihre Kinder“ überzeugt „Connemara“ nur teilweise. Das Drama von Pubertät und Erwachsenenda sein wird nun nicht nur an Eltern und de ren Kindern, sondern – mithilfe zahlreicher Rückblenden – an den beiden Protagonisten selbst vorgeführt. Statt Fußball-WM gibt es diesmal Eishockey der Regionalliga, statt „Smells Like Teen Spirit“ eben „Les Lacs du Connemara“. Mehr vom selben, bloß nicht mehr neu – und nicht ganz so gut.
KLAUS NÜCHTERNMit „Steinway“ hat die selbst Betroff ene Rongfen Wang eine beklemmende Abrechnung mit Maos „Kulturrevolution“ vorgelegt
Derart böse waren doch nicht mal die Nazis, oder?“, fragt Shi Sun. „Du kannst das eine nicht mit dem anderen vergleichen, aber es gibt immer noch böse re“, antwortet ihm seine Großmutter. „Die Nazis haben sechs Millionen Juden ermor det. In der Kulturrevolution wurden fünf mal so viele Chinesen zu Tode gebracht. Schon wenn ich an die Gaskammern nur denke, wird mir schlecht.“
Auf knapp 500 Seiten beschreibt Rong fen Wang in ihrem autobiografischen Ro man „Steinway“ die Gräuel der Roten Gar den. Sie erzählt die Geschichte aus der Sicht von Shi Sun, einem Jungen, der gemeinsam mit seiner Schwester Shi Zhu auf einem alten Steinway Klavier spielen lernt. Das prachtvolle, mit Perlmutteinlagen verzier te Instrument hat Tasten aus Sandelholz und Elfenbein und ist eine Reminiszenz an die „herzzerreißende Schönheit“ vergange ner Zeiten. Hier entspinnt sich die Erzäh lung der Klavierlehrerin Cheng Pinzhi, die als Alter Ego der Autorin nach der Kultur revolution als Orchestermusikerin arbeitet und selbst von Mao umgarnt wird – bis der Mann ihrer Schwester sie anschwärzt, was zu Chengs Verha ung führt.
Mit rasender und zugleich poetischer Sprache schildert Wang die unmenschliche Brutalität des Mao-Regimes. Grausame De tails spart die Autorin, die selbst 13 Jah re in chinesischen Gefängnissen verbracht hat, nicht aus: „Das Gemisch von Blutge ruch, verschwitztem Körper- und Uringe stank biss in die Nase, schmerzte die Au gen wie Pfefferspray.“
Die Protagonistin teil sich in den sieben Jah ren ihrer Ha die Zelle unter anderen mit einer Apothekerin, einer Vizeabteilungs leiterin der Pekinger Stadtverwaltung und einer Mitarbeiterin des Museums der Chi nesischen Revolution. Sie trifft auf eine Frau, die als Einzige ihrer Familie das Massaker von Daxing überlebt hat, dessen Tote man in einem Schil eich entsorgt hat te: „Kleine Kinder, die noch lebten, waren wieder herausgekrochen; mordgierige arme und untere Mittelbauern hatten ihnen mit Eisenschaufeln die Schädel zertrümmert.“
Wang Rongfen, die mit 16 Jahren in den kommunistischen Jugendverband aufgenom men wird, erlebt die Kulturrevolution aus nächster Nähe. Sie beobachtet, wie Jugend liche grölend auf den Friedhof im Univer sitätsviertel die Knochen des berühmten Malers Qi Baishi ausgraben – und lässt die Schändung im Roman noch einmal Revue passieren lässt. „So plötzlich war die Kul turrevolution hereingebrochen, die Men schen hatten sich ihr noch nicht anpassen können, mochten sich noch nicht an Le benden vergreifen und übten sich erst ein mal an den Toten.“
In den 1950er-Jahren verursacht Mao mit seinem „Großer Sprung nach vorn“ eine Hungersnot, die 55 Millionen Chi nesen das Leben kostet. Weil er sich da nach in seinen eigenen Reihen nicht mehr sicher fühlt, ru er 1966 die „Kulturrevo lution“ aus. Unter dem Vorwand, „Reak tionäre“ zu bekämpfen, beginnt eine gigan tische Säuberungsaktion, an deren Spitze die Roten Garden stehen: Schüler- und Stu dentengruppen sollen „alles ‚Vierfach Alte‘
– Ideen, Kultur, Sitten, Angewohnheiten –vernichten, plündern und dabei ‚Revolution ist kein Gastmahl‘ grölen und Menschen totprügeln“, schreibt Wang. Ihr Roman ist ein ebenso packendes wie beklemmendes Stück Zeitgeschichte von Maos Macht kampf über die Kulturrevolution bis zum Tian’anmen-Massaker 1989.
Im Gefängnis lernt Cheng auch Liu Yalan kennen, die längst in Pension ist, als man ihr Spionage vorwir . Ihre Wohnung wird durchsucht, die Katze von den „Rotgardis ten totgeschmissen“ und die vier 16 Zenti meter langen Goldfische „mit bloßen Hän den zerquetscht“. Als sie vom Tod ihres Mannes erfährt, nimmt sie ein Küchen messer, sticht sich in den Kopf – und über lebt. Ihren Zellengenossinnen gegenüber meint sie lakonisch: „Ich bereue, dass ich mit dem Messer nicht he ig genug zuge stochen habe, nicht krä ig genug, damit es was gebracht hätte.“ Eine andere Mitinsas sin befindet sich mit hinter dem Rücken ge fesselten Händen wochenlang in Einzelha
Rongfen Wang: Steinway. Roman. Aus dem Chinesi schen von Lao Men. Ma hes & Seitz, 492 S., € 29,50

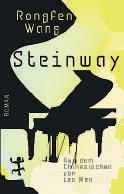
und liegt in ihren Exkrementen, ihrem Urin und Menstruationsblut. Als sie schließlich das Essen verweigert, wird sie mit Mais mehlsuppe durch die Nase zwangsernährt und geht dabei elendig zugrunde. Ein Wär ter brüllt die völlig entkrä ete Frauen beim Abortgang an: „Los, los, was trödelt ihr Fot zen […], wartet ihr auf den Fick?“ Chinesi sche Menschenleben seien eben billig, lautet das bittere Resümee der Autorin.
Cheng Pinzhi hat überlebt, wird schließlich aus der Ha entlassen und rehabilitiert. Auch Wang Rongfen kommt 1979 frei und wird gleichfalls rehabilitiert und darf an die Hochschule zurückkehren. Als im Juni 1989 Panzer über den Platz des Himmli schen Frieden rollen und die studentische Demokratiebewegung niederschießen, flieht sie nach Deutschland, wo sie noch heute lebt. „Des erhabenen Führers Erziehungs reform in drei Sätzen zusammengefasst! Scheiß der Hund auf Mao stinkt-stank, ver saut das Land, versaut das Volk!“
MIRIAM DAMEVKinderbücher: Verstecken, Schatzsuchen, Räuber und Ri er: Diese Themen sind in Kinderherzen unverwüstlich. Aber auch die Beziehung zu Großeltern stellt einen Eckpfeiler in einem Kinderleben dar – sowie die Frage: Wer gehört dazu und wie löst man Konflikte?
REZENSIONEN: KIRSTIN BREITENFELLNERGroßväter sind Vorbilder. Und Kinder lieben ihre Großväter. Deswegen ver mag es kaum zu verwundern, dass die klei ne Kati sich vornimmt, selbst ein Groß vater zu werden.
Das geht vorbei, denken die Erwachse nen. Aber Kati lässt sich davon nicht be eindrucken. „Wenn ich Großvater werde, können Großvater und ich beste Freunde sein und Großvaterdinge machen“, meint sie. Zum Beispiel Akkordeon spielen, Zit ronenbonbons verteilen und es nie eilig ha ben. Großväter haben große Hände, Kati sucht sich Fäustlinge. Das mit den weißen Haaren erweist sich allerdings schon als komplizierter.
Das junge Duo, das diese erfrischende Geschichte in die Welt gesetzt hat, stammt aus Lettland. Signe Viska mag Wortspiele und hat laut Verlagshomepage selbst immer ein paar Zitronenbonbons in der Tasche.
Elina Braslinas wilde Buntsti striche il lustrieren die unbändige, anarchische Fan tasie der kleinen Kati. Kinderwünsche ge hören ernst genommen und nicht verlacht, lautet die dahinterstehende pädagogische Botscha . Denn Pädagogik bedeutet auch, sich nicht andauernd unnötig einzumischen.
Vor Räubern fürchtet sich jeder. Sie kommen in der Nacht und klauen al les, was nicht niet- und nagelfest ist. In dieser nachtblau illustrierten Geschichte braucht es dazu nur ein Wort: Pssst! Den Rest erzählen die Bilder. Wie der Räuber sich anschleicht, die Vase in seinen Sack steckt, die Treppen hinaufschleicht und selbst vor dem Teddybären keinen Halt macht. Aber halt! Da ist jemand aufge wacht. Gegen Räuber helfen Hunde. Sie lassen sich nicht mit Würsten bestechen, sondern jagen die Räuber davon, um sich dann selbst eine Wurst zu gönnen. Pssst!
Die Bedeutung von Wörtern, lernt man dabei, hängt auch davon ab, warum und wie man sie benutzt. Tini Malitius sei durch einen Zufall zum Illustrieren gekommen, liest man ganz vorne in diesem Debüt. Was für ein Glück!

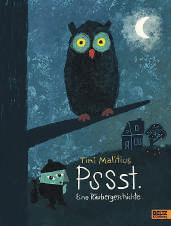
Romana Romanyschyn und Andrij Les siw studierten an der Akademie der Künste in Lwiw und konzipierten unter ihrem Label Agra a preisgekrönte Kin der- und Erwachsenenbücher. Auf Deutsch erschienen die Kindersachbücher „Hören“ und „Sehen“ (2021, Gerstenberg). Das uk rainische Volksmärchen, das sie nun vor stellen, handelt von einem Rübchen, das so groß wird, dass der Großvater es nicht al leine ernten kann. Nicht nur die Großmut ter, sondern alle menschlichen und tieri schen Hausbewohner müssen bei der Ernte helfen. 45 Millionen Menschen, lernt man aus dem Nachwort der Übersetzerin Kati Brunner, sprechen Ukrainisch. Mit diesem mit liebevollen Collagen ausgestatteten Märchen gelingt eine erste Annäherung an Sprache und Kultur des kriegsgebeutelten Landes.

Anne Hunter: Wo steckt mein kleiner Fuchs. Aladin, 40 S., € 16,– (ab 2)



Zu den Themen, die Kindern nie langweilig werden, gehört das Verstecken. Das geht schon in dem Alter los, wo Kinder nicht begreifen, dass sie gesehen werden, obwohl sie nichts sehen. Ob die in zarten Federstrichen auserzählte Geschichte, deren Farbigkeit sich auf Hellblau und Fuchsrot beschränkt, tatsächlich schon für Zweijährige verständlich ist, sei dahingestellt. Versuchen kann man es auf jeden Fall. Die Geschichte ist simpel: Vater Fuchs sucht das Füchslein überall: im Bau, auf dem Baum, im hohlen Baumstamm, hinter dem Hügel, im Wasser, hinter den Bäumen – aber er kann es nicht finden. Wie auch, wenn es sich immer hinter ihm au ält. Auch Erwachsene vermögen nicht immer zwischen dem, was sie sehen, und dem, was sie wissen, zu unterscheiden!
Tom Gauld: Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Moritz, 40 S., € 19,– (ab 4)

Von der New York Times ausgezeichnete Bücher haben es hierzulande nicht schwer, Aufmerksamkeit zu erregen. In diesem Fall sind es vor allem die Illustrationen, die auffallen. Seine Protagonisten sind ein kleiner Holzroboter und eine Baumstumpfprinzessin, die von einer Erfinderin und einer Hexe ins Leben gerufenen Adoptivkinder des Königspaars, die süß, aber nicht perfekt sind.
Im Bauch des Holzroboters wohnt eine Käferfamilie. Und die Baumstumpfprinzessin ist nur tagsüber ein Mädchen. Nachts verwandelt sie sich in ihren Ursprung zurück. Hier nimmt die ebenso gewitzte wie unterhaltsame Geschichte einer Patchwork-Geschwisterliebe ihren Ausgang und hält dabei allerlei Abenteuer parat.
Eduard Altarriba erklärt den Krieg mit Worten und Bildern
Erklärungsbedarf in Sachen mangelnden Friedens gibt es derzeit genug. Eduard Altarriba stellt die Themen, um kriegerische Auseinandersetzungen besser begreifen zu lernen, anschaulich dar: mit einfachen und ansprechenden in den Farben Rot, Grau und Schwarz gehaltenen Illustrationen und dazu passenden kurzen Texten. Sie bieten ein Rüstzeug, um über die Entstehung sowie die Lösung von Konflikten nachzudenken.
Wer ist in einen Krieg involviert? Welche Akteure gibt es in der Weltpolitik? Welche Rolle spielen Waffen und Geld dabei? Was unterscheidet Kriege von Revolutionen oder Terror? Und welche Folgen haben Kriege für die Zivilbevölkerung? Am Schluss erläutert Altarriba die Kriege in Syrien und der Ukraine. Ein Buch der Stunde aus traurigem Anlass.
Katerina Gorelik: Mister Maulwurf sucht einen Schatz. Thienemann, 40 S., € 16,– (ab 4)





Von der russischen Bilderbuchkünstlerin Katerina Gorelik erscheinen diesen Herbst gleich zwei Bilderbücher auf Deutsch. „Schau durchs Fenster“ im Insel Verlag befriedigt die Neugier darauf, was andere tun. Man weiß nur, was man sieht! Mit „Mister Maulwurf“ begeben wir uns auf eine Schatzsuche. Obwohl der keine Ahnung hat, wie so ein Schatz aussieht, beschließt er, einen zu suchen. Krone, Zepter und Siegelring, die ihm das Schlossgespenst zeigt, kann er nicht als solchen erkennen, auch nicht die Dukaten, die eine Piratenbande in einer Grotte versteckt hat. Nach einer langen Suche glaubt er, ihn gefunden zu haben: in einer Vorratskammer voller Essen. Seine Freunde wissen: Der Schatz, das ist der Maulwurf selbst! Fazit: Man sieht nur, was man weiß!
Dieter Wiesmüller: Wenn Ri er träumen. atlantis, 32 S., € 19,– (ab 4)
D er Illustrator Dieter Wiesmüller hat zahlreiche Titelbilder für die Magazine Spiegel und Stern gemacht, aber er schreibt auch: für Kinder. Sein fün es Kinderbuch packt das Thema Konflikte mit so magisch-schönen wie ironisch angehauchten Bildern in eine traumhafte Geschichte, bei der man – wie es bei Kindern ja o vorkommt – nicht immer zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Die Buben der Nachbarscha verschanzen sich in ihrer Burg. Die „anderen“ dürfen nicht mitspielen. Sie versuchen alle Tricks, verwandeln sich mittels eines Zaubertranks in Prinzessinnen und in Drachen. Eine Chance bekommen die „anderen“ erst, als den Buben in ihrer Burg langweilig wird. Am Ende steht die Versöhnung. Zusammen macht es mehr Spaß!

Mauern habe auch gute Eigenschaften: Sie können jemanden beschützen. Meistens werden sie aber gebaut, um jemanden auszusperren. Bogus Janiszewski hat bereits Kindersachbücher über das Klima oder Viren vorgelegt. Sein flapsiger Stil macht auch dieses schwere Thema gut konsumierbar.
Auf je einer Doppelseite wird eine berühmte Mauer abgehandelt – von der biblischen Mauer von Jericho über die chinesische und die Berliner Mauer bis zu Donald Trumps Grenzwall zu Mexiko. Wie kann man Mauern überwinden? Auch das wird hier auf je einer Doppelseite besprochen. Etwa durch Belagerung, Erfindungen, List, Verrat oder Verhandlungen. Von Max Skorwider fetzig bebildert, bietet der Band Stoff für Diskussionen über Grenzen, Konflikte und deren Überwindung.

Berühmte Mauern und wie man sie überwinden kannEduard Altarriba: Was ist Krieg? Beltz & Gelberg, 48 S., € 16,– (ab 8) Bogus Janiszewski, Max Skorwider (Illustrationen): Mauern. Beltz & Gelberg, 62 S., € 17,– (ab 10)
Kinderbücher: Die Reihe über Ra, den Katzendetektiv, ist nach allen Regeln der Krimikunst gestrickt. Den Kinderroman von der Oma, die dement wird, lesen wir aus Sicht ihrer Enkelin. Und Paul Maar schenkt uns ein Weihnachtsbuch mit Baby-Sams
REZENSIONEN: GERLINDE PÖLSLERAn einem Teich dösend, genießt er es, des Pharaos Kater zu sein. Tief verbeugt servieren die Diener ihm die feinsten Gerichte an die Zehen. Huld voll nickt er und wartet, dass man sich entferne und er sich „den Opferga ben“ widmen kann. „Es ist nämlich schwierig, wie ein Gott auszusehen, wenn man gerade geschmorte Anti lope hinunterschlingt.“
nicht hilfst, weißt du, was ich dann tu? Ich steck dir Dung ins Essen.“
Amy Greenfield: Ein Fall für Katzen detektiv Ra. Das verschwundene Amule . 256 S., € 13,40 (ab 8)


W enn wir Ra dem Mächtigen, Herr der Kra vollen Pfo te, zum ersten Mal begegnen, deu tet nichts darauf hin, dass wir es mit einem kün igen Meisterdetektiv zu tun haben, der nächtelang in gefährli cher Mission durch Gräber und Paläs te schleicht. Aber wirklich gar nichts. Kein Schnurrhaar.
Auch die erste Begegnung mit der Kü chenkatze Miu läu schlecht. „He, du da“, ru sie ihm zu. Was für eine re spektlose Anrede, ist das zu fassen?
Das Dienstmädchen Tedimut, keucht Miu, ein Kind noch, werde zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt. Dafür kann es die Nase abgeschnitten krie gen, wenn nicht gar die Todesstrafe ausfassen. Sie brauche Ras Hilfe. Der will sich rausreden, da sagt Miu: „Es ist also wahr, was alle sagen – dass du ein verwöhnter Hohlkopf bist.“ Den letzten Schubser gibt Khepri, der Ska rabäus, auch Mistkäfer genannt, der von Ras Rücken aus alles mitgehört hat. „Ra“, sagt der Käfer, „wenn du ihr
Rooobert! Herrscha szeiten, hörst du nicht?!“ Die Oma, die wegen ihres ver letzten Fußes vorübergehend bei ihrem Sohn und dessen Familie eingezogen ist, ist mit ihren Krücken über die Gemüsekiste gestol pert. Was passiert sei? „Nichts. Ich wollte nur wissen, wie man auf Tomaten sitzt“, sagt sie und tappt weg, an der Wand eine Spur roter Handabdrücke hinterlassend. Großteils ist die Oma immer noch die Alte, auch wenn sie jetzt ö er diese Aussetzer hat. Dann versteht sie nicht recht, was um sie herum vorgeht. Kurz darauf sagt sie wieder lustige Sachen wie frü her, und Papa Robert, Mama, Klara und An ton lachen mit ihr. Doch die Demenz schreitet fort, beinah wird Oma überfahren und fackelt die Küche ab. Friedbert Stohner erzählt das al les witzig, traurig – und richtig, richtig schön.
So geht das los mit dem detektivi schen Dreiergespann. Im ersten Band der Reihe lässt Amy B. Greenfield, die in den USA und Großbritannien Geschichte studiert hat, das Trio das „Auge des Horus“ aufspüren, ein wert volles Amulett. Im zweiten schickt sie die drei zu den Mumien, auf dass sie Grabräuber jagen. Der erste Band der Serie erschien im Sommer 2021, der dritte, „Die Suche nach Pharaos Sohn“, wird ab 16. November in den Buchlä den stehen.
Erschaffen hat Greenfield die Kin derkrimis nach allen Regeln der Kunst. Ständig legt sie neue Fährten. Heckt vielleicht die Hofdame Neferubiti et was aus, die mit ihren kajalumran deten Augen aussieht wie ein Rabe? Hat Tigerlady Aat, Gefährtin der Gro ßen Gemahlin, ihre Krallen im Spiel? Oder – Ra wagt kaum, das zu den ken – steckt die Große Gemahlin gar selbst dahinter? Jedes Kapitel endet mit einem Cli anger und verleitet so zum stetigen Weiterblättern. All das
hat Greenfield 2019 die Nominierung zum Edgar Award eingebracht, dem bedeutendsten Preis für kriminallitera rische Werke in den USA. Dazu geizt sie nicht mit liebevoller Ironie und je der Menge Lokalkolorit aus dem alten Ägypten. Die Zeichnungen der mehr fach ausgezeichneten deutschen Illus tratorin Felicitas Horstschäfer werten die Geschichten mit ihrem Witz zu sätzlich auf.

Auch im dri en Band wird es wieder spannend: Als Dedi, der Sohn des Pharaos, vermisst wird, ist selbst für Ra an Essen nicht mehr zu denken, sollte er doch auf des Pharaos Kinder aufpassen. Was ist mit Dedi gesche hen, wurde er gekidnappt? Haben die Krokodile ihn gefressen?
Eines muss Ra rasch zugeben: Auch wenn er gern allein der Große Detektiv wäre, sind Khepri und Miu, die Küchenkatze, alles andere als bloß Assistierende. Vor allem der Mistkä fer wird unterschätzt, unscheinbar, wie er ist, und leise, wie er redet. Wie das halt o so zugeht!
Das Sams hat seinen ersten Heiligen Abend mit Papa Taschenbier, Christbaum mit Würstchenketten und Weihnachtsliedern samt Saxofonbegleitung verbracht. Selbst Frau Rotkohl geht wegen des Mini-Sams das Herz auf, und das heißt was.
Doch am Weihnachtsmorgen fehlt das Mi ni-Sams. Der Zauberspruch, mit dem man aus der Sams- wieder in die Menschenwelt gelan gen kann, ist kompliziert und das Mini-Sams noch klein. Und so landet es erst im Kau aus von Herrn Rudolf Rudolf, auf dem Rodelberg der kleinen Stadt und beim Festessen der Fa milie Schemmel. Pünktlich zum 85. Geburts tag bringt der deutsche Doyen für schrägen Humor, Paul Maar, die el e Geschichte mit seinen Samsen heraus. Natürlich wird wieder gereimt, was das Zeug hält.
 AUF SCHIENE Othmar Pruckner
AUF SCHIENE Othmar Pruckner

Informationen: www.tdj.at
 steinkellner.com;
Foto: Rita Newman
steinkellner.com;
Foto: Rita Newman
Kinderbuch: Eine magische Liebesgeschichte, die sich in einen Krimi und dann in Science-Fiction verwandelt
Ponger sitzt in der U-Bahn und verliebt sich in ein Mädchen. Sie liest dasselbe Buch wie er, einen Best seller. Kann das Zufall sein? Mit die sem unwahrscheinlichen Setting er ö

net Nils Mohl einen Jugendroman, der einen bis zur letzten Seite in Atem hält. Dann würde man ihn gerne noch mal von vorne lesen, denn vieles des Erzählten erscheint nun in einem an deren Licht.
Verliebtheit kann man nicht erklä ren. Es ist einfach da. „Die Stimme. Als würde sie eine unsichtbare Ver bindung zu ihm, der sie beobachtet, herstellen. Wie dieses Lächeln. Er hat keine Erklärung dafür. Und sieht das nur er? Um sie herum erscheint der Raum silbern von ihrer Anwesenheit. Beruhigend und beunruhigend, bei des gleichzeitig. Sie, nah und fremd: Das ist Henny.“
Verliebtheit bleibt. Auch wenn man es nicht zugeben will. Auch wenn man sich dagegen wehrt, so wie Henny. „Ganz grundsätzlich wäre es natür lich am schlausten, Partnerwahl und Gefühle rigoros voneinander zu tren nen. Wer verknallt ist, ist doch selten ganz zurechnungsfähig“, findet sie. Der Bestseller, den sie gerade liest, gefällt ihr, weil sich die beiden Prot agonisten am Ende nicht bekommen. „Kitschfreier Schluss. Ist gut.“ „Wenn ich verliebt ins Verliebtsein bin, dann bist du aber mal mindestens genau so verliebt in die Idee, dass das etwas Schlimmes ist“, hält Ponger Henny später entgegen. Kurz darauf bereut er es schon wieder, sich von einer Frem den um den Finger wickeln gelassen zu haben und nun lauter unvernünf tige Dinge zu tun.
Henny – so nennt Ponger alle sei ne Angebeteten, die echten und die erfundenen – haut ab, nachdem sie die Notbremse gezogen hat. Das Handy, das sie ihm zugesteckt hat, wir er weg. Trotzdem tauchen in der Kfz-Werkstatt, in der er arbei tet, bald Ermittler auf, die Henny su chen. Ist sie eine Illegale? Psychisch krank? Aus dem Knast abgehauen? Umweltaktivistin?
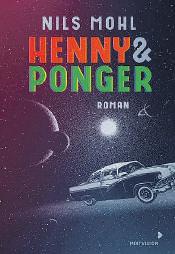
„Also ich hätte als Jugendlicher ja ums Verrecken kein Jugendbuch frei willig angefasst“, sagt einer der Er mittler zu Ponger, als er ihm das Buch zeigt, das ihn mit der Gesuchten ver bindet. „Ist das nicht alles so Prob lemzeug über Mobbing oder Mager sucht mit pickligen Helden? Na, egal, wem’s Spaß macht.“
Über Nils Mohls „Henny & Pon ger“ lässt sich definitiv sagen: So ein Jugendbuch ist das nicht. Es kreist nicht um Probleme, sondern um Rät sel. Mohl, der bereits neun teils preis gekrönte Kinder- und Jugendbücher vorgelegt hat, wurde in Hamburg ge boren, wo seine Geschichte auch
spielt. Er beherrscht die Kunst des leichtfüßigen, plastischen Erzählens mit raffinierten Anspielungen, geist reichen Dialogen und einem Drive, der von den 201 teilweise nur ein paar Zeilen, teilweise anderthalb Seiten langen Kürzestkapiteln erzeugt wird.
Was beginnt wie eine Lovestory, ver wandelt sich dabei zuerst in einen Krimi und schließlich in eine veri table Science-Fiction mit Aliens, de ren Flugobjekten und ihrer eigenen Art von Kommunikation. Über die se darf nicht zu viel verraten werden, um die Spannung nicht zu zerstören. Aber dass dieser Pageturner verfilmt werden wird, darauf darf man getrost wetten. Man sieht die zukün ige Ki noversion schon vor sich, so tauglich scheinen Setting und Schauplätze: die Kfz-Werkstatt von Susi, wo Ponger il legalerweise arbeitet, in der Flipper automaten stehen, an denen die Mäd chen vom Straßenstrich sich die Zeit vertreiben. Der Gedächtnisverlust, der Ponger nicht wissen lässt, wo er her kommt und wer er ist. Die winzige Wohnung, in der Ponger mit seiner Ziehmutter Pörl wohnt, oder der silb rige Buick-Oldtimer, mit dem Hen ny, Ponger und Pörl schließlich nach Amrum fahren, wo die Geschichte kulminiert.
Das größte, um nicht zu sagen ma gische Kunststück des Autors besteht aber darin, mit dieser wilden, so gar nicht pädagogischen Geschichte trotz dem die ganz realen Gefühle der Ado leszenz einzufangen: nicht von dieser Welt zu sein, sondern vielmehr ein Alien, das von fremden Gefühlen und undurchschaubaren Sitten bedrängt wird, eigentlich so sein möchte wie alle anderen, sich aber trotzdem als etwas ganz Besonderes fühlt. Und das Angst hat vor dem Verliebtsein, sprich vor einem Leben, das in Aufruhr gerät und härter wird, wenn man etwas zu verlieren hat, wie Pörl an einer Stel le sagt. Aber gleichzeitig auch inter essanter und schöner.
KIRSTIN BREITENFELLNERKinderbuch: Ein harter Roman nach einer wahren Ge schichte über einen Jungen, dessen Vater die Mu er ermordete
D ie Geschichte ging 2017 durch die Medien. „Mark“ – der Name ist vermutlich ein Pseudonym – hat te seine Mutter durch einen Angriff des Vaters mit dem Messer verloren, bei dem auch der Junge verletzt wur de. Mark und seine Schwester lande ten in betreuten Wohngemeinschaf ten, dort hielt es Mark aber nicht aus, lebte auf der Straße, bis er zwei Jahre später tot auf einem Baum entdeckt wurde.
Christian Duda hat Marks kur zem und hartem Leben mit dem Ro man „Baumschläfer“ ein Denkmal ge setzt. Er erzählt die Geschichte nicht nur nach, sondern lässt den anfangs 14-Jährigen als Kommentator au re ten. In fett gedruckter Schri notiert er dessen Gedanken. Dieser Metatext verleiht dem nicht sehr gesprächigen Buben eine authentische Stimme, die unter die Haut geht.
dort, Fabian, der die Szene später den Medien schildern wird, ist komplett überfordert. Marius bittet ihn um Hil fe für seine Mutter, wird selbst ins Krankenhaus eingeliefert und erfährt erst dort die ganze Wahrheit: „Sie ist ihren schweren Verletzungen erlegen.“
„Was für eine Scheißart, es zu sagen!“, kommentiert Marius’ Stimme, fett gedruckt. Der Junge kann sich nicht gut ausdrücken, besitzt aber ein feines Sensorium für Beschönigungen, Lü gen und Manipulationen. Und selbst eine ganz eigene Liebe zur Sprache. Wenn er überfordert ist, lenkt er sich gerne mit Wortverdrehungen ab und versteckt sich hinter Sarkasmus.
Ein Jahr nach dem Prozess bringt sich der Vater im Gefängnis um. In der Wohngemeinscha , in der Marius einen Freund gefunden hat, zieht er sich immer mehr zurück. Er hat ein Talent zum Comiczeichnen, aber die Betreuer kritisieren zu viel Blut in den Geschichten.
Marius beginnt die Schule zu schwänzen, wird beim Klauen er wischt. Er ist auch für die gestan densten und einfühlsamsten unter den Sozialarbeitern nicht mehr er reichbar. Der Erzähler hält zu seinem jungen Helden. „Ich beschließe, dass Marius nicht trinkt“, schreibt er an einer der wenigen Stellen, an denen er sich offen zu erkennen gibt. „Er, der seinem Vater das Trinken nicht ver zeihen kann, soll nicht trinken. Ich will das nicht.“
Die vier Kapitel des Romans, „An klage“, „Urteil“, „Vollzug“ und „Kom mentare“, sind in Unterpunkte auf gegliedert, die akademische Arbeiten nachahmen: 1.1, 1.2, 1.2.1 etc. Mit dieser Distanznahme teilt Duda den Schicksalsbrocken, mit dem Mark umzugehen hat, in wenn auch nicht verdaubare, so doch konsumierbare Häppchen.
Christian Duda wurde 1962 unter dem Namen Ahmet Ibrahim el Said Gad Elkarim in Graz geboren, er arbeite te an deutschen Theatern und lebt heute in Berlin. Seine Kinderbücher, die Außenseitertum, Alkoholismus, Analphabetismus, Armut oder Adi positas thematisieren, wurden mit zahlreichen Preisen bedacht. „Baum schläfer“ ist sein erster Jugendroman. Was heißt Jugendroman! Der Autor erschafft mit seinen einfachen, klaren, hammerharten Sätzen nichts weniger als ein Stück Literatur von großer Wucht und Klarheit, das sich nicht, wie in dem Genre gängig, an den Jar gon der Jugend anzubiedern versucht.
Der Roman beginnt mit dem 24. Januar 2014. Marius – so heißt „Mark“ hier –, selbst verletzt, stürzt in das Büro, das gegenüber der elter lichen Wohnung liegt. Der Praktikant
Duda macht klar, dass an die sem Fall nicht das System versagt hat. Umso trauriger wird diese heil lose Lebensgeschichte. Marius lebt unbewusst nach „Gefängnisregeln“: „Traue niemandem. Misstraue allen. Glaub kein Wort. Alle lügen.“ Er wird zu einem Sandler, mit Erfrierungen, Wunden, Entzündungen. Eine Zeit lang schlä er auf dem Vordach des Gesundheitsamtes und zuletzt auf einem Baum, wo seine Leiche erst Monate später entdeckt wird.
KIRSTIN BREITENFELLNER»„Was für eine Scheißart, es zu sagen“
„MARIUS“
BEI CHRISTIAN DUDA
Aufrüstung
Wer kennt BlackRock & Co. und ihre Eigentümer? Sie sind Mitei gentümer von 18.000 Unternehmen und Banken im USgeführten Westen. Obwohl ihre Lobbyisten bei der Weltbank, der US- und der Europäischen Zentralbank und bei der Europä ischen Kommission in Brüssel und bei fast allen wichtigen westlichen Länder- und LandesRegierungen ein- und ausgehen und ebenso bei den Redaktionen der westlichen Leitmedien – sie sind der breiten Ö ffentlichkeit so gut wie unbekannt.
Die österreichische Kranken schwester Maria Stromberger, eine erbitterte Gegnerin des NS-Staates, ließ sich 1942 freiwillig ins KZ Auschwitz versetzen, mit der Begründung: Ich will sehen, wie es wirklich ist, vielleicht kann ich auch etwas Gutes tun. Dort hat sie aktiv Widerstand geleistet, viele Hä linge gerettet, Kurier dienste erledigt, Waffen und Sprengstoff geschmuggelt.
Werner Rügemer | BlackRock & Co. enteignen! Auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht Klappenbroschur | 176 S. | 12 € ISBN 978-3-939816-82-9

Werner Rügemer zeigt das Macht- und Gewinn-Instrumen tarium von BlackRock & Co. und dessen Auswirkungen und erklärt, warum diese globalen Monopolisten enteignet werden müssen. www.nomen-verlag.de


Entführung im
Harald WalserHölle von Auschwitz
Diese wohl einzigartige Frau war zu Lebzeiten zwar in Polen hoch angesehen, wurde in Ös terreich aber kaum gewürdigt.
Dank vieler neuer Quellen legt der Autor mit dem Buch „Ein Engel in der Hölle von Ausch witz“ eine umfassende Biografie Maria Strombergers vor.


Ulrike Kotzinas neuer Erzählband als Einladung zur Melange, einer sorglosen Stunde, Auszeit, die zum Lesen und Träumen verführt
Die alleinerziehende Emma reist mit ihrer kleinen Tochter Lucy ins verschneite Prag, um dem Weihnachtsstress zu Hause zu entkommen. Doch statt Adventszauber erlebt sie dort ihren schlimmsten Alptraum: Auf dem Weih nachtsmarkt in der Altstadt wird Lucy entführt. Mitten im Schneetreiben beginnt die fieberha e Suche nach ihr –mit Unterstützung des Rezeptionisten Jo, für den Emma bald mehr als bloße Dankbarkeit empfindet.
Prag www.emons-verlag.de
Andrea Nagele erzählt mit viel Fingerspitzengefühl eine herz zerreißende Geschichte, in der ihre Protagonistin auch einem lange gehüteten Familienge heimnis auf die Spur kommt.
Die Geschichten handeln vom Suchen und Finden der Wahr heit, die sich gerne versteckt, vielleicht aber auch gar nicht entdeckt werden will.
„Sie hob ihre Hand, um die Locken zu glätten […], dann eilte sie weiter, seufzte ver gnügt: Warum nicht den Wind an ihrem Haar zausen lassen, wie einen Liebhaber, der darin wühlt, der zerstreut damit spielt?“
„Die Themen sind universell und persönlich zugleich. Ein Spagat, der nur den besten Erzählerinnen gelingt. Ulrike Kotzina ist eine dieser starken Stimmen, es lohnt sich, ihr zu lauschen.“ (Jürgen Weber, Literaturhaus Wien)
edition laurin bei innsbruck university press Bestellungen unter iup@uibk.ac.at | www.uibk.ac.at/iup August 2022 | 192 Seiten | € 21,– | ISBN: 978-3-903539-16-7
Zukun : Ausblicke in die Heißzeit samt Survival-Guide: Drei essenzielle Bücher, die es aktuell zu lesen gibt

S hu, Samiha, Carla und Ayotola: Sie alle wurden am selben Tag im August 2020 geboren. Samiha kam in einem Slum in Bangladesch zur Welt, Ayotola in einem Armenviertel im nigerianischen Lagos. Die Familien von Shu und Carla hingegen sind bessergestellt. Shu wächst in der chinesi schen Stadt Changsha auf, Carla im kali fornischen Los Angeles. Wie es ihnen erge hen wird, wie alt sie werden – all das wird maßgeblich davon abhängen, um wie viel Grad die globale Durchschnittstemperatur steigen wird. Die vier Mädchen sind fiktive Figuren; Wissenscha ler:innen haben aber anhand zweier Klimaszenarien typische Le benswege für sie nachgezeichnet. Nachzu lesen sind diese im Buch „Earth for All“, dem neuen Bericht an den Club of Rome, der vor 50 Jahren mit „Die Grenzen des Wachstums“ aufrüttelte.
Die Klimabücher dieses Herbstes machen klar: Ein Zurück zu einem gemäßigten Kli ma gibt es nicht mehr, extreme Wetterereig nisse werden weiter zunehmen. Jetzt geht es darum, ob die Menschheit dennoch ei nigermaßen gedeihlich weiterleben kann –oder ob die heutigen Kinder und Jugendli chen in einer Plus-drei-Grad-Welt werden leben müssen. „Eine Erde, wie wir sie nicht kennen wollen“, so Stefan Rahmstorf, einer der Leitautoren des vierten Sachstandsbe richts des Weltklimarates (IPCC). Und, da sind sich die Autorinnen und Autoren der Bücher „Earth for All“, „Sturmnomaden“ und „3 Grad mehr“ einig: Herumreißen las se sich das Ruder nur, wenn die Klu zwi schen Arm und Reich kleiner wird. Die drei Bücher gehören zum Wichtigsten, das ein Mensch derzeit lesen kann.
„3 Grad mehr“ lautet der Titel des Sam melbandes von 19 Autoren, darunter die Klimaforscher Stephan Rahmstorf und
Hans Joachim Schellnhuber sowie die So zialforscherin Jutta Allmendinger. Aber warum sollen wir uns überhaupt ein DreiGrad-Szenario ansehen, sehen doch die Pa riser Klimaziele eine Erwärmung von 1,5, höchstens zwei Grad vor? Weil wir laut jüngstem Weltklimabericht bereits auf dem besten Weg in Richtung drei Grad plus sind.
Was das bedeutet, müssten die Menschen wissen, findet Herausgeber Klaus Wie gandt. Viel zu lange habe die Politik die Krise verharmlost, und so glaubten viele immer noch, es gehe „bloß“ um Eisbären und ein paar versinkende Inselchen. „Wüss ten die Menschen, was den Enkelkindern bevorsteht, würde das keiner wollen“, sag te Wiegandt einmal: nämlich „eine Radi kalisierung des Wettergeschehens“. Wüss ten sie es, ist er sich sicher, würden sie eine völlig andere Politik einfordern.
Stakkatoartig zählt Stephan Rahmstorf auf, in welcher Welt seine Kinder, derzeit Gymnasiasten, da leben müssten – und mit ihnen rund vier Milliarden Menschen, die heute jünger als 20 Jahre alt sind. Drei Grad globale Erwärmung, das bedeutet für viele Landgebiete sechs Grad mehr, so auch für Deutschland und Österreich. „Damit wäre Berlin wärmer, als es Madrid heute ist.“ An den heißesten Tagen müssten die Deut schen dann um die 45 Grad ertragen. Rund um den Erdball würden sich „die während Hitzewellen tödlich heißen Gebiete mas siv ausweiten“. Extremwettereignisse näh men überproportional zu. Starkregen, Dür reperioden, Tropenstürme – sie alle kämen ö er, würden he iger und blieben länger.
Beim Meeresspiegel wäre schon ein Me ter Anstieg „eine Katastrophe“, schreibt Rahmstorf: Weil an den Küstenlinien mehr als 130 Millionenstädte liegen, dazu Hä fen, Flughäfen und 200 Kernkra werke.
Bei drei Grad plus stiegen die Meere laut IPCC-Bericht jedenfalls um 70 Zentimeter. Erreicht allerdings das Grönlandeis seinen Kipppunkt und schmilzt komplett ab, steigt der Meeresspiegel um sieben Meter. Auch weltweite Hungerkrisen befürchtet Rahms torf. „Ich persönlich“, schließt er seinen fu riosen Text, „halte eine 3-Grad-Welt für eine existenzielle Gefahr für die mensch liche Zivilisation“.
Was heißt eine solche Heißzeit nun für unsere vier Mädchen? In „Earth for All“ schaut sich der Club of Rome zwei Sze narien an. Das schlechtere, „Too little, too late“, erscheint gar nicht so pessimistisch. Da passiert bis 2050 durchaus einiges: Windräder und Fotovoltaikanlagen gehen in Betrieb, auch in Asien schließen die Koh lekra werke. Dennoch ist alles zu wenig und zu spät. Fossile Brennstoffe kommen immer noch zum Einsatz, die Menschen kleben an ihren Autos und essen viel zu viel rotes Fleisch. Insgesamt ist es mehr ein Durchlavieren. Kommt Ihnen bekannt vor?
Mithilfe aufwendiger Simulationsprogram me haben die Forscher errechnet, was das für die Temperaturen, die Weltbevölkerung, die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und vieles mehr bedeutet. Demnach überspringt die Erde mit „Too little, too late“ bereits 2050 die Zwei-Grad-Grenze.
In diesem Jahr sind unsere Mädchen 30 Jahre alt. Shu ist Wasserwirtscha singe nieurin, häufige Überschwemmungen be drohen Chinas Nahrungsmittelsicherheit. Carla zieht von Kalifornien in den Norden, hat jedoch das Gefühl, dass Brände und Hitze ihr folgen. In Bangladesch hat Sami ha ihren Job in einer Kleiderfabrik verloren, weil die Küstenregion wegen der Flutkatast rophen allmählich aufgegeben wird. Ayotola lebt mit vier Kindern im Armenviertel, nur
»Binnen Minuten steigt das Wasser gefährlich hoch und schwappt langsam in die Hütte
KIRA VINKE ÜBER EINEN STARKREGEN IM SLUM
ILLUSTRATION: GEORG FEIERFEIL
TEXT: GERLINDE PÖLSLER
der Sohn wird zur Schule gehen können.
Noch weiter in die Zukun geschaut, stirbt Carla mit 65 an Krebs. Samiha lei det im Slum unter Wasser- und Essens knappheit. Im nigerianischen Lagos muss ten Ayotola und ihr Mann ihre Unterkun wegen immer gefährlicherer Fluten aufge ben. Noch am besten geht es Shu, deren Kompetenzen im Hochwassermanagement sehr gefragt sind.
Wie realistisch solche Lebensläufe sind, hat Kira Vinke rund um den Erdball recher chiert. Die Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesell scha für Auswärtige Politik hat zahlreiche Länder besucht, sie erzählt von Hirten im Sahel, von Fischern auf den Philippinen –und von der Flut im deutschen Ahrtal 2021.

Längst haben Millionen ihre Heimat verlassen, weil Taifune oder Dürren ihnen die Existenz raubten. Viele bleiben dabei innerhalb ihrer Herkun sländer, so wie in Bangladesch: Im Korail-Slum in Dha ka trifft Vinke zwei junge Frauen, die aus dem Süden des Landes hierher kamen, weil ihre alte Heimat immer wieder überflutet wurde. Aber auch in ihren Hütten sind sie nicht sicher. „Binnen Minuten“, beschreibt Vinke einen Starkregen, „steigt das Wasser gefährlich hoch und schwappt langsam in die Hütte.“ So sei es hier eben, „es gibt kei ne richtige Kanalisation“, erklärt eine Frau. Vinke watet durch Dreck und Fäkalien. Die Menschen in den Slums werden nicht alt.
Und was jetzt?
„3 Grad mehr“ setzt vor allem auf „na turbasierte Lösungen“: Aufforstung, nach haltige Holznutzung, Wiedervernässung der Moore, regenerative Landwirtscha . Zum Wichtigsten aber gehöre der Schutz des Re genwaldes. Ein verbindliches Abkommen zum Stopp der Abholzung der Regenwäl
der innerhalb der nächsten Jahre könnte ein globales Au ruchssignal ein, schreibt Wie gandt: Es würde die CO2-Emissionen so drastisch reduzieren, „als würde Europa bis spätestens 2026 klimaneutral“.

Doch all das braucht Investitionen, und dafür fordern alle drei Bücher eine Umver teilung. Die müsse sowohl vom globalen Norden in den Süden stattfinden als auch innerhalb der einzelnen Länder. „3 Grad mehr“ geht davon aus, dass zumindest zwei Prozent des Weltsozialprodukts nötig sein werden, „Earth for All“ schätzt zwei bis vier Prozent. Nichts, was nicht zu stem men wäre, argumentieren sie.
Nun wird jenen, die den Kampf gegen die Klimakrise einfordern, ja gern vorgewor fen, sie wollten rein ideologisch motiviert auch gleich den sozialen Umsturz durch drücken. Allerdings nennen die Forscher nachvollziehbare Argumente: Ärmere Län der können sich sonst keinen Klima- oder Waldschutz leisten. Und auch in den bes sergestellten Ländern werden jene, die un verhältnismäßig unter den Kosten etwa der Energiewende leiden, protestieren und den Kurswechsel nicht mittragen. Ob in Euro pa oder den USA, in Afrika oder Südame rika: Eine zu große Vermögensklu führt überall zu Destabilisierung und Aufständen, das Vertrauen in die Regierungen sinkt, au toritäre Populisten gelangen an die Macht.
Um das Geld für die nötigen Investitio nen zu erhalten, schlagen Wiegandt & Co vor, sollen die Regierungen die Subventio nen in fossile Energieträger streichen, Mili tärbudgets reduzieren und Steuerschlupflö cher schließen. Für Deutschland schweben ihnen vor allem die Finanztransaktionsund Erbscha ssteuer als Hebel vor. Un gerecht? Zwei Zahlen aus dem Buch: In Deutschland war 2015 das reichste Zehn
Klaus Wiegandt (Hg.): 3 Grad mehr. oekom, 352 S., € 25,70tel der Bevölkerung für mehr Emissionen verantwortlich als die gesamte ärmere Hälf te. Und: Bei drei Grad mehr werden die ma teriellen Schäden jährlich mindestens zehn Prozent des Weltsozialprodukts ausmachen, eher viel mehr. Da geht es auch den Aller reichsten nicht mehr gut.
In „Earth for All“ lautet die Lösung: „Gi ant Leap“, ein Riesensprung. Den reichs ten zehn Prozent dürfe nicht mehr als 40 Prozent des jeweiligen Nationaleinkom mens zustehen. Industrien müssen da für das Nutzen von Gemeingütern zahlen, das Geld daraus fließt auch hier in Bürgerfonds und Grundeinkommen. Die Forscher sehen fünf Hauptstrategien: extreme Armut be kämpfen, Ungleichheit und Gender-Gaps verringern, die Herstellung von Nahrungs mitteln und Energie revolutionieren. Damit würden sich die Temperaturen um 2050 bei unter zwei Grad stabilisieren.
Alle drei Bücher sind dicht, kein Spazier gang – jeder sollte aber ihre wesentlichsten Inhalte kennen, besonders Entscheidungs träger. Reizvoll an „Earth for All“ sind die Biografien der Mädchen. Dieses Buch und „3 Grad mehr“ bieten sowohl einen Ge samtüberblick als auch Spezialwissen zum Bauen oder zur Energiewende. Die meis ten Menschen lernen wir bei Vinke kennen.
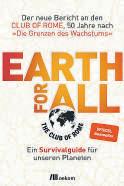
Und unsere Mädchen? Beim „Riesensprung“ können auch Samiha und Ayotola als Kin der in neue Wohnungen umziehen. Alle vier erhalten gute Ausbildungen, keine lebt in einem Armenviertel. Auch ein stabiles Kli ma kennt keine, extreme Wetterereignisse gehören zum Leben. Doch viel Leid wird mittlerweile gelindert, und die Gefahr eines eskalierenden Klimawandels ist nicht mehr so groß. Welches Szenario eintritt, das wird die Menschheit vor allem in der allernächs ten Zukun entscheiden: noch vor 2030. F

Biologie: In „Jagen, sammeln, sessha werden“ liest das britische Multitalent Charles Foster dem Neolithikum die Leviten
Wenn es ein Gedicht gibt, das Charles Foster auf den Leib geschrieben scheint, dann ist es wohl Walt Whitmans Hymnus „Song of Myself“ mit seiner groß spurigen (und von Bob Dylan zitierten) Ansage: „Do I contradict myself? / Very well then I contradict myself, / (I am large, I contain multitudes.)“
Auch Charles Foster, Jahrgang 1962 und von seiner Statur her das, was man hierzu lande „ein gstandenes Mannsbild“ zu nen nen pflegt, enthält Vielheiten: Er ist Tierarzt und Tierpräparator, Philosoph und Jurist, er lehrt Ethik und Rechtsmedizin in Oxford, ist ein brillanter Vertreter des blühenden Genres Nature Writing und darüber hin aus Vater von sechs Kindern. In „Der Ge schmack von Laub und Erde“ (2016) be richtet er von seinen Bemühungen, sein menschliches Selbst zu transzendieren und unter anderem wie ein Dachs, Fuchs oder Fischotter zu leben. In seinem soeben er schienenen Buch „Jagen, sammeln, sessha werden“ unternimmt er einen nicht ganz so spektakulären Selbstversuch und begibt sich wieder in die Wälder, Fluren und Höh len der englischen Countryside, um an die Existenzform anzuknüpfen, die der mensch lichen Gattung im Jungpaläolithikum, also der jüngeren Altsteinzeit, geläufig war. Salopp formuliert könnte man Fosters jüngstes und mit einer Bibliografie von rund 250 Werken der Anthropologie, Altertums kunde, Ethnologie, Hirnforschung, Linguis tik, Religionswissenscha en und sonstigen Wissenscha sdisziplinen versehenes Werk auf eine These herunterbrechen: So lange wir Menschen noch als Jäger und Sammler im Einklang mit der Natur lebten, war al les im grünen Bereich, wohingegen mit der „Neolithischen Revolution“ vor rund 10.000 Jahren alles den Bach runterging. Acker bau und Sessha igkeit sind für Charles Foster nichts weniger als eine Sackgasse, von SUVs und Smartphones einmal ganz zu schweigen.
Eine starke Ansage, die naturgemäß nicht unwidersprochen blieb. Aus der Scien tific Community wurde vor allem der Ein wand laut, dass es letztlich lächerlich sei, sich in unsere Vorfahren aus dem Jungpa läolithikum hineinversetzen zu wollen: Die Unterschiede zwischen ihnen und uns sei en schlicht unüberbrückbar.
Die aggressivsten Reaktionen aber, so erinnert sich Foster, der die deutsche Übersetzung seines Buches Mitte September in Wien (und nur dort) präsentierte und den der Falter zum Interview traf, kamen aber nicht aus dem akademischen Milieu, sondern von jenen Leserinnen und Lesern, die am liebs ten die Jugendfürsorge auf den Plan gerufen hätten; denn Foster wird – wie schon da vor – von seinem Sohn begleitet. Tom, 13 Jahre alt, versteht die Aufregung so wenig wie sein Vater: „Wir haben schon davor in Erdlöchern gelebt. Jetzt gehen wir in einen Wald, den wir bestens kennen, bauen uns dort einen Unterschlupf, töten das ein oder andere Getier und starren bis Weihnachten ins offene Feuer.“
Das ist, wie Foster senior auf Nachfra ge bestätigt, nicht nur legal, sondern sei ner Meinung nach auch ganz normal: „Das Gegenteil sollte verboten sein. Wir miss
brauchen unsere Kinder, indem wir es ih nen erlauben, den ganzen Tag lang auf das Display ihres Smartphones zu starren.“ In der familiären Alltagspragmatik sieht das dann – „very well then I contradict myself“ – ohnedies anders aus: Bis auf den jüngs ten, el ährigen Sohn verfügen alle Kinder über ein Smartphone, nur einen Fernseher gibt es im Hause Foster nicht – ein Min deststandard an Menschlichkeit sollte dann doch nicht unterschritten werden.
„Being Human“ lautet – in Analogie zum Vor gänger „Being a Beast“ – der Titel des Bu ches im englischen Original. In der Über setzung wurde die lakonisch-wuchtige Prägnanz durch den unkaputtbaren tro chäischen Groove à la „Götter, Gräber und Gelehrte“ ersetzt. Allerdings geht es in „Ja gen, sammeln, sessha werden“ tatsächlich um die Frage nach dem Wesen des Mensch seins, die man, so Foster im Interview, erst beantworten müsse, um Fragen der Reli gion, der Moral oder Politik sinnvollerweise überhaupt erst stellen zu können.
Seine Antwort in Kurzform: Das Wesen des Menschen gründet in seiner Existenz form als Jäger und Sammler; alles, was da nach kam, ist im Wesentlichen Entfrem dung und zivilisatorische Überformung. Smells of Jean-Jacques Rousseau, doesn’t it, Mr. Foster? Und der bestätigt postwen dend: „Ich bin ein reueloser Rousseauia ner und habe es einfach aufgegeben, von all diesen Unterstellungen peinlich berührt zu sein. Es ist meine Überzeugung, dass wir über ein paar inhärente Eigenscha en ver fügen, die wir nicht ändern können und die keinen Umwelteinflüssen unterliegen. Sie brauchen nur ein bisschen an einem Ban ker zu kratzen, und schon kommt der Jäger und Sammler zum Vorschein. Wenn mich diese Auffassung zu einem Essenzialisten macht: So sei es! “
Charles Foster wurde 1962 geboren und ist ausgebildeter Tierarzt und Anwalt. Er hat vielfach publiziert, unter anderem über Reisen, Jesus, Bioethik, Mauersegler oder die Biologie religiöser Erfahrungen. Sein Buch „Being a Beast“ war ein internationaler Best seller und wird derzeit verfilmt. Foster lebt mit seiner Familie in Oxford, wo er Ethik und Rechtsmedizin lehrt
Was Foster definitiv nicht ist: ein Reaktio när. So kritisch er im kürzesten, der Auf klärung des 18. Jahrhunderts gewidmeten Kapitel mit ebendieser ins Gericht geht, so handelt es sich bei seinem Buch, wie der Autor in seinen Vorbemerkungen beteuert, „nicht um ein anti-au lärerisches Traktat“, sondern den Versuch, „die Au lärung aus den Klauen ihrer selbst ernannten Hohe priester – der wissenscha lichen Funda mentalisten – zu befreien“.
Diese Anstrengung weist auff ällige Ge meinsamkeiten mit der „Dialektik der Auf klärung“ (1947) von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno auf. So wie diese Kri tik an einer „instrumentellen Vernun “ übt, die die Herrscha über eine „äußere Na tur“ zum Ziel hat (und unterm Primat der Selbsterhaltung letztendlich die „innere Na tur“ des Menschen unterjocht), so wendet sich Foster gegen die „Tyrannei des Kogni tiven“ und die „unheilige Trinität aus Seh vermögen, Erkenntnis und Sprache“, durch die der Mensch seine Möglichkeiten, sich Welt zu erschließen und mit dieser in Kon takt zu treten, mutwillig limitiere.
„Wir haben zumindest fünf Sinne“, erklärt Foster, „wahrscheinlich sind es um einige mehr, aber gut, bleiben wir bei fünf; von denen nutzen wir aber nur einen wirklich, womit wir unser Potenzial auf 20 Prozent reduzieren. Würden wir unsere ökonomi schen Entscheidungen und unsere Bezie hungen auf Grundlage dieser Informatio nen ausrichten, wären wir bankrott und sehr einsam.“
Der Rückzug aufs eigene Selbst, die kla re Scheidung des eigenen Ich vom Rest der Welt ist für Foster so etwas wie die Ursün de der Menschheit. „Mensch zu sein heißt, in Beziehung zu treten“, lautet eine der pro grammatischen Passagen von „Being Hu man“ – „und zwar nicht nur zu lebenden Menschen, sondern auch zu toten und zu Nicht-Menschen.“
Während Charles und Tom durch die Wälder streifen, begegnen ihnen ihre jung steinzeitlichen Vorfahren in Gestalt von X, wie er genannt wird, und dessen Sohn. Ob es sich dabei um einen literarischen Kniff, eine Fantasie oder tatsächlich um eine Er scheinung handelt, ist vielleicht auch des wegen nicht ganz leicht zu entscheiden, weil sich Foster einen Spaß daraus macht, sei ne Leserinnen und Leser zu verwirren oder zu schockieren.
Dass er es für eine gute Idee hält, die Zähne des eigenen toten Vaters als Ket te um den Hals zu tragen, muss man ihm aber wohl abnehmen.
Charles Foster: Jagen, sammeln, sessha werden. Meine Abenteuer in 40.000 Jahren Menschheits geschichte. Deutsch von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß. Malik, 415 S., € 24,70

Der Inbegriff all dessen, was im Neolithi kum falsch läu , ist für Foster das Feld: „Es ist ein Indikator unserer Leidenscha zu er klären: ,Das gehört mir und deswegen nicht dir!‘ Und es zeigt, wie wir mittels Mau ern und Zäunen nicht nur das Land au ei len und zergliedern, sondern auch unseren Geist – was unsere Beziehungen und unsere geistige Gesundheit schwer beeinträchtigt.“
In Frontstellung zu dieser Mentalität stellt „Being Human“ ein Plädoyer für die Durchlässigkeit dar, eine Aufforderung, Grenzen zu überschreiten, statt diese als absolut zu akzeptieren. Das gilt nicht nur für Territorien, sondern auch für vermeint

lich streng binäre Kategorien wie „Mensch vs. Tier“ oder „tot vs. lebendig“. Techniken der Ek-stase, des Außer-sichSeins oder -Geratens, spielen in diesem Zu sammenhang eine wichtige Rolle. Foster, der täglich morgens und abends meditiert, erweist sich auch hier als Pragmatiker und lässt sowohl Fasten als auch exzessiven Rot weinkonsum gelten. Und er beschreibt de tailreich, wie er, mit ausgekugelter Schulter ins Spital gebracht, mit einem Sauerstoff Lachgas-Gemisch behandelt wird und dar au in seinen Körper verlässt: „,Ich‘ konnte die deformierte Schulter, die Pigmentflecken oben auf meiner Glatze und den sauber ge zogenen Scheitel des Pflegers sehen. Moch te der Körper auch Schmerzen haben, das wahre ,Ich‘ – das beobachtende – hatte kei ne. Allerdings wusste es, dass der Körper litt, was es bedauerte.“
Man muss mit den Thesen Fosters durchaus nicht übereinstimmen, um an der Lektü re von „Jagen, sammeln, sessha werden“ großes Vergnügen zu finden. Der Autor ist fraglos meinungsstark, aber keineswegs ein Dogmatiker; er will seine Leserscha nicht belehren, sondern eher betören und verfüh ren – was ihm mit seiner höchst sugges tiven Prosa immer wieder gelingt: „Eine nasse Eule erjagt Beute. Dachse trampeln durchs Gebüsch und saugen Regenwürmer ein wie Spaghetti. Ein Schaf hustet. Man sieht keine Sterne. Von der Erde steigt Käl te auf, kriecht in unsere Kleider. Wir den ken an Feuer und Tee und Wein. Mit der Kälte schleicht sich der Schlaf heran. Wir sind eins mit der Erde.“
Letztendlich ist „Being a Human“ ein einziges Paradox: Es erzählt zwar von einer katastrophischen Verfallsgeschichte, be wahrt aber einen unerschütterlichen Glau ben daran, dass nicht nur Walt Whitman, sondern jeder Mensch Vielheiten enthält. „Wir Menschen“, versichert Foster im Ge spräch, „sind schon ganz besondere Tiere.“
KLAUS NÜCHTERN»Sie brauchen nur ein biss chen an einem Banker zu kratzen, und schon kommt der Jäger und Sammler zum Vorschein
CHARLES FOSTERGeorge war ein Endling: der Letzte sei ner Art. Jahrelang hatten Wissenschaf ter versucht, einen Paarungspartner für die hawaiianische Schnecke zu finden, um die Art doch noch zu retten – vergeblich. „Wäh rend die Welt ins neue Jahr hineinfeierte und die Korken knallen ließ, starb er am Neujahrstag 2019 im Alter von 14 Jahren allein in seinem Terrarium“, erzählt Jasmin Schreiber. Die Schnecke war nach Loneso me George benannt gewesen, der letzten Schildkröte der Pinta-Insel. Endling, das ist „ein Wort von san er Schönheit, von herz zerreißender Einsamkeit und eiskalter End gültigkeit“, zitiert die Autorin aus Ed Yongs Artikel „The Last of Its Kind“.
Die „100 Seiten“-Serie aus dem Reclam-Ver lag will aktuelle Themen behandeln, unter haltsam und persönlich geschrieben sein. Die Deutsche Jasmin Schreiber ist prädes tiniert dafür, den Band über Biodiversität zu bestreiten, ist die 34-Jährige doch für sich schon ein diverses System: Die Biolo gin, Wissenscha sjournalistin und Autorin hochgelobter Romane („Marianengraben“) strei gern im Wald herum und lässt sich gerade zur Rangerin ausbilden.
Erst mal erklärt sie, was Biodiversität eigentlich ist. Die meisten von uns den ken dabei an Artenvielfalt – und aus! Die ist natürlich wichtig, aber nur ein Aspekt. Bei Biodiversität geht es nämlich auch um die genetische Vielfalt innerhalb von Arten und um die Diversität von Ökosystemen.

Warum das wichtig ist: Einer von Schrei bers Hunden hat zum Beispiel Klapp-, der andere Stehöhrchen. In Bezug auf die Ohr form repräsentieren sie also zwei „Sorten“. Zwar wirke die Ohrform nicht gerade wie das große Power-Kriterium, aber: „Je mehr Varianten von Genen vorhanden sind, umso besser kann eine Art beispielsweise auf ver änderte Umweltbedingungen reagieren, weil irgendein Exemplar vielleicht das passende Erbgut hat, um zu überleben.“
Die Ansprüche der Serie erfüllt Schrei ber locker: Sie erklärt das Wichtigste, er zählt persönlich und formuliert einfach. „Ja, wir machen jetzt einen kleinen Genetikex kurs, aber keine Sorge, wird nicht schlimm.“ Happy-pappy klingt ihr Buch deswegen nicht. Bei einer Million vom Aussterben be drohter Arten gehe es auch für uns Men schen ums Ganze: „Brechen unsere Öko systeme zusammen, verlieren wir unsere Lebensgrundlagen und werden von all den wegen uns Menschen aussterbenden Orga nismen mit in den Abgrund gezogen.“ Soll te die Erde in diesem Jahrhundert die DreiGrad-plus-Schwelle überschreiten – was gut möglich ist –, würden fast die Häl e der In sektenarten, 44 Prozent der Pflanzen und gut ein Viertel der Wirbeltiere mindestens die Häl e ihres Verbreitungsraums verlie ren. Am Ende gibt Schreiber Tipps, was je der tun kann. Das hätte etwas breiter aus fallen können, das meiste ist bekannt: wilde Ecken im Garten lassen, Insektenhotel auf stellen, niemals Schneckenkorn verwenden.
Die Schnecken, die das Sterben besonders stark trifft, betrauert Schreiber besonders. Auch weil ihr Aussterben den meisten Leu ten egal ist. Nicht so Schreiber. „Wenn das hier Forscherinnen oder Forscher lesen und ich mir was wünschen darf: Gerne eine Schnecke nach mir benennen! Mehr könn te ich mir als Lebenshighlight nicht wün schen.“ GERLINDE PÖLSLER
Was ich in meinem Herzen fühle, wenn ich über meinen Bruder und sein Leben nachdenke, ist so gewaltig, so strahlend, dass ich mir dachte, ich müsse ein Buch schreiben, das Menschen dabei hilft zu verstehen, wie es ist, wenn man einen Jungen oder ein Mädchen mit Down-Syndrom kennt und liebt.
– Jesse Ball –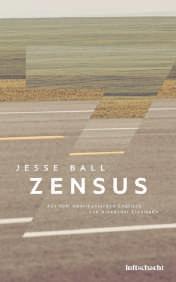
Zensus ist ein lebendiges Zeugnis selbstloser Liebe, ein Psalm über alltägliche Wunder und eine geheimnisvolle, sich entwickelnde Metapher. So freundlich, dass es schmerzt.
DAVID MITCHEL ( CLOUD ATLAS )

Biologie: Über Endlinge, Hunde und Schnecken: Warum Biodiversität existenziell und das Artensterben entsetzlich traurig istJasmin
Kulturgeschichte: Philipp Blom beschreibt, wie der Mensch seit über 6000 Jahren versucht, die Natur zu beherrschen
A n der Weltlage verzweifeln derzeit vie le Menschen – so auch Philipp Blom, der sonst so besonnene Historiker, Jour nalist und Radiomacher. „Die Unterwer fung. Anfang und Ende der menschlichen Herrscha über die Natur“ heißt seine in Buchform gegossene Reaktion darauf. Da rin beschreibt Blom die Geschichte der menschlichen Wahnidee, die Natur zu be herrschen, und die narzisstische Vorstel lung, über dieser zu stehen.
In einem klassisch kulturgeschichtlichen Ansatz geht es dabei weniger um die Ein griffe, mit denen die menschlichen Zivili sationen das Antlitz der Erde verändert ha ben – wie Rodungen, Bewässerungssysteme und die Ausbeutung von Ressourcen –, als um die Genese der Ideen, die angetreten waren, um diese zu rechtfertigen.
Seinen Lesern verlangt Blom dabei einiges an Geduld ab, beginnend mit einer ausführli chen Analyse einer mesopotamischen Vase und einer seitenlangen Rekapitulation des Gilgamesch-Epos, dessen fehlerha er Held ihm als „der erste Träger dieses Wahns“ gilt. Im Alten Testament wird mit der Auffor derung, sich die Erde untertan zu machen, „die Unterwerfung zur schri lich festgeleg ten Leitidee und zum göttlichen Au rag“. Der Mensch schwingt sich zum Herrn über die Schöpfung auf.
Um es vorweg zu sagen: Den für den Denkhorizont und die Handlungsmöglich keiten der damaligen Gesellscha vermut lich so kühnen wie unvorstellbaren Im perativ als „Wahn“ und „Narzissmus“ zu bezeichnen, erweist sich als wenig hilfreich. Denn der Autor verwendet diese aus dem Bereich der Psychiatrie stammenden Begrif fe wie einen Basso continuo, ohne sie zu erklären. Erschwerend kommt hinzu, dass auch sein adjektiv- und metaphernreicher Stil mehr den raunenden Erzähler markiert als den kühlen Wissenscha ler.
Blom scheut sich nicht, die ferne Vergan genheit mit für heutige Verhältnisse ent wickeltem Vokabular heraufzubeschwören.
Bei der Venus von Willendorf und anderen „delikaten Figuren mit den üppigen Run dungen aus dem Paläolithikum und dem Neolithikum“ spekuliert er über eine „stein zeitliche Pornografie“. Neanderthaler be zeichnet er salopp als „primitivere Liebha ber oder Partner der frühen Homo sapiens“, die Maori rotteten die „riesigen, flugunfä higen Moa-Vögel aus, um einen regen lo kalen Markt zu befriedigen“.
Aber es stimmt schon: Früher waren Men schen auch nicht anders, sie hatten nur we niger Möglichkeiten. „Menschen haben ihre Umwelt schon immer umgeformt und dabei nur ihre unmittelbaren Interessen im Blick gehabt. […] Auch in der Zeit vor der Flut waren Menschen gierig, versuchten Jäger, mehr zu jagen, als sie essen und verwer ten konnten, wurden durch Brandrodungen ganze Landscha en verändert.“
Spannend wird es aber, wenn Blom der Frage nachgeht, warum die tatsächliche Unterwerfung der Natur ihren Ausgang von Europa nahm und nicht von ande ren, damals viel mächtigeren Reichen. Sei ne Antwort: Zufall. Auch China hatte kei ne Skrupel, seine Ressourcen auszubeuten, und das, obwohl seine führende Philoso phie auf dem Gedanken der Harmonie mit dem Fluss der Natur beruhte. „Tatsächlich aber wurde kaum ein Fluss in seinem na türlichen Bett gelassen.“

Europa konnte erstarken, weil China seine Kontrolle über Seewege und Han delsknoten freiwillig aufgegeben hatte, und zwar genau in dem Moment, als es mit den technischen Entwicklungen der Schifffahrt des Reichs der Mitte gleichge zogen hatte. Anders als das Osmanische Reich hatte Europa, bestehend aus zahl reichen rivalisierenden und damit Entwick lungen antreibenden Kleinmächten, Zugang zum Atlantik. Dazu kam die Erfindung der Feuerwaffen, die eher der für die europäi sche Kriegsführung wichtigen Städtebela gerung zugute kamen als Kämpfen in der Steppe, zu denen China und das Osmani
»Auch in der Zeit vor der Flut waren Menschen gierig, versuchten Jäger, mehr zu jagen, als sie essen und verwerten konnten
PHILIPP BLOMsche Reich greifen mussten, um ihre Gren zen zu sichern.
Der europäischen Au lärung stellt Blom zunächst kein sehr gutes Zeugnis aus, denn sie habe theologische Konzepte wie die menschliche Ausnahmerolle, den historischen Fortschritt und die erlösende Vernun fortgesetzt, sich damit der Über macht der Kirche gebeugt und sogar den Kolonialismus unterstützt. „Die Sklaven händler lernten bald, ihren Wohlstand im Lichte der Evangelien und der Au lärung zu begründen.“ Mit dieser Art von „Recht fertigungsindustrie“, die auch die Not des europäischen „Lumpenproletariats“ legiti mieren sollte, geht Blom genauso hart ins Gericht wie mit den Allmachtsfantasien der Naturbeherrschung nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA und Europa über die UdSSR bis nach China.
Erst zum Schluss versucht er einen optimisti schen Ausblick und thematisiert damit das im Titel angesprochene „Ende der mensch lichen Herrscha über die Natur“. In seinem überzeugenderen, weil stringenteren Buch von 2017, „Die Welt aus den Angeln“, hat te Blom dargelegt, wie die Kleine Eiszeit von 1570 bis 1700 dem europäischen Den ken und Handeln einen enormen Entwick lungsschub verschafft hatte. Dasselbe hofft er nun von einer „weitergedachten“ Au lä rung für die derzeitige Klimakatastrophe.

In seinem bisher persönlichsten Buch stellt sich der Philosoph Peter Strasser den Selbstzweifeln des schreibenden Denkers ebenso wie der Frage, »warum wir da gewesen sein werden«. Ihm geht es dabei weniger um das »Wozu« als um die übergeordnete Problematik, welchen Sinn wir unserer Existenz über unsere Endlichkeit hinaus zusprechen können. Der Advent des Philosophen ist für ihn dabei eine Zeit des Ahnens, das nichts mit Wunschdenken zu tun hat, sondern unserer ambivalenten Gegen wart abgelauscht werden muss. Bereits die Tragweite der Fragestellung bestimmt für Strasser über die Möglichkeit eines Antwortens: »Erst unter einer solcherart heilsgeschichtlichen Perspektive werden wir wahrhaft da gewesen sein.«
Philipp Blom: Die Unterwerfung. Anfang und Ende der menschlichen Herrscha über die Natur. Hanser, 368 S., € 29,50


Dazu schlägt er ein Menschenbild vor, das den theologischen Ballast abwir und den ehemaligen „Herrn der Schöpfung“ als einen symbiotischen Organismus und ein „Produkt ungeahnter Kommunikations prozesse zwischen zahllosen Lebensfor men“ begrei , den neuesten naturwissen scha lichen Forschungen der Genetik und den Erkenntnissen über das Mikrobiom des Darms entsprechend. Was diese „radikale Wiederentdeckung des Menschen als Teil der Natur“ konkret bedeuten würde, müsste Blom in seinem nächsten Buch dann auch näher ausführen.
KIRSTIN BREITENFELLNER»Unser Weltzustand heute schwankt zwischen Apokalypse und Advent.«
N ur der Irrtum braucht die Macht des Staates. Die Wahrheit setzt sich von allein durch“, meinte einst Thomas Jeffer son. „That didn’t age well“ gehört noch zum Freundlichsten, was man aus heuti ger Sicht über dieses Zitat sagen kann. Es wurde auch in die Unabhängigkeitserklä rung des Cyberspace von 1996 aufgenom men, die vom naiven Optimismus der Pio nierzeit des World Wide Web geprägt ist. Wer sich ein Vierteljahrhundert später ange sichts der wiedererstarkten Flacherdler-Be wegung und marschierender Troll-Armeen fragt, wie wir in so kurzer Zeit in eine so missliche Lage kommen konnten, findet in Gérald Bronners Essay „Kognitive Apoka lypse“ eine mögliche Antwort.
Für den an der Sorbonne lehrenden fran zösischen Soziologen leben wir mittlerwei le nämlich in einem „deregulierten kogniti ven Markt“, der uns einen Spiegel vorhält: Je geringer der Einfluss vermittelnder Ins tanzen und traditioneller Gatekeeper wie etwa Journalisten auf das verfügbare Infor mationsangebot ist, desto deutlicher wird das Bild, das die Menschheit in Form digi taler Spuren von sich selbst zeichnet. Und dieses Bild ähnelt nicht etwa einer seit der Au lärung verbreiteten, durch Rationalität geformten Idealvorstellung des Menschen. Für Bronner zeigt sich durch die Deregulie rung des kognitiven Markts vielmehr eine „nicht naive, oder, wenn man so will, rea listische Anthropologie: Die Tatsache, dass unser Gehirn Aufmerksamkeit für jegliche egozentrische, auf Streit ausgerichtete, mit Sexualität oder Angst zusammenhängende Information entfaltet, zeichnet die Umrisse eines sehr realen Homo sapiens.“
Und dieser Homo sapiens von heute verbringt seine Zeit eben damit, auf Bildschirmen he rumzuwischen, dabei nach Sex und Skan dalen zu suchen und sich von haarsträu benden Unsinnigkeiten in die Irre leiten zu lassen, wenn sie nur gut erzählt sind. Wie konnten sich die vielen Denker und Utopis ten, von denen Bronner einige der wichtigs
Gérald Bronner: Kognitive Apo kalypse. Eine Patho logie der digitalen Gesellscha . C.H.Beck, 285 S., € 24,70


ten herbeizitiert, nur so täuschen? Schließ lich würden wir doch in einer Epoche leben, in der ein großer Teil der Menschheit dank des atemberaubenden technologischen Fort schritts der letzten Jahrzehnte nur einen verschwindend geringen Teil seiner Ener gie für Hausarbeit, Broterwerb und der gleichen einsetzen müsse. Jedenfalls geht das aus historischen Vergleichen und Sta tistiken hervor, aus denen Bronner zitiert. Von den Zwängen des Überlebenskampfs befreit, stehe uns heute so viel „freigesetz te Gehirnzeit“ zur Verfügung wie noch nie. „Unsere Vorfahren träumten häufig von die sem Augenblick, den wir heute erleben“, so Bronner. „Aber sahen sie auch voraus, dass aus diesem Traum ein Albtraum wer den kann?“
Bronner zählt in seinem fakten- und an ekdotenreichen Buch viele Facetten und Ab surditäten unseres von Social Media, Fake News & Co geprägten Zeitalters auf, warnt jedoch davor, das Smartphone zum Sünden bock zu machen: „Wer den Bildschirmen die Schuld gibt, jagt Schimären nach, denn sie sind lediglich die Vermittler zwischen dem hypermodernen Charakter des kognitiven Marktes und den sehr alten Funktionswei sen unseres Gehirns.“
Diese Gesellscha sdiagnose erklärt auch den Titel von Bronners Buch: „Apoka lypse“ versteht er im biblischen Sinn als „Offenbarung“.

Pathologie, Anthropologie, Offenbarung: Vor der großen Geste schreckt der streit bare Soziologe nicht zurück. Er belegt sei ne Positionen durch eine Fülle von Studien und Anekdoten von unterschiedlicher Über zeugungskra : Während er die von führen den Anthroposophen geäußerte Theorie, die Covid-19-Pandemie sei dem Aufstellen von 5G-Masten geschuldet, genüsslich als Ver wechslung von Korrelation und Kausalität enttarnt, wird ihm nicht jeder bei der An sicht folgen, man könne nicht gleichzeitig gegen Atomkra und für den Kampf gegen den Klimawandel sein. Auf die anschließen
de Feststellung, dass uns „eine auf Ängs te ausgerichtete Au ereitung der Welt“ in unserer Handlungsfähigkeit lähmt, wird man sich hingegen wieder einigen können. Für Bronner macht uns die permanente In szenierung von Angstmachendem aller Art „seltsam apathisch angesichts von Risiken, die uns durchaus bewusst sind. Die Angst hat sich also offenbar eines Teils des kostba ren Schatzes bemächtigt, den unsere men tale Verfügbarkeit darstellt.“
Dass auf dem deregulierten kognitiven Markt Angebot und Nachfrage genau aufeinander abgestimmt sind, ist demnach kein Grund zur Freude: Aufgrund der Evolution beson ders für Bedrohungen sensibilisiert, neigen wir dazu, uns viel zu großzügig aus den reich gefüllten Regalen im „Supermarkt der Ängste“ zu bedienen.
Bronner warnt davor, die Verantwor tung für das wenig schmeichelha e Bild, das die Menschheit derzeit abgibt, im Ge folge von Adorno, Bourdieu oder Choms ky auf die Hegemonie des Bürgertums oder die Manipulation der Massen zum Zwe cke ihrer Unterjochung zu schieben. An dererseits würden Populisten, die „allen Ausdrucksformen unserer kognitiven Spon tanität politische Legitimität“ zuschreiben, eine abstoßende Karikatur an die Stelle eines realistischen Porträts der Mensch heit setzen.
Analog zum antiken Mythos der Me dusa, die man nur durch einen Spiegel be trachten kann, will man nicht zu Stein er starren, sieht Gérald Bronner in seinem Buch ein Werkzeug dafür, das von uns selbst gezeichnete Zerrbild richtig analy sieren und interpretieren zu können – ein bei aller Emphase immerhin lösungsorien tierter Ansatz. Wie es jedoch ausgehend von seinem Befund gelingen soll, den „kostba ren Schatz“ unserer freigewordenen Gehirn zeit zu heben, wird auch im leider ziemlich nebulos geratenen Schlussteil seines Essays nicht klarer.
GEORG RENÖCKL
ca. 220 Seiten, gebunden, Lesebändchen EUR 21,00 ISBN 978-3-99029-539-7


MICHEL JEAN
geboren 1960, ist Innu aus der Gemeinde Mashteuiatsh am Lac Saint-Jean (Québec). Nach einem Studium der Geschichte und Soziologie arbeitet er seit 1988 als Journalist und Moderator für die französischkanadischen Fernsehsender Radio Canada Info und, seit 2005, TVA Nouvelles. Er ist mit acht Romanen und zwei Anthologien mit Erzählungen indigener Au torinnen und Autoren aus Québec einer der wichtigsten indigenen Autoren Québecs. Im Oktober 2021 erschien sein Roman Tiohtiá:ke (Montréal in der Sprache der Mohawk). Sein Roman Kukum verkaufte sich weit über 100.000 Mal in Québec und wurde im Herbst 2020 mit dem renommier ten Prix littéraire France-Québec und im Herbst 2021 mit dem erstmals verliehenen Prix littéraire Nature Nomade ausgezeichnet.


Dieser Roman erzählt das Schicksal von drei jungen Innu, Marie, Virginie und omas, die im August 1936 ihren Famili en entrissen und mit dem Flugzeug in das 1000 km entfernte Internat Fort George in der James Bay gebracht wurden, wo es ih nen verboten war, ihre Sprache zu sprechen, sie nur noch eine Nummer waren und hil os brutalen Übergri en und sexuellem Missbrauch von Seiten der Mönche und Nonnen ausgesetzt waren, die sie „Wölfe“ (maikan) nannten.
Michel Jean wendet sich in seinem erstmals 2013 erschienenen Roman einer der ns tersten Perioden der Geschichte Kanadas zu, die bis heute nicht wirklich aufgear beitet ist. Durch die Funde von gut 1000 Überresten von Leichen indigener Kinder in Massengräbern in der Nähe ehemaliger Umerziehungsinternate 2021 und Anfang 2022 bekommt dieser erschütternde Ro man noch einmal eine neue Aktualität und Brisanz.

Zeitgeschichte: Zwei Bücher rekonstruieren den Aufruhr des Jahres 1923, eines Schlüsseljahres der deutschen Geschichte
Jubiläen künden sich durch Bücher an. 1923? Gewiss, bald ist es hundert Jahre her, aber ist das Jahr denn einer genaueren Betrachtung wert? Zwei Bücher über 1923 sind schon erschienen, weitere sind ange kündigt. Schon wieder ein Erinnern, das vollmundig mehr verspricht, als es einlösen kann? Erschien da nicht gerade ein Buch, das 1922 zum Jahr des Glücks ausrief? Bei genauerem Hinsehen beschränkte sich die ses Glück auf die Literaturgeschichte. Der deutsche Schri steller Norbert Hummelt folgte den Spuren von Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf und Rainer Maria Ril ke und meinte, ein Annus mirabilis gefun den zu haben.
Jetzt also Volker Ullrichs „Deutschland 1923. Ein Jahr am Abgrund“ (C. H. Beck) und, eine Spur weniger dramatisch, Peter Reichels „Rettung der Republik? Deutsch land im Krisenjahr 1923“ (Hanser). Die zwei Geschichtsbücher, auf Deutschland konzentriert, machen auf klassische Ge schichtsschreibung. Aber ist die explosi ve Rhetorik in den Titeln gerechtfertigt? Verdient es 1923, zum Schlüsseljahr der Weimarer Republik und zum Vorspiel von Hitlers Machtergreifung 1933 stilisiert zu werden?
Der Historiker und Journalist Volker Ullrich, der viele Jahre bei der Zeit für das politi sche Buch verantwortlich war, breitet das Krisenjahr in einem großen Panorama aus. Durch Porträts und persönliche Geschich ten, durch pointierte Zitate aus Tagebü chern und Tageszeitungen stellt er anschau liche Farbigkeit her, was die Lektüre leicht und spannend macht. 1923 bedeutete in seiner Darstellung in der Geschichte der Weimarer Republik eine nie da gewesene Steigerung an Wirr nis und Spannung. Der Publizist Sebastian Haffner, den er zitiert, meinte gar: „Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deut schen 1923-Erlebnis entspricht“.


Denn nicht nur die große Politik ge riet aus der Balance. Die ganze Bevölke
Peter Reichel: Re ung der Republik? Deutsch land im Krisenjahr 1923. Hanser, 228 S., € 27,50

rung wähnte sich in einem Tollhaus, sah das Land in den Untergang dri en, reif für den Ruin.
Beklemmende Ungewissheit im Alltag wurde zum Dauerzustand, jede Stabilität war verloren. Die Tagebuchschreiber beklag ten, dass man sich auf nichts mehr ver lassen, sich an nichts mehr halten konnte. „Die Zeit ist allzu sehr aus den Fugen“, no tierte etwa der Romanist Victor Klemperer Ende Mai 1923, Anfang September klag te er: „Jeder fühlt etwas Bedrohlichstes in nächster Nähe, niemand weiß, was wird.“

In der Chronik der Ereignisse mangelte es dem Jahr 1923 also wahrlich nicht an Spannung. Straßenkämpfe und Aufstän de, Umsturzversuche und Verschwörun gen, Regierungs- und Parteikrisen hielten die politischen Eliten wie das Land in ste ter Spannung.
Es begann mit der französischen Beset zung des Ruhrgebietes (11. Januar), die aus Versäumnissen in der Zahlung der Repa rationen resultierte; was folgte, waren pas siver Widerstand vor Ort, wilde Streiks, gewaltsame Zusammenstöße, Gerichts prozesse und Ausweisungen Zehntausen der, was in ganz Deutschland eine nationa listische Dauererregung auslöste.
lutionären Endkampf zu stehen, und rech neten sich, ausgehend von einer rot-roten Regierung in Sachsen und Thüringen, eine Machtübernahme aus. Überdies rüttelten separatistische Bewegungen entlang des Rheins an der Einheit des Reiches.
Begleitet und befeuert wurde die poli tische Hochspannung durch eine galop pierende Inflation, die die Ersparnisse in Nichts auflöste und den Wert von Gehältern und Renten innerhalb von Stunden dahin schmelzen ließ. Das Geld möglichst schnell auszugeben, bevor es an Kau ra verlor, wurde zu einer Überlebensfrage. Reis, der gestern pro Pfund 80.000 Mark kostete, war am nächsten Tag nur mehr um 160.000 Mark zu haben.
Der Zahlenwahnsinn fraß sich in die Hirne, bestimmte das alltägliche Denken, führte zu Spekulationsfieber und Prasserei. Die Hyperinflation, an deren Ende das Brot eineinhalb Milliarden Mark kostete, zerriss den Zusammenhalt der Gesellscha , mach te vor allem den Mittelstand zu Verlierern.
Volker Ullrich: Deutschland 1923.
Das Jahr am Ab grund. C. H. Beck, 441 S., € 29,50

Peter Reichel: Ret tung der Republik? Deutschland im Krisenjahr 1923. Hanser, 228 S., € 27,50
Der Erste Weltkrieg schien in den deutsch-französischen Auseinandersetzung eine Fortsetzung zu erhalten. Und das Jahr war noch nicht zu Ende, als Adolf Hitler, zusammen mit der Weltkriegslegende Erich Ludendorff, durch einen Putsch im Münch ner Bürgerbräukeller (8. November) einen „Marsch auf Berlin“ anstoßen wollte.
Hitler war damals aber nicht der Einzige aus den völkisch-nationalistischen Kreisen, die in diesem Jahr eine Chance zur Machtüber nahme witterten. Kurz vorher hatte sich die gegenrevolutionäre Landesregierung des Freistaats Bayern damit profiliert, den An ordnungen Berlins und dem Republikge setz die Stirn zu bieten. Auch die deutschen Kommunisten waren der Ansicht, im revo
Noch im Dezember 1923 schien die Weima rer Republik verloren; aber Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichskanzler Gustav Stresemann gelang in den nächsten Mona ten das Kunststück, erfolgreich durch die Krise zu steuern. Die Währung wurde sa niert, der Ruhrkampf wurde abgeblasen, Deutschland konnte sich unter veränder ten internationalen Konstellationen mit den Alliierten in der Reparationenfrage einigen, in der innenpolitischen Auseinandersetzung trat eine gewisse Beruhigung ein. Die Jah re, die folgten, gelten als die glücklichsten in der Geschichte der Weimarer Republik.
Aber war in den Golden Twenties al les gut?

Peter Reichel zeigt anschaulich, wie er bittert und risikoreich der Kampf um die Macht geführt wurde, wie knapp der Wett lauf um eine Stabilisierung war und welche persönlichen Wunden die Krise von 1923 schlug. Die Politiker an der Spitze des Staa tes waren groben Beleidigungen und De

»Hella Pick ist die Doyenne, die Königin der außenpolitischen Autorinnen.«
John Simpson, BBC
Das bewegende Leben einer außergewöhnlichen Journalistin
mütigungen ausgesetzt: Ebert musste er leben, wie ihm ein Gericht zur Freude der Rechten Hochverrat attestierte, weil er sich im Jänner 1918 in der Streikführung enga giert hatte. Die Rede von den „November verbrechern“, der rechtsradikalen Lieblings bezeichnung für die Gründer der Republik, wurde damit quasi gerichtlich bestätigt. Der Stress hatte Folgen: Friedrich Ebert starb frühzeitig im Alter von 54, Gustav Strese mann mit 51 Jahren.
1923 wurde sichtbar, welche Instrumente die Weimarer Verfassung dem Schaltraum der Republik zur Verfügung stellte. Ebert wen dete das Instrument des Ermächtigungsge setzes an und schaltete in der Notsituation die Reichswehr ein. Der politische Gegner mit seinen Bastionen in Reichswehr, Ver waltung und Justiz lernte, welch große Be deutung das Amt des Reichspräsidenten barg, und hielt Ausschau nach einem popu lären Kandidaten, um das Präsidentenamt zu erobern.
1925 war es dann so weit. Nach dem überraschenden Tod Eberts wurde die Wahl vorzeitig notwendig. Der Kandidat des anti republikanischen „Reichsblocks“, der grei se Feldmarschall Paul von Hindenburg, gewann. Als die Weltwirtscha skrise die politische Mitte dezimierte, schlug seine Stunde – mit den bekannten Folgen.
Was leisten die beiden Bücher im Vergleich? In der Tendenz sind sie ähnlich, beide ha ben ihre Vorzüge. Volker Ullrich inszeniert das „Jahr am Abgrund“ im Überblick; er zeigt, dass er auch Journalismus kann. Pe ter Reichels Darstellung ist viel enger ge fasst, auch kürzer, und kümmert sich in der Analyse vor allem um die Funktionsweise der Republik. Trotzdem leistet er sich über raschenderweise einen langen Exkurs zur Münchner Räterepublik, um das Besonde re des bayrischen Anteils an der Geschichte herauszustreichen. Hitler wurde bekannt lich in München groß und nicht in Berlin.
ALFRED PFOSER

1947 erschien das Romandebüt „Die Sackgasse“ der damals 24-jährigen Vera Ferra-Mikura, die später als Kinder- und Jugendbuchautorin berühmt werden sollte.

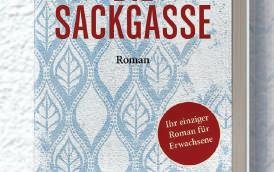
Sie erzählt darin mit erstaunlicher Klarsicht und großem sozialen Bewusstsein die Geschichte der Familie Kleist, die unter ärmlichen Bedingungen in einem Zinshaus am Ende einer Sackgasse lebt.
Auf engstem Raum wohnt die Witwe Kleist mit dem Sohn Rupert und den Töchtern Luise und Fanny.
Unausgesprochen wird klar, dass der Roman im Wien der unmittelbaren Nachkriegszeit spielt und das Haus in der Sackgasse eine Metapher für die Situation Österreichs nach 1945 ist.


Kulturgeschichte: Freud, Adler, Frankl: Was die drei Urahnen der Psychotherapie geprägt, getrennt und vereint hat

Wien, der fruchtbare Nährboden der Psychotherapie, brachte Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur einen Sigmund Freud hervor. Kurz nach der Jahrhundert wende begründete Alfred Adler als einer der ersten Zöglinge des Psychoanalyse-Urvaters seine eigene Schule, die Individualpsycholo gie. Sein Schüler Viktor Frankl folgte ihm: Wie schon Adler mit Freud, brach auch er mit seinem Lehrherren, um seine eigene Richtung zu entwickeln – die Logotherapie. Alle drei Wiener Altmeister der Seelenfor schung werden nun für eine kurze Revue im Licht ihrer Zeit auf die Bühne geholt. Dafür haben sich mit dem Kulturwissen scha ler Christian Rapp, dem Historiker Hannes Leidinger und der gelernten Juris tin Birgit Mosser-Schuöcker drei Autor:in nen unterschiedlicher Herkun zusammen getan. „Mehr als eine Biografien-Sammlung oder Zusammenfassung dreier Denkrich tungen“ wollen sie liefern. Sie fragen nach den sozialen Milieus und den beruflichen Netzwerken, in denen die richtungswei senden Schulen der Psychotherapie ent stehen, gedeihen und weltweit Blüten tra gen konnten.
Die Spurensuche führt durch dramatische Etappen der österreichischen Geschichte, beginnend mit der intellektuellen Blüte des Fin de Siècle, das Freuds Arbeit befruchte te, durch die Bedrängnisse des Ersten Welt kriegs, in dem Adler als Militärarzt dien te, die Zwischenzeit der Ersten Republik, in der sowohl Adler als auch Freud interna tionale Vereinigungen au auten, bis zur Ju denverfolgung in der Nazizeit, vor der sich Adler und Freud ins Exil retten konnten, Letzterer kurz vor seinem Tod. Zu lesen, wie Viktor Frankl, der bereits ein britisches Visum hatte, dennoch blieb, um für seine Eltern da zu sein, und dann als „Juden behandler“ ein degradiertes Dasein friste te, um letztendlich im KZ seine Familie und fast sein eigenes Leben zu verlieren, zählt zu den berührendsten Passagen die ser Dreilebensbeschreibung.
Formal sind es dann doch drei Biografien, die sich aneinanderreihen. Christian Rapp, vor allem als Ausstellungskurator mit den Schwerpunkten Stadt- und Zeitgeschich te bekannt, schreibt über Sigmund Freud. Hannes Leidinger, der als Historiker die Wiener Außenstelle des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung leitet, porträtiert Alfred Adler. Die beiden haben dieselbe Epoche jüngst schon in einer Bio grafie des jungen Adolf Hitler betrachtet („Hitler. Prägende Jahre. Kindheit und Ju gend 1889–1914“, Residenz 2020).
Zeitgeschichte ist auch das Spezialgebiet der ursprünglichen Juristin Birgit MosserSchuöcker. Neben Sachbüchern und TV-Do kumentationen schrieb sie in den letzten Jahren eine Trilogie historischer Romane zum Aufstieg und Fall der Ersten Repub lik („Der Sturz des Doppeladlers“, „Kinder einer neuen Zeit“, „Die Stunde der Wöl fe“, Amalthea). Als kleinen Au akt gibt es auch noch einen Artikel der Militärhistori kerin Verena Moritz über Sigmund Freud.
Wo wird das gemeinsame Werk nun mehr als die Summe seiner Teile? In einem schma len Bildteil in der Mitte des Buches fin den sich Jugendfotos, Familienbilder und öffentliche Aufnahmen aller drei Seelen doktoren, die sie anschaulich in Bezug zu ihrer Zeit setzen – derselben Zeit. Freud, Adler und Frankl konnten alle drei eben so von der großen medizinischen Tradition und Kultur Wiens profitieren, wie sie unter den Einschränkungen durch den Antisemi tismus und schließlich durch die Verfolgung durch die Nazis leiden mussten.
Den stärksten Zug Richtung Synergie bringt das Schlusskapitel: Die drei Autor:in nen finden sich zu einer „gemeinsamen Sit zung“ zusammen und diskutieren aus der historischen Sicht „ihres“ Seelenforschers.
Bei Themen wie „sexuelle Normalität“, Gemeinscha sgefühl oder Suizid versu chen sie auch, aktuelle Bezüge herzustel len. Davon hätte es noch ein wenig mehr sein dürfen.




Peter-André Alt: Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne. C.H. Beck, 1036 S., € 36, Viktor E. Frankl: ... trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Penguin TB, 192 S., € 10,30
Alexander Kluy: Alfred Adler. Die Vermessung der menschlichen Psyche – Biographie. DVA, 432 S., € 28,80
Dass Österreich, und da insbesonde re Wien, heute die höchste Dichte an Psychotherapeut:innen pro Einwohner auf weist, hat sicherlich mit den hier beleuch teten Quellen der Seelenheilkunde zu tun, doch so weit wagt sich das Werk nicht in die Jetztzeit vor. Der Bogen, den die Autor:in nen klar und detailliert ausleuchten, ist je ner vom forschenden Meister zum Schüler, der dann selbst weiterforscht, sich vom al ten Lehrer abwendet und seinerseits zum Meister wird.
Spannend zu lesen ist dies vor allem dann, wenn man noch keine der in den letz ten Jahren erschienenen großen Biografien der einzelnen Psychotherapie-Urväter ge lesen hat. Diese liefern naturgemäß Bil der der jeweils Porträtierten mit weit grö ßerer Detailliertheit und Tiefenschärfe, die ebenfalls den wirkmächtigen kulturel len und soziologischen Hintergrund einer Welthauptstadt der Medizin im Umbruch hervorragend ausleuchten. Zugegeben muss man hierfür aber einiges mehr an Lesezeit aufwenden.



Was im Werk von Leidinger, Rapp und Mosser-Schuöcker hervorragend gelingt, ist, Leben und Werk der drei großen Wiener Seelenforscher in gutem Überblick und in Bezug zueinander darzustellen. Die kom plexen Beziehungen der zunächst vonein ander Lernenden und dann miteinander ri valisierenden Forscher, Heiler und Lehrer werden ebenso deutlich wie das Wachsen ihrer psychotherapeutischen Antworten auf eine Welt im Umbruch. Die Grundgedanken ihrer drei Therapierichtungen lassen sich dabei gut greifen.
Hannes Leidinger, Christian Rapp, Birgit Mosser-Schuöcker: Freud – Adler –Frankl. Die Wiener Welt der Seelen forschung. Residenz, 285 S., € 28,–








Insgesamt scha ff t das Werk ein kompaktes, erhellendes Bild der großen Wiener Meister der Seelenheilkunde vor einem sich verdüs ternden Hintergrund. Ohne viel Aufwand oder Vorkenntnisse kann man hier dank klarer Sprache und konkreten, aus dem Le ben gegriffenen Szenen gut in ihre Welt und ihr Werk einsteigen.
ANDREAS KREMLAPolitik:
Oksana Sabuschko fuhr am 23. Februar zur Lesereise nach Polen. Hier entstand dieser Essay

Sie gehört seit Jahren zu jenen, die vor Putins Russland warnen: die ukraini sche Lyrikerin, Essayistin und Erzählerin Oksana Sabuschko. 1960 in Luzk gebo ren, wurde sie im deutschsprachigen Raum mit ihrem Roman „Feldstudien über uk rainischen Sex“ aus dem Jahr 2006 erst mals breiter wahrgenommen. Die Ukraine hat sie einmal als „Spielwiese des Teu fels“ bezeichnet. Aus ihrem jüngsten Buch spricht allerdings kein Triumph, zu jenen gehört zu haben, die das Übel haben kom men sehen. Sondern eher eine Wut auf die Blindheit und Naivität oder, besser: das ungeheure Ausmaß an Ignoranz westli cher Politik.
„Die längste Buchtour“ lautet der Titel des fast 200 Seiten langen Essays. Entstanden ist er in den Monaten nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, geschrie ben in Polen, wohin die Autorin am 23. Fe bruar zu einer Lesereise aufgebrochen war – mit einem mulmigen Gefühl zwar, aber doch nicht ahnend, dass sie vorerst nicht in ihr Land würde zurückkehren können. „… um sechs (um sechs!!!) klingelte das Tele fon wie durchgedreht. Es war [mein Mann] Rostyk. ‚Dummkopf!‘, stöhnte ich leise und öffnete mühsam die Augen. Warum weckt er mich so früh, weiß er denn nicht, was für einen schweren Tag ich vor mir habe? Und was für eine zwar kurze, aber dafür mit Terminen vollgestop e Reise! Aber ich griff zum Telefon – wach war ich jetzt so oder so. Anstelle eines ‚Guten Morgen!‘: ‚Es hat angefangen, Kleine, sie bombardieren uns.‘“ Oksana Sabuschko, von einer Minute zur anderen im polnischen Exil gestran det, wird zur gefragten Gesprächspartne rin für Fernsehsender und Radiostationen. Sie hat Au ritte, schreibt Artikel, erklärt. Wiederholt geduldig, was sie schon in frü heren Büchern und Essays geschrieben hat. Versucht die aus ihrer Sicht im Westen nie verstandene Geschichte der Ukraine zu rechtzurücken; sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie westliche


Grazia,
Im Hochland Sardiniens leben die Menschen besonders lang. Geschäftemacher wittern ein Milliarden-Business. Wie weit sind sie bereit zu gehen?
Kommentatoren von einer „Ukraine-Krise“ sprechen hört. Nicht nur, weil das eine Ver kennung dessen sei, was Putins Russland in den letzten Jahrzehnten vorbereitet hat. Sondern auch, weil es sich hier nicht um einen lokalen Krieg handele. „Ich nenne ihn den Dritten Weltkrieg. Die beiden vorange gangenen Weltkriege begannen genau so: aus einer Anhäufung systemischer Fehler globalen Charakters, von denen jeder sei ne Wirkung auf die architektonische Struk tur des internationalen Gleichgewichts im Ganzen hatte.“
„Die längste Buchtour“ ist ein Konden sat. Zugleich eine Suada. Sie erklärt die Vor gehensweise des sich ausdehnen wollen den Russlands, das streng nach dem alten KGB-Lehrbuch handele: Demoralisierung, Destabilisierung, schließlich militärische Auseinandersetzung usw. Die weltweiten Desinformationskampagnen der letzten Jahre gehörten ebenso dazu wie psycholo gische Tricks, um das Ausland zu täuschen. Sabuschko fühlt sich zurückgebeamt in die 1930er-Jahre. Was gerade geschehe, sei kein neuer Krieg, sondern ein „ununterbroche ner, massiver und alles durchdringender“, den der „russische Staat – ganz gleich unter welchem Namen er au ritt – konsequent gegen die zivilisierte Welt führt“.

Was gerade geschehe, sei natürlich Wahn sinn. Aber es habe durchaus Methode. Dass der Westen dies nicht erkannt oder doch großzügig übersehen hat, erregt den un gebrochenen Zorn der Autorin. Sabusch kos zugespitzte und zuspitzende Formu lierungen, ihr Pauschalurteile über die brutale russische Mentalität seien ihr an gesichts der sie und uns schockierenden Kriegsgräuel-Bilder aus der Ukraine ver ziehen. Zuspitzungen aber bergen natür lich Gefahren.
Was schon in früheren Büchern zum Vorschein kam: Sabuschkos historische Ex kurse sind teils verklärend, teils verallge meinernd, teils undifferenziert. Man kann durchaus über die Rolle der Sowjetunion
zu Beginn des Zweiten Weltkriegs diskutie ren und muss nicht der lange vorgetragenen Neutralitätsthese anhängen. Sabuschko je doch schreibt: „Die UdSSR hat zusammen mit dem Nazi-Reich den Zweiten Weltkrieg entfesselt und sich nie dafür verantwortet.“ Weil es in Polizeistaaten wie Russland nie eine Zivilgesellscha gegeben habe, könne es dort auch keine Sympathie, kein Mitge fühl geben, stellt sie fest. Gerade von einer hervorragenden Literatin vorgetragen, hat das etwas unangenehm Doktrinäres.
Im Frühjahr vertrat sie in der NZZ die The se, dass die gesamte russische Literatur im mer schon der Unmenschlichkeit russischer Aggressionen Vorschub geleistet habe, Aus druck des barbarischen russischen Wesens sei. Das grei sie – abgeschwächt – auch in diesem Essay auf. Sie spricht vom „un aufgeklärten Imperialismus der russischen Literatur von Puschkin bis Brodsky, mit Ausnahmen, die man innerhalb von zwei Jahrhunderten an den Fingern einer Hand abzählen kann“. Solche Töne kennt man sonst nur von politischen Eiferern, nicht von Dichterinnen.
Die Sprache von Sabuschkos jüngstem Essay gleicht einer unversöhnlichen Wut rede: Satzungetüme, an denen Mark Twain seine Freude gehabt hätte, und verwirrend assoziative Argumentationsgirlanden täu schen o mals komplexe Gedanken eher vor, als sie wirklich zu entfalten. Dennoch stößt man in diesem Dschungel an Einschüben und Endlossätzen nicht nur auf Bedenk liches, sondern auch auf Bedenkenswer tes. Nicht zuletzt auf den zu Recht vor gebrachten Vorwurf, dass der Westen sich zu lange nicht für die Ukraine interessiert habe und stattdessen den Einlullungsver suchen Putins erlegen sei. Sie hat recht: Wir befinden uns in einer Zeit von „his torischen Veränderungen tektonischer Na tur“. Die Literatur könnte dazu beitragen, diese jenseits von politischen Kamp egrif fen zu erspüren.
ULRICH RÜDENAUEROksana Sabuschko: Die längste Buch tour. Essay. Über setzt von Alexander Kratochvil. Droschl, 176 S., € 22,–
D ie deutsche Außenministerin Annale na Baerbock gab sich am 24. Febru ar ehrlich verblü
t: Wladimir Putin habe den Westen fortlaufend getäuscht. Tatsäch lich hatte Putin sein beim KGB erlerntes Handwerk des Täuschens und Verstellens mit Vorliebe vor deutschem Publikum er probt. Als erster russischer Präsident hat te er zwei Wochen nach 9/11 eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten – auf Deutsch, „der Sprache von Goethe, Schil ler und Kant“, wie er schmeichelnd sagte. Er versprach darin ein friedliches Mitein ander in der europäischen Familie.

Die Hörer glaubten, die wundersame Läuterung des Ex-KGB-Agenten zu erle ben, verziehen ihm seine Liquidierungen politischer Kontrahenten und unabhängi ger Medien. Dabei hatte Putin, zuvor ein farbloser und unsicherer Kompromisskan didat Boris Jelzins, den wenige ernst nah men, seine erste Präsidentenwahl mit der Pose des unerschrockenen Führers im Zwei ten Tschetschenienkrieg gewonnen. Dass er dort mit staatsterroristischer Brutalität vor ging, wollte er den deutschen Parlamenta riern als legitimes russisches Pendant zum Abwehrkampf der USA gegen den Terro rismus nach 9/11 verkaufen. Der Lohn für Putins Blendwerk: stehende Ovationen des deutschen Parlaments. Vorneweg: Kanzler Gerhard Schröder und seine sozialdemokra tischen Vertreter der Entspannungspolitik. Deren Credo „Wandel durch Handel“ über nahm später Angela Merkel.
Dabei ha en Osteuropäer und Angelsach sen zunehmend verzweifelt vor Putins ag gressiver Kriegspolitik als Wiederkehr des russischen Expansionismus gewarnt. Zwei davon, viel beachtete Autoren, haben nun hochaktuelle Bücher vorgelegt: Mark Ga leotti, Osteuropa-Historiker, Berater der britischen Regierung und sehr gefragt in englischsprachigen Medien wegen seiner intimen Kenntnisse wie auch ironischen Originalität. Und der Investigativjourna list John Sweeney, ein leicht exzentrischer, schnoddrig-ironischer Veteran der BBC-Re portage, mit seiner Analyse über den „Kil ler im Kreml“.
Sweeney gehörte zu jenen, die von Be ginn an vor Putin warnten und dessen Täu schungsmanöver aufdeckten. Er hat in Mos kau, Tschetschenien und in der Ukraine während des Kriegs recherchiert, hat mit Zeugen, Wegbegleitern und Kritikern ge sprochen. Alles, was Putin an Missionen verkündete, sind für ihn bloß camouflieren de Manöver, um den Staatsapparat im Geis te des organisierten Verbrechens umzubau en: mit nackter Brutalität, Täuschung und Lüge. Verachtung des Rechts und schran kenlose Korruption seien die Werkzeuge dazu gewesen, alte Seilscha en mit Ge heimdienst und Mafia die soziale Basis.
Die Posen des kaltschnäuzigen Machos sind für Sweeney Ausdruck einer erschüt ternd banalen Seele. Diese sei vom Zwang angetrieben, durch Gewalt, Rachsucht und Täuschung imponieren und dabei Kränkun gen und Minderwertigkeitskomplexe über spielen zu müssen. Tragischerweise verstehe Putin es, bei älteren, vor allem schlecht aus gebildeten Russen Revanchefantasien und damit Kadavergehorsam zu aktivieren. Pu tin sei „ein hyperaggressiver Psychopath“, ist Sweeney sicher: „Ein Mann, der Kom promisse für Schwäche hält“ und „gerne tö tet. Die Idee, dass wir mit Putin verhandeln können, ist töricht. Niemand im Westen wird sicher sein, bis er und seine Tötungs maschine gestoppt werden.“
Zeitgeschichte: Was treibt Putin an? John Sweeney hat dazu vor Ort recherchiert , Mark Galeo i rollt die russische Historie auf
Mark Galeo i: Die kürzeste Geschichte Russlands. Ullstein, 256 S., € 13,40

Mit „We Need to Talk About Putin: How the West Gets Him Wrong“ hatte auch der Historiker Mark Galeotti schon 2019 ge warnt; trotz der Schwere des Themas war das Werk voller Witz und Ironie. Sein neues Buch „Die kürzeste Geschichte Russlands“ ist bedauerlicherweise das erste, das von ihm auf Deutsch erhältlich ist. Vor allem seine Schilderung von Russlands „SuperMafia“ hätte eine Übersetzung verdient: Es ist eine Geschichte der organisierten Krimi nalität, die in zaristischen Straflagern ent stand, in den Gulags blühte und für Staat und Ökonomie immer bedeutender wurde, bis sie mit Putin zum Teil des Regierungs handelns wurde.

Im aktuellen Buch schildert Galeotti die russische Geschichte von ihren Anfängen über die Ära der Romanows, die kommu nistische Revolution, Lenin und Stalin bis in die heutige Autokratie. Russland, so Ga leotti, war stets ein prekäres Staatsgebil de, das seit der Gründung der „Rus“ im 9. Jahrhundert durch einfallende Nordvölker unentwegt um seine Mission und Identi tät rang. Schon wegen seiner Ausdehnung, dem Mangel an natürlichen Grenzen und der Vielfalt von Religionen und Völkern sei es unentwegt auf der Suche nach einer sta bilen Staatsform, starken Führern und einer vereinheitlichenden Mission.
Wie ein Riese throne die gewaltige Landmas se im geografischen Zentrum des eurasi schen Kontinents und fühle sich doch meist marginalisiert, bedroht und nicht wahrha anerkannt. Der Riese sei so gefräßig wie kränkbar und labil; habe immer eher von wahrer Größe und Einheit geträumt, als dass er sie besessen habe. Nie habe er eine zeitgemäße Ökonomie hervorgebracht, da für umso stärkere, theatralische Bilder des eigenen Wesens in einer erträumten, gran diosen Vergangenheit. Doch selbst diese Bilder waren meist das Ergebnis von Pro jektionen anderer Mächte. Galeottis Kabi nettstück historischer Essayistik lehrt: Pu tin ist ein Anachronismus, zugleich setzt er das uralte Drama der russischen Identi tätssuche fort.
In erweiterter Neuauflage erschien kürz lich auch „Bloodlands“, der Welterfolg des Yale-Historikers Timothy Snyder. Die ser zeigte, wie Hitler als auch Stalin nie da gewesene Massenmorde in Osteuropa entfesselten, um gigantische, ethnisch wie auch agrarökonomisch motivierte Umge staltungsutopien umzusetzen: die Zwangs kollektivierung am Ende der 1920er-Jah re und den „Sozialismus in einem Land“ Stalins dort, Hitlers abstrusen „General plan Ost“ hier.
Für beide waren die Ukraine und Weißruss land (als auch Polen) zu säubern, sie sollten die imperialen Zentren mit Nahrungsüber schüssen und Rohstoffen versorgen. Dass in Hitlers blutrünstiger Utopie Hungermorde von vornherein als Mittel eingeplant wa ren, während Stalin den Hunger erst dann (nach Lenins Vorbild) als staatsterroris tische Massenvernichtungswaffe einsetz te, als seine dilettantische Zwangsindust rialisierung der Landwirtscha fehlschlug, ändert nichts an der grundsätzlichen Ver wandtscha der totalitären Umgestaltungs visionen. Wer die „Bloodlands“ noch einmal liest, wird in Putins Paranoia ebenso wie in seinen mit Terrormethoden und Kolonial machtattitüden geführten Kriegen vor al lem Gespenster der düsteren Vergangenheit der totalitären Systeme wiederkehren sehen.
SEBASTIAN KIEFERPutin- und Russlanderklärer haben Kon junktur. Wenn sich Journalisten, Polito logen und diverse Kreml-Experten wie im Zuge des aktuellen Ukrainekrieges nicht mehr auskennen, haben die Historiker das Wort. Einer der profundesten Russlandken ner, der Historiker Manfred Hildermeier, bekennt in seiner Studie mit dem bezeich nenden Titel „Die rückständige Großmacht. Russland und der Westen“ gleich eingangs unumwunden: Das Konzept „Rückständig keit“ sei wohl umstritten, vielleicht auch veraltet, bislang sei aber kein besserer Be griff gefunden worden, um das asymmet rische Verhältnis zwischen West und Ost zu beschreiben. Die gegenseitige Wahrneh mung war vom Anfang bis herauf in die Gegenwart dergestalt: „Während der Wes ten sich dabei überwiegend im Gefühl der Überlegenheit sonnte, wurde sie in Russ land zum Wechselbad von Hochschätzung und Ablehnung, von Nacheifern und Be sinnung auf Eigenständigkeit.“ Der An satz mag Ausdruck einer eurozentristischen Position sein, allerdings bringt der Göttin ger Historiker ausreichende Belege für das ungleiche Verhältnis.

In acht dicht geschriebenen und gut lesba ren Kapiteln spannt Hildermeier einen Bo gen von der so genannten Kiewer Rus, dem Ursprung des russischen Staates (ein Aus druck von Historikern des 19. Jahrhun derts), bis in die Gegenwart, wobei der „wil de Osten“ anfangs kaum barbarischer als der Westen erscheint. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit handelte es sich um eine religiöse Abgrenzung; den nachhal tigsten Einschnitt stellt die Kirchenspal tung im Großen Schisma von 1054 dar, in dem sich Papst und Patriarch gegensei tig exkommunizierten. Ältesten russischen Chroniken zufolge war der Westen nicht nur Feindesland, der lateinischen Welt wur den auch höchst merkwürdige Eigenschaf ten zugeschrieben: Eine Brutstätte der Ab artigkeit und Unreinheit sei sie, in der man

Katzen isst und Urin trinkt. Waren es an fangs Mönche und gelehrter Klerus, die im Osten dieses Bild des Westens formulier ten, blieben die im Lauf der Jahrhunderte sich ablösenden Eliten nicht weniger zwie spältig, egal ob es sich um Aristokratie und aufgeklärtes Beamtentum oder die säkula re Intelligenzija des 19. Jahrhunderts han delte. Bewunderung und Ablehnung gingen stets Hand in Hand.
Das hinderte weder das Fürstentum Novgo rod daran, Handel mit dem Westen zu trei ben, noch Iwan III., sich an der Wende zum 16. Jahrhundert italienische Architekten ins Land zu holen, um etwa den Moskau er Kreml, wie man ihn heute noch kennt, zu bauen. Über Jahrhunderte wurden aus Europa Handwerker, Bergbauspezialisten, Wundärzte und Militärexperten in russische Dienste geholt; gelegentlich auch gegen den Widerstand der Ortsansässigen, da die Aus länder mit Privilegien gelockt wurden.
Der mächtigste Gegner des Wissens transfers, die orthodoxe Kirche, wurde von Peter dem Großen in die Schranken gewie sen, worauf diese ihn sogleich zum „Anti christen“ erklärte. Mit der Gründung Sankt Petersburgs war die Öffnung zum Westen nicht mehr aufzuhalten. Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz wurde als Be rater bei der Gründung der Akademie der Wissenscha en gewonnen, noch mehr euro päische Experten kamen ins Land, um die Industrie aufzubauen, ebenso Militärs, um die Expansion des Zarenreiches fortzu setzen. Die berühmte Bartsteuer hatte zu entrichten, wer sich nicht zum zivilisierten Europäer rasierte. In der Ära von Katharina der Großen setzten sogenannte Bildungsrei sen nach Westeuropa ein: „Ein neuer Adeli ger kathariänischer Prägung war beides zu gleich – Kosmopolit nach Maßstäben der Zeit, i.e. Europäer und Russe.“
Besonderes Augenmerk schenkt der Historiker den Reformdiskussionen des 19. Jahrhunderts, beginnend mit dem Phi
losophen Pjotr Tschadajew, der Russland als zivilisatorische Tabula rasa ansah: Das Land sei „geistig vollständig unbedeutend“, die Verantwortung dafür verortet er bei der Kirche. Zar Nikolaus I. erklärt den Den ker postwendend für verrückt. Im Zuge der Diskussionen zwischen „Slawophilen“ und „Westlern“ und vor allem nach der Niederla ge der diversen europäischen Revolutionen des Jahres 1848 setzt sich auch in der russi schen Intelligenzija das Bild eines verrotte ten Westens durch. Diverse Spielarten eines slawischen Urkommunismus entzünden die Geister. Umfangreiche Reformen finden erst im Gefolge von Russlands Niederlage im ersten gesamteuropäischen Krieg, dem Krimkrieg, statt (1853–1856): Bauernbe freiung, Industrialisierung durch Eisen bahnbau, Schaffung von Schwerindustrie.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges stellt Russland zumindest in kultureller Hinsicht eine Großmacht dar – das Petersburger „La boratorium der Modernen“ wird sprich wörtlich, die ersten bedeutenden Sammler von Picasso und Matisse sind Kaufleute aus Moskau. Mit dem Sieg des Sozialismus in der sogenannten Oktoberrevolution wird der Anspruch, Rückständigkeit gegenüber dem Westen aufzuholen, ins Gegenteil ver kehrt – im russischen Selbstverständnis hat sich der Weltgeist des Fortschritts in der Sowjetunion niedergelassen.
Als diese untergeht, werden Europa und Nordamerika zwar wiederum zum Symbol von Freiheit und materiellem Wohlstand, doch das Pendel schlägt abermals nach der entgegengesetzten Seite aus: „Die autori tär-konservative, von nationalistischen Tö nen begleitete Wende unter Putin wieder holt in vielerlei Hinsicht nur ein bekanntes historisches Muster.“ Manfred Hildermeiers im besten Sinne „sine ira et studio“ – ohne Zorn und Eifer – verfasstes Buch ist eines der besten, die man derzeit über Russland lesen kann.
ERICH KLEINManfred Hildermeier: Die rückständige Großmacht. Russland und der Westen. C.H.Beck, 271 S., € 18,50
Literatur: Eine faszinierende Arbeit zeigt auf, wie wichtig das Jüdische für Marcel Proust war.
A lle haben vergessen, dass ich jü disch bin. Ich nicht.“ Mit diesem Satz schließt das faszinierende Buch des Schweizer Literaturkritikers An dreas Isenschmid, eine weitere Wür digung seines literarischen Idols Mar cel Proust – er hatte ihm schon 2017 eine elegante Bildbiografie gewidmet. Das Zitat ist nur in mündlicher Form überliefert: Ein Freund des Schri stellers erwähnte es im Gespräch mit dem Nobelpreisträger Patrick Modia no als Detail eines leider verloren ge gangenen Briefs.
Er hat ihn also gesehen, den Ele fanten, das Offensichtliche, von dem kaum einer redet, und dies auch aus gesprochen. Isenschmid macht es zum Thema seiner Untersuchung: das Judentum im Proust’schen Universum und dessen Stellenwert für den Autor des Werkes „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ („À la recherche du temps perdu“).
Wie Proust den Erzähler Mar cel darin mit der Homosexualität in einem Maskenspiel von Ver- und Enthüllung der gleichgeschlechtlichen Vorlieben einiger Protagonisten um gehen lässt, zeigt, wie großartig er die Ambivalenz beherrschte. Biogra fie und Werkrezeption haben sich mit Verve darauf gestürzt. Das Judentum hingegen fand kaum Beachtung.
Das erstaunt aus mehreren Gründen. Schon die Darstellung der Proust’ schen Verwandtscha als einer gut bürgerlichen französischen Familie mit einer eingeheirateten jüdischen Mutter verdreht die Tatsachen. Die Bezugspersonen des jungen Proust, schillernde Figuren, deren Züge sich in der „Recherche“ wiederfinden, stammen alle aus der Familie der ge liebten Mutter; der katholische Vater wirkt da als Fremdkörper.
Dann ist nicht zu übersehen, dass zwei der wichtigsten Akteure im Ro man Juden sind: der kunstsinnige Ge sellscha slöwe Charles Swann und der zunächst unsympathisch wirken de Albert Bloch, der nach und nach zum Freund des Erzählers wird. Auch dieser, Marcel, verlässt ein einziges Mal seine Deckung und gibt sich als Jude zu erkennen.
Weiters fällt auf, welch großen Raum die Dreyfus-Aff äre in „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ ein nimmt: 1400 Seiten behandeln die ses Drama, das die französische Ge sellscha spaltete, die konfliktreichen drei Jahre machen damit immer hin etwa ein Drittel des siebenbän digen, ein halbes Jahrhundert um spannenden Riesenwerks aus. Was nicht weiter erstaunlich ist, hat doch der Schauprozess wegen Hochver rats gegen den jüdischen Offizier mit einem Fehlurteil und der entwürdi genden Prozedur der Ausstoßung
und Verbannung geendet. Er brachte einen Antisemitismus an die Oberflä che, wie ihn das moderne Frankreich noch nie gekannt hatte.
Warum also wurde Proust so spät als jüdischer Schri steller wahrge nommen? Zunächst der trivialste Grund: Das französische Publikum der 1920er-Jahre sah den eleganten Träger des Prix Goncourt lieber als „bon français“, man hatte auch kaum Erfahrung im Umgang mit jüdischen Schri stellern. Der einzige, den man kannte, war „Henri Heine“, und der war ein Dichter aus Deutschland.
Viel wichtiger aber ist Prousts eigener Umgang mit dem Thema. Sein The matisieren der Homosexualität kann man als kokettes Spiel sehen, in dem die Ambivalenz die Choreografie ent wir . Das Verhältnis der jüdischen Akteure Swann und Bloch, vor allem aber des Erzählers Marcel zu ihrem Erbe ist wesentlich weniger freudvoll und komplizierter. Grobe Missver ständnisse können sich da ergeben.
Proust selber ist nicht ganz un schuldig daran. Etwa wenn er Albert Bloch, der im Verlauf des Textes sein Alter Ego wird, bei dessen erstem Au reten die Haltung eines Schakals attestiert. Isenschmid bezeichnet dies gelassen als „Holzschnitzerei“. Der is raelische Historiker Saul Friedländer hingegen ist davon so abgestoßen, dass er Proust in einem sehr kriti schen Essay jüdischen Antisemitis mus unterstellt – aus seiner Biografie verständlich, aber doch unterkomplex.
Das ist „Der Elefant im Raum“ ganz und gar nicht: Leichtfüßig folgt der Autor durch die Textmassen von Entwürfen, Briefen und Tagebuchein tragungen den immer vertrackten, in ihrer Bedeutung sich verschieben den Spuren des Themas Judentum. Es geht Isenschmid „um die Entfal tung, wenn nicht gar Dialektik der Figuren im Werk“. So schreibt er in Beantwortung einer Detailfrage des Rezensenten mit eben dem Under statement, das ihn als Autor des Bu ches auszeichnet. Aber bei aller phi lologischen Akribie lässt er keinen Zweifel: „Auf der Suche nach der ver lorenen Zeit“ sei „jüdisch von der ers ten Zeile der Entwürfe bis zum letz ten Zettelchen aus der Todesnacht“.
THOMAS LEITNERZeitgeschichte: Über den glänzenden Aufstieg eines jüdischen Geschä smannes und dessen brutales Ende
Einen üppigen Besteckkasten nebst ein paar wenigen Briefen und Dokumenten: Das konnte Shel ly Kupferberg von ihrem Urgroßon kel noch aufspüren. Sie fand ihn auf dem Dachboden ihres Großvaters. „Isidors in roten Samt gebettete Sil bergarnitur ist das Einzige, was sich aus dem Besitz des reichen Mannes erhalten hat.“ Die Zerstörungsma schinerie der Nazis hatte gründlich gearbeitet. Im Frühjahr 1938 hatte sie Isidor innerhalb weniger Mona te physisch zerstört, er starb mit 52 Jahren. Fast sämtliche Zeugnisse sei ner Existenz in Luxus und kulturel ler Opulenz hatte sie in alle Winde zerstreut. Eines der entwendeten Bü cher entdeckte die Autorin ausgerech net in der Raubbibliothek des Stür mer-Gründers Julius Streicher: ein „Kleines Handbuch der Kunst fran zösischer Höflichkeit und Etikette“
ter Kultiviertheit ab, der Umgang mit Damen der Gesellscha machte ihn zum Lebemann: Nach zwei geschei terten Verbindungen, beide gutbürger liche Töchter, leistete er sich die Li aison mit einem ungarischen Starlet, das es mit Isidors finanzieller Hilfe in die Staatsoper schaffte.
Im Gegensatz zu anderen Juden aus dem Schtetl, die ihre entbehrungs reiche Kindheit romantisch verklär ten, hatte er das alles erfolgreich hin ter sich gelassen, wie er glaubte. Den sich immer deutlicher breitmachen den Antisemitismus versuchte er zu verdrängen. Bis am 13. März 1938 die Gestapo vor seiner prunkvollen Tür steht: Isidors Chauffeur und die Be diensteten Resi und Mizzi, zu denen er immer äußerst großzügig gewesen war, hatten bereits Monate vor dem „Anschluss“ eine Aufstellung seiner Wertpapiere kopiert und an die „Par tei“ weitergereicht.
»Wichtiger sind die Geschichten, die überlebt haben. Und weitererzählt werden
SHELLY KUPFERBERGmit einem Exlibris Isidors.
Shelly Kupferberg, 1974 in Tel Aviv geboren und seit ihrer frühen Kindheit in Berlin lebend, befasst sich in ihrem ersten Buch mit der Wie ner Vergangenheit der eigenen Fami lie. Im Zentrum steht die schillernde Figur des Urgroßonkels Isidor Gel ler. Bei der Erinnerungsarbeit half der Großvater Walter Grab, Gründer des Instituts für Deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv – auf seinem Dachboden lagerte der Besteckkasten.
Gellers Geschichte ha e als glänzende Erfolgsstory begonnen: Es war der ra sante Aufstieg aus einem ultraortho doxen Milieu im hintersten Winkel der galizischen Provinz, von wo Lem berg schon als Tor zur Welt erschien, in die Assimilierung hinauf zu Wiens feinster Gesellscha .
Nuancenreich beschreibt Kupfer berg den reizvollen, aber nicht ma kellosen Vorfahren, schildert einfühl sam weitere Familienmitglieder wie eben den Großvater Walter, der sein jugendliches Leben in Wien mit un zähligen Fotos dokumentiert hat te, oder den (erfundenen) Schneider Goldfarb. So entsteht ein Sittenbild der Wiener Gesellscha um 1930, zwischen Kanzlei und Salon, Kaf feehaus und Theater. Die scheinba re Idylle wird abrupt beendet durch die Gräuel der Nationalsozialisten in einer Zeit, in der der aufgehetzte Pö bel eine solche Fortune nicht erträgt.
Dort, wo der Autorin Fakten feh len, bedient sie sich ausschmückend der Fantasie. Damit changiert der Text zwischen Dokumentation und Fiktion. Das klappt über weite Stre cken gut, geht aber zuweilen auch da neben: etwa wenn ein Gauleiter (!) des 20. Bezirks au aucht. Oder wenn am Grab des Urgroßonkels ein Reh erscheint und Kupferberg schreibt, Reh und Fuchs würden einander hier gute Nacht sagen – auf dem Zent ralfriedhof wurde früher gejagt, da her löst dies Assoziationen zu den Judenverfolgungen aus. Aber: „Wich tiger sind die Geschichten, die über lebt haben. Und weitererzählt wer den.“ Deren gibt es sicherlich noch einige auf dem Dachboden.
THOMAS LEITNERAndreas Isenschmid: Der Elefant im Raum. Proust und das Jüdische. Hanser, 240 S., € 26,80

Erfolgreiches Rechtsstudium und geschickte Geschä stätigkeit als Hee reslieferant machten Geller zu einem der wenigen Gewinner nach dem Ers ten Weltkrieg. Seinen Reichtum trug er öffentlich zur Schau, der Salon in der von Baron Rothschild gemieteten Beletage in der vornehmen Canova gasse gleich hinter dem Musikverein wurde zu einer gefragten Adresse. Die Bibliothek legte Zeugnis von äußers
Shelly Kupfer berg: Isidor. Ein jüdisches Leben. Diogenes, 256 S., € 24,70

Verlässliche Reiseleiter führen uns si cher durch Bergwelten und Großstadt dschungel, bewahren uns vor Irrwegen und Fettnäpfchen. Ian Mortimer ist so einer. Er weiß etwa, wie man am komfortabelsten durch das Land kommt (auf keinen Fall oben auf der Postkutsche), welche Kleidung angemessen ist (schlicht, wenn Sie die Wer te der Französischen Revolution vertreten) und was man vermeiden sollte, um nicht an einer Blutvergi ung zu sterben (unvorsich tig die Zehennägel schneiden). Sein Wissen stellt er nun Zeitreisenden ins England um 1800 zur Verfügung.
Das sogenannte Regency ist nicht die erste Epoche, in die der britische Histori ker und Autor einlädt. Auch zu Shakes peares elisabethanischem England und dem Mittelalter hat er bereits – sehr erfolgreich – Anleitungen für das Sehen, Hören, Rie chen und Schmecken der Vergangenheit ver fasst. Denn „wir dürfen nicht einfach vom Ufer aus auf den Fluss der Zeit schauen. Wir müssen hineinspringen und ganz ein tauchen.“ Abenteuerlust sollte man für eine Reise mit Mortimer also mitbringen.
Mit seinem neuen Buch „Im Rausch des Ver gnügens“ führt er auf fast 500 Seiten äu ßerst detailreich durch scheinbar wi dersprüchliche Entwicklungen und eine zerrissene Gesellscha : Die Französische Revolution und Aberglaube, Industrialisie rung und Romantik prägen die Jahrzehnte
von 1789 bis 1830 in Mortimers Beschrei bung gleichermaßen. Zentrale Begriffe wie Privilegien und Armut unterfüttert er mit Unmengen von Quellen, Daten und Fak ten. Das kann überfordern.
Doch Mortimer, der unter dem Pseudonym James Forrester auch historische Romane verfasst, schreibt höchst unterhaltsam. Das Mitglied der Royal Historical Society reiht Beispiele und Anekdoten aneinander und ist überzeugt: „Wenn man als Historiker ein Dokument als die höchste wissbare Wahr heit betrachtet, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, sich vorzustellen, was die Menschen zum Weinen, Schreien und Be ten brachte, dann ist das einfach eine aka demische Übung.“

Bei allem Wissen über die Werte und Standards des Regency urteilt Mortimer be wusst aus der Perspektive eines Menschen des 21. Jahrhunderts. Sklavenhalter und Kolonialisten zählen für ihn „heute ganz sicher nicht mehr zu den Guten“ – auch wenn ihnen vor 200 Jahren Denkmäler er richtet wurden.
Nur weil Stein und Bronze besser al tern als Werte, will Mortimer nicht zum „schweigenden Unterstützer der Unterdrü ckung“ werden. Seine spezielle Verantwor tung als Historiker sieht er darin, Vergan genheit und Gegenwart zu verbinden „und zu entdecken, dass sie die gleiche Lebens fülle besitzen“.
Deshalb bietet Reiseführer Mortimer Sightsmelling zum Sightseeing: Die Lesen den riechen die „Eingeweide, die Schuppen und das Blut“, die Londons Fischmarkt in Billingsgate sein „markantes Aroma“ ver leihen. „Der Geruch der Kohlefeuer, dazu beißender Rauch und Nebel“ ziehen ihnen in die Nase. Es rattern die Webstühle, ru fen die Lumpensammler und manchmal hört man Löwengebrüll aus der königli chen Menagerie. In der Rotunde von Ra nelagh wird derweil ein Ball gegeben, auf dem die schönsten Frauen Londons „vor beisegeln wie Schwäne“.
Die Reise mit Mortimer ist kein Spazier gang. Es ist ein Rasen durch Landstriche und Städte, durch Jahrzehnte und sozia le Schichten. Der Weg führt vorbei an den festlich beleuchteten Stadthäusern der auf strebenden Küstenorte Bath und Brighton über Londoner Parks, in denen sich Gent lemen im Morgengrauen duellieren, bis in die dunklen Hinterhäuser Liverpools. Le send erlebt man das Regency als Zeit, in der Dampfmaschinen Arbeiter ersetzen, Besit zende reicher werden und jene, „die nichts als ihre Arbeitskra anzubieten haben“, är mer. Hier rückt die Gegenwart unerwartet nah an das „Zeitalter der Eleganz und der Gewalt“, in dem sich die Fabriken, das Was serklosett und Unterhosen auch für ehrba re Frauen durchgesetzt haben.
FELICE GALLÉWissenscha : 15 Jahre Science Busters: Österreichs erfolgreichste Wissenscha serklärer über Bühnenshows und Jubelbuch
Im November 2007 schrieb ich für den Falter die Kritik der ersten Bühnenshow der Science Busters: „Kabarettist Mar tin Puntigam führt als Moderator durch den Abend, die Physiker Heinz Oberhum mer und Werner Gruber geben die leicht schrulligen Experten. Das hat schon sei nen Unterhaltungswert, mitunter aber auch seine Längen.“ Ob sich die Wissenscha s kommunikation in Österreich durch selbst gebastelte Raketen und das Abbrennen von Teebeuteln verbessern ließe? „In zehn Jah ren wissen wir mehr“, schrieb ich.
Jetzt sind es 15 Jahre geworden, aber die Antwort fällt eindeutig aus. Aus den Sci ence Busters (SB) ist eine erfolgreiche Mar ke geworden, die auch in Deutschland und der Schweiz die Hallen füllt. Neben den mittlerweile über 50 Bühnenshows sind die fidelen Wissenscha serklärer längst auch im Radio und Fernsehen aktiv.
Insofern haben die SB allen Grund, ein „Jubelbuch“ zu veröffentlichen. Ihr sechstes Opus ist eine Chronik. Jedes Jahr beginnt mit relevanten oder auch skurrilen Wissen scha s-News, danach werden Themen wie HPV-Viren, dunkle Materie, schwarze Lö cher, künstliche Intelligenz und natürlich ansteckende Krankheiten abgehandelt. Das mit Blockchain und den Kryptowährungen und warum das Unmengen an Energie kos tet, verstehe ich nun in der Tat besser. Und unsere Milchstraße mit ihren 200 Milliar den Sternen stelle ich mir jetzt als Zimt schnecke vor.
Routiniert nutzen die SB den Werkzeugkas ten der Wissenscha svermittlung: anschau liche Vergleiche, am besten aus dem Alltag, Antizipieren von Leserfragen, Fachbegrif fe sofort erklären, Verzicht auf Mathema tik und beständige Witzeleien. Der Humor fällt mal subtiler aus – und mal weniger. Augenzwinkernd werden auch „Small-TalkHilfen“ geliefert, um Mitmenschen zu er heitern oder zu beeindrucken.
All das ist im schwungvollen SB-Duk tus verfasst, der Wiedererkennungswert hat,
INTERVIEW: OLIVER
genauso wie die skurril-lustigen Titel der Bühnenprogramme (das erste hieß: „Im Weltall gibt es keine Bohnen“) und Bü cher wie „Warum landen Asteroiden im mer in Kratern?“. Der satzlange JubelbuchTitel könnte auch das Motto der SB sein: „Wissenscha ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt“.
Aber auch Selbstkritik wird geübt. So äußerten die SB 2009 noch Skepsis, ob das mit der Erderwärmung nicht etwas übertrieben sei. Mittlerweile ist der men schengemachte Klimawandel ein Dauerthe ma der Shows und auch des Buchs. „Heu te würden wir vermutlich nicht mehr auf die Bühne gehen und arglos ein Hochfest des Schweinsbratens zelebrieren“, hat doch „Fleischkonsum keinen geringen Anteil am Klimawandel“. Das Originalrezept von Wer ner Gruber ist dennoch abgedruckt.
Am Ende jedes Kapiteljahrs erzählen die SB auch ihre eigene Geschichte: ihre be eindruckend lange Liste an Ehrungen (so wohl Kabarett- als auch Kommunikations preise), kleine und große Bühnendesaster – und wie sich die „schärfste Science Boy group der Milchstraße“ in die Kelly Family der Wissenscha verwandelte. Heinz Ober hummer verstarb im November 2015 un erwartet, Werner Gruber zog sich zur sel ben Zeit aus gesundheitlichen Gründen zurück. Mittlerweile besteht das Ensemb le aus neun Personen, darunter auch der Astronom und Science-Blogger Florian Freistetter. Im Interview mit ihm und dem Gründungsmitglied Martin Puntigam (dem „Master of Ceremony“, MC, Bühnenoutfit hautenges rosa Leiberl) geht es um das Er folgsgeheimnis der SB und was sich dar aus für die Wissenscha skommunikation in Österreich lernen ließe.
weiterhin auf den letzten Plätzen. War Ihre Au lärungsmission in den letzten 15 Jahren wirkungslos?
Martin Puntigam: Zum einen: Wir Science Busters sind weder eine staatstragende Ak tion noch ein Rationalismusexporteur. Wir sind ein Liveshowprojekt und werden über Zuschauerzahlen evaluiert, nicht über das Eurobarometer. Zum anderen: Wenn man in einem Land wie Österreich lebt, in dem so absurde Dinge geglaubt werden, wie dass ein unsichtbarer Herrgott seinen Sohn zur Erlösung auf die Erde schickt, dann dauert das halt. Wir bilden uns ja nicht wenig auf uns ein, aber es wäre vermessen zu glauben, dass man hierzulande in ein paar Jahren eine fundamentale Änderung in der Ein stellung zur Wissenscha erreichen könne.
Florian Freiste er: Wenn man Wissen ver mitteln möchte, lautet die Frage, worauf man den Fokus legt. Bei einem öffentlichen Vortrag an der Uni liegt dieser auf der Wis senscha . Bei den Science Busters ist der Fokus ein anderer. Wenn die Zuschauer am Ende denken: „Das war ein cooler Abend“, dann ist das ein Erfolg. Wenn sie außer dem noch etwas über Wissenscha gelernt haben – gut. Jedenfalls haben sie gesehen, dass es Spaß machen kann, sich mit As tronomie oder Biomedizin zu beschä igen. Das ist unser grundlegendes Ziel.
Puntigam: Ich war als Ministrant vom Hoch amt beeindruckt. Nur gibt es in der Messe keine Ironie und keine Witze. Aber wenn man die Hierarchie umdreht, wird der Mi nistrant zum Master of Ceremony und die Hohepriester, die Wissenscha ler, zu CoZelebranten. Ich bin als MC mit dem Publi kum verbündet. Die beiden Wissenscha ler müssen sich Mühe geben, dass ich es be greife – und dann können es alle verstehen.
Science Busters. Wissenscha ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Hanser, 336 S., € 27,80

Falter: Der Wissenscha sminister lobt die Science Busters, sie spielen vor ausverkau en Hallen. Und dennoch liegt Österreich laut Eurobarometer-Umfrage in puncto Wissenscha sverständnis und -akzeptanz im europäischen Vergleich
Puntigam: Ja. In der katholischen Tradition gibt es Gabenbereitung und Kommunion, weil diese Reihenfolge dramaturgisch gut ist. Leute erst belehren, dann gibt es was zu essen und am Ende den Segen.

Belehren? In der Einleitung Ihres neuen Buchs fragen Sie selbst, ob Ihre Shows nicht bloßer Frontalunterricht seien.
Freiste er: Das ist das grundlegende Di lemma einer Bühne: Sie trennt Darsteller vom Publikum. Beim Theater ist das kein Problem, aber wer Wissenscha kommu nizieren möchte, sollte nicht ins Dozieren verfallen. „Hört gut zu, dann seid ihr ge scheiter als vorher.“ Wir haben uns also ge fragt, wie man das Publikum besser einbe ziehen könnte.
Puntigam: Wir machen nicht diese Foren, wie sie nach Vorträgen üblich sind, wo das Mikrofon herumgeht und die Leute sich wieder nichts zu sagen trauen. Wir schauen eh schon komisch aus, machen Witze über uns und bleiben auf Augenhöhe mit dem Publikum. Und wenn alles gutgeht, duf tet es am Ende der Show und es gibt gratis was zu essen oder zu trinken. Dann kann der Zuschauer mit uns übers Essen reden, übers Wetter und dann übers Leiberl.
Puntigam: Werner Gruber hat Wiener Schnitzel und Gulasch gekocht. Helmut Jungwirth hat Laugengebäck zubereitet, Florian das Bier kalt destilliert. Bei der Jubi läumssendung wird es einen SB-Gin geben. Freiste er: Ich werde ja als Astronom vorge stellt und bastle auf der Bühne einen kos mischen Cocktail. Am Ende haben wir alle ein Glas in der Hand und die Leute fragen, was sie schon immer mal von einem Astro nomen wissen wollten. Wir reden nach der Show immer noch 15 Minuten oder sogar länger mit dem Publikum.
Puntigam: Ich finde es das fadeste Kabarett, wenn die, die drinnen sitzen, alle meinen, die Bösen und Blöden seien alle draußen.
In Österreich findet man im Publikum des Kabaretts ein buntes Spektrum. Vorige Wo che hat uns eine Frau als Knechte der Phar ma-Lobby beschimp – wir hatten gezeigt, was die endlose Verdünnung der Wirkstoffe in der Homöopathie bedeutet, sie aber hat te mit Homöopathie gute Erfahrungen ge macht. Wir erreichen also nicht nur Gläubi ge, die zu uns in den Gottesdienst kommen, um zu hören, was sie eh schon wissen.
Geht die Kommunikation auch über die Show hinaus?
»Ich bin als Master of Ceremony mit dem Publikum verbündet. Die beiden Wissen scha er müssen sich Mühe geben, dass ich es begreife
MARTIN PUNTIGAM

Freiste er: Ja, zum Beispiel unsere Show „Global Warming Party“. Da zeigen wir mit rot gefärbtem Wasser, wie viel CO2 Men schen im Laufe der Geschichte in die At mosphäre reingegeben haben. Und wie we nig Spielraum uns bleibt, um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen. Wir bekom men E-Mails etwa von Lehrern, die genau wissen wollen, wie viel Wasser und wel che Gefäße man für einen Nachbau in der Schule braucht.

Puntigam: Weil man mit uns einfach kom munizieren kann, kriegen wir auch viele Fragen von Menschen. Sie glauben, dass wir es so erklären können, dass sie es ver stehen. Das haben wir nach 15 Jahren zu mindest erreicht.
Freiste er: Man will die Wissenscha an die Öffentlichkeit kommunizieren. Das eine ist aber genau so divers wie das andere. Man che Leute mögen kein Kabarett. Es nützt also nichts, wenn nun die gesamte Wissen scha skommunikation auf lustig getrimmt wird. Es geht nicht darum, noch mehr Ka barettisten mit rosa Leiberln anzuschaffen, sondern möglichst viele Kanäle abzudecken und auch auszuprobieren.
In Österreich gibt es Tage der offenen Tür, die Lange Nacht der Forschung ... Freiste er: Alles wunderbar. Wichtig aber wären Konzepte für jene Menschen, die noch nicht wissen, dass sie sich für Wis senscha interessieren. Zum Beispiel im Wirtshaus: „Science in the Pub“. Wir pro bieren die Vielfalt im Kleinen. Uns gibt es nicht nur als Bühnenshow, sondern auch als Buch, Podcast, Radioshow und im Fern sehen. Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit, die Wissenscha skommu nikation in Österreich alleine zu stemmen. Je mehr das machen, desto besser für alle.
Die Wissenscha sforscherin Helga Nowotny fordert, dass die Wissenscha skommunikation auch zeigen sollte, wie Forschung betrieben wird und wie Forschende zu ihren Ergebnissen kommen. Können die SB auch den Alltag, die Leiden und Freuden der Wissenscha lerInnen vermitteln?
Freiste er: Wir vermitteln in einer Show nicht nur Inhalte. Wenn es die Geschichte hergibt, kommen auch die Menschen vor,


die das erforscht haben. Einstein auf dem Oktoberfest ist so ein Beispiel. Auch wir stehen als Privatpersonen auf der Bühne. Kommt ein neues Ensemblemitglied dazu, stellen wir das mit Fotos aus der Kindheit und dem Studium vor. Je unschmeichelhaf ter die Bilder und Anekdoten für uns sind, desto wahrscheinlicher, dass wir sie auf der Bühne zeigen. Menschen wollen sich was über Menschen anhören.
Puntigam: Ab und zu erzählen wir über die Mechanismen der Wissenscha . Beispiel Autismuslüge: also die irrige Behauptung, dass die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln Autismus auslöse. Elisabeth Oberzaucher hat in einer Fernsehsendung und auf der Bühne erklärt, wie diese Studie im angesehenen Medizinjournal The Lancet erscheinen konnte. Und warum es so lange dauerte, bis die fehlerha e Publikation zu rückgezogen wurde. In der Pandemie konn ten wir in unserer FM4-Kolumnen-Serie er klären, wie aus einer Studie eine publizierte Studie wird, was Preprints und Peer Re views sind. Viele dieser Begriffe hatten die Menschen vorher noch nie gehört.
Die SB starteten als Boygroup, das aktuelle Hauptprogramm machen drei Männer. Tradiert das nicht ein überkommenes Bild von männlicher Naturwissenscha ? Puntigam: Das hat sich so ergeben, zu Be ginn mit mir und zwei Physikern. Wie die Wissenscha ist auch das Kabarett eher eine männliche Angelegenheit. Das ändert sich leider nur langsam. Mittlerweile sind wir neun Ensemblemitglieder, darunter drei Wissenscha erinnen. Dass derzeit das Kernensemble aus drei Männern besteht, also ich, Florian und Martin Moder, hat auch berufspraktische Gründe. Alle anderen haben eine Praxis oder lehren an der Uni. Die müssten Überstunden schinden und ihren Urlaub au rauchen, um auf Tour zu gehen, während wir drei selbstständig sind. Freiste er: Möglicherweise sind Wissen scha erinnen in der Öffentlichkeit etwas zurückhaltender. Bedenken Sie, was der deutsche Virologe Christian Drosten in der Covid-Debatte alles an Beleidigungen ertra gen musste. Die Frauen würden dann noch zusätzlich den Sexismus abkriegen. Aber in den nächsten 15 Jahren wird sich das SBEnsemble sicher noch wandeln. F
Physik:






Z u Beginn seines Buchs erinnert sich Guido Tonelli an seinen Großvater Emilio: wie dieser einst auf seinem kleinen Ackerstück nahe Florenz in Lo Scasso gerade am Um graben war, als früh am Morgen das Licht plötzlich schwächer und es dun kel wurde. Sein Opa sei auf die Knie gesunken, in Tränen ausgebrochen und habe gebetet. „Das ist das Ende der Welt“, dachte er. Wie vielen Men schen vor und auch nach ihm war ihm nicht bewusst gewesen, dass es so et was wie eine Sonnenfinsternis gibt.
Dieses sehr spezielle Naturphäno men, lernen wir heute in der Schule, können wir beobachten, falls wir uns bei Neumond im Kernschatten des Mondes befinden, wenn der auf sei ner Umlau ahn über uns gerade die Sonne verdeckt. Tonelli verwendet die Sonnenfinsternis als Einstieg in sei ne sehr inhaltsreiche Schilderung des Phänomens „Zeit“.
Der 1950 in einer kleinen Gemein de der Toskana geborene Guido Ton elli studierte und lehrte an der Uni versität von Pisa Physik, er war am Auf- und Ausbau des 2008 in Betrieb genommenen Teilchenbeschleuni gers Large Hadron Collider am Gen fer Forschungsinstitut Cern beteiligt. 2012 erhielt er zusammen mit der CMS Collaboration, die Mitglieder der Teilchenphysik-Community aus der ganzen Welt zusammenbringt, den Special Fundamental Physics Pri ze für die Entdeckung des Higgs-Bo sons, einem zentralen Baustein des Standardmodells der Teilchenphysik.
Als Autor allgemein verständli cher Bücher bekannt wurde der ita lienische Professor 2020 mit „Die
Geschichte des Universums in sie ben Tagen“. Jetzt nimmt er uns in „Chronos“ auf eine Reise zu den Ur sprüngen der Zeit mit. Dabei dient ihm als Metapher der Gott desselben Namens, der in der griechischen My thologie als Personifizierung der Zeit galt. Schon in der Antike wurde er o mit dem Titanen Kronos gleich gesetzt, dem Sohn des Uranos und der Gaia, der die eigenen Kinder fraß. Tonelli diskutiert, ob wir das un au altsame Voranschreiten der Zeit jemals zum Stillstand bringen kön nen, ob sich der sogenannte Zeitpfeil umdrehen lässt und ob die Zeit tat sächlich eine eigene Existenz hat –oder ob sie lediglich eine gewaltige Illusion ist.


Altersforschung: Weit über 100 Lebensjahre müssten bald drin sein, so die Biochemikerin Renée Schroeder
Um zu zeigen, wie weit wir auf dem Weg zur ewigen Jugend bereits sind, wir Renée Schroeder einen Blick auf die Entwicklungskur ve der Weltbevölkerung, die im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderts auf ein mal steil nach oben zeigt. Warum? Weil wir uns seit der Au lärung wis senscha licher Methoden bedienen, um die Gesundheit zu erhalten. Da mit haben wir unsere Lebenserwar tung in vielen Weltgegenden allein in den letzten 100 Jahren verdoppelt.
Die biochemischen Bausteine, die es braucht, um die Wirkung der Wun dermittel zu verstehen, erklärt sie knapp und klar, darunter auch die in den Pandemiejahren weit ö er zitierte als verstandene messenger-RNA oder die polymerase chain reaction (PCR).
Um in den Kern solcher Fragen vorzustoßen, vollzieht Guido Tonelli nach, wie unser Zeitsinn entstanden ist, und untersucht, wie sich Zeit für die materiellen Objekte um uns her um darstellt. Chronos zu stürzen sei ein immer wiederkehrender Traum der Menschheit, hält er fest und fragt: „Können wir uns von der Herrscha des Chronos jemals befreien?“ War um diese Antwort offen bleibt, erklärt er in seinem Buch lebendig und gut verständlich.
ANDRÉ BEHRFür ihren Beitrag dazu, insbeson dere die Erforschung der Ribonuk leinsäure, wurde Schroeder vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Witt genstein-Preis und als Wissenscha lerin des Jahres. Zweimal wurden ihre Werke zum österreichischen Wissen scha sbuch des Jahres gewählt (2012 und 2017). In Zukun werde die Le benserwartung noch weit rascher stei gen, meint sie. Die exponentiell an wachsenden Erkenntnisse über die zellulären Mechanismen von Alte rungsprozessen könnten uns Werk zeuge für ein Mehrfaches an gesun den Jahren bringen. Schroeder spricht sogar von zukün igen Möglichkeiten, „die Biotechnologie so einzusetzen, dass wir nicht mehr altern“. Wobei sie ergänzt, dass die titelgebende „Un sterblichkeit“ dennoch Utopie bliebe.


Als Instrumente stellt sie Nah rungsmittel, die spezielle Enzyme ak tivieren, eine noch nicht zugelassene „Verjüngungsdroge“ oder das bereits heute erhältliche Nicotinamid-Ribo sid auf eine Stufe mit Anti-AlterungsHausmitteln: Genuss, Bewegung, Fasten und „das Leben genießen und nicht aufs Ausatmen vergessen“.
Schroeders schlankes Werk macht dem Namen der von Hannes An drosch editierten Reihe, in der es er schienen ist, Ehre: „Auf dem Punkt“. Die Großmeisterin der kleinen Le bensbausteine schafft hier vor den Augen der Leser ein präzises Modell der Steuerung von Alterungsprozes sen. Was zunächst gewagt erscheint, wird logisch schlüssig dargelegt. Gegenthesen allerdings finden kei nen Platz. Wie die Autorin ihre klei ne Utopie gegen fachliche Kritik ver teidigen würde und wie haltbar sie dann erscheint, bleibt allen, die nicht vom Fach sind, verborgen.

Das Beste, was man dem Buch wünschen kann, ist, dass es auch von jenen gelesen wird, die in ähnlich kla ren Worten antworten können. Dann gäbe es den Au akt zu einem Diskurs über Möglichkeiten und Machbarkeit einer langlebigeren, sorgen- und fal tenfreieren Menschheit von morgen.
ANDREAS KREMLAJürgen Renn, 66, ist ein international bestens vernetzter Wissenscha shisto riker, der als Gründungsdirektor und Wis senscha liches Mitglied seit 1994 mit dem Max Planck Institut für Wissenscha sge schichte in Berlin verbunden ist. Als Phy siker und promovierter Mathematiker war er von 1986 bis 1992 auch Mitherausgeber der „Collected Papers of Albert Einstein“, ein Mammut-Projekt der Princeton Univer sity Press, das mehr als 30.000 Dokumente verarbeiten will und bereits bei Band 16 an gelangt ist. Damit ist das vielfältige Schaf fen des 1955 verstorbenen Genies allerdings erst bis zum Jahr 1929 aufgearbeitet.
Auch Renns eigene Publikationslis te ist beeindruckend lang und thematisch vielschichtig. In seinem jüngsten, großzü gig bebilderten Werk holt er nochmals mit großem Schwung aus. Er beschreibt nicht weniger als „die Zeitspanne von den Ur sprüngen des menschlichen Denkens bis zu den aktuellen Herausforderungen des Anth ropozäns“. Bei diesen Reflexionen über „das vom Menschen geprägte Zeitalter der Erd geschichte“, wie der Duden das Fremdwort übersetzt, fächert er in 17 Kapiteln die ge samte Wissenscha s- und Technikgeschich te der Menschheit auf: von der Erfindung der Schri über die wissenscha liche Re volution der Neuzeit bis zur Industrialisie rung und Digitalisierung.
Konkret verknüp Renn in seinem über 1000 Seiten starken Werk „vielfältige historische und geografische Horizonte“ miteinander. Im Unterschied zum traditionellen Ansatz, die Geschichte von Wissenscha und Tech nologie anhand der jeweiligen Innovatio nen zu erzählen, richtet er das Augenmerk mehr auf die Weitergabe des Wissens. Viel fach, schreibt er, sei es gerade das weniger spektakuläre Wissen wie etwa über Optik gewesen, das zu den gefeierten Entdeckun gen und Erfindungen geführt habe.
„Dieses Wissen“, schreibt Renn, „zeigt teilweise eine verblüffende Stabilität und Haltbarkeit, und zwar nicht selten über gro
ße Zeiträume mit Phasen grundlegender Umwälzungen hinweg. In ähnlicher Weise haben seit den Anfängen der menschlichen Kultur der interkulturelle Wissenstransfer und die damit einhergehende Transforma tion dieses Wissens die technologischen und wissenscha lichen Errungenscha en geprägt.“

Um ihren Ansatz verständlich vermit teln zu können, haben sich Renn und sein Team an der Biologie orientiert. Dort wer den allgemeine Muster gerne anhand eines Modellorganismus erläutert, beispielswei se an der Drosophila melanogaster, einer Art aus der Familie der Taufliegen. An ih nen wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Wirkung von Inzucht studiert. Man be obachtete die Effekte, die nach Kreuzung in Inzuchtlinien au raten. Unter anderem erhielt man dadurch wichtige Erkennt nisse über die Anordnung von Genen in Chromosomen.

Gegliedert ist Renns „Neubestimmung der Wissenscha “ in fünf Teile. Im ersten dis kutiert der Autor, was Wissenscha und was Wissen ist. Im zweiten lernen wir, wie sich Wissensstrukturen wandeln, im drit ten, wie diese die Gesellscha beeinflussen. Danach führt er aus, wie sich Wissen ver breitet, um im fün en Teil festzuhalten, von welchem Wissen unsere Zukun abhängt.



Zu beachten ist, dass Wissenscha nicht von sich aus eine treibende Kra war, son dern wissenscha liche Praktiken über die längste Zeit der Menschheitsgeschichte von zufälligen äußeren Umständen abhing, etwa der Förderung durch Mäzene.
„Erst durch die kapitalistische Produk tionsweise“, schreibt Renn, „wurde die Wissenscha zu einem wichtigen Produk tionsfaktor. Im Laufe der industriellen Re volution wurden Wissenscha und Tech nologie mit weitreichenden Folgen für den gesamten Planeten in die expansive Dyna mik der kapitalistischen Wirtscha einge bunden. Aber im Verlauf dieses Prozesses und wegen seiner Auswirkungen auf den
»„Dieses Wissen zeigt teilweise eine verblüff ende Stabilität und Haltbarkeit, und zwar nicht selten über große Zeit räume mit Phasen grundlegender Umwälzungen hinweg“
ganzen Planeten haben sich Wissenscha und Technologie von Randbedingungen der wirtscha lichen Entwicklung zu unabding baren Faktoren der kulturellen Evolution gewandelt, unabhängig davon, auf welcher Wirtscha s- oder Gesellscha sorganisation diese in Zukun beruhen wird.“

Weiteren Hinweisen für den „Beginn eines neuen Evolutionsprozesses jenseits der kulturellen Evolution“ spürt Renn in den letzten Kapiteln nach. „So wie die Evo lution des Lebens“, schreibt er, „hat auch die Wissensentwicklung eine Richtung, ohne global einheitlich zu verlaufen. Sie ist we der deterministisch noch teleologisch.“ Zu fallsereignisse, die in den Prozess der Wis sensentwicklung integriert werden, können langfristige Auswirkungen haben.




Angesichts aller aktuellen globalen Her ausforderungen, die zu bewältigen sind, rät der Wissenscha er, sollten wir „lokale Per spektiven einbeziehen und neue Wege fin den, um problemorientierte Forschung mit der Lehre und dem Lernen innerhalb und außerhalb der Wissenscha zu verbinden. Bürgerscha liches Engagement und Zivil courage werden in den uns unvermeidlich bevorstehenden globalen Transformations prozessen ebenfalls eine unverzichtbare Rolle spielen.“
Jürgen Renn: Die Evolution des Wissens. Eine Neu bestimmung der Wissenscha für das Anthropozän. Suhrkamp, 1072 S., € 47,30

im Übergang vom industriellen zum kybernetischen Zeitalter. Wie die Wirtschaftshistorikerin Andrea Komlosy in
Eine derart komplexe Herausforderung zu meistern, fasst der Autor zusammen, „er fordert eine Entwicklung neuer Curricu la und Forschungsagenden, die Verzah nung multipler Wissensdimensionen und die kritische Auseinandersetzung mit der Verflechtung von Wissen mit politischen, ökonomischen und moralischen Fragestel lungen“. Eine Mammutaufgabe, die ein Zusammenspiel von Gesellscha , Wissen scha und Politik verlangt.

Eine Mammutaufgabe ist auch das Le sen von Jürgen Renns Buch. Sie anzugehen lohnt sich, denn derart geistig anregend und umfassend ist die Komplexität des Anth ropozäns wohl kaum je analysiert und be schrieben worden.

ANDRÉ BEHR
Buch erläutert, korrespondiert dieser Übergang mit
Wachstumszyklus der Öko-
und Schnittstellen zwischen
Maschine geprägt ist.
JÜRGEN RENN
Primatenforschung: Was wir von Schimpansen und Bonobos über Gender, Sex und Erziehung lernen können
Donna war anders. Sie rau e ger ne mit dem Alphamännchen, sah aufgrund ihres dichteren Fells „männ licher“ als ein typisches Schimpan senweibchen aus. Die Männchen zeigten nur wenig Interesse an ihr, Mutter wurde sie nie. Kurz: Ihre Ge schlechtsidentität war uneindeutig. Frans de Waal beobachtete Donna über Jahre hinweg, sie ließ sich ger ne von ihm kitzeln.
Sein neues Buch „Der Unter schied“ ist voller Geschichten, die so manche Gewissheit in Frage stel len. Etwa dass es non-binäre Ge schlechter nur beim Menschen gäbe. De Waal ist dank seiner populärwis senscha lichen Bestseller einer der bekanntesten Primatologen welt weit. Er beschrieb eindrucksvoll die uns am nächsten verwandten Prima ten: machiavellistische Schimpansen und Sex genießende Bonobos. Wel chen der in puncto Geschlechterhie rarchien grundverschiedenen Men schenaffen gleichen wir mehr? Bei den Schimpansen führt ein AlphaMännchen das Regime, die matriar chal organisierten Bonobos verbün den sich in „Schwesternscha en“, gegen die einzelne Männchen (auch wenn diese physisch stärker sind) nicht ankommen.

„Was wir von Primaten über Gen der lernen können“ verspricht der Untertitel. De Waals Argument lautet: Wenn wir die gravierenden Ungerech tigkeiten zwischen den Geschlechtern überwinden wollen, sollten wir unser evolutionäres Gepäck kennen. Immer wieder betont er: „Biologie lässt sich nicht leugnen.“ Dabei vertritt der er klärte Feminist aber gerade keinen plumpen Determinismus.
Beispiel Mu erverhalten: ein Produkt der Evolution, das aber in der sozialen Interaktion erst erlernt werden muss. Deswegen sei auch der Begriff „Mut terinstinkt“ irreführend. Natur und Kultur (nature and nurture) seien kei ne Gegensätze, sondern untrennbar miteinander verschlungen und aufei nander angewiesen.
Dass Männer und Frauen unter schiedlich seien, dass Burschen Fahr zeuge lieben und gerne raufen wür den, während Mädchen mit Puppen spielten und Mutterverhalten übten – das ist für de Waal ein Fakt. Ge schlechterspezifisches Verhalten fin de sich analog bei unzähligen Prima tenarten. Angewandt auf Erziehung hieße das: Kinder sollen sich ihre Spielsachen einfach selber aussu chen können.
De Waal richtet seinen Blick aber nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf unsere reduktionistische Wahrnehmung der Tiere. Haben die se Sex, ist das für uns ein „rein funk tionaler Vorgang“. Gerade Menschen
affen aber haben offensichtlich jede Menge Spaß am Kopulieren, Oralver kehr und Masturbation. Forscher hät ten viel zu lange nach „arttypischem“ Verhalten gesucht und viel zu wenig nach Abweichungen – wie etwa der transidenten Donna.
Biologie determiniert uns, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Unsere hormonelle und genetische Ausstattung ist flexibel. Schimpan senmänner spielen normalerwei se nie mit den Kleinen. Stirbt aber die Mutter, werden die Kleinen von einem Männchen „adoptiert“, das sich als erstaunlich guter Vater erweist.
Dazu streut de Waal auch noch die ein oder andere polemische Spitze ein. Homosexuelle Praktiken wurden bei hunderten von Tierarten nachgewie sen – aber keinerlei Homophobie! Al lerdings sei kaum eines dieser Tiere – Pinguine, Japanmakaken oder Gi raffen – „konsequent“ (also lebens lang) schwul. Das finde sich nur beim Menschen und bei Schafen.
So etwas wie Vergewaltigung gibt es im Tierreich hingegen nur sehr selten –und zwar aufgrund der strikten sozia len Kontrolle. Die lebenslange Paar bindung und damit die Kernfamilie gibt es nur beim Menschen, nicht bei anderen Menschenaffen. Gerade die den Blicken der anderen entzogene Hausgemeinscha werde hier für die Frau zur Gefahr.
„Der Unterschied“ ist ein großarti ges Buch, unterfüttert mit de Waals jahrzehntelangen Erfahrungen mit Menschenaffen und seiner profun den Kenntnis der zoologischen und psychologischen Forschung (und de ren gelegentlichen Irrwegen und ideo logischer Verblendung!). Es ist flüs sig geschrieben, klug abwägend, dabei durchaus streitbar, vor allem aber von einer tiefen Empathie für alle Pri maten durchzogen. Sein Plädoyer „Gleichstellung braucht keine Gleich heit“ ist zwar nicht neu, aber bestens untermauert. Auch ist das Buch einen Tick persönlicher als de Waals frühe re Werke. Er erzählt etwa von seiner Kindheit in den Nachkriegsniederlan den als vierter von sechs Brüdern. Die insgesamt sieben hochgewachsenen Männer überragten die einzige Frau um Haupteslänge. Das Sagen in der Familie de Waal aber hatte die Mut ter.
 OLIVER HOCHADEL
OLIVER HOCHADEL
Kulturgeschichte: 100 Alltagsgegenstände erzählen von Gemeinheiten und von Rebellion
Frauen und Objekte? Aber Frauen sind doch Objekte!“ Mit diesem Ausruf fiel ein alter Mann Annabel le Hirsch ins Wort, als sie von ihrer Buchidee berichtete. Das sprach umso mehr für das Projekt. Die Journalistin – sie hat Kunstgeschichte, Theater wissenscha und Philosophie studiert – erzählt mit klarer feministischer Haltung entlang von Gegenständen „history“ als „herstory“ und kämp dagegen an, dass Frauen selbst als Objekte gesehen werden.
Hirsch widmet sich Mythen, in die man Frauen seit jeher zu zwängen versuchte, und Alltagsgegenständen, die „dem Leisen, dem Übersehenen“ Bedeutung zukommen lassen. Diese Dinge entstammen dem privaten Be reich, „der lange als weiblich und so mit als unwichtig galt“. Das startet beim Oberschenkelknochen von vor circa 30.000 Jahren vor unserer Zeit rechnung und endet mit dem Pussy Hat 2017, in Reaktion auf Donald Trumps „Grab them by the pussy“Sager entstanden.
Der Fokus der chronologisch ge reihten, angenehm kurzen und an ekdotischen Texte liegt auf der Ge schichte der Frauen des Westens. Die Autorin arbeitet nicht nur für die Frankfurter Allgemeine, taz und Zeit online, sie übersetzt auch aus dem Französischen. Das erklärt den auf
eine Quittung aus dem Kau aus Au Bon Marché), ja sogar die Frau – konkret Hatschepsut – als „weib liche Pharao“; Hirschmann verwen det nicht den Begriff „Pharaonin“. In Aufzeichnungen heißt es „His Ma jesty, herself“ ebenso wie „die“ Pha rao, und Hatschepsut ließ sich ger ne als Mann mit Bärtchen am Kinn und einer entblößten flachen Brust porträtieren.
Unter Hatschepsuts Herrscha , so ler nen wir, erlebte Ägypten eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Sie för derte die Kunst und beau ragte eini ge der schönsten Bauwerke, etwa die Tempelanlage Deir el-Bahari. „His Majesty, herself“ ist ein Beispiel da für, dass weibliche Erfolge o igno riert werden, während weibliches Ver sagen übertrieben thematisiert wird (siehe das tragische Ende Kleopatras).
Die Autorin holt auch unter dem Teppich hervor, was der türkische Prä sident Recep Tayyip Erdoğan gerne verheimlicht: das „Sultanat der Frau en“ im Osmanischen Reich, zu dessen Zeit Frauen ein hohes Maß an Au torität erlangten. In ihrem Text über Zurschaustellung und Privatsphäre erläutert Hirschmann, welche Fragen die Romanautorin Elena Ferrante und die Selbstvermarkterin Kim Kardas hian verbinden.
Wir erfahren von der Vorform des Plateauschuhs, der Chopine, mit der Frauen im 16. Jahrhundert auf dem Markusplatz herumtaumelten, und dass die nahe Glasbläser-Insel Mu rano nicht nur für Deckenleuchten bekannt war, sondern auch für die Dildo-Produktion. Die Menstrua tionstasse gab es in Wahrheit schon in den 1930ern, die Hosentasche war wie das Frauenrecht eine Forde rung auf Suffragetten-Demos und mit Hutnadeln wehrte man ab, was heu te unter Catcalling fällt.
fällig umfassenden frankophilen Con tent etwa rund um die „Mères lyon naises“, herausragende Köchinnen lange vor Paul Bocuse.
Frans de Waal: Der Unterschied. Was wir von Primaten über Gender lernen können. Kle -Co a, 480 S., € 28,80
Manche Themen sind aufgelegt, etwa die Antibabypille. Oder Tupperware, die berühmt wurde, weil eine allein erziehende Mutter ihr Marketingta lent eingesetzt und Partys mit Bow le und belegten Brötchen veranstaltet hatte. Wie auch der kurze Essay über das Korsett: Ist es ein bestärkendes Kleidungsstück oder von Männern forcierte Einschränkung? Und wie ist das mit der Schreibmaschine, die den Frauen neue Jobs verschaffte?
Weiters geht es um die Frau als Sklavin, die Frau als heilbringendes Medium im Spiritismus, die Frau als Konsumentin (symbolisiert durch
Übrigens: Der frühere Direktor des British Museum, Neil MacGre gor, erzählte schon vor gut zehn Jah ren anhand von 100 Exponaten Welt geschichte in einem Buch. Annabelle Hirsch leistete nun eine wichtige Er gänzung, die endlich weibliche Errun genscha en in den Vordergrund rückt. Noch dazu kommt die geballte Zu sammenschau in appetitlichen Häpp chen daher. Gelungen!
JULIANE FISCHERAnnabelle Hirsch: Die Dinge. Eine Geschichte der Frauen in 100 Ob jekten. Kein&Aber, 416 S., € 32,90
»„Frauen und Objekte? Aber Frauen sind doch Objekte!“
EINE REAKTION AUF ANNA BELLE HIRSCHS BUCHIDEEYELIN/C. H. BECK
M an vergisst es inzwischen leicht, doch es ist noch nicht lange her, dass sich Comics außerhalb von eingeschworenen Fankreisen etabliert haben. Und zwar als Medium, das zu Recht Anspruch darauf er hebt, auch abseits von Mickey Mouse und Superheldentum Geschichten und Ge schichte erzählen zu können. Mittlerweile ist die Auswahl an gezeichneten Politrepor tagen, Biografien und Romangeschichten gewaltig. Unter dem Aufwertungsetikett Graphic Novel erlebt das Genre einen ech ten Höhenflug.
Als großer Durchbruch für die inter nationale Anerkennung von Comics gilt nach wie vor Art Spiegelmans bahnbre chender, zweiteiliger Schwarz-Weiß-Comic „Maus“ aus den Jahren um 1990, in dem der US-Zeichner die Erinnerungen seines Vaters an den Holocaust schilderte. „Maus“ war der erste Comic, der mit dem PulitzerPreis ausgezeichnet wurde. Das war von un schätzbarem Wert für das gesamte Medium.
Seither hat es international und auch im deutschsprachigen Raum zahlreiche weitere zeichnerische Annäherungen an den Zwei ten Weltkrieg, an Nationalsozialismus und Holocaust gegeben, die eindrücklich und auf sehr verschiedenartige Weise vor Augen führen, dass zeichnerische Geschichtsver mittlung einen besonderen Mehrwert dar stellt – künstlerisch und erzählerisch eben so wie in der Möglichkeit, ein anderes und neues Publikum für historische Inhalte zu interessieren.
Aus genau diesem Wunsch entstand auch die Idee zur Graphic Novel „Aber ich lebe“: Sie versammelt drei Comics in einem Band, die nach den Erinnerungen von vier Zeitzeugen entstanden sind, die alle als Kin der im Volksschulalter den Holocaust über lebt haben. Die Idee dazu stammt von der kanadischen Germanistin und HolocaustForscherin Charlotte Schallié, der es – als Mutter eines lesefaulen, aber Graphic-No vel-affinen 13-Jährigen – darum zu tun war, neue visuelle Ansätze für das Sammeln, Be
wahren und Verbreiten von Zeitzeugenbe richten zu fördern. Was sperrig klingt, hat durch die besonders enge Zusammenarbeit aller Beteiligten an diesem kanadisch-israe lisch-deutschen Gemeinscha sprojekt eine ganz spezielle und speziell gelungene Gra phic Novel werden lassen.
Die Überlebensgeschichten von Emmie Arbel, David Schaffer und dem Brüderpaar Nico und Rolf Kamp könnten nicht unter schiedlicher sein.
Die in Holland geborene Emmie Arbel, die der Münchner Comic-Zeichnerin Barbara Yelin ihre Geschichte erzählt hat, überlebte als kleines Mädchen zwei Konzentrations lager und lebt seit langem in Israel. Faszi nierend ist nicht nur, wie Barbara Yelin Em mie Arbels gleichermaßen bruchstückha e („Ich erinnere mich nicht“) wie drastische Erinnerungsbilder an ihre KZ-Zeit, an Hun ger und Gewalt oder an den miterlebten Tod ihrer Mutter in dunkel gehaltene Bildfol gen umsetzt, sondern auch, wie gelungen sie in ihren Bildern zwischen Emmie Ar bels Vergangenheit und ihrem heutigen is raelischen Alltag hin und her wechselt. So sehr Erzählgegenwart und erinnerte Vergan genheit auch kontrastieren, so sehr visua lisieren die bei Yelin vorherrschenden, o
Emmie Arbel im Jahr 1945 als Achtjährige, gezeichnet von Barbara Yelin. Arbel hat als kleines Mädchen zwei Konzentrationslager überlebt

verwaschenen und ineinander übergehen den Blau- und Grautöne die durchgehen de Prägung durch das Erlebte bis ins Heu te hinein.
Völlig anders ist der an naive, kindli che Wasserfarbenmalerei angelehnte Zei chenstil, den die israelische Comiczeich nerin Miriam Libicki für David Schaffers Odyssee gefunden hat: Libickis Figuren ha ben riesige, fragende Augen, in denen das ganze unerklärliche Entsetzen enthalten scheint, das David Schaffer als Kind erlebt hat. Gemeinsam mit seiner Familie wurde er aus der Bukowina vertrieben und wan derte völlig mittellos mehrere Jahre, vor al lem in den Wäldern Transnistriens, unter größten Gefahren und Entbehrungen zwi schen den Fronten umher.
Nicht weniger dramatisch, wenn auch völlig anders beschaffen ist die Geschichte des jü disch-holländischen Brüderpaares Nico und Rolf Kamp, die der israelische Zeichner Gi lad Seliktar auf stark stilisierte, reduzierte Weise unter Verwendung von nur vier Far ben – Schwarz, Grau, Ocker und Weiß –erzählt: Die Brüder wurden während der deutschen Besatzung an insgesamt 13 ver schiedenen Orten versteckt bzw. unter fal schen Namen untergebracht.
Barbara Yelin, Miriam Libicki, Gilad Seliktar. Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust. Nach den Erinnerungen von Emmie Arbel, David Scha ff er, Nico Kamp und Rolf Kamp. C.H. Beck, 178 S., € 25,75


Nicht nur die mitunter dramatisch ver laufenden Versteckwechsel überforderten die Buben, genauso tat es die Umstellung auf immer wieder neue Umgebungen. Dabei war jeweils nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben derer in Gefahr, die sie ver steckten. Gilad Seliktar, der es hier mit zwei Erzählern zu tun hat, glättet keineswegs den Umstand, dass sich die Erinnerungen der Brüder an das – vermeintlich parallel – Erlebte mitunter ziemlich unterscheiden. Was es in „Aber ich lebe“ insgesamt zu entdecken gibt, sind Erinnerungsstimmen und -bilder, die bisher noch nicht o zu hö ren oder zu sehen waren: nämlich die von Menschen, die den Holocaust als Kinder überlebt haben.
JULIA KOSPACHEin Führer durch die Literaturgeschichte der Stadt: vom Mittelalter bis hin zur jungen Poetry-Slam-Szene.
256 Seiten, € 24,90
Holocaust: Drei Zeichner:innen erzählen in der Graphic Novel „Aber ich lebe“ drei Geschichten von Kindern, die überlebten
Als Amartya Sen 1956, noch nicht einmal 23 Jahre alt und ohne Pro motion, von einer neuen Universität im indischen Kalkutta gebeten wur de, eine wirtscha swissenscha liche Fakultät au auen zu helfen, gab es Gegenwind. Mit viel Humor berich tet er in seiner Autobiografie mit dem treffenden Titel „Zu Hause in der Welt“ von einer in einer Studenten zeitschri veröffentlichten Karikatur, die zeigte, wie er aus der Wiege her ausgerissen und direkt zum Professor gemacht wurde.
Seine akademische Vita ist in der Tat imposant. 1933 in eine indische Ge lehrtendynastie geboren, war Amar tya Sen ein wissenscha liches Wun derkind. Im Rückblick scheint es, dass er, ausgehend von seiner westbenga lischen Heimat, fast mühelos an die renommiertesten Universitäten der Welt (Cambridge, Oxford, London School of Economics, Stanford, Har vard) gelangte. Dazwischen wirkte er acht Jahre an der Universität Delhi. Sein Spezialgebiet waren die Wirt scha swissenscha en, zu deren Wei terentwicklung er bedeutende Beiträge leistete. Für seine Bücher zur Wohl fahrtsökonomie und Sozialwahltheo rie wurde ihm 1998 der Nobelpreis für Wirtscha swissenscha en zu erkannt. Stets stand er quer zur etab lierten Ökonomie, hielt sich aus dem Streit zwischen Keynesianern und Neo-Klassikern heraus und ging eige ne Wege in seiner Beschä igung mit ökonomischer Ungleichheit, Armut und rationalen bzw. demokratischen Auswahlverfahren.
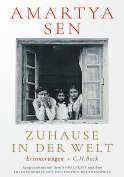
Der vierte Teil der Autobiografie gibt ausführlich Einblick in die aka demische Karriere, liefert (meist sehr freundliche) Porträts der ihn prägen den Scientific Community – das ist
wohl eher für einen kleineren Teil der Leserscha interessant. Für die Witt genstein-Gemeinde wird das schöne Charakterbild des italienischen Mar xisten Piero Sraffa von Bedeutung sein, weil dieser in Cambridge nicht nur die Wende zur Sprachphilosophie im Denken des großen Philosophen stark beeinflusste, sondern als „direc tor of studies“ auch die Formierung von Sens Denken.
Gerne hätte man nicht nur für diese Lebensphase mehr über Gefühle und Irritationen gelesen und etwas undip lomatischere Einblicke in das univer sitäre Hickhack als auch das Alltagsund Eheleben gelesen. Aber da lässt uns der nette Sen meist wenig rein schauen. Seine langjährige Gefähr tin Martha Nussbaum, eine bekannte Philosophin, kommt überhaupt nicht vor. Selbst in der Beschreibung sei ner Kindheit und Jugend fehlt Sen die psychologische Raffinesse. Umso mehr wirkt der soziologische Blick früh entwickelt.
Der weltgewandte Forscher hat bereits früher mit mehreren Büchern bewie sen, dass er gut und locker formulieren kann und die Fähigkeit besitzt, poli tische und soziale Fragen mit Witz und enormem Wissen anschaulich für eine breite Öffentlichkeit zu erörtern. Nicht zufällig wurde ihm 2020 der Friedenspreis des deutschen Buch handels überreicht. Die Autobiografie zeigt sich ebenso gut lesbar. Fast im Plauderton schreibt er über die Prä gungen der indischen Kindheit, über die so besondere Schule in Santinike tan (geleitet vom Schri steller Rabin drarath Tagore) und die Studienjahre in Kalkutta, die ihn in seinem Den ken und Forschen zu dem gemacht ha ben, wofür er heute in der Öffentlich keit steht.
O b Sport Mord ist, wie ein Win ston Churchill zugeschriebenes Zitat behauptet, sei dahingestellt. Mancher, wie Fußball, ist unbestrit ten Big Business, das Geschä damit wird täglich größer. Joshua Robinson und Jonathan Clegg, für den europäi schen Sport zuständige Korresponden ten des Wall Street Journal, sind also prädestiniert, dieses so aufgeblähte wie verwirrende Monstrum in Zeiten des Neoliberalismus zu untersuchen.

Sie tun dies in lebendiger und an schaulicher Weise, indem sie die bei den Aushängeschilder Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ins Zentrum stellen, noch eingehender aber die or ganisatorischen, medialen und finan ziellen Hintergründe des Profifußballs
durchleuchten. Wer sich also eine Ha giografie der Superstars erwartet, wie es der Titel vermuten lassen könnte, wird enttäuscht. Hingegen machen die Autoren die Krä e aus Politik und Wirtscha sichtbar, die auf den brei testen der Breitensportarten einwir ken, und gehen dem Zustandekom men öffentlicher Meinung nach.
So analysieren sie Phänomene wie das des Agenten, das sich erst seit 20 Jah ren so richtig entfaltet: Nicht nur ver schiebt er die Spieler von Klub zu Klub und von Land zu Land, er übernimmt auch die Rolle des Vermögensverwal ters und Finanzberaters. Da versteht man dann eine Gemeinsamkeit in der Vita der beiden Superstars: Glaubwür
Mit dem Buch „Die Identitätsfal le“ (Deutsch 2007) verwehrte sich Sen energisch dagegen, Philosophie, Reli gion oder Geschichte für einen Kampf der Kulturen zu vereinnahmen. Auch in der Autobiografie plädiert er mit Nachdruck für eine multiple Identität.
Noch immer meldet sich bei ihm der Schmerz, dass sich das große Indien 1948 unter dem Einfluss der politi schen Hassprediger in einen hinduisti schen Teil (Indien) und zwei muslimi sche Teile (West- und Ost-Pakistan) aufgespalten hat, mit dem „Kollate ralschaden“ von einer Million Toten und 15 Millionen Vertriebenen. Sen war nie bereit, diese Teilung zu ak zeptieren, und polemisiert gegen den gegenwärtigen Hindu-Nationalismus. In seiner Kindheit habe er erlebt, wie Hindus und Muslime einträchtig zu sammen- oder nebeneinanderlebten, von ganz anderen Sorgen geplagt.
Die Mittelschicht hatte die Ka tastrophe lange Zeit nicht wahrge nommen, auch der zehnjährige Kna be nicht, bis schließlich unübersehbar ausgezehrte Gestalten durchs Land zogen und auf Kalkuttas Straßen zehntausende Menschen starben. Ab 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, grassierte im westbengalischen Indien wegen gestiegener Lebensmittelprei se eine Hungersnot, die zwei bis drei Millionen der ganz Armen dahinraff te. Die britische Zensur sorgte da für, dass über das Elend ein Mantel des Schweigens gebreitet wurde. Spä ter sollte Sen eine große Studie über das Entstehen von Hungersnöten schreiben.
Der Niedergang des britischen Empire zeichnete sich während Sens Schulzeit ab. Repression war allgegen wärtig. Etliche seiner Onkel wurden von den Kolonialbehörden unter Prä
ventivverdacht ins Gefängnis gewor fen, Familienbesuche dorthin gehörten zu seinen frühen Erfahrungen. Bit ter stellt er fest, dass Großbritannien 1945 mit der Einführung des Natio nalen Gesundheitsdienstes den Sozial staat begründete, in der Kronkolonie aber von einer solchen Politik nichts wissen wollte. Genauso wenig küm merte die Briten der grassierende An alphabetismus. Sen verschweigt aber nicht, dass Indien mit Kastenwesen und Feudalismus seine eigene Tradi tion der Ungleichheit besitzt (nachzu lesen in seinem tollen Buch „Indien“).
Auch ein Thema dieser Autobiografie: die Gleichzeitigkeit von indischem und westlichem Denken, die mögli che gegenseitige Bereicherung. Sen beherrscht den selbstverständlichen Umgang mit den klassischen philo sophischen Denkern von Adam Smith über David Hume bis Karl Marx, er nimmt Stellung zu den großen wirt scha swissenscha lichen Debatten der Gegenwart. Gleichzeitig schöp er aus dem großen kulturellen und wissenscha lichen Erbe Indiens wie der altindischen Sprache Sanskrit und alten indischen Epen. Sen sorgte da für, dass ein Buch seines Großvaters über den Hinduismus wieder erschien. Welch Weite und Offenheit in dieser intellektuellen Autobiografie!
ALFRED PFOSERdig beteuern sie Unwissenheit in ihren diversen Finanzskandalen.
Plastisch auch die Darstellung des Scouts, der durch die Kontinente reist und Jugendspieler auf Ausbaufähigkeit checkt. Die Autoren erklären den Auf stieg der englischen Premier League zur reichsten und mächtigsten Liga der Welt, mit deren sechs größten Vereinen gerade noch die zwei spa nischen Traditionsklubs und neuer dings das Modeprodukt Paris St. Ger main mithalten können. Geldströme aus dem Nahen Osten und das Wir ken russischer Oligarchen sind dafür verantwortlich.
Den Autoren gelingt es, nichts schönzureden und dennoch einen An klageton zu vermeiden, der dem Fuß
ballfan die Freude verderben könnte. Schließlich wird dieser auch die unter fragwürdigsten Umständen zustande gekommene WM in Katar verfolgen. Und damit kein Zweifel au ommt: Natürlich sind Messi und Ronaldo die besten Spieler aller Zeiten.
THOMAS LEITNERA ls der Schauspieler Brad Pitt diesen Sommer bei einer Filmpremiere in Ber lin au reuzte, herrschte Aufregung: Der Endfünfziger zeigte sich in einem lu igen Rock, dessen Leinenstoff im Wind san sei ne nackten Waden umspielte. Der Au ritt des mittelalten, weißen Mannes im unge wohnten Kleidungsstück bot so gut wie al len Zeitungen Anlass für eine Schlagzeile.
Im September zog dann Timothée Cha lamet, Schauspieler und Stilvorbild der jun gen Generation Z, bei den Filmfestspielen in Venedig blank. Unaufgeregt, als wäre nichts, stap e er im glänzenden, rücken freien Overall über den Teppich. Kein un gewöhnliches Outfit für eine Frau – aber für einen Mann? Das Ereignis wurde Mil lionen Mal in den sozialen Netzwerken ge teilt und hitzig diskutiert. Männer verfüh ren nicht, sie werden verführt, scheint noch immer in den meisten Köpfen zu stecken.
Nun, der überpräsente Chalamet ist auch Oktober-Covermodel der britischen Vogue, um den Hals eine schimmernde Perlenket te, über Jahrhunderte ein Symbol für weib liche Eleganz. Auch dazu überschlugen sich die Meldungen: Ist der 26-Jährige doch der erste Mann, dem solo diese Ehre zugeteilt wurde – ein Novum in der 106 Jahre lan gen Historie der britischen Ausgabe der Modebibel.
Zugegeben, der rote Teppich und Magazinco vers eignen sich besser als die normale Stra ße als Spielwiesen, um Geschlechternormen herauszufordern. „Aber wo sich hippe Men schen treffen – ob auf der Universität oder beim Ausgehen im Club – wird intensiv mit Geschlechterrollen gespielt“, sagt die Mo detheoretikerin und Professorin für Lite raturwissenscha Barbara Vinken, die ihr neuestes Werk „Ver-kleiden“ diesem Thema widmet. Und Mode ist eben ein Seismograf für gesellscha liche Strömungen.
Auf Nagellack für Männer und Springer stiefel für Frauen folgen nun Röcke, trans parente Stoffe, reichlich Schmuck, wallen de Rüschenhemden und tiefe Dekolletés für den Mann, beobachtet die Wissenscha le rin. Im Kern reflektiert die Kleiderdebatte ein Thema, das einen Großteil der Mode welt und der Welt insgesamt gerade be schä igt: die Geschlechterbinarität. Tref fend schreibt Vinken: „Die Kämpfe um die Geschlechterdifferenz toben mit einer emotional aufgeladenen Intensität, wie sie nur noch Kriege oder Klimakatastrophen hervorrufen.“
Dabei sei Mode seit der Französischen Revolution in erster Linie Frauensache ge wesen. Vor dem späten 18. Jahrhundert klei deten sich beide Geschlechter so gut es ging modisch. Erst mit dem Ende der Feudalge sellscha wurde die mit Spitzenstoffen und Stickereien verzierte Kleidung der adeligen Männer abgeschafft. Nach der Revolution von 1789 trug der Mann Sakko. „Seither hatte der, der als Mann durchgehen woll te, auf aristokratische Zurschaustellung sei ner körperlichen Reize zu verzichten.“ Denn der Herrenanzug erlaube nur geringfügige Variationen, und wenn ein Mann aus dem heutigen gewohnten Erscheinungsbild fällt, werde er schnell als „schwul“ bezeichnet, so die deutsche Modetheoretikerin.
Nun aber werden, modetechnisch ge sprochen, alle Genderkorsetts gesprengt. „Be what you are“ lautet das verlockende Versprechen. Vinken sieht darin eine Um kehr der Einbahn, die seit Jahrzehnten von männlich zu weiblich laufe. Im Moment aber passiere in der Männermode weit mehr als in der Frauenmode.


Gender: Kennt die Zukun der Mode noch Geschlechter? Barbara Vinken sucht Antworten am Laufsteg und in der Geschichte
Ein einflussreicher Wegbereiter dieser Strömung war etwa der französische De signer Hedi Slimane mit seinen schma len Hosen und stark taillierten Jacken. Sei ne Silhouette stand ab den 1990er-Jahren für den modernen Mann. Man munkel te, einer seiner größten Fans, ein gewisser Karl Lagerfeld, habe extra 40 Kilogramm abgenommen, um sich in die Slim-Outfits hineinzuhungern.
Die Branche und die Laufstege sind längst offen für Genderfluidität. 2020 kün digte das British Fashion Council an, dass die Londoner Modewoche zu einer ge schlechterübergreifenden Plattform über gehen und Damenkollektionen und Her renmode in einer Show zusammenbringen werde. Und das italienische Modehaus Gucci führte 2020 in seinem Onlineshop „Gucci Mx“ ein: einen geschlechtsneutra len Einkaufsbereich mit einer Auswahl an genderfluider Kleidung, die von Models aller Geschlechter und Identitäten getragen wird.
Zurzeit bringen aus Vinkens Sicht Labels wie Gucci und der Designer John Galliano für Martin Margiela queere Mode und Cross dressing in ihren Kollektionen am klars ten zur Geltung. Alle Prinzipien weiblicher Mode fänden sich hier auf Mode für alle übertragen. Die Outfits seien anachronis tisch tiefschichtig und nicht gradlinig mo dern, erotisch-sinnlich wie bis dahin nur die Kleider für das weibliche Geschlecht. O mit exquisiten Handarbeitstechniken, wie sie früher nur in Haute-Couture-Ateliers an gewandt wurden, gefertigt.
Das schnörkellos Funktionale, das Un geschmückte, die a-modische Männlichkeit werde nun verdrängt von der unbändigen Lust am Ver-kleiden, erklärt die 62-Jährige. Selbst das französische Modehaus Balencia ga, um das momentan am meisten Wind ge macht wird, komme im Zeichen des Cross dressings daher. Über dessen Konzept sagt Vinken: „Bestimmt wird die Kollektion von der Logik des Fetisch, die den Geschlechts unterschied … im Dunkeln oder besser im unentscheidbaren, verführerischen Oszillie ren lässt.“ Und der neue Trend sei weder Ni sche noch kurzlebiger Hype, sondern eine „langfristige Bewegung mit Tiefenstruktur“.
Und wie geht es nun der „Frauenmode“? Sie schöp e ja einst aus dem Fundus tra ditioneller Männerkleidung. Queering war das Zauberwort, wie es bereits Anfang der 1910er-Jahre Coco Chanel mit dem Anzug oder dem Smoking vorführte.
In diesem Jahr war der ultrakurze Mi crominiskirt von Miu Miu außergewöhn lich erfolgreich und sofort ausverkau . Von Vogue bis Vanity Fair tauchte er auf allen Covers auf, getragen von Frauen zwischen 18 und 60 Jahren. Nach wallenden Gewän dern, Midi- und Maxi-Röcken und #Me Too feiere der Mini völlig hedonistisch ein triumphales Comeback, so Vinken. Sie liest darin die Geste eines Schulmädchens, das „sich selbst von aller Scham und allen An ständigkeitsregeln des Comme-il-faut“ re bellisch befreit. Der ausgefranste Rock, so groß wie eine „Po-Manschette“, kam in männlich konnotierten Stoffen daher, in grünem Armee- und grauem Anzugtuch. Kombiniert mit einem Schlabberpulli und darunter einem Herrenhemd, beide so kurz abgeschnitten, dass man die Unterseite des BHs sehen konnte.
Anscheinend führt die emanzipatori sche Befreiung schlussendlich nicht direkt zur Genderneutralität, sondern zu mehr Se xiness. Und zwar für alle.
NATHALIE GROSSSCHÄDLBarbara Vinken: Ver-kleiden. Was wir tun, wenn wir uns anziehen. Residenz, 96 S., € 19,–
D ie Obauers sind Monumente. Ich sage das, ohne je in ihrem Lokal in Werfen gegessen zu haben. Ich weiß es aber von Werner Meisinger. Meisinger schreibt, wie Sie wissen, die witzigsten und pfiffigsten Kochrezepte im deutschen Sprachraum. Sie wissen das, weil diese Rezepte im Falter erscheinen. Meisinger hat den Text von Total Obauer, dem neuen Obauer-Kochbuch, verfasst, wie die Texte aller O-Bücher davor.
Die Obauers müssen ihre Kunst nicht beweisen, obwohl sie immer wieder auch in komplexeren Gerichten au litzt, wie der mit Brennnessel gefüllten Wachtel. Aber das alles sieht aus, als könnte man es sel ber machen.
Da findet man Dinge wie ein Erdäpfelgu lasch mit Tofu, natürlich mit kleinem ExtraPfiff. Was mir gefällt: die Obauers sind sich treu geblieben. Ich mochte sie, als ich in ihrem Österreich-Buch 1977 den Eierstich fand, eine Kindheitserinnerung. Und siehe da, da ist er wieder, etwas verfeinert, mit Morchelragout und Karottensauce. Schluss mit den Lobpreisungen, dieses Buch wer den Sie haben wollen.
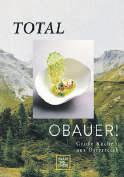
Das zweite große O in dieser Herbstsaison ist Yotam O olenghi, dessen Küche mit ihren nahöstliche Einflüssen nicht nur in England seit Jahren Trends setzt. Manchmal wun dere ich mich, wenn ich durch die Fenster eines von jungen Menschen überlaufenen Lokals in der Wiener Innenstadt schwarz gebratene Blumenkohlköpfe und verbrann te Karottenhaufen sehe, die offensichtlich Vergnügen bereiten, und denke, die wollten vielleicht so etwas wie Ottolenghi sein, ha ben es aber nicht ganz geschafft. Jetzt kann ihnen geholfen werden. Ottolenghi gibt Einblick in Tricks, wie er mit Extras, also gewürzten Zugaben, Gerichte au essert. Harissa-Butter oder Tamarinden-Dressing sind nicht mehr das, was man Raketenwis senscha in der Küche nennen kann, aber vielleicht kann es eine Kohlenkarotte ret ten. Wann ist ein Gericht eigentlich „Otto lenghi“?, fragt sich der Meister und antwor tet: „Wenn Grünzeug im Mittelpunkt steht, in seiner ganzen Vielfalt und Vielseitigkeit. Wenn die Portionen großzügig bemessen sind und einladend präsentiert werden. Es hat einen orientalischen Touch, nicht im mer, aber meist: Kardamom trifft auf Vanil le, Piment auf Tomate.“ Auf das Aromenge rüst kommen die Extras, die er in diesem Buch vorstellt. Man bekommt hundert An
regungen, von gemogelter Salzzitrone über gebeiztes Eigelb bis zu Rosen-Harissa. Und natürlich viele praktische Rezepte.
Der Salzburger Emanuel Weyringer kocht in seinem gleichnamigen Haus am Wallersee. Ich war – meine letzte Anekdote für dies mal – ich war vor Jahren dort, als unser Hund jung war. Weyringers Haus ist näm lich hundefreundlich. Unser Hund lern te dort schwimmen, weil er, der bis dato auf uns wasserscheu wirkte (oh ahnungs lose Junghundebesitzer!), sich blind einem Pulk von Kollegen anschloss, die ins Was ser preschten, und mitten unter ihnen schwamm er frisch und fröhlich. Weyringer war damals als einer der in Italien höchst dekorierten Köche aus Hongkong zurück gekehrt und kochte ganz prima. Jetzt legt er sein erstes Kochbuch vor, Poesie des Ko chens, mit vielen Geschichten und Bildern zu den Rezepten (die kommen dann kom primiert am Schluss und verlangen teils Profiwerkzeug, Etamintuch oder Paco-Jet, es ist aber durchaus Fußgängiges dabei, wie der Engländer sagt, etwa Salzburger No ckerln). Das besondere: Weyringes Vater, der Maler Johannes Weyringer, hat das Buch il lustriert, der als Begräbnisredner bekann te Walter Müller hat zu allen Rezepten Ge schichten geschrieben (etwa: wie kam das Schweinswürstel zur Galway-Auster). Ein ganzes Sextett macht aus dem Buch ein ku linarisch-ästhetisches Erlebnis der anderen, feinen Art. Fotograf Peter Angerer, Grafiker Michael Punz und Brigitte Trnka („Regie“) komplettieren es. (Erscheint erst am 1.11.)
Große Chefs machen Kochbücher, weil sie sie in ihren Lokalen verkaufen oder weil sie ihre Du marke im kulinarischen An spruchsmarkt setzen. Ein idealtypisches Beispiel ist Ösch Noir. Im Öschberghof, einem zu einem Golfressort gehörigen Haus im Schwarzwald, gebaut von AldiGründer Karl Albrecht, kocht der 35 Jahre alte, aus der Gegend stammende Manuel Ulrich. Klassische, von französischer Küche beeinflusste Moderne, wunderschön anzu schauen, sternenbekrönt, nachzukochen in den wenigsten Fällen (Kimchiröllchen in Spitzkraut zum Beispiel).
Anton Schmaus kocht ist eine Visiten karte anderer Art: die Autobiografie eines Kochs. Das ist wirklich gut gemacht. Der nun in Regensburg wirkende Sternekoch nimmt uns mit auf die Stationen seiner

Yotam O olenghi: Test Kitchen Extra Good Things. Dorling Kindersley, 255 S., € 25,70


Karriere und begleitet sie mit Rezepten; die werden im Verlauf immer schwieriger, aber Schmaus spart auch seine Internats zeit nicht aus. Sympathisch ist seine Fä higkeit zur Selbstreflexion und zu der – in Genregrenzen möglichen – Selbstkritik. Die Schiene des kiloweisen Kaviar und der sündteuren Luxusweine hat er verschmäht. Da verzeihen wir ihm sogar, dass er sein Wiener Schnitzel nur mit Eiweiß paniert. Ich werde es vielleicht einmal probieren.
Ein französischer Spitzenkoch ist Da niel Galmiche. In seinem Buch Französi sche Landküche kommt er aber als Ratgeber daher, nicht als Angeber. Viel brauchba re Anregungen finden sich hier, von Rös ti (Galette) aus Erdäpfeln und Sellerie bis Tomatentartes. Das ist alles sehr appetit lich und gut nachkochbar.

Roland Tre l hat sich vom Dasein als Groß meisterkoch verabschiedet und findet Sinn in der kulinarisch gelebten Partnerscha mit seiner Frau Dani. Hier legt er den zwei ten Band von Kochen zu zweit vor. Bei mir ist es ja leider anders. Zusammen zu kochen führt nur zu Streit, füreinander kochen ist schon besser. Die Rezepte der Trettls sind prima, das ausgestellte Partnerscha stur teln weniger.
Beni Tonka ist kein gelernter Koch. Er spürte seine karibischen Wurzeln auf und führt uns in Good Lime in jene Welt ein. Ka ribisches Lebensgefühl will er vermitteln. Das schafft er, wenngleich ich bezweifle, ob ich mich je zu einem Maniokkloß aufraf fen werde.
Daniela und Roland Tre l: Kochen zu zweit. Bd. 2. Südwest, 208 S., € 25,70



Christan Henze, schon wieder ein Ster nekoch, aber in Veggie einer, der einfach gute Rezepte gibt. Schnell und vegetarisch schafft Henze vif und variantenreich. Zum Beispiel das Pilzgulasch mit Kartoffeln und frischem Spinat, kommt demnächst bei mir auf den Tisch. Zubereitungszeit zwölf Minuten, Garzeit 15 Minuten. Das stimmt. Mann und Buch halten, was sie versprechen.

Barbara van Melle, gewesene TV-Prä sentatorin, ist längst Backunternehmerin. Sie hat das Thema Brot stark besetzt. Mit dem schön gemachten Buch Laib und Seele unternimmt sie Reisen zu exemplarischen Bäckereien, erzählt deren Geschichte, bringt viele interessante Rezepte und darüber hi naus Grundsatzwissen satt. Eine Seele ist im Westen und in Deutschland übrigens ein Brötchen.
ARMIN THURNHERManche Sterneköche zeigen, wer sie sind und was sie können; andere geben brauchbare Tipps. Manche tun sogar beidesAnton Schmaus: Anton Schmaus kocht. Südwest, 224 S., € 30,90 Beni Tonka: Good Lime. Brandstä er, 201 S., € 32, Daniel Galmiche: Französische Landküche. Ars Vivendi, 239 S., € 32,90 Manuel Ulrich: Ösch Noir. Ma haes, 240 S., € 51,30 Christian Henze: Feierabend-Blitz rezepte veggie. Becker Joest, 168 S., € 32,90 Emanuel Weyringer: Poesie des Kochens. Anton Pustet, 360 S., € 48, Barbara van Melle: Laib mit Seele. Brandstä er, 238 S., € 32, Rudolf und Karl Obauer: Total Obauer. Gräfe und Unzer, 288 S., € 32,90
A. Punkt | Fischerstiege 1–7
Aichinger Bernhard | Weihburg. 16
ChickLit | Kleeblattgasse 7
Die Fachbuchhandlung | Rathausstraße 21
Facultas im NIG | Universitätsstraße 7
Freytag & Berndt | Wallnerstraße 9
Frick | Graben 27
Herder | Wollzeile 33
Kuppitsch | Schottengasse 4
Leo & Co. | Lichtensteg 1
Leporello | Singerstraße 7
Morawa | Wollzeile 11
ÖBV | Schwarzenbergstraße 5
Schaden | Sonnenfelsgasse 4 Tyrolia | Stephansplatz 5
2. Leopoldstadt
facultas.mbs an der WU | Welthandelsplatz 1/D2/1
Im Stuwerviertel | Stuwerstraße 42
Lhotzkys Literaturbuffet | Taborstraße 28
tiempo nuevo | Taborstraße 17a
Laaber | Landstraßer Hauptstraße 33 Thalia | Landstraßer Hauptstraße 2a/2b
4. Wieden
Jeller | Margaretenstraße 35 I NTU.books | Wiedner Hauptstraße 13
Margareten Buchinsel | Margaretenstraße 76
Thalia | Mariahilfer Straße 99
Audiamo | Kaiserstraße 70/2 Hintermayer | Neubaugasse 27 Posch | Lerchenfelder Straße 91 Walther König | Museumsplatz 2
Josefstadt Bernhard Riedl | Alser Straße 39
Eckart | Josefstädter Straße 34 Lerchenfeld | Lerchenfelder Straße 50
Alsergrund Buch-Aktuell | Spitalgasse 31 Facultas am Campus | Altes AKH | Alser Straße 4
Hartliebs Bücher | Porzellangasse 36
Löwenherz | Berggasse 8
Oechsli | Berggasse 27
Orlando | Liechtensteinstraße 17 Yellow | Garnisongasse 7
Favoriten Facultas | Favoritenstraße 115
Meidling Frick | Schönbrunner Straße
Kral | Hietzinger Hauptstraße
Penzing Morawa Auhof Center | Albert Schweitzer Gasse 6
15. Rudolfsheim-Fün aus
Buchcafé Melange | Reindorfgasse 42 Buchkontor | Kriemhildplatz 1 Thalia Bahnhof CityWien West | Europaplatz 1
16. O akring Margaritella | Ottakringer Straße 109
Book Point 17 | Kalvarienberggasse 30
18. Währing Hartliebs Bücher | Währinger Straße 122
Baumann | Gymnasiumstraße 58 Georg Fritsch | Döblinger Hauptstraße 61 Stöger-Leporello | Obkirchergasse 43 Thalia Q19 | Kreilplatz 1
20. Brigi enau Hartleben | Othmargasse 25
Bücher Am Spitz | Am Spitz 1 Kongregation der Schulbrüder | Anton-Böck-Gasse 20
Freudensprung | Wagramer Straße 126 Morawa V.I.C. | Wagramer Straße 5
Seeseiten | Janis-Joplin-Promenade 6 Thalia | Donauzentrum | Wagramer Straße 94
Lesezeit – Liesing | Breitenfurter Straße 358
In Mauer | Gesslgasse 8A Frick EKZ Riverside | Breitenfurter Straße 372
Korneuburg | Stockerauer Straße 31, 2100 Korneuburg
Am Hauptplatz | Hauptplatz 15, 2320 Schwechat Morawa | SCS, Galerie 27, 2334 Vösendorf
Kral | Elisabethstraße 7, 2340 Mödling
Valthe | Wiener Gasse 3, 2380 Perchtoldsdorf
Riegler | Kirchengasse 26, 2460 Bruck an der Leitha Bücher-Schütze | Pfarrgasse 8, 2500 Baden Papeterie Rehor | Theodor-Körner-Platz 6, 2630 Ternitz
Hikade | Herzog-Leopold-Straße, 2700 Wiener Neustadt
Thalia | Hauptplatz 6, 2700 Wr. Neustadt
Mitterbauer | Wiener Straße 10, 3002 Purkersdorf
Sydy’s | Wiener Straße 19, 3100 St. Pölten
Thalia | Kremsergasse 12, 3100 St. Pölten Reischl | Hauptplatz 12, 3250 Wieselburg
Schmidl | Obere Landstraße 5, 3500 Krems/Donau
Murth | Wiener Straße 1, 3550 Langenlois
Rosenkranz | Els 127, 3613 Els Kargl | Hauptplatz 13–15, 3830 Waidhofen/Thaya
Spazierer | Budweiser Straße 3a, 3940 Schrems
Stark Buch | Bahnhofstr. 5, 3950 Gmünd
Fürstelberger | Landstraße 49, 4013 Linz Alex | Hauptplatz 17, 4020 Linz Buch plus | Südtiroler Str. 18, 4020 Linz Bücher & Mehr | Klosterstraße 12, 4020 Linz
In der Freien Waldorfschule | Waltherstraße 17, 4020 Linz
Neugebauer | Landstraße 1, 4020 Linz
Thalia | Landstraße 41, 4020 Linz
Buchhandlung Auhof | Altenberger straße 40, 4045 Linz-Auhof Wolfsgruber | Pfarrgasse 18, 4240 Freistadt
Wurzinger | Hauptplatz 7, 4240 Freistadt
Ennsthaler | Stadtplatz 26, 4273 Unterweißenbach
Obereder | Markt 23, 4400 Steyr
Hartlauer | Stadtplatz 6, 4400 Steyr Michael Lenk | Vogelweiderplatz 8, 4600 Wels
SKRIBO GmbH | Stadtplatz 34, 4600 Wels
Thalia | Schmidtgasse 27, 4600 Wels
Schachinger | Untere Stadtplatz 20, 4780 Schärding
Kochlibri | Theatergasse 16, 4810 Gmunden
Thalia | Pfarrgasse 11, 4820 Bad Ischl
Michael Neudorfer | Hinterstadt 21, 4840 Vöcklabruck
Schachtner | Stadtplatz 28, 4840 Vöcklabruck
Bücherwurm | Bahnhofstraße20, 4910 Ried
Thalia | Wohlmeyrgasse 4, 4910 Ried/Innkreis
Der Buchladen | Stadtplatz 15-17, 5230 Mattighofen
Riepenhausen | Langer Graben 1, 6060 Hall in Tirol
Riepenhausen | Andreas-Hofer-Straße 10, 6130 Schwaz
Steinbauer, EKZ Cyta | Cytastraße 1, 6167 Völs
Zangerl | Salzburger Straße 12, 6300 Wörgl
Lippott | Unterer Stadtplatz 25, 6330 Kufstein
Tyrolia | Rathausstraße 1, 6460 Imst
Jöchler | Malserstraße 16, 6500 Landeck
Tyrolia | Rosengasse 3-5, 9900 Lienz
Ananas | Marktplatz 10, 6850 Dornbirn
Brunner | Marktstraße 33, 6850 Dornbirn
Rapunzel | Klostergasse 1, 6850 Dornbirn
Brunner | Rathausstraße 2, 6900 Bregenz
Ländlebuch | Strabonstraße 2a, 6900 Bregenz
Brunner | Konsumstraße 36, 6973 Höchst
s’Lesekistl | Obere Hauptstraße 2, 7122 Gols
Pokorny | Schulgasse 9, 7400 Oberwart Wagner | Grazer Str. 22, 7551 Stegersbach
Bücherstube | Prokopig. 16, 8010 Graz
ÖH Unibuchladen | Zinzendorfgasse 25, 8010 Graz
Moser | Am Eisernen Tor 1, 8010 Graz büchersegler | Lendkai 31, 8020 Graz
Morawa | Lazarettgürtel 55, 8025 Graz
Plautz | Sparkassenplatz 2, 8200 Gleisdorf Morawa | Wiener Straße 2, 8230 Hartberg Buchner | Hauptstraße 13, 8280 Fürstenfeld
Morawa | Hauptplatz 2, 8330 Feldbach Morawa | Hauptplatz 6, 8530
Morawa | Mittergasse 18, 8600 Bruck/ Muhr Mayr | Kurort 50, 8623 Aflenz
Morawa Shoppingcity Seiersberg | Top 2/2/12, 8055 Salzburg
Bücher-Stierle | Kaig. 1, 5010 Salzburg
Motzko | Elisabethstr. 24, 5017 Salzburg
Facultas NAWI-Shop | Hellbrunner Straße 34, 5020 Salzburg
Höllrigl | Sigmund-Haffnergasse 10, 5020 Salzburg
Morawa SCA | Alpenstraße 107, 5020 Salzburg
Rupertusbuchhandlung | Dreifaltig keitsgasse 12, 5020 Salzburg
Thalia | Europastraße 1, 5020 Salzburg
Haymon | Sparkassenplatz 4, 6020 Innsbruck
Studia | Innrain 52f, 6020 Innsbruck
Wagner’sche | Museumstraße 4, 6020 Innsbruck
Tyrolia | Maria-Theresien-Straße 15, 6020 Innsbruck
Kerbiser | Wiener Straße 17, 8680 Mürzzuschlag
Morawa | Hauptplatz 19, 8700 Leoben Morawa | Burgg. 100, 8750 Judenburg
Hinterschweiger | Anna Neumannstraße 43, 8850 Murau
Buch + Boot | Altausse 11, 8992 Altaussee
Heyn Johannes | Kramergasse 2, 9020 Klagenfurt
Die Kärntner Buchhandlung | Wiesbadener Straße 5, 9020 Klagenfurt
Besold | Hauptpl. 14, 9300 St. Veit/Glan
Die Kärntner Buchhandlung | Bahnhofsplatz 3, 9400 Wolfsberg
Die Kärntner Buchhandlung | 8.-Mai-Platz 3, 9500 Villach
Spittaler Stadtbuchhandlung | Tiroler Straße 12, 9800 Spittal am Millstätter See
Eine Biografie der TV-Legende Elizabeth T. Spira. Die Frau hinter „Alltagsgeschichte“ sowie „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. 224 Seiten, € 24,90
