Ortswechsel +
Evangelisches Religionsbuch für Gymnasien 11


Evangelisches Religionsbuch für Gymnasien 11

Evangelisches Religionsbuch
für Gymnasien 11
Herausgegeben von Ingrid Grill-Ahollinger, Sebastian Görnitz-Rückert, Tanja Gojny
verfasst von Heide Ewerth, Sebastian Görnitz-Rückert, Tanja Gojny, Ingrid Grill-Ahollinger, Hans Christian Kley
unter Mitarbeit von Heide Bartelmus, Katharina Luchner
Claudius Verlag München 2023 Birkerstraße 22, 80636 München www.claudius.de
Rechtschreibreformiert, sofern nicht urheberrechtliche Einwände bestehen.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Gestaltung und Typografie:
Cordula Schaaf, München
Druck und Bindung: appl, Wemding
978-3-532-70096-9
Liebe Schülerinnen und Schüler, Zwischenräume übersieht man gern, weil man ja eigentlich woanders hin will. Wer aber einmal genauer hinschaut und wahrnimmt, was »dazwischen« ist – in Gebäuden, im Freien oder auch (im übertragenen Sinn) im eigenen Leben und Denken – , kann neue Perspektiven auf das »Gewohnte« und »Normale« gewinnen. –Dann können Zwischenräume zu Freiräumen werden.
Vielleicht betrachten Sie auch die Jahrgangsstufe 11 als einen solchen Zwischenraum, der zwischen der erfolgreich bewältigten Mittelstufe und der Kursphase liegt, in der es dann ernst wird? Welche Chancen wird Ihnen diese Lebensphase bieten? Wie werden Sie sie gestalten? Welche Freiräume werden Sie für sich entdecken? Wenn das eine war und das andere noch nicht ist, dann kann das eine sehr offene und kreative Zeit dazwischen werden – so wie hoffentlich dieses Jahr in Ihrem Religionsunterricht.
Im Einzelnen wird es in diesem Jahr um folgende Themen gehen:
Das Eingangskapitel regt zum Nachdenken über die besondere Rolle von Zwischenräumen an – zum Beispiel im Rahmen von Architektur, in lebensgeschichtlichen Zusammenhängen, in Bezug auf Judentum, Christentum und Islam und für das Verständnis von Kunst, Bildung und Freiheit. Die Frage, wie sich Glaube und kritisches Denken zueinander verhalten, ob es z. B. einen Raum zwischen ihnen gibt, der einen fruchtbaren Austausch ermöglicht oder leer bleiben muss, hat in der Aufklärungszeit wichtige Zuspitzungen erfahren. Den Herausforderungen, die sich bis heute daraus er-
geben, gehen Sie nach und setzen sich damit auseinander, inwieweit man zum Beispiel Glaube und moderne Naturwissenschaften konstruktiv aufeinander beziehen kann (Lernbereich 11.1 »Glaube und Vernunft – alte und neue Herausforderungen«)
Judentum, Christentum und Islam sind äußerst vielgestaltige, komplexe Phänomene, die man nicht einfach so miteinander vergleichen oder gar in eins setzen kann. Deshalb reflektieren Sie, warum es so schwierig ist, deren Verhältnis zueinander sachgerecht zu bestimmen und inwiefern es geboten ist, Vereinfachungen etwa im Blick auf mediale Darstellungen der drei Religionen entgegenzutreten. Sie diskutieren in diesem Zusammenhang mögliche Chancen und Grenzen eines interreligiösen Austauschs (Lernbereich 11.4 »Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, Christentum, Islam«).
Die Bibel können Sie als Buch mit Zwischenräumen wahrnehmen; gerade das Fremde und Abständige an ihr kann (im Wortsinn) »inter-essant« sein, weil es dazu einlädt, die Leerstellen mit eigenen Erfahrungen und Gestaltungen, Gegentexten und Weiterdichtungen zu füllen. Dies wird am Beispiel der HiobDichtung demonstriert und ausprobiert, dem vielleicht »ketzerischsten« Buch der Bibel, das wie kaum ein anderes die bildende Kunst, Dichtung, Theologie und Philosophie inspiriert hat (Lernbereich 11.3 »Sola scriptura!? – Zugänge zur Bibel«)
Freiheit stellt nicht nur eines der großen Themen der Menschheit, sondern gerade auch eine wichtige Dimension des evangelischen Glaubens dar. Sie
tauschen sich über eigene Freiheitserfahrungen aus, stellen diese in Bezug zu Freiheitsverständnissen aus Philosophie, Theologie und Hirnforschung
und diskutieren Konsequenzen, die sich daraus im Hinblick auf aktuelle ethische Fragestellungen ergeben (Lernbereich 11.2 »Freiheit leben«).
reflektieren
OrtswechselPLUS 11 enthält folgende aus den vorigen Bänden bekannte Elemente: Jedes Kapitel beginnt mit einer Reihe von »großen Fragen«. Sie führen in die Thematik des Kapitels ein und sind in der Regel nicht abschließend zu beantworten. Sie regen zum Weiterfragen und Philosophieren an.
wahrnehmen deuten
Sie tauschen sich darüber aus, inwiefern Kunst und Freiheit zusammengehören. Von Beispielen moderner Schularchitektur ausgehend entwerfen Sie eigene Gestaltungsideen für eine Bildungsarchitektur, die Lernräume auch jenseits von Klassenzimmern, zugleich aber auch Rückzug ermöglicht.
kommunizieren
Auf der ersten Doppelseite hilft eine Vorschau dabei, sich im Kapitel zu orientieren. Sie ist an die Kompetenzerwartungen des Lehrplans angelehnt und ermöglicht Ihnen, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen und ggf. Schwerpunkte zu setzen.
Die Extratour enthält einen Vorschlag, wie man einzelne Themen oder Teile davon mithilfe des Buches allein oder in Kleingruppen selbstständig erarbeiten kann. In diesem Jahr liegt ein Akzent auf öffentlicher Religion.
In jedem Kapitel führt eine Doppelseite mit besonderen Bildern oder Texten mitten in das jeweilige Thema hinein. Die darauf folgende Doppelseite enthält Erläuterungen und Aufgaben dazu. Es folgen Doppelseiten mit unterschiedlichen Materialien und Impulsen. Jede Doppelseite stellt eine Einheit dar, vergleichbar einem Raum, in dem man sich in unterschiedliche Richtungen bewegen und an unterschiedlichen Orten aufhalten kann.

Was man zum Bearbeiten der jeweiligen Aufgaben wissen sollte, steht in den Infos Weitere Informationen enthält das Lexikon am Ende des Buches. Begriffe, die dort erklärt werden, sind im Text mit einem Sternchen* versehen. Wenn ein Begriff auf einer Doppelseite selbst ausführlicher oder genauer erklärt wird als im Lexikon oder wenn das ganze Kapitel davon handelt, wird meist auf das Sternchen verzichtet, ebenso, wenn ein Begriff in einem Text wiederholt wird. Alle Lexikonbegriffe der Ortswechsel-Bände finden Sie auf der Homepage des Claudius Verlags.
Manchmal »merkt« man etwas, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, man wundert sich, es geht einem ein Licht auf oder man möchte etwas kritisch »anmerken«. Solche Gedankensplitter finden Sie als »Merke« auf manchen Buchseiten. Lassen Sie sich davon zu eigenen »Merke« anregen.
Die »Wegweiserkästen« enthalten Aufgaben und Impulse zur Bearbeitung des jeweiligen Themas. So wie der Wegweiser in mehrere Richtungen weist, so sind auch die angebotenen Aufgaben vielfältig. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres Niveaus und ihrer Komplexität sowie hinsichtlich des benötigten Materials und Zeitaufwands; sie richten sich an unterschiedliche Lerntypen und decken ein breites Spektrum an Methoden und Sozialformen ab.
[7] Eine Zahl in eckigen Klammern weist darauf hin, dass ein Thema in einem der vorhergehenden Schuljahre behandelt wurde.
Das Schließfach-Symbol kennzeichnet solche Aufgaben, die Sie für sich allein bearbeiten können und deren Ergebnisse Sie nicht mit anderen teilen müssen – wenn Sie es nicht möchten.
Am Ende eines jeden Kapitels können Sie anhand von exemplarischen Materialien und Anforderungssituationen erproben, ob Sie das Gelernte im Zusammenhang anwenden können. Dies ist auch eine gute Übung für schriftliche und mündliche Prüfungen.
Auf dieser letzten Seite finden Sie auch den für Ortswechsel charakteristischen Rucksack. Er steht symbolisch dafür, dass sinnvoll Gelerntes eine Art »Reisegepäck« für das Leben darstellen kann. Er soll Sie außerdem dazu anregen, den Prozess des Lernens zu reflektieren und sich darüber auszutauschen.

Der Wechsel in die Oberstufe wird in OrtswechselPLUS 11 daran deutlich, dass Ihnen keine neuen Methoden vorgestellt werden. Denn Sie haben viele für den Religionsunterricht und mit Blick auf die Bearbeitung im Abitur alle wichtigen Methoden bereits kennengelernt und können und werden diese weiterhin in Gebrauch nehmen. Bei etwaigen Unsicherheiten finden Sie sie auf der Homepage des Claudius Verlags. An die Stelle der Methoden treten im Anhang des Buches nun Seiten zu Theologie als Wissenschaft. Diese Seiten sollen Sie zum einen über Studien- und Berufsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Evangelischer Theologie informieren. Sie könnten deshalb auch für die Wahl eines Praktikumsplatzes interessant sein. Zum anderen sollen Sie diese Seiten – in Ergänzung zu den Inhalten der Kapitel des Buches – bei der Wissenschaftswoche unterstützen, in deren Rahmen Sie sich mit einem fächerübergreifenden Thema in Vorbereitung auf das W-Seminar befassen und dabei die fachspezifischen Zugänge ihrer verschiedenen Unterrichtsfächer einbringen sollen.
Wie in anderen Fächern geht es auch in Religionslehre nicht darum, Wissen anzuhäufen – womöglich nur bis zur nächsten Prüfung –, sondern das Gelernte längerfristig in Gebrauch zu nehmen, in neuen Zusammenhängen zu bedenken und aus veränderten Perspektiven zu betrachten. Was Sie aus jedem Jahrgang auf jeden Fall »mitnehmen« sollen, beschreiben im Lehrplan die »Grundlegenden Kompetenzen«. Im Folgenden finden Sie diese Gr undlegenden Kompetenzen für die Jahrgangsstufe 11 (kursiv gedruckt), jeweils ergänzt durch einige Hinweise, auf
welche Fragestellungen und Themen der vergangenen Jahrgangsstufen sie aufbauen. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch?
Die Schülerinnen und Schüler erläutern, wie Glaube und Vernunft konstruktiv aufeinander bezogen werden können, und bringen eine differenzierte Verhältnisbestimmung von Glauben und naturwissenschaftlichem Denken in Diskussionen ein.
Die Frage, wie sich Glaube und kritisches Denken zueinander verhalten, wird sich in den letzten Jahren immer wieder im Un-
terricht gestellt haben – zum Beispiel in Deutungsversuchen des Kreuzes, in denen Paulus scheinbar »vernünftige« Urteile unter Bezug auf Gott gleichsam auf den Kopf stellt. Explizit knüpft der Lernbereich an die Rede von Gott als Schöpfer der Welt und dem Menschen als Geschöpf Gottes an und an damit verbundene Fragen nach Weltbildern und ersten Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Glaube, die Sie nun in einem viel größeren historischen Kontext wahrnehmen und z . B. anhand eines vielschichtigen theologischen Ansatzes vertiefen können.
Sie reflektieren Dimensionen und Ambivalenzen von Freiheit und entwickeln aus einem evangelischen Verständnis von Freiheit Perspektiven für eine verantwortliche Lebensgestaltung.
Spannungen und Ambivalenzen in Bezug auf Freiheit haben bei vermutlich allen ethischen Fragestellungen des Religionsunterrichts der letzten Jahre eine Rolle gespielt, wie z. B. bei der Nutzung des Internets, des Verhältnisses von Staat und Kirche oder bei den Themen wie Liebe, Glück und Gerechtigkeit. Wichtige theologische Zusammenhänge haben Sie z. B. im Nachdenken über die »Freiheit eines Christenmenschen«, die Bedeutung des Kreuzes oder in Bezug auf Leben und Tod erarbeitet. In diesem Jahr werden Sie diese Überlegungen im Rahmen eines eigenen Kapitels mit Blick auf die Kursphase systematisieren und in Hinblick auf ein evangelisches Gewissensverständnis vertiefen.
Sie setzen sich mit Deutung und Wirkungsgeschichte einer biblischen Schrift oder Erzähltradition auseinander und erklären die Rede von der Bibel als »Heiliger Schrift« und »Wort Gottes« von einem evangelischen Schriftverständnis her.
Deutungen und Wirkungen biblischer Erzählungen sowie die Frage, wie diese mit Gott zusammenhängen bzw. zu einer modernen Weltsicht passen, haben Sie vermutlich Ihre ganze Gymnasialzeit begleitet. An diese Fragen und Erkenntnisse knüpfen Sie an und bringen sie im Kontext einer umfangreicheren Erzähltradition mit der Perspektive der historisch-kritischen Exegese und ihren verschiedenen methodischen Zugängen und Lesarten ins Gespräch. Dadurch erarbeiten Sie sich die Grundlagen für den Umgang mit biblischen Texten in der Kursphase.
Sie beschreiben im Bewusstsein der Problematik stereotyper Zuschreibungen differenziert die Vielgestaltigkeit der Beziehungen von Judentum, Christentum und Islam und diskutieren Geltungs- und Wahrheitsansprüche von Religionen in ihrer Spannung zum Toleranzbegriff.
In den vergangenen Jahren haben Sie sich mit verschiedenen Weltreligionen, christlichen Konfessionen und religiösen Sondergemeinschaften sowie mit der Frage beschäftigt, was Religion eigentlich ist. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse helfen Ihnen, mögliche Verhältnisbestimmungen zwischen Judentum, Christentum und Islam problembewusst wahrzunehmen und dabei auch Chancen und Grenzen des Toleranzbegriffs sensibel zu beurteilen.
Viel Freude beim Nachdenken und Diskutieren im Religionsunterricht wünschen Ihnen die Autorinnen und Autoren von OrtswechselPLUS 11.
Wozwischen bewege ich mich?
Schule – ein Zwischenraum?
Bin ich drinnen oder draußen?
Sind Zwischenräume Freiräume?
Ist jede Lücke ein Zwischenraum?
Eröffnet Religion Zwischenräume?
Lernbereiche: »Freiheit leben«, »Sola scriptura!? – Zugänge zur Bibel«, »Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, Christentum, Islam«
Sie beschäftigen sich mit unterschiedlichen Zwischenräumen und beschreiben deren Besonderheit(en). Sie legen dar, inwiefern die Wüste im Judentum, Christentum und Islam einen wichtigen »Zwischenraum« darstellt. Sie lernen Schillers Überlegungen zum Zusammenhang von Kunst und Freiheit kennen und können wichtige Aspekte wiedergeben.
Sie entdecken Zwischenräume im Orts bzw. Stadtbild, in der Schule und anderen Lebenskontexten und deuten diese.
Sie interpretieren Texte aus der Bibel sowie aus anderen religiösen Traditionszusammenhängen, die von der Wüste handeln.
Sie erschließen den Zusammenhang zwischen Kunst und Freiheit.
Sie denken darüber nach, inwiefern Jugend und Bildung Zwischenräume darstellen – und welche Freiheitsräume es braucht, um erwachsen und mündig zu werden. Sie bilden sich ein Urteil über die Funktion von Kunst in der Gesellschaft.
Sie tauschen sich darüber aus, inwiefern Kunst und Freiheit zusammengehören. Von Beispielen moderner Schularchitektur ausgehend entwerfen Sie eigene Gestaltungsideen für eine Bildungsarchitektur, die Lernräume auch jenseits von Klassenzimmern, zugleich aber auch Rückzug ermöglicht.
DÖRFLICHE UND STÄDTISCHE ZWISCHENRÄUME
Unter dem Motto »Auf der Suche nach dem Zwischenraum« hat die Stadt Weimar 2021 Jugendliche zu einem Hörspaziergang eingeladen. Dabei ging es u. a. um die Frage, wem die Stadt eigentlich gehört – und ob es auch für Jugendliche genügend Zwischenräume gibt, die noch gestaltet und erobert werden können. Lassen Sie sich von dieser Idee dazu anregen, für Ihre Stadt bzw. Ihren Ort einen Audioguide zu erstellen, der Interessierte auf Zwischenräume aufmerksam macht, diese deutet und ggf. auch Anregungen für alternative Nutzungen gibt. Gibt es auch Zwischenräume, die mit Religion zu tun haben?

Diese Fotomontage von Simon Tanner ist Teil des Architektur-Kunst-Bandes »dazwischen. Von der Wohnungstüre zur Trottoirkante«. Diese Publikation versammelt Beispiele für die Gestaltung von Zwischenräumen in Zürich.


Wer die Lebensreise lernt, wird zum Passagier: Er erfährt den eigentümlichen Zustand des Dazwischens. Die alten Regeln gelten nicht mehr und die neuen noch nicht. Die Passage eröffnet einen Freiheitsspielraum: Es könnte auch anders sein. Passagier werden

heißt auch, wie Hermes* übersetzen zu können, sowohl hier als auch schon da zu sein, anstatt beides im Entweder-Oder scharf voneinander zu trennen.
Henning Luther, Theologe
a) Ein Zwischenraum ist ein unvollständiges Loch, er liegt genau zwischen links und rechts. Zwischenräume entstehen beim unverdichteten Schreiben und helfen Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden.
b) Der Zwischenraum ist zwischengalaktisch, also eigentlich intergalaktisch und befindet sich im unverdichteten Zustand nie in schwarzen Löchern, wenn man ihn verdichtet, dann allerdings IST er in Wahrheit ein schwarzes Loch.
aus dem Satire-Wiki Kamelopedia
1. Identifizieren Sie unterschiedliche Zwischenräume auf der Fotomontage auf S. 10. Deuten Sie dieses Bild durch einen oder mehrere passende Titel.
2. In architektonischen Zwischenräumen gibt es einiges zu sehen und zu hören: Imaginieren Sie Alltagseindrücke zum Bild auf S. 10.

3. Sammeln Sie weitere typische »Zwischenräume« und tauschen Sie sich darüber aus, welche Erfahrungen sie ggf. mit ihnen gemacht haben. Sie können auch eine Fotostrecke gestalten.
4. Versuchen Sie eine Definition von »Zwischenraum« und mutmaßen Sie anhand der Materialien dieser Seite, warum der Begriff offenbar zu satirischer Auseinandersetzung einlädt.
5. Recherchieren Sie nach Initiativen und kommerziellen wie nichtkommerziellen Angeboten mit dem Titel/Namen »Zwischenraum« und deuten Sie die Verwendung der Metapher.
6. Zwischenraum und Religion? Deuten Sie die Aufschrift des Klebebandes.
Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren geh’n, ohne sich zu stoßen?
Rechts sind Bäume, links sind Bäume, und dazwischen Zwischenräume, wo die großen Elefanten spazieren geh’n, ohne sich zu stoßen!
KINDER-SINGSPIEL
Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da –und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm, mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick gräßlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh Nach Afri- od- Ameriko.
CHRISTIAN MORGENSTERNMERKe des Tao Te King: »Dreißig Speichen treffen die Nabe, aber das Leere zwischen ihnen erwirkt das Wesen des Rades.«
Was es heißt, jung zu sein? Wir ahnen es noch, weil wir es selbst gewesen sind. Aber wir wissen nichts Genaues mehr, weil es vorbei ist. Es ist die Zeit dazwischen. Zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, zwischen Schule und Beruf, zwischen Freundschaft und Liebe, zwischen Träumen und Plänen, zwischen mir und den anderen, zwischen mir und mir. Die Zeit dazwischen ist voller Schmerzen, Langeweile und hochfliegendem Selbstvertrauen; unglaublich anstrengend, selten richtig schön – was Erwachsene so schön nennen, aber immer wichtig. Aus der Zeit dazwischen stammen unsere intensivsten inneren Bilder.
Rita BurrichterSo gesehen wäre der Raum der Bildung im doppelten Sinne ein Zwischenraum: einer zwischen Vergangenheit und Zukunft und zugleich einer, in dem den Kräften, die das Leben ausmachen, Einfluss eingeräumt und zugleich auch Einhalt geboten wird dadurch, dass der Raum der Bildung als Zwischenraum Weite gibt für das Entwickeln eines eigenen Standpunkts, einer eigenen Form, einer eigenen Lebensweise, eben einer entfalteten Gegenwart.
Renate Girmes
1. Im Filmklassiker »Terminal« strandet der Protagonist im Transitbereich des New Yorker Flughafens. Er darf nicht in die USA einreisen, denn seine Papiere sind ungültig geworden, weil sein osteuropäisches Heimatland nicht mehr existiert. So muss er am Flughafen bleiben, wo er sich allmählich mit dem Flughafenpersonal anfreundet: Tauschen Sie sich darüber aus, was es für Menschen bedeuten kann, wie der Protagonist in einem Transit-Raum zu leben.
2. Identifizieren Sie weitere Transit-Räume in unserer Gesellschaft, in denen sich Menschen unfreiwillig aufhalten – im konkreten wie auch im übertragenen Sinn. Formulieren Sie besondere Herausforderungen, die sich damit verbinden.
3. Tauschen Sie sich über den Textausschnitt von Henning Luther ( S. 11) aus. Beziehen Sie ihn auf den Film und auf eigene Erfahrungen mit dem »eigentümlichen Zustand des Dazwischens«.
4. Welcher Satz »nervt« am meisten? Diskutieren Sie über die Zitate unten.
5. Jugend im Zwischenraum? Schreiben Sie, ausgehend von den Zitaten, dem Bild und den Texten einen Blogartikel.
»Nun geht es ja langsam Richtung Oberstufe …
»Weißt du schon, was du mal machen willst?
»Du bist ja schon richtig erwachsen geworden.
»11. Klasse – jetzt kommt es drauf an.
Fernab von Alltagsstress und jeglicher Zivilisation führt mich eine Wüstenreise zurück zu dem, was ich verloren habe. Gemeinsam mit 15 Kamelen, einem Hund, zehn Mitreisenden und fünf Beduinen reite ich durch die Wüste Sinai in Ägypten. Schlafsäcke und das nötigste Gepäck haben wir bei uns, außerdem Wasservorräte und L ebensmittel.
Zehn Tage und neun Nächte verbringen wir ohne Internet, ohne Smartphones, ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Toilette und ohne Zelt in der freien Natur. Wir schlafen unter dem funkelnden Sternenhimmel im Wüstensand, hinterlassen nichts außer Spuren und nehmen mehr mit, als wir uns jemals erträumt hatten.
»Geduld und Humor sind zwei Kamele, die dich durch die Wüste bringen.
»Wer in die Wüste geht, wird nicht derselbe bleiben, der er vorher war.
(Arabische Sprichwörter)
1. Sammeln Sie Assoziationen und/oder eigene Erfahrungen zum Thema Wüste. Vergleichen Sie sie mit den Schilderungen im Reisebericht (oben) und im Text von A. Camus.
2. Tauschen Sie sich darüber aus, warum Sie (nicht) gerne in die Wüste reisen würden.
3. Von »Wüstenerfahrungen« wird auch im metaphorischen Sinn gesprochen. Beschreiben Sie solche Wüsten-Phasen in der eigenen oder in einer fremden (ggf. fiktiven) Biographie.
4. Erläutern und diskutieren Sie die Zitate auf dieser Seite.
IN DER ALGERISCHEN WÜSTE

Jetzt waren sie unterwegs, und wahrhaftig, nichts war so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Janine hatte sich vor der Hitze gefürchtet, den Schwärmen von Fliegen, den schmutzstarrenden Hotels, wo alles nach Anis roch. Sie hatte nicht an die Kälte gedacht, den schneidenden Wind, die Polarlandschaft der moränenübersäten Hochplateaus. Von Palmen und weichem Sand hatte sie geträumt, nun musste sie einsehen, dass die Wüste anders war, dass sie nur aus Stein bestand, Stein allüberall: auf der Erde, wo im Gestein dürre Gräser wuchsen, wie im Himmel, wo der kalte, knirschende Staub des Gesteins allmächtig herrschte.
Aus: Albert Camus, Die Ehebrecherin
»Jeder wach gewordene und wirklich zum Bewusstsein gekommene Mensch geht ja einmal oder mehrmals diesen schmalen Weg durch die Wüste – den anderen davon reden zu wollen, wäre vergebliche Mühe.
(Hermann Hesse)
»Wenn ich einen Gottlosen bekehren wollte, würde ich ihn in eine Wüste verbannen.
(Sir Julien Sorell Huxley)
• wandern die Israeliten durch die Wüste
VIERZIG JAHRE
• leben sie unter der Herrschaft der Philister
• währt jeweils die Herrschaft der Könige David und Salomo
• sind sowohl Isaak als auch Esau alt, als sie heiraten
VIERZIG TAGE
• dauert die Sintflut
• hält sich Mose auf dem Berg Sinai auf
• wandert der Prophet Elija zum Berg
Horeb/Sinai

• wird Ninive von Gott geprüft
• fastet Jesus in der Wüste
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Ex 3,1
Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Ex 16,2 f.
Gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kundwürde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Dtn 8,2
Er fand ihn [Israel] in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Dtn 32,10 f.
1. Arbeiten Sie aus den Bibelzitaten unterschiedliche Akzentuierungen und Deutungen des Wüstenmotivs heraus. Mit der Exodustradition beschäftigen Sie sich auf S. 114 f. genauer.
2. Der Ikonenmaler verwandelt die Wüste in einen »heiligen Ort«. Beschreiben und deuten Sie die Ikone unter diesem Aspekt.
3. Die 40 steht in der Bibel für ein Lebensalter, symbolisiert aber auch Umkehr und Bewährung. Recherchieren Sie die links aufgeführten Beispiele und versuchen Sie eine Deutung.
Im Islam wird Abrahams Sohn Ismael als Stammvater verehrt. Von seiner Mutter Hagar wird Folgendes erzählt:
Als Hagar noch ihren Sohn Ismael stillte, brachte Abraham sie eines Tages an den Ort, an dem heute die Kaaba steht und der Brunnen Zamzam fließt. Damals war dort aber nur Wüste.
Er ließ sie dort sitzen und gab ihr einen Lederbeutel mit Datteln und einen gefüllten Wasserschlauch. Hagar lief ihrem Mann nach und fragte ihn: »Abraham!
Wohin gehst du, dass du uns hier zurücklässt, wo nichts ist?«, und als Abraham keine Antwort gab: »Hat Allah dir das befohlen?« Er sagte: »Ja.« Sie sagte: »Dann wird Er uns nicht vernachlässigen«, und kehrte zurück, während Abraham wegging. Bald aber waren das Wasser im Schlauch und die Dat
teln im Beutel aufgebraucht und die Muttermilch begann zu versiegen. Das Kind wurde durstig und wälzte sich vor Schmerzen.
Diesen Anblick ertrug Hagar nicht und sie begann eilig jemanden zu suchen, der ihr helfen könnte. In großer Verzweiflung rannte sie zwischen den Bergen Safa und Marwa hin und her, um von den Gipfeln aus jemanden zu erspähen. Doch sie fand keine Hilfe.
Als sie den Berg Marwa zum siebten Mal erreicht hatte, hörte sie aber eine Stimme, sie lauschte aufmerksam und bat: »Oh, wer immer du auch sein magst, du hast mich deine Stimme hören lassen; hast du etwas, um mir zu helfen?« Und siehe, ein Engel stand an der Stelle von Zamzam und grub mit der Ferse den Boden um, bis an dem Ort eine Quelle entsprang. Eilig grub Hagar ein Becken um die Quelle, um sie zu fassen, und füllte ihren Schlauch und trank davon, sodass sie bald auch ihren Sohn wieder stillen konnte.
Der Engel sagte zu ihr: »Fürchte dich nicht, vernachlässigt zu werden, denn dies ist das Haus Allahs, das von diesem Jungen und seinem Vater gebaut werden wird, und Allah vernachlässigt niemals sein Volk.«
Die Suche Hagars nach Wasser ist bis heute ein zentraler Teil der Rituale bei der Wallfahrt nach Mekka.


1. Vergleichen Sie die islamische Fassung der HagarGeschichte mit Gen 21,8–21. Beachten Sie dabei insbesondere die Haltung Hagars.
2. Beschreiben und deuten Sie das Bild von C. Rohlfs links unter Berücksichtigung seines Titels. Beziehen Sie es auf die beiden Fassungen der Geschichte.
3. Die Geschichte von Hagar in der Wüste wird – als Gründungsgeschichte der Muslime – jedes Jahr von Pilgern nachvollzogen. Deuten Sie die Erzählung vor diesem Hintergrund.
• Der jüdische Prediger Johannes der Täufer reinszenierte am Jordan den erneuten Einzug des Volkes Israel in das Gelobte Land. Durch die Taufe vom Staub der Wüste – also den Sünden – gereinigt, konnten die Gläubigen das anbrechende Reich Gottes betreten.
• Im Neuen Testament wird die Wüste als Ort der Bewährung und der Verwandlung verstanden. In der Wüste begegnen den Suchenden sowohl Gott als auch Dämonen.
• Im 3. Jahrhundert suchten erste christliche Einsiedler (Eremiten) in der Wüste Ägyptens Schutz, »Herzensruhe« und Gottesnähe. Die »Wüstenväter« (und mütter) wurden zu gefragten Ratgebern. Später schlossen sich Männer und Frauen zu ersten monastischen Gruppen zusammen – die Vorläufer der Klöster.
• In der geistlichen Literatur des Mittelalters verwandelt sich die Wüste ganz zum literarischen Ort, zur Metapher für Spiritualität, Askese und Meditation. Europäische Eremiten suchen die »Wüste« oft im Wald.
Wüste und trockenes Land werden sich freuen, und die Steppe wird jauchzen und blühen wie die Lilie. Üppig wird sie blühen und jauchzen, jauchzen und jubeln! Jes 35,1–2 (Zürcher Bibel)
ANFECHTUNG – UND VERWANDLUNG
1. Lesen und deuten Sie Mk 1,1–12 unter dem Aspekt der Wüste als »Zwischen-Raum«.
2. Markus verrät nicht, worin die Versuchung Jesu bestand. Matthäus füllt die Lücken (Mt 4,1–11). Beziehen Sie die drei Versuchungen auf Jesu Leben und Botschaft [9]
3. Beschreiben Sie das Bild von B. Riviere und deuten Sie seine Darstellung der Wüstenerfahrung Jesu.

4. Suchen Sie weitere Darstellungen von Jesus in der Wüste bzw. Jesu Versuchung in der bildenden Kunst und vergleichen Sie diese.
5. Endzeitlich bleibt die Wüste nicht Wüste. Deuten Sie die Prophezeiung im Buch Jesaja oben.
»UND WÜRD’ ER IN KETTEN GEBOREN«
1. Deuten Sie den unten abgebildeten Raum als Zwischenraum.
2. Ein Freiraum? Lassen Sie Betroffene (Künstlerinnen und Künstler, Personal, Insassen) ein fiktives Gespräch über die Kunstaktion führen.
3. Erläutern Sie die Zitate von F. Schiller auf dieser Doppelseite mithilfe des Textes von J. Berger ( S. 19). Identifizieren Sie den Gedanken des Zwischenraums darin. Falls Sie schon Dramen von F Schiller gelesen/gesehen haben: Erinnern Sie sich an Szenen, in denen Freiheit eine Rolle spielt.

4. Deuten Sie die Kunstaktion in der JVA aus der Perspektive von F. Schiller.

5. Kunst als Freiraum, als Zwischenraum – tauschen Sie sich über Beispiele im eigenen Leben, in der Schule und in der Öffentlichkeit aus.
6. »Ohne Kultur …« – lassen Sie sich von der Abbildung auf S. 19 zu eigener »Werbung für die Kunst« anregen.
Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und würd er in Ketten geboren, Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei, Nicht den Mißbrauch rasender Toren. Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, Vor dem freien Menschen erzittert nicht.
AUS: FRIEDRICH SCHILLER, WORTE DES GLAUBENS
AnMERKung: Über die Freiheit der Kunst lässt sich streiten.
Zwischen 2012 und 2015 gestalteten Streetart-Künstlerinnen und -Künstler die Wände in der Schweizer Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Wo früher grauer Beton war, weiden jetzt Kühe, wachsen Bäume und Blumen, fliegen Frösche und Schmetterlinge und bringen abstrakte Kompositionen Farbe ins Leben der Angestellten und Gefangenen.

Um die Menschheit und um die Gesellschaft stand es Anfang der 1790er Jahre nicht gut. Die Revolution in Frankreich hatte im Terror geendet; die Stimmung im Volk schwankte zwischen Ratlosigkeit und Aktivismus. Die Geistesgeschichte – »das Denken« – machte hingegen große Sprünge. Philosophen, Pädagogen, Gesellschaftstheoretiker und Dichter sahen die Gelegenheit, nun endlich alles neu zu ordnen, Kunst, Kultur, Staat und Gesellschaft in neue Beziehung zueinander zu bringen und damit die Menschheit aufs richtige Gleis zu setzen.
Wie man die zunächst erkämpfte und vermeintlich erlangte Freiheit und Selbstbestimmung wiedererlangen und letztlich auf Dauer sichern könne, darüber war man sich nicht einig. Heute käme angesichts einer politischen Krise wohl kaum jemand auf die Idee, eine Lösung gerade von der Kunst zu erhoffen. Doch genau dies tat Friedrich Schiller. Und lieferte eine Erklärung dafür in seinen 27 Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«, die er schubweise in der von ihm herausgegebenen Literaturzeitschrift »Die Horen« veröffentlichte.
Zunächst analysierte er die Lage und fand beißende Worte über die moderne Gesellschaft – Worte, die uns heute nur allzu aktuell und vertraut erscheinen, allen voran der Begriff der Entfremdung. Schiller glaubte an die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit; doch aus seiner Sicht kontrollierten die »Mechanismen des Zwanghaften« diese Freiheit. Reduziere man den Menschen auf nur wenige Aufgaben, erniedrige man ihn. Vor Schiller hatte bereits Immanuel Kant* die Freiheit als Idealzustand postuliert. Schiller wollte mit seinen Briefen den Weg zu ihr weisen:
Die »ästhetische Erziehung« will die Zersplitterung der menschlichen Triebe in der Moderne aufheben. Das heißt für Schiller, auf ein bisher noch unerreichtes,
harmonisches Ideal hinzuarbeiten – und das ohne Zwang. Wodurch kann das gelingen? Nur indem man sich der Schönheit zuwende.
»Durch die Schönheit wird der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und der Sinnenwelt wiedergegeben.«
Die Ästhetik stellt somit für Schiller die einzige Möglichkeit dar, Gefühle mithilfe der Vernunft zu gestalten und so zwischen Natur und Vernunft zu vermitteln –und das auf spielerische Weise. Gelingt dies, ist viel gewonnen. Der Kunst kommt dann nämlich ein doppelter Sinn zu: Sie ermöglicht auf der einen Seite persönliches Glück und erfüllte Lebensführung und verändert dadurch auf der anderen Seite die Gesellschaft ins Positive. Denn es ist »die Schönheit ..., durch welche man zur Freiheit wandert«.
Jens BergerDie schönsten Träume von Frei- heit werden ja im Kerker ge- träumt.
Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze baut der ästhetische Bildungstrieb un- vermerkt an einem dritten, fröhli- chen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse ab- nimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.
Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.

Bei der Gestaltung architektonischer Konzepte für Bildungseinrichtungen kommt seit einiger Zeit zunehmend in den Blick, dass der Raum von pädagogischer Bedeutung ist.

HINAUS:
Bei zukunftsorientierter Gestaltung von (hoch)schulischen Lernräumen geht der Trend dahin, die klassischen Strukturen und Grenzen des Klassenzimmers (bzw. Seminarraums) aufzulösen, z. B.

• durch eine flexibel veränderbare Möblierung, was unterschiedliche Arten des Bespielens ermöglicht
• durch Unterteilen in Zonen mit Ausstattung für unterschiedliche Aktivitäten
• Einbeziehen von Zwischenräumen (Flure, Foyers, Nischen)
Aus einer Präsentation zum Thema »Lernräume der Zukunft – Die Wechselwirkung zwischen Raum und Lernen«
Entdecken Sie Zwischenräume in den Bildern ( S. 20) und vergleichen Sie, wie diese gestaltet sind.
Nehmen Sie Zwischenräume an der eigenen Schule wahr und fotografieren Sie diese. Berücksichtigen Sie dabei sowohl solche, die von den Architekten und Architektinnen bewusst gestaltet wurden – und auch solche, die nicht in eine Hochglanzbroschüre über zukunftsweisende Schularchitektur aufgenommen werden würden. Vielleicht wollen Sie die Fotos in einer kleinen Ausstellung im Schulgebäude zeigen?
Notieren Sie, wie schulische Zwischenräume genutzt werden – von den Schülerinnen und Schülern und ggf. auch von anderen Personen. Nehmen Sie dabei auch wahr, ob und unter welchen Bedingungen solche Räume »dazwischen« zu Freiheitsräumen werden.
Gibt es an Ihrer Schule auch Wüsten-Orte im Sinne von S. 14–17? Tauschen Sie sich aus und entwickeln Sie ggf. Ideen, wie man solche schaffen könnte.
Tauschen Sie sich darüber aus, welche Zwischen- und Freiheitsräume es in der Schule braucht, um auf dem Weg zum Erwachsensein optimal unterstützt zu werden.

Was haben Sie dazugelernt (vgl. S. 9)?
Was möchten Sie sich merken?
Welche Methoden bzw. Materialien haben Sie besonders angesprochen?
Was wird Sie weiter beschäftigen?
Welche Fragen bleiben offen?
Skizzieren Sie eigene Vorschläge, wie eine »Schule der Zukunft« Ihrer Meinung nach architektonisch oder künstlerisch gestaltet sein sollte. Berücksichtigen Sie dabei auch, welche Bedeutung Sie der Freiheit in einer »Schule der Zukunft« beimessen.
Kann man vernünftig glauben?
Sind wir aufgeklärter als die Aufklärung?
Ab wann ist man erwachsen?
Nicht selbst denken: Geht das überhaupt?
Reicht Vernunft aus?
Bin ich vernünftig?
Lernbereiche: »Glaube und Vernunft – alte und neue Herausforderungen«, »Freiheit leben«
Die Aufklärung hat die abendländische Kultur und Geschichte maßgeblich geprägt. Sie geben Grundgedanken dieser Zeit wieder und beschreiben philosophische und künstlerische Ansätze, die sich mit der starken Betonung der Vernunft oder aufklärerischem Fortschrittsoptimismus auseinander setzen. Außerdem lernen Sie Verhältnisbestimmungen von Vernunft und Glaube kennen.

Sie nehmen wahr, welche Herausforderungen sich aus der aufklärerischen Sicht auf die Welt für den christlichen Glauben ergeben haben. Den Umgang mit diesen Herausforderungen untersuchen Sie an historischen Beispielen auch unter Einbezug gegenwärtiger Entwicklungen. Sie erschließen einen modernen theologischen Entwurf, der Glaube und Vernunft konstruktiv aufeinander bezieht.
Sie reflektieren, was Mündigkeit ausmacht und inwiefern das Thema in Ihrem Leben eine Rolle spielt. Die Entwicklungen der Aufklärungszeit haben die Frage aufgeworfen, ob der Glaube in einer naturwissenschaftlich geprägten Welt Platz hat. Sie beurteilen Einschätzungen dieser Frage, prüfen Kriterien für eine differenzierte Sicht auf das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft und beziehen selbst Stellung.
In der Öffentlichkeit wird das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft manchmal sehr pauschal und undifferenziert zur Sprache gebracht. Sie tauschen sich über damit verbundene Kommunikationsstrategien aus und formulieren Einwände. Sie entwickeln anlässlich eines Beispiels für den Grundschulbereich eigene Ideen für Materialien zum Thema Evolution und Schöpfung und können diese gestalten.
Am Ende Ihrer schulischen Laufbahn sollen Sie laut dem Erziehungs- und Bildungsauftrag des Gymnasiums dazu fähig sein, »Gegebenes kritisch zu reflektieren«. Denken Sie zunächst darüber nach, was »kritisch reflektieren« bedeuten kann und halten Sie Ihre Überlegungen in einer Mindmap fest. Ergänzen Sie diese im Laufe des Kapitels. Überlegen Sie anschließend, wie in den einzelnen Schulfächern kritisch reflektiert wird: Ist man in Religion anders kritisch als in Biologie? Wie verhält es sich mit dem Kritisch-Sein in Fächern wie Deutsch, Kunst und Chemie? Sie können auch einzelne Fachlehrkräfte dazu befragen und ein Radiofeature erstellen, das Ergebnisse aus Ihren Mindmaps sowie O-Töne aus den Gesprächen enthält.




In der Berlinischen Monatsschrift stellten Philosophen, Theologen, Politiker und Kulturschaffende zwischen 1783 und 1796 Gedankengut der Aufklärung zur Diskussion. Immanuel Kants* Essay zur im Jahr zuvor in der Zeitschrift von Pfarrer Johann Friedrich Zöllner aufgeworfenen Frage »Was ist Aufklärung?« wird als die klassische Antwort angesehen.
Mutiger zu werden, ist gar nicht so schwer. Du musst nur anfangen und dich kontinuierlich mit kleinen Übungen herausfordern. Am Anfang beginnst du am besten mit kleinen Schritten. Mit der Zeit fallen dir einige Dinge mit Sicherheit leichter und du wirst Veränderungen feststellen.
Was du denkst, hat Einfluss darauf, wie du dich fühlst und wie du handelst. Versuche, positiv zu denken.
Habe keine Angst davor, neue Wege zu gehen und dich auf ungewohnte Dinge einzulassen. Beginne mit etwas so Simplem wie einem neuen Weg zur Arbeit.
Traue dich, nein zu sagen, wenn dir danach ist. Mache dir keinen Stress, nur um anderen Menschen zu gefallen, sondern kläre zunächst mit dir selbst, wonach du dich fühlst. Lächle fremde Menschen an und schaue ihnen dabei in die Augen. Lächeln macht nicht nur dich froh, sondern auch deine Mitmenschen.
Du wirst nicht von einem auf den anderen Tag zu einer Person, die keine Hemmungen mehr hat. Wie mutig du im Endeffekt bist und wie schnell du mutiger wirst, hängt auch von deiner Persönlichkeit ab. Lass dir also genügend Zeit, dich weiterzuentwickeln, und mache dir selbst keinen Druck.
Isabelle Bach in einem Online-Magazin für persönliche und berufliche Weiterbildung
MUT
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt, das sagt heraus

Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’ s wagen
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
Wenn alle mittun, steht allein
Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht
LOTHAR ZENETTI
1. Mut – erstellen Sie ein Cluster mit passenden Begriffen und Gegenbegriffen.
2. Mutig-Sein: Halten Sie eigene Erfahrungen und Gedanken dazu fest.
3. Beschreiben und deuten Sie die Skulptur auf S. 24. Beziehen Sie Ihre Gedanken zu Mut (Impuls 1 und 2) ein.
4. Stellen Sie selbst verschiedene Haltungen, die Mut ausdrücken, nach und fotografieren Sie diese. Achten Sie dabei auch auf Kameraperspektive und -einstellung: Ergeben sich neue Erkenntnisse zu Mut?
5. Überlegen Sie, in welchen Situationen die Imperative in L. Zenettis Gedicht passend und in welchen sie eher unpassend wären. Beziehen Sie in Ihre Überlegungen auch den Cartoon mit ein.
6. Schreiben Sie weitere Strophen für das Gedicht.
7. Es gibt viele Ratgeber mit Tipps zum Thema Mut. Diskutieren Sie über den Sinn solcher Ratgeber und die konkreten Vorschläge im Beispiel links oben. Vielleicht mag jemand diese Tipps eine Zeit lang ausprobieren und davon berichten.
Jemand ist volljährig, voll geschäftsfähig und auch straffähig. Er oder sie hat die vollen Bürgerrechte, kann wählen gehen und selbst gewählt werden. Gemeint ist damit auch Selbstbestimmung und Urteilsfähigkeit. Man spricht oftmals von »mündigen Bürgern« und meint damit, dass die Bürger und Bürgerinnen nicht nur für sich selbst Verantwortung übernehmen, sondern auch für ihren Staat und ihre Gesellschaft.
Abgeleitet von »Mündigkeit« ist die Bezeichnung »Mündel«. Dabei handelt es sich um eine minderjährige Person, die unter Vormundschaft steht. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn ein Minderjähriger Waise wird oder aus einem anderen Grund nicht mehr unter elterlicher Obhut und Sorge ist. Bundeszentrale für politische Bildung 2021
Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, […] nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: Räsonniert (Denkt) nicht! Der Offizier sagt: Räsonniert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: Räsonniert nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: Räsonniert nicht, sondern glaubt! […] Hier ist überall Einschränkung der Freiheit.
1. Klären Sie Begrifflichkeiten und Wendungen im berühmten Auszug aus Kants* Essay ( S. 25). Notieren Sie erste Fragen und Erkenntnisse.

2. Kant ( S. 25) verwendet scharfe Kontraste: Stellen Sie diese einander gegenüber und arbeiten Sie heraus, was aus seiner Sicht für Mündigkeit nötig ist.
3. »… ohne Leitung eines andern« – Eine Illusion? Eine Absage an Schule und Bildung? Und warum braucht es dafür Mut? – Diskutieren Sie Kants Forderung unter Einbezug der Doppelseite.
4. Erläutern Sie die juristischen Aspekte zu »Mündigkeit« mit Beispielen. Ziehen Sie Verbindungen zu den Ausführungen von I. Kant*.
5. Empfinden Sie sich als mündig? Notieren oder gestalten Sie Ihre Gedanken dazu.
6. Deuten und diskutieren Sie die Karikatur.

7. Links finden Sie weitere Gedanken aus Kants* Essay »Was ist Aufklärung?«. Tauschen Sie sich darüber aus, ob die darin genannten Instanzen, die sich gegen das Denken richten, noch aktuell sind.
BeMERKenswert: Denken allein reicht nicht!
THEOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE SCHRIFTEN AUS DER ZEIT DER AUFKLÄRUNG

• Ein Versuch über den menschlichen Verstand
John Locke*, 1690
• Über den richtigen Gebrauch des Verstandes
David Hume*, 1706
• Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet

Chr istian Wolff*, 1719
• Über die Fortschritte des menschlichen Geistes
Anne Robert Jacques Turgot*, 1750
• Über die Unsterblichkeit der Seele
David Hume*, 1757
• Über die Evidenz der Beweise für die Wahrheit der christlichen Religion
Johann Daniel Schumann*, 1778
• Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
Immanuel Kant*, 1793
Die Radierungen Daniel Chodowieckis, 1791, sind Teil einer Bilderfolge für den Göttinger Taschenkalender unter dem Titel »sechs große Begebenheiten des vorletzten Decenniums [Jahrzehnts]«. Die zweite Radierung zeigt Minerva, die römische Göttin der Weisheit, vor Vertretern verschiedener Religionen.

BeMERKenswert: Manches wirkt fast religiös.
1. Erstellen Sie eine Übersicht, in der Sie Grundgedanken der Aufklärung* festhalten, die Sie in anderen Fächern kennengelernt haben. Ergänzen Sie weitere Erkenntnisse im Laufe der Unterrichtseinheit.
2. Zeigen Sie auf, inwiefern sich aufklärerisches Denken in den Titeln der Aufklärungsschriften (links) spiegelt
3. Deuten Sie die Radierungen oben vor dem Hintergrund ihrer Titel und beziehen Sie das Merke mit ein.
Unsere Tage füllten den glücklichsten Zeitraum des 18. Jahrhunderts. Kaiser, Könige, Fürsten steigen von ihrer gefürchteten Höhe menschenfreundlich herab, verachten Pracht und Schimmer, werden Väter, Freunde und Vertraute ihres Volkes. Die Religion zerreißt das Pfaffengewand und tritt in ihrer Göttlichkeit hervor. Aufklärung geht mit Riesenschritten. Tausende unserer Brüder und Schwestern, die in geheiligter Untätigkeit lebten, werden dem Staat geschenkt. Glaubenshass und Gewissenszwang sinken dahin. Menschenliebe und Freiheit im Denken gewinnen die Oberhand. Künste und Wissenschaften blühen, und tief dringen unsere Blicke in die Werkstatt der Natur. Handwerker nähern sich gleich den Künstlern ihrer Vollkommenheit, nützliche Kenntnisse keimen in allen Ständen. Hier habt ihr eine getreue Schilderung unserer Zeit. Blickt nicht stolz auf uns herab, wenn ihr höher steht und weiterseht als wir; erkennt vielmehr aus dem gegebenen Gemälde, wie sehr wir mit Mut und Kraft euren Standort emporhoben und stützten. Tut für eure Nachkommenschaft ein Gleiches und seid glücklich.
1. Arbeiten Sie aufklärerische Ideale und Haltungen aus der Grundsteinurkunde heraus. Diskutieren Sie, ob es sich eher um eine Beschreibung oder eine Vision handelt.
2. Sammeln Sie Errungenschaften der Aufklärung, welche auch heute von Bedeutung sind.
3. Deuten Sie den Filmtitel und die Plakatgestaltung unten und diskutieren Sie sie. Stellen Sie Bezüge zur Aufklärungszeit her.

4. Suchen Sie in Werbungen Fortschrittsgedanken und bewerten Sie diese.
5. Lassen Sie sich von der Grundsteinurkunde anregen: Füllen Sie selbst einen Grundstein für unsere Nachfahren oder für eine Raumsonde.
Als Zeitalter der Aufklärung (engl. enlightenment; franz. siècle des lumières) wird v. a. das 18. Jh. angesehen. Es wird häufig als Zeitalter des Aufbruchs und Fortschritts verstanden, in dem modernes kritisches Denken seine Anfänge hat. Gedanken der Aufklärung wurzeln im Empirismus und im Rationalismus. Im Empirismus ist Grundlage aller Erkenntnis das sinnlich Wahrnehmbare, das zum Beispiel durch Messen, Zählen oder Wiegen bestimmt werden kann. Der Rationalismus gesteht verlässliche Einsichten über die Welt nur der Vernunft und dem streng logischen Denken zu. Beide Perspektiven führten zu einer Abkehr von übernatürlichen Erklärungen von Welt, Staat und Gesellschaft und befeuerten die Entwicklung der modernen Wissenschaften. Aufklärer waren davon überzeugt, dass mit den Mitteln der Vernunft überkommene Vorstellungen und Vorurteile durch kritische Prüfung überwunden werden können und sich jeder und jede Einzelne durch Bildung zum Positiven weiterentwickeln und vervollkommnen wird.
DER MENSCH, DER ERSTE FREIGELASSENE DER SCHÖPFUNG (1784)
Das Tier ist nur ein gebückter Sklave; wenngleich einige edlere derselben ihr Haupt empor heben oder wenigstens mit vorgerecktem Halse sich nach Freiheit sehnen. Ihre noch nicht zur Vernunft gereifte Seele muss notdürftigen Trieben dienen und in diesem Dienst sich erst zum eigenen Gebrauch der Sinne und Neigungen von fern bereiten. Der Mensch ist der erste Freigelassene der Schöpfung; er stehet aufrecht. Die Waage des Guten und Bösen, des Falschen und Wahren hängt in ihm; er kann forschen, er soll wählen. […] Selbst im ärgsten Missbrauch seiner Freiheit ist er noch König. Er darf wählen, wenn er auch das Schlechteste wählte; er kann über sich gebieten, wenn er sich auch zum Niedrigsten aus eigener Wahl bestimmte. Vor dem Allsehenden, der diese Kräfte in ihn legte, ist freilich sowohl seine Vernunft als auch seine Freiheit begrenzt. […] In der Sache selbst aber und in der Natur des Menschen wird dadurch nichts geändert. Er ist und bleibt für sich ein freies Geschöpf, obwohl die allumfassende Güte ihn auch in seinen Torheiten umfasset und diese zu seinem und dem allgemeinen Besten lenket. Wie kein getriebenes Geschoss der Atmosphäre entfliehen kann; aber auch, wenn es zurück fällt, nach ein und
(1757)
Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet; der Mensch, ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet: der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güt’ und Größe.
CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (EG 506)denselben Naturgesetzen wirket, so ist der Mensch im Irrtum und in der Wahrheit, im Fallen und Wiederaufstehen Mensch, zwar ein schwaches Kind, aber doch ein Freigeborener; wenn noch nicht vernünftig, so doch einer bessern Vernunft fähig; wenn noch nicht zur Humanität gebildet, so doch zu ihr bildbar.
 Johann Gottfried Herder*
Johann Gottfried Herder*
»Erkenne dich selbst, versuche nicht, Gott zu durchschauen. Der wahre Forschungsgegenstand der Menschheit ist der Mensch. (Alexander Pope, 1734)
»Der Mensch ist der einzigartige Begriff, von dem man ausgehen und auf den man alles zurückführen muss. (Denis Diderot, 1755)
»SELBST IM ÄRGSTEN MISSBRAUCH SEINER FREIHEIT IST ER NOCH KÖNIG«
1. Imaginieren Sie unterschiedliche Kontexte, in denen die Vektor-Illustration oben eingesetzt werden könnte. Deuten Sie die obige Darstellung des Menschen in den jeweiligen Kontexten.
2. Arbeiten Sie J. G. Herders Sicht auf den Menschen heraus und diskutieren Sie darüber.
3. Vergleichen Sie J. G. Herders Verständnis vom Menschen und die Darstellung der Vektor-Illustration miteinander.
4. »Zwar ein schwaches Kind, aber doch ein Freigeborener …« – Vergleichen Sie J. G. Herders Gedanken mit Luthers Freiheitsschrift* [8]
5. Identifizieren Sie Gedanken der Aufklärung* bei J. G. Herder, im Liedtext von Ch. F. Gellert und in den Zitaten.
Die letzte Aufgabe unseres Daseins [ist,] dem Begriff der Menschheit in unserer Person sowohl während der Zeit unseres Lebens als auch noch über dasselbe hinaus durch die Spuren des lebendigen Wirkens, die wir zur ücklassen, einen so großen Inhalt als möglich zu verschaffen. Diese Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung. (1794)
Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes – Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versetzt, bildet sich minder aus. (1792)
Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum andern überzugehen. (1809)
AUS DEN BILDUNGSZIELEN DER UN 2015:
BIS 2030 WOLLEN DIE UN …
– sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.
– Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts auf allen Bildungsstufen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen sichern, einschließlich Menschen mit Behinderung, indigenen Völkern und benachteiligten Kindern.

1. Erarbeiten Sie das Humboldt’sche Bildungsideal. Erläutern Sie seine Vorstellungen mit eigenen Worten und suchen Sie dafür ggf. nach Beispielen.
2. Führen Sie ein Schreibgespräch darüber, welche Folgerungen und Konsequenzen sich aus Humboldts Vorstellungen ergeben.

3. Diskutieren Sie mit Blick auf die beiden Materialien und ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen, inwieweit die Bildungsideale Humboldts umgesetzt sind.
4. Recherchieren Sie nach aktuellen Zahlen zur Chancen(un)gleichheit in der Bildung. Lassen Sie sich von der UN-Agenda anregen und formulieren Sie eigene Bildungsziele für die Zukunft.
»Es besteht kein Zweifel, dass der Lebensform des Lehrens und Lernens das größte Wohlgefallen Gottes gilt.«
Eine typische GottesDarstellung in der Grundschule
NATÜRLICHE RELIGION UND DEISMUS

• Aufklärerisches Denken hatte Auswirkungen auf das Verständnis von Religion. Sofern es nicht zu Atheismus* führte, wurden im Licht der Vernunft und durch den Aufweis z. B. außerbiblischer Einflüsse übernatürliche Phänomene wie die Auferstehung, Wunder oder eine direkte Gottesoffenbarung abgelehnt. Im englischen Deismus* entstand daraus im 17. Jh. die Vorstellung einer natürlichen UrReligion, die durch die geschichtlichen Offenbarungsreligionen verfälscht worden sei. Aus der Ordnung der Natur könne man zwar auf einen Schöpfergott schließen, über den man aber ansonsten nichts wisse, da er nicht mehr ins Weltgeschehen eingreife. Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte daraus das Sprachbild Gottes als Uhrmacher, der die Welt so perfekt hergestellt und in Gang gesetzt habe, dass ein Eingreifen nicht nötig sei. • Die Vorstellung einer natürlichen Religion gewann große Attraktivität. Als zentrale Wahrheiten wurden u. a. angesehen: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit der Seele und tugendhaftes Verhalten ( vgl. S. 33).
Unter der natürlichen Religion verstehe ich den Glauben, dass ein Gott ist, und dass man diejenigen Pflichten sich vorstellt und ausübt, welche aus unserer Erkenntnis Gottes und seiner Vollkommenheiten als auch unserer selbst und unserer eigenen Unvollkommenheiten und endlich von der Verbindung, in der wir mit Gott und unseren Nebenmenschen stehen, entspringen. Die natürliche Religion begreift also alles dasjenige in sich, was in der Vernunft und in der Natur der Dinge gegründet ist.
Die christliche Religion stimmt mit dem Gesetz der Natur völlig überein, dergestalt, dass sie nichts verbietet, was dieses fordert, noch etwas fordert, was dieses verbietet. Die natürliche oder vernünftige Religion, welche einem jeden von uns bei der ersten Schöpfung ins Herz geschrieben worden ist, ist aber nun der Probierstein jeder geoffenbarten Religion. Und wenn diese nur in einem einzigen Stück von der natürlichen und vernünftigen Religion abweicht, auch nur in dem allergeringsten Umstand, so ist dieses allein ein genügender Gr und, wodurch alles andere, was man zur Verteidigung derselben beibringen kann, ganz und gar unkräftig gemacht wird. (1730)
1. Tauschen Sie sich über vertraute Gottesbilder wie das oben aus. Überlegen Sie, welche Konsequenzen, aber auch Probleme sich aus ihnen ergeben.
2. Arbeiten Sie aus Info und M. Tindals Ausführung Kennzeichen der »natürlichen Religion« heraus. Beziehen Sie sie auf Ihre vorherige Diskussion.
3. Was bleibt mit M. Tindals Sicht vom christlichen Glauben übrig? Beziehen Sie seine Überlegungen auf das Credo [5], [6], [7]. Diskutieren Sie die rationalistische Auslegung des Kreuzestodes (rechts).
Der Kreuzestod erfolgte im Allgemeinen durch Erstarrung, die von außen nach innen zunahm. Nun »starb« aber Jesus auffallend rasch. Der laute Ruf, bevor er das Haupt sinken lässt, zeigt an, dass seine Kraft noch lange nicht erschöpft war, sondern dass es sich um eine totenähnliche Erstarrung gehandelt haben kann. Das kühle Grab und die Gewürze setzten die Wiederbelebung fort, bis dann das Gewitter und das Erdbeben Jesus vollends zur Besinnung brachten. Glücklicherweise wurde so auch der Stein von der Öffnung entfernt. Der Herr legte die Binden im Grab ab und verschaffte sich einen Gärtnersanzug. Darum meint Maria, Joh 20,15, mit dem Gärtner zu reden.
Heinrich Eberhard Gottlob Paulus* (1761–1851)Die reine Lehre Christi, welche aus seinem eigenen Munde geflossen ist, […] enthält nichts als eine vernünftige praktische Religion. Folglich würde ein jeder vernünftige Mensch, wenn es einer Benennung der Religion brauchte, sich von Herzen christlich nennen. […] Nein, es ist wahr, wir glauben das nicht, was das heutige Christentum zu glauben verlangt, und können es aus wichtigen Ursachen nicht glauben; dennoch sind wir keine ruchlosen Leute, sondern bemühen uns, Gott nach einer vernünftigen Erkenntnis demütigst zu verehren, unsern Nächsten aufrichtig und tätig zu lieben, die Pflichten eines rechtschaffenen Bürgers redlich zu erfüllen und in allen Stücken tugendhaft zu wandeln.
aus: Fragment eines Ungenannten, 1774
1. Positionieren Sie sich zu den Aussagen (unten).
2. Zeigen Sie Parallelen zwischen H. S. Reimarus* und M. Tindal* ( S. 32) auf.
3. Weisen Sie in den Liedern und Predigtthemen Einflüsse aufklärerischen Denkens nach. Deuten Sie diese Einflüsse als Herausforderungen für den eigenen Glauben und als Versuche, mit diesen Herausforderungen umzugehen.
4. W. W. J. D. am Handgelenk. Deuten Sie eine solche Glaubenshaltung und diskutieren Sie sie vor dem Hintergrund dieser Doppelseite.
»Jesus war ein vorbildlicher Mensch –nicht mehr und nicht weniger.
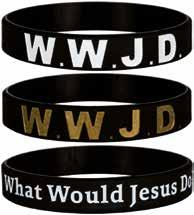
»Jesus stellt uns immer wieder vor neue Aufgaben und hilft uns dabei, sie zu lösen.
»In der christlichen Religion sind wichtige Werte überliefert, ohne die der Einzelne oder die Gesellschaft nicht bestehen könnte.
AUS GEISTLICHEN LIEDERN DES 18. JH.S
1. Kinder geht zur Biene hin! / Seht die kleine Künstlerin, / Wie sie emsig sich bemüht, / Und aus allem Honig zieht. / Unverdrossen duldet sie / Ihres kurzes Lebens Müh, / Ist geschäftig spät und früh.
2. Advent:
Über Schaden, welchen die Unmäßigkeit in Essen und Trinken unter uns anzurichten pflegt.
Christnacht:
Trost aus der Geburt Christi bei schlaflosen Nächten.
1. Weihnachtstag:
Über die Abhärtung der Hirten und Warnung vor dem Gebrauch der Pelzmützen.
Über den Nutzen der Stallfütterung.
Ostersonntag:
Über die Gefahr des Lebendigbegrabenwerdens.
Über das Frühaufstehen.
Über die Gespensterfurcht.
Vernünftige Regeln für Christen, wie sie ihre Leichen begraben sollen.
2. Und wir wollen müßig sein? / Froh will ich dem Fleiß mich weihn, / Arbeitsamer sein als sie; / Ich, dem Gott Verstand verlieh, / Meines Lebens erste Zeit / Sei in muntrer Tätigkeit / Gott und meinem Glück geweiht.
1. Kein Lehrer ist dir, Jesu, gleich. An Weisheit und an Liebe reich, bist du sowohl durch Wort als Tat, der schwachen Menschen sich’rer Rat. […]
5. Du lehrest uns durch Wort und Tat. Man trifft der reinsten Tugend Pfad in deinem heil’gen Wandel an. Gib, Herr, dass ich auf dieser Bahn, gestärkt von dir, mit steter Treu dir nachzufolgen eifrig sei!
In der Epoche der Romantik wird Vernunftdenken infrage gestellt. Romantiker kritisierten am aufklärerischen Denken den sog. »Primat der Vernunft« als alleiniges Kriterium zur Erkenntnis von Wirklichkeit
Das Wesentliche ist immer hinter dem Horizont. Das Wesentliche ist immer hinter dem Sichtbaren. Alles, was mich als selbstverständliche Wirklichkeit umgibt, ist nur Schein und vordergründig und vorläufig. Da ist noch eine zweite Welt, und auf die allein kommt es an. Es gibt Menschen, die sehen durch die vordergründige Welt hindurch, und Menschen, die sehen nur diese allein. Es kommt auf die Augen an. Genauer noch: Es kommt auf das zweite Augenpaar an, das im Menschen angelegt ist und eines Tages zu sehen und zu erkennen beginnt. Dieses zweite Augenpaar sieht durch die vordergründige Welt hindurch auf die andere Wirklichkeit, die dahinter ist. Wem es nie gelingt, dieses zweite Augenpaar in sich zu erwecken, der bleibt blind, auch wenn er alle Dinge um sich herum so scharf sieht wie ein Raubvogel.
Aus einem Radiofeature von Peter von Matt
1. Arbeiten Sie die Weltsicht der Romantiker mithilfe der Zitate heraus. Stellen Sie dabei vor allem die Kritik an der Vernunft dar.
2. Deuten Sie C. D. Friedrichs Gemälde als Ausdruck einer romantischen Weltsicht. Beziehen Sie dafür den Radiobeitrag mit ein.

Schläft ein Lied in allen Dingen, Die da träumen fort und fort, Und die Welt hebt an zu singen, Triffst du nur das Zauberwort.
Man gibt dem Denken zu viel Wert, dem Fühlen zu wenig, dem Wissen zu viel, und dem Idealisieren zu wenig. Nicht im Verstande oder in der Vernunft ist die Genialität, in der Phantasie leuchtet sie, wie eine helle Flamme, und begeistert alles, was sich ihr naht.
Carl August Eschenmayer, 1822
Denn der Begriff kann nur jedes für sich umschreiben, was doch der Wahrheit nach niemals für sich ist; das Gefühl wird alles in allem zugleich gewahr.
August Wilhelm Schlegel, 1846
»Shutter Island*« (2010). Edward »Teddy« Daniels (bzw. Andrew Laeddis, s. rechts oben) verhört als vermeintlicher US-Marshal zusammen mit seinem Partner Chuck Aule (der sich später als sein behandelnder Arzt Dr. Lester Sheehan entpuppt) Mrs Kearns, eine Insassin der Gefängnisinsel Ashecliffe, um das Verschwinden der Insassin Rachel Solando aufzuklären. Teddy hat den Verdacht, dass auf der Insel geheime Experimente durchgeführt werden. Er hat Albträume und Halluzinationen, in denen es u. a. um den Tod seiner Ehefrau Dolores Chanal sowie ihrer drei Kinder geht, in denen das Motiv Wasser eine Rolle spielt. Zwischen Screenshot 1 und 3 liegen ca. vier Sekunden.


DIE SCHLUSSSZENE VON »SHUTTER ISLAND*«
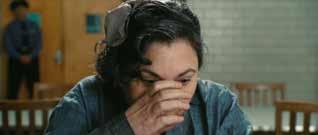
Mithilfe eines von Dr. Cawley und Dr. Lester Sheehan entwickelten riesigen 2-tägigen Rollenspiels erkennt Teddy (s. links), dass er in Wahrheit der schizophrene Insasse Andrew ist. Dr. Cawley äußert allerdings die Befürchtung, dass Andrew – wie schon einmal – wieder rückfällig werden könne, sodass ihm, als Mörder seiner Frau, eine Lobotomie* droht: Es müsse sich zeigen, ob die Heilung dauerhaft ist. Am nächsten Tag im Freien:

Dr. L. Sheehan: »Na, wie geht’s uns heute Morgen?«
Andrew Laeddis: »Gut. Und selbst?«
»Kann nicht klagen.«
»Und, wie geht’s jetzt weiter?«
»Irgend ’ne Idee?«
»Wir müssen von diesem Felsen runter, Chuck. Zurück aufs Festland. Was immer hier vor sich geht – es ist nichts Gutes.« (Dr. Lester Sheehan blickt kopfschüttelnd zu Dr. Cawley, der veranlasst, die Pfleger mit dem Eispickel für die Lobotomie zu holen.)
»Keine Sorge, Partner, die kriegen uns nicht.«
»Hast Recht, wir sind viel zu schlau für die.«
»Ja, oder? … An diesem Ort frage ich mich …«
»Was denn, Boss?«
»Was wäre schlimmer: zu leben wie ein Monster oder als guter Mann zu sterben?« (Teddy geht mit den Pflegern mit, während Dr. Sheehan ihn anstarrt.)
1. Rekonstruieren Sie Grundzüge der Filmhandlung und erläutern Sie die Materialien.
2. Erarbeiten Sie, wie es dem Film gelingt, Gewissheiten zu irritieren und die Vernunft herauszufordern.
3. Tauschen Sie sich über eigene Irritationserfahrungen mit sog. Mindfuck-Filmen ( s. Info) aus.
SOG. BEWUSSTSEINS- ODER MINDFUCK-FILME Seit den 1990er Jahren häufen sich Filme, die durch Strategien unzuverlässigen bzw. komplexen Erzählens versuchen, die Wahrnehmung des Publikums auf falsche bzw. doppeldeutige Fährten zu locken und so zu irritieren, dass sie sich irgendwann nicht mehr sicher sein können, wie real das Dargestellte in der Filmwelt ist. Da es sich in der Regel um Filmfiguren handelt, die Wahrnehmungs und Bewusstseinsstörungen haben (hervorgerufen durch Traumata, technische Möglichkeiten, psychische Erkrankungen etc.), eröffnen die Filme dem Publikum die Möglichkeit, vergleichbare Irritationen ein Stück weit am eigenen Leib zu erfahren.

Wir fühlen uns heute nicht mehr wie von der Sonne der Vernunft beschienene Aufklärer. Wir irren heute ohne Kompass durch die Nebel eines selbsterschaffenen Informationsuniversums, das mit seiner chaotischen Dynamik gefährliche Konsequenzen für uns haben kann. Was sollen wir tun? Man muss nicht alles machen, was möglich ist! Da, wo es möglich ist, sollten wir Übersichtlichkeit anstreben. Im Industriedesign heißt die Zauberformel »Einfachheit«: Benutzeroberflächen werden so gestaltet, dass sie die Komplexität für den Anwender auf wesentliche Bestandteile reduzieren. Von diesem Ansatz kann auch die Politik lernen. Eine Demokratie lebt schließlich davon, dass Bürger und Politiker zumindest prinzipiell in der Lage sind, zu verstehen, worüber sie entscheiden.
Marco Wehr, Physiker und PhilosophȆberschwemmungen gab es schon immer.
»Man hört so viel Verschiedenes.
»Das mit dem Impfschutz hast du doch aus den Mainstreammedien. Alles Fake News*.
1. Deuten und beurteilen Sie das Demonstrationsplakat. Zeigen Sie dabei auf, inwiefern hier auf Gedanken der Aufklärung zurückgegriffen wird.

2. Stellen Sie M. Leuzinger-Bohlebers Sicht der des Plakats gegenüber. Diskutieren Sie die Erklärungskraft ihrer Deutungen.
3. Welche Rolle spielen digitale Kontexte im Zusammenhang mit z. B. Verschwörungstheorien*, Antisemitismus [9] und Populismus? Deuten Sie die Zeichnung von G. Waters.
4. Diskutieren Sie, wieweit sich M. Wehrs Vorschlag der Einfachheit von den Überlegungen M. Leuzinger-Bohlebers unterscheidet und ob Sie seine Lösung überzeugt.
5. Imaginieren Sie Situationen zu den Zitaten links. Tauschen Sie sich darüber aus, wie Sie sich in solchen Situationen verhalten (würden).
Teilnehmer auf einer Demonstration der sog. QuerdenkerBewegung in Frankfurt/Main im April 2021
Während der langen Monate der Pandemie haben Verschwörungstheorien*, Gewalt, Fremdenhass, Antisemitismus und Populismus in erschreckender Weise zugenommen. Sie sind mitbedingt durch individuelle und gesellschaftliche Regressionsprozesse. Dabei wird versucht, unerträgliche Komplexitäten zu bewältigen, indem vereinfacht zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch, Schwarz und Weiß, Ich und Du, Wir und Ihr unterschieden wird. Dieses reduktionistische, vereinfachende Denken und Fühlen befriedigt zentrale unbewusste Fantasien und schafft scheinbare Orientierungen und Erleichterungen, stellt aber eine enorme Bedrohung für unsere westlichen Demokratien dar.
Marianne Leuzinger-Bohleber, Psychoanalytikerin
Anlässlich des 90. Geburtstags des berühmten deutschen Philosophen Jürgen Habermas (*1929) führten die Journalistin Gisa Funck und der Soziologe Stefan MüllerDoohm ein Gespräch über ihn und seine wichtigsten Überlegungen und Theorien.
Funck: Sie erwähnten gerade schon, dass das Gegenargument bei Habermas einen wichtigen Stellenwert hat. Was steht im Mittelpunkt seiner Lehre?
Müller-Doohm: Im Mittelpunkt steht der Versuch, Vernunft zu bestimmen, eine Theorie der Vernunft zu entwickeln. Vernunft ist für Habermas etwas, das im dialogischen Verfahren immer wieder neu hervorgebracht werden muss. Erst nach dem, was er dann »Diskurse« nennt, also erst nach Diskursen kann etwas einleuchtend oder nichteinleuchtend sein. Und solche herrschaftsfreien Diskurse*, die übrigens alle Betroffenen als gleichberechtigte Teilnehmer einbeziehen, die sind für Habermas die grundlegende Voraussetzung eines, wie er es nennt, »rationalen Konsenses«, der die Anerkennung aller Betroffenen verdient. Aber wenn er vom »herrschaftsfreien Raum« redet und von der »gleichberechtigten Anerkennung« aller Beteiligten, dann klingt das doch schon etwas idealistisch, oder?
Nein, idealistisch würde ich nicht sagen. Es ist eine kontrafaktische Idee, an der wir allen Grund haben festzuhalten. Wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass sich am Ende der »zwanglose Zwang des besseren Arguments« durchsetzt, dann würden wir ja die Ent
scheidung abgeben an irrationale Instanzen oder an Inhaber von Machtpositionen. Und ich bin davon überzeugt, dass es zu dieser Idee einer Einigung im kommunikativen Prozess keine Alternative gibt. Es sei denn, wir geben unsere Freiheit auf, aber daran kann ja keinem gelegen sein.
»Immer diese leidigen Streitereien.
»In der Schule wird nie richtig diskutiert.
»Die Mehrheit hat nicht immer recht.
»Besser, du entscheidest.
1. Führen Sie Schreibgespräche zu den Zitaten (oben) oder tauschen Sie sich darüber aus, was Ihnen am Diskutieren wichtig/unwichtig/nervig/anstrengend/problematisch … erscheint.
2. J. Habermas* ist für seine Theorie des »herrschaftsfreien Diskurses« berühmt geworden. Erarbeiten Sie diese Vorstellung sowie ihren Zusammenhang zur Vernunft aus dem Interviewausschnitt.
3. Suchen Sie Beispiele für Räume, die nicht »herrschaftsfrei« sind. Denken Sie dabei auch an metaphorische bzw. soziale Räume.
4. Diskutieren Sie J. Habermas*� Verständnis von Vernunft als kontrafaktischer Idee. Beziehen Sie dabei die Karikatur oben bzw. S. 36 mit ein.
5. Formulieren Sie ein »Merke« für diese Seite.

Aus einer Rezension zur Paul Klee-Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne 2018:

Unten [auf dem Gemälde] sehen wir einen zu einer kompliziert aufgebauten Apparatur mutierten Kopf, dessen wie mechanisierte Schultüten aussehende Augen die Umgebung beobachten. Allerdings nur auf horizontaler Ebene. Der Kopf hat eine fragile Leiter ausgefahren. Sie führt auf eine höhere Ebene. Auf der steht eine weitere klapprige Leiter. Sie reicht jedoch nicht an das über allem prangende Himmelsgestirn heran, das die höhere Einsicht und die letzten Wahrheiten versinnbildlicht.
Aber die Sehnsucht nach dem Aufstieg in diese höchste geistige Sphäre ist unverkennbar. Das Bild ist nicht zuletzt Klees Kommentar auf die damalige Rationalitätsbesessenheit am Bauhaus*: »Wir konstruieren und konstruieren, und doch ist Intuition immer noch eine gute Sache. Man kann ohne sie Beträchtliches, aber nicht alles. Es wären Aufgaben zu stellen, wie etwa: die Konstruktion des Geheimnisses.«
Dafür ist Klees Werk »Grenzen des Verstandes« ein Anschauungsbeispiel. Er war überzeugt: »Im obersten Kreis (der Kunst) steht hinter der Vieldeutigkeit ein letztes Geheimnis und das Licht des Intellekts erlischt kläglich.«
Veit-Mario Thiede, Journalist
BeMERKenswert: so viele Zwischenräume
KONSTRUKTION, INTUITION, INTELLEKT, GEHEIMNIS
1. Machen Sie einen gedanklichen Spaziergang im Gemälde von P. Klee. Betrachten und beschreiben Sie es von verschiedenen Aufenthaltsorten aus und halten Sie Gedanken und Gefühle fest.
2. Deuten Sie das Gemälde unter Einbezug des Titels und stellen Sie Bezüge zum bisherigen Kapitel her.
3. Vergleichen Sie Ihre Überlegungen mit der Deutung (rechts oben).
4. »… kam ich zu dem Schluss …« – Philosophieren Sie über Pred 8,16 und bringen Sie die Bibelstelle mit P. Klees Aussagen ins Gespräch.
Ich habe über die Weisheit* nachgedacht, um ihr auf den Grund zu gehen. Dabei fiel mein Blick auf das vergebliche Tun, das auf der Erde getan wird. Man sagt ja: »Auch am Tag und in der Nacht gönnt sich der Mensch keinen Schlaf.«
Als ich aber darauf schaute, was Gott alles tut, kam ich zu dem Schluss: Der Mensch kann das alles nicht begreifen, was unter der Sonne geschieht. Auch wenn der Mensch sich noch so anstrengt, begreift er es nicht. Und wenn einer meint, alle Weisheit der Welt zu besitzen, begreift er es trotzdem nicht.
Pred 8,16 f. (BasisBibel)

Alma Haser, Patient No. 01 (2016) aus der Serie »Kosmische Chirurgie« (Cosmic Surgery), gefaltetes Origami vor Gesicht
Wenn die Biologielehrerin über eine Rose spricht, folgt sie einer anderen Form von Rationalität als der Deutschlehrer, der ein Liebesgedicht behandelt. Niemand würde (hoffe ich) behaupten, dass nur einer der beiden Zugänge richtig und angemessen sei. Vielmehr müssen sich beide Zugänge ergänzen: Wer seiner Angebeteten seine Liebe erklären will, sollte um die Symbolkraft der Rose wissen und vielleicht nicht stattdessen einen Kaktus schenken. Wer mit Zucht und Verkauf von Blumen Geld verdienen will, dem kann dagegen die Poesie so lange egal sein, bis er sich verliebt.
Von einem gebildeten Menschen kann man also beides erwarten – naturwissenschaftliche Kenntnisse und ein geisteswissenschaftliches oder ästhetisches Verständnis. Darüber hinaus sollte man erwarten, dass er diese verschiedenen Rationalitäten oder Weltzugänge unterscheiden und ihre jeweiligen Grenzen reflektieren kann.
Joachim Willems, Theologe
1. Erschließen Sie sich komplizierte Begrifflichkeiten in der Übersicht zu J. Baumerts Weltzugängen aus dem Zusammenhang.
2. Suchen Sie zu jedem Weltzugang ein passendes Instrument, Motto und/oder Symbol.
3. Ergänzen Sie das Beispiel der Rose (links) um die Perspektive von Religion/Philosophie. – Erproben Sie weitere eigene Beispiele.
4. Reflektieren Sie die folgenden Fragen z. B. unter Einbezug der Schulfächer: Auf welche Weise(n) erschließen bzw. eröffnen die verschiedenen Weltzugänge die Welt? Was kommt in den Blick, was muss ausgeschlossen werden? Wo liegen die jeweiligen Grenzen und wie stark werden diese für gewöhnlich zum Thema?
5. Beziehen Sie jeden der Weltzugänge auf das Gemälde P. Klees ( S. 38).
6. Was haben die verschiedenen Weltzugänge mit der eigenen Person zu tun? Deuten Sie das Porträt links oben. – Erproben Sie eigene Gestaltungen zum Thema: Ich und meine Weltzugänge.
kognitivinstrumentelle Modellierung der Welt
ästhetischexpressive Begegnung und Gestaltung


normativevaluative Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Gesellschaft
Probleme konstitutiver [festlegender]
Rationalität
Mathematik, Naturwissenschaften
Sprache / Literatur; Musik / Malerei / bildende Kunst; körperlicher Ausdruck
Wie geht es? Wie begegne ich der Wirklichkeit?
Wie kann ich Wirklichkeit ausdrücken?
Geschichte; Ökonomie; Politik / Gesellschaft; Recht
Religion, Philosophie
Wie ist die soziale Welt verbindlich zu ordnen?
Was ist wahr?
Wozu bin ich da?
Ein MERKe von dem Theologen Bernhard Dressler: »Keiner Perspektive eröffnet sich eine andere Welt, aber immer die eine Welt als eine andere.«
Nach dem Bildungsforscher Jürgen Baumert ist für eine Allgemeinbildung unverzichtbar, sich mit den vier nebenstehenden Weltzugängen bzw. Welthorizonten zu beschäftigen, denen jeweils andere Fragerichtungen zugrunde liegen. Er geht davon aus, dass alle vier Arten der Weltbegegnung eigene Perspektiven auf die Wirklichkeit haben, eigene Wahrnehmungsmuster bzw. eine andere Art, die Welt zu »lesen« –, und dass sich diese Zugänge ergänzen, aber nicht ersetzen können.
• Das Verhältnis von Glaube und Vernunft wird auch als Verhältnis von Glaube und Denken, Offenbarung und natürlicher (vernunftgeleiteter) Erkenntnis oder (in der Neuzeit) als Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft* ( S. 44) beschrieben.
• Historisch entwickelt es sich im frühen Christentum in der Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Letztere wird von antiken Theologen wie Augustin* produktiv aufgegriffen; beide Seiten sollen wechselseitig ineinandergreifen und sich befruchten: »crede ut intelligas« (glaube, damit du verstehst) und »intellige ut credas« (verstehe, damit du glaubst).
• Die mittelalterliche Theologie führt diese Sicht fort: Auch wenn die Vernunft nicht von sich aus zu wahrer Gotteserkenntnis gelangen kann, wird dem Denken zugetraut, die von Gott offenbarten Glaubensinhalte Gläubigen wie NichtGläubigen als plausibel und denknotwendig aufzuzeigen bzw. nachzuzeichnen und somit den Glauben als vernünftig auszuweisen. Ausdruck dieser Haltung sind die sog. Gottesbeweise*. – Martin Luther betont dagegen, dass die Vernunft – bei aller Wertschätzung – nicht in der Lage ist, das eigentlich Wesen Gottes als Gott »für mich« [9] zu erkennen.
• In der Neuzeit führen neben der aufklärerischen Kritik ( S. 25 ff.) die großen Erfolge der Naturwissenschaften dazu, dass nur noch Letzteren echte Erkenntnis über die Wirklichkeit zugetraut wird. Entsprechend werden biblische Aussagen zur Entstehung der Welt und des Menschen im 19. Jh. in der Regel als unvereinbar mit dem geschichtslosen, mechanischen Weltbild der klassischen Physik* sowie mit der Evolutionstheorie* verstanden und als unwissenschaftlich abgelehnt. Erst mit dem Aufkommen der modernen Physik und z. B. ihrer Erkenntnis eines kosmischen Anfang und Endes ergeben sich Möglichkeiten, diese Konfrontationsstellung von naturwissenschaftlicher Seite her aufzubrechen. Umgekehrt ermöglichen die Erkenntnisse der aus der Aufklärung herrührenden historischkritischen Methode ( S. 92) von christlicher Seite ein neues Verständnis biblischer Aussagen über Gott, Welt, Mensch und Evolution.
»Es stimmt, dass die Vernunft die Hauptsache von allem ist, das Beste im Vergleich mit den übrigen Dingen dieses Lebens; sie ist geradezu etwas Göttliches. Sie ist Erfinderin aller Kunst und Wissenschaft […] und all dessen, was in diesem Leben an Weisheit*, Macht, Tüchtigkeit und Herrlichkeit den Menschen zukommt.«
»Sie weiß [auch], dass Gott ist. Aber wer oder welcher es sei, der da recht Gott heißt, das weiß sie nicht. Also spielt auch die Vernunft Blindekuh mit Gott und tut eitel Fehlgriffe und schlägt immer nebenhin, dass sie das Gott heißt, das nicht Gott ist, und wiederum nicht Gott heißt, das Gott ist. […] Darum ist es gar ein großer Unterschied, wissen, dass ein Gott ist, und wissen, was oder wer Gott ist. Das erste weiß die Natur und ist in allen Herzen geschrieben. Das andere lehrt allein der Heilige Geist.«
1. Entwickeln Sie Standbilder, die das Verhältnis von Glauben und Denken zum Ausdruck bringen. Tauschen Sie sich über diese aus und beziehen Sie die Info auf Ihre Diskussion.
2. »Das Beste im Vergleich« – erläutern Sie M. Luthers Überlegungen. Vergleichen Sie sie mit Sichtweisen der Aufklärung ( S. 25–33). Gestalten Sie Luthers Sicht von Vernunft visuell.
3. Eine gemeinsame Bibliothek für Theologie und Philosophie? Deuten Sie die Zusammenstellung der Literaturbestände (s. oben) und stellen Sie architektonische Bezüge zu Kapitel 1 her.

Glaube und Vernunft können sich im gemeinsamen Haus der Weisheit* finden und je das Ihre zum Bau dieses Hauses in einer lebensklugen Kultur beitragen. Von theologischer Seite aus war es immer die Aufgabe der »natürlichen Theologie« ( S. 32) oder einer »Theologie der Natur*«, solche Weisheit zu entdecken und zu lernen, die mit dem Gott der Offenbarung und des Glaubens in Einklang steht. […]
Sucht man Weisheit, dann findet man beides: Man entdeckt und man lernt. Man entdeckt eine vorgegebene Weisheit im Aufbau der Materie und den Stufen des Organischen. Es sind lebensdienliche Molekularverbindungen und Zellorganismen entstanden und lebensfeindliche ausgeschlossen worden. Was wir einseitiglinear »Evolution« nennen, ist in Wahrheit ein komplexer Lernprozess des Lebendigen. Der genetische Code ist lernfähig und kreativ. Im Aufbau der Materie und des Lebens ist ein uraltes Gedächtnis gespeichert, das durchaus den Namen der Weisheit verdient. Die Spezies Mensch ist erst spät auf dem blauen Planeten Erde erschienen und hat darum allen Grund, nach der Weisheit des Lebendigen und seiner Ökosysteme zu forschen, […] nicht nur um Informationen zu sammeln, sondern auch um von der Weisheit zu lernen, die der Natur inhärent ist.
Wenn aber die erkenntnisleitende Frage der Naturwissenschaft nur noch darin besteht, was man aus dem erkannten Gegenstand »machen« oder wie man ihn für den Menschen nützlich verän
dern kann, hört die Suche nach Weisheit auf. Das ist interventionistische Wissenschaft. Mit ihr hört dann auch das Erstaunen (thaumazein) über die Phänomene auf und wird durch KostenNutzenRechnungen verdrängt. Man kann es daran erkennen, dass immer mehr biologische Erkenntnisse, wie z. B. die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, sofort patentiert werden, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Einseitige menschliche Herrschaft bringt die Natur zum Verstummen und macht Menschen dumm.
Ist die Suche nach menschlicher Lebensweisheit angesagt, dann entstehen andere forschungsleitende Interessen. Es entsteht dann ein Dialog zwischen entdeckter natürlicher Weisheit und zu lernender menschlicher Weisheit. Menschliche Weisheit wird nach überlebensfähigen Ausgleichen zwischen der menschlichen Kultur und den Ökosystemen der Erde suchen. Nicht menschliche Herrschaft über die Natur, sondern lebenskluge Übereinstimmung mit der Natur ist dann das Ziel. Sie beginnt mit dem Respekt vor dem uralten Gedächtnis des Lebens in den natürlichen Vorgängen und der »Ehrfurcht vor dem Leben« (Albert Schweitzer) als dem obersten Gebot, das aus dem Recht auf Leben folgt.

1. Weisheit* beschreibt schon im Alten Orient die Suche nach gelingendem Leben im Zusammenspiel von Glaube, den damaligen Anfängen von Wissenschaft und praktischer Lebenserfahrung [8]. Arbeiten Sie diese weisheitliche Grundhaltung der Welt gegenüber aus J. Moltmanns* Überlegungen z. B. als Schaubild heraus. Machen Sie dabei deutlich, wie er Vernunft und Glaube aufeinander bezieht und inwiefern er zwischen göttlicher und menschlicher Weisheit unterscheidet.
2. Lesen Sie Spr 8,22–36 und stellen Sie Assoziationen zu Plakatmotiv und Ausstellungstitel links her. Markieren Sie auf einer Kopie des Textes oben Wendungen und Gedanken, die zu Spr 8,22–36 oder dem Plakat passen.
Wanderausstellung der katholischen Erwachsenenbildung
Rheinland-Pfalz
3. Konkretisieren Sie J. Moltmanns Sicht an einem Thema wie Klimawandel [10] und diskutieren Sie sie.
Im Ark Encounter gib es den sog. »Truth Traveler«. Hierzu heißt es: »Nehmen Sie Platz in der Truth Traveler-Zeitmaschine, tauchen Sie in unser Virtual-Reality-Erlebnis ein und reisen Sie zurück in die Zeit Noahs, A Flood of Reality! Pod, der liebenswerte Roboter, wird Ihr Führer sein, während Sie Zeuge des Baus von Noahs Arche werden, die Flut erleben, sich mit den Tieren in die Arche wagen und vieles mehr – einschließlich einiger aufregender Überraschungen auf dem Weg!«

Foto aus dem seit 2007 in der Nähe von Cincinnati bestehenden Creation Museum der evangelikalen Vereinigung »Answers in Genesis*« (AiG).
AUS DER HOMEPAGE DES CREATION MUSEUM

»Was wir über Gottes Wort und den Schöpfungsbericht glauben, wird bestimmen, was wir über das Alter der Erde, Dinosaurier, Menschen und vieles mehr glauben. Vergleichen und kontrastieren Sie die beiden widersprüchlichen Standpunkte im Museum der Schöpfung und entdecken Sie die Wahrheit.«
»Wir können sehen, dass Dinosaurier zur Zeit von Noahs Flut noch existierten, weil wir heute Dinosaurierfossilien finden, die gebildet wurden, als die Bedingungen während der globalen Flut stimmten. Dinosaurier könnten jederzeit ausgestorben sein, nachdem die beiden von jeder Art die Arche verlassen hatten, genau wie viele andere Tiere seit der Flut ausgestorben sind.«
»Das intakte Skelett dieses Allosauriers zeugt von einer katastrophalen, schnellen Bestattung, die die in der Bibel aufgezeichnete globale Flut vor einigen tausend Jahren bestätigt.«
Die AiG steht auch hinter dem Themenpark Ark Encounter, der sich 45 Minuten vom Creation Museum entfernt in Williamstown befindet. In der Arche (Länge 155 m, Höhe 20 m, Kosten ca. 100 Mio Euro) finden sich u. a. auch Dinosaurier.


»Wir zwingen niemanden, unseren Glauben anzunehmen. Wir wollen nur, dass die Menschen die Bibel ernst nehmen, und ihnen zeigen, was falsch und was richtig ist.«
Ken Ham, Präsident von AiG
»Sowohl im Nachbau der Arche als auch im Schöpfungsmuseum wird durch vielfältige Präsentationen und Erklärungen nachgewiesen und vor Augen geführt, dass die biblischen Aussagen über Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Turmbau zu Babel, Entstehung der Völker und die Erlösung in Jesus Christus in allen Einzelheiten vollkommen zutreffend sind. Dabei wird deutlich: Die Bibel ist das unfehlbare und irrtumslose Wort Gottes – nicht nur, was die Rettung des Sünders und das ewige Leben betrifft, sondern auch in allen historischen, geografischen und naturwissenschaftlichen Aussagen.«
L othar Gassmann, deutscher evangelikaler Publizist
1. Die Existenz von Dinosauriern wurde von Kreationisten* [8] früher häufig bestritten. Deuten Sie die Materialien der linken Spalte.
2. Arbeiten Sie aus den Materialien Strategien heraus, mit denen die Besucher überzeugt werden sollen. Recherchieren Sie dazu auch Trailer, Werbeclips und Internetauftritte dieser oder vergleichbarer Projekte. Beurteilen Sie sie unter Einbezug früherer Jahrgangsstufen [5], [8], der vorherigen Seiten sowie S. 98 f. – Vertiefen Sie diese Auseinandersetzung mithilfe von S. 44 f.
Bildausschnitt aus dem Buch »Susi Neunmalklug erklärt die Evolution« von Michael Schmidt-Salomon und Helge Nyncke. Das Buch bildet die textliche und visuelle Vorlage für den gleichnamigen Kurzfilm der Giordano-Bruno-Stiftung*, die einen evolutionären Humanismus vertritt.
TEXT DES KURZFILMS: »SUSI NEUNMALKLUG ERKLÄRT DIE EVOLUTION*«
Hallo, ich bin Susi, Susi Neunmalklug, und mein Name ist keine Übertreibung. Wie viele Superhelden verstecke auch ich meist meine Superkräfte. Nur manchmal, wenn ich etwas richtig Dummes höre, kann ich mich einfach nicht bremsen. So war es auch als Herr Hempelmann eines Morgens die Klasse betrat und uns Kindern eine seltsame Geschichte erzählte.
»Liebe Kinder«, sagt Herr Hempelmann, »die Bibel sagt uns, dass Gott, der Herr, die Erde in sechs Tagen erschuf. Und das ging so: Am ersten Tag trennte Gott Licht von Dunkelheit, den Tag von der Nacht. Am zweiten Tag spannte er das große Himmelszelt über die Erde. Am dritten Tag trennte er das Land von dem Wasser. Am vierten Tag machte er die Sterne, die nachts so schön am Himmelszelt leuchten. Am fünften Tag«, erklärte Herr Hempelmann, »machte Gott die Fische und die Vögel. Am sechsten Tag erschuf Gott die Tiere, die auf dem Land leben, und auch die ersten Menschen: Adam und Eva. Am siebten Tage ruhte Gott. Er sah, dass es gut war, was er gemacht hatte.«
Als Herr Hempelmann geendet hatte, musste ich laut loslachen. »Aber Herr Hempelmann«, sagte ich, »das haben Sie ja völlig falsch verstanden. Ich erkläre Ihnen mal, wie das wirklich war.«
Und dann erzähle ich ihm die ganze Geschichte, vom Urknall und der Entstehung der Sterne unseres Sonnensystems, von der Ursuppe und den ersten einzelligen Urlebewesen, von der Entstehung der Pflanzen und Tiere, von dem Aufstieg und dem Untergang der Dinosaurier und von der Herkunft des modernen Menschen.

Herr Hempelmann war zunächst ein wenig verlegen. Dann aber meinte er, dass doch vielleicht Gott die Ursuppe angerührt und die Entwicklung vom einfachen Lebewesen zum modernen Menschen gelenkt habe.
»Denken Sie doch mal nach! In der Natur geht es um fressen oder gefressen werden. Wenn ein lieber Gott so etwas erschaffen hat und dann auch noch denkt, alles sei gut, dann hat der wohl riesige Tomaten auf den Augen.«
Am Schluss wollte ich Herrn Hempelmann noch Darwins Buch über die Entstehung der Arten ausleihen, damit er auch mal etwas Vernünftiges liest. Doch da ist Herr Hempelmann urplötzlich aus der Klasse gestürmt. Vielleicht hatte er Fieber. Zumindest hat er furchtbar geschwitzt, der arme Kerl.
Ich bin Susi, Susi Neumalklug. Und mein Name ist keine Übertreibung. Ihr erwachsenen Lehrer, Erzieher nehmt euch in Acht. Macht nicht den Fehler, mir Unsinn zu erzählen. Denn ich bin nicht nur neunmal, ich bin zehnmal, ja vielleicht sogar hundertmal klüger als ihr. Heute war’s Herr Hempelmann. Morgen ist ein anderer dran. Dumme Leute gibt’s genug. Meint eure Susi Neunmalklug.
MERKwürdig: »vollkommen« –»völlig« – gar nicht so verschieden
1. Buch und Kurzfilm richten sich an Grundschulkinder. Arbeiten Sie die hinter dem Clip stehende Problemstellung [8] (vgl. auch S. 42), die Form ihrer Darstellung in Text und Bild und damit verbundene Intentionen heraus.

2. Beurteilen Sie die Darstellung unter Einbezug früherer Jahrgangsstufen [5], [8] und der vorherigen Seiten. – Vertiefen Sie die Diskussion mithilfe von S. 44 f.
3. Im Videoportal, auf dem der Clip gestreamt wird, ist die Kommentarfunktion deaktiviert. Wägen Sie Vor- und Nachteile der Deaktivierung mit Blick auf eine erwartbare Diskussion in einem solchen digitalen Kontext ab.
• Haben eine religiöse bzw. theologische und eine naturwissenschaftliche Betrachtung der Welt in ein und demselben Weltbild Platz oder nicht? Hierzu gibt es unterschiedliche Haltungen:

• Wenn man der Ansicht ist, dass nur eine der beiden Perspektiven die einzig richtige und legitime Sicht auf die Welt darstellt, kann man von einem Konkurrenz oder Konfliktverhältnis sprechen. Diese Haltung wird z. B. im Kreationismus* [8] oder in szientistischen* [8] bzw. materialistischpositivistischen* Weltbildern deutlich. Wenn man Gen 1 als Tatsachenbericht zur Entstehung der Welt liest, schließt dies die Evolutionstheorie aus. Wenn nichts als Materie existiert bzw. auf sie zurückgeführt werden kann, schließt dies ein höheres geistiges Wesen oder Prinzip aus.
• Eine zweite Möglichkeit betont demgegenüber die grundsätzliche Unabhängigkeit. Als Begründung wird z. B. angeführt, dass sich Glaube und Theologie ganz unterschiedlichen Bereichen oder Fragestellungen – Gott vs. Natur bzw. Sinnfragen vs. Sachfragen [8] – beschäftigen und somit abweichende Denkweisen und »Sprachen«, Zuständigkeitsbereiche, Forschungsansätze und Methoden haben (vgl. auch S. 39).
• Eine dritte Position knüpft an die zweite an, verweist aber darauf, dass beide Sichtweisen sich ergänzen, aufeinander angewiesen sind und deshalb in einen Dialog treten sollten. Dies betrifft z. B. Grenzfragen, die die Naturwissenschaft aufwirft, aber aus wissenschaftstheoretischen Gründen nicht naturwissenschaftlich beantworten kann. Umgekehrt können für Sinnfragen naturwissenschaftliche Annahmen und Erkenntnisse über die Welt eine Rolle spielen. Auch bei vielen ethischen Fragen überschneiden sich Sach und Sinnfragen.
• Eine vierte Möglichkeit stellen Versuche dar, beide Perspektiven zu vereinheitlichen bzw. ins eigene System zu integrieren, indem man z. B. physikalische Begriffe und Annahmen in religiöse Vorstellungen übersetzt und die Existenz von Naturgesetzen theologisch begründet oder den Gegensatz von Geist und Materie naturwissenschaftlich begründet aufhebt.
Über die großen Theoriemodelle des 19. und 20. Jh.s, die Evolutionstheorie* und die Quantenphysik, hat die Vorstellung der Geschichte erneut Einzug gehalten in das Denken der Naturwissenschaften. Für die Verhältnisbestimmung von Schöpfungslehre und Naturwissenschaft ist dies von erheblicher Bedeutung. Über das Zeitverständnis wird es nämlich möglich, einen gemeinsamen Verständigungsbereich zwischen Theologie und Naturwissenschaft zu definieren, ohne in unproduktive Apologetik, in ein beziehungsloses Nebeneinander oder aber auch in gegenseitige Grenzüberschreitungen zu verfallen.
R einer Anselm, Theologe
Theologie und Naturwissenschaften als konkurrierende Disziplinen zu betrachten, halte ich für überholt. Konkurrenz gibt es nur, wo sich Verschiedene um das Gleiche bemühen. Das ist hier nicht der Fall. Grundsätzlich müssen wir uns immer bewusst sein, welche Fragen wir beantworten wollen. Die Rede von der Schöpfung etwa versucht nicht zu erklären, wie das zustande gekommen ist, was da ist. Sie legt vielmehr nahe, dass das, was sich so entwickelt hat, als Gottes gute Gabe zu verstehen ist. Das heißt, die Rede von der Schöpfung erlaubt es Menschen, sich unter Einbezug aller wissenschaftlichen Erkenntnisse im Leben auf bestimmte Weise zu orientieren und dadurch eine Lebenshaltung zu gewinnen.
Ingolf U. Dalferth, Theologe
KAMPF, UNABHÄNGIGKEIT, DIALOG, INTEGRATION?
1. Beziehen Sie die Info auf die Materialien oben sowie auf die Seiten 41–43. Diskutieren Sie mögliche Zuordnungen.
2. Prüfen Sie, inwiefern sich aus den obigen Zitaten neue Erkenntnisse zur Beurteilung von S. 42 f. ergeben.
Kann es Beschreibungsweisen eines Phänomens geben, die sich eigentlich ausschließen, aber dennoch zusammengedacht werden müssen? Der Physiker Niels Bohr hat ein solches Modell zur Deutung des WelleTeilchenDualismus* des Lichts entwickelt: In Widerspruch zur klassischen Physik* können Photonen je nach Versuchsanordnung sowohl die Eigenschaften von Wellen als auch Teilchen aufweisen. Somit muss zum vollständigen Verständnis von Licht beides gleichwertig und sich ergänzend, also komplementär gedacht werden. Dieses Modell ist von Bohr verallgemeinert und auf andere scheinbar sich ausschließende Phänomene aus z. B. Biologie, Psychologie, Kultur übertragen worden. Es wird heute u. a. als Möglichkeit diskutiert, den methodischen Atheismus* der Naturwissenschaft mit der Perspektive der Theologie konstruktiv in Bezug zu setzen.
GRUNDLEGENDE DIFFERENZEN BEACHTEN
Das Werden eines neuen Menschen lässt sich als Abfolge biochemischer und physikalischer Gesetze beschreiben; doch auf dieser Grundlage kann immer nur generell ein Mensch als Gattungswesen, nie ein konkretes Individuum, das gerade durch die Kontingenz seines Daseins gekennzeichnet ist, beschrieben werden. Schöpfung steht dabei nicht im Gegensatz zu solchen naturgesetzlichen Prozessen. Aber mit der Rede von der Schöpfung soll doch eine diese Zugangsweise überschreitende Perspektive eingenommen werden: Das Einmalige ist genau deswegen existent, weil es von Gott gewollt ist; das gilt für die ganze Erde ebenso wie für die individuelle Existenz.
Reiner Anselm, TheologeZUM STICHWORT »BEWEIS«

1. Arbeiten Sie mithilfe dieser Seite mögliche weitere Kriterien zur Beurteilung von Seite 42 f. heraus und diskutieren Sie diese.
2. Stellen Sie eine Redaktionskonferenz zum Bild unten nach und bringen Sie darin eigene Vorschläge ein.
3. Entwickeln Sie nach dem Durchgang durch das Kapitel eigenes Material für die Grundschule (vgl. S. 43) zu Evolution und Schöpfung oder formulieren Sie, was Sie an Herrn Hempelmanns Stelle sagen würden.
Foto zu einem Zeitungsartikel über Wissenschaft und Glaube: »Die Schwerkraft und das Kreuz: Glaube und wissenschaftliche Erkenntnisse geraten sich nicht in die Haare, wenn sie sich an ihre Freiräume halten.«
Manchmal hört man in Diskussionen über Glaube und Naturwissenschaft: »Die Wissenschaft hat bewiesen, dass ...«. Hier wird verwechselt, dass naturwissenschaftliche Theorien zwar einen sehr hohen Grad an Gewissheit haben können und man ihnen deshalb auch vertrauen darf, sie aber grundsätzlich nicht beweisbar sind. Denn Experimente sind Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Ob die Abstraktionen, die zur Aufstellung einer Theorie gemacht werden, in künftigen Experimenten und damit unter geänderten Bedingungen vielleicht unangepasst sind und daher eine Änderung der Theorie erforderlich machen, kann niemand vor neuen Experimenten wissen. Ein echter »Beweis« würde jedoch eine künftige Änderung der Theorie bereits jetzt schon mit absoluter Gewissheit ausschließen. Entsprechend wird darauf verwiesen, dass man seit Karl Popper* wisse, dass empirisch gestützte Theorien niemals bewiesen (verifiziert), sondern höchstens falsifiziert werden können. Doch die Situation ist noch komplizierter. Eine Falsifikation* würde voraussetzen, dass das entsprechende Experiment mit einem Gerät durchgeführt wurde, welches einwandfrei gemäß einer wahren – also verifizierten –Theorie funktioniert, was ein Zirkelverfahren wäre. Deshalb hat bereits Popper darauf verwiesen, dass die Verifikation einer Falsifikation nicht möglich ist.
Thomas Görnitz, PhysikerDer Mensch sucht soviel Welt als möglich zu ergreifen und so eng, als er nur kann, mit sich zu verbinden. (Wilhelm von Humboldt*)
Unsere Welt ist in zunehmendem Maße durch hohe Komplexität geprägt. Damit sich die Kinder und Jugendlichen in ihr orientieren, sie je nach ihren persönlichen Möglichkeiten mitgestalten und in ihr schließlich als mündige Mitglieder der Gesellschaft sinnvoll und verantwortlich handeln können, müssen sie auf der Grundlage einer Wertorientierung entsprechende Einstellungen und Haltungen entwickeln, das notwendige anschlussfähige Wissen erwerben und Kompetenzen aufbauen, die ihrem jeweiligen Begabungsprofil gemäß sind. Kinder und Jugendliche, die sich geistig fordern lassen, finden im Angebot des Gymnasiums einen Zugang zu unserer Welt, bei dem neben einer gr undlegenden Handlungsorientierung Fachlichkeit und Wissenschaftspropädeutik einen besonderen Stellenwert besitzen.
Das Gymnasium ist dabei den obersten Bildungs und Erziehungszielen verpflichtet, die in Art. 131 der Bayerischen Verfassung festgelegt sind.


(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.


(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.

(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.
(4) Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen.
Formulieren Sie eine Antwort auf die Frage »Wozu Schule« ( S. 46) und vergleichen Sie Ihre Antwort mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums ( S. 46). Tauschen Sie sich darüber aus, ob der Bildungs- und Erziehungsauftrag ergänzt oder verändert werden sollte.
Arbeiten Sie im Rückgriff auf das Kapitel heraus, inwieweit Art. 131 und der Bildungs- und Erziehungsauftrag ( S. 46) aufklärerische Gedanken enthalten. Diskutieren Sie, wie stark die beiden Gesetzestexte links über einzelne Aspekte hinaus von einem aufklärerischen Geist geprägt sind.
Verorten Sie die Diskussion um Glaube und Vernunft bzw. Glaube und Naturwissenschaft in den Gesetzestexten links.
Assoziieren Sie mögliche schulische Projekte, Veranstaltungen, Unternehmungen …, die zu den Fotos auf S. 46 passen, und bringen Sie sie mit den danebenstehenden Texten in Verbindung.
Vergleichen Sie Schulprofil und Aktivitäten Ihres Gymnasiums mit den Texten und Bildern auf S. 46.
Was haben Sie dazugelernt (vgl. S. 23)?
Was möchten Sie sich merken?
Welche Methoden bzw. Materialien haben Sie besonders angesprochen?
Was wird Sie weiter beschäftigen?
Welche Fragen bleiben offen?
Gestalten Sie für die Homepage Ihres Gymnasiums einen Beitrag des Faches Evangelische Religionslehre, der sich mit dem Thema Glaube und Vernunft beschäftigt. Ziehen Sie dazu Gedanken aus dem Kapitel heran.

Wann ist eine Religion wahr?
Wie vergleicht man Religionen?
Was toleriere ich, was nicht?
Wozu sind Unterschiede gut?
Ein Gott für alle?
Gehört Streit dazu?
Wollte Gott nur eine Religion?
Lernbereich: »Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, Christentum, Islam«
In diesem Kapitel beschäftigen Sie sich mit Judentum, Christentum und Islam in der Zusammenschau. Sie vertiefen Ihr Wissen zu ausgewählten historischen Stationen und beschreiben aktuelle Auseinandersetzungen, z. B. um Geschlechterrollen, in ihrer religiösen, kulturellen und politischen Dimension.

Sie erkennen, auf welche Weise das Verhältnis der Religionen in ihrem eigenen Umfeld, aber auch in analogen und digitalen Medien thematisiert wird. Dabei unterscheiden Sie zwischen kulturellen und religiösen Anteilen. Stereotype und Vorurteile nehmen Sie wahr und deuten sie in ihrer geschichtlichen Bedingtheit sowie in ihrer aktuellen Funktion und Problematik.
Indem Sie über Wahrheitsansprüche in Religionen allgemein sowie über konkrete Glaubensinhalte nachdenken, schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen und prüfen, inwieweit Darstellungen der drei Religionen als z. B. »abrahamitisch« als angemessen angesehen werden können. Auf diesem Wege reflektieren Sie Bedingungen und Möglichkeiten eines gelingenden Miteinanders der Religionen. urteilen
Im Spannungsfeld von Toleranz und deren Grenzen erproben Sie eine von Fachkenntnis und Respekt getragene Art des Redens mit Angehörigen anderer Religionen und Kulturen im interreligiösen Dialog bzw. Trialog sowie im interkulturellen Austausch. Kreative, auch nonverbale Ausdrucksmittel können Ihnen dabei zusätzliche Dimensionen erschließen.
DARSTELLUNG VON RELIGIONEN IN FILMEN UND SERIEN
Schauen Sie sich Spielfilme und/oder Serien an, in denen es um die Beziehungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen geht – besonders zwischen Judentum, Christentum und Islam. Analysieren Sie die Darstellung der Personen und Konfliktfelder, die damit zusammenhängende Inszenierung (filmische Mittel, Kontraste, Missverständnisse, Klischees und Stereotype …) sowie die eventuell angebahnten Lösungen in den Filmen. Überlegen Sie, ob die Darstellung der jeweiligen Religionen aus Ihrer Sicht positiv (z. B. konfliktentschärfend, klärend, zutreffend) oder eher negativ (Vorurteile schürend, verzerrend, Konflikte verschärfend etc.) zu bewerten ist. Stellen Sie Ihre Ergebnisse im Plenum vor. Als Filme kommen z. B. infrage: »Das Unwort«, »Masel Tov Cocktail«, »Monsieur Claude und seine Töchter«, »Familie ist ein Fest – Taufalarm«.
Das »House of One« (Modell), ein in Bau befindliches interreligiöses Projekt von Juden, Christen und Muslimen in Berlin. Die Grundsteinlegung war am 27. Mai 2021. Errichtet wird das Haus am Standort der 1964 abgetragenen Petrikirche, deren erhaltene Grundmauern im Keller des geplanten Gebäudes gezeigt werden sollen. Über den drei religiös definierten Gebäudeteilen wird sich der neutrale Mittelbau – die sog. Stadtloggia – turmartig erheben. In deren oberem Teil soll eine mit Metall überzogene kugelförmige Kuppel ruhen, die von einem luftigen Raum umgeben ist. Von dort aus werden Touristen einen Ausblick über die Mitte Berlins haben.

Auf die Frage des Sultans, welche von den drei monotheistischen Religionen die wahre sei, erzählt Nathan folgende Parabel:
Vor grauen Jahren lebt‘ ein Mann in Osten, Der einen Ring von unschätzbarem Wert
Aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der hundert schöne Farben spielte, Und hatte die geheime Kraft, vor Gott
Und Menschen angenehm zu machen, wer
In dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, Dass ihn der Mann in Osten darum nie Vom Finger ließ; und die Verfügung traf, Auf ewig ihn bei seinem Hause zu
Erhalten? Nämlich so. Er ließ den Ring
Von seinen Söhnen dem geliebtesten; Und setzte fest, dass dieser wiederum
Den Ring von seinen Söhnen dem vermache, Der ihm der liebste sei; […]
So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn, Auf einen Vater endlich von drei Söhnen; Die alle drei ihm gleich gehorsam waren, Die alle drei er folglich gleich zu lieben Sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit
Zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald
Der dritte, […] würdiger
Des Ringes; den er denn auch einem jeden
Die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das ging nun so, solang es ging. – Allein
Es kam zum Sterben, und der gute Vater
Kömmt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei
Von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort
Verlassen, so zu kränken. – Was zu tun? –Er sendet in geheim zu einem Künstler, Bei dem er, nach dem Muster seines Ringes, Zwei andere bestellt, und weder Kosten
Noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, Vollkommen gleich zu machen. Das gelingt
Dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, Kann selbst der Vater seinen Musterring Nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft
Er seine Söhne, jeden insbesondre;
Gibt jedem insbesondre seinen Segen, –Und seinen Ring, – und stirbt.
Nach dem Tode des Vaters ziehen die Söhne vor Gericht, um dort klären zu lassen, welcher Ring der echte ist. Der Richter ist aber außerstande, das durch Augenschein zu ermitteln. So erinnert er die drei Männer an die Eigenschaft des Rings, den Träger bei anderen Menschen angenehm zu machen. Wenn dies bei keinem eingetreten sei, müsse der echte Ring wohl verloren sein. Doch er rät den Brüdern:
[…] Hat von Euch jeder seinen Ring von seinem Vater: So glaube jeder sicher seinen Ring
Den echten. – Möglich; dass der Vater nun
Die Tyrannei des einen Rings nicht länger
In seinem Hause dulden wollen! – Und gewiss; Dass er euch alle drei geliebt, und gleich
Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen, Um einen zu begünstigen. – Wohlan!
Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette, Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag
Zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut, Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilf’! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bei euern Kindes-Kindeskindern äußern: So lad ich über tausend tausend Jahre
Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird
Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen
Als ich; und sprechen. Geht! – So sagte der Bescheidne Richter.
»HOUSE OF ONE«
»Ich sehe es so: Wir sind eine Basisbewegung, drei Gemeinden, die sich auf den Weg machen. Wir repräsentieren nicht das Ganze. Aber wir verpflichten uns, andere, die mitmachen wollen, einzubinden und nicht auszugrenzen.«
Pfarrer Gregor Hohberg
»Man sollte diese Frage [ob sich da etwas vermischen wird] auch nicht ständig stellen, sondern einfach schauen, was passiert, wenn wir in einem Haus sind. Wir werden ganz sicher keine Esperanto*-Religion schaffen, wir sind einfach beieinander, jeder in seiner Tradition.«
Rabbiner Andreas Nachama
»Natürlich wollen wir unsere Unterschiede nicht wegdiskutieren, die sind da, und wir wollen nichts Neues schaffen. Aber es gibt eben auch die verbindenden Elemente, und die zu entdecken, ist etwas Schönes.«
Imam Osman Örs
Grundriss des »House of One«:
A: Kirche, B: Moschee, D: Synagoge. C. Offener Zwischenraum zur Begegnung untereinander und mit interessierten Menschen jeder religiösen Prägung
1. Beschreiben Sie den geplanten Bau anhand des Modells ( S. 50) und des Grundrisses oben.
2. Beziehen Sie die konzeptionellen Entscheidungen (vgl. Info) auf die architektonische Gestaltung.
3. Überlegen Sie konkrete Veranstaltungstitel für den Zwischenraum.
4. In den schwarzen Flächen des Grundrisses ist Platz für weitere Räume. Diskutieren Sie gemeinsam,
ZUR KONZEPTION DES »HOUSE OF ONE«

• Das »House of One« wird von drei lokalen Gemeinden errichtet, einer jüdischen, einer muslimischen und der christlichen Gemeinde, der der Bauplatz gehört. Der Berliner Senat unterstützt das Bauvorhaben.
• Im »House of One« soll jede Gemeinde ihre eigenen Gebete verrichten bzw. Gottesdienste und Feste feiern können. Gebete für den Frieden, Aufrufe zur Toleranz, offene Andachten und andere über-religiöse Aktionen werden gemeinsam verantwortet. Gottesdienstliche Feiern mit aktiver Teilnahme an den Ritualen der anderen Religionen soll es nach Aussagen der Initiatoren aber nicht geben, um eine Vermischung zu vermeiden.
• Im neutralen Mittelbau soll der Dialog miteinander und mit Angehörigen anderer Religionen sowie mit Menschen ohne religiöse Bindung gepflegt werden.
welche Räume dort ergänzt werden sollten und welche Begegnungen dort stattfinden könnten.
5. Recherchieren Sie den aktuellen Stand des Bauvorhabens und informieren Sie sich über die mit dem Bau verbundene Kontroverse.
6. Arbeiten Sie aus dem Symbol der Kugel im Zentralbau und den Äußerungen der Initiatoren (oben links) das Verständnis von Religion [10] heraus, das hier prägend ist.
Am Ende von »Nathan der Weise« stellt sich heraus, dass alle (außer Nathan) miteinander verwandt sind: Sultan Saladin und seine Schwester Sittah – beide Muslime, der christliche Tempelherr und Recha, die Ziehtochter des Juden Nathan. Oben: Schlussszene des Theaters für Niedersachsen, 2018, Regie: Bettina Rehm

So wie der Opal »hundert schöne Farben spielte«, so lässt er vielfältige Wahrnehmungen der Fülle göttlicher Gnade zu. Die Wahrnehmenden empfangen nicht nur Teilmomente der Gnade Gottes, sondern jeweils das Ganze in einer je besonderen »Spielart«, jedenfalls genug, um der Liebe des Vaters, die sich in dieser Fülle kund tut, gewiss zu sein.
Die verschiedenen Religionen werden damit nicht vereinheitlicht, sondern vielmehr herausgefordert in je besonderer Perspektive, unter je besonderen geschichtlichen Bedingungen die ihnen zu Teil gewordene Liebe anzunehmen und aus diesem Glauben heraus Liebe zu üben.
Johannes von Lüpke, Theologe
Das geht ja MERKwürdig einfach.
NATHAN DER WEISE
1. Verschaffen Sie sich Informationen über den Inhalt des Stücks »Nathan der Weise*« und deuten Sie die Ringparabel.
2. Überlegen Sie, was geschieht, wenn alle drei Erben ihren Ring voller Vertrauen auf seine »geheime Kraft« tragen. Entwerfen Sie eine Fortsetzung der Ringparabel.
3. Erklären Sie die Deutung der Ringparabel im Text Lüpkes oben rechts.

4. Deuten Sie die Aussageabsicht der Schlussszene im Foto oben. Beachten Sie dabei auch die Entscheidung der Regisseurin, Nathan nicht in die Umarmung einzubeziehen.
DER SOG. FRAGMENTENSTREIT (1774 –1778)
• G. E. Lessings* »Nathan der Weise*« ist Teil einer heftigen Auseinandersetzung u. a. mit dem Hamburger Hauptpastor J. M. Goeze, einem Vertreter der sog. lutherischen Orthodoxie*. Vorausgegangen war eine anonyme Veröffentlichung der »Fragmente eines Ungenannten« durch Lessing, deren Ver fasser der verstorbene Orientalistikprofessor Samuel Reimarus* war. Als Deist* und Aufklärer* übte dieser darin radikale Kritik am Gedanken der Verbalinspiration* und der Buchstabengläubigkeit z. B. in Bezug auf biblische Wundererzählungen oder an der Darstellung Jesu als Sohn Gottes. Er bestritt auch den exklusiven Wahrheitsanspruch des Christentums. Bibel und Christentum seien nur zufällige Formen einer an sich richtigen und ewigen, weil natürlichen Religion. (Vgl. S. 32 f.)
• Lessing war der Meinung, dass man eine solche Position öffentlich diskutieren müsse, auch wenn er selbst sie nicht ganz teilte. Auf die schroff ablehnende, autoritäre Haltung der Amtskirche, die Lessing ein Veröffentlichungsverbot in Sachen Religion auferlegte, antwortete Lessing schließlich mit seinem »Nathan der Weise«.
Jede Religion ist ein Haus der nach Gott verlangenden Menschenseele, ein Haus mit Fenstern und ohne Tor; ich brauche nur ein Fenster aufzumachen, und Gottes Licht dringt ein; mache ich aber ein Loch in der Mauer und breche aus, dann bin ich nicht bloß hauslos geworden: Mich umgibt ein kaltes Licht, das nicht das Licht des lebendigen Gottes ist. Jede Religion ist ein Exil, in das der Mensch vertrieben ist; hier ist er es deutlicher als sonst wo, weil in seiner Beziehung zu Gott von den Menschen anderer Gemeinschaften geschieden; und nicht eher als in der Erlösung der Welt können wir aus den Exilen befreit und in die gemeinsame Gotteswelt gebracht werden. Aber die Religionen, die das wissen, sind in der gemeinsamen Erwartung verbunden; sie können einander Grüße von Exil zu Exil, von Haus zu Haus durch die offenen Fenster zurufen. Doch nicht das allein: Sie können miteinander in Verbindung treten und miteinander zu klären versuchen, was von der Menschheit aus getan werden kann, um der Erlösung näher zu kommen; es ist ein gemeinsames Handeln der Religionen denkbar, wenn auch jede von ihnen nicht anderswo handeln kann als im eignen Haus.
All das aber ist nur in dem Maße möglich, als jede Religion sich ihrem Ursprung, der Offenbarung, in der sie ihren Ursprung hat, zuwendet und an der Entfernung davon, die sich in ihrem geschichtlichen Entwicklungsprozess vollzogen hat, Kritik übt. Die geschichtlichen Religionen haben die Tendenz, Selbstzweck zu werden und sich gleichsam an Gottes Stelle zu setzen, und in der Tat ist nichts so geeignet, dem Menschen das Angesicht Gottes zu verdecken, wie eine Religion.
Die Religionen müssen darauf verzichten, das Haus Gottes auf Erden zu sein, und sich damit begnügen, ein Haus der Menschen zu sein, die in der gleichen Absicht Gott zugewandt sind, ein Haus mit Fenstern.
Martin Buber*1. Religion als Haus, als Exil? – Deuten Sie die Bilder und Metaphern, die M. Buber in seinem Text verwendet.
2. Vergleichen Sie die Schlusspointe in der Ringparabel ( S. 51) mit der in M. Bubers Text.
3. Ordnen Sie verschiedene Grundhaltungen gegenüber religiösen Wahrheitsansprüchen anderer wie Exklusivismus*, Inklusivismus*, (theozentrischer) Pluralismus*, Relativismus* und Skeptizismus* den Bildern links zu.
Wie wahr ist eine Religion im Vergleich zu anderen? Modelle zur »Theologie der Religionen«
4. Vergleichen Sie die in den Bildern dargestellten Positionen mit der M. Bubers und gestalten Sie zu ihr ggf. ein weiteres Bild.
»Das kann ich nicht akzeptieren!
»Jetzt sag doch auch mal was!
»Wenn du meinst.
»Ist mir doch egal.
»Jeder kann denken, was er will!
»Bitte jetzt keinen Streit!
»Solange du unter meinem Dach wohnst ...
»Man kann das so oder so sehen!
»Du bist heute einfach unerträglich!
»Jetzt entspann dich doch mal!
Anerkennung verzichtet auf die Macht, aus der die Toleranz noch kommt. Toleranz wird oft wie Billigung und Anerkennung gebraucht, was bedeutsame Unterschiede verwischt, auf die aufmerksam zu machen wichtig ist. Anerkennung ist dagegen Liebe als Erkenntnisform, denn sie lässt mich den Anderen tiefer erkennen, und in diesem Licht geht auch mir eins über mich auf.
Josef Fellsches, Erziehungswissenschaftler
MERKe: Niemand will nur toleriert werden.
Heißt Toleranz zugleich, dass alles gleich gültig ist, dass alles geht, dass alles zu akzeptieren ist, ja dass letztlich kein Anspruch auf Wahrheit mehr erhoben werden kann? Sicherlich nicht, denn die Konsequenz davon wäre nicht nur die Aushöhlung der Gesellschaft, die in diesem Falle keine gemeinsam anerkannten Grundwerte mehr hätte, sondern gleichzeitig der Verlust jeglicher Identität – des einzelnen wie der Gemeinschaft. Eine Identität nämlich hängt wesentlich davon ab, ob eine Überzeugung vertreten und damit begründetermaßen Wahrheit bekannt wird. Auch die Begegnung mit dem/ der Anderen, woran immer er/sie glauben mag, gewinnt ihren Wert und ihre Spannung erst daraus, dass nicht als egal betrachtet wird, was er/sie glaubt, sondern dass man sich gegenseitig zutraut und für würdig erachtet, um die Wahrheit zu ringen und zu streiten.
Heinrich Schmidinger, Philosoph und Theologe
to-le-ranz, die at. indulgentia egoistica

genießt als Leiter der Prüfungskommission für politisch korrektes Verhalten einen sehr guten Ruf. Dabei genügt es in der Regel schon, sich großzügig Dingen gegenüber zu zeigen, die man ohnehin mag. Bei heikleren Themen empfiehlt sie hingegen, Abstand zu halten. Sobald nämlich die eigenen Gewohnheiten gestört werden, ist es mit der Toleranz schnell vorbei.
1. Diskutieren Sie, inwiefern die Zitate (mittig links) etwas mit Toleranz zu tun haben.
2. Grenzen Sie mithilfe dieser Seite die Begriffe Respekt, Anerkennung, Duldung und Gleichgültigkeit voneinander ab. Entwerfen Sie Situationen, in denen die jeweilige Haltung angemessen sein könnte.
3. Beenden Sie folgende Sätze: »Wahre Toleranz beginnt, wenn ...« und »Toleranz sollte enden, wo/ wenn ...«
4. Deuten Sie die Darstellung der Toleranz als »Monster des Alltags« (oben).
5. Erarbeiten Sie einen differenzierten Toleranz-Begriff.

• Die große Nähe von Judentum, Christentum und Islam zueinander – sowohl geografisch als auch religiös – birgt von Anfang an Konfliktpotential.
• Dies gilt u. a. für die krisenhafte Zeit der Entstehung des Christentums, denn in der gleichen Periode musste sich das Judentum nach der Zerstörung des herodianischen Tempels durch Rom (70 n. Chr.) und dem Ende der Staatlichkeit (135 n. Chr.) neu sammeln und definieren [6], [9] Auf der Suche nach einem eigenen klaren Profil haben Anhänger beider Religionen die je anderen aus den eigenen Reihen verstoßen und als »Irrlehrer« gebrandmarkt.

• Auch Mohammed hat zunächst Juden und Christen als Dialogpartner und Verbündete bei der Verbreitung des Monotheismus gesehen, sich dann aber deutlich von beiden Gruppen abgegrenzt. Im Laufe der Entstehung der koranischen Texte nimmt die Polemik gegen die »Leute des Buches«, wie Christen und Juden im Koran auch genannt werden, deutlich zu. Die Änderung der Gebetsrichtung von Jerusalem
DIE VORFÄLLE IM RHEINLAND ZU BEGINN DES ERSTEN KREUZZUGS:
Als die Kreuzfahrer nun auf ihrem Zuge durch die Städte kamen, in denen Juden wohnten, sprachen sie untereinander: »Sehet, wir ziehen den weiten Weg, um die Grabstätte aufzusuchen und uns an den Ismaeliten (d. h. an den Muslimen) zu rächen, und siehe, hier wohnen unter uns die Juden, die ihn (d. h. Christum) unverschuldet umgebracht und gekreuzigt haben! So lasset zuerst an Ihnen uns Rache nehmen und sie austilgen unter den Völkern, dass der Name Israel nicht mehr er
nach Mekka im Jahr 624 (vgl. Sure 2,144) ist ein solcher Schritt der Profilierung. Im selben Jahr beginnen auch militärische Aktionen gegen Feinde und Andersgläubige.
• Im Jahr 1074 plante Papst Gregor VII. an der Spitze eines geeinten christlichen Heeres das von Muslimen besetzte Byzanz zu befreien und das geeinte Christentum dann nach Jerusalem zu führen. Die Kreuzzugsidee war geboren – ein religiös begründeter Waffengang zur Verteidigung der Überlegenheit des C hristentums. Den Kreuzrittern wurde ein großzügiger Sündenerlass in Aussicht gestellt. Im Jahr 1095 kam es zum ersten von vielen Kreuzzügen. Zum 16. Jahrhundert hin ebbte die Kreuzzugsidee langsam ab, ohne ganz zu verschwinden.
• Der Begriff »Kreuzzug« wird heute von verschiedenen Seiten verwendet, um Kämpfe oder Anstrengungen ideologisch zu rechtfertigen oder sie als ideologisch zu markieren.
1. Vergleichen Sie die Abstoßungsbewegungen bei der Entstehung von Religionen mit Familienstreitigkeiten.
2. Verknüpfen Sie die Kreuzzugsidee (vgl. Info) mit Ihren Kenntnissen zum Verhältnis von Staat und Kirche im Mittelalter [8].
3. Beziehen Sie Informationen und Material dieser Seite auf das Kreuzzugsbild unten. Deuten Sie es.
4. Tauschen Sie sich über erste Assoziationen zum Gemälde von C. Twombly ( S. 57) aus. Erarbeiten Sie eine Interpretation vor dem Hintergrund der Doppelseite sowie eigener Recherchen zum ganzen Bildzyklus Twomblys. Stellen Sie Vermutungen über Motive an, solch einen Bildzyklus im 20. Jh. zu malen.
Die Nachfolger Mohammeds unterwarfen bis zum 8. Jahrhundert den gesamten Norden Afrikas, den Nahen Osten sowie Südspanien. Die dort bisher herrschenden Mächte, das christliche Byzanz und das Perserreich, waren so geschwächt, dass sie dem Ansturm kaum widerstehen konnten. Ziel dieser militärischen Expansion war aber nicht der territoriale Gewinn, sondern die Verbreitung der eigenen Religion. In den eroberten Gebieten genossen Juden und Christen als abgabepflichtige Schutzbefohlene der Muslime trotzdem eine relative Religionsfreiheit.
Etymologisch bedeutet der arabische Begriff die Bemühung, ein bestimmtes Objekt zu erreichen. Auch wird dar unter eine individuelle Bemühung um den Glauben (großer Jihad) oder zum moralischen Handeln und Mission verstanden. Im islamischen Recht bezeichnet er oft eine der zulässigen Formen des Krieges zur Erweiterung des islamischen Herrschaftsbereichs oder zu dessen Verteidigung (kleiner Jihad; vgl. Suren 8:30; 61:8; 2:217 u. a.). Jihad ist eine Pflicht der Gemeinschaft der Muslime, die ständig verfolgt werden muss. Gemäß dem islamischen Recht müssen bei der Ausrufung des kleinen Jihad bestimmte Regeln eingehalten werden: Zunächst ein Aufruf an die Ungläubigen, den Islam anzunehmen bzw. an die Juden und Christen, die Herrschaft der Muslime anzuerkennen. Nach einer Bedenkzeit wird dann der Krieg begonnen.
Die Lehre vom Jihad erfuhr verschiedene Umdeutungen, als Friedensschlüsse mit nichtmuslimischen Herrschern unumgänglich wurden. In der Moderne gehört das Konzept des Jihad zur Rhetorik radikaler islamischer Bewegungen und auch muslimischer Staaten bei der Abgrenzung von und der Auseinandersetzung mit dem Westen.
Christian Szyska, Orientalist
Cy Twombly, aus dem Lepanto-Zyklus*, der die Ereignisse der historischen Seeschlacht zwischen christlichen und osmanischen Truppen vom 7. Oktober 1571 im Golf von Patras reflektiert

Im Jahr 1219 unternahm Franziskus von Assisi eine Reise nach Damiette in Ägypten, um mit dem Sultan einen Friedensvertrag auszuhandeln, der von den christlichen Heerführern aber abgelehnt wurde. Briefmarke zum 800. Jahrestag dieses Treffens

KAMPF UND HEILIGER KRIEG
1. Die Expansion des islamischen Herrschaftsgebiets gilt und galt als Jihad. Differenzieren Sie diese Bezeichnung mithilfe der Informationen links.
2. Heute wird die kriegerische Deutung von Jihad von vielen Muslimen abgelehnt. Recherchieren Sie nach Beispielen.
3. Informieren Sie sich über die auf der Briefmarke abgebildeten Personen sowie dazu, warum diese Begegnung als Briefmarkenmotiv verewigt worden ist. Deuten Sie die Darstellung.
4. Sowohl dem Christentum als auch dem Islam wird die jeweilige kriegerische Vergangenheit in Gestalt der Kreuzzüge bzw. der militärischen Expansion bis heute vorgeworfen. Doch es gibt auch differenziertere Stimmen. Recherchieren und diskutieren Sie entsprechende Stellungnahmen.
Als wichtigsten Grund nennen die Kopftuchträgerinnen religiöse Gründe (Abbildung 4-41). Für 89 % der muslimischen Frauen mit Kopftuch gehört das Kopftuch demnach zur Ausübung ihrer Religion dazu. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der MLD-Studie 2008 (Haug et al. 2009: 205f.). Der zweithäufigste Grund ist mit einem Anteil von 38 % die Vermittlung von Si-
das Kopftuch zum Schutz vor Belästigung von Männern zu tragen. Ein gleicher Anteil gibt andere Gründe an. Hierunter fallen insbesondere Moscheebesuche.
Insgesamt fällt auf, dass die Frauen mehrheitlich Gründe nennen, die eine eigene Motivation erkennen lassen. Erwartungen des Bekanntenkreises (5 %), der Familie oder des Partners (4 %) spielen eine marginale Rolle. Es ist zu beachten, dass sich diese Anteile
Abbildung 4-41: Gründe für das Tragen eines Kopftuches der befragten Musliminnen mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Herkunftsländern (in Prozent), Mehrfachnennungen möglich
Ich stehe irgendwo zwischen Deutschland und Marokko und weiß nicht, wer ich bin. Als ich jetzt für ein paar Monate in Marokko zur Schule ging, haben alle Mädchen Kopftuch getragen. Nach einer Weile hat mich das gestört und ich wollte es nicht mehr anziehen. Ich habe dort auch gespürt, wie wenig Rechte ich als Frau habe. Meine Meinung war oft nicht gefragt. Hier in Deutschland hat mir das Kopftuch eine Weile ein Gefühl dafür gegeben, wer ich bin. Aber will ich das wirklich sein? Ich überlege, ob ich das Kopftuch wieder ablege, um nach außen hin nicht immer anders zu sein. Ich weiß ja, dass ich anders bin, muss es aber nicht immer zeigen. In Marokko spüre ich, dass ich Deutsche bin und in Deutschland bin ich für alle aus Marokko. Ich bin sehr gläubig, aber das Kopftuch ist irgendwie was anderes.
Fatiha, 17
Hier geht es nicht nur um Religion. Aber das MERKt man nicht gleich.
Frauen mit Kopftuch tragen das Patriarchat mit.
Sollen Kopftücher für Mädchen unter 14 Jahren verboten werden?
Wer das Kopftuch verbieten will, muss auch Kreuz und Kippa verbieten.
Bayern: Kopftuchverbot für Richterinnen zulässig.
Der Kopftuch-Streit: Das Abendland und ein Quadratmeter Islam.
Das Kopftuch degradiert Frauen zum Sexobjekt.
Religiöse Pflicht
Vermittlung von Sicherheit Tradition
Erkennbarkeit als Muslimin in der Öffentlichkeit
Schutz vor Belästigung von Männern
Schutz vor Belästigung von Männern Erkennbarkeit als Muslimin in der Öffentlichkeit
Andere Gründe
Andere Gründe
Erwartungen Bekanntenkreis
Erwartungen/Forderung Familie/Partner

Erwartungen Bekanntenkreis Erwartungen/Forderungen Familie/Partner Modische Gründe
603 befragte Muslimas ab 16 Jahren mit Migrationshintergrund aus muslimischen Herkunftsländern, Mehrfachnennungen möglich, Statista April 2021
Quelle: MLD 2020, Datensatz der Befragten im Alter ab 16 Jahren, gewichtet. Ungewichtete Fallzahl: 603. Fragen v401_1-v401_9. Hinweis: Die Abbildung gibt die Gründe nur für Musliminnen wieder, die angeben, das Kopftuch manchmal, meistens oder immer zu tragen.
1. Muslimische Frauen bzw. Mädchen und das Kopftuch. – Tauschen Sie sich über Ihre Vorkenntnisse [7] und Meinungen aus und vergleichen Sie sie mit der Statistik.
2. Erarbeiten Sie aus den – teilweise polemischen –Schlagzeilen (links) differenziert die Konfliktfelder des sog. »Kopftuchstreits«.
3. Zeigen Sie auf, welche der Konfliktfelder für Fatiha in ihrer Entscheidung eine Rolle spielen.
4. Diskutieren Sie, inwiefern die Einschätzung von R. Wielandt (unten) etwas zur Klärung des Konflikts beitragen kann.
Die koranische Textbasis enthält keine explizite Weisung an muslimische Frauen, ihren Kopf in Gegenwart von Männern, die nicht zum Kreis ihrer engen Verwandten gehören, bedeckt zu halten.
Festzuhalten ist: Koran und Hadīt* bieten Muslimen hinsichtlich des obligatorischen oder nicht obligatorischen Charakters der Kopfverschleierung eine Pluralität von Deutungsmöglichkeit, und verschiedene Deutungen werden heutzutage von Muslimen, die sich ernsthaft um die Erkenntnis und Erfüllung des geoffenbarten Gotteswillens bemühen, auch tatsächlich ver treten und gelebt.
Rotraut Wielandt, Islamwissenschaftlerin
• Modest Fashion (etwa »dezente, sittsame Mode«) ist ein schnell wachsendes Marktsegment der internationalen Textilbranche. Modest fashion hat – bei höchst unterschiedlicher konkreter Umsetzung –das Ziel, den weiblichen Körper dezent zu umhüllen, ohne die Frau zu verstecken.

• Die Ausstellung »Contemporary Muslim Fashions«, zuerst in San Francisco gezeigt, kam 2019 nach Frankfurt. Um einen Einblick in den Stil von Modest Fashion zu geben, wurden etwa 80 Modeentwürfe an Kleiderpuppen sowie Video- und Fotoarbeiten gezeigt. Die meisten Kleiderpuppen trugen eine Kopfbedeckung, also Haube, Hut, Hijab oder Turban.
OFFENER BRIEF AN DEN DIREKTOR DES MUSEUMS, IN DEM DIE AUSSTELLUNG STATTFAND
Sehr geehrter Herr Prof. Matthias Wagner K, wir sind entsetzt, dass Sie die Ausstellung »Contemporary Muslim Fashions« hier nach Frankfurt in die Wiege der deutschen Bürgerrechte geholt haben. Diese Ausstellung, die religiöse Kleidervorschriften als Mode darstellt, ist ein Schlag ins Gesicht inländischer und ausländischer Frauenrechtlerinnen. Sie machen sich damit mit der Religionspolizei in manchen islamischen Ländern gemein.
Mit dieser Ausstellung ignorieren Sie den Kampf von Frauenrechtlerinnen in islamischen Staaten, die sich gegen den Zwang zu Verschleierung und Verhüllung einsetzen und dafür ihre Freiheit, ihre Unversehrtheit und ihr Leben riskieren.
Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung e.V.
Nabila Bushra, praktizierende Muslima und Studierende im Fach »Gender Studies« äußert sich zur Diskussion über die Ausstellung:
»Das Kopftuch, das ohnehin nur ein kleiner Teil der Ausstellung ist, wird dort weder als positiv propagiert, noch als negativ dargestellt, sondern als Lebensrealität vieler muslimischer Frauen.« Für sie zeichne die Ausstellung aus, dass sie Raum für unterschiedliche Perspektiven und Gespräche lasse. Mit Kritik noch im Vorfeld der Eröffnung hatte Bushra trotzdem gerechnet. Für sie bilden die Zeitungstexte von Autorinnen und Autoren, die weder die Exponate gesichtet, noch mit einer Kopftuchträgerin über die Schau gesprochen haben, einen starren Diskurs* ab: Eurozentrisch und bevormundend, kaum auf Augenhöhe, die weiße Feministin muss gehört, die bedeckte Muslimin gerettet werden. »Kritikerinnen und Kritiker der Ausstellung wollen diese dominanten Diskurse, bestimmte Bilder und Konzepte, die inzwischen unserer komplexen Lebensrealität nicht mehr gerecht werden können, aufrecht erhalten«, sagt Bushra, die in Pakistan geboren wurde.
Manuel Almeida Vergara, Journalist1. Fassen Sie die kontroversen Meinungen in den Materialien dieser Seite zusammen. Recherchieren Sie weitere Reaktionen auf die Ausstellung (auch in ihrer amerikanischen Version) in den Medien.
2. Nehmen Sie eine der möglichen Positionen zur Ausstellung ein und diskutieren Sie in der Klasse.
3. Deuten Sie den modischen Gesamtentwurf im Bild links.
4. Wenden Sie die Erkenntnisse aus S. 60 f. auf die Diskussion um die Ausstellung an.
5. Entwerfen Sie einen Einladungstext zu einer Veranstaltung, die Befürworter und Gegner von Modest Fashion miteinander ins Gespräch bringt.
Foto aus der Ausstellung (vgl. links). Auf der Bomberjacke ist hinten der 1. Zusatzartikel der Verfassung der USA (u. a. garantiert er die Religionsfreiheit) arabisch abgedruckt.

Angesichts der Vielzahl der Verwendungsweisen des Wortes »Kultur« und der Vielfalt konkurrierender wissenschaftlicher Definitionen erscheint es sinnvoll, von Kulturbegriffen im Plural zu sprechen. Als zentraler Aspekt bezeichnet Kultur das vom Menschen Gemachte bzw. gestaltend Hervorgebrachte – im Gegensatz zu dem, was nicht vom Menschen geschaffen, sondern von Natur aus vorhanden ist. Der weite Begriff der Kultur umfasst somit die Gesamtheit der vom Menschen selbst hervorgebrachten und im Zuge der Sozialisation erworbenen Voraussetzungen sozialen Handelns, d. h. die typischen Arbeits- und Lebensformen, Denk- und Handlungsweisen, Wertvorstellungen und geistigen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft.
Ansgar Nünning, Anglist und KulturwissenschaftlerVERWOBEN UND VERFILZT
Einig sind sich die gegenwärtigen Kulturtheorien weitgehend darin, Kultur als etwas Dynamisches zu verstehen. Als Produkte menschlichen Handelns sind sie veränderbar und verändern sich beständig. Schon deshalb kann man nicht von »der« Kultur eines Volkes, einer Religionsgemeinschaft oder einer anderen Gruppe sprechen. Hinzu kommt: In der Regel haben Menschen Anteil an verschiedenen Kulturen, denn der Begriff Kultur bezieht sich im Grunde nicht auf »Hochkulturen« oder »Nationalkulturen«, sondern allgemein auf die verbindende Kraft von partialen, regionalen oder lokalen, also auch flüchtigeren kulturellen Lebenszusammenhängen. So verbindet Punks in verschiedenen Ländern ihre Punk-Subkultur, zugleich unterscheiden sie sich voneinander nicht nur aufgrund individueller Merkmale der Personen, sondern auch, weil sie aufgrund unterschiedlicher »nicht-punk-kultureller« Sozialisationen an verschiedenen Kulturen partizipieren. Religionsgemeinschaften sind ebenso wenig homogen, wie es sog. Nationalkulturen sind: Auch innerhalb von Religionsgemeinschaften gibt es Subkulturen oder Subreligionen. Jeder Mensch hat somit Anteil an unterschiedlichen Kulturen und Subkulturen und entsprechend an unterschiedlichen Religionskulturen und Religionssubkulturen. Diese überlagern und ergänzen sich, und jeder Mensch bringt auf diese Weise neue Impulse in Kulturen und Religionskulturen ein, wodurch sich diese verändern – und in dieser veränderten Form
1. Sammeln Sie Beispiele für die Verwendung des Begriffs »Kultur« im Alltag und leiten Sie daraus eine eigene erste Definition von »Kultur« ab.
2. Ergänzen Sie – ggf. mit Varianten – die folgenden Satzanfänge mithilfe der Texte von A. Nünning und J. Willems: Kultur ist … / Kultur leistet … / Kultur und Religion … – Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihren eigenen Definitionen (Aufgabe 1).
3. Arbeiten Sie aus der Abbildung (oben) kulturelle und religiöse Anteile heraus.
4. Diskutieren Sie anhand eigener Beispiele den Zusammenhang zwischen Religion und Kultur.
5. Beziehen Sie Ihre Erkenntnisse zum Zusammenhang von Kultur und Religion auf S. 58 f. und 61 bis 63.
auf Individuen ein- und zurückwirken. Kultur ist wiederum, wenn man sie als Set von Ordnungsformen und Deutungsmustern versteht, selbstverständlich religiös geprägt, da die Bewohner aller Regionen der Welt über viele Jahrtausende von Religion geprägt wurden. Religion und Kultur erscheinen damit als miteinander ver woben oder, da das Bild des Verwobenseins noch impliziert, dass man beides eindeutig voneinander unterscheiden könnte, als verfilzt.
Joachim Willems, Theologe
DAS GESCHLECHTERVERHÄLTNIS IN JUDENTUM, CHRISTENTUM UND ISLAM
• Kulturelle und religiöse Einflüsse sind besonders bei der Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter zueinander schwer voneinander zu lösen. Gerade diese Frage wird jedoch besonders oft alleine dem religiösen Bereich zugeordnet.
• In allen drei Religionen ist die Frau dem Mann traditionell nicht völlig gleichgestellt, da alle drei Kulturen zur Zeit der Entstehung ihrer Heiligen Schriften patriarchal geprägt waren. Entsprechend ist das Verhältnis der Geschlechter in den Religionen immer wieder Gegenstand von Kontroversen, die abhängig von lokalen Traditionen, von soziologischen Gruppen und vielen weiteren Faktoren unterschiedlich geführt werden.
• Im Judentum hat die Frau traditionell eine herausgehobene Funktion bei der Beachtung der häuslichen Vorschriften (Reinheit, Speisegesetze), bei der fr ühen religiösen Erziehung der Kinder sowie am Sabbat, an dem sie die Kerzen anzündet und den Segen spricht.
• In allen drei Religionen gibt es seit dem 20. Jh. in bestimmten Ausprägungen sowie unterschiedlicher Breite die Ordination von Frauen zu Ämtern in den Gemeinden (Rabbinerin, Pfarrerin, Imamin).
• Alle drei Religionen kennen verschiedene Vorschriften zur dezenten Kleidung für Frauen.

1. Sammeln Sie weitere Informationen zur Situation der Frau in verschiedenen Strömungen in Judentum [9], Christentum und Islam [7]. Tragen Sie sich gegenseitig die Ergebnisse vor und differenzieren Sie zwischen kulturellen und religiösen Einflüssen. Tauschen Sie sich über die Ergebnisse aus.
2. Recherchieren Sie, wie sich Rechte für Frauen in Deutschland im Lauf der letzten 200 Jahre entwickelt haben. Überprüfen Sie diese Entwicklungen auf religiöse Anteile.
3. Diskutieren Sie, welche geschlechtsbezogenen Einschränkungen und Verhaltensvorschriften es in Ihrem Umfeld sowohl für Männer als auch für Frauen
MERKwürdig: Die Rolle der Frau –ein Männerproblem
gibt Welche (ggf. auch religiösen) Faktoren spielen dabei eine Rolle?
4. Beschreiben und deuten Sie die Karikatur und diskutieren Sie, ob Sie deren Umgang mit dem »Konfliktfeld« Kopftuch für angemessen halten.
1. Untersuchen Sie die anderen Konfliktfelder, die meist den Religionen zugeschrieben werden ( S. 56 f. und 58), auf Anteile von Kultur und Religion.
2. Bewerten Sie anhand der Erkenntnisse dieser Doppelseite den Konflikt um die Ausstellung in Frankfurt ( S. 59) neu.

• Es gibt beobachtbare und beschreibbare gruppenspezifische Eigenheiten, die meist kulturell bedingt sind. Davon zu unterscheiden sind Stereotype und Vorurteile, also verallgemeinerte stark verfestigte Vorstellungen von Eigenschaften, die allen Angehörigen bestimmter Gruppen zugeordnet werden. Verallgemeinerungen treffen in der Regel Angehörige »anderer« Gruppen. Mitglieder der »eigenen« Gr uppe werden meist differenzierter betrachtet, deren Eigenschaften als individuelle Eigenheiten und nicht als typisch für eine ganze Gruppe gedeutet.
• Stereotype und Vorurteile kommen in jeder Kultur vor. Sie verschaffen einen schnellen Überblick über die Vielfalt der Phänomene. Insofern sind sie ein kognitives Hilfsmittel zur beschleunigten Wahrnehmung. Die Zuordnung von Menschen zu Gruppen mit festgelegten Eigenschaften ermöglicht das rasche Finden von Handlungsoptionen – gerade im Konfliktfall ein Vorteil. Als Abgrenzung von den »Anderen« sorgen Stereotype und Vorurteile außerdem für eine Stärkung des Zusammenhalts und der eigenen Identität.
• Der große Nachteil derartiger Vereinfachungen ist, dass sie den Blick auf das reale Gegenüber verstellen. Die schnell verfügbaren Handlungsoptionen wirken sich auf reale Begegnungen meist destruktiv aus, weil sie unpassend sind.
Mit Othering wird ein Prozess beschrieben, in dem Menschen als »Andere« konstruiert und von einem »wir« unterschieden werden. Diese Differenzierung ist problematisch, da sie mit einer Distanzierung einhergeht, die »das Andere« als »das Fremde« aburteilt. Prozesse des Othering können sich auf die soziale Stellung eines Menschen in der Gesellschaft wie etwa Klassenzugehörigkeit oder Glaubensvorstellungen beziehen, auf race/Ethnizität, Sexualitäten, Geschlechter oder Nationalitäten.
In erster Linie umfasst Othering eine Selbstaffirmation: Über die Zuschreibung von Minderwertigkeit wird für sich Überlegenheit in Anspruch genommen.
Homepage der Hochschule der Künste in Zürich
ISLAMOPHOBIE ODER ISLAMFEINDLICHKEIT?
Interview mit dem Wiener Politologen Farid Hafez
Herr Dr. Hafez, was ist Islamfeindlichkeit?
Kurzgesagt ist Islamophobie die Projektion eigener Ängste, Bedürfnisse oder Wünsche auf den Islam. Warum sprechen Sie von Islamophobie statt von Islamoder Muslimenfeindlichkeit?
Ich finde, dass der Begriff der Muslimenfeindlichkeit zu kurz greift. Natürlich sind die Opfer konkreter islamophober Diskriminierungen immer einzelne Menschen. Aber wenn etwa Geert Wilders … … der Chef der islamfeindlichen Partei für die Freiheit in den Niederlanden … … davon spricht, der Islam sei eine faschistoide Religion und der Koran wie Hitlers »Mein Kampf« – dann geht es nicht um einzelne Muslime, sondern um den Islam an sich. Vor allem spreche ich von Islamophobie, weil dies der Terminus auch der internationalen Fachdebatte ist.
Aber ist der Begriff nicht verniedlichend? Klingt er nicht zu sehr nach etwas Verschrobenem wie einer Spinnenphobie, einem irrationalen Angstgefühl?
Hier sollte man die Ebenen auseinanderhalten: Wenn beispielsweise eine rechtsradikale Gruppierung den Slogan »Maria statt Scharia« plakatiert, dann ist das eine bewusst eingesetzte, islamfeindliche Kampagne. Der Effekt bei den Betrachtern hingegen ist eine irrationale Angst, dass die Muslime Deutschland islamisieren würden. Beim planenden Akteur geht es also um etwas anderes als beim Rezipienten.
Damit sind wir beim Kern der Sache: Islamophobie bzw. Islamfeindlichkeit ist ein multidimensionales Phänomen. Sie kann unterschiedliche Motive haben, von unterschiedlichen Akteuren kommen und sich in unterschiedlichen Diskursstrategien manifestieren. Sie ist jedenfalls kein einheitliches Gebilde, sondern etwas Fließendes. Der zentrale Mechanismus ist aus der Vorurteilsforschung bekannt: die Projektion eigener Ängste auf Andere.
Bei der Islamfeindlichkeit geht es nicht um den realen Islam oder reale Muslime, sondern um ein imaginiertes Bild davon. Dies knüpft natürlich an die Realität an, aber das Vorurteil verfälscht die Erfahrung. Der Islam, über den Islamfeinde sprechen, hat jedenfalls wenig mit dem realen Islam zu tun; es gibt reihenweise Islamwissenschaftler, die Ihnen das bestätigen können.
1. Vergleichen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mit Stereotypen und Vorurteilen mit den Ausführungen in der Info ( S. 62)
2. Diskutieren Sie, ob das Reden über Vorurteile diese stärkt oder schwächt bzw. diese auf- oder abbaut.
3. Sind Vorurteile gegenüber dem Islam und Islamfeindlichkeit dasselbe? Sammeln Sie die Argumente des Interviews und tauschen Sie sich darüber aus.

4. Suchen Sie in den Materialien dieses Kapitels nach Stereotypen und Verallgemeinerungen.
1. Gestalten Sie Plakate zum Entkräften von Vorurteilen unter Einbezug des Ratgebers unten.
2. »Othering« ( S. 62 unten links) ist eine Strategie, um Vorurteile zu stützen. Finden Sie Spuren von Othering in Ihrem Alltag und überlegen Sie sich Gegenmaßnahmen.
3. Die Comic-Zeichnerin S. Hamed veröffentlicht ihre Bilder in sozialen Netzwerken und versucht, Vorurteilen und Hass entgegenzuwirken. Deuten Sie die Comics und überprüfen Sie auch den Gebrauch von Stereotypen.

Bei interkulturellen Begegnungen sorgen Stereotype und Vorurteile oft für Probleme. Diese einfach abzulehnen und deren Äußerung zu verurteilen, führt in der Regel dazu, dass die Verallgemeinerungen unter der Oberfläche weiter wirken, aber nicht adressiert und so entkräftet werden können.
Es ist daher sinnvoll, Stereotype und Vorurteile bewusst wahrzunehmen. Im geschützten Raum eines urteilsfrei geführten Gesprächs dürfen diese frei geäußert werden. Anschließend kann man untersuchen, was die Ursachen, Funktionen und Mechanismen dieser Verallgemeinerungen sind. So verlieren sie ihre Kraft und können das Handeln nicht mehr dominieren. Nicht der Konsens oder das Verbindende macht eine interkulturelle Begegnung wertvoll, sondern die Zwischenräume, die offen bleiben, die Unterschiede und sogar das Irritierende.
Nach einem Ratgeber für interkulturelle Begegnungen
Eine christliche Stimme: Wir haben, wie die Schrift sagt, keinen Gott als den einen, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm (1 Kor 8,6). Juden, Christen und Muslime glauben an denselben Gott. Zugleich streiten wir darüber: Hat er sich in der Tora* zu erkennen gegeben? In Jesus Christus? Im Koran? Was gebietet Gott für das tägliche Leben?
Dieser Streit ist nach menschlichen Maßstäben nicht zu entscheiden. Die entscheidende Frage an uns ist daher, auf welche Weise wir den unvermeidlichen Streit führen. Streiten wir »auf schöne Art«, wie es der Koran formuliert (Sure 29,46)? Oder streiten wir mit Rechthaberei, Verachtung, Polemik, gar mit Gewalt?
Aus christlicher Sicht ist die Antwort eindeutig. Das Gebot der Nächstenliebe gilt nach dem Zeugnis der Bibel gegenüber jedermann.
Unterschiede gilt es zu respektieren. Ich soll meine Nächsten behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und wenn es um der Sache willen nötig ist, dass ich mit ihnen streite, dann auf »schöne Art«, mit Klugheit, Demut und Achtung vor dem Anderen.
Eine muslimische Stimme: Im Qur’an und in der islamischen Tradition sind Namen Gottes bekannt, die ihn als barmherzigen, zuwendenden, reueannehmenden, mächtigen, gerechten und auch strafenden Gott bezeichnen. Die multivalenten Namen und Attribute belegen die vielfältigen Zugänge zu einem einzigen Gott, der größer als alles ist, was ein Mensch denken und sich vorstellen kann. Allah ist das arabische Wort für Gott, das auch von Anhängern anderer monotheistischen Religionen im arabischen Raum verwendet wird. Die Wahrnehmungen und die Wege zu Gott sind unterschiedlich, sie bereichern und ergänzen sich gegenseitig, können aber auch zu Abgrenzungen führen. Diese Realität ist zu akzeptieren und zu respektieren, sollte aber keine Grundlage dafür sein, einen ausschließenden Anspruch zu erheben. Der Qur’an lädt in Sure 3 Vers 64 ein, sich an dem einen Gott festzuhalten und Ihn als die verbindende Kraft anzuerkennen: Sprich: »Volk der Schrift, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch, dass wir Gott allein dienen und nichts neben Ihn stellen.«
Hamideh Mohagheghi, islamische Theologin



Eine jüdische Stimme: Unsere Väter in der Bibel, Abraham, Isaak und Jakob haben ihre eigene persönliche G’tteserfahrung. Jeder von ihnen haderte mit Gott in einer bestimmten Weise. Es stellt sich jedoch die Frage: Wer ist G’tt?
Hermann Cohen (1842–1918), der große jüdische Philosoph, meinte, dass G’tt kein Mensch sein kann, der jüdische G’tt ist der G’tt der Geschichte. Je mehr wir in die Tiefe gehen, desto mehr sollten wir überzeugt sein, dass wir gar nicht versuchen sollten, das Göttliche zu verstehen. Wir lesen in Exodus 33,20: »Und Er sprach: Du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen; denn kein Mensch kann mich sehen, so lange er lebt.«
Maimonides’ (12. Jh.) Lehre zum G’ttesverständnis ist die Theologie der Negation: Der Mensch kann nicht sagen, was G’tt ist, sondern nur, was G’tt nicht ist!

Der Torakommentator Joschua Leibowitz (20. Jh.) sagte in einem Gespräch mit G’tt: »Der Glaube besteht nicht darin, was ich von G’tt weiß, sondern darin, was ich über meine Pflichten gegenüber G’tt weiß.«
Vielleicht lässt sich sagen, dass das Wesentliche und Entscheidende der Frömmigkeit im Judentum das Tun des Menschen ist, die Erfüllung des G’ttesgebotes, des Pflichtbewusstseins.
Gábor Lengyel, Rabbiner
1. Die drei Beiträge stammen aus einem Magazin zu »Gott im Spiegel der Religionen«. Erarbeiten Sie deren jeweilige Sicht.
2. Vergleichen Sie, wie jeweils mit der gestellten Frage umgegangen wird und diskutieren Sie darüber. Finden Sie für jede der drei Antworten eine Überschrift.
3 Könnte Gott, wenn er nicht erfassbar ist, auch nicht derselbe oder der gleiche sein? Philosophieren Sie.
4. Beziehen Sie die Kalligrafie (oben) auf die Überlegungen dieser Seite.
Mouhanad Khorchide* und Klaus von Stosch* im Gespräch mit der Journalistin Christiane Florin über ihre gemeinsamen Forschungen zu Jesus im Koran.
Khorchide: Jesus wird im Koran gewürdigt als Gesandter, als Prophet. In unserer Forschung sind wir auch darauf gekommen, dass Jesus nicht nur einfach erwähnt wird im Koran, sondern er gibt sogar Christen Anlass, nach der Christologie, nach Jesus Christus auch im Koran zu suchen.
Florin: Überraschend fand ich zum Beispiel, dass die Geburtswehen so ausführlich geschildert werden. Die kommen in der Bibel so nicht vor.
von Stosch: Das ist sehr spannend, weil es in der christlichen Tradition deswegen nicht vorkommt, weil Maria hier in einer immerwährenden Jungfräulichkeit gedacht wird, sodass sie eben auch bei der Geburt keine Wehen haben darf. Da ist uns die koranische Version heute, die eben Maria mit Wehen denkt, ja viel näher, weil sie uns die Menschlichkeit Mariens nahebringt.
Florin: Jesus wird im Koran als Gottesknecht bezeichnet. Ist das etwas Positives?
Khorchide: Definitiv. Das ist etwas sehr Positives. Es ist auch ein christlicher Hoheitstitel eigentlich. Interessanterweise ist Jesus die einzige Figur, die einzige Person im Koran, die sich selbst im Koran – laut dem Koran – als Gottesknecht bezeichnet. Hier sieht man, dass der Koran keineswegs auf Ab- und Ausgrenzung
1. Sammeln Sie anhand des Interviewausschnitts und ihres Vorwissens [9] Anregungen und Fragestellungen für ein interreligiöses Gespräch über Jesus.
2. Vergleichen Sie das Interview mit den Überlegungen auf S. 64.
3. Lesen Sie eine Übersetzung von Sure 19,16–30, deuten Sie die Miniatur und stellen Sie Bezüge zum Interview her.
hinaus ist, sondern im Gegenteil, er liefert gerade die Grundlage für den Dialog. Er würdigt Jesus und verwendet dafür christliche Hoheitstitel. Interessant auch, dass der Koran Jesus nicht mit Mohammed vergleicht oder mit anderen Personen, sondern mit sich selbst, also mit der Offenbarung Gottes. Beide, der Koran und Jesus werden als Wort Gottes, als Geist Gottes, als Barmherzigkeit Gottes für die Welt bezeichnet. Hier gibt uns auch der Koran Anlass – zum Teil, ja, zugegeben, irritierend für uns Muslime –, zumindest zu hinterfragen: Will der Koran uns hier sagen, dass Gott sich nicht nur im Koran offenbart hat, sondern auch auf verschiedenste Art und Weise, womöglich auch in Jesus, ohne jetzt Jesus zu vergöttlichen? Eine Vergöttlichung lehnt ja der Koran klar ab.
Florin: Wie groß ist das Interesse in der muslimischen Community an dem Thema »Jesus im Koran«, auch an dieser Auslegung, die Sie hier präsentieren?
Maria mit dem Kind, Miniatur (1650). Der für muslimische Darstellungen typische Flammennimbus hebt Jesu besondere Beziehung zu Gott hervor.
Khorchide: Für die Muslime ist es klar, dass Jesus sehr stark gewürdigt ist im Koran. Das ist erst einmal nichts Neues. Neu ist allerdings diese Lesart, die historischkritische Untersuchung, die wir gemacht haben, die zeigt, dass der Koran keineswegs eine Apologetik gegenüber dem Christentum herstellt, wie in vielen exegetischen Werken leider nachzulesen ist, sondern im Gegenteil: Der Koran lädt hier ein und bietet auch eine steile Grundlage für einen vertieften Dialog, für einen islamisch-christlichen Dialog, wo es auch um solche Fragen geht. Natur Jesu, die Offenbarung Gottes im Koran, die Offenbarung Gottes in Jesus und vieles mehr. Ich erhoffe mir, dass wir Muslime auch den Koran durch diese Brille lesen, eine Brille, die einladen will zum Dialog und keineswegs sich ab- und ausgrenzen will.


Rhein-Main-Airport: Muslime, Juden und Christen feiern. Kraftvoll bläst Rabbiner Andrew Steinman in den Schofar, das gedrehte Widderhorn, und eröffnet so den jüdischen Teil der »Abrahamischen Feier« im Frankfurter Flughafen. Durch Mark und Bein geht der biblische Tempelruf und macht die rund hundert Gäste hellhörig. Üblicherweise erklingt er zum jüdischen Neujahrstag oder Versöhnungsfest – doch »Versöhnung« ist ja ein passendes Stichwort für diese Feier, die im Jahr 2001 nach dem tragischen 11. September von der Flughafenpfarrerin Ulrike Johanns angeregt wurde, weil »die Atmosphäre am Flughafen deutlich abkühlte und Religion plötzlich zum Risikothema wurde«. Johanns fragte den Frankfurter Rabbiner und den Mannheimer Imam, ob sie mit ihr und dem katholischen Kollegen am »Tor zur Welt« ein Zeichen setzen wollten. Die Männer sagten zu. Seit neun Jahren gibt es nun diese Abrahamische Feier, Motto: »Frieden, Shalom, Salam«. Sylvia Meise
ABRAHAM ALS ANKNÜPFUNGSPUNKT
• Die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam werden seit etwa 1950 als die drei abrahamitischen Religionen bezeichnet, weil alle drei sich auf je ihre Art auf Abraham als ihren Ahnen beziehen.


• Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts rückte Abraham auch als populäre Leitfigur für ein friedliches »abrahamitisches« Miteinander der Religionen immer mehr in den Mittelpunkt.

• Heute wird der Begriff z. T. auch kritisch gesehen, da er theologische Unterschiede verwischt und auch historisch nicht begründbar ist.
1. Abrahamitische Religionen, abrahamitische Feier … – arbeiten Sie aus den Materialien dieser Seite Absichten und Hoffnungen heraus, die mit diesen Begriffen und Aktivitäten verbunden sind.
2. Deuten und bewerten Sie das Coverbild (oben). Achten Sie z. B. darauf, wie hier die drei Religionen »sichtbar« gemacht werden und welcher Eindruck Kindern dadurch vermittelt wird.
• Die Geschichte Abrahams wird im Judentum als dauerndes Auf und Ab gedeutet. Die Bindung Isaaks (vgl. Gen 22) wird als dessen größte Prüfung verstanden: Abraham bleibt auch in dieser schlimmen Situation voller Gottvertrauen und überwindet so das Leid. Im Lebensweg Abrahams erkennen Jüdinnen und Juden sich selbst, ihr Volk und ihren oft leidvollen Weg durch die Geschichte.
• Auch im Christentum gilt Abraham als Vorbild im Glauben, jedoch aus anderen Gründen: Er folgt ohne jede Sicherheit dem Ruf Gottes, aus seiner Heimat aufzubrechen (vgl. Gen 12, Hebr 11,8). Weil sich die ersten Gemeinden bis etwa 100 n. Chr. als Teil des Judentums verstehen, sehen sie auch sich selbst unter dem Bund Gottes mit Abraham. Später freilich wurde daraus der Anspruch, alleinige Erben Abrahams zu sein.
• Im Islam wird Abraham als Gottgläubiger dargestellt, der weder Jude noch Christ (Sure 3,68), sondern ein »Hanif*« ist, also wie Mohammed ein Anhänger des unverfälschten monotheistischen Glaubens (vgl. Sure 2,135; 16,120 und Sure 3,19). Abraham gilt als der erste wahre Muslim und der Islam, den der Prophet Mohammed verkündet, entspricht der Ur-Religion Abrahams.
• Jede der drei Religionen verbindet also mit Abraham etwas je Eigenes und identifiziert sich mit Abraham traditionell auf eine Weise, die die Angehörigen der anderen Religionen letztlich ausschließt.
GEMEINSAMER BEZUGSPUNKT?
Die Bezugnahme der drei großen religiösen Traditionen auf Abraham ist offensichtlich so unterschiedlich, dass die Behauptung einer grundlegenden Gemeinsamkeit entweder nur Hülle ohne Inhalt ist oder aber im Namen einer gemeinsamen Symbolfigur einer eigenen, neuen Konstruktion jenseits dessen bedarf, was in der jeweiligen Glaubensgesellschaft in Geltung steht.
Friedmann Eißler, Islambeauftragter der württembergischen Landeskirche

Meine These ist, dass historisch-literarisch der in der Bibel und dem Koran vorgestellte Abraham nicht als Urgestalt der Ökumene zwischen Juden, Christen und Muslimen genannt werden kann.
Dennoch kann »Abraham« als Metapher oder Symbol in transformierter und abstrahierter Gestalt einen gemeinsamen Weg von Juden, Christen und Muslimen zu einem friedlichen Miteinander und zum Frieden in der Welt andeuten und eröffnen.
Hubert Frankemölle, Gründer der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
1. Recherchieren Sie politische und religiöse Konflikte rund um das Grab Abrahams und deuten Sie die Gestaltung des Fotos (links) auch unter dem Aspekt »Zwischenraum«.
2. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über die verschiedenen Zugänge zu Abraham, indem Sie die in der Info genannten Bibel- und Koranstellen nachlesen.
3. Formulieren Sie ausgehend von den Positionen F. Eißlers und H. Frankemölles eine Stellungnahme zu Dialogbemühungen im Namen Abrahams. Beziehen Sie ggf. andere Stimmen (z. B. aus einer Recherche zu »abrahamitische Religionen«) ein.
4. Entwerfen Sie vor dem Hintergrund dieser Seite eine alternative Idee zum Cover S. 66.
5. Überlegen Sie sich einen ansprechenden Titel, mit dem Sie zu einer interreligiösen Feier einladen wollen, und diskutieren Sie, ob Abraham darin vorkommen soll oder nicht.

VOM DIALOG ZUM TRIALOG?
Bundestagspräsident Norbert Lammert zum 50. Jahrestag des jüdisch-christlichen Dialogs 2011
Friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern, Nationen und Kulturen wird es nicht geben ohne Verständnis, Verständigung und Toleranz zwischen den Religionen. Fast ein Drittel der Menschheit sind Christen oder Muslime. Beide Religionen sind mit dem Judentum von ihren eigenen Quellen her stärker verbunden, als es im Selbstverständnis der Gläubigen wie in der Selbstdarstellung ihrer Religionen oft erkennbar ist. Ein Trialog ist offensichtlich nötig – aber ist er auch möglich? Wer einen Trialog der monotheistischen Weltreligionen ernsthaft will, muss wissen, worauf er sich einlässt:
1. Der jüdisch-christlich-muslimische Trialog muss mehr sein als die Freude an Vielfalt, oft verbunden mit dem fröhlichen Missverständnis, alles ist möglich, alles ist gleich, alles ist gleich gültig oder gleichgültig.
2. Der Blick auf das Gemeinsame darf die Sicht auf Unterschiede nicht trüben. Trialog ist keine Bagatellisierung der Wahrheitsfrage. »Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer Gemeinde gemacht, einer einzigen. Aber er wollte euch in dem prüfen, was er euch gegeben hat. So wetteifert um die guten Dinge« (Sure 5,48).
3. Es gibt keinen Dialog zwischen Religionen, schon gar keinen Trialog. Dialoge gibt es nur zwischen Menschen, sie müssen zum Dialog bereit und in der Lage sein. Sie müssen die Eigenständigkeit des jeweils Anderen wahren. Überfällig ist ein Erlernen trialogischer Kompetenz durch das jeweilige Füh-
rungspersonal. Es gibt ein Zitat des bedeutenden islamischen Mystikers Rumi: »Draußen hinter den Ideen vom rechten und falschen Tun liegt ein Acker. Wir treffen uns dort. Das ist die ganze Aufgabe. Aber um sie zu erledigen, bedarf es zweier Voraussetzungen. Erstens muss man sich treffen wollen und zweitens, muss man den Acker tatsächlich bearbeiten.« Man muss sich treffen. Man muss tatsächlich arbeiten. Und vor allem: Man muss es wollen.
1. »Ein Trialog ist offensichtlich nötig …«: Sammeln Sie (auch vor dem Hintergrund dieses Kapitels) Gründe für sog. trialogische Bemühungen.
2. Arbeiten Sie mithilfe dieser Seite Herausforderungen für Trialoge heraus. Deuten Sie in diesem Zusammenhang die Karikatur (oben rechts).

3. Ist die Ringparabel ( S. 51) ein gelungener Trialog? – Diskutieren Sie.
DER SOGENANNTE TRIALOG
• Nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht ein jüdischchristlicher Dialog, der vor allem als Aufgabe der christlichen Kirchen verstanden wird. Hier geht es (zunächst zögerlich) um die historische Aufarbeitung der Schuld der Kirchen im Zusammenhang mit der Schoa [9] und um die Absage an eine Judenmission. Dieses asymmetrische Gesprächsverhältnis wandelt sich im Laufe der Zeit, sodass heutige Initiativen stärker theologische Berührungspunkte suchen, an einer inhaltlichen Auseinandersetzung darüber interessiert sind und/oder Begegnungen zwischen Juden und Christen ermöglichen.
• Mit der Einsicht, dass hierbei auch Muslime einbezogen werden sollten, erwuchsen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aller drei Religionen. Diese werden wortspielerisch bisweilen Trialog genannt, um den Charakter eines Dreiergesprächs prägnant hervorzuheben.
Plakat des Kulturprojekts »respect-us« aus München. In dem Konzert »Music for the one God« wird sakrale Musik aus Judentum, Christentum und Islam aufgeführt.

ÜBER DAS KUNSTPROJEKT TRIMUM – MUSIK FÜR
JUDEN, CHRISTEN UND MUSLIME

Es läge nahe, einem Projekt wie diesem eine unmittelbar »grenzüberschreitende« und »friedensstiftende« Bedeutung zuzuschreiben. Gerne wird der Musik eine entsprechende, quasi naturgegebene Mittlerfunktion attestiert. Doch im Kontext von Interreligiosität sind solche einfachen Zuschreibungen unangebracht. Eine Koranrezitation, ein gesungenes Kaddisch-Gebet und ein protestantisches Kirchenlied mögen durchaus nach außen hin Ähnlichkeiten aufweisen. Doch die theologischen Deutungen dessen, was im Moment des Singens geschieht, die Vorstellungen davon, worin dies Singen begründet ist und was es »bedeutet«, liegen weit auseinander: Wenn es um die drei monotheistischen Religionen geht, dann trennt Musik mehr, als dass sie verbindet. In unseren Veranstaltungen, Neukompositionen und Liedern sollen diese Unterschiede nicht verwischt, sondern offensiv thematisiert und künstlerisch gestaltet werden. Die wichtigste und anspruchsvollste Aufgabe wird deshalb darin bestehen, den »Zwischenräumen«, dem Verbindenden und dem Trennenden der drei Religionen eine adäquate musikalische Form zu geben. Unser ehrgeiziges Ziel: Eine »neue Musik des Trialogs« zu kreieren.
Bernhard König, Komponist und Konzertpädagoge
TRIALOGISCHE PROJEKTE?
1. Analysieren Sie, wie die Projekte dieser Seite jeweils »Trialog« verstehen und umsetzen.
2. Recherchieren Sie weitere Projekte zum Trialog und stellen Sie diese in Ihrer Lerngruppe vor.
3. Beziehen Sie die auf S. 68 (Aufgabe 2) erarbeiteten Herausforderungen auf die Praxisbeispiele dieser Seite.
Die Erich Kästner Schule Baunatal berichtet über geplante Aktivitäten zum Trialog-Schulprojekt »Wurzeln erinnern – Zukunft gestalten. Sprachen, Kulturen, Religionen in Deutschland«.
Die Herbert-Quandt-Stiftung möchte mit dem Wettbewerb die Verständigung zwischen den Religionen Judentum, Christentum und Islam fördern. Um diesem Ziel nachzukommen, möchte die Projektgruppe die ganze Schulgemeinde in den Wettbewerb einbeziehen. Im Religions- und Ethikunterricht interviewen die Neunt-Klässler ihre Eltern und Großeltern sowie Experten aus den verschiedenen Religionen. Eine Gruppe dieses Jahrgangs vertieft ihr Wissen über die Festkultur in den einzelnen Religionen und präsentiert dies in der Pausenhalle der Schule. Der Kurs »Darstellendes Spiel« entwickelt Spielszenen zur Ringparabel Lessings*. Im Kurs »Räumliches Darstellen« erkunden die Schüler Merkmale von Synagogen, Kirchen und Moscheen. Die jüngeren Schüler suchen nach Ritualen und Gebeten der drei abrahamitischen Religionen. Im Kunstunterricht gestalten die EKS-Schüler Symbole der Religionen. Das Ergebnis, ein Mosaik der Religionen, soll den Boden eines Klas senraumes schmü cken. 33 Schülerin nen und Schüler gestalten zum Holo caust-Gedenktag im Januar 2014 einen Gottesdienst und bre chen im Frühjahr zu einer Studienfahrt nach Auschwitz auf.
Unterrichtshilfen wie diese wollen zu sog. trialogischem Lernen anregen.

Es gibt so etwas wie eine »Leitkultur für Deutschland«. Manche stoßen sich schon an dem Begriff der »Leitkultur«. Das hat zu tun mit einer Debatte vor vielen Jahren. Man kann das auch anders formulieren. Zum Beispiel so: Über Sprache, Verfassung und Achtung der Gr undrechte hinaus gibt es etwas, was uns im Innersten zusammenhält, was uns ausmacht und was uns von anderen unterscheidet.
Ich finde den Begriff »Leitkultur« gut und möchte an ihm festhalten. Denn er hat zwei Wortbestandteile. Zunächst das Wort Kultur. Das zeigt, worum es geht, nämlich nicht um Rechtsregeln, sondern ungeschriebene Regeln unseres Zusammenlebens. Und das Wort »leiten« ist etwas anderes als vorschreiben oder verpflichten. Vielmehr geht es um das, was uns leitet, was uns wichtig ist, was Richtschnur ist. Eine solche Richtschnur des Zusammenlebens in Deutschland, das ist das, was ich unter Leitkultur fasse. [...]
Umgekehrt ist auch richtig: Andere Länder, andere Sitten. Wenn eine Lebensgewohnheit im Ausland anders ist, ist sie eben anders als in Deutschland, nicht besser oder schlechter. Es ist die Mischung, die ein Land einzigartig macht und die letztlich als Kultur bezeichnet werden kann. [...]
1. Wir legen Wert auf einige soziale Gewohnheiten, nicht weil sie Inhalt, sondern weil sie Ausdruck ei-
ner bestimmten Haltung sind: Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Bei Demonstrationen haben wir ein Vermummungsverbot. »Gesicht zeigen« – das ist Ausdruck unseres demokratischen Miteinanders. Im Alltag ist es für uns von Bedeutung, ob wir bei unseren Gesprächspartnern in ein freundliches oder ein trauriges Gesicht blicken. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka. [...]
6. In unserem Land ist Religion Kitt und nicht Keil der Gesellschaft. Dafür stehen in unserem Land die Kirchen mit ihrem unermüdlichen Einsatz für die Gesellschaft. Sie stehen für diesen Kitt – sie verbinden Menschen, nicht nur im Glauben, sondern auch im täglichen Leben, in Kitas und Schulen, in Altenheimen und aktiver Gemeindearbeit. Ein solcher Kitt für unsere Gesellschaft entsteht in der christlichen Kirche, in der Synagoge und in der Moschee. [...] Unser Staat ist weltanschaulich neutral, aber den Kirchen und Religionsgemeinschaften freundlich zugewandt. Kirchliche Feiertage prägen den Rhythmus unserer Jahre. Kirchtürme prägen unsere Landschaft. Unser L and ist christlich geprägt. Wir leben im religiösen Frieden. Und die Grundlage dafür ist der unbedingte Vorrang des Rechts über alle religiösen Regeln im staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenleben.
Thomas de Maizière, ehem. Bundesinnenminister, 2017
Erarbeiten Sie die Position von Th. de Maizière zum Thema »Leitkultur« ( S. 70) und diskutieren Sie diese vor dem Hintergrund des Kapitels sowie der Karikatur von Thomas Plaßmann ( S. 70). Formulieren Sie eine eigene Stellungnahme zum Thema.
»In unserem Lande ist Religion nicht Keil, sondern Kitt der Gesellschaft.« Erläutern Sie diese Aussage mithilfe von Beispielen und problematisieren Sie das dahinterstehende Verständnis von Religion vor dem Hintergrund dessen, was Sie in der 10. Jgst. zur Funktion von Religion gelernt haben.
Gehen Sie mit offenen Augen durch Ihr Schulgebäude und suchen Sie Spuren von Toleranz in Architektur, Gestaltung und Ausstattung, in den schulischen Angeboten, in der Schulkultur oder bei den Menschen, die das Schulhaus nutzen. Verfassen Sie einen Beitrag für die Schulhomepage zum Thema Toleranz, der die Ergebnisse aufnimmt, beschreibt und gegebenenfalls Vorschläge zu einer Weiterentwicklung dieses Themas an Ihrer Schule macht.

Überlegen Sie sich Situationen in Ihrem alltäglichen Leben, in denen Ihnen die Erkenntnisse aus diesem Kapitel konkret helfen können und tauschen Sie sich darüber aus.
Was haben Sie dazugelernt (vgl. S. 49)?
Was möchten Sie sich merken?
Welche Methoden bzw. Materialien haben Sie besonders angesprochen?
Was wird Sie weiter beschäftigen?
Welche Fragen bleiben offen?
Suchen Sie nach Aktionen und Angeboten an Ihrem Wohnort oder z. B. in der nächsten größeren Stadt zum Thema interreligiöser Dialog, Begegnung der Religionen, Fest der Kulturen und Ähnlichem. Versuchen Sie etwas über die Motive der Beteiligten in Erfahrung zu bringen, sich in dieser Weise zu engagieren.
Beobachten Sie für einige Tage die Nachrichten in den Medien. Sammeln Sie Meldungen über Themen, die weltanschauliche und/oder religiöse Felder berühren bzw. die als weltanschauliche bzw. religiöse Themen gedeutet werden. Versuchen Sie die Meldungen für sich zu ordnen und überprüfen Sie die Zuordnung der Themen zu den Bereichen Religion, Weltanschauung bzw. Kultur.
Hat die Bibel recht?
Glauben Christen an die Bibel?
Warum ist das Alte Testament dicker?
Sind Texte von heute weniger heilig?
Warum ist die Bibel für Protestanten so wichtig?
Ist die Bibel interessant?
Verstehen Theologen die Bibel besser?
Lernbereiche: »Sola scriptura!? – Zugänge zur Bibel«, »Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, Christentum, Islam«
Im Religionsunterricht haben Sie sich immer wieder mit biblischen Texten beschäftigt. In diesem Kapitel geht es nun um die Bedeutung der Bibel als ganzer und um mögliche Zugänge, beispielhaft erarbeitet am Buch Hiob. Sie lernen wichtige Aspekte eines evangelischen Schriftverständnisses kennen, beschreiben Ziele und methodische Schritte der historisch-kritischen Auslegung der Bibel sowie Kernanliegen weiterer Lesarten der Bibel.
Sie deuten Texte aus dem Buch Hiob aus unterschiedlichen Perspektiven und vergleichen ihre theologischen Aussagen. Sie nehmen die vielfältige Wirkungsgeschichte dieser biblischen Schrift wahr und deuten einzelne Beispiele aus Kunst, Literatur und Film. Sie vergleichen das christliche Schriftverständnis mit dem der jüdischen und islamischen Religion und grenzen es von fundamentalistischen Lesarten ab.
Sie machen sich Ihre eigenen Einstellungen zur Bibel bewusst und prüfen Reichweite und Grenzen unterschiedlicher Methoden der Textauslegung. Ausgehend von einem evangelischen Schriftverständnis setzen Sie sich kritisch mit einem fundamentalistischen Umgang mit der Bibel auseinander.
Sie tauschen sich über die im Hiobbuch aufgeworfenen Fragen aus und kommen ins Gespräch über Chancen und Grenzen unterschiedlicher Arten der Auslegung biblischer Texte. Sie erproben eigene Auslegungen und verwenden dabei auch kreative und spielerische Methoden.
DER BIBEL AUF DER SPUR
Worte, Erzählungen, Figuren und Symbole aus der Bibel begegnen einem nicht nur in religiösen und kulturellen Zusammenhängen, sondern auch in Politik und Gesellschaft. Begeben Sie sich auf Entdeckungstour und dokumentieren Sie Beispiele für solche biblischen Spuren. Um Ihre Funde übersichtlich zu präsentieren, können Sie z. B. eine digitale Pinnwand erstellen oder selbst eine passende Form der Präsentation wählen. Deuten und bewerten Sie die Beispiele und stellen Sie Vermutungen an, warum jeweils biblische Motive verwendet wurden.
Der Dichter Gotthold Ephraim Lessing* (1729–1781) sieht eine unüberbrückbare Kluft zwischen den geschichtlichen Zeugnissen der Bibel und einem vernünftigen, aufgeklärten Glauben:
»Das, das ist der garstig breite Graben, über den ich nicht kommen kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe. Kann mir jemand hinüber helfen, der tue es; ich bitte ihn, ich beschwöre ihn.«

Der Schreiber »gestaltet mit der Schrift eine Art Leiter zwischen Mensch und Gott und dabei weiß er, dass es eben gerade nicht die Stufen dieser Leiter sind, die das Auf und Ab bestimmen und ermöglichen. Es sind die Abstände zwischen diesen Stufen, die den Weg bestimmen, ihm gleichsam im Schweigen eine Stimme geben. Im Bild der Leiter Jakobs ist das Verhältnis zwischen dem konkreten Text und der religiösen Erfahrung zu verstehen. Die Leerstellen zwischen den Stufen müssen entdeckt werden. In der Sprache einer alten jüdischen Redeweise: ›Die Tora* wurde geschrieben, schwarzes Feuer auf weißes Feuer‹. Das schwarze Feuer sind die Buchstaben der Tora, die es uns ermöglichen, sie zu lesen; sie sind aber zugleich nur Rahmen für die sie ausfüllenden Zwischenräume.«
Eveline Goodman Thau, Rabbinerin, Professorin für jüdische Religionsgeschichte

Die olympischen Götter gelten nicht eben als sonderlich seriös. Betrügen, berauben und überlisten sie doch die Sterblichen wie ihre unsterblichen Mitgötter in einem Übermaß, das verlässliches Hören, Sehen und Verstehen vergehen macht. Unseriöser aber ist unter ihnen keiner als ausgerechnet der Gott, dessen Aufgabe es ist, gesicherte Informationsübermittlung und verständigen Umgang miteinander zu gewährleisten: Hermes*. Keine Schandtat, die ihm nicht zuzutrauen wäre. Was nicht ausschließt, ihn als Genie des Betrugs und der systematischen Desinformation auch zu bewundern. Hermes vereint Kompetenzen, die offenbar voraussetzen, dass das eine immer auch s andere seiner selbst sein kann: dass Tausch und Diebstahl, Weissagung und Betrug, Glücksverheißung und sich einstellendes Unglück mehr miteinander gemein haben, als es der Schulweisheit träumt. chen Hörisch, Literaturwissenschaftler
Von Haus aus ist er der Gott der Händler und Dolmetscher, ein go-between und trickster, dem man zutraut, dass er seine Vermittlerrolle und Sonderkompetenz auch für listige Täuschungsmanöver missbraucht. eida Assmann, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin
• Hermeneutik, abgeleitet vom Gott Hermes*, bezeichnet die Kunst des Auslegens, Übersetzens und Verstehens. Zunächst war sie v. a. auf die Auslegung klassischer und »heiliger« Texte bezogen. In der Moderne wurde daraus allgemeiner das Nachdenken über das Verstehen literarischer Texte sowie z. B. auch von Rechtsvorschriften. Der »hermeneutische Zirkel« (oder vielleicht besser: die hermeneutische Spirale) beschreibt die Wechselwirkung zwischen Vorverständnis des/der Lesenden und verstehender Aneignung eines Textes.

• Ende des 20. Jahrhunderts lässt sich in den Geisteswissenschaften eine »antihermeneutische Wende« beobachten. Bevorzugt werden jetzt Lesarten, die darauf verzichten, Texten einen festen Sinn zu entnehmen. Stattdessen betonen sie die Eigenständigkeit und Fremdheit des Textes; sie verweisen auf seine Leerstellen und (unendlichen) Bezüge, die ein (vereinnahmendes) Verstehen unmöglich machen.
1. Erläutern Sie das Lessing-Zitat ( S. 74) vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse zum Zeitalter der Aufklärung* (vgl. S. 25–33).

2. Ein Experiment: Einige bekannte biblische Überlieferungen werden auf Zettel notiert (Stichpunkte genügen, z. B. Verlorener Sohn, Jeremia). Die Zettel werden nacheinander in die Mitte gelegt und jede/r stellt sich zu dem Text bzw. der Überlieferung in dem für ihn/sie passenden Abstand. Danach kann man sich austauschen: Wie groß oder klein sind die »Gräben«? Worin bestehen sie (z. B. unbekannt, schwierig, banal ...)?
3. »Verstehen« hat unterschiedliche Facetten. Stellen Sie sie dar, etwa indem Sie Sätze mit »Verstehen« formulieren und in verschiedenen »Tonarten« sprechen. Beziehen Sie Ihre Wahrnehmungen auf die Eigenschaften des Gottes Hermes.
Manchmal ist BeMERKen wichtiger als Verstehen.
• »Früher hat mir meine Mama aus der Kinderbibel vorgelesen; das habe ich geliebt.«
• »Die Bibel ist ein heiliges Buch; das heißt aber nicht, dass ich alles glaube, was drinsteht.«
• »Die Bibel ist doch nur ein Märchenbuch.«
• »Biblische Geschichten kenne ich durch den Religionsunterricht und den Kindergottesdienst – und durch Filme.«
• »Zum Glück benutzt unsere Religionslehrerin die Bibel nicht so oft.«
• »Ich treffe mich mit anderen Jugendlichen, um gemeinsam in der Bibel zu lesen.«
• »Früher habe ich die Bibel schon für wahr gehalten, inzwischen bin ich da kritischer.«
• »Selbst würde ich nie in der Bibel lesen. Aber für die Konfirmation habe ich lange nach einem Bibelspruch gesucht, der mir gefällt und der zu mir passt.«
Auf den folgenden Doppelseiten können Sie am Beispiel des Buches Hiob probieren, die Zwischenräume zwischen den Stufen zu füllen: mit eigenen Ideen und Deutungen sowie mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Lesarten und künstlerischen Deutungen.
Nichts auf der Welt ist uninteressant. Aber manches interessiert mich nicht. Vielleicht, weil es zu bekannt ist?
Oder zu unbekannt?
Zu schwierig?
Zu banal?
Zu eng?
Oder zu unbestimmt?
Weil kein Platz für mich bleibt?
Für schräge Gedanken, Widersprüche?
Inter-esse heißt dazwischen sein.
1. Ergänzen Sie die Zitate links durch eigene Statements. Ggf. können Sie auch eine kleine Umfrage in der Klasse hierzu machen.
2. Lesen Sie die Geschichte von Jakobs Traum (Gen 28), auf die sich das Zitat auf S. 75 bezieht, und informieren Sie sich über den größeren Erzählzusammenhang der Episode. Untersuchen Sie die Erzählung nach Motiven wie Zwischenraum / Abstand / Nähe / Ferne.
3. Die jüdische Theologin E. Goodman-Thau bezieht die »Jakobsleiter« auf das Verstehen biblischer Texte. Entschlüsseln Sie das Zitat ( S. 75 ). Vergleichen Sie ihre Sicht der Zwischenräume in Texten mit Lessings Rede vom »garstigen Graben«.
4. Überprüfen Sie die Gedanken zum »Inter-esse« (oben), indem Sie sie auf Themen, Dinge, Aktivitäten beziehen, für die Sie sich besonders oder für die Sie sich überhaupt nicht interessieren. Erinnern Sie sich auch, ob (und wodurch) einmal etwas zunächst Uninteressantes für Sie interessant wurde.
5. Religionslehrkräfte klagen manchmal über Desinteresse der Schülerinnen und Schüler an der Bibel. Sammeln Sie Vorschläge für einen Umgang mit biblischen Texten, der zu Jugendlichen passt.
Es war ein Mann
So beginnen Märchen. Wann, wo, wie? Ist das wirklich passiert?
Typisch, von einer Frau ist nicht die Rede.
im Lande Uz,
Das ist irgendwo weit im Osten, jedenfalls nicht in Israel. Ist es die Gegend, aus der Abraham kommt? Das wäre eine Anspielung auf die Ursprünge Israels.
der hieß Hiob.
Der Name bedeutet: Wo ist mein Vater? Es klingt aber auch das Wort »Feind« mit (Ojeb). Hiob ist auch im Islam bekannt. Er kommt noch zweimal in der Bibel vor. Heute heißen in Arabien manchmal Kamele nach ihm – wegen ihrer Geduld.
Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse.
Gleich viermal – der Verfasser kann Hiob gar nicht genug loben. Ein anständiger Mensch! Aber wäre er mir auch sympathisch?
Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde, und er war reicher als alle, die im Osten wohnten.
Unglaubliche Zahlen! Ein typischer reicher Nomadenscheich – stammt die Geschichte aus der Nomadenzeit? Er ist gut und ihm geht es gut – typisch für weisheitliches Denken. Das kann nicht gut gehen; irgendetwas passiert jetzt.
DAS HIOBBUCH
• Das Buch Hiob (auch: Ijob) gehört zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur*. Es besteht aus einer Prosa-Rahmenerzählung vom frommen Hiob, der trotz schwerster Schicksalsschläge an Gott festhält, und einem metrisch gestalteten dialogischen Mittelteil. Darin klagt Hiob über sein Leid und wird zunehmend zum Ankläger Gottes. Seine Freunde versuchen ihn vergeblich zurechtzuweisen. Schließlich ergreift Gott selbst das Wort.
• Die Rahmenerzählung des Hiobbuchs ist in märchenhaft-legendärer Form gestaltet und geht möglicherweise auf mündliche Vorformen zurück. Der kunstvolle Dialog und das gesamte Werk in seiner Endgestalt, das in seinem Aufbau an ein Theaterstück erinnert, dürfte nachexilischen* Ursprungs sein (5.–2. Jh. v. Chr.).
• Kaum ein anderes Buch der Bibel stellt so radikal die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leidens unschuldiger Menschen. Es wurde zur Inspirationsquelle für zahlreiche theologische, philosophische und künstlerische Deutungen und Bearbeitungen bis heute.
»Mit dem ersten Satz wird der Stein ins Rollen gebracht. Der erste Satz ist Versprechen, Duftmarke, Schlaglicht – kurz: der Brühwürfel, mit dem die ganze folgende Suppe gekocht wird. (Thomas Brussig, Schriftsteller)
1. Suchen Sie »erste Sätze« aus Büchern, Theaterstücken, Filmen, biblischen Schriften usw. und beziehen Sie sie auf T. Brussigs Zitat.
2. Auch Hi 1,1-3 ist so ein »Brühwürfel«: Das Bild der Leiter nimmt den Gedanken der »Abstände zwischen den Stufen« ( S. 75) auf. Füllen Sie sie mit eigenen Ideen und Fragen!
Hiob! Hast du wirklich nichts anderes gesagt als jene schönen Worte? Weißt du nicht mehr zu sagen, wagst du nicht mehr zu sagen, als was die beamteten Tröster wortkarg dem Einzelnen zumessen, was die beamteten Tröster, steifen Zeremonienmeistern gleich, dem Einzelnen vorschreiben, dass es nämlich in Stunden der Not ziemlich [angemessen] sei zu sprechen: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobet, nicht mehr und nicht weniger, ebenso wie man Prosit sagt zu dem Niesenden!
Søren Kierkegaard*,1843
Der Satz Hiobs ist gerade nicht als duldsame Einwilligung in das Leiden zu verstehen.
Denn kein blindes Schicksal traf Hiob, sondern Adonaj*, Gott selbst: »Niemand als Adonaj ist’s, der gegeben, niemand als Adonaj ist’s, der genommen hat, gesegnet sei der Name Adonaj.« Wer so spricht, ist kein Objekt eines bloß passiv hinzunehmenden Geschicks. Wer so redet, weiß, mit wem er es zu tun und von wem er sein Recht zu fordern hat. »Wenn nicht Gott, wer dann?« Fromm sein, heißt nicht allein Ja und Amen zu sagen. Es gibt auch ein Nein und Amen.

Jürgen Ebach, Theologe
Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s genommen; der Name des HERRN sei gelobt! In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott.
Hi 1,20 ff.
Die »Hiobsbotschaften« überschlagen sich: Hiob verliert seinen ganzen Besitz und seine Kinder. Hier eine Buchmalerei aus dem 11. Jh.
1. Lesen Sie Hi 1,13–22 und beschreiben Sie, mit welchen Stilmitteln Hiobs Unglück gestaltet wird.
2. Tauschen Sie Ihre Eindrücke über Hiobs Reaktion aus.
3. Hi 1,21b wird manchmal bei Beerdigungen gesprochen und in Todesanzeigen zitiert. Versuchen Sie nachzuvollziehen, welche Gedanken und Gefühle bei der Entscheidung für diesen Vers eine Rolle spielen könnten. Führen Sie ein Schreibgespräch zu dem Anzeigenmuster.
4. Vergleichen Sie S. Kierkegaards und J. Ebachs Interpretationen von Hi 1,21b. Probieren Sie dazu auch aus, in welchem Ton man die Sätze Hiobs sprechen könnte. Achten Sie auch auf seine Körpersprache in der Szene.
5. »Es gibt auch ein Nein und Amen« – finden Sie Beispiele.
Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt! (Hi 1,21)
Vorname – Nachname
*Geburtsdatum – Todesdatum
Trauernde
Der Trauergottesdienst findet statt am . . . Or t .
DIE SATANSSZENEN
Der »Prolog im Himmel« aus Johann Wolfgang von Goethes »Faust*« ist dem Hiobbuch nachempfunden. Mephisto wettet mit dem HERRN, dass er es schaffen werde, Faust, den unermüdlich Fragenden und Suchenden, von seinem Weg abzubringen. Hier sieht man die Szene in einer Comicfassung von Flix.

1. Erinnern Sie sich an typische Kasperltheaterszenen und beschreiben Sie die Funktion des Teufels* darin.
2. In Hi 1,21 sagt Hiob: »Der HERR [allein] hat�s gegeben, der HERR hat�s genommen.« – Was ändert sich, wenn ein Teufel* mit im Spiel ist? Spielen Sie es gedanklich – oder wenn Sie mögen, in kleinen Szenen mit Kasperlfiguren – durch.
3. Lesen Sie Hi 1,6–12 und 2,1–7; untersuchen Sie die Rolle des Satans* und vergleichen Sie sie mit den Bildern auf dieser Seite. Achten Sie genau auf den Gegenstand der Wette.

4. »Der Auftritt Satans* bringt Gott aus der Schusslinie.« – »Er macht alles noch viel schlimmer.« –Diskutieren Sie.
5. Tauschen Sie sich darüber aus, welche Bedeutung die Gestalt des Satans bzw. Teufels für Sie hat. Informieren Sie sich über seine Rolle in Bibel und Christentum. BeMERKung von Robert Musil*: Ich glaube nicht an den Teufel, aber wenn ich es täte, würde ich ihn mir als den Trainer vorstellen, der den Himmel zu Rekordleistungen hetzt.

• Die beiden Himmelsszenen Hi 1,6–12 und Hi 2,1–7 stehen im Buch Hiob isoliert da. Danach ist von Satan* nicht mehr die Rede. Manche Forscher halten diese Passagen daher für nachträglich eingefügt, womöglich unter Einfluss der persischen Zarathustra*-Religion, die durch einen ausgeprägten Dualismus (Widerstreit eines guten und eines bösen Prinzips) charakterisiert war. In der Bibel ist eher selten vom Satan (hebr: Widersacher) oder vom Teufel* (griech. diabolos: Durcheinanderwerfer) die Rede. Ein konsequenter Dualismus wäre mit biblischen Gottesvorstellungen, die Gut und Böse auf Gott zurückführen, nicht vereinbar.
• Im Hiobbuch erscheint Satan zusammen mit den »Gottessöhnen«; hier liegt die altorientalische Vorstellung einer himmlischen Ratsversammlung zugrunde. Diese ursprünglich polytheistische Vorstellung wird allerdings im Alten Testament so umgewandelt, dass Gott in dieser »Konferenz« fraglos das Sagen hat.
1. Vergleichen Sie die Personenkonstellationen auf den beiden Bildern. Deuten Sie die Unterschiede mithilfe von Hi 2,9 f. und dem apokryphen* Text (unten).
2. Erzählen Sie Hi 1 und 2 aus der Perspektive von Hiobs Frau.
3. Suchen Sie, ausgehend von der Info, weitere Beispiele für eine Abwertung oder ein Unsichtbarmachen von Frauen in der Bibel.
Hiob wird von Satan und seiner Frau gegeißelt (mittelalterliche Buchmalerei).


Der greise Hiob erzählt rückblickend:
»Und ich sah mit eigenen Augen, wie meine erste Frau Wasser in das Haus eines Reichen trug als Dienstmagd, bis sie Brot bekam und es mir brachte. Und betroffen sprach ich: ›Welche Unverschämtheit von den Herrn dieser Stadt! Wie können sie es wagen, meine Frau wie eine Sklavin zu behandeln?‹ Aber sie teilte, was sie bekam, mit mir und schämte sich nicht, auf den Markt zu gehen, und Brot von den Brotverkäufern zu erbetteln.«
[Sie selbst erzählt:] »Und ich bat um Brot. Aber der Händler sprach: ›Gib das Geld und nimm.‹ Da tat ich ihm unsere Not kund und bekam von ihm zu hören: ›Wenn du kein Geld hast, Frau, so gib dein Haar her und nimm dafür drei Brote. Gewiss werdet ihr drei Tage davon leben können.‹ Und in meiner Verzweiflung sprach ich: ›Steh auf und schere mich‹. Und so stand er auf und schor mit einer Schere mir zur Schande mein Haar auf dem Markt vor der gaffenden Menge.«
FRAU HIOB – SICHTBAR GEMACHT
• Hat Hiobs Frau nicht auch gelitten über den Tod ihrer Kinder? Wie so oft in der Bibel zählt nur die Perspektive des Mannes. Hiobs namenloser Frau bleibt lediglich der denkbar unvorteilhafte Satz: »Sage Gott ab und stirb!« (andere Übersetzungen: »Fluche Gott!«), auf den Hiob schroff entgegnet: »Du redest, wie die törichten Frauen reden.« (Hi 2,9 f.)
• Feministische Theologinnen ( S. 95) machen hingegen darauf aufmerksam, dass in Frau Hiobs Satz der hebräische Begriff für »Gott absagen, Gott fluchen« eigentlich derselbe ist wie »Gott segnen«. Zwar nehmen die meisten Auslegenden hier einen Euphemismus an – aber wie, wenn hier wirklich »segnen« gemeint wäre, etwa so: »Auch wenn ich es nicht verstehe, segne Gott, solange du es noch kannst; gib ihm die Ehre, die ihm zusteht, damit du in Frieden mit deinem Gott sterben kannst!« (M. Frettlöh).
• In diese Richtung weist auch ein Blick in außerkanonische* Schriften: Die Hiobübersetzung der Septuaginta* enthält eine anrührende Klage der Frau Hiobs. Und das apokryphe* Testament Hiobs lässt sie zur gleichberechtigt leidenden Partnerin werden.
Auftritt der Freunde:
Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort: Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. (Hi 2,11–13)
Hiob:
Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach: Ein Knabe kam zur Welt! Jener Tag sei Finsternis, und Gott droben frage nicht nach ihm! Jene Nacht – das Dunkel nehme sie hinweg! Ihre Sterne sollen finster sein!
Warum bin ich nicht gestorben im Mutterschoß? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Dann läge ich da und wäre still, dann schliefe ich und hätte Ruhe. Wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt, wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen - die auf den Tod warten, und er kommt nicht, und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen -, dem Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat? Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und wovor mir graute, hat mich getroffen.
(aus Hi 3)
Elifas:
Du hast’s vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden; aber Worte zurückhalten, wer kann’s? Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt; deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich, und nun es dich trifft, erschrickst du!
Bedenke doch: Wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen: Die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein.
Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist; darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet; er zerschlägt, und seine Hand heilt. (aus Hi 4 und 5)
Hiob:
Die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir; mein Geist muss ihr Gift trinken, und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Belehrt mich, so will ich schweigen, und worin ich geirrt habe, darin unterweist mich! Wie könnten redliche Worte betrüben? Aber euer Tadel, was tadelt er?
Mein Fleisch ist gekleidet in Maden und staubigen Schorf, meine Haut ist verschrumpft und voller Eiter. Meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Eine Wolke vergeht und fährt dahin: so kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten herunterfährt. Darum will auch ich meinem Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Bin ich denn das Meer oder der Drache, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Ich vergehe! Ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? (aus Hi 6 und 7)
Bildad:
Wie lange willst du so reden und sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt?
Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie ihrer Missetat preisgegeben. Wenn du aber dich zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wieder aufrichten deine Wohnung, wie es dir zusteht. (aus Hi 8)
Hiob:
Ja, ich weiß wohl, es ist so: Wie könnte ein Mensch recht behalten gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eins antworten.
Wenn ich auch recht habe, so kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Ich bin unschuldig! Ich möchte nicht mehr leben; ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich: Er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen.
(aus Hi 9)
Zophar:
Soll ohne Antwort bleiben, der viele Worte macht? Muss denn ein Schwätzer immer recht haben? Müssen Männer zu deinem leeren Gerede schweigen?
Meinst du, du kannst die Tiefen Gottes ergründen oder die Grenze des Allmächtigen erforschen?
Wenn er daherfährt und gefangen legt und Gericht hält – wer will’s ihm wehren?
(aus Hi 11)
Hiob: Ich habe solches oft gehört. Ihr seid allzumal leidige Tröster! Wollen die leeren Worte kein Ende haben? Oder was reizt dich, so zu reden? Auch ich könnte wohl reden wie ihr, wärt ihr an meiner Stelle. Auch ich könnte Worte gegen euch zusammenbringen und mein Haupt über euch schütteln.
(aus Hi 16)
Eliphas:

Kann denn ein Mann Gott etwas nützen? Meinst du, dem Allmächtigen gefalle, dass du gerecht bist? Was hilft’s ihm, selbst wenn deine Wege ohne Tadel sind?
Meinst du, er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen und mit dir ins Gericht gehen? Ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende?
So vertrage dich nun mit Gott und mache Frieden; daraus wird dir viel Gutes kommen.
(aus Hi 22)
DIE SPRACHE DER KLAGE
»[Im Buch Hiob] zwitschern und pfeifen die entsetzlichen Schlangen ihr ewiges: Warum?«
Heinrich Heine*
»Der erste Schritt der Überwindung des Leidens ist, eine Sprache zu finden, die aus dem unbegriffenen und stumm machenden Leiden herausführt, eine Sprache des Klagens, des Schreies, der Schmerzen, die wenigstens sagt, was ist.«
Dorothee Sölle*
»Wo findest du tiefere, kläglichere Worte von der Traurigkeit, als die Klagepsalmen sie haben? Und das allerbeste [ist], dass sie solche Worte gegen Gott und mit Gott reden; […]. Daher kommt es auch, dass ein jeder, in was für Sachen er auch ist, Psalmen und Worte darin findet, die sich auf seine Sachen reimen und ihm ebenso sind, als wären sie allein um seinetwillen so gesagt.«


Martin Luther
»Ist womöglich zu viel Gesang und zu wenig Geschrei in unserem Christentum? Zu viel Jubel und zu wenig Trauer, zu viel Zustimmung und zu wenig Vermissen, zu viel Trost und zu wenig Tröstungshunger? Steht die Kirche nicht zu sehr auf der Seite der Freunde Hiobs, der dem Glauben auch Rückfragen an Gott zugetraut hat?«
VON DER KLAGE ZUR THEODIZEE
• »Warum?« und »Wie lange?« – Immer wieder werden in den Klagepsalmen diese Grundfragen Gott entgegen geschrien. Der einzelne Mensch oder auch das ganze Volk klagen ihr Leid vor Gott und bitten um Hilfe. Typisch für die Klagepsalmen ist der plötzliche Umschwung von Klage zu Hoffnung. Vielleicht weist er historisch auf eine dazwischenliegende kultische Handlung hin. Was im Text bleibt, ist eine rätselhafte Lücke, eine winzige und doch unendlich lang scheinende Pause.
• Hiobs Klage ist in ihrem überbordenden Bilderreichtum im Stil dieser Psalmen gestaltet. Auf den »Umschwung« wartet man – zunächst – vergeblich.
• Im »Warum« liegt auch der Kern der sogenannten Theodizeefrage: Warum lässt ein allmächtiger und zugleich liebender Gott das Böse und das Leiden auf der Welt zu? Im Hiobbuch wird diese Frage so radikal gestellt wie sonst kaum jemals in der Bibel; sie wird zugespitzt auf die Frage: Warum lässt Gott den Gerechten so maßlos leiden?
BeMERKenswert: Hiob wird nicht zum Atheisten*.
1. Die Bilder gehen um die Welt: Blumen, Kerzen und Warum-Schilder an Orten von Unfällen oder Anschlägen. Recherchieren Sie solche Bilder und formulieren Sie die jeweilige Warum-Frage aus.
2. Untersuchen Sie die Reden Hiobs. Wenn Zeit ist, können Sie über die Zitate auf S. 82 f. hinaus auch weitere Passagen aus dem biblischen Buch heranziehen. Achten Sie besonders
• auf die Warum-Fragen,
• auf Sprachbilder und damit verbundene Emotionen,
• auf Anspielungen auf andere biblische Traditionen.
3. Fassen Sie zusammen, worin die Autorinnen und Autoren der Zitate (links) die Bedeutung des Klagens sehen, und überprüfen Sie die Aussagen anhand eigener Erfahrungen.
Johann Baptist Metz*
Frau Gassert, Sie werden als Notfallseelsorgerin an Unfallorte, zu Gewaltverbrechen und anderen Tragödien gerufen. Sie sind auch dabei, wenn Menschen schlimme Nachrichten überbracht werden – ich stelle es mir schwierig vor, in einer solchen Situation das »Richtige« zu sagen. Sandra Gassert: Das »Richtige« gibt es nicht. Nie. Ich denke, es gibt überhaupt nur wenige Worte, die Leid treffend wiedergeben – und die zu finden ist unendlich schwer. Gut ist es, einfach da zu sein. Mit Worten, einer Geste oder einer Berührung zu signalisieren: »Ich bin da. Ich helfe dir diesen Tag zu überstehen. Ich halte deinen Schmerz mit dir aus und helfe dir, Halt zu finden.« Wie das aussieht? Manches Mal bin ich der Manager der Krise, dann wieder weine ich mit, halte jemanden im Arm oder trinke mit den Betroffenen Tee – denn der wärmt und man kann sich an der Tasse festhalten. Und immer schweige ich ganz viel ... Denn: Worte zu finden, die wahr sind und nicht bloß platt oder banal, das ist eben schwer.
DER TUN-ERGEHENS-ZUSAMMENHANG
• »Wer anderen eine Grube gräbt ...«, fällt bekanntlich selbst hinein (Spr 26,27). Das ist die Logik weisheitlicher* Ethik im Alten Testament (z. B. im Buch der Sprüche). Es geht dabei nicht um Strafe oder Vergeltung, sondern schlicht um Erfahrungen, die man im Bereich der Großfamilie immer wieder machte: Das Verhalten des und der Einzelnen fällt – im Guten wie Schlechten – auf ihn/sie und seine/ihre Familie zurück. Solche Erfahrungen wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Als Lebensregeln halfen sie, die Welt als geordnet und verlässlich zu erleben und sich darin zu orientieren.
• Gott galt als »Schützer« dieser Ordnung, doch war er ihr nicht unterworfen. Der Tun-Ergehens-Zusammenhang war nicht unumstößlich, natürlich konnte es auch anders kommen – dies galt umso mehr, je mehr der oder die Einzelne sich nicht mehr in erster Linie als Teil der Großfamilie sah.
1. Was tröstet und was eher nicht? Sammeln Sie Redewendungen, Gesten, Verhaltensweisen aus dem Alltag.
2. Hiobs Klagen, mit denen Sie sich schon beschäftigt haben ( S. 84), werden unterbrochen durch Trostund Erklärungsversuche seiner Freunde. Lesen Sie Rede und Gegenrede im Wechsel ( S. 82 f., ggf. ergänzt durch weitere Texte aus dem Hiobbuch).
3. Arbeiten Sie Verhaltensweisen und Argumente der Freunde heraus; versuchen Sie das Anliegen der Freunde mit Hilfe der Info zu verstehen. Bewerten Sie ihre »Trostversuche« unter Gesichtspunkten der Krisenseelsorge (oben).
4. Vergleichen Sie, wie T. Lehnerer ( S. 83), E. v. Wächter ( S. 84) und W. Blake ( S. 85) jeweils das Verhältnis zwischen Hiob und seinen Freunden darstellen. Lassen Sie sich von T. Lehnerers Installation anregen, selbst Stühle so zu stellen bzw. umzustellen, wie es zum Verlauf des Dialogs zwischen Hiob und seinen Freunden passt.
• Am Hiobbuch lässt sich die Krise des Tun-Ergehens-Zusammenhangs ablesen. Während Hiob davon überzeugt ist, ungerechterweise zu leiden, beharren die Freunde auf der Stimmigkeit der Er fahrungsregeln.

Will Eisner begründete mit seiner Bildgeschichte »Ein Vertrag mit Gott« die Graphic Novel. Sie handelt von einem frommen Juden in den USA, der in seiner Jugend einen Vertrag mit Gott geschlossen und auf einem Steintäfelchen fixiert hat. Er hält sich
seither treu daran, doch als seine Tochter stirbt, kündigt er ihn in seiner Wut und Verzweiflung auf und wird zum skrupellosen Immobilienspekulanten. Am Ende findet ein Junge die Steintafel und trägt seinen Namen darunter ein.
1. Hiobs Klage wird zunehmend zur An-Klage. Belegen Sie dies anhand der Textausschnitte Hi 9,19–36; 16,18–22; 19,6–7.23–29; 31,35 ff.

2. Klären Sie die Rollen in dem von Hiob gewünschten Prozess. Achten Sie besonders auf die Rolle Gottes. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit dem von Goethe überlieferten lateinischen »Merke« (Niemand gegen Gott außer Gott selbst).
3. Gibt es überhaupt eine Rechtsgrundlage für einen Prozess gegen Gott? Wiederholen Sie, was Sie über den Bund Gottes mit Israel wissen.
4. Hat Satan seine Wette jetzt gewonnen? Erfinden Sie ein »Zwischenspiel im Himmel«.
5. Lassen Sie sich vom Comic und der Zeitungsnachricht anregen, den Gedanken eines Prozesses gegen Gott unter aktuellen Vorzeichen weiterzudenken: Ist ein solcher Prozess erlaubt und sinnvoll? Wie könnten Anklage, Verteidigung, Urteil lauten? Sie können z. B. Texte verfassen, Szenen spielen oder einen Film drehen.
Verbreitung von Tod, Zerstörung und Terror: Wegen dieser Vergehen hatte der Ex-Senator Ernie Chambers (Nebraska, USA) keinen Geringeren als Gott verklagt. Nun wurde das Verfahren abgeschmettert. Ein US-Gericht wies die Klage gegen Gott ab, weil der Beschuldigte keine Adresse habe, an die die Anklageschrift gesendet werden könne.
A us einer Zeitungsnachricht
Hier meine Unterschrift!
Der Allmächtige antworte mir!
Hi 31,35
Denn ich bin der HERR, der das Recht liebt.
Jes 61,8a
So sollst du nun wissen, dass der HERR, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten.
Dtn 7,9
Hebr. goel, Partizip zu gaal: loskaufen, auslösen, aus fremder Verfügungsgewalt befreien, den Rechtszustand wiederherstellen
Aber ich weis das mein Erlöser lebet / und er wird mich hernach aus der Erden auffwecken. Und werde darnach mit dieser meiner Haut umbgeben werden / und werde in meinem Fleisch Gott sehen. Den selben werde ich mir sehen / und meine augen werden jn schauen / und kein Fremder.
Martin Luther 1545
Aber ich weiß, mein Bluträcher ist am Leben und wird zu guter Letzt sich über dem Staube aufheben. Der Zeuge meiner Unschuld wird bei mir sein und meinen Schuldbefreier werde ich für mich sehen, mit eigenen Augen sehe ich’s und kein Fremder.
Ernst Bloch*
Doch nein, ich weiß, dass Gott, mein Anwalt, lebt! Er spricht das letzte Wort hier auf der Erde. Jetzt, wo die Haut in Fetzen an mir hängt und ich kein Fleisch mehr auf den Knochen habe, jetzt möchte ich ihn sehn mit meinen Augen, ihn selber will ich sehen und keinen Fremden!
Gute Nachricht
Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten. Und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen.
Ich werde ihn mit meinen Augen sehen, und er wird für mich kein Fremder sein.
BasisBibel

I know that my redeemer liveth, / and that he shall stand / at the latter day upon the earth. / And though worms destroy this body, / yet in my flesh shall I see God. / For now is Christ risen from the dead, / the first fruits of them that sleep.
(Hi 19,25 f. und 1 Kor 15,20)
AUF WEN WARTET HIOB?
1. Hi 19,25 ff. ist eine aus textkritischen ( vgl. S. 92) und inhaltlichen Gründen sehr umstrittene Passage. Kopieren Sie die Übersetzungsvorschläge und zeichnen Sie Verständnislücken und Leerstellen als »Zwischenräume« ein.
2. Wer ist der goel? Vergleichen Sie die Übersetzungen.
3. Lesen oder hören Sie die Sopranarie aus Händels »Messiah« (unten) und deuten Sie den Text mithilfe der Info.
HI 19,25 ff. IN CHR ISTLICHER DEUTUNG
Hi 19,25 ff. ist einer der im Christentum meistzitierten alttestamentlichen Texte, denn man sah darin eine Anspielung auf Jesus Christus und eine Voraussage seiner Auferstehung. Dieses Deutungsschema – das Alte Testament als Verheißung, das Neue als Erfüllung – prägte lange Zeit den christlichen Umgang mit der Hebräischen Bibel (v. a. auch mit den Prophetentexten). Es ist nicht nur historisch fragwürdig, sondern steht auch in Gefahr, die Hebräische Bibel christlich zu vereinnahmen. Eine Lesart, die die Eigenständigkeit beider Teile der Bibel bewahren kann, ist die intertextuelle ( S. 94): Sie geht davon aus, dass biblische Texte sich gegenseitig beleuchten können, ohne voneinander abhängig zu sein. Hi 19,25 ff. wäre dann keine Voraussage Christi, aber die Hiobdichtung könnte dennoch Jesu Passion verstehen helfen. Jesu »Warum« am Kreuz (Mk 14,34) bekommt einen widerständigeren Ton, wenn Hiobs Anklagen mitschwingen. Umgekehrt eröffnet die Botschaft vom »gekreuzigten Gott« [9] eine neue Perspektive auf Hiobs Prozessforderung (Gott gegen Gott!).
1. Gefragt werden, gefragt sein, ausgefragt werden –tauschen Sie sich über Erinnerungen und Gefühle aus.
2. Der biblische Gott als »Deus ex machina«? Lesen Sie die Gottesreden Hi 39–41 und prüfen Sie, inwieweit sie eine Lösung für Hiobs Klagen und Anklagen anbieten.
3. Vergleichen Sie die beiden Reaktionen Hiobs auf das Machtwort Gottes (Hi 40,3–5 und 42,2–6). Stellen Sie sie als Standbilder dar.
4 Es folgt – wieder im Stil der alten Prosaerzählung – das »Happy-End« (Hi 42,7–17), wie J. Schnorr von Carolsfeld es anschaulich illustriert hat. Lesen Sie den Text und führen Sie ein Schreibgespräch dazu.
5. Verfassen Sie einen Kommentar zum Schluss des Hiobbuchs z. B. aus der Sicht einer der Figuren der Dichtung (Hiobs Frau, ein Freund, Satan).
6. Vergleichen und diskutieren Sie die kontroversen Deutungen dieses Schlusses ( S. 89).
Und der HERR antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach:
Wer ist’s, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand?
Gürte deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, lehre mich!
Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir’s, wenn du so klug bist!
Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat?
Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt?
Hi 38,1–6
Der Verdacht liegt nahe, dass der Hiobdichter etwas von griechischen Tragödien wusste. Dafür spricht vor allem das Motiv des Deus ex machina, das zu den klassischen Bühnenkunstgriffen gehört. Jahwe ist freilich keine griechische Gottheit. Undenkbar, dass er, von dem man sich kein Bild machen darf, auf einer Theaterbühne erschiene. Aber im Konflikt um Hiobs Schuld oder Unschuld haben sich die Kontrahenten ausweglos festgezogen. Nur einer kann helfen, und plötzlich ist dieser eine da. Er macht keinen Theaterdonner, sondern echten, spricht nicht ex machina, sondern »aus dem Wetter«, also mit ähnlichem atmosphärischen Nachdruck wie einst, als er seine zehn Gebote auf dem Sinai aus Blitz und Donner hervorgehen ließ.
Christoph Türcke, Philosoph
Schließlich trat der Herr der Heerscharen noch persönlich auf und bewies, wie porträt-ähnlich Hiob ihn gezeichnet hatte. Der Allmächtige dachte gar nicht daran, sich zu rechtfertigen. Er wies nur auf sein mächtiges irdisches Empire hin und meinte, recht hochmütig: »Wo warest du, da ich die Erde gründete?« Als ob das ein Einwand gegen das Halten von Verträgen ist. Dann fragte er noch: »Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit?« Natürlich konnte Hiob das nicht. Und er bestand auch nicht die weitere ExamensFrage: »Kannst du mit gleicher Stimme donnern«?
Aber Hiob hielt es eben nicht für das Thema des Streits: Ob er genauso gut donnern kann? Die Frage war seiner Ansicht nach: Wer hat sich an die Abmachungen gehalten? Doch der Allmächtige, als habe er nie etwas vom Sinai gehört, erklärte kurz und bündig: »Es ist mein, was unter allen Himmeln ist.« Das Ende der Geschichte ist voll von ungetrübtem, unproblematischem Glück, nur ist es nicht ein Ende, das zur vorangehenden Geschichte passt. Hiob ist nicht mehr Hiob.
Ludwig Marcuse, PhilosophGott gibt Hiob Recht gegen die Freunde, die die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, um an der heilen Welt und einem sie garantierenden Gott festhalten zu können. Aber Hiob bekommt auch Unrecht – nicht darin, dass er seine Klage als Be- und Getroffener vorbringt, auch nicht darin, dass ihn sein Leiden zu Worten gegenüber Gott führt, die nicht fromm, nicht duldend, nicht schicksalsergeben sind. Unrecht wird Hiob darin bekommen, dass er in einem monomanen Ego-Trip den Zustand der Welt und die (fehlende) Güte Gottes allein an seinem persönlichen Ergehen ablesen will. (Mir ergeht es schlecht, also ist die ganze Welt schlecht).
Jürgen Ebach, Theologe
Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss:
Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss.
[...] Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen
Den Vorhang zu und alle Fragen offen ...
Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss!
Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!
Hiob klagt nicht nur, er klagt Gott an. Und er empfängt von Gott eine Antwort. Aber was Gott ihm sagt, beantwortet die Anklage gar nicht, es berührt sie gar nicht; die wahre Antwort, die Hiob empfängt, ist die Erscheinung Gottes allein, dies allein, dass die Ferne zur Nähe sich wandelt, dass »sein Auge ihn sieht«, dass er ihn wiederkennt. Nichts ist erklärt, nichts ausgeglichen, das Unrecht ist nicht Recht geworden und die Grausamkeit nicht Milde. Nichts ist geschehen, als dass der Mensch wieder Gottes Anrede vernimmt.
Martin Buber*, jüdischer ReligionsphilosophHiob starb alt und lebenssatt. Er hatte es also – wenn man so will –, satt zu leben, er hatte genug davon. Er wusste von jetzt an, dass ein Geschwätz, eine Wette zwischen Fremden genügt, um das ganze Gebäude wie eine Sandburg bei einem Sturm zusammenfallen zu lassen. Wenn man den Satz jedoch ganz wörtlich nimmt, dann scheinen diese Worte anzuzeigen, dass Hiob, nachdem er die Prüfung hinter sich hatte, in Frieden mit seinem Schicksal und versöhnt mit Gott und den Menschen gelebt hat. Doch das möchte ich eher für falsch erklären und laut dagegen protestieren. Und warum soll ich nicht sagen, dass Hiob mich vor allem nach dem Kriege in Verwirrung gestürzt hat. Man traf ihn damals auf allen Wegen Europas, verwundet, beraubt, verstümmelt, sicher nicht glücklich, aber auch nicht resigniert. Seine Unterwerfung im Buche Hiob erschien mir wie ein Hohn. Er hätte nicht so schnell nachgeben dürfen. Er hätte mit seinem Protest nicht aufhören dürfen. Er hätte zu Gott sagen müssen: »Gut, ich verzeihe dir, verzeihe dir insofern es sich um mich handelt. Aber meine toten Kinder, verzeihen sie denn dir? Habe ich das Recht, in ihrem Namen zu sprechen? Ich fordere, wenn nicht für mich, so doch für sie, dass Gerechtigkeit geschehe und der Prozess weitergeht.«

Ja, eine solche Sprache hätte er sprechen müssen. Nun hat er aber nichts gesagt, hat akzeptiert, so zu leben wie vorher. Hier liegt der eigentliche Sieg Gottes. Er hat Hiob dazu gezwungen, das Glück anzunehmen. Nach der Katastrophe lebt Hiob glücklich wider seinen eigenen Willen. Sein Prozess geht jedoch weiter. Die Tragödie Hiobs endet nicht mit Hiob.
Elie Wiesel, Schriftsteller, Auschwitz-Überlebender

Der Roman von Josef Roth* (1930), links in einer Aufführung der Münchner Kammerspiele, rechts in der Verfilmung von Michael Kehlmann, handelt von dem galizischen Juden Mendel Singer, der nach Amerika auswandert. Seine Familie erlebt ein Unglück nach dem anderen: Der jüngste Sohn Menuchim ist Epileptiker und wird bei der Auswanderung zurückgelassen; der älteste Sohn ist verschollen, der dritte fällt im Ersten Weltkrieg; die Tochter Mirjam bricht mit den Moralvorstellungen der Familie und wird schließlich psychisch krank. Als auch noch seine Frau stirbt, bricht Mendel in seiner Verzweiflung mit seiner Religion und wendet sich von Gott ab. Doch das »Wunder« geschieht: Der – inzwischen geheilte und als Musiker berühmt gewordene –Menuchim findet seinen Vater in Amerika und lässt ihn seinen Frieden finden.

HIOB
O du Windrose der Qualen! Von Urzeitstürmen in immer andere Richtungen der Unwetter gerissen; noch dein Süden heißt Einsamkeit. Wo du stehst, ist der Nabel der Schmerzen.
Deine Augen sind tief in deinen Schädel gesunken Wie Höhlentauben in der Nacht die der Jäger blind herausholt. Deine Stimme ist stumm geworden, denn sie hat zuviel Warum gefragt.
Zu den Würmern und Fischen ist deine Stimme eingegangen. Hiob, du hast alle Nachtwachen durchweint aber einmal wird das Sternbild deines Blutes alle aufgehenden Sonnen erbleichen lassen.
NELLY SACHS*
Gedenkstein im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen mit Hi 16,18

ADAMS ÄPFEL

Der mehrfach preisgekrönte groteske Film des dänischen Regisseur Anders Thomas Jensen handelt von einem »modernen Hiob«:
Der dänische Landpfarrer Iwan nimmt ehemalige Straftäter auf, um sie zu bekehren, so auch den aus dem Gefängnis entlassenen Neonazi Adam. Iwan lässt sich von allen Provokationen seiner Schützlinge nicht von seinem Glauben an das Gute im Menschen abbringen. Die zahlreichen Schicksalschläge, die er in seinem eigenen Leben erfahren musste (der frühe Tod der Mutter, die Misshandlung durch seinen Vater, der Suizid seiner Frau, die Behinderung seines Kindes und zuletzt ein tödlicher Gehirntumor), blendet er als vermeintliche Versuchungen des Satans einfach aus. Doch Adam, der in Iwans Bibel das Buch Hiob entdeckt hat, fordert ihn heraus, der Realität ins Auge zu sehen und (wie Hiob) Gott selbst für sein Unglück verantwortlich zu machen. Iwan verfällt in tiefe Depression, woraufhin Adam immer mehr Verantwortung in der Gruppe übernimmt. Zuletzt kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit den früheren Nazi-Freunden Adams und Iwan erleidet einen Kopfschuss, der ihn (wunderbarerweise) von seinem Tumor heilt.
1. In diesem Kapitel sind Sie verschiedenen künstlerischen und literarischen Bearbeitungen der Hiobtradition begegnet; auf dieser Doppelseite finden Sie weitere Beispiele. Untersuchen Sie, auf welche Aspekte und Fragestellungen des Hiobbuches sich die einzelnen Bearbeitungen beziehen. Arbeiten Sie unterschiedliche Akzentsetzungen heraus und suchen Sie nach Gründen (z. B. historischer Kontext).
2. Informieren Sie sich über weitere Beispiele der Rezeption der Hiobtradition in Kunst, Musik und Literatur (ggf. Referate).
3. Vielleicht mögen Sie selbst kreativ werden und z. B. Hiobszenen inszenieren, einen Kurzfilm (Handyfilm) drehen, einen Rap dichten und vertonen, Textcollagen anfertigen, Bilder gestalten.
DIALOG ZWISCHEN ADAM UND IWAN
Adam: Und wenn es nicht der Teufel ist, der dich prüft?
Iwan: Wie meinst du das? […] Wenn es nicht der Teufel ist, wer ist es dann?
Gott.
Wie bitte?
Gott.
Ich verstehe nicht, was willst du sagen?
Was ist, wenn Gott dich geprüft hat und nicht der Teufel?
Wieso um alles in der Welt sollte er das tun?
Weil er dich so hasst, Iwan. Ich habe dieses Buch gelesen, das Buch Hiob – kennst du doch, oder?
Das hab’ ich leider nie geschafft. Es handelt doch von einem kleinen Krokodil, zumindest hab’ ich das gehört
Über ein Krokodil steht viel drin, aber auch viele andere Dinge [Adam erzählt aus dem Buch]. Sieh mich an, Iwan: Du weißt genau, dass Gott diesen ganzen Zirkus hier veranstaltet. […] Der Teufel denkt gar nicht daran, auch nur eine Sekunde an dich zu verschwenden.
• Mit dem Zeitalter der Aufklärung* wurde die Bibel als historisches Dokument entdeckt. Es entwickelte sich der »historisch-kritische« Umgang mit der Bibel, der bis heute ein wichtiger Bestandteil des Theologiestudiums ( S. 142 f.) ist. »Kritisch« bedeutet in diesem Zusammenhang: analytisch, unterscheidend. Die historisch-kritische Forschung untersucht den Überlieferungsprozess, der zu dem Text in seiner jetzigen Gestalt geführt hat. Dazu werden verschiedene methodische Verfahren eingesetzt:
• Textkritik: Selbst den ältesten erhaltenen Bibelhandschriften (z. B. Qumranfragmenten* aus dem 3. Jh. v. Chr. oder dem Codex Sinaiticus* aus dem 4. Jh. n. Chr. [5]) geht jeweils schon ein langer Prozess des Abschreibens voraus. Dabei sind Fehler unterlaufen oder auch bewusste Textkorrekturen vorgenommen worden. So kam es zu Textvarianten, die in jeder wissenschaftlichen Bibelausgabe in einem sog. »textkritischen Apparat« aufgeführt sind. Beim Auslegen hat man sich begründet zwischen solchen Textvarianten zu entscheiden.



• Literarkritik: Inhaltliche oder stilistische Brüche, Widersprüche oder Wiederholungen können darauf hinweisen, dass ein Bibeltext nicht aus einem Guss ist. Vielleicht wurden hier verschiedene Quellen zusammengefügt oder ein ursprünglicher Text wurde überarbeitet. Möglich ist aber auch, dass solche Brüche von einem einzigen Autor bewusst eingesetzt wurden.
• Formgeschichte: Die Texte der Bibel wurden irgendwann einmal in realen Lebenssituationen kommuniziert. Oft verrät ihre Form, ihre »Gattung«, etwas davon. Geprägte Formen wie Märchen, Sprüche, Lieder, Gesetzestexte, Briefe u. v. m. weisen auf einen je unterschiedlichen »Sitz im Leben« der Texte (wie z. B. Familie oder Tempelkult) hin.
• Traditionskritik: Mit diesem Begriff wird einerseits die Frage nach dem Überlieferungsprozess eines Textes bezeichnet, andererseits die Untersuchung seiner geistesgeschichtlichen Hintergründe (religiöse Vorstellungen und ihre Entwicklung, Weltbilder, Denkstrukturen).
• Redaktionskritik: Die Quellen- und Redaktionskritik beschäftigt sich mit den Stadien der schriftlichen Überlieferung. Woher hat der Redaktor (der Bearbeiter des Textes in seinem Endstadium) seine Quellen? Wie und mit welcher Absicht hat er sie zusammengefügt?
• Folgerungen: Aus all diesen methodischen Schritten wird der/die Auslegende Schlüsse ziehen. Dabei wäre es ein verkürztes Verständnis von historischkritischer Forschung, wenn am Ende das als normativ gültig herauskäme, was »ursprünglich« oder »echt« an einem Text ist. Vielmehr leistet es die historisch-kritische Forschung, die in den biblischen Texten »eingefrorenen« Gesprächsprozesse wieder zu verflüssigen. Heute wird die historisch-kritische Methode im Verbund mit anderen Auslegungsmethoden angewendet; sie steht für eine kritische Haltung gegenüber den Texten, die diesen Texten ihre Fremdheit lässt und sie vor Vereinnahmung schützt.
Matthäus und der Engel. Rekonstruktion eines verschollenen Gemäldes von Michelangelo Merisi da Caravaggio

1. Blättern Sie zurück und prüfen Sie, ob Sie einzelne Elemente der historisch-kritischen Exegese auf den vorhergehenden Seiten wiederfinden können.
2. Identifizieren Sie historisch-kritische Fragestellungen auf den abgebildeten Buchtiteln ( S. 92).
3. Erläutern Sie die von M. Oeming aufgezählten »Probleme des Hiobbuchs« (rechts) mithilfe von Textstellen.
4. Diskutieren Sie die beiden Antworten (rechts) und formulieren Sie ggf. eigene.
1. »Der historisch-kritische Umgang mit der Bibel macht den Glauben kaputt«, klagen manchmal Theologiestudierende zu Anfang ihres Studiums. Erfinden Sie einen Dialog.
2. Deuten Sie das Gemälde (oben). Diskutieren Sie, welche Aussagekraft es nach der Aufklärung*, angesichts historisch-kritischer Forschung noch haben kann.
EINIGE PROBLEME DES HIOBBUCHES AUS HISTORISCH-KRITISCHER PERSPEKTIVE:
? Wie ist der Wechsel von Prosa zur Poesie und zur ück zu erklären?
? Im Prosarahmen ist Hiob ein demütiger Dulder, im poetischen Teil hingegen ein Rebell, der bis an die Grenzen der Blasphemie Gott kritisiert.
? Im Rahmen scheint Hiob ein Nomade, im poetischen Teil ein wohlhabender Städter zu sein.
? Wie kommt es, dass Satan, der in den Kapiteln 1 und 2 die zentrale Figur ist, im Folgenden vollkommen verschwindet?
? In der Redeschlacht zwischen Hiob und seinen drei Freunden wiederholen sich die Argumente; zum Ende hin fransen die Dialoge aus.
? Gottes Antworten passen gar nicht zu Hiobs Fragen. Zudem sind sie mehrstufig: Mitten in der Gottesrede fängt Gott an, nochmal zu reden. nach Manfred Oeming
Mögliche Antworten:
Das Buch ist sprachlich und inhaltlich sehr uneinheitlich. Das weist auf einen jahrhundertelangen Überlieferungsprozess hin. Eine alte mündliche Erzählung wurde immer wieder überarbeitet, weil das geschilderte Problem – die Frage, warum Gott den unschuldigen Hiob so furchtbar leiden lässt – eigentlich nicht lösbar ist.
Das Buch Hiob ist weitgehend aus einem Guss. Es wechselt zwar zwischen unterschiedlichen Sprachformen und enthält inhaltliche Widersprüche. Doch diese werden von einem einzigen Autor bewusst zitiert, nebeneinandergestellt und inszeniert, um seine Leserinnen und Leser (ggf. sein Theaterpublikum) zum Nachdenken zu bringen.

Die literaturwissenschaftliche Bibelauslegung untersucht den einzelnen Bibeltext in seiner Letztgestalt (also einschließlich aller Spannungen und Brüche) als literarisches Kunstwerk. Sie bedient sich dabei der Methoden der Literatur- und Sprachwissenschaft und fragt z. B. nach literarischen Strukturen, Textgattungen, erzählerischen, dramatischen oder poetischen Stilmitteln, Personengestaltung.
Die tiefenpsychologische Bibelauslegung steht in der Tradition Sigmund Freuds* und Carl Gustav Jungs*. Sie geht davon aus, dass in den biblischen Geschichten seelische Urbilder verborgen sind, ähnlich wie auch in Träumen, Mythen oder Märchen. Biblische Erzählungen wie z. B. die Exodustradition ( S. 114) können als Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung interpretiert werden (Befreiung von Fremdbestimmung und Angst) und können so für die Lesenden heilend und befreiend wirken.
So ist es, wenn man leidet: Der Weg führt von der Schockstarre über den Protest zur Ergebung.
Bei dieser Lesart geht es nicht um die historische Überlieferungsgeschichte eines Textes, sondern die Bibel wird als ganze betrachtet – so wie sie uns in ihrer kanonischen* Endgestalt vorliegt. Innerhalb der Bibel findet sich eine Vielzahl von (beabsichtigten und unbeabsichtigten) Bezügen zwischen einzelnen Texten, Motiven, Begriffen. So »entsteht zu jedem Text ›im Zwischenraum mit anderen Texten‹ ein intertextuelles Sinnpotential, das kein Einzeltext für sich alleine genommen generieren kann.« (Michael Schneider). Die Texte erhellen und befragen sich gegenseitig – dies zu untersuchen und für die Interpretation fruchtbar zu machen, ist Aufgabe der intertextuellen Exegese.
Und woran MERKt man jetzt, wer
Viele Bibeltexte sind über die Jahrhunderte hinweg vielfältig rezipiert und umgestaltet worden – in der persönlichen Frömmigkeit, im Gottesdienst, im Unterricht (z. B. in Religionsbüchern!), in Kunst, Literatur, Musik, Theologie, Philosophie u.v.m. Solche aktualisierenden Interpretationen entfernen sich zwar oft scheinbar weit von dem, was der Autor des Textes damals (vermutlich) »gemeint« hat, doch trotzdem sind sie im Text (z. B. in seinen Leerstellen, Brüchen, offenen Fragen) angelegt und helfen bei der Auseinandersetzung mit dem Text.
Die biblischen Texte wurden in einer von Männern dominierten Gesellschaft verfasst und überliefert. Dabei wurden Frauen und ihre Erfahrungen oft an den Rand gedrängt oder ganz unsichtbar gemacht. Feministische Bibelauslegung macht auf einseitig männliche Denkweisen in der Bibel und ihrer Wirkungsgeschichte aufmerksam, kritisiert und revidiert sie. So beschäftigt sie sich z. B. mit biblischen Frauengestalten, bringt verdrängte Frauentraditionen ans Licht (etwa die Existenz von Jüngerinnen Jesu) und macht grundlegende biblische Freiheitstraditionen (wie z. B. im Alten Testament die Exoduserfahrung und im Neuen die Rechtfertigungsbotschaft) gegen einzelne frauenfeindliche Aussagen geltend. Feministische Bibelhermeneutik steht im größeren Kontext von Befreiungstheologie* und weltweitem Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung. Mittlerweile wird sie durch den Ge-
Hermeneutisches Viereck nach M. Oeming. Die unterschiedlichen Lesarten, einschließlich der historisch-kritischen Bibelauslegung, setzen hier unterschiedliche, einander ergänzende Schwerpunkte.
danken der Gendergerechtigkeit ergänzt und nimmt zunehmend auch die Vielfalt sexueller Identitäten in den Blick.
Neben stärker wissenschaftlich orientierten Lesarten der Bibel gibt es auch solche, die keine wissenschaftlich-theologischen Kenntnisse voraussetzen, sondern von der unmittelbaren Begegnung mit der Bibel leben, wie z. B. »Bibel teilen«. Diese Methode, die in manchen Gemeinden praktiziert wird, soll helfen, einen persönlichen spirituellen Zugang zu den biblischen Texten zu finden. In kleineren Gruppen wird ein Text in vorgegebenen Schritten erschlossen; dabei wechseln sich meditative Elemente, persönliche Reflexion, Austausch und Gebet ab. Andere erfahrungsbezogene Lesarten sind z. B. Bibliolog* oder Bibliodrama*.
1. Ordnen Sie die Lesarten der Bibel (einschließlich der historisch-kritischen) dem hermeneutischen Viereck (oben) zu.
2. Beziehen Sie die Lesarten, ausgehend von den Gedanken zwischen den Leiter-Stufen ( S. 94) auf das Hiobbuch.
3. Probieren Sie in arbeitsteiligen Gruppen je zwei Lesarten an einem Textbeispiel aus; vergleichen Sie sie und zeigen Sie, wie sie sich ggf. ergänzen.
REFORMATORISCHES SCHRIFTVERSTÄNDNIS
• Es war ein Hauptanliegen der Reformation Martin Luthers [8], die Schrift als verbindliche Norm kritisch gegen die herrschende Kirche und ihre Lehren anzuwenden (»sola scriptura«). Nach einer bekannten lutherischen Formulierung »bleibt allein die Heilige Schrift der einig [der einzige] Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher als dem einigen Probierstein sollen und müssen alle Lehren erkannt und geurteilt werden, ob sie gut oder bös, recht oder unrecht seien«. Anders als die meisten Theologen vor ihm ging Luther nicht davon aus, dass die kirchliche Tradition und Überlieferung in einer selbstverständlichen Harmonie mit der Heiligen Schrift steht und dass sich z. B. kirchliche Konzilien* grundsätzlich nicht irren können.
• Luther wollte mit dem Prinzip »sola scriptura« dabei nicht sklavischer Buchstabengläubigkeit das Wort reden. Kriterium für die Autorität der Bibel war für Luther das, »was Christum treibet«, d. h. inwieweit eine biblische Aussage der frohen Botschaft von Jesus als dem Christus entspricht. Von diesem Kriterium her konnte er sogar einzelne Schriften der Bibel ablehnen.

Unter diesem Bibelwort (Joh 1,1) wurden die kirchlichen und staatlichen Aktivitäten zum Lutherjahr 2017 gebündelt. In der an der Kommunikationskampagne beteiligten Kirchen luden Bücherregale dazu ein, Bücher zu tauschen.
1. Erläutern Sie mit Hilfe der Info die Kommunikationskampagne zum Lutherjahr (oben) sowie die Gestaltung der Lutherfigur. Entwerfen Sie jeweils alternative Ideen der Gestaltung.
2. Zeigen Sie ausgehend von dem Lutherzitat (unten) und der Info Verbindungen des »sola scriptura«Prinzips zu anderen reformatorischen Grundeinsichten* [8] auf. Entwerfen Sie ein Plakat zum reformatorischen Schriftverständnis.
3. Diskutieren Sie, ob das Hiobbuch dem Kriterium »was Christum treibet« entspricht.
MARTIN LUTHER ÜBER DIE BIBEL
Evangelion heißt auf Deutsch: gute Botschaft, gute Märe, gute neue Zeitung [Nachricht/Botschaft], gutes Geschrei, von dem man singt, sagt und fröhlich ist. Nun kann ja der arme Mensch, in Sünden tot und zur Hölle verstrickt, nichts Kostbareres hören als solch teure liebliche Botschaft von Christus. Sein Herz muss von Grund auf lachen und fröhlich darüber werden, sofern er glaubt, dass es wahr ist. Darin stimmen alle rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass sie allesamt Christum predigen und treiben. Auch ist das der rechte Prüfstein, alle Bücher zu beurteilen, ob sie Christum treiben oder nicht. Was Christum nicht lehrt, das ist nicht apostolisch*, selbst wenn es der Heilige Petrus oder der Heilige Paulus lehrte. Wiederum was Christum predigt, das ist apostolisch, selbst wenn es Judas, Hannas, Pilatus oder Herodes täte.

Seit zwei Wochen ist sie nun da, die »neue« Lutherbibel. Pünktlich zur Eröffnung des Reformationsjubiläums ist der revidierte Text fertig gestellt, der die nunmehr zweiunddreißig Jahre alte vorige Fassung ersetzen soll … Diese Revision [Überarbeitung] ist ein Teil einer theologischen Tradition, die weit vor Martin Luther begann. Jesus von Nazareth sprach aramäisch. Seine Worte sind uns jedoch nur auf Griechisch überliefert. Die Stimme Jesu ist uns also nur in der Brechung durch die Übersetzung bekannt. Die neutestamentlichen Autoren zitieren die Schriften Israels nicht in ihrem hebräischen Original, sondern ebenfalls in der griechischen Übersetzung. Das westeuropäische Christentum gr ündet seine gesamte Theologie in der Hauptsache auf die Vulgata* des Hieronymus, der lateinischen Übersetzung der hebräischen und der griechischen Bibel. Die verschiedenen reformatorischen Bibelübersetzungen und alle danach reihen sich in diesen Traditionsstrom ein. Es ist eins der Hauptmerkmale des Christentums, dass es so etwas kennt wie eine »Heilige Übersetzung«. Und auf jeden Fall unterscheidet dieser Sachverhalt die christlichen Gemeinschaften von den jüdischen und muslimischen, die aus guten Gründen mit der Übersetzung der Heiligen Schrift sehr sparsam umgehen.
Melanie Köhlmoos, Theologin[…] Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
WORT GOTTES
1. Sammeln Sie ausgehend von den Bildern typische Situationen, in denen die »Bibel« (auch) als gegenständliches Buch eine Rolle spielt. Tauschen Sie sich darüber aus, inwiefern hier der Bibel Autorität und ggf. sogar »Heiligkeit« zugesprochen wird.

2. Erläutern Sie, inwiefern eine Bibelübersetzung »heilig« sein kann (Text oben).
3. Erklären Sie, wie in der zitierten Barmer These [9] »Wort Gottes« verstanden wird.

Wer so fragt, zielt in aller Regel auf die Ebene historischer Wahrheit, genauer: auf die Ebene bestimmter historischer Tatsachen. Das heißt dann landläufig: Die Bibel »wörtlich« nehmen. Die Bibel ist in diesem Verständnis dann »wahr«, wenn die Schöpfung ein astronomischgeographischer Messbericht, wenn die Jungfrauengeburt ein medizinischer Befund, wenn der Gang Jesu übers Wasser ein elegantes Schauspiel ist. Angesichts der Lebendigkeit und Differenziertheit biblischer Texte erscheint diese Art, die Bibel zu lesen und nach ihrer Wahrheit zu fragen, bestenfalls banal. Um so mehr stellt sich die Frage, weshalb für viele Menschen der ganze Glaube an dieser Art »Wahrheit« hängt. Für landläufig als »fundamentalistisch*« bezeichnete Kreise haben biblische Texte die Aufgabe, die Leser und Leserinnen in die Entscheidung zu führen, sie zu konfrontieren mit der Notwendigkeit der Wahl zwischen Glaube und Unglaube. Damit dies gelingt, ist gerade nicht die Wahrnehmung der Vielfalt biblischer Texte, das differenzierte Lesen und Nachfragen, das offene Gespräch gefragt, im Gegenteil: Es reicht, dass die Bibel »Recht« hat. Die Bibel lesen heißt hier nicht in ein Gespräch eintreten, eine neue Welt entdecken, sich auf einen neuen Weg begeben, sich herausfordern lassen zur Verwandlung; die Bibel lesen heißt hier, vor eine einmalige Entscheidung gestellt zu werden oder auch sich eine eigene bereits gefällte Entscheidung immer wieder zu bestätigen. Gegen diese »fundamentalistische« Lesart bleibt neben vielem anderem besonders dies einzuwenden: Sogar wenn man die Bibel in diesem Sinn »wörtlich« liest, müsste den fundamentalistischen Leserinnen und Lesern auffallen, dass ausgerechnet die Bibel selber Glaube und Unglaube gerade nicht an diese Ebene der historischen Fakten bindet. Etwas pointiert gesagt: Fundamentalisten glauben an die Bibel, die ihnen die Verantwortung abnimmt, statt an Gott, der Verantwortung zuspricht; indem die fundamentalistische Bibellektüre die Texte auf historische Tatsachenberichte reduziert, entbindet sie sich von der Arbeit, immer wieder neu und offen zu fragen, auf welche Erfahrungen, auf welche Wirklichkeit sich die bib-
lischen Texte überhaupt beziehen - die Texte also Zeugnisse einer bestimmten Wirklichkeit ernst zu nehmen. Es deutet auf ein ungelöstes Problem in Theologie und Kirche hin, dass häufig davon gesprochen wird, ein Text sei entweder »wörtlich« oder »nur« in einem »übertragenen oder symbolischen« Sinn zu verstehen. Das verräterische »nur« belegt, dass auch in keineswegs fundamentalistischen Kreisen die Ebene der historischen Tatsachen heimlich als die eigentlich maßgebende Ebene für die Bibel betrachtet wird. Überflüssig darauf hinzuweisen, dass dies bei anderen Texten wie zum Beispiel Liebesgedichten nicht so ist. Die Liebhaber dieser Texte würden sie wohl kaum als »nur« in einem übertragenen Sinn gemeint bezeichnen.
An dieser Stelle ist es nun auch möglich, die Wahrheitsfrage noch einmal anders zu formulieren: Wenn der Bezug eines biblischen Textes auf Erfahrung »wirklich« gelingt, dann zeigt sich seine »Wahrheit«, sein Aussagereichtum, sein Sinn, seine Weisung. Unter dieser Voraussetzung ist jeder biblische Text »wahr«. Schöpfung etwa als Antwort auf die Frage: Worin besteht der tragende Grund unseres Lebens? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Die Jungfrauengeburt etwa als Antwort auf die Frage: Wes Geistes Kind ist Jesus?
Etwas anderes ist es dann, sich mit den Antworten der Texte, sich mit ihren Wahrheiten auseinanderzusetzen. Hier beginnt dann das Gespräch.
Chr istian Bühler, Theologe
AUS DER ZUSAMMENFASSUNG DER CHICAGOERKLÄRUNG* (1978)
Da die Schrift vollständig und wörtlich von Gott gegeben wurde, ist sie in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum oder Fehler. Dies gilt nicht weniger für das, was sie über Gottes Handeln in der Schöpfung, über die Geschehnisse der Weltgeschichte und über ihre eigene, von Gott gewirkte literarische Herkunft aussagt, als für ihr Zeugnis von Gottes rettender Gnade im Leben einzelner.
Sehr evangelisch ist die [freikirchliche] Gemeinschaft, in der Sie aufgewachsen sind, ja darin, dass das Wichtigste die Bibel ist: Nur das Wort zählt. Allerdings gilt sie dabei als sehr konservativ und eine rigoristische Bibelauslegung hegend. Wenn man der Bibel wortwörtlich folgt, kommt man da nicht ins Strudeln aufgrund der ganzen Widersprüche, die sich darin finden?

Viele Widersprüche werden aufgelöst, indem man sich sehr intensiv beschäftigt mit den Texten und ihre Kernbedeutung stark macht. Zum Beispiel die zwei Schöpfungsgeschichten, da geht es einmal um das Physische, in der wird alles hergestellt, und beim zweiten Mal um das Geistliche. Und beide ergänzen sich. Und wie schaut es mit dem Umgang mit Homosexualität aus?
In den meisten Kreisen meiner Kirche ist Homosexualität aufgrund der Interpretation der heiligen Schrift leider nicht akzeptiert. Wenn man homosexuell ist, soll man es nicht ausleben. Aber Homosexuelle zu verfolgen, wäre auch wiederum nicht mit der Schrift zu vereinbaren.
Wie war das für dich als queere Person – hast du irgendwann deinen Glauben infrage gestellt oder dich von Gott nicht mehr geliebt gefühlt, wenn Menschen in deiner Gemeinde gesagt haben, dass Homosexualität und Transidentität nicht Gottes Willen sind? Nein, gar nicht. Ich habe mich immer von Gott geliebt gefühlt als die, die ich bin. Aber ich habe viel gehadert. Warum muss ich so etwas Schmerzvolles erleben?!
1. Fassen Sie den Text von C. Bühler ( S. 98) in Thesen zusammen. Achten Sie dabei auf die unterschiedlichen Facetten des Begriffs »Wahrheit«.
2. Zeigen Sie mit Bezug auf den Text von C. Bühler auf, inwiefern in dem Buchcover und in dem Zitat aus der Chicago-Erklärung* ( S. 98) ein fundamentalistisches* Bibelverständnis zum Ausdruck kommt.
3. Vergleichen Sie das Bibelverständnis der »Chicago-Erklärung*« mit dem, das sich in der Äußerung Luthers zeigt ( S. 96).
4. Tauschen Sie sich ausgehend von den Materialien dieser Doppelseite über die Schwierigkeit aus, ein problematisches »fundamentalistisches*« Bibelverständnis von angemessenen Bibelverständnissen zu unterscheiden.
5. Der Begriff »Fundamentalismus*« begegnet aktuell in verschiedenartigen Zusammenhängen – informieren Sie sich genauer und versuchen Sie zu differenzieren.
6. »Das verräterische ›Nur‹ ...«. Überprüfen Sie das »Nur« im MERKE von P. Lapide*.
7. Formulieren Sie aus evangelischer Sicht eine Antwort auf die Behauptung, dass die biblische Schöpfungsgeschichte [8] wörtlich »stimmt«.
CHRISTLICHEN FUNDAMENTALISMUS*
• Behauptung absoluter und unerschütterlicher Fundamente des Glaubens

• Absicherung des Glaubens gegen die Infragestellung durch alternative Weltsichten und Lebensweisen
• Ablehnung von bestimmten Facetten moderner Lebensweisen
• rigorose (traditionelle) ethische Vorstellungen
• Tendenz, die Welt dualistisch wahrzunehmen (gut/böse, richtig/falsch ...)
• zentrale Bedeutung der Glaubensentscheidung des und der Einzelnen
• Hang zu einer apokalyptischen* Deutung der Gegenwart nach einer Vorlage der EZW*
Der Koran ist für die Moslems die Urnorm des Gesetzes, die primäre Wirklichkeit des Islam. Er ist nicht nur die Verdichtung aller Lehren des Propheten, aus der ein breiter Strom von Traditionen gespeist wird, sondern vor allem die letztgültige Autorität, das Wort Gottes durch den Mund des Propheten, das den Islam begründet. Für den Moslem ist der Koran das Abbild einer ewigen, übergeschichtlichen Urschrift der Offenbarung, die bei Gott aufbewahrt wird. Der Moslem versucht sein heiliges Buch in laut vorgetragener Rezitation zu verstehen. Er macht sich den Koran innerlich zu eigen. Wie also ein Christ sagen kann, dass er mit Christus lebe, so kann das der Moslem vom Koran sagen. Der Koran existiert als Anrede, die Antwort erwartet, die den Hörer miteinbezieht. Islam heißt ja auch Hingabe. Der Koran sammelt also die islamische Gemeinde um sich und nicht der Prophet. Der Koran ist also – um einen Vergleich zu sagen –der »Christus des Islam« und nicht der Prophet, durch dessen Mund er offenbart worden ist: Im Christentum wurde das Wort Fleisch – im Islam zu einem Buch, zum Koran.
Muhammad Salim Abdullah, Islamexperte
1. Wiederholen Sie, was Sie über die Bedeutung des Korans im Islam wissen. [7]

2. Informieren Sie sich über unterschiedliche Kinderund Schülerbibeln: Welche Texte wurden ausgewählt? Welche kommen nicht vor? Tauschen Sie sich darüber aus, ob Sie die Auswahl gelungen finden.
3. Formulieren Sie aus jüdischer, christlicher und islamischer Perspektive mögliche Begründungen für die »Heiligkeit« der jeweils zentralen Schrift
Frau Akgün, liberale Muslime sind in Deutschland in der Minderheit. Aber ihre Zahl wächst. Die ersten muslimischen Gemeinden entstanden. Wer gibt den liberalen Muslimen in Deutschland eine Stimme?
Liberale Muslime können Sie eigentlich überall antreffen. In der Wissenschaft haben wir inzwischen einige Ver treter.
Wenn wir uns die religiösen Vorstellungen moderner Muslime anschauen, wie interpretieren liberale Muslime den Koran?
Ich glaube, das ist der wichtigste Knackpunkt. Liberale Muslime sagen, dass der Koran zwar auch Gottes Wort ist, aber Gottes Menschenwort – wie Abu Zaid, der berühmte ägyptische Theologe, das ja mal vor Jahren formuliert hat, weswegen er auch damals in Ägypten verfolgt wurde und in die Niederlande flüchten musste. Es heißt, dass die Suren insgesamt historisch-zeitlich interpretiert werden müssen. Und letztendlich muss daraus folgen, dass bestimmte Suren heute keine Gültigkeit mehr haben können, weil sie zeitlich begrenzte Suren waren. Also wenn in einer Sure steht, wenn deine Frau dir nicht gehorcht, dann ermahne sie, und wenn sie immer noch nicht gehorcht, dann schlage sie, dann kann diese Sure für uns heute keine Gültigkeit mehr haben. Dann reicht es nicht, das Wort »schlagen« anders zu interpretieren, wie eben »streicheln« oder »nicht so schlimm schlagen«; sondern wir müssen den Mut haben zu sagen: Diese Sure mag vor 1500 Jahren vielleicht noch möglich gewesen sein. Heute mit unserem Verständnis der Frauengleichberechtigung ist diese Sure nicht mehr gültig.
Für den »Koran für Kinder und Erwachsene« haben die Autorinnen Suren neu übersetzt und thematisch angeordnet. Dies soll den Zugang zum Koran erleichtern.
Marc Alain Ouaknin beschreibt das Auslegen des Talmuds* [9] im traditionellen jüdischen Lehrhaus – einem Ort des Debattierens und des kultivierten Streits um die Wahrheit. Stoßen wir die Tür zum Studiensaal [des Lehrhauses] auf: In der Regel ist die ganze Atmosphäre geprägt von Durcheinander, Stimmengewirr, heftigem Gestikulieren und einem unaufhörlichen Kommen und Gehen. Die nur selten in Reih und Glied stehenden Tische quellen über von einem Wirrwarr großformatiger Talmudtraktate und verschiedener Kommentare; alle sind aufgeschlagen und übereinander geschichtet. Die Talmudschüler lesen mit lauter Stimme, bewegen sich dabei von vorne nach hinten, von links nach rechts. Dann wieder blättern sie fieberhaft die Seiten der Kommentare um. Alles ist in Bewegung.
Vielleicht können wir in dieser Umgebung am besten die Bedeutung und die politische Funktion dieser Texte, ihren anti-ideologischen Aspekt empfinden. Was den L eser von Talmud und Midrasch* auf Anhieb verblüfft, ist die Bedeutsamkeit des Dialogs für die Anlage des Denkens. Nur selten gibt es Themenstellungen, die nicht kontrovers sind. Sobald ein Lehrer seine Auslegung vorlegt, bringt sein Gesprächspartner sie von
seinem Standpunkt und seinen Erkenntnissen her ins Wanken: Es geht um eine andauernde Destabilisierung und ein Denken in Gegenthesen, welches sich der Gleichschaltung und der Synthese, die sich als alleingültiger, allgemeiner und die Wahrheit aussagender Begriff etablieren würde, widersetzt.
Dieses grundsätzliche Dialogisieren hat einen Namen: die Mahloquet*. Sie ist der erste Raum, der »die Aufspaltung und die Trennung als Ursprungsort jeden positiven Bedeutungswertes kennzeichnet«. Dieser Zwischenraum ist in gewisser Hinsicht politisch, denn er stellt die auffallendste Bekundung dafür dar, das Abschließen zurückzuweisen. Die Mahloquet ist die antiideologische Situation schlechthin. Jede Auslegung stellt ein Verflochtensein in die inneren Beziehungen eines unendlich komplizierten Netzes dar, das immerfort Knäuel bildet und stets einer Verquirlung unterworfen ist.
Mahloquet heißt die Unmöglichkeit, für sich alleine zu denken. Durch den Dialog zwischen den Lehrern wird Raum geschaffen für eine wechselseitige Kritik. »Die Worte des einen wie die Worte des anderen sind Worte des lebendigen Gottes«.
Marc Alain Ouaknin, Rabbiner und Philosoph1. Stellen Sie Bezüge her zwischen dem Buch-Cover und der von M. A. Ouaknin geschilderten Szene. Vergleichen Sie diese mit selbst erlebten LernSituationen.

2. Beziehen Sie die »Mahloquet« auf das Zitat von E. Goodman-Thau ( S. 75) und auf das Buch Hiob.
3. Vergleichen Sie anhand der Materialien auf S. 96–101, worin nach christlich-evangelischem, islamischem und jüdischem Verständnis die Autorität, die »Heiligkeit« der Schrift besteht.
1996 erschien das erste jüdische Lesebuch für Kinder in Deutschland nach der Zeit des Nationalsozialismus.
Neulich hat mich ein Professor aus meinem früheren Politologie-Studium gefragt, wie ich als Rabbinerin damit umgehe, [dass die Autoren Israel Finkelstein und Neil Asher Silberman in dem Buch belegen wollen, dass die historischen Berichte der Bibel nicht haltbar sind.] Meine Antwort: Ich bin begeistert. Ich brauche die Bibel nicht zu glauben. – Ich kann vielmehr gleich daran gehen, sie zu verstehen, das heißt zu verstehen, wie die damaligen Autoren ihre Epoche in religiösen Botschaften verarbeiten.
Ingo Baldermann hat als Professor für Religionspädagogik zahlreiche Bücher geschrieben, in denen er Religionslehrkräfte zum Umgang mit der Bibel im Religionsunterricht anleitet:
Bei den professionellen Interpreten der Bibel hat man immer wieder den Eindruck einer sehr großen Mühe. Von dem »garstigen breiten Graben« war lange die Rede, der uns Heutige von diesen Texten trennt, von all den Schwierigkeiten, ihn zu überbrücken. Was sagt dieser Text denn uns? Ja, hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? In der Religionspädagogik wird nach wie vor die Frage diskutiert, was es denn überhaupt für einen Sinn macht, heutigen Kindern und Jugendlichen diese alten, schweren, fremden Texte vorzulegen. Dabei ist es mittlerweile nicht mehr eine nur ganz persönliche, sondern durchaus eine öffentliche Erfahrung, dass die biblischen Texte direkt zu uns reden. Wir müssen nicht einen garstigen breiten Graben mühsam überbrücken, sondern biblische Texte haben sich selbst in der öffentlichen Diskussion unerwartet nachhaltig Gehör zu verschaffen gewusst.
Die biblischen Texte sind aufgeschrieben, um mich anzureden und herauszufordern, dass ich mich auf einen Dialog einlasse. Die mich da anreden, suchen in mir
nicht ein Gefäß für ihre Lehren, sondern sie wollen mir etwas zeigen, sie wollen mich dies selbst wahrnehmen lassen, und sie wissen und respektieren dabei, dass ich auf einem ganz eigenen Weg zu dieser Begegnung gekommen bin und eigene Erfahrungen und Fragen mitbringe. Sie wollen mir ihre Erfahrungen zeigen, damit ich auch meine Erfahrungen und Fragen neu zu sehen lerne. Nicht durch die Übernahme fremder Meinungen, sondern erst in diesem Dialog erlange ich die Mündigkeit selbständigen Urteils. Eben dies ist das von der Bibel selbst initiierte Lernen.

Dieser Umgang mit der Bibel verleiht der Kirche den Charakter einer »Lerngemeinschaft«; und sie ermöglicht ein Lernen, in dem nicht die einen zu Herren des Glaubens der anderen werden, sondern jede und jeder selbst geöffnet wird für eigene Wahrnehmung.
Als Lehrkraft muss ich versuchen, Begegnungen herbeizuführen zwischen den Kindern und den Worten der Bibel, Begegnungen, mit denen ein Dialog beginnt, der länger dauert als mein Unterricht. An den Anfängen dieser Dialoge werde ich selber staunend teilnehmen und manches Unerwartete lernen können. Alles andere wäre der Bibel viel zu aufdringlich.
Fassen Sie den Text von I. Baldermann zusammen.
Betrachten Sie einen selbst gewählten biblischen Text aus der Sicht verschiedener Bibelhermeneutiken. Was fällt Ihnen durch die jeweilige »Brille« besonders auf?
Tauschen Sie sich aus.
Die Überlegungen von I. Baldermann lassen auch seine Bewertung historisch-kritischer Methoden erkennen. Arbeiten Sie diese heraus und diskutieren Sie sie.
Was haben Sie dazugelernt (vgl. S. 73)?
Was möchten Sie sich merken?
Welche Methoden bzw. Materialien haben Sie besonders angesprochen?

Was wird Sie weiter beschäftigen?
Welche Fragen bleiben offen?
Fragen Sie Ihre Religionslehrkraft, ob und wo sie staunend von ihren Schülerinnen und Schülern Unerwartetes gelernt hat
Erinnern Sie sich, welche biblischen Texte bzw. Traditionen in Ihrem Religionsunterricht eine Rolle gespielt haben: Welche haben Sie positiv oder negativ beeindruckt? Prüfen Sie, ob solche – unmittelbaren – Begegnungen, wie I. Baldermann sie beschreibt, im Religionsunterricht oder ggf. auch anderswo stattgefunden haben.
Vielleicht haben Sie Lust und Gelegenheit eine eigene Unterrichtsstunde für eine Klasse aus der Unter- oder Mittelstufe zu einem Bibeltext vorzubereiten, den Sie besonders mögen oder der Sie besonders herausfordert.
»Dabei ist es mittlerweile eine öffentliche Erfahrung, dass die biblischen Texte direkt zu uns reden.« Mit diesem Satz bezieht sich I. Baldermann u. a. auf den Leitspruch »Schwerter zu Pflugscharen« der Friedensbewegung der 1980er-Jahre. Tauschen Sie sich darüber aus, ob und ggf. in welcher Weise heute in den Medien und in der Öffentlichkeit auf die Bibel Bezug genommen wird! Deuten und diskutieren Sie das Beispiel auf S. 102 sowie ausgewählte Beispiele, die Sie im Rahmen der »Extratour« ( S. 73) gesammelt haben.
Was begrenzt mich?
Wann ist man frei? Und wo?
Ist Freiheit Einbildung?
Was kostet Freiheit?
Sind Evangelische freier?
Ist Gott frei?
Lernbereiche: »Freiheit leben«, »Sola scriptura!? – Zugänge zur Bibel«
In diesem Kapitel beschäftigen Sie sich mit unterschiedlichen Facetten von Freiheit: Sie geben Auskunft über verschiedene Begriffe und Theorien von Freiheit aus Philosophie und Theologie sowie aus der Hirnforschung. Wichtige Aspekte des biblischen Freiheitsverständnisses sowie des evangelischen Gewissensverständnisses können Sie beschreiben.
Ausgehend von der Reflexion eigener Freiheitserfahrungen erörtern Sie unterschiedliche Freiheitsverständnisse und deren Konsquenzen. In diesem Zusammenhang nehmen Sie auch Stellung zu Problemen und Ambivalenzen im Zusammenhang mit Freiheit – etwa der Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit oder der Gefahr des Missbrauchs von Freiheit. urteilen
Sie nehmen wahr und Sie deuten, wie das Motiv der Freiheit in Kunst, Medien und Werbung gestaltet wird. Sie interpretieren biblische, theologische und philosophische Texte, die von Freiheit handeln, vergleichen unterschiedliche Auffassungen von Freiheit und beziehen diese auf aktuelle Fragestellungen. Sie erkennen Gefährdungen und Spannungen im Hinblick auf menschliche Freiheit.
Sie tauschen sich über eigenes Erleben von Freiheit und Unfreiheit aus und diskutieren kontroverse Positionen zum Thema Freiheit, auch aus dem Bereich der Politik. Eigene Gedanken zur Thematik gestalten Sie mit kreativen Methoden.
PRESSESPIEGEL
Tagtäglich wird auf der ganzen Welt über Freiheit gestritten und verhandelt, werden Freiheitsrechte verletzt, wird für Freiheit gekämpft. Wählen Sie aus den Freiheitsrechten des Grundgesetzes ( S. 116) eines heraus, das Ihnen persönlich wichtig ist, und verfolgen Sie über den Zeitraum, in dem Sie dieses Kapitel behandeln, die täglichen Nachrichten in den Medien. Sammeln und bewerten Sie Meldungen und Kommentare, die mit dem von Ihnen ausgewählten Freiheitsrecht zu tun haben, in einem »Pressespiegel« (analog oder digital). Stellen Sie einander ausgewählte Fundstücke vor (am Ende des Lernbereichs oder auch regelmäßig zu Beginn jeder Stunde).
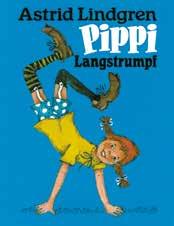




Tareq ist 2016, mit 19 Jahren, aus dem Irak nach Deutschland geflo hen. Auf einem Spaziergang durch Münster erzählt er der Journalistin Hannah Dürken aus seinem Leben.
Tareq stockt mitten im Satz, schaut mit dunklen Augen in den Himmel, als ein tief fliegendes Flugzeug den Münsteraner Hafen für einen Moment in Fluglärm taucht. In Tareqs Gesicht verrutscht das Lächeln, die Lachfältchen verschwinden kurz. »Die Geräusche kenne ich noch aus meiner Kindheit«, sagt er.
Seit fünf Jahren wohnt Tareq hier. Er hat Deutsch gelernt und macht bald sein Abitur. Danach will er in Münster Informationstechnik studieren. Er hat viel erreicht und ja, er fühlt sich heute frei. Aber bis dahin war es ein langer Weg.
[Tareq erzählt von seiner von Schleusern organisierten gefährlichen Flucht über Meer und Land.]
Seitdem sei Deutschland seine zweite Heimat, sagt er: »Ich bin diesem Land immer dankbar …«. Die Monate nach seiner Ankunft seien für ihn eine sehr schwere Zeit gewesen, sagt Tareq, als er am Kanal entlangläuft. Auch heute falle es ihm nicht leicht. Er habe die Bilder von der Flucht immer wieder im Kopf, Bilder von Kindern etwa, die unterwegs ertrunken sind: »Ich erinnere mich an alles, was passiert ist. Dann bekomme ich große Kopfschmerzen und manchmal weine ich. Dann komme ich hier zum Kanal.«
Manchmal kämen auch die Erinnerungen an die Zeit vor der Flucht hoch, an den Irakkrieg und die Bomben. Auch das Haus von Tareqs Familie in Baschiqa wurde bei einem Angriff zerstört. Bei dem Gedanken daran reibt er sich mit einer Hand durchs Gesicht und zieht die Nase hoch. Trotzdem blieben er und seine Familie in der Nähe seiner Heimatstadt, bis der IS* die Region einnahm und sie noch weiter in Richtung Norden fliehen mussten. »Dort hatten wir eine richtig schwere Zeit. Zu zehnt haben wir in einer Wohnung mit drei Zimmern gewohnt, für ein Jahr.« Wegen der Flucht
mussten er und seine Geschwister damals die Schule verlassen. Er habe große Angst vor der Zukunft gehabt, erzählt Tareq, und daraufhin beschlossen, vor dem Krieg in seiner Heimat und der Perspektivlosigkeit nach Deutschland zu fliehen, alleine, ohne seine Familie.
Hier in Deutschland vermisst Tareq seine Familie mehr als alles andere. Als er entschied zu gehen, konnte er sie nicht dazu bewegen mitzukommen: »Sie hatten zu große Angst.« Beim Abschied habe er versucht, sich seine eigene Angst nicht anmerken zu lassen. »Meine Mutter und meine Oma haben mich lange umarmt und geweint. Als mein Vater, mein Bruder und mein Cousin kamen, war ich sehr, sehr traurig. Aber ich musste mich normal verhalten, damit sie sich nicht noch mehr Sorgen machen.«
Auf dem Weg durch das Hansaviertel kauft Tarek an einem Kiosk Kaffee. Er denkt über das Wort Zuhause nach. »Die Freiheit und Gesellschaft hier sind für mich Zuhause«, sagt er. Vor allem Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung fehlen ihm im Irak.
»Hier in Deutschland bin ich frei von Angst, ich kann sein, wie ich bin«, sagt Tareq. »Weil ich glauben, sagen und machen kann, was ich will.« Dann verschwinden seine Lachfältchen noch einmal. »Aber ich kann meine Familie nicht vergessen.« Zuhause sei für ihn vor allem der Ort, an dem seine Familie ist, »egal, wo das ist«, sagt er auf dem Weg zurück zum Hafen und stemmt die Hände tief in die Hosentaschen. Er zögert bei den nächsten Worten. »Wenn ich sie nicht bald treffen kann, muss ich zurückgehen.«
Tareq hat zwar mittlerweile einen unbefristeten Aufenthaltsstatus in Deutschland, aber er hat keinen Pass, mit dem er verreisen kann. Genauso wenig können seine Eltern und Geschwister zu ihm kommen und ihn hier, in seinem Leben in Freiheit, besuchen. Dass er für ein besseres Leben die Nähe zu seinen Liebsten opfern musste, das lässt ihn gefangen zurück.

Freiheit kann man nicht eingrenzen, Freiheit muss man ausatmen.
Freiheit, Freiheit
Ist das Einzige was zählt […].
Freiheit bedeutet sein wie ich bin, Freiheit heißt für mich Fehler machen wie'n Kind.
Und wenn's sein muss, fall ich halt hin.
Doch ich steh wieder auf, Freiheit heißt: Zöger‘ nicht, sondern lauf.
Wenn du weißt, was du willst, dann tu es, wenn nicht, dann tust du es auch.
Freiheit bedeutet frei sprechen, frei machen, frei bleiben,
Mauern, die die Angst vorm Versagen errichtet, einreißen, Mut haben.
Freiheit bedeutet auch zu enttäuschen, sich selbst zu erfüllen,
Anstatt die Erwartungen von anderen Leuten.
Freiheit heißt auch Entscheidungen treffen.
Freiheit heißt, hin und wieder sich die Freiheit zu nehmen, die Meinung zu wechseln.
Freiheit heißt, es macht manchmal auch Sinn, Dass meine Freiheit da enden muss, wo die Freiheit eines Anderen beginnt.
aus einem Song von Curse
ENDLICH FREI?
1. »Endlich 18!« – Formulieren Sie in einem Brainstorming eigene Erwartungen an den 18. Geburtstag und die Zeit danach.
2. Arbeiten Sie aus Text und Gestaltung der Glückwunschkarten ( S. 106) Freiheitsversprechen heraus, die mit der Volljährigkeit verbunden werden, und vergleichen Sie sie mit Ihren Erwartungen sowie den Erfahrungen von 18-Jährigen (rechts).
3. Wählen Sie aus dem Lied von Curse eine Aussage heraus, die Sie anspricht, und gestalten Sie daraus eine eigene Glückwunschkarte.
4. So frei wie Pippi Langstrumpf möchten wohl viele Kinder sein. Identifizieren Sie Freiheitsmotive im Buchcover. Erzählen Sie einander von Ihren Freiheitsheldinnen und -helden der Kindheit.

»[Manche] freuen sich, dass sie jetzt Alkohol kaufen können – ich trinke aber nur selten. Wenn man ehrlich ist, hat man ja vieles in die Richtung auch schon gemacht, bevor man 18 wurde – und freut sich am Geburtstag dann nur noch, dass es legal wird.«
»Ich dachte lange, der 18. würde eine richtige 180GradWendung ins Leben bringen. Ganz so war es nicht. Ich wurde schon lange erwachsen behandelt, weil ich erwachsen aussehe. An der Kasse werde ich beispielsweise nur sehr selten nach meinem Ausweis gefragt. Eine neue Freiheit habe ich vor allem gespürt, als ich meinen ersten Flug alleine gebucht habe. Ich kann jetzt hingehen, wo ich will und ich brauche niemanden dafür! Ich habe mir auch schon ein Tattoo stechen lassen, da musste ich natürlich auch niemanden vorher um Erlaubnis fragen, das ist cool.«
»Mit 16, 17 konnte ich nur mit Muttizettel feiern gehen und war immer darauf angewiesen, dass mich jemand abholen kann. Alle sehen einen immer als kindlich und unreif an, auch wenn man schon fast 18 ist. Das ist von einem auf den anderen Tag ganz anders, man wird ganz anders wahrgenommen und gerade feiern gehen mit 18 oder so – da würde man die Freiheit schon merken. Ich habe richtig Lust, in Berlin feiern zu gehen, sobald das nach Corona wieder geht! Nach dem Abi will ich mit meinen Freunden reisen und einen Freiwilligendienst im Ausland machen.«
Aus einem Jugendmagazin
Jean-Paul Hoffmann, aus der Bilderserie »Überleg ungen zur Freiheit« 2006 (Mitte), 2007 (oben), 2018 (unten)


»Ich habe genug Geld, um mein Leben nach meinen Wünschen zu gestalten.
»Ich kann denken, was ich will.
»Ich kann etwas rückgängig machen.
»So oder so? Ich muss mich entscheiden.
»Bin das wirklich ich, die entscheidet?
»Ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern, auch wenn sie unbequem ist.
»Ich lasse mich nicht verbiegen.

1. Lesen Sie die Reportage auf S. 107 und tauschen Sie sich über erste Eindrücke aus. Informieren Sie sich über politische und historische Hintergründe von Tareqs Geschichte und sammeln Sie Fragen, die Sie ihm stellen möchten.
2. Ist Tareq nun frei? Arbeiten Sie aus dem Text Erfahrungen von Freiheit und Unfreiheit heraus.
3. Deuten und vergleichen Sie, wie J.-P. Hoffmann in seiner Bilderserie Freiheit (und Unfreiheit) gestaltet. Beziehen Sie die Bilder auf Tareqs Geschichte und auf eigene Erfahrungen.
4. Der Begriff Freiheit wird in unterschiedlichen Bedeutungen und Zusammenhängen gebraucht. Beginnen Sie mithilfe der Wordcloud und der Materialien von S. 106– 109 sowie Lexikoneinträgen eine Mindmap, die Sie im Laufe des Kapitels inhaltlich weiter füllen und differenzieren können.

Echte Zufriedenheit und Glückseligkeit kann man mit Geld allein wahrscheinlich nicht kaufen. Aber wie sieht es mit Freiheit aus? Klar, man kann diese Frage nicht allgemeingültig beantworten, da jeder Mensch Freiheit anders definiert. Es gibt aber ein paar Aspekte, die fast alle Menschen teilen. Was also ist Freiheit, die durch Geld ermöglicht wird?
Ganz einfach: Im Grunde ist es die Summe der Möglichkeiten, die du hast, und die du ohne Geld eben nicht hättest. Nehmen wir deine Gesundheit. Sie ist sicherlich mehr wert als alles Geld, aber nur mit den passenden Finanzen hast du die Möglichkeiten schneller und meist auch besser behandelt zu werden. Drei Monate den Job pausieren, um die Welt zu bereisen ohne das nötige Kleingeld …? Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Was auch immer du vorhast, du musst es nicht tun, aber du könntest es – das ist Freiheit.
Du kannst deine finanzielle Freiheit natürlich auch auf andere Menschen übertragen und ihnen mit deinem Geld helfen. Ganz gleich, ob du an eine Organisation spendest oder einen Freund unterstützt. Wenn wir also sagen, Freiheit ist immer die Summe der Möglichkeiten, die du hast, dann trifft es in vielen Fällen zu: Dann kann man sich Freiheit mit finanzieller Unabhängigkeit kaufen.
Aus einer Werbung für eine Geldanlage-App
1. Formulieren Sie Sätze mit den Wörtern »ich« bzw. »mein«, »Geld« und »Freiheit«. Tauschen Sie sich darüber aus und vergleichen Sie sie mit den Zitaten (rechts unten).
2. Recherchieren Sie nach Ratgebern zum Thema »Geldanlage«. Überprüfen Sie, welche Rolle der Gedanke der Freiheit in Aufmachung und Inhalt spielt. Recherchieren Sie auch nach Werbeanzeigen, die mit dem Freiheitsmotiv arbeiten, und analyisieren Sie die dort gegebenen Freiheitsversprechen.
3. Beschreiben und deuten Sie das Gemälde »Gekaufte Freiheit« (oben).
4. Diskutieren Sie über die Positionen, die in den beiden Texten zum Ausdruck kommen.
GELDFREI LEBEN?
Der Aktivist Tobi Rosswog äußert sich in einem Interview: Zweieinhalb Jahre habe ich radikal geldfrei gelebt, um Erfahrungen und Perspektiven außerhalb von Verwertungslogik, Leistungsdruck und Selbstoptimierungswahn zu machen. Aktuell lebe ich nur noch geldfreier. Das heißt ich gebe lediglich für zwei Dinge ein wenig Geld aus: Zum einen für die Warmmiete zur Finanzierung eines Projekt und Gemeinschaftshauses. Und zum anderen für die Krankenversicherung. Welche positiven Veränderungen gibt es, wenn Geld keine Rolle mehr spielt?
Das Leben ohne Geld oder Tauschlogik bewirkt zum einen eine Befreiung – wenn diese Lebensweise selbstbestimmt gewählt ist. Zum Beispiel befreit sie von Bürokratie. Außerdem überwindest du damit die klassischen Rollen von Verkäufer*in und Konsument*in. Somit kannst du Menschen wieder auf einer menschlichen Ebene begegnen. Und vor allem ist geldfrei(er) zu handeln das Nachhaltigste, was du tun kannst, weil du keine weitere finanzielle Nachfrage für Angebote schaffst, die ohnehin schon in Hülle und Fülle vorhanden sind.
»Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach!
(Mk 10,21 b)
»Geld ist geprägte Freiheit.
(Fjodor Michailowitsch Dostojewski)
»Der Preis, den wir für das Geld bezahlen, ist die Freiheit.
(Robert Louis Stevenson)
»Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit, dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft.
(Jean-Jaques Rousseau*)

Das Grundgesetz kennt keine ausdrückliche Bestimmung über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Aus dem Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar« und aus den Garantien der Grundrechte kann man erkennen, dass unsere Verfassung von der Freiheit und dem »Eigenwert« der einzelnen Person ausgeht. Diese ist jedoch nicht »isoliert«, sondern »gemeinschaftsbezogen und gemeinschaftsgebunden«, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Die im Menschenwürde Satz ausgesprochene Verpflichtung »aller staatlichen Gewalt« (z. B. der Richter, Polizisten und Abgeordneten), die Menschenwürde zu »achten und zu schützen«, bedeutet einerseits die Wahrung der individuellen Freiheit in allen ihren Formen, andererseits aber auch die Pflicht des Staates, Schutzmaßnahmen gegen Angriffe durch Dritte (Kriminelle, Terroristen) zugunsten aller Bürgerinnen und Bürger vorzukehren, kurz: für Sicherheit zu sorgen.
Neue Balance
Seit dem 11. September 2001 und den nachfolgenden islamistischen Terroranschlägen ist vielerorts die Rede davon, das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit müsse neu ausbalanciert werden. Auch das Bundesverfassungsgericht erkennt die Befugnis des Gesetzgebers an, die traditionellen rechtsstaatlichen Bindungen des Polizeirechts (z. B. klare Ermächtigungen durch Gesetz, richterliche Vorbehalte für Durchsuchungen) jeweils nach den Erkenntnissen neuartiger Gefährdungsund Bedrohungssituationen fortzuentwickeln. Die
Balance zwischen Freiheit und Sicherheit darf vom Gesetzgeber »neu justiert, die Gewichte dürfen jedoch von ihm nicht grundlegend verschoben werden«. Kein fester Wechselkurs
Zu den Zielen der Europäischen Union gehört es, ihren Bürgerinnen und Bürgern »einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« zu bieten. Doch hat dieser Raum keine feststehenden Wände, keine ausmessbaren Grenzen. Ähnlich wie »Freiheit« oder »soziale Gerechtigkeit« benennt »Sicherheit« ein elementares Grundbedürfnis des Menschen, bildet aber keinen klar definierten oder definierenden Begriff. Eher mag man von einem nie ganz erfüllbaren Verfassungsideal sprechen, das allerdings zur Legitimation eines schrankenlosen, ungebremsten staatlichen Aktionismus ge oder auch missbraucht werden kann. »Sicherheit« ist in sich maß und grenzenlos; sie bietet keinen Maßstab. Zwischen Sicherheit und Freiheit existiert kein fester Wechselkurs, zu dem die eine in die andere zu tauschen wäre. Welchen Kurs die Freiheit behalten wird, die wir nicht aufgeben wollen, wird allerdings nicht zuletzt von den uns noch bevorstehenden TerrorErfahrungen abhängen.
Erhard Denninger, Staatsrechtler
1. Erschließen Sie die Grundaussagen des Textes von E. Denninger und gestalten Sie diese grafisch.
2. Beschreiben und deuten Sie das Graffito (links). Entwerfen Sie eigene Graffiti, die für mehr Freiheit oder auch für mehr Sicherheit werben.

3. Suchen Sie Beispiele für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen beim Ausbalancieren von Freiheit und Sicherheit in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Diskutieren Sie eine ausgewählte Fragestellung.
4. Auch im privaten Bereich gibt es »kein[en] feste[n] Wechselkurs« zwischen Freiheit und Sicherheit. Tauschen Sie sich über Beispiele aus.
Politische Fassadengestaltung eines Jugendzentrums in Tübingen (Ausschnitt)
BeMERKenswert: Balancieren braucht Kraft.
Die Qual der Wahl: Sachertorte oder Käsekuchen? Urlaub in der Karibik oder Hüttentour in den Bergen? Aussteigerleben oder Karriereturbo? Wir entscheiden uns für Berufe, Hobbys und Partner, gegen Wohnorte, Familienpläne und Parteien. Wir wählen Lebensentwürfe und Laufbahnen, Glaubensrichtungen und Identitäten. Mit der Formel im Kopf: Auswahl = Freiheit = Zufriedenheit.
Doch oft genug spüren wir, dass diese Gleichung nicht aufgeht. So mancher erstarrt in einem Zustand der Unverbindlichkeit: vielleicht spontan, mal sehen, je nachdem. Sind die Würfel gefallen, beginnt das große Hadern. Hätte ich nicht gesollt? Was wäre, wenn?
Du hast die Wahl: mach was draus!
Diese Zweifel überfallen uns nicht ohne Grund. Entscheiden ist schwer und war vielleicht nie schwerer als heute. Wir haben unzählige Möglichkeiten vor Augen und die Last der Verantwortung auf unseren Schultern. Das setzt unter Druck. Was also hilft dabei, sich nicht in Grübelschleifen zu erschöpfen und in ProundKontraListen zu verzetteln? Vielleicht: das Wesen der Entscheidung und ihre Rahmenbedingungen besser zu verstehen.
Denn »die Entscheidung, die sowohl in ihrer Gegenwart als auch in ihrer Abwesenheit von trivial bis lebensverändernd reicht, ist ein untrennbarer Teil unserer Lebensgeschichte«, schreibt die Psychologin Sheena Iyengar in ihrem Buch »The Art of Choosing«. Überall warten Entscheidungen
Rund 20 000 Entscheidungen treffen wir pro Tag. Die meisten von ihnen handeln wir ab, ohne weiter darüber nachzudenken – rechts oder links ausweichen, Schinkensandwich oder Käsebrezel bestellen, Nachricht tippen oder anrufen?
In diesen Strom aus Alltagsentschlüssen mischen sich auch schwerwiegendere Fragen.
Etwa die Entscheidung, welchen Partner wir wählen, wie Angehörige im Pflegefall betreut werden sollen, welchen Karriereweg wir beschreiten oder ob der Kontakt zu Familienmitgliedern abgebrochen werden darf. Antworten auf diese Fragen müssen wir meist selbst finden – anhand von Fakten, Werten, Erfahrungswissen und Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.
Moderne Bastelbiografien
Haben früher Milieus, Normen und Traditionen die
Werk der anonym agierenden
Richtung gewiesen, bahnen wir uns heute einen eigenen Weg durch das Dickicht an Möglichkeiten. »Chancen, Gefahren, Unsicherheiten der Biografie, die früher im Familienverbund, in der dörflichen Gemeinschaft, im Rückgriff auf ständische Regeln oder soziale Klassen definiert waren, müssen nun von den Einzelnen selbst wahrgenommen, interpretiert, entschieden und bearbeitet werden«, schrieben die Soziologen Elisabeth BeckGernsheim und Ulrich Beck schon im Jahr 1994 in einem Aufsatz. Die Normalbiografie werde zur »Wahlbiografie«, zu einer »Bastelbiografie« und somit auch zur »Risikobiografie«. Alles sei bis ins Kleingedruckte hinein entscheidbar, der Mensch werde folglich zur Wahl seiner Möglichkeiten, zum Homo Optionis. Lisa
Auffenberg1. »Ich muss meine Freiheit aushalten«: Erzählen Sie einander von Situationen, die zu der Schildercollage oben passen.

2. Erinnern Sie sich an eine Entscheidung, die Sie getroffen haben. Notieren Sie: Was hat dabei den Ausschlag gegeben? Wer oder was hat mir geholfen? Wie ging es mir hinterher damit? Prüfen Sie, welche der Aussagen des Textes auf Ihre Entscheidung zutreffen.
3. »Normalbiografie«, »Wahlbiografie«, »Bastelbiografie«, »Risikobiografie«: Diskutieren Sie diese Begriffe im Blick auf das Thema Freiheit.
Erstens: Wir sind mit dem Internet und im Internet aufgewachsen. Wir benutzen das Internet nicht, wir leben darin und damit. Wir haben online Freunde und Feinde gefunden, wir haben online unsere Spickzettel für Prüfungen vorbereitet, wir haben Partys und Lerntreffen online geplant, wir haben uns online verliebt und getrennt.
Die Fähigkeit, Informationen zu finden, ist für uns so selbstverständlich wie für frühere Generationen die Fähigkeit, einen Bahnhof oder ein Postamt in einer unbekannten Stadt zu finden. Wir wissen, dass wir die benötigten Informationen an vielen Stellen finden werden, und wir können ihre Glaubwürdigkeit beurteilen. Wir haben gelernt zu akzeptieren, dass wir statt einer Antwort viele verschiedene Antworten finden, und aus diesen abstrahieren wir die wahrscheinlichste Version und ignorieren die unglaubwürdigen. Wir müssen keine Experten in allem sein, denn wir wissen, wie wir Menschen finden, die sich auf das spezialisiert haben, was wir nicht wissen, und denen wir vertrauen können. Menschen, die ihre Expertise nicht für Geld mit uns teilen, sondern wegen unserer gemeinsamen Überzeugung, dass Informationen ständig in Bewegung sind und frei sein wollen, dass wir alle vom Informationsaustausch profitieren.
Zweitens: Die globale Kultur ist der Sockel unserer Identität, wichtiger für unser Selbstverständnis als Traditionen, sozialer Status, die Herkunft oder sogar unsere Sprache. Aus dem Ozean der kulturellen Ereignisse fischen wir jene, die am besten zu uns passen, wir treten mit ihnen in Kontakt, wir bewerten sie und wir speichern unsere Bewertungen auf Websites, die genau zu diesem Zweck eingerichtet wurden und die uns außerdem andere Musikalben, Filme oder Spiele vorschlagen, die uns gefallen könnten. Einige dieser Filme, Serien oder Videos schauen wir uns gemeinsam mit Kollegen an, oder aber mit Freunden aus aller Welt, denen wir vielleicht niemals persönlich gegenüberstehen werden. Das ist der Grund für unser Gefühl, dass Kultur gleichzeitig global und individuell wird. Das ist der Grund, warum wir freien Zugang dazu brauchen. Drittens: Die Gesellschaft ist für uns ein Netzwerk, keine Hierarchie. Wir sind es gewohnt, das Gespräch mit fast jedem suchen zu dürfen, sei er Journalist, Bürgermeister, Universitätsprofessor oder Popstar, und
wir brauchen keine besonderen Qualifikationen, die mit unserem sozialen Status zusammenhängen. Der Erfolg der Interaktion hängt einzig davon ab, ob der Inhalt unserer Botschaft als wichtig und einer Antwort würdig angesehen wird. Was uns am wichtigsten ist, ist Freiheit. Redefreiheit, freier Zugang zu Information und zu Kultur. Wir glauben, das Internet ist dank dieser Freiheit zu dem geworden, was es ist, und wir glauben, dass es unsere Pflicht ist, diese Freiheit zu verteidigen. Das schulden wir den kommenden Ge nerationen, so wie wir es ihnen schulden, die Umwelt zu schützen. Wahrscheinlich ist das, was wir wollen, eine wahre und tatsächliche Demokratie.
Piotr Czerski, polnischer Dichter, Autor, Musiker und Ex-Blogger
Diese 2021 veröffentlichte Denkschrift* der EKD reflektiert, ausgehend von den Zehn Geboten, den Umgang mit dem Internet.
Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels

1. Geben Sie den drei Abschnitten des Textes passende Überschriften, in denen der Begriff Freiheit vorkommt.
2. Diskutieren Sie, ob die Aussagen des Textes für Sie zutreffen.
3. In der 9. Jahrgangsstufe haben Sie sich mit den Chancen und Gefahren der Digitalisierung beschäftigt. Sammeln Sie Beispiele, wie die Freiheit im Internet auch in ihr Gegenteil umschlagen kann, und formulieren Sie Anfragen an P. Czerski (z. B. in einem Forum).
4. Deuten und bewerten Sie das Cover der EKDDenkschrift. Lesen Sie ggf. Abschnitte daraus.
• »Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft« (Dtn 5,6). Die Präambel des Dekalogs fasst die Ursprungserzählung Israels und damit die wesentlichen Elemente alttestamentlichen Glaubens zusammen: die dankbare Erinnerung, von Gott aus der Sklaverei befreit worden zu sein; die treue Verbundenheit zwischen diesem (einzigen) Gott der Freiheit und seinem Volk; die Einsicht, dass Freiheit immer gefährdet ist (zu den »Rückfällen« in der Wüste vgl. S. 15); vor allem aber die Verpflichtung, in dieser Freiheit zu leben, in Frieden miteinander und in Solidarität mit den Schwachen [5], [8]
• Historisch bleiben die in Ex bis Dtn geschilderten Ereignisse im Dunkeln. Womöglich gab es einen Auszug einer kleinen Gruppe, sicher aber nicht eines ganzen Volkes aus Ägypten. Relevant wurde die Exodustradition erst in den großen Krisen Israels, dem Untergang des Nordreichs (722 v. Chr.) und des Südreichs (586 v. Chr.) sowie dem babylonischen Exil*. Die Erinnerung an die Befreiung aus Äg ypten half dabei, die erlebten Katastrophen selbstkritisch zu reflektieren und eine eigene jüdische Identität zu entwickeln.
• Im jüdischen Talmud heißt es: »In jeder Generation muss man sich so betrachten, als wäre man selbst aus Ägypten ausgezogen«. Der Exodus – jährlich im Pessachfest vergegenwärtigt – wird zum Modell für jede Erfahrung der Unterdrückung und für die Hoffnung auf Befreiung und Erlösung [9]
All die Szenen, wie Israel zu seiner Freiheit und zum Ort seiner Bestimmung gelangt, sind Bilder und Stationen des Prozesses, den ein jeder von uns durchlaufen muss, um sich selbst zu finden. Alles, was Israel in seiner äußeren Geschichte durchgemacht hat, sind typische Marksteine auf dem inneren Weg eines jeden Menschen, der endlich einen eigenen Grund und Boden unter die Füße bekommt.
Aber der Weg dahin ist lang. Keine Station kann dabei überschlagen werden. In jeder finden wir uns wieder. Eugen Drewermann
Vielleicht wird dich dein Kind einmal fragen: »Was soll das alles, diese ganzen Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen? Warum hat der HERR, unser Gott, sie uns befohlen?« Wenn dein Kind so fragt, sollst du ihm antworten: »Wir waren Sklaven in Ägypten und mussten für den Pharao arbeiten. Aber der HERR hat uns aus Ägypten geführt – mit seiner starken Hand.
Dtn 6,20 f. (BasisBibel)
1. Das surrealistische Bild von W. Lettl (oben) lädt zum Phantasieren ein. Sammeln Sie Assoziationen und überlegen Sie, wie diese zum Bildtitel »Exodus« passen.

2. Wiederholen Sie wichtige Stationen der ExodusÜberlieferung (orientieren Sie sich an den Überschriften in Ex bis Dtn); beziehen Sie auch S. 15 mit ein.
3. Identifizieren Sie, ausgehend von den Aussagen J. Assmanns und J. Rosens ( S. 115), Motive von Freiheit und Unfreiheit, Gewalt und Humanität in ausgewählten Texten der Exodus-Erzählung.
4. Suchen Sie nach Beispielen aus Familie und Gesellschaft dafür, wie Erinnerungen zu Deutemodellen und Orientierungshilfen für die eigene Lebensführung werden können.
5. Informieren Sie sich über die von J. Assmann aufgeführten Befreiungsbewegungen. Hören Sie sich entsprechende Spirituals und Gospels an (z. B. »Oh Freedom«, »When Israel was in Egypts Land«).
6. Deuten Sie das Cover von J. Assmanns Exodusbuch ( S. 115).
7. Versuchen Sie, E. Drewermanns psychologische Deutung (links) auf Ihre eigene Lebenssituation und Ihre eigenen Zukunftspläne zu beziehen.
BEFREIUNG, GEWALT, HUMANITÄT
Anlässlich des Erscheinens seines Buches »Exodus« wurde der Ägyptologe Jan Assmann von dem Journalisten Philipp Gessler interviewt; hier ein Auszug: P. Gessler: Die Wirkungsgeschichte der Exodus-Erzählung ist enorm. Viele Bewegungen, auch viele politische Bewegungen, haben sich auf die Exodus-Erzählung berufen.
J. A ssmann: Ja, natürlich – »Let my people go!« Das fängt am deutlichsten an mit der puritanischen* Revolution in England, der Auswanderung der Pilgrim Fathers* nach Amerika, die sich nun wirklich als das neue auserwählte Volk gefühlt haben und Amerika als das neue gelobte Land sahen. Und das zieht sich durch die gesamte amerikanische Geschichte. Exodus wird zum Gründungsmythos der Vereinigten Staaten, und die ersten Präsidenten werden als neuer Moses gefeiert, die werden in diese Tradition gestellt. Aber das gilt auch für die Buren*, als sie nach Südafrika zogen, auch ganz im Bewusstsein, als neues auserwähltes Volk in ein neues Kanaan aufzubrechen, mit dem Auftrag, die dort wohnenden Ureinwohner zu vertreiben und umzubringen – das ist eben die Schattenseite dieser Überlieferung. Ja, und dann aber sind es wiederum die Sklaven der Südstaaten, die diese Überlieferung der Befreiung, der Auswanderung nun zu ihrem Programm machen. Da wäre noch die Befreiungstheologie* zu nennen in Südamerika, und auch die Trauer um Nelson Mandela*, der als ein neuer Moses gefeiert wurde. Aber es bleibt dabei, dass mit dieser Exodus-Erzählung immer auch Gewalt mit einhergeht?
So ist es.
Auf der anderen Seite beschreiben Sie in Ihrem Buch, dass die Exodus-Geschichte neben dieser, sagen wir mal, Gewaltgetränktheit auch etwas mit Humanität zu tun hat. Ja , das finde ich besonders eindrucksvoll. Also, in Ex 23, da begegnet der Vers: »Den Fremden sollst du nicht unterdrücken, denn du kennst die Seele des Fremden, da du ja selbst ein Fremdling in Ägypten warst.« Das finde ich sehr bemerkenswert, das ist eine Definition von Empathie. Und dass das an einer so zentralen Stelle steht, also man zieht aus der Unterdrückung in Ä g ypten nicht etwa die Lehre der Rache, also den Ägyptern werden wir es heimzahlen oder so, sondern man zieht daraus die Lehre der Humanisierung, des Mitleids, der Empathie mit den Armen, den Verfolgten, den Fremden, den Unterprivilegierten.

Schon vor 2.000 Jahren entschieden die Rabbiner, dass wir die Freude über unsere Freiheit dämpfen müssen, gerade weil unsere Freiheit anderen Menschen Leid bringen kann. Deshalb vergießen wir beim PessachMahl bis auf den heutigen Tag etwas Wein aus unserem Glas, immer wenn die Rede auf das Leiden anderer kommt, und wir beschränken die Anzahl der Psalmen, die wir zum Preis Gottes, der uns befreit hat, singen, weil Ägypter dabei umkamen.
Der Midrasch* lehrte uns auch, dass nichts jemals schwarz und weiß ist; deshalb ist es so wichtig, stets die andere Seite zu sehen. Zu viele von uns sind noch immer in dem unerträglichen Strudel von Gewalt und Rohheit gefangen, in einem Konflikt, der daraus entsprang, dass zwei Völker die gleiche Heimat beanspruchen. Nichts beleidigt meine jüdischen Werte mehr, als wenn ich höre, wie auf beiden Seiten Hass ausgespien wird – umso mehr, wenn er den sittlichen Werten, für die wir stehen, diametral widerspricht. Viele Muslime und Christen empfinden das Gleiche, wenn sie hören, wie ihre Friedens und Liebesreligionen sich in Dogmen des Hasses verwandeln.
R abbiner Jeremy Rosen
• Die Freiheitsrechte der Menschenrechte begrenzen den staatlichen Einfluss auf bestimmte Bereiche des menschlichen Lebens (Abwehrrechte) und ermöglichen jeder Person gesellschaftliche Teilhabe (Mitwirkungsrechte). Die wichtigsten Freiheitsrechte sind: Diskriminierungsverbot, Recht auf Leben, Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung, Verbot der Sklaverei, Gedankenund Religionsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Vereinigungs und Versammlungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre und des Familienlebens, Recht auf ein faires Gerichtsverfahren.
• Im 18 Jh. entstanden die ersten umfassenden Menschenrechtserklärungen: die Virgina Bill of Rights von 1776 und die französische Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers von 1789. 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNO) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der u. a. die obengenannten Freiheitsrechte enthalten sind. In der Europäischen Menschenrechtskonvention (1951) sowie im Internationalen Pakt der UNO über bürgerliche und politische Rechte (1966) wurden diese Rechte international verbindlich.
AnMERKung: Die Freiheit der Anderen – Grenze und Bereicherung
Für aufgeklärte Menschen ist ohne Weiteres einsichtig, dass man jedem Mitglied der Gemeinschaft ebenso viel Freiheit zugestehen muss, wie man für sich selbst fordert. Jeder hat das Recht auf die gleiche Freiheit, und wo immer Freiheit eingeschränkt wird, muss dies um der größeren Freiheit aller willen geschehen. Dies bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Allgemeinheit. Individuelle Freiheit und kollektive Freiheit bedingen einander wechselseitig. Einer allein kann nicht frei sein. In einer Gemeinschaft von Unfreien ist auch der Einzelne nicht frei. Die Selbstbegrenzung der Freiheit aus Freiheit und um der Freiheit aller willen findet ihren Niederschlag in den Normen der Moral des Rechts, die in Form ungeschriebener oder geschriebener Gesetze menschliches Handeln an Regeln binden und damit die Gesamtheit möglicher Freiheiten im Hinblick auf den legitimen Freiheitsanspruch jedes Individuums einschränken.
Annemarie Pieper, Philosophin
1. Identifizieren und erläutern Sie Freiheitsrechte im deutschen Grundgesetz.
2. Informieren Sie sich über Konzeption und Anliegen der Straße der Menschenrechte in Nürnberg (links). Machen Sie ggf. eigene Fotos.
3. Vergleichen Sie das Freiheitsverständnis A. Piepers mit der Plakatwand (unten).


4. Sammeln und diskutieren Sie Beispiele, bei denen die von A. Pieper beschriebene Begrenzung von Freiheit zu Konflikten führt.

In einem Urteil vom 29. April 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz von 2019 nachbessern muss, um die Freiheit kommender Generationen zu schützen. Das Bundesverfassungsgericht hat ein »epochales« Urteil zum Klimaschutz gefällt. Dabei liegt der Entscheidung ein Freiheitsbegriff zu Grunde, der den politischen Diskurs* der kommenden Jahre massiv prägen dür fte. Dass das Bundesverfassungsgericht die aktuellen Klimaschutzziele im Endeffekt als, salopp gesagt, zu lasch und unkonkret aburteilte, begründete es nämlich wie folgt: Da Deutschland sich gemäß dem Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet hat, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, sind die Regelungen des aktuellen Klimaschutzgesetzes insofern nicht ausreichend, als dass sie »hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030« verschieben. Die nach 2030 erforderlichen Minderungen müssten »dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden«. Und da von diesen Maßnahmen »praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen« wäre, »weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden« sind, wären die »zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden« in der Zukunft »durch die angegriffenen
1. Interpretieren und diskutieren Sie die Karikatur. Entwerfen Sie ein Gespräch zwischen Eltern und Kind.
2. Informieren Sie sich über das Urteil des BVerfG und recherchieren Sie, wieweit es schon umgesetzt wurde.
3. Erläutern Sie den im Text beschriebenen Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Freiheit an Beispielen.
4. Auch Gegner und Gegnerinnen der Maßnahmen gegen Klimaschutz [10] berufen sich auf Freiheit und sprechen z. B. von einer »Klimadiktatur«. Verfassen Sie dazu ein Statement auf der Basis der Materialien dieser Doppelseite.
Bestimmungen [...] in ihren Freiheitsrechten verletzt.« Damit macht sich das Gericht einen Freiheitsbegriff zu eigen, den der Philosoph Claus Dierksmeier in seinem 2016 erschienenen Buch Qualitative Freiheit auf den Begriff gebracht hat. Dierksmeier differenziert zwischen quantitativer und qualitativer Freiheit. Ein quantitatives Freiheitsverständnis zielt vor allem auf die Erhöhung subjektiver Präferenzen sowie die Minderung persönlicher Einschränkungen ab. Liegt diesem die Maßgabe »je mehr, desto besser« zugrunde, geht es also, zugespitzt gesagt, darum, dass der Einzelne möglichst das machen kann, was er möchte. Im Extremfall wäre das jener AuspuffLiberalismus, der sich im Wesentlichen in einer »freie Fahrt für freie Bürger«Ethik erschöpft. Ein qualitativer Freiheitsbegriff folgt hingegen dem umgekehrten Motto: »je besser, desto mehr«. Bei ihm geht es also nicht »nur« um die Erhöhung individueller Wahlmöglichkeiten, sondern vor allem auch um die wechselseitige Verbesserung von Lebenschancen. Hat die qualitative Freiheit also immer ein Abwägen von Freiheiten zum Ziel, um Letztere nicht nur einigen wenigen, sondern möglichst vielen zukommen zu lassen, so ist das genau jener Geist, den auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts atmet. Schließlich forderten die Karlsruher Richterinnen und Richter – de facto – ein höheres Maß an Klimaschutzregelungen ein, die den Einzelnen zwar womöglich punktuell einschränken können, die Freiheit vieler anderer – insbesondere künftiger Generationen – aber überhaupt erst ermöglicht. Oder umgekehrt formuliert: Wo ökologische Zerstörung herrscht, können die allermeisten Menschen nicht frei sein. Nils Marquardt

Arendts Vision hatte den unschätzbaren Vorzug, dass sie in Athen, »in der Frühzeit der abendländischen Geschichte«, schon einmal verwirklicht worden war. Gemeint ist die Polis*, die Gemeinschaft der Bürger in den Stadtstaaten, die sich »unvergessen der europäischen Menschheit eingeprägt hat«.
Warum die Polis? Weil das sprachbegabte Tier hier zum ersten Mal mit seiner Freiheit experimentiert und das macht, was nur Menschen können: einen Anfang. Die »Sterblichen« erproben, was es bedeutet, sich in einer gemeinsamen Welt zu orientieren, einander etwas zu versprechen und kollektiv zu handeln. Während sich im Haushalt alles um das Notwendige dreht, um das ÜberL eben, geht es im »Erscheinungsraum« der Polis um das GutL eben. Es gibt hier weder Herrscher noch Beherrschte; obwohl von Natur aus verschieden, sind alle Bürger gleich. Jeder mutet dem anderen die eigene Perspektive zu; jeder erprobt im Hin und Her der Meinungen die »erweiterte Denkungsart«. In seltenen Augenblicken erfahren die Polisbürger das Glück der Öffentlichkeit und das Wunder der pluralen Freiheit. Während des VietnamKrieges* und nach der Veröffentlichung der PentagonPapiere* fällt Hannah Arendt »im Arsenal der menschlichen Torheiten« etwas Neues auf. Nervös beobachtet sie, dass die US Regierung Methoden aus der Werbung einsetzt, sie spricht von imaging, von Bildermachen, von »Totalfiktionen«. Der Begriff FakeNews* fehlt ihr zwar, aber genau das meint Arendt, wenn sie Politikern vorwirft, sie würden Tatsachenwahrheiten zu Meinungen umlügen. Nicht nur, dass sie damit Orientierungssinn und Urteilsfähigkeit der Bevölkerung »vernichteten«; sie schafften Scheinwelten, in die die Bürger hineingelockt und in denen sie über die Wahrheit getäuscht würden. In dem Maß wie sich die Regierung der öffentlichen Einflussnahme entzieht, laufen die PolisEnergien der Bürger ins Leere, werden ins Private abgedrängt, die Zersplitterung der Gesellschaft wächst. In der Folge davon beginnen die Bürger an Gespenster oder – wie man heute sagt – an Verschwörungsideologien zu glauben: »Ein merkliches Abnehmen des gesunden Menschenverstandes und ein merkliches Zunehmen von Aberglauben deuten darauf hin, dass die Gemeinsamkeit der Welt abbröckelt.«
Thomas Assheuer»Freiheit und Gleichheit beginnen erst, wo die Lebensinteressen ihre Grenze haben und ihnen Genüge getan ist.
»Politisch zu sein, in einer Polis* zu leben, das hieß, dass alle Angelegenheiten vermittels der Worte, die überzeugen können, geregelt werden und nicht durch Zwang und Gewalt.
»Der irdische Raumvorrat ist aufgebraucht […]. Von der Freiheit der Menschen, von ihrer Fähigkeit, Unheil zu wenden, mag diesmal mehr abhängen als je zuvor, nämlich die Fortexistenz der Menschheit auf Erden.
FREIHEIT BEI HANNAH ARENDT
• Ein zentrales Thema im Lebenswerk von Hannah Arendt ist die Freiheit. Nach dem Vorbild der von ihr bewusst idealisierten antiken Polis* beschreibt sie Freiheit als politische Freiheit, die Welt in einer Gemeinschaft gleichberechtigter Personen denkend und handelnd mitzugestalten. Diese ist aber erst möglich auf der Basis der Befreiung von Zwang, sei es von staatlicher Willkür, von Sorge um das tägliche Überleben oder vom Beherrschtwerden durch Arbeit und Konsum. Diese Befreiung nennt sie »negative« bzw. »bürgerliche« Freiheit.
• Sosehr Freiheit für H. Arendt im Handeln besteht, so wichtig ist es ihr, die Grenzen des Handelns zu berücksichtigen, z. B. die Unantastbarkeit eines Gegenübers, die Anerkennung von Fakten oder die Eingebundenheit in die Natur.


Diese begriffliche Unterscheidung findet sich in einem außerordentlich einflussreichen Aufsatz von Isajah Berlin aus dem Jahre 1958, doch ist die Idee einer solchen Freiheit schon sehr viel älter. Mit negativer Freiheit bezeichnet Berlin solche Freiheitskonzeptionen, die Freiheit wesentlich als die Abwesenheit von Hindernissen und Beschränkungen begreifen, wie sie etwa vorliegen in den klassischen liberalen Ansätzen von Hobbes*, Locke* oder Mill*. Auch in zeitgenössischen Freiheitstheorien begegnen wir rein negativen Konzeptionen, wie etwa bei Hayek*, wenn er schreibt, Freiheit sei jener »Zustand der Menschen, in dem Zwang auf einige von seiten anderer Menschen so weit herabgemindert ist, als dies im Gesellschaftsleben möglich ist«.
Gegenüber einem solchen, rein formalen negativen Freiheitsbegriff als Abwesenheit von Zwang sehen Konzeptionen positiver Freiheit diese darin, bestimmte Optionen verfolgen zu können, bestimmte Fähigkeiten realisieren zu können bzw. ein selbstbestimmtes Leben führen zu können (klassisch etwa Rousseau*).

Positive Freiheit bedeutet folglich zunächst einmal, dass Personen die Kontrolle darüber haben, das machen zu können, was sie selbst als sinnvolle Option für sich begreifen, was Ausdruck ihres wesentlichen Selbst ist oder Ausdruck dessen, als welche Person sie sich verstehen wollen.
Nun hat jedoch Charles Taylor* gezeigt, dass sich beide Freiheitsbegriffe nicht gegenseitig auszuschließen brauchen: Wir können, so wendet er ein, über die Abwesenheit von Hindernissen nur reden – Welche sind wichtiger? Warum wollen wir gerade diese Einschränkungen nicht? –, wenn wir zugleich auch eine Vorstellung davon haben, was wir eigentlich mit der Freiheit wollen. Es ist also weder sinnvoll noch möglich, eine klare Grenze zwischen negativer und positiver Freiheit zu ziehen; negative Freiheit verweist immer auf positive und umgekehrt.
Wir schätzen also negative Freiheit, weil wir frei sein wollen, bestimmte Dinge zu tun, eine bestimmte Person zu sein, unser Leben auf unsere Weise leben zu wollen. Um dies erklären zu können, reicht ein negativer Begriff von Freiheit allein nicht aus. Beate Rössler, Philosophin
1. Diese Doppelseite ist mit dem Titel eines Essays von H. Arendt überschrieben. Erläutern Sie ihn mithilfe der Texte auf S. 118.
2. »Think like Arendt« ( S. 118) – begründen und diskutieren Sie die Aktualität von H. Arendts Freiheitskonzeption.
3 Entwerfen Sie Möglichkeiten für Jugendliche, im Raum der Schule, aber auch darüber hinaus, im Sinne von H. Arendt ( S. 118) politisch zu handeln.
4. Beziehen Sie die von B. Rössler erläuterte Unterscheidung bzw. Verschränkung von negativer und positiver Freiheit auf H. Arendts Ansatz ( S. 118).
5. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie sich selbst frei gefühlt haben. Untersuchen Sie, inwieweit hier »negative« bzw. »positive« Freiheit eine Rolle gespielt haben.
MERKwürdig – über »Freiheit von« redet sich’s leichter.
Nach Auffassung einiger Hirnforscher ist der freie Wille eine Illusion: Das, was als Wahlfreiheit erscheint, ist die Folge einer Hirnaktivität, die dem bewussten Willen vorausläuft.
Handelt es sich wirklich um eine freie Entscheidung, wenn einfach nur ein paar Millionen Neuronen interagieren?
Sie verwechseln Willens mit Handlungsfreiheit. Wenn Sie jemand fragt, warum Sie hier sitzen, antworten Sie: Weil ich das so will. Das ist Handlungsfreiheit. Anders aber ist es, wenn Sie fragen: Wer oder was bestimmt den Willen?
Wie lautet Ihre Antwort?
Die gab der Amerikaner Benjamin Libet* schon Anfang der Achtzigerjahre. Libet war Katholik. Er untersuchte im Detail, was bei einer einfachen Handbewegung im Gehirn vor sich geht, und wollte dabei die Willensfreiheit des Menschen beweisen. Das ging nach hinten los. Sein Experiment zeigte nämlich, dass der Bewegungsimpuls 300 Millisekunden vor dem Moment auftrat, in dem seine Probanden den Entschluss dazu fassten. Libet folgerte: Eine Willensfreiheit gibt es nicht. Wenn wir glauben, eine Entscheidung zu treffen, ist sie im Gehirn längst gefallen. Das gilt allerdings nur für solch einfache Bewegungen.
Das klingt, als wären wir von unserem Gehirn ferngesteuert. Nein – das Ich ist ja ein Teil des Gehirns. Was Libet gezeigt hat, erleben wir doch jeden Tag beim Autofahren. Außer Fahranfängern macht sich niemand groß Gedanken darüber, wann er in den zweiten Gang schaltet – wir tun es einfach. Trotzdem sagen wir: Ich war das. Nur bei komplexen Situationen oder Aufgaben müssen wir überlegen.
Wer oder was legt fest, wie sich die Neuronen in meinem Kopf nun verhalten?
Unser Verhalten wird durch drei Faktoren bestimmt: die Gene; die prägenden Erfahrungen in früher Kindheit; unsere spätere Erfahrung und Erziehung. Was wir bisher am meisten unterschätzt haben, ist die frühkindliche Prägung. Traumatische Erfahrungen in dieser Lebensphase können das Gehirn eines Kindes nachhaltig verändern und sind später nur noch schwer zu reparieren. Grundsätzlich aber bewirkt jede psychische Veränderung auch eine neuronale Veränderung im Gehirn. Sind S traftäter in der Regel also eher krank als böse? Klinisch gesehen, ja, und dies spricht dafür, dass sie im
»Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. »Ich konnte nicht anders.
»Die Freiheit nehm’ ich mir.
1. Tauschen Sie sich über die Redewendungen, die Karikatur und die Sprüche ( S. 121) sowie die darin zum Ausdruck kommenden Erfahrungen eines (un)freien Willens aus. Formulieren Sie hiervon ausgehend Thesen zum Verhältnis von Freiheit und Willen.

2. »Das gilt allerdings nur für solch einfache Bewegungen.« – Recherchieren Sie kritische Anfragen zum bekannten Libet-Experiment*.
3. Fassen Sie das Interview mit G. Roth* thesenhaft zusammen und diskutieren Sie mögliche Konsequenzen für das Strafrecht.
herkömmlichen Sinn nicht schuldig sind. Fast alle Diktatoren und Massenmörder waren als Kind auffällig. Sie litten, vielleicht genetisch bedingt, unter übermäßigem Egodrang und empfanden Beschämungen und Ausgrenzungen als unerträglich. Diese Menschen wollten sich daher an der Welt rächen. Woher rührt diese Instanz?
Von unserer Prägung und Erziehung. Wären wir in einem Slum aufgewachsen, hätten wir vielleicht auch kein Unrechtsbewusstsein.
Philosophen und Neurobiologen unterscheiden sich nach der Ansicht von Peter Bieri darin, wie sie mit dem Wort »Willensfreiheit« umgehen. »Es gab in der Philosophie den Gedanken, dass der Wille nur frei ist, wenn er keine Vorgeschichte hat. Doch das ist falsch. Der Wille ist dann frei, wenn er auf die richtige Weise von einer Person kontrolliert wird.« Die Entdeckungen der Neurobiologie erkennt Bieri dennoch an. »Es leuchtet ein, dass nichts in der Psyche eines Menschen passiert – kein Glücksgefühl, keine Angst, keine Freude und eben auch keine Willensentscheidung –, ohne dass etwas im Gehirn geschieht.« Was ist dann der Wille? Der Wille ist derjenige unter unseren vielen Wünschen, der sich durchsetzt und in einer Handlung mündet. Und wo ist der Wille? Nicht an einer bestimmten Stelle im Menschen lokalisierbar, auch nicht im Gehirn. Bieri sagt: »Der Wille ist nicht getrennt von der Lebensgeschichte oder der Situation, sondern die Freiheit des Willens besteht in der richtigen Bestimmung des Willens durch kontrollierendes Überlegen.« Wenn jemand nach dem Abitur über die Berufswahl und die eigenen Fähigkeiten nachdenkt, ist er am Ende vielleicht überzeugt, Anwalt werden zu wollen. Die Entscheidung wurde dann aus freiem Willen getroffen.
Nach Bieri lautet die Formel: Die Freiheit des Willens ist so groß wie die Selbsterkenntnis und die Selbstkontrolle. Je besser wir über uns Bescheid wissen – wer wir sind, wie wir denken, was wir möchten –, desto besser wird es uns gelin
Wenn ihr die Wahl habt, DAS BAD ZU putzen oder zum SPORT ZU GEHEN, welche Serie schaut ihr dann?
1. Arbeiten Sie die Hauptthesen von P. Bieri* zur Willensfreiheit heraus. Entwickeln Sie auf dieser Grundlage Ideen dafür, wie Schule einen Beitrag zur Freiheitserziehung leisten kann.
2. Bringen Sie die Positionen von G. Roth* ( S. 120) und P. Bieri* miteinander ins Gespräch.

3. Formulieren Sie Bedingungen für eine Entscheidung, die Sie als »frei« deuten. Identifizieren Sie in diesem Sinne freie Entscheidungen, die Sie heute bzw. in der letzten Woche getroffen haben.
gen, den Willen unter Kontrolle zu bringen, ihn zu bewerten und zu verstehen. All das kann man üben. So gesehen ist Willensfreiheit das Resultat von Arbeit. Die Freiheit des Willens setzt sich zusammen aus Erinnerungen, Emotionen, Überzeugungen und Vorstellungen. Es ist auch dann eine freie Willensentscheidung, wenn jemand Anwalt werden möchte, weil seine Eltern es wünschen oder weil er denkt, er könnte sich als Anwalt am ehesten drei Autos und ein Haus kaufen – solange der Wille kontrolliert ist. Zur Kontrolle des Willens kommen zwei weitere wichtige Punkte, die einen Willen erst zu einem freien Willen werden lassen: Er muss von demjenigen, der ihn hat, gutgeheißen werden und der Mensch muss seinen Willen verstehen. Das Gegenteil wäre der Wille eines Süchtigen oder psychisch Kranken. Aber einem unfreien Willen ist man nicht hilflos ausgeliefert. »Freud* hat gesagt: Wenn man durch eine Therapie eine Neurose behebt, dann gibt man dem Betroffenen die Freiheit zurück«, erklärt Bieri. Abstrakte Intelligenz, wie etwa mathematische Begabung, hilft bei der Suche nach dem freien Willen nicht. Viel wichtiger ist die Beobachtung des eigenen Verhaltens und des Fühlens. Und eine spezielle Form von Bildung: Ein gebildeter Mensch ist einer, der nicht glaubt, dass seine Art zu leben die einzig richtige und mögliche ist. Er besitzt stattdessen die Fähigkeit, sich ganz verschiedene Lebensweisen vorstellen zu können. Deshalb ist der gebildete Mensch einer, der weiß, was in der Welt und im menschlichen Leben alles vorkommen kann. Auf Reisen zum Beispiel kann man solche Er fahrungen machen. Auch Lesen fördert das Einfühlungsvermögen in andere Personen.
Julia DeckerGrabmal des griechischen Dichters Nikos Kazantzakis in Heraklion (Kreta), mit der Aufschrift (übersetzt): Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei.

Nach seiner Berufung [zum Christen/zur Christin] soll jeder so bleiben, wie er berufen wurde. Warst du bei deiner Berufung ein Sklave, dann mach dir deswegen keine Sorgen. Aber wenn du frei werden kannst, dann nutze diese Gelegenheit umso lieber. Warst du ein Sklave, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest? Dann bist du jetzt ein Freigelassener des Herrn. Warst du frei, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest?
Dann bist du jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet jetzt nicht zu Sklaven von Menschen! Brüder und Schwestern! Bleibt, was ihr bei eurer Berufung wart – jeder und jede von euch. Und lebt entsprechend vor Gott!
1 Kor 7,20 ff. (BasisBibel)
1. Die Inschrift auf Kazantzakis‘ Grabmal nimmt hellenistische Lebensweisheit auf. Vergleichen Sie sie mit Paulus‘ Freiheitsverständnis (Info).
2. Lesen Sie Gal 5,1–15. Fassen Sie die Predigt ( S. 123) in Thesen zusammen.
3. Sammeln Sie weitere Befreiungsgeschichten in den Evangelien.
4. Diskutieren Sie das Merke vor dem Hintergrund von 1 Kor 7,20 ff., der Info und der Predigt ( S. 123).
5. Beschreiben Sie die Kalligraphie ( S. 123). Formulieren Sie mögliche Gedanken zu 2 Kor 3,17 aus jüdischer, christlicher und islamischer Perspektive ( Kap 3).

MERKwürdig. An der Sklaverei will Paulus nichts ändern.
PAULUS, DER THEOLOGE DER FREIHEIT
• In der hellenistischen Welt, in der Paulus unterwegs war, spielte das Thema Freiheit eine zentrale Rolle. So strebten griechische Philosophen Freiheit als Unabhängigkeit von allen Begierden und äußeren Einflüssen, als Einstimmung in die kosmische Ordnung an. Paulus füllte diesen Begriff aus der Perspektive seiner Theologie: Freiheit gründet für ihn in der befreienden Erfahrung von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi, ist also geschenkte Freiheit. [9]
• Paulus entfaltete keine Theorie der Freiheit, sondern argumentierte damit in konkreten Gesprächssituationen: Muss man als Christ beschnitten sein und die jüdischen Ritualgesetze erfüllen? Nein, das wäre ein Rückfall in Unfreiheit. »Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist« (Gal 5,6). Darf man Fleisch essen, das aus Götzenopferritualen stammt? Ja, aber man kann es aus Rücksicht auf die Vorsichtigeren auch lassen, denn »alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten« (1 Kor 6,12). Im Römerbrief beschreibt Paulus Freiheit als Befreiung von dem Teufelskreis aus Gesetz und Sünde (das Gute wissen, aber nicht tun). In Röm 8,21 schließlich gewinnt die Freiheit kosmische Dimensionen: Die ganze »Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.«
Der Wertstoffhof ist ein einfach zugänglicher, moderner Sehnsuchtsort der Freiheit. Denn zur Freiheit gehört vor allem ja auch dies: Dinge, die uns binden, wieder loszuwerden. Man kann an der Macht der Dinge ersticken. Sich von ihnen zu trennen, ist eine wunderbare Tat der Freiheit. Freiheit ist erstaunlicherweise zunächst und zuerst vor allem dies: Beschränkung. Was brauche ich eigentlich wirklich? Was zählt wirklich im Leben?
Ein großer Wertstoffhof ist auch die Reformation. Denn auch in der Reformation ging es darum, sich von Dingen, Gewohnheiten und Haltungen zu trennen, die zur Last geworden sind. Reformation ist nicht einfach nur ein Ereignis, Reformation ist ein fortwährender Prozess, ein Prinzip, das im Christentum immer wieder wirksam wird. Reformation heißt: Im Christentum wird eine immerwährende Kraft der Erneuerung sichtbar, die größer ist als all das, was Menschen machen und bewirken können – und diese Kraft der Erneuerung bedeutet Freiheit. Der Apostel Paulus schreibt davon im Brief an die Galater – ein wahrhaft wunderbarer Text, eine Magna Charta christlicher Freiheit. Paulus hat mit einem sonderbaren Problem unter den ersten Christinnen und Christen zu kämpfen. Sie sind dabei, die Freiheit, die ihnen geschenkt wurde, wieder zu verlieren. Sie fallen zurück in die Machenschaften und Gewohnheiten des alten Lebens, das sie wieder festhält und fesselt. Drei Dinge bläut Paulus seiner Gemeinde ein.
Erstens: »Zur Freiheit hat uns Christus befreit!« Die Freiheit der Christenmenschen ist kein abstraktes Prinzip, sie ist etwas Konkretes. Jesus Christus hat sie gelebt durch seine Worte und seine Taten. Jesus lässt seine Jünger, die Hunger haben, am Sabbat Ähren ein
sammeln, seinen Kritikern entgegnet er: »Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen« (Mk 2,27).
Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lk 15) erzählt die Geschichte einer großartigen Rückkehr, die die Vergangenheit hinter sich lässt. Denen, die die Ehebrecherin steinigen wollen, ruft Jesus entgegen: »Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein« (Joh 8,7); zu der Frau selbst spricht er ein großes Vergebungswort, das das begangene Unrecht nicht ungeschehen macht und doch den Blick nach vorne richtet: »Geh und sündige hinfort nicht mehr.« Das alles sind großartige Befreiungsgeschichten, die einem bei den Worten des Paulus, in den Sinn kommen. In Jesu Taten kommt etwas zum Vorschein, was wichtiger, größer und erhabener ist als all das, was sich Menschen für ihr Leben ausdenken. Es bricht etwas durch, was Menschen aus einer unfassbaren Tiefe freimacht, weil das Leben viel mehr ist, als Menschen daraus machen können.
Zweitens lernen wir von Paulus, dass diese Freiheit, die durch Christus geschenkt wird, keine Selbstverständlichkeit ist. Man kann sie verlieren. Die Fesseln und Schlingen des gewöhnlichen Lebens warten überall. Freiheit ist ein Geschenk, und doch muss man sich um sie mühen, man muss für sie kämpfen.
Drittens geschieht dies in der Tat. Freiheit ist die Gewissheit des Glaubens, der durch Liebe tätig wird. Paulus meint damit keinen Moralismus »Tu dies, tu das.« Wer die Ewigkeit berührt, der schreitet in seinem Leben voran mit Taten, die sich nicht aufhalten mit dem Kleinen und Nichtigen, das Menschen nutzen, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Die Freiheit, die Paulus meint, macht vieles klein und unwichtig.
Jörg Lauster, TheologeDer in Pakistan geborene, in Deutschland lebende Künstler Shahid Alam gestaltet in seinen Kalligraphien Texte, die für Juden, Christen und Muslime von Bedeutung sind, in arabischer Sprache. Hier: »Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit« (2 Kor 3,17).

Heinrich Bedford-Strohm* bezeichnet Luthers Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« als die wichtigste und brillanteste der ganzen Reformationszeit: Rechtfertigung – so hat Martin Luther in seiner Freiheitsschrift dargelegt – heißt innere Freiheit und es heißt zugleich äußere Freiheit. Martin Luther selber hat erlebt, was es heißt, immer unter dem Druck stehen zu müssen, einem bestimmten Gesetz gerecht zu werden: Die Gebote Gottes, das Gesetz, das uns in der Bibel vor Augen tritt, hat Martin Luther als etwas verstanden, was er erfüllen muss, um bei Gott gerettet zu sein, um auf die offenen Arme Gottes hoffen zu können. Und er ist daran verzweifelt. Er hat getan, was er konnte; er hat sich gegeißelt, er hat gefastet; er hat alles versucht, was er konnte, um diese Gebote zu erfüllen. Und er hat gemerkt, dass er nur daran scheitern kann. Und er hat weiter in der Bibel gelesen. Und ist dann auf diesen Satz gestoßen, der erst einmal so nüchtern und strohern klingt: »Der Mensch ist allein gerechtfertigt aus dem Glauben und nicht aus den Werken.«
Für ihn war es die große Befreiung des Lebens. Denn Luther hat gemerkt: Ich muss gar nicht einem Anspruch hinterherjagen, sondern Gott liebt mich allein aus Gnade, allein durch die Gottesbeziehung darf ich mich in die Arme Gottes werfen. Alles, was daraus kommt, alle Werke gründen darauf, dass ich mich in Gott geborgen weiß.
Weil wir heute in unserem modernen Freiheitsverständnis nun aber dazu neigen, den Schutz des Individuums vor den Ansprüchen Anderer zum alleinigen Zentrum zu machen und den Freiheitsbegriff damit individualistisch zu verengen, deswegen ist die zweite These vom Beginn der Freiheitsschrift so wichtig. »Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.«
Wir Christenmenschen sagen, wenn wir diese innere Freiheit spüren, eben nicht: Freiheit heißt für mich, dass ich wählen kann, so oder so zu handeln. Freiheit heißt für mich, dass ich unabhängig bin. Freiheit heißt für mich, dass ich keine Bindungen mit anderen Menschen eingehen muss. Das genau heißt es nicht! Sondern: Freiheit kann nie wirklich Freiheit sein, wenn sie nicht gleichzeitig Dienst am Nächsten ist.

Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan.
Aus dem allen ergibt sich die Folgerung, dass ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und in seinem Nächsten; in Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott, aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe. [...] Sieh, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, die alle andere Freiheit übertrifft wie der Himmel die Erde.
1. Erläutern Sie Luthers Thesen mithilfe des Textes von H. Bedford-Strohm. Beziehen Sie dabei Ihre Kenntnisse zur Reformation ein. [8]
2. Freier Herr – dienstbarer Knecht / niemandem –jedermann usw. Arbeiten Sie die antithetischen Leitbegriffe aus Luthers Text heraus und gestalten Sie daraus eine Grafik.

MACH WAS AUS DIR!
Jugendliche posten, kommentieren, liken und teilen. Sie inszenieren, kaschieren und optimieren. Sie bewundern, vergleichen, lästern und spotten. Soziale Medien gehören zu den Kommunikationsinstrumenten, mit denen sich junge Menschen jederzeit und überall präsentieren. Wer online nicht sichtbar ist, wird nicht wahrgenommen und verpasst alles. Dabei sind Selfies der Maßstab für Sichtbarkeit und Likes die soziale Währung. Wer viel Haut zeigt, bekommt viel Anerkennung oder läuft Gefahr, zum Spott oder gar MobbingOpfer zu werden. Was als schön und begehrenswert gilt und wer als »Schlampe« abgestempelt wird – die Kriterien scheinen beliebig und die Konsequenzen nachhaltig.
Iren SchulzFür Jugendliche von wesentlicher Bedeutung sind Fragen nach einer »optimalen Gestaltung« von Bildungsverläufen in der schulischen wie beruflichen Bildung. Der 14. Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung benennt diese Anforderung sehr deutlich: »Die Reformen des Schul und Hochschulsystems lassen sich als Aufforderung interpretieren, stromlinienförmige, schnelle Bildungswege anzustreben und vermeintlich überflüssige Umwege zu vermeiden.« An die Stelle eines Verständnisses von Bildung, in dem Lernen (auch) als Prozess der Selbstbildung und der Erlangung der Freiheit zum Leben gesehen wird, tritt eine Erwartung sozialer Einpassung nach dem Motto »Mach was aus Dir!«
Nora Gaupp, Christian Lüders
»WERDE, DER DU SEIN DARFST«
»Was bin ich wert?«, fragten die Reformatoren und kündeten von der guten Nachricht der bedingungslosen Zuwendung und Liebe Gottes zum Menschen. Dieses Ja Gottes zu seinen Geschöpfen, die alles andere als per fekt, makellos, integer sind, ist das, was der alte Begriff »Gnade« ausdrücken möchte. Menschen gewinnen in christlicher Perspektive ihren Wert nicht dadurch, dass sie Qualitäten, Fähigkeiten und Leistungen mitbringen, sondern der Akt der freien Gnade zerbricht die K ategorie »Wert«. »Wer bin ich?«, »Was muss ich aus mir machen, um in den Augen der anderen und damit auch in meinen Augen bestehen zu können?« Diesem Um sich selbstKreisen des Menschen auf der Suche nach einer Identität, die ihn vor anderen, aber auch vor sich bestehen lässt, wird im Evangelium widersprochen. Der Widerspruch besteht nach reformatorischem Verständnis nicht in einem »Du sollst« (etwa: »Du sollst dem Leben vertrauen!«) bzw. »Du sollst nicht« (etwa: »Du sollst nicht auf dich selbst gerichtet sein!«), sondern in einer Gabe, die dieses Um sich selbstKreisen zerbricht: Im Evangelium wird dem Menschen die Annahme durch Gott zugesagt – und zwar voraussetzungslos und bedingungslos, sodass der Mensch von sich selbst wegblicken kann. Das Vertrauen auf die Zusage der bedingungslosen Annahme befreit von der unaufhörlichen Selbstbeschäftigung und Selbstbetrachtung. Wir werden befähigt, in einem wohlverstandenen Sinne selbstvergessen zu sein.
Mirjam Zimmermann, Theologin1. Tauschen Sie sich darüber aus, ob Sie sich in den Aussagen über Jugendliche (links) wiederfinden. Zeigen Sie auf, wie die genannten Phänomene der Selbstoptimierung (einschließlich der Fitness-Uhr) sowohl Freiheit eröffnen als auch unfrei machen können.

2. Beziehen Sie den Text von M. Zimmermann auf das Plakat ( S. 124).
3. Diskutieren Sie mithilfe der Materialien dieser Doppelseite, ob der Versuch, Rechtfertigung als Befreiung von Selbstoptimierungsstreben zu »übersetzen«, Sie überzeugt
Mit dem Gewissen ist das Menschsein des Menschen angesprochen. In Anlehnung an Luther könnte man sagen, der Mensch hat nicht ein Gewissen, er ist Gewissen. Der Mensch unterscheidet sich von übrigen Lebewesen dadurch, dass er zu sich selbst in ein Verhältnis treten kann. Er kann mit sich selbst im Zwiegespräch sein. Er kann bestimmte Ereignisse, Erfahrungen, Herausforderungen im Leben in Bezug zu sich selbst setzen. Wenn ich höre und sehe, wie meinen Mitmenschen Unrecht zugefügt wird, wie sie gedemütigt werden, etwa durch Mobbing im Netz oder durch Stigmatisierung ihres Aussehens, ihrer sozialen Stellung oder ihrer Herkunft, dann kann ich als Mensch dazu Stellung nehmen. Ich bin der Situation nicht ausgeliefert und muss sie geschehen lassen, sondern kann dagegen sprechen, dagegen vorgehen. Nun gibt es aber auch Situationen, die gerade dies schwierig machen und eine große Herausforderung für den Einzelnen bedeuten. So kann eine solche Haltung, die Missstände offenlegt, dadurch erschwert werden, dass etwa in der Peergroup, in der ich mich aufhalte, meine Einschätzung nicht geteilt oder sogar nicht geduldet wird und ich selbst – wenn ich sie äußere – von Ausschluss und Mobbing bedroht bin.
Solche Herausforderungen stellen sich nicht nur im kleinen zwischenmenschlichen Bereich ein, sie können sich auch auf einen größeren politischen Rahmen beziehen, wenn etwa in totalitären Gesellschaften keine regierungskritischen Meinungen geäußert werden dürfen. Hier stehen nicht nur der Mut des Einzelnen, sondern die Frage der Normenbefolgung und die Berechtigung des Widerstands zur Debatte. Ist das Gewissen eine Instanz, die normwidriges Verhalten zulässt oder dies sogar moralisch gebietet? Und wer oder was befindet über die Legitimität solchen normwidrigen Verhaltens? Welche Rolle spielen dabei menschliche Freiheit, Würde und Selbstbestimmung, und wie verhalten sie sich zu einer übergeordneten Instanz, die Weisungen über das Richtige und Wahre enthält?
Elisabeth Gräb-Schmidt, TheologinDer Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.
1 Sam 16,7 b
»Das Gewissen ist so eine Art innere Stimme, so etwas wie ein Instinkt, ein Gefühl dafür, was richtig und falsch ist.
»Ein gewissenloser Mensch!

»Hier kann ich nicht mit gutem Gewissen zustimmen.
»Anna ist eine gewissenhafte Schülerin.
»Mir wurde als Kind ständig ein schlechtes Gewissen eingeredet.
»Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.
»Ich habe mich entschuldigt, aber das schlechte Gewissen quält mich immer noch.
1. Stellen Sie die unterschiedlichen Bedeutungen von »Gewissen«, wie Sie sie auf dieser Seite finden, als Standbilder dar. Eine erste Anregung bietet das Bild oben.
2. Fassen Sie die Aussagen des Textes (links) in drei Thesen zusammen.
3. Erläutern Sie an Beispielen aus dem öffentlichen oder dem eigenen Erfahrungsbereich, worin die im Text geschilderten »Herausforderungen« für das Gewissen bestehen können.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine.
Ps 139,23
So oft Gottes Wort gepredigt wird, macht es weite, fröhliche, sichere Gewissen, denn es ist eine Botschaft der Gnade und der Vergebung.
Wer mit Traurigkeit, Verzweiflung oder anderem Herzeleid geplagt wird und einen Wurm im Gewissen hat, derselbe halte sich ernstlich an den Trost des göttlichen Wortes, danach so esse und trinke er und trachte nach Gesellschaft und Gespräch gottseliger und christlicher Leute, so wird’s besser mit ihm werden.

Ohne ein fröhliches Gewissen und ein unbeschwertes Herz vor Gott kann niemand selig werden.
Schon geMERKt? Es gehört zur Freiheit eines Christenmenschen, über sich selber lachen zu können.
(Karl-Josef Kuschel, Theologe)
Martin Luther bestritt, dass der Mensch (wie im Mittelalter gelehrt wurde) eine naturhafte Anlage habe, das Gute irrtumsfrei zu erkennen (und das Gute dann auch zu wollen). So lange das Gewissen nicht »an Gottes Wort gebunden« ist, ist es ein »irrendes« Gewissen, das den Menschen, der auf sich selbst schaut, anklagen und schuldig sprechen muss. Christus hat dieses Gewissen entmachtet: Im Glauben darf der Mensch dessen gewiss sein, dass ihm – unverdienterweise – seine Sünde vergeben ist. Das solchermaßen getröstete und befreite Gewissen vertraut auf Gott und lässt sich von seinem Willen in die Pflicht nehmen.
Das Gewissen ist der Ort im Menschen, an dem sich entscheidet, woran der Mensch gebunden ist. Das, was Luther unter gutem Gewissen, unter einem befreiten Gewissen versteht, gibt es nur im Glauben, im Vertrauen auf das Wort Gottes. Erst der Glaube macht das Gewissen frei, schafft Gewissensfreiheit. Allerdings muss das befreite, getröstete, mutige Gewissen beständig gegen das schlechte, anklagende Gewissen kämpfen, sowie der Glaube sich in beständigem Widerstreit mit dem Unglauben befindet.
Das im Vertrauen auf Gott befreite und deshalb freie Gewissen kann auch zur Freiheit gegenüber äußeren Zwängen befähigen; es kann auch z. B. die Freiheit gegenüber menschlichen Autoritäten ermöglichen und dazu motivieren, ihnen gegenüber »Gewissensfreiheit« zu verteidigen.
Karl-Friedrich Haag, Theologe
1. »Das Gewissen kann nicht irren«, meinte der Philosoph Johann Gottlieb Fichte*. Nehmen Sie dazu aus der Sicht Martin Luthers Stellung.
2. Martin Luthers Gewissensverständnis steht in engem Zusammenhang mit seiner Freiheitsschrift* (vgl. S. 124). Verdeutlichen Sie dies in einem Schaubild.
3. Deuten und bewerten Sie das Plakat (links) vor dem Hintergrund eines evangelischen Gewissensverständnisses.

Dietrich Bonhoeffer* hat sich dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen. In der Wohnung seines Schwagers Hans von Dohnanyi wird ein Attentat vorbereitet, das RudolfChristoph Freiherr von Gersdorff ausführen soll. Dohnanyi übergibt v. Gersdorff den Sprengsatz.
Dohnanyi: Kommen Sie näher, von Gersdorff! (bereitet die Bombe vor) Beste britische Chemikalien. Abwehrbestände. Scharf gemacht wird sie hier und gezündet hier
Gersdorff: In Ordnung.
Bonhoeffer (erschrocken): In die Manteltasche? Moment mal – Sie wollen die in Ihrer Manteltasche zünden? Das ist doch Selbstmord!
Gersdorff: Aber ich nehm’ ihn mit in den Tod.
Bonhoeffer: Warum zeigt ihr mir das alles? Warum bin ich hier?
Gersdorff (zu B.): Wird Gott mir vergeben?
Bonhoeffer: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass unser Gott gnädig ist und verzeiht.
Gersdorff: Segnen Sie mich bitte?
Bonhoeffer (nach längerem Nachdenken, freundlich, aber ohne Segensgeste): Denken Sie immer an die Worte Jesu: Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde.

Das Gewissen ist der Ort, an dem sich entscheidet, wer ein Mensch ist. Es ruft den Menschen – so D. Bonhoeffer – zur »Einheit« mit sich selbst. Er selbst schreibt dazu: Der Gewissensruf im natürlichen Menschen ist der Versuch des Ich, sich in seinem Wissen um Gut und Böse vor Gott, vor den Menschen und vor sich selbst zu rechtfertigen und in dieser Selbstrechtfertigung bestehen zu können.
Die große Veränderung tritt in dem Augenblick ein, in dem die Einheit der menschlichen Existenz nicht mehr in ihrer Autonomie besteht, sondern – durch das Wunder des Glaubens – jenseits des eigenen Ich und seines Gesetzes, in Jesus Christus gefunden wird.
Das natürliche – und sei es das rigoroseste Gewissen erweist sich nun als die gottloseste Selbstrechtfertigung, es wird überwunden durch das in Jesus Christus befreite Gewissen, das zur Einheit mit mir selbst in Jesus Christus ruft. Das bedeutet, dass ich die Einheit mit mir selbst nur noch in der Hingabe meines Ich an Gott und die Menschen finden kann.
Das vom Gesetz befreite Gewissen wird das Eintreten in fremde Schuld um des anderen Menschen willen nicht scheuen, es wird sich vielmehr gerade so in seiner Reinheit erweisen. Das befreite Gewissen ist nicht ängstlich […], sondern weit geöffnet für den Nächsten und seine konkrete Not
»SEI
1. Sehen Sie, wenn möglich, die Filmszene (oben) an und analysieren Sie den Dialog!
2. Fassen Sie D. Bonhoeffers* eigenen Text (rechts) zusammen und beziehen Sie ihn auf den Filmausschnitt! Bei der Entschlüsselung des Textes kann eine Skizze helfen, in der Sie die Gegensätze visualisieren: natürliches Gewissen –befreites Gewissen / Autonomie – jenseits des Ichs usw.
3. Die Bonhoeffer*-Biografie von Alois Prinz wird auch als Jugendbuch empfohlen. Erklären Sie einem jüngeren Schüler bzw einer Schülerin den Titel.
Wer in Verantwortung Schuld auf sich nimmt –und kein Verantwortlicher kann dem entgehen – der rechnet sich selbst und keinem anderen diese Schuld zu und steht für sie ein, verantwortet sie. Vor den anderen Menschen rechtfertigt den Mann der freien Verantwortung die Not, vor sich selbst spricht ihn sein Gewissen frei, aber vor Gott hofft er allein auf Gnade.
»Ich kann doch nicht einfach …
»Was, wenn …
»Ich weiß nicht so recht …
»Wieso ich?
1. Erinnern oder imaginieren Sie Situationen zu den Zitaten (oben) – tauschen Sie sich zu zweit darüber aus.
2. Beschreiben und deuten Sie das Fastenplakat und diskutieren Sie, inwieweit es zur Fastenzeit passt
3. Arbeiten Sie wesentliche Aussagen aus dem Predigtausschnitt (unten) heraus und beziehen Sie sie auf D. Bonhoeffers* Gewissensverständnis ( S. 128).
4. Mut zum Risiko – stellen Sie Verbindungen zu den Überlegungen zu »Mut« ( S. 26) her.
Wir haben der Fastenzeit dieses Jahr das Motto gegeben: »Riskier, was, Mensch! Sieben Wochen ohne Vorsicht.« Wir haben unser Leben mit Umsicht, aber auch volles Risiko zu leben – denn Gott überantwortet es uns. Glauben heißt, sich dem Leben und seinen Stürmen stellen: in der Schule, bei Klassenarbeiten, wenn man Liebeskummer hat, Krisen in der Partnerschaft zu bewältigen sind, Ärger am Arbeitsplatz droht. Wir scheitern, wenn wir uns zu viele Gedanken machen. Was kann alles passieren, wenn ich auf die muslimischen Nachbarn zugehe, um sie willkommen zu heißen? Vielleicht weisen sie mich ab ... Was, wenn ich den Eltern, die ein Kind mit einer Behinderung haben, meine Unterstützung anbiete? Ob sie beleidigt sind? Was, wenn ich endlich einmal Nein sage, weil meine Kollegin ihre Arbeit wieder nicht rechtzeitig fertig kriegt und erneut meine Hilfe will? Und was, wenn ich einen in der Familie ewig unter den Teppich gekehrten Konflikt anspreche?
Es stimmt. Es ist ein Risiko, deutlich zu sagen, was man will und was nicht. Laut Protest einzulegen gegen
Ungerechtigkeit in der Firma oder jemanden in Schutz zu nehmen, der von anderen angegriffen wird. Damit riskiere ich Leben – aber ganz anders, als man zunächst meint: Ich riskiere zu leben, selbst und mit anderen zusammen. Ich nehme andere ernst und ich zeige Respekt vor mir selber – ich bleibe ehrlich und stehe zu mir, ich halte an meinen Überzeugungen fest und trete entschlossen für sie ein. Wir könnten das Risiko natürlich vermeiden. Aber nur um einen Preis, der viel zu hoch ist: wenn wir aufhören zu lieben. Denn wer liebt, der riskiert etwas mit allen Sinnen und dem Verstand. Der liebt das Leben, die Liebe, die Freiheit, die Wahrheit, der liebt seinen Nächsten wie sich selbst.
Riskier was, Mensch! Trauen wir uns etwas zu, lassen wir uns inspirieren von diesem aufregenden Gott, von seiner heiligen Unruhe, damit wir dahin kommen, wo es ungewöhnlich schön und gut für alle ist. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Es kann alles anders werden – im persönlichen, im gesellschaftlichen und globalen Leben. A us der Auftaktpredigt zur Fastenaktion »Riskier was, Mensch«, die die bayerische Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler in einem Fernsehgottesdienst hielt.



Plakat

In jedem Jahr lädt Amnesty International* zu einem Briefmarathon ein. Zu zehn Einzelfällen werden bundesweit Solidaritätsbriefe und Appellbriefe geschrieben. Unter einem Link auf der Homepage kann man sich für die ausgewählten Menschen einsetzen.

Verschaffen Sie sich Informationen über die auf S. 130 abgebildeten Organisationen bzw. Initiativen, über ihre Ziele und Aktionen und über Reaktionen darauf.
Beschreiben Sie die Bilder ( S. 130) und deuten Sie ihre Gestaltung im Blick auf die dahinterstehende Aussageabsicht.
Ordnen Sie den Bildern Freiheitsrechte aus den Menschenrechten bzw. dem Grundgesetz zu.
In diesem Kapitel sind Ihnen verschiedene Freiheitskonzeptionen begegnet. Beziehen Sie diese in arbeitsteiligen Gruppen auf die Abbildungen ( S. 130). Sie können entweder überprüfen, inwiefern die jeweils ausgewählte Freiheitskonzeption hilft, die abgebildeten Themen besser zu verstehen. Oder Sie machen eines der Bilder und seine konkrete Botschaft zum Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen und analysieren, welche Konzeptionen und Aspekte von Freiheit hier anklingen.
Entwerfen Sie ein »Freiheitsplakat«, aus dem ein christliches Verständnis von Freiheit deutlich wird. Sie können dabei auf eines der auf S. 130 angesprochenen Themen, aber auch auf andere aktuelle Beispiele zurückgreifen.
Was haben Sie dazugelernt (vgl. S. 105)?
Was möchten Sie sich merken?
Welche Methoden bzw. Materialien haben Sie besonders angesprochen?

Was wird Sie weiter beschäftigen?
Welche Fragen bleiben offen?




Sie kennen das aus den vergangenen Ortswechsel-Bänden: Am Ende des Schuljahrs werden noch einmal alle Lernbereiche »Im Zusammenhang« in den Blick genommen: Was ist Ihnen aus einem Jahr Religionsunterricht besonders in Erinnerung geblieben? Was hat Sie interessiert? Bei welchem Thema fühlen Sie sich besonders sicher, sodass Sie es z. B. jüngeren Schülerinnen und Schülern erklären könnten? Wo sind Fragen offengeblieben, womit werden Sie sich ggf. weiter beschäftigen?

Die Bilder unten stehen für die Kapitel dieses Buches und damit für die unterschiedlichen Themen des Religionsunterrichts in diesem Schuljahr. Suchen Sie nach Verknüpfungen zwischen den einzelnen Themen; beziehen Sie sie auf das Buchmotto »Zwischenräume«. Vielleicht lassen sich auch Zusammenhänge zu vergangenen Jahrgangsstufen herstellen.
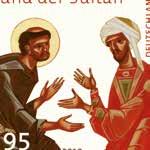
Neues
Altes Testament
VorlesungAnstrengung
Wörtlich übersetzt bedeutet der aus der griechischen Philosophie stammende Begriff »Theologie« Lehre, Rede oder auch Wort von G ott. Aber: Kann man Gott eigentlich als »Gegenstand« einer Wissenschaft erforschen? Diese Frage hat prominent der Theologe Karl Bar th in den 1920er-Jahren gestellt und die Grundspannung beschrieben, in der jeder Versuch des Theologie-Treibens steht: »Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können wissen und eben damit Gott die Ehre geben«. Gegenwärtig wird der Hauptzweck der Theologie unterschiedlich beschrieben: z. B. als Reflexion des christlichen Glaubens und seiner jüdischen Wurzeln in Geschichte und Gegenwart sowie der Suche nach der bleibenden Relevanz biblisch-christlicher Sprachtraditionen – oder auch als Frage danach, wie sich Lebenswirklichkeit und menschliche Selbstverständnisse im Licht des christlichen Glaubens darstellen.
Die Universitätstheologie hat sich historisch in folgende Disziplinen (Fächer) ausdifferenziert: die beiden exegetischen Fächer Altes und Neues Testament, die Systematische Theologie bzw. die Dogmatik, die Ethik (als Teil der Systematischen Theologie), die Kirchengeschichte, die Religionswissenschaft und die Praktische Theologie. An vielen Universitäten bereichern noch weitere Disziplinen den Fächerkanon, wie z. B. Judaistik, Ökumenik und Konfessionskunde oder Philosophie.
Die Theologie gehört zu den Wissenschaften, die ab dem 13. Jahrhundert neben Jura und Medizin und den freien Künsten* als Erstes an europäischen Universitäten gelehrt wurde. Theologisches Denken hat nicht nur einen Ort an Hochschulen, sondern z. B. auch in den Gemeinden. Der Sache nach gehört Theologie als Reflexion von Gotteserfahrungen und Glaubenspraxis von Anfang an zum Christentum dazu. Als erster Theologe der Christenheit gilt Paulus; seine Briefe zeigen, wie er christlichen Glauben durchdacht hat. Aber nach evangelischer Überzeugung sind hier nicht nur religiöse Expertinnen und Experten gefragt: Gemäß der Lehre vom Priestertum aller Gläubigen ist jede Christin und jeder Christ dazu aufgerufen: »Selber denken!« (vgl. S. 142) – gerade auch im Hinblick auf den Glauben.
Obgleich die Theologie zu den Ursprungsdisziplinen der Universitäten gehört, ist gegenwärtig nicht unumstritten, ob sie heute noch als Wissenschaft gelten kann, die im Hochschulsystem ihren gleichberechtigen Platz neben anderen Wissenschaften beansprucht. Ein aus atheistischer Perspektive vorgebrachtes Argument gegen die Wissenschaftlichkeit von Theologie lautet z. B., dass diese gegenstandslos sei, weil Gott nicht existiere; andere Kritiker monieren, dass der Gegenstand der Theologie nicht hinreichend präzise definiert werden könne. Demgegenüber hat der Deutsche Wissenschaftsrat* 2010 dafür plädiert, die Position der wissenschaftlichen Theologie zu stärken, da sie sich auf einen spezifischen Erkenntnisgegenstand beziehe – die Transzendenz – und Religion in unserer Gesellschaft und weltweit keineswegs bedeutungslos geworden sei. Zudem reflektierten Theologien im Wissenschaftssystem die Grenzen einer rein wissenschaftsförmigen Selbstdeutung des erkennenden Menschen.
Zu den Kriterien der Wissenschaftlichkeit von Theologie gehören u. a., dass alle Behauptungen begründungspflichtig sind, klar, logisch, transparent und ideologiefrei argumentiert wird, eine präzise Terminologie ver wendet wird, ein Bezug zur jeweiligen Fachdiskussion erkennbar ist und diese Bezüge sorgfältig nachgewiesen werden sowie dass es zu einer Theorie- bzw. Systembildung kommt. Ein weiteres zentrales Kriterium ist der reflektierte Einsatz von Methoden, die auch in außertheologischen Bezugswissenschaften (wie z. B. Sprach-, Kultur-, Geschichts-, Sozialwissenschaft, Philosophie und Pädagogik) vielfältig eingesetzt werden (z. B. hermeneutische, empirische, historische, vergleichende Methoden).
Damit Sie sich ein wenig vorstellen können, womit sich die Evangelische Theologie beschäftigt, wurden Fachvertretern und -vertreterinnen der verschiedenen theologischen Disziplinen jeweils die gleichen Fragen gestellt. Dazu finden Sie teils einige Titel von Veranstaltungen dieses Faches an verschiedenen Universitäten sowie exemplarische Veröffentlichungen.
Fragen an Helmut Utzschneider, emeritierter Professor für Altes Testament an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau
Womit beschäftigt sich die alttestamentliche Wissenschaft?
Wir Alttestamentler und Alttestamentlerinnen legen die Literatur des Alten Testaments aus, in dem Menschen des Alten Israel ihre Erfahrungen mit Gott zum Ausdruck gebracht und in das sie ihre Traditionen und Hoffnungen eingeschrieben haben. Wir erkunden die geschichtlichen Voraussetzungen und Intentionen der Texte. Wir erforschen, wie sie, angefangen bei Jesus und im Neuen Testament, spätere Generationen verstanden haben, und wir fragen, was sie heute bedeuten könnten. Weil das christliche Alte Testament (weitgehend) identisch ist mit der Hebräischen Bibel der Juden, beschäftigen wir uns auch mit der Frage nach den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden zum Judentum.
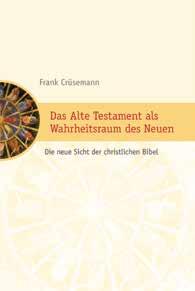
Was finden Sie daran besonders spannend?
Mich fasziniert, in die fremde Welt des Alten Israel und seiner Nachbarkulturen in Ägypten und im Orient einzutauchen. Spannend finde ich die Auseinandersetzung mit dem Alten Testament, auch die kritische: Welche seiner Ideen und Bräuche sind (nur) zeitbedingt zu verstehen, wie etwa der Opferkult? Wo sind Grenzen zu ziehen, etwa gegenüber manchen Einstellungen zur Homosexualität? Wo haben sich bei uns Vorurteile gegenüber dem Alten Testament eingenistet, nicht zuletzt Klischees mit antisemitischem Hintergrund? Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
Sprach- und Literaturwissenschaft, Altorientalistik und Judaistik, Geschichtswissenschaft und Archäologie, Sozial- und Religionswissenschaft, Theologie. War um muss es Ihre Disziplin unbedingt geben?
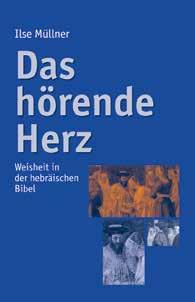
Weil wir ohne sie den christlichen Glauben und die Kultur, in der wir leben, nicht verstehen würden.
Einige Veranstaltungstitel zum Alten Testament
Die Zehn Gebote
Lektürekurs Hebräisch
Das Nachdenken über den Menschen im Alten Israel
Migration und Beheimatung. Alttestamentliche Erkundungen
Ausgrabungsexkursion nach Israel
Exodus und die Frauen
Hermeneutik der Tora
Fragen an Gudrun Guttenberger, Professorin für Biblische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg

Womit beschäftigt sich die neutestamentliche Wissenschaft?
Die neutestamentliche Wissenschaft hat drei Gegenstände: (a) die Entstehung und Formatierung der Gr uppe der Christusanhängenden innerhalb des antiken Judentums bis etwa 120 n. Chr.; (b) die Auslegung der Texte, die in dieser Gruppe und in ungefähr diesem Zeitraum entstanden sind. Einige dieser Texte sind später kanonisch geworden und bildeten das »Neue Testament«; andere Texte haben nicht eine so breite Anerkennung gefunden, sind aber für das Verständnis des frühen Christusglaubens und das Leben der Christusanhängenden ebenso wichtig; (c) die sozio-kulturellen (also die politischen, sozialen und wirtschaftlichen) Kontexte, in denen diese Texte entstanden sind. Wir versuchen, die antiken Lebenswelten so genau wie möglich zu rekonstruieren. Hier sind die Überschneidungen mit der Altphilologie und der Alten Geschichte groß. Schließlich sind die einschlägigen Texte auf Griechisch oder Latein verfasst. Was finden Sie daran besonders spannend?
Im Hinblick auf viele Bereiche interessiere ich mich für Sprache und Kulturen. Das fasziniert mich auch bezüglich der Lebenswelten und der Texte der »frühen Christen«. Besonders spannend ist für mich schon seit meiner Schulzeit, was Worte können! Wie anders wir Menschen etwas wahrnehmen und empfinden, beurteilen und bedenken, ist abhängig davon, mit welchen Worten und Sprachbildern ein Stück »Wirklichkeit« formuliert – in sprachliche Form gebracht wird! Die frühen Christen haben die Welt neu gesprochen! Sie haben neue Worte gefunden für eine fundamentale Erfahrung, die sie gemacht haben: Von der Fülle des Lebens, eines nicht fassbaren Geheimnisses, das mit dem Wirken und v. a. mit dem Sterben Jesu zu tun hatte. Dass er den Tod überwunden hat, das ist eine solche sprachliche Form der »Neuerfindung« der Welt. Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
Wir arbeiten mit denselben Methoden wie die Sprach-, Geschichts- und Literaturwissenschaften. Wir fragen z. B. nach der Bedeutung bestimmter Wörter, wie charis (Gnade, Gabe, Anmut), wir lesen antike Quellen, jüdi-
sche, darunter die n e utestamentlichen und griechisch-römischen, historisch-kritisch, wir verwenden Methoden wie die Erzählanalyse, um z. B. die Evangelien besser zu verstehen. Warum muss es die neutestamentliche Wissenschaft unbedingt geben? Das Fachwort für die Auslegung von Texten ist Exegese; das Antonym ist Eisegese – etwas in den Text hineinlegen. Und genau das ist unser »Kerngeschäft«: Wir rekonstruieren den ursprünglichen und wissenschaftlich belegbaren Sinn der neutestamentlichen Texte und stellen damit ein Instrument zur Verfügung, an dem Menschen, die die Bibel lesen, ihr persönliches Verständnis messen können. Würde das fehlen, würde jede*r der Bibel genau das entnehmen, was diejenige Person dort finden will. Die völlige Willkür! Neutestamentliche Wissenschaft stellt »Objektivität« her. Es lässt sich nicht immer ganz klar definieren, was ein Text bedeutet – es lässt sich aber in fast allen Fällen genau beschreiben, was er bedeuten kann und was eben nicht. Wir verteidigen die Grenze zum Unsinn und zur Ideologie.
Einige Veranstaltungstitel zum Neuen Testament Einführung in die exegetischen Methoden des Neuen Testaments
Das Matthäusevangelium – Erzählstruktur, literarische Kunst und Theologie
Deutungen des Todes Jesu
Bibelkunde des Neuen Testaments und Geschichte des Urchristentums
Lukas und Paulus – zwei Brüder in Christus
Midraschliteratur und das Neue Testament
Fragen an Katharina Will, zurzeit Vikarin in München, die im Fach Kirchengeschichte promoviert hat Womit beschäftigt man sich in Ihrer Disziplin? Was man normalerweise einfach »Kirchengeschichte« nennt, müsste eigentlich »Kirchen- und Theologiegeschichte« heißen, denn es geht in diesem Fach nicht nur um die Geschichte der christlichen Kirchen, sondern auch um die Geschichte der Theologie. Daher fragt die Kirchen- und Theologiegeschichte sowohl nach der Entwicklung der christlichen Konfessionen als auch nach der Veränderung der christlichen Glaubensinhalte – wie sie sich Theologinnen und Theologen und wie sie sich andere Christinnen und Christen zu eigen gemacht haben.
Was finden Sie daran besonders spannend?
Als ich für meine Forschung in verschiedenen Archiven nach Quellenmaterial gesucht habe, war das für mich wie eine Schatzsuche. Eine Schatzsuche, bei der ich nicht genau wusste, ob es einen Schatz gibt, worin er besteht und ob ich ihn finden würde. Einmal stieß ich nach tagelangem Suchen auf circa 500 Jahre alte Dokumente und merkte, dass sie zu zentralen Quellen in meinem Forschungsvorhaben werden würden. Das war ein tolles Gefühl! Diese Dokumente zu berühren (natürlich mit Handschuhen), war für mich etwas Besonderes. Ich fühlte mich den Menschen, die vor uns gelebt haben, ganz nah. Es geht mir darum, ihren Gedanken, Hoffnungen und Ängsten nachzuspüren. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, in welcher Tradition wir stehen, um zu begreifen, was uns an unserem Glauben heute wichtig ist. Vielleicht auch, warum wir für unseren Glauben einstehen sollten. Es ist das Gefühl, dass unser individueller Glaube nicht nur für sich steht, sondern Teil einer Gemeinschaft ist – der Gemeinschaft aller Gläubigen.

Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
Im Gr unde dieselben Methoden wie sie die Geschichtswissenschaft auch sonst verwendet. In der Kirchenund Theologiegeschichte legen wir Quellen nach wissenschaftlichen Standards aus. Übrigens müssen diese Quellen nicht unbedingt Texte sein, sondern können auch in Liedern, Kirchenfenstern, Bildern etc. bestehen. Schaut euch doch nur mal die Abbildungen in der Chronik des Felipe Guamán Poma de Ayala aus Peru an. Faszinierend! Im Grunde kann alles eine interessante

Quelle sein – es kommt dabei auf die Fragen an, die ich an die Quelle habe.
Warum muss es Ihre Disziplin unbedingt geben? Durch die Kirchen- und Theologiegeschichte bekommen wir einen Einblick in die Vielfalt des christlichen Glaubens. Kirche und Theologie, wie wir sie heute kennen, sind ja nur eine Möglichkeit unter vielen. Es hätte im Lauf der Zeit so viele Abbiegungen gegeben, so vieles, was anders möglich gewesen wäre und anders war. Diese Pluralität wahrzunehmen, unseren Geist und unser Herz zu weiten für die Vielfalt und die Legitimität anderer Denk- und Glaubensweisen anzuerkennen, das ist das Eigentliche der Kirchen- und Theologiegeschichte. Und dazu muss es sie unbedingt geben!

Fragen an Jörg Lauster, Professor für Systematische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Womit beschäftigt man sich in Systematischer Theologie?
Systematische Theologie thematisiert die Inhalte des Christentums, seine zentralen Ideen und Motive. Was geht in Christinnen und Christen vor, was denken sie, was fühlen sie und was folgt für ihr Handeln daraus, wenn sie sagen, Gott ist eine Person, Gott hat die Welt erschaffen, Gott wurde Mensch, Gott nimmt Menschen gnädig an, Gott begegnet uns in einem Jenseits. Was finden Sie daran besonders spannend?

Das sind die großen Themen unserer Kultur. Es geht ja letztlich um nichts anderes als Anfang, Ziel und Sinn unseres Daseins. Was kann es Spannenderes geben?
Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
Sehr viele. Wir lesen und interpretieren Quellen, manchmal in fremden und alten Sprachen, wir tragen deren Gedanken zusammen – ganz ähnlich wie dies in der Philosophie geschieht –, wir fragen mit Hilfe der Psychologie und Soziologie, was wir heute damit anfangen können.
War um muss es Ihre Disziplin unbedingt geben?
Sie ist das beste Heilmittel gegen Langeweile und Banalität. Sie öffnet die Augen für das Geheimnis und auch den Sinn unseres Daseins, über beides kann man immer wieder nur staunen.
Einige Veranstaltungstitel aus der Systematischen Theologie
Was ist Religion? Diskursformationen vom Zeitalter der Aufklärung bis zur Gegenwart
Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende?
Die Apokalyptik in Geschichte und Gegenwart und ihre Bedeutung für eine Wahrnehmung von Zeit und Welt
Zur Bedeutung der Gefühle für religiöse Überzeugungen Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft
Gotteskindschaft. Der christliche Glaube als Erleben und Deuten
Geist Gottes: Substanz, Kraftfeld oder Person?
Neue Entwürfe in der Pneumatologie
Der stellvertretende Sühnetod Christi als Problem der Christologie
Einige Veranstaltungstitel aus der Ethik
Medizin- und Bioethik im Film
Von Freiheit und Anderem. Krisensprache und die Frage, wie wir leben wollen
Gerechter Krieg – Gerechter Friede
Kann Globalisierung gerecht sein? Aktuelle ethische Diskurse um den globalen Wandel
Bildung als Thema theologischer Ethik
Die Freiheit des Christenmenschen
Liebe und Gerechtigkeit. Kennzeichen protestantischer Ethik
Geist und Geld. Wirtschaftsethik als theologische Aufgabe
Digitalisierung (in) der Ethik
Fragen an Reiner Anselm, Professor für Systematische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Womit beschäftigt man sich in theologischer Ethik?
Das Christentum ist keine Philosophie, sondern eine Lebensform. Das bedeutet, dass sich die Überzeugungen des Glaubens immer auch darauf auswirken, wie wir unser Leben gestalten. Was es nun bedeutet, ein christliches Leben zu führen, eine Partnerschaft zu gestalten, eine Familie zu haben, einer Arbeit nachzugehen, politische Entscheidungen zu treffen, das Verhältnis zum eigenen Körper und zu der uns umgebenden Natur zu gestalten. – Das sind die Fragen, mit denen sich die evangelische Ethik auseinandersetzt. Wie prägen unsere Überzeugungen maßgebliche Entscheidungen? Wie lässt sich eine Lebenswelt gestalten, die unseren Überzeugungen entspricht?
Was finden Sie daran besonders spannend?
Obwohl natürlich unsere eigenen Entscheidungen immer geprägt sind von der Geschichte, in der wir stehen, ist der Ort der Ethik die Gegenwart. Hier geht es darum, sich mit den Themen zu beschäftigen, die uns als Einzelne und als Gesellschaft beschäftigen. Dieser Gegenwartsbezug fasziniert mich bis heute. Immer aufs Neue. Darüber hinaus kann man nur entscheiden, wenn man weiß, um was es geht. Daher ist Ethik immer auch am Gespräch mit anderen Disziplinen und Wissenschaften orientiert. Ich selbst beschäftige mich vor allem mit der Biomedizin und der Politik, und diesen interdisziplinären Austausch schätze ich ganz besonders. Und schließlich: Wer Ethik betreibt, gestaltet immer auch die Welt mit, in der wir leben. Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
In der Ethik geht es zunächst einmal darum, Probleme möglichst genau zu beschreiben: Warum wird etwas zu einem ethischen Problem? Das liegt daran, dass wir eine Differenz bemerken zwischen den grundlegenden moralischen Normen, denen wir uns verpflichtet fühlen, und der Situation, die wir wahrnehmen. Zu einer ethischen Analyse gehört es daher, auf der einen Seite diese Normen präzise zu beschreiben. Was bedeutet Menschenwürde? Wie buchstabieren wir Freiheit? Was beinhaltet Gerechtigkeit? Sodann muss mit diesem Wissen das jeweilige Themenfeld genau erschlossen werden. Wo liegen die Schwierigkeiten? Welche Alter-
nativen gibt es? Lassen sich entsprechende Probleme lösen oder stehen wir in einem Dilemma? Da unsere Bilder von Gerechtigkeit, aber auch von Krankheit und Gesundheit, Mann und Frau, Natur und Umwelt durch unsere Geschichte geprägt sind, sind alle diese Aspekte noch einmal vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Perspektive, ihres Ortes und ihres Zeitbezugs zu reflektieren.
War um muss es Ihre Disziplin unbedingt geben? Es macht das Besondere des Menschen aus, dass er sein Leben nach eigenen Entscheidungen führen kann –aber auch führen muss. Moral und Ethik gehören daher unumstößlich zu dem, was uns als Menschen ausmacht. Ein Mensch, der die Voraussetzungen und Fähigkeiten zum Entscheiden hätte, aber nicht nutzt, wäre so etwas wie ein Vogel, der auf seine Flügel verzichtet. Dabei ist die Moral nicht etwas, über das wir einfach von Natur aus verfügen, sondern es ergibt sich daraus, dass wir in Beziehungen, dass wir in einer Kultur leben. Und daher ist es notwendig, diese Fähigkeiten zu erlernen, wie eine Sprache, wie Rituale, eine Kultur. Diese sind das Thema und der Gegenstand der Ethik. Sie ist unverzichtbar für eine menschliche Kultur.
Fragen an Lukas Grill, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Praktische Theologie an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg
Womit beschäftigt man sich in der Praktischen Theologie?
Praktische Theologie beschäftigt sich mit Praxis: im engeren Sinne mit kirchlichen Praxisfeldern (also mit dem, was künftige Pfarrerinnen, Pfarrer und Religionslehrkräfte zu tun haben werden: z. B. Predigt, Seelsorge oder Religionsunterricht). Aber auch mit religiöser Praxis im weiteren Sinne: z. B. Film, digitale Medien, Literatur oder Alltagssprache. Dabei lehrt Praktische Theologie nicht, wie man es in der Praxis »richtig macht«; sondern Praktische Theologie versteht sich als Theorie der Praxis, d. h.: als ein Nachdenken über die Praxis. Was finden Sie daran besonders spannend?

An der Praktischen Theologie ist mir besonders wichtig, dass sie dazu beiträgt, neue Perspektiven auf den Alltag – auch auf meinen persönlichen Alltag! – zu gewinnen. Wenn ich mein alltägliches Leben aus der Perspektive »religiöser« Praxis deute, dann wirft das ein ganz neues Licht auf mein Leben: Zum Beispiel fallen mir bestimmte Redewendungen (»Grüß Gott ...!«) auf, in denen Religion explizit zur Sprache kommt. Oder ich denke mir, während ich einen Film anschaue: Hier zeigen sich Strukturen, die sich aus theologischer Perspektive mit Begriffen wie »Sünde«, »Erlösung« oder »Auserwähltsein« beschreiben lassen.
Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
Praktische Theologie wird oft als »Wahrnehmungswissenschaft« bezeichnet. Sie bedient sich daher vor allem solcher Methoden, die helfen, genauer, tiefer, differenzierter wahrzunehmen. Konkret wird in der Praktischen Theologie viel empirisch geforscht – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Zudem arbeitet sie klassischerweise eng mit anderen Disziplinen zusammen: etwa mit der (Religions-)Psychologie, der Soziologie oder auch der Linguis tik.
War um muss es Ihre Disziplin unbedingt ge ben?
Friedrich Schleiermacher vergleicht das Studium der Theologie mit dem Bild eines Baumes: Die Wurzel bildet die Philosophische Theologie, den
Stamm die Historische Theologie. Die Praktische Theologie ist in seinem Bild die Baumkrone. Wenn er die Praktische Theologie als »Krone des theologischen Studiums« bezeichnet, so meint er damit keine Abwertung der anderen Fächer, sondern: Die Praktische Theologie braucht die anderen Fächer, um religiöse Praxis wahrnehmen und beschreiben zu können. Aber: Die anderen Fächer bleiben ohne die Praktische Theologie im luftleeren Raum, weil erst durch die Praktische Theologie der Bezug zur Praxis deutlich wird.
Einige Veranstaltungstitel aus der Praktischen Theologie
Praxisübung Seelsorge
Urlaub und Religion
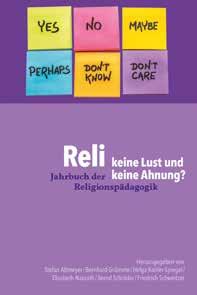
Schulgottesdienst und religiöse Vielfalt
Gleichnisse im Religionsunterricht
Begleitseminar zum Schulpraktikum
Digitalisierung als theologische und religionsdidaktische Herausforderung
Zur Theorie öffentlicher religiöser Rede Geschichte der Religionspädagogik Verschwörungstheorien als pastorale Herausforderung
Kinder und Theologie
Religion und Film
Fragen an Daria Pezzoli-Olgiati, Professorin für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und an Verena Eberhard, wissenschaftliche Mitarbeiterin Womit beschäftigt man sich in Ihrer Disziplin? Religionswissenschaft ist eine Disziplin, die sich mit Menschen und Kulturen beschäftigt. Sie untersucht Religionen in Gesellschaften der Geschichte und der Gegenwart. Mit »Religion« fasst man in dieser Fachrichtung eine Vielfalt von Phänomenen zusammen. Eine Besonderheit von Religion ist, dass sie sich auf Transzendenz bezieht, das heißt auf Erfahrungen, die Menschen nicht unmittelbar begreifen können, wie zum Beispiel den Tod oder transzendente Wesen wie Götter und Engel. In der Religionswissenschaft erforscht man, wie Menschen eine Verbindung zu dieser Sphäre herstellen und welche Medien sie dafür benutzen. Wir interessieren uns sowohl für religiöse Menschen und Gemeinschaften, als auch für Darstellungen von Religion in der Öffentlichkeit. Unterschiedliche Perspektiven auf Religion sind dabei sehr wichtig. In der Religionswissenschaft erforscht man die Veränderungen, die religiöse Traditionen im Laufe der Zeit erfahren, aber auch Formen von Religion, die sich nicht so leicht einer Tradition zuordnen lassen. Religion spielt eine Rolle in der Politik, in den Medien, wie zum Beispiel in der Werbung, in der Wirtschaft, der Kunst oder auch im Sport. All diese Dimensionen sind sehr wichtig, wenn man verstehen möchte, wie sich Menschen im Leben orientieren und was für sie wichtig ist. Religion kann dabei eine positive Rolle übernehmen und dazu beitragen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird. Religion kann aber auch zu Missbrauch und Gewalt führen. Wir kümmern uns um alle Aspekte dieses Phänomens, das so alt ist wie die Menschen.
Was finden Sie daran besonders spannend?
Religion umfasst nicht nur das, was Menschen machen, sondern auch ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, Träume und Erwartungen für das Leben und auch für das Jenseits. Religion ist ein System, das eng mit Gesellschaften und Kulturen verflochten ist. Wenn man sich mit Religion beschäftigt, erfährt man sehr viel über Menschen, ihre Gewohnheiten, ihre Erwartungen und ihre Ängste. Religion prägt die Art und Weise, wie eine Gesellschaft organisiert wird, wie Macht verteilt
wird und wie die Geschlechter definiert werden. Sie beeinflusst Werte und Normen. Religion spiegelt sich in Literatur, Kunst, Film und in der populären Kultur. Damit liegt man so richtig im Kern menschlicher Kultur. Welche Methoden werden in dieser Disziplin angewendet?
Religionswissenschaft ist sehr interdisziplinär ausgerichtet: Im Kontext der Universität arbeitet sie mit vielen anderen Fächern zusammen. Sprachen spielen eine große Rolle in dieser Disziplin, um Texte zu lesen und sich mit Menschen auszutauschen. Methoden der Untersuchung von Medien wie Bilder, Filme, Architektur oder Gegenstände sind zentral. Auch die Kenntnisse der Geschichte Europas und anderer Kulturen ist sehr wichtig. Wir versuchen, religiöse Phänomene zu beschreiben, um sie im Kontext der Gesellschaft zu deuten. Durch die Methode des Vergleichs lernt man, kulturelle Vielfalt zu untersuchen.
War um muss es Ihre Disziplin unbedingt geben? Religion ist ein ambivalentes Phänomen. Religion kann Orientierung stiften und Menschen einen Sinn des Lebens geben. Sie kann zu großartigen Entwicklungen führen: Gesellschaftliche Innovationen, Gleichberechtigung, Einsatz für andere Menschen oder moralische Entscheidungen haben häufig mit Religion zu tun. Auch künstlerische, musikalische oder architektonische Wunder wurden und werden sehr häufig im religiösen Kontext erschaffen. Religion kann aber auch als Legitimation von Missbrauch, Gewalt und Zerstörung eingesetzt werden. Beides soll untersucht und verstanden werden, wenn man wissen möchte, wer der Mensch ist, wie er sein Leben in der Gemeinschaft historisch organisiert hat und in der Gegenwart gestaltet. Für eine florierende, diverse Demokratie ist das Wissen über Religion unentbehrlich.
Einige Veranstaltungstitel
Auf vielen Hochzeiten tanzen. Materielle und mediale Dimensionen eines Rituals
Das Eigene und das Andere
Einführung in den gelebten Hinduismus der Moderne anhand eines Bollywood-Films
Konstruktionen von Weiblichkeit im frühen Christentum und frühen Islam
In der unten abgebildeten Fastenaktion »7-Wochenohne« der Evangelischen Kirche wird dazu aufgerufen, in der Fastenzeit eigene Gewissheiten und Denkmuster zu hinterfragen und »mündig« im Denken zu sein. Im Studium der Theologie wird immer wieder aufs Neue die Gelegenheit dazu geboten. Es geht darum, eigene Gewissheiten in Sachen Religion und Glauben kritisch zu reflektieren. Beim Sich-Selbst-Gedanken-Machen können die unterschiedlichen theologischen Disziplinen und ihre jeweiligen Perspektiven eine Hilfe sein. Vorgestellt wurden diese auf den S. 135–141. Abhängig vom Studiengang (z. B. L ehramt, Pfarramt, Bachelor, Master, Promotion) studiert man die theologischen Disziplinen in unterschiedlicher Auswahl und Intensität. So wie das vielschichtige Studium der Theologie sind auch die Berufe, die eingeschlagen werden können. Religionslehrkräfte haben Theologie studiert; Gemeindepfarrer und Pfarrerinnen ebenfalls. Aber auch im Journalismus, in der Wirtschaft, im Bereich der Politik und im Bereich der Erwachsenenbildung und in vielen anderen Berufen werden Sie auf Menschen treffen, die einen der verschiedenen theologischen Studiengänge absolviert haben. Vielleicht ist es ja für Sie eine Zukunftsoption? Auf den Internetseiten der Universitäten, an denen man Evangelische Theologie bzw. Evangelische Relig ionslehre studieren kann, und in den Studienberatungen erfahren Sie mehr.
Eine Auswahl an Studiengängen in der evanglischen Theologie:
Evangelische Theologie für Pfarramt
Evangelische Theologie / Religionslehre für Lehramt für Gymnasium, Real-, Mittel- und Grundschule sowie als Didaktikfach für Mittelund Grundschulen (auch Sonderpädagogik)
Evangelische Theologie für Bachelor (im Hauptund Nebenfach) in Kombination mit anderen Fächern, wie z. B. Philosophie oder Volkswirtschaftslehre
Verschiedene Möglichkeiten der Vertiefung im Master, zum Beispiel: Lehramt für berufliche Bildung
Theologien interreligiös – Interfaith studies
Religionen verstehen / Religious Literacy
(Kooperation von Evangelisch-Theologischer Fakultät mit anderen Fakultäten und Instituten wie der Islamischen Theologie, der Judaistik und der Philosophie)

»Ich hatte mich im Vorfeld allein mit der Bibel auseinandergesetzt. Darin gab es viele Stellen, die ich überhaupt nicht verstand, andere, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war. Ich hatte große Zweifel, ob eine Religion, die sich auf dieses Buch stützt, überhaupt meine Religion bleiben kann. Ich haderte mit den christlichen Kreuzzügen und der Idee der Mission an sich. Ein Studium, das mich auf die Verkündigung und Arbeit als Pfarrerin vorbereitet, war daher ausgeschlossen für mich. Trotzdem wollte ich nicht einfach sofort aus der Kirche austreten, denn ich war mir bewusst, dass die Bibel kein Buch ist, das man einfach liest und auf Anhieb alles einordnen kann. Darüber hinaus hatte ich auch mit meinen Zweifeln und meiner Kritik gute Erfahrungen in meiner liberalen Heimatgemeinde gemacht. Also beschloss ich, der Religion eine Chance zu geben und mich frühestens zu distanzieren, wenn ich mich vertieft damit auseinandergesetzt hatte.
»Ein Aspekt war meine Vorstellung vom Studium an sich. Ich war nicht auf der Suche nach einer »Ausbildung«, die mich in möglichst kurzer Zeit, inhaltlich möglichst präzise auf eine Arbeitsstelle vorbereitet. Ich war begeistert für das Abenteuer »Bildung«. Ich wollte Zeit haben, mit interessanten Menschen über interessante Themen und große Lebensfragen ins Gespräch zu kommen. Nach der breitgefächerten Ausbildung am Gymnasium genoss ich es, endlich selbst entscheiden zu können, in welchen »Fächern« ich weiterhin unterrichtet werden wollte. Trotzdem wünschte ich mir, dass eine große Vielfalt im geisteswissenschaftlichen Bereich erhalten bleiben konnte. Kenntnisse in alten Sprachen, Literatur, Geographie und Geschichte, Bibelwissenschaften und philosophische Fragen. Das Theologiestudium bot das alles, kein Seminar war wie das andere. Ich bin auch im Nachhinein davon überzeugt, dass junge, flexible, aufgeschlossene Akademiker ihren Berufsweg finden, wenn sie diesen Bildungsweg einschlagen.
»Wenn ich daran denke, wie ich mir meine zukünftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen vorgestellt habe, frage ich mich manchmal, warum ich mich für Evangelische Theologie einschreiben wollte: Birkenstocksandalen an den Füßen, eine Gitarre auf dem Rücken und vertieft ins Gebet in jeder Freistunde. Die anderen Erstsemester hatten wohl ähnliche Vorurteile und so waren wir bei unserer ersten Begegnung positiv überrascht, wie normal die anderen sind. Wobei es ›normal‹ nicht gut beschreibt: Das Tolle ist eigentlich, dass das Studium die verschiedensten Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen zusammenbringt und es gerade das so spannend macht.
»Für mich stehen Glaubensfragen im Mittelpunkt. Ich finde es schön, die Möglichkeit zu haben, sich in theologische Literatur zu vertiefen und mit anderen zu diskutieren, welche Antwortversuche heute tragen. Die wissenschaftliche Herangehensweise an die Bibel war für mich zunächst sehr fremd. Manchmal habe ich mich gefragt: Stimmt das alles nicht, was ich eigentlich für ganz sicher gehalten habe? Inzwischen merke ich, dass sich mein Glaube verändert hat. Von einigen Überzeugungen habe ich mich verabschiedet, in anderen Fragen habe ich für mich neue Gewissheit gefunden. Mal sehen, was noch passiert.
»Ich möchte Pfarrerin werden und möglichst viel lernen, was mir hilft, interessante Gottesdienste zu gestalten und mich in der Seelsorge anderen Menschen so zuzuwenden, dass es ihnen wirklich auch hilft.
»Ich möchte Grundschullehrer werden. Ich habe eine Fächerkombination mit Evangelischer Religionslehre gewählt, da es einfach ein besonderes Fach ist, in dem man einen wirklich persönlichen Kontakt zu den Kindern bekommt. Vielleicht weil man Zeit hat, mit ihnen über ganz grundlegende Fragen des Lebens zu sprechen. Ich durfte es schon im Praktikum ausprobieren, das hat großen Spaß gemacht. Aber die Kinder haben mir auch sehr schwierige Fragen nach Gott und der Welt gestellt – da bin ich froh, dass ich noch einige Semester Theologiestudium vor mir habe.
Im zweiten Kapitel dieses Buches haben Sie über das Verhältnis von »Glauben und Vernunft« nachgedacht und dabei Jürgen Baumerts Modell der Weltzugänge kennengelernt ( S. 39): Unterschiedliche Wissenschaften – und entsprechend unterschiedliche Schulfächer – betrachten die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven, stellen unterschiedliche Fragen, sprechen unterschiedliche Sprachen, wenden unterschiedliche Methoden an. Dabei ist keiner dieser Zugänge den anderen überlegen, vielmehr ergänzen und begrenzen sie sich gegenseitig. Doch es ist die eine Welt, auf die sie sich beziehen, und es ist der einzelne Mensch, in dessen Kopf sie zusammentreffen. So stehen auch Sie als Schülerin und Schüler vor der Herausforderung (die im Bild angedeutet ist), die einzelnen Fächer Ihres Stundenplans nicht einfach so nebeneinander stehen zu lassen, sich aber auch nicht durch ihre Vielfalt durcheinanderbringen zu lassen, sondern sie in ihrer Unterschiedenheit in Ihr Weltbild zu integrieren. Solche fächerverbindende »Mehrsprachigkeit« muss man üben. Im Unterricht gibt es immer wieder Situationen, in denen man Bezüge zu anderen Fächern entdeckt oder in denen die Expertise von Fachleuten nötig ist. Besonders geeignet zum fächerverbindenden Lernen sind gemeinsame Aktionen, Projekte, Studientage, Wissenschaftswochen, die bestimmte Themen aus der Sicht mehrerer Fächer und Wissenschaften beleuchten. Das Fach Religionslehre (aller Konfessionen und Religionen) mit der Bezugswissenschaft Theologie ist bei solchen Projekten eine wichtige Partnerin. Wenn Religion »Weltabstand« ist und das Ganze der Welt in den Blick nimmt, dann ergeben sich Berührungspunkte zu Fragestellungen aller Wissenschaftsbereiche. In den Interviews auf S. 135–141 wurde deutlich, wie sehr jede theologische Disziplin vom interdisziplinären Dialog lebt.
In den Aufgabenstellungen und Materialien dieses Buches finden sich vielfältige Anregungen zum fächerverbindenden Arbeiten. Größere Projekte – bezogen auf die L ernbereiche der Jahrgangsstufe 11 – wären z. B. zu folgenden Themen denkbar:
»Zwischenräume«: das Leitmotiv dieses Buches könnte zu einem Projekt z. B. mit Kunst, Mathematik, Literatur oder Sozialkunde anregen.

Die Epoche der Aufklärung lässt sich aus der Sicht von Kunst, Musik, europäischer Literatur, Geschichtswissenschaft, Theologie und Philosophie erforschen und beschreiben.
Beim Thema Schöpfung und Evolution sind z. B. Fächer wie Ethik, Biologie und Physik wichtige Diskussionspartner.
Freiheit, das Kernthema evangelischen Glaubens, ist ein zentrales Thema der politischen Bildung, der Geschichte, der Literatur und Philosophie, der Neurowissenschaften und Psychologie.
Zusammen mit anderen Fächern lässt sich die Beschäftigung mit Judentum oder Islam vertiefen (ihre Geschichte und politische Bedeutung; ihre Kultur, z. B. Kunst, Literatur und Musik).
Ein Thementag oder eine Themenwoche zum Thema Toleranz würde über die einzelnen Fächerbezüge hinaus auch Fragen des Schullebens einbeziehen. Die Wirkungsgeschichte einzelner biblischer Traditionen lässt sich in Kooperation mit Deutsch, Kunst, Musik , Fremdsprachen und Philosophie untersuchen.

donaj (hebr. [mein] Herr): Gottesbezeichnung im Alten Testament und Judentum.
Akgün, Lale (*1953) ist eine deutsche Politikerin und engagiert sich u. a. für die Etablierung eines liberalen Islams in Deutschland.
Amnesty International ist die größte Menschenrechtsorganisation, die u. a. durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, thematische Kampagnen, Eilaktionen (»urgent actions«), Briefe und Appelle gegen die Verletzung von Menschenrechten kämpft. Sie agiert weltweit und hat Mitglieder in 150 Ländern. Dabei bezieht sie sich auf alle Menschenrechte, die in der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« proklamiert werden. Die Organisation ermittelt und dokumentiert Menschenrechtsverletzungen, unterstützt Menschen, die in repressiven Staaten Kritik an der Regierung und am politischen System üben, interveniert, wenn akut das Leben von Menschen bedroht ist, und engagiert sich im Bereich Menschenrechtsbildung. Amnesty International finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.
»Answers in Genesis«, kurz AiG, ist der Name einer kreationistischen Organisation, deren Ziel es ist, die Wahrheit der Bibel dadurch zu beweisen, dass diese die Entstehung der Welt plausibler erkläre als die Evolutionstheorie. Mitglieder der Organisation gehen aufgrund einer wörtlichen Auslegung von Gen 1–11 davon aus, dass die Erde und die anderen Himmelskörper ca. 6000 Jahre alt (sog. Junge-Erde-Kreationismus) und alle Menschen biologische Nachkommen Adam und Evas seien. Gott habe eine Sintflut geschickt, die u. a. die meisten Dinosaurier aussterben ließ. Die durch die Arche geretteten Paare hätten teils noch länger mit den Menschen gelebt, was sich schließlich in Drachenlegenden niedergeschlagen habe. AiG betreibt einen riesigen medialen, publizistischen und pädagogischen Aufwand, um die eigene Weltsicht zu verbreiten.
apokalyptisch bedeutet im engeren Sinn: auf das biblische Buch Apokalypse (Offenbarung) des Johannes bezogen. Allgemein beschreibt der Begriff auch ein (katastrophales) Weltende und wird daher auch in Bezug auf besonders verheerende Katastrophen verwendet.
Apokryphen, apokryph (griech.: verborgen, dunkel) nennt man Bücher, die den biblischen Schriften nahestehen, aber nicht zum verbindlichen Bestand der Bibel gehören. Die apokryphen Schriften Judit, Weisheit Salomos,Tobit, Jesus Sirach, Baruch, 1. und 2. Makkabäerbuch sowie Zusätze zu Ester und Daniel werden in katholischen und orthodoxen Bibeln zum Alten Testament gezählt, in lutherischen Bibelausgaben sind sie manchmal mit abgedruckt (Luther hielt die Apokryphen für gut und nützlich zu lesen). Darüber hinaus gibt es auch neutestamentliche Apokryphen, z. B. das Thomasevangelium, das eine Sammlung von Aussprüchen Jesu enthält, oder das Kindheitsevangelium des Thomas mit Legenden aus der Kindheit Jesu.
apostolisch: Mit diesem Begriff soll ausgesagt werden, dass etwas im Sinne der Apostel ist oder von ihnen ausgeht. Mit der Bezeichnung »apostolisches Glaubensbekenntnis« will man also sagen, dass es dem Glauben der Apostel entspricht. In der katholischen Kirche bedeutet apostolisch oft auch päpstlich, weil sich der Papst als Nachfolger des Apostels Petrus sieht.
Atheismus (griech. a-theos: nicht göttlich, gottlos): Bestreitung der Existenz Gottes bzw. eines transzendenten Wesens.
Aufklärung als Epochenbezeichnung bezieht sich vor allem auf die Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts. Die Aufklärer wollten mit den Mitteln der Vernunft alte Vorstellungen über die Welt überwinden. Grundlage aller Erkenntnis sollten sinnliche Wahrnehmungen sein, die durch den Verstand geordnet werden. Dies bewirkte große Fortschritte in Naturwissenschaften und Technik. Im politischen Bereich setzte man sich für die Gleichheit und Freiheit aller Menschen und den Toleranz-Gedanken ein. Das neue Denken sollte auch für die Religion gelten: Gott habe zwar die Welt in Gang gesetzt und sinnvoll eingerichtet, greife aber seitdem nicht mehr in sie ein. Entsprechend wurde alles Übernatürliche abgelehnt bzw. durch Naturwissenschaft und historisch-kritische Forschung erklärt. Sinn der Religion sei es, moralisches Verhalten und Tugenden wie Nächstenliebe zu fördern, nicht Weltdeutung.
Augustin(us) (354–439) war einer der bedeutendsten christlichen Theologen und Philosophen der Spätantike und wird häufig als Vater der abendländischen Theologie angesehen.
außerkanonisch Kanon
Barmer Theologische Erklärung: Die Erklärung der Synodalversammlung in Barmen vom 31. Mai 1934 (»Bekenntnissynode«) ist die zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kirche unter der nationalsozialistischen Herrschaft 1933–1945. Sie richtet sich gegen die Theologie und das Kirchenregime der sog. Deutschen Christen, welche die evangelische Kirche der Diktatur Adolf Hitlers anzugleichen versuchen. Die EKD bestätigt in Artikel 1 (3) ihrer Grundordnung mit ihren Gliedkirchen die von dieser Bekenntnissynode getroffenen Entscheidungen. Auch die Gliedkirchen der EKD betrachten die Barmer Theologische Erklärung als wegweisendes Lehr- und Glaubenszeugnis der Kirche.
Bauhaus ist der Name für eine stilprägende Hochschule für Gestaltung in den 1920er-Jahren, die sich in Weimar, dann Dessau und bis kurz vor ihrer Schließung 1933 in Berlin befand. Programmatisch ging es weniger um das künstlerische Einzelwerk als vielmehr um einen praktischen Alltagsbezug. In Zusammenarbeit mit Handwerk und Industrie sollten neue Design-Formen für das Zusammenleben entwickelt werden, die sich zugleich industriell nutzen lassen.
Bedford-Strohm, Heinrich (*1960) ist ein deutscher evangelisch-lutherischer Theologe mit dem Schwerpunkt Sozialethik. Er ist seit 2011 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und war von 2014 bis 2021 Ratsvorsitzender der EKD. An seinem ehemaligen Bamberger Lehrstuhl entstand die Dietrich-Bonhoeffer-Forschungsstelle für Öffentliche Theologie, an der theologische Fragen von öffentlicher Bedeutung reflektiert werden.
Befreiungstheologie, entstanden in Lateinamerika in den Jahren 1960–1970, fragt aus der Perspektive von unterdrückten bzw. unterprivilegierten Gruppen, Völkern und Ethnien nach dem Befreiungspotential der
christlichen Botschaft. Sie ist stark eschatologisch geprägt. Dabei wird auch an apokalyptische Traditionen positiv angeknüpft. Darüber hinaus werden in Aufnahme prophetischer Kritik bestehende Unrechtsverhältnisse und Ursachen für Armut und Ungerechtigkeit angeprangert. Sie fordert eine Kirche der Armen, in der schon jetzt darum gerungen wird, wie sich Kennzeichen des Reiches Gottes wie Friede und Gerechtigkeit verwirklichen lassen.
Bibliodrama ist ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden der szenischen Umsetzung und Aneignung von Bibeltexten. Indem man biblische Texte »spielt«, legt man sowohl diese Texte als auch die eigene Lebenssituation aus und bringt beides miteinander ins Spiel. Auf das Spiel folgt eine Phase der Reflexion und des Austausches.
Bibliolog: Bei dieser Form des Umgangs mit der Bibel wird mit den »Zwischenräumen« des Bibeltextes gearbeitet. Man füllt die Leerstellen des Textes, indem man – angeleitet durch eine/n Gesprächsleiter/in – z. B. einzelnen Gestalten oder Gegenständen einer biblischen Geschichte eine Stimme gibt. Diese Methode, oft in Gemeinden oder Schulklassen angewendet, ermöglicht es, die biblischen Texte einerseits unmittelbar auf das eigene Leben zu beziehen, andererseits sich aber auch immer wieder in der Reflexion davon zu distanzieren.
Bieri, Peter (*23. Juni 1944) ist Philosoph und Schriftsteller; er lehrte Philosophie an verschiedenen Universitäten in Deutschland. Seine Publikationen befassen sich u. a. mit Zeit und Zeiterfahrungen, mit philosophischer Psychologie, mit Erkenntnistheorie und mit dem freien Willen. An der Sicht, dass man das menschliche Bewusstsein mithilfe der Neurowissenschaften hinreichend erklären könnte, übt er immer wieder Kritik.
Bloch, Ernst (1885–1977) war ein deutscher Philosoph jüdischer Herkunft; als sein Hauptwerk und zugleich als Leitmotiv seiner Philosophie gilt das »Prinzip Hoffnung«. Er vertrat einen Atheismus marxistischer Prägung, doch sah er in den biblischen Traditionen (z. B. in der Exodusüberlieferung oder im Protest Hiobs) ein wichtiges Hoffnungs- und Befreiungspotential.
Bonhoeffer, Dietrich (*4. Februar 1906 in Breslau; †9. April 1945 im KZ Flossenbürg) war ein evangelischer Theologe, der sich im »Dritten Reich« aktiv am Widerstand gegen Adolf Hitler und dessen Diktatur (Nationalsozialismus) beteiligte. Am 5. April 1943 wurde er deshalb verhaftet und kurz vor Kriegsende im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Viele Menschen kennen sein Gedicht »Von guten Mächten wunderbar geborgen« (EG 65 und 637), das er im Gefängnis für seine Verlobte schrieb. Eines seiner bedeutendsten Werke ist die »Ethik«, 1939 begonnen und mit seinem Tod abgebrochen.
Buber, Martin (*1878 in Wien, †1965 in Jerusalem) war ein bedeutender jüdischer Religionsphilosoph, der sich in seinen Schriften mit der Religion und Geschichte des Judentums befasste und zusammen mit Franz Rosenzweig eine moderne Übersetzung der hebräischen Bibel verfasste. Er trat für ein friedliches Zusammenleben in Palästina ein.
Buren (von niederl. boeren: Bauern) ist die Bezeichnung für ursprünglich überwiegend aus den Niederlanden stammende europäische Siedler, die sich seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor allem in Südafrika niedergelassen haben. Sie selbst nannten sich meist »Afrikaaner«. Mit den Buren verbindet sich eine komplexe Geschichte bis heute, in der diese einerseits an der gewaltsamen Verdrängung von Einheimischen von ihrem Land und an einem Apartheitssystem beteiligt waren, andererseits aber auch selbst zu Opfern von Gewalt der britischen Armee im zweiten Burenkrieg wurden.
Chicago-Erklärung: Zwischen 1978 und 1986 formulierte der Internationale Rat für biblische Irrtumslosigkeit (International Council on Biblical Inerrancy), eine Gruppe evangelikaler Theologen v. a. aus den USA, drei Erklärungen zur Auslegung der Bibel. Darin wird ein fundamentalistisches Schriftverständnis vertreten: Die ganze Bibel sei wortwörtlich von Gott gegeben und stelle darum die verbindliche Autorität für alle Lebensbereiche dar.
Codex Sinaiticus wird ein berühmtes Bibelmanuskript aus dem 4. Jh. genannt, das 1844 von Konstantin von Tischendorf im Katharinenkloster am Berg Sinai ent-
deckt wurde. Es enthält neben Schriften des griechischen Alten Testaments die älteste vollständige Handschrift des Neuen Testaments.
Deismus nennt man die Überzeugung, dass zwar die Schöpfung göttlichen Ursprungs sei, dieser Schöpfergott aber darüber hinaus nicht in das Weltgeschehen eingreife. Als bekannter Anhänger des vor allem in der Aufklärung vertretenen Deismus gilt Gottfried Wilhelm Leibniz. Von ihm stammt auch das bekannte Sprachbild Gottes als Uhrmacher, der die Welt so perfekt hergestellt und in Gang gesetzt hat, dass ein weiteres Eingreifen Gottes nicht nötig ist. Deisten, die alternativ auch Freidenker oder Naturalisten genannt wurden, berufen sich auf die von Gott allen Menschen gegebene Vernunft, die eine »natürliche«, also eine nicht geoffenbarte Gotteserkenntnis zulasse.
Denkschrift ist die Bezeichnung für einen Text zu einer bestimmten Fragestellung, der als Standpunkt der Unterzeichner veröffentlicht und für besonders denkwürdig gehalten wird. Die Fachgremien der EKD haben mehr als 20 solcher Denkschriften seit 1962 ausgearbeitet und dem Rat der EKD (das Gremium, das die Geschäfte zwischen den jährlich stattfindenden Synoden führ t) zur Verabschiedung vorgelegt.
Deutscher Wissenschaftsrat: Gremium, das Bund und Länder bezüglich Fragen der Wissenschaftspolitik und der Weiterentwicklung von Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Institutionen berät.
Diskurs bezeichnet bildungssprachlich einen öffentlichen Austausch von Gedanken und Argumenten –schriftlich und mündlich – zu einem bestimmten gesellschaftlichen, wissenschaftlichen oder politischen Thema. Ein Diskurs verändert sich, wenn sich in der Summe der öffentlichen Äußerungen eine veränderte Haltung zu dem verhandelten Thema zeigt.
Esperanto (wörtlich: der Hoffende) ist eine sogenannte Plansprache, also eine bewusst konstruierte Sprache, die mit der Absicht geschaffen wurde, die internationale, völkerverbindende Kommunikation zu erleichtern und den mit den natürlichen Weltsprachen verbundenen Ethnozentrismus abzulösen.
Evolutionstheorie erklärt und beschreibt die Entstehung der Arten als das Ergebnis einer stufenweisen Höher- und Weiterentwicklung (Evolution), die Tausende von Jahrmillionen umspannt. Somit trägt jedes Lebewesen auch die Geschichte seiner Gattung und anderer Gattungen aus den vergangenen Zeitaltern in sich. Als Ursache dieser Entwicklung werden vor allem Mutation bzw. Variation (Veränderung der vererbbaren Merkmale) und deren Rekombination (Neuverteilung) sowie natürliche Selektion angesehen. Die Evolutionstheorie wurde insbesondere durch Charles Darwin (1809–1882) begründet. Alle heutigen Ausprägungen der Evolutionstheorie beziehen dabei die sog. Abstammungsoder Deszendenztheorie ein, die besagt, dass alles Leben auf der Erde einen gemeinsamen Ursprung hat.
Exil, babylonisches (auch: babylonische Gefangenschaft) ist die Zeit des Aufenthalts der Juden in Babylonien nach der Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar II. Die Zeitspanne umfasst vermutlich die Jahre 587 bis 537 v. Chr. Die Rückkehr nach Jerusalem erfolgte mit der Erlaubnis des gegen die Babylonier siegreichen Perserkönigs Kyros II.
Exklusivismus: Wenn eine Religionsgemeinschaft für sich beansprucht, als einzige die Wahrheit zu vertreten und damit der Weg zum Heil auch nur durch sie und in ihr zu erlangen ist, spricht man von Exklusivismus. Die klassische Formulierung aus dem christlichen Bereich für diesen Anspruch ist die Aussage »extra ecclesiam nulla salus« (»außerhalb der Kirche kein Heil«), die 1215 auf einem Kirchenkonzil formuliert wurde. Später wurde dies von der katholischen Kirche dahingehend interpretiert, dass es heilsnotwendig sei, Glied der katholischen Kirche zu sein (»ekklesiologischer Exklusivismus«). Im Protestantismus wurde eine Formel geprägt, die weniger auf die Kirchen- bzw. Konfessionszugehörigkeit zielte, sondern auf das Bekenntnis zu Christus: »nulla salus extra Christum«. Berühmte Vertreter für solch einen »christozentrischen Exklusivismus« sind Martin Luther und Karl Barth.
EZW: Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen ist eine Forschungs-, Dokumentationsund Beratungsstelle der EKD. Ihre Aufgabe besteht darin, »die Entwicklungen im religiös-weltanschaulichen
Bereich zu beobachten und ihre Bedeutung für die Evangelische Kirche in Deutschland zu klären«. Sie will »zur christlichen Orientierung im religiösen und weltanschaulichen Pluralismus beitragen, einen sachgemäßen Dialog mit Anders- und Nichtglaubenden fördern« sowie »über Entwicklungen und Tendenzen der religiösen Landschaft in Deutschland informieren«. Dies geschieht z. B. durch Veröffentlichungen, Tagungen und Beratung.
Fake News meint üblicherweise eine gezielt erstellte Falschmeldung, die – meist über soziale Netzwerke verbreitet – die öffentliche Meinung manipulieren soll. Daneben wird die Bezeichnung auch als politischer Kampfbegriff verwendet, um unliebsame Nachrichten als angebliche Falschmeldungen zu diskreditieren.
Falsifikation meint die Widerlegung einer Hypothese durch eine dieser widersprechenden Beobachtung. Karl Popper hat aufgezeigt, dass Beobachtungen allenfalls erfahrungswissenschaftliche Annahmen widerlegen, aber nicht grundsätzlich bestätigen können, da die nächste Beobachtung zu einem anderen Ergebnis führen könnte. Somit ist eine Verifikation, also ein »Beweis« naturwissenschaftlich unmöglich.
Faust: Johann Wolfgang von Goethes Werk »Faust I«, auch »Faust. Der Tragödie Erster Teil« oder »Faust. Eine Tragödie« genannt, wurde 1808 veröffentlicht und gilt als eines der bedeutendsten und am häufigsten zitierten Werke der deutschen Literatur. Im Prolog im Himmel schließen Mephisto (der Teufel) und der Herr (Gott) eine Wette ab, die an die Wette im Buch Hiob erinnert: Nachdem Mephisto über die Menschen gelästert hat, führt der Herr als Gegenbeispiel den Gelehrten Dr. Faust an, doch Mephisto wettet darauf, ihn vom rechten Weg abbringen zu können. Der Herr lässt Mephisto gewähren, darauf folgt die eigentliche Dramenhandlung: Deprimiert, weil er trotz all seiner Studien den Sinn des Lebens nicht findet, schließt Dr. Faust mit Mephisto einen Pakt: Wenn Mephisto es schafft, dass Faust einen glücklichen Augenblick festhalten möchte, dann gehört ihm Fausts Seele. Mephisto verführt Faust zu einer Affäre mit einem jungen Mädchen: Gretchen. Faust schwängert Gretchen und verursacht den Tod ihrer Mutter und ihres Bruders. In
ihrer Verzweiflung tötet Gretchen ihr Neugeborenes und wird zum Tode verurteilt. Faust und Mephisto fliehen.
Fichte, Johann Gottlieb (1762–1814) war ein deutscher Philosoph. Er arbeitete nach seinem Studium der Theologie und Philosophie als Hauslehrer, bevor er mit seinem zunächst anonym erschienenen (und Immanuel Kant zugeschriebenen) Werk »Versuch einer Kritik aller Offenbarung« berühmt wurde und ihm ein Philosophielehrstuhl in Jena angeboten wurde. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Erlangen, Königsberg und Berlin. Fichte gilt neben Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Idealismus.
Freie Künste: Seit der Spätantike zählte man zu den sieben freien Künsten meist Grammatik, Rhetorik und Dialektik, die in den Elementarschulen unterrichtet wurden, sowie Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie, die der höheren Bildung vorbehalten blieben.
Freiheitsschrift Luthers: Luthers heute wohl meistgelesene Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« beschäftigt sich mit der scheinbar widersprüchlichen Existenz des »Christenmenschen«: Indem sich der Mensch ganz auf Gott verlässt, ist er von allen Zwängen der Welt frei. Da der Mensch die Liebe, die er selbst von Gott erfährt, anderen weitergeben möchte, bindet er sich aber freiwillig im Dienst an seinen Mitmenschen.
Freud, Sigmund (1856–1939) war als Neurologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker v. a. in Wien tätig; bekannt wurde er vor allem durch seine Studien zum Unbewussten und als Begründer der Psychoanalyse. Wichtig für den theologischen Diskurs sind auch seine religionskritischen Schriften.
fundamentalistisch: Mit diesem Begriff fasst man weltanschauliche und religiöse Haltungen zusammen, die durch kompromissloses Festhalten an Grundsätzen (lat. fundamentum: Grundlage) und durch einen radikal vertretenen Wahrheitsanspruch gekennzeichnet sind. Am häufigsten hört man diesen Begriff heute im Zu-
sammenhang mit islamistischen Gruppierungen, doch auch im Christentum sowie in anderen Religionen und Weltanschauungen finden sich fundamentalistische Strömungen. In Bezug auf die Bibel vertreten christliche Fundamentalisten ihrem Selbstverständnis nach die wortwörtliche Geltung des gesamten Textes, betonen aber in der Regel einzelne Bibelstellen (z. B. Schöpfungsgeschichte nach Gen 1, Aussagen zu Homosexualität) und lehnen historische Kritik ab. In den USA spielt der christliche Fundamentalismus in der Politik eine wichtige Rolle. Hier entstand auch der Begriff. Zwischen 1910 und 1915 verfassten konservative Protestanten, die den Zerfall ihrer Religion befürchteten, eine Reihe von Schriften: »The Fundamentals – a Testimony to the Truth« (»Die Fundamente – ein Zeugnis für die Wahrheit«). Diese Schriften fanden ein Millionenpublikum.
Giordano-Bruno-Stiftung (gbs): Das Ziel der gbs ist, einen evolutionären Humanismus sowie eine auf ihm basierende Ethik zu fördern und über traditionelle religiöse und politische »Ideologien« kritisch aufzuklären. Letztere könnten die Herausforderungen des 21. Jh.s nicht meistern, da sie moderne wissenschaftliche Erkenntnisse nicht berücksichtigten. Zur Verdeutlichung werden z. B. in Publikationen religiöse Texte nicht historisch-kritisch wahrgenommen und hinsichtlich einer möglichen Aussagekraft für die Gegenwart ausgelegt, sondern unmittelbar mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder z. B. den Allgemeinen Menschenrechten konfrontiert. Der Mensch selbst wird in der gbs als Zufallsprodukt der Evolution gesehen, dessen Würde dadurch bestimmt sei, dass der Einzelne über seine Würde bestimmen dürfe. Der Staat solle weltanschaulich neutral sein, so dass jede Person ihre eigene Weltanschauung leben könne, solange diese nicht in Konflikt mit den Rechten Dritter oder den Werten von Gerechtigkeit und Humanität stehe. Die gbs verbreitet ihre Sichtweisen medial und publizistisch. Einige Öffentlichkeitskampagnen richten sich dabei an Kinder.
Gottesbeweise nennt man Versuche, den Glauben an Gott als denkerisch vernünftig darzustellen. Bei diesen geht es ursprünglich weniger darum, Ungläubige durch möglichst zwingende Argumente von Gottes Existenz
zu überzeugen, sondern vielmehr darum, den Glauben an Gott mithilfe der Vernunft so darzulegen, dass sich ein vertieftes Verständnis für die Gläubigen ergibt. So wird z. B. beim sog. kosmologischen Gottesbeweis darauf verwiesen, dass nichts, was existiert, aus sich selbst heraus entsteht. Entsprechend müsse auch der Kosmos einen Ursprung und eine Ursache außerhalb seine selbst haben. Gottes Existenz dagegen bedürfe keines Grundes und sei somit als Ursprung zu denken. Immanuel Kant hat die sog. Gottesbeweise einer grundlegenden Kritik unterzogen und aufgezeigt, dass die aufgestellten Kausalitäten nicht zwingend, sondern nur möglich seien.
Habermas, Jürgen (*1929 in Düsseldorf) ist einer der meistgelesenen Philosophen und Soziologen der Gegenwart. Sein Denken zielt einer Selbstaussage nach auf eine »Versöhnung der mit sich selber zerfallenden Moderne« ab, sodass mithilfe der Vernunft eine Grundlage für das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen gefunden und das Projekt der Aufklärung sinnvoll fortgeführt werden kann. Er bezog zu allen großen gesellschaftspolitischen Kontroversen der Bundesrepublik Stellung. Berühmt ist seine Vision eines »her rschaftsfreien Diskurses«.
Hadith (arab. hadīth: Erzählung, Gespräch) bezeichnet die Berichte über Aussprüche, Anordnungen und Handlungen des Propheten Muhammad und anderer Personen des frühen Islam, deren Überlieferung auf seine Gefährten zurückgeführt wird. Die überlieferten Handlungen und Aussprüche gelten vor allem im sunnitischen Islam als wegweisend und sind neben dem Koran die zweite wichtige Quelle für Glaubens- und Rechtsfragen.
Hanīf beschreibt einen Menschen, der sich schon in vorislamischer Zeit von den »heidnischen Götzen« abwendet und auf reine und ursprüngliche Weise allein Gott verehrt. Mit dem Wort Hanīf ist im Koran ein Konzept verbunden, das den Islam mit der Religion Abrahams identifiziert, der – ebenso wie der Prophet Muhammad – als Hanīf charakterisiert wird. Der Begriff Hanīf wird auch in Abgrenzung zu Juden und Christen gebraucht.
Hayek, Friedrich August von (1899–1992) ist ein Ökonom, der auch zu Themen der Rechts- und Sozialphilosophie publiziert hat. Ein besonders bekanntes Werk von ihm ist die »Die Verfassung der Freiheit«, in der er die individuelle Freiheit als Motor und Garanten der wirtschaftlichen und kulturellen Blüte von Gesellschaften bzw. den zivilisatorischen Fortschritt beschreibt und sich gegen einen Wohlfahrtsstaat wendet, da dieser letztlich sozialistische Umverteilungsziele umsetze. Mit diesem Werk lieferte Hayek eine philosophische Grundlage für den Neoliberalismus.
Heine, Heinrich (*1797 in Düsseldorf, †1856 im Pariser Exil) war ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Journalist aus der Epoche der Romantik und des Vormärz.
Herder, Johann Gottfried (1744–1803) war Theologe, Philosoph, Übersetzer und Schriftsteller. Er lebte lange in Weimar und gehörte zu den vier großen Dichtern der Weimarer Klassik neben Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Christoph Martin Wieland. Seine philosophischen, theologischen und sprachwissenschaftlichen Abhandlungen waren über die Grenzen hinaus für viele europäische Dichter wegweisend. Zu seinen populärsten Werken gehört »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«, in dem er seine Vorstellung des zur Humanität gebildeten Menschen darstellt.
Hermes ist einer der Götter der griechischen Mythologie. Er gilt als Bote des Zeus und Geleiter ins Totenreich, als Gott der Kaufleute und Reisenden, der Hirten, Wissenschaftler, Magier, Diebe, der Redekunst, des Dolmetschens und der Träume.
Hobbes, Thomas (1588–1679), englischer Philosoph, Staatstheoretiker und Mathematiker, verfasste in seinem bekanntesten Werk »Leviathan« (benannt nach dem biblischen Meerungeheuer) eine theoretische Begründung des Absolutismus; angesichts des unsicheren Naturzustands der Menschen, deren Zusammenleben durch Egoismus, Gewalt und den Kampf aller gegen alle charakterisiert ist, sieht er die Notwendigkeit der Übertragung aller Macht auf den Souverän.
Humboldt, Wilhelm von (1767–1835) war preußischer Staatsmann und vielseitig gebildeter Schriftsteller und Gelehrter. Er prägte das sog. »Humboldt’sche Bildungsideal«, das umfassende Bildung für jeden Menschen als Voraussetzung für die Persönlichkeitsentwicklung ansieht. Orientierung und Grundlage sollte dafür der Humanismus der Antike bieten. Humboldt prägte damit nicht nur das Bildungswesen seiner Zeit, sondern setzte Impulse, die bis in die heutige Zeit reichen. Er reformierte das von Geistlichen dominierte Bildungswesen und etablierte staatlich ausgebildete Lehrer. Er konzipierte anhand der nach ihm benannten Humboldt-Universität zu Berlin eine immer noch aktuelle Vorstellung von Universität, die Professoren nicht nur als Forschende begriff, sondern zu ihrem genuinen Aufgabengebiet auch die Lehre zählte. Humboldts Bildungsgedanke einer umfassenden, allgemeinen Bildung, zu der möglichst viele Menschen freien Zugang haben sollen, spielt in Diskussionen zu Bildungsgerechtigkeit und lebenslangem Lernen eine immer noch entscheidende Rolle.
Hume, David (1711–1767) war ein für die schottische Aufklärung wichtiger Philosoph und Historiker. Sein Denken wird dem philosophischen Empirismus zugeordnet, in dem die Erfahrung des Menschen und die kritische Prüfung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit als zentral für Wissensgewinn gesehen werden.
Inklusivismus bezeichnet ein Modell, das besonders prominent vom katholischen Theologen Karl Rahner (1904–1984) vertreten wurde. Es hält an dem exklusiven Wahrheitsanspruch der christlichen Religion fest, bietet aber eine denkerische Möglichkeit, nicht automatisch alle Menschen, die keine Christen sind (z. B. weil sie noch nie etwas von Christus gehört haben), für von Gott verworfen zu halten. Nach Ansicht Rahners könne auch ein Mensch einer anderen Religion Gott ansatzweise erkennen, z. T. aus eigenen, allen Menschen gegebenen Möglichkeiten der vernünftigen Erkenntnis Gottes (»natürliche Gotteserkenntnis«), andererseits aber auch aus Gnade, die durch Christus von Gott komme. Solche Menschen, die »von der Gnade und Wahrheit Gottes berührt« werden, können nach Rahner als »anonyme Christen« bezeichnet werden, auch wenn sie sich selbst nicht als Christen verstehen.
Der Inklusivismus wurde und wird nicht nur von katholischen Theologen vertreten, auch offizielle Äußerungen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche gehen in diese Richtung.
IS: Die dschihadistisch-salafistische Terrorgruppe, die sich selbst »Islamischer Staat« nennt und das Ziel verfolgt, einen Gottesstaat (Kalifat) im Nahen Osten zu errichten, hat ihren Ursprung im Irak. Dort und in Syrien kontrollierten die Anhänger des »IS«, die sich zu einer fundamentalistischen Auslegung des sunnitischen Islam bekennen, jahrelang weite Landesteile. Nach einem mehrjährigen Krieg gegen den »IS« verlor dieser zwar an Einfluss in der Region; viele ausländische IS-Kämpfer kehrten aber in ihre Heimatländer zur ück. Aktiv ist die Terrorgruppe »IS« insbesondere in Afghanistan, Libyen, im Jemen und auf den Philippinen; weltweit berufen sich Terroristen, die islamistisch motivierte Anschläge begehen, auf den »IS«.
Jung, Carl Gustav (1875–1961) war ein Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie. Er untersuchte u. a., welche Rolle Archetypen (überindividuelle Symbole) z. B. in Mythen, Märchen, Bildern oder Träumen bei der Entwicklung des Selbst spielen.
Kanon (griech.: Richtschnur) bezeichnet die jeweilige Sammlung als heilig geltender Schriften der jüdischen und christlichen Glaubensgemeinschaften. Im Bereich der christlichen Kirche wurde bis 350 n. Chr. der Kanon des Alten Testaments auf der Basis der Hebräischen Bibel des Judentums festgelegt; ca. 400 n. Chr. stand der Kanon des Neuen Testaments fest.
Kant, Immanuel (1724–1804) ist ein deutscher Philosoph und gilt als einer der bedeutendsten Denker der Neuzeit. Seine berühmte Aussage »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen« wurde zum Wahlspruch der Epoche der Aufklärung. Er war davon überzeugt, dass mit den Mitteln der Vernunft alte Vorstellungen und Vorurteile über die Welt durch kritische Prüfung überwunden werden können und der Mensch sich so zum Positiven weiterentwickeln wird. Sein Denken stellt einen Wendepunkt der Philosophiegeschich-
te dar. Er hat sich u. a. intensiv mit der Frage nach den Grenzen unserer Erkenntnis (»Was kann ich wissen?«) und mit Fragen der Ethik (»Was soll ich tun«?) befasst. Daraus erwuchsen die beiden Werke »Kritik der reinen Vernunft« (1781, 1787) und »Kritik der praktischen Vernunft« (1788).
Khorchide, Mouhanad (*1971) ist ein österreichischer Soziologe, Islamwissenschaftler und Religionspädagoge. Er tritt für eine historisch-kritische Koranauslegung und einen liberalen Islam ein. Im Rahmen der 6-jährigen Forschungszusammenarbeit mit Klaus von Stosch erschien erstmals ein Buch über Jesus im Koran, das gemeinsam von einem muslimischen und einem christlichen Autor verfasst wurde.
Kierkegaard, Søren (1813–1855) war ein dänischer Philosoph, Schriftsteller und evangelischer Theologe. In seinen Schriften beschäftigte er sich mit Grundstimmungen der menschlichen Seele: Angst, Zweifel, Trost, Sehnsucht. Scharfe Kritik übte er an einer verbürgerlichten, protestantischen Kirche seiner Zeit, die den Glauben auf vernünftige Lehrsätze reduzierte. Er gilt als Begründer der Existenzphilosophie.
Konzil (lat. Versammlung) nennt man eine Bischofskonferenz, die über Fragen des Glaubens und der Lehre berät und verbindliche Entscheidungen trifft. Auf den Konzilien der Alten Kirche (z. B. Nizäa, 325, Konstantinopel, 381) wurden die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens festgelegt (z. B. Trinität, Glaube an Jesus Christus). Martin Luther lehnte die Auffassung der katholischen Kirche seiner Zeit ab, dass Papst und Konzilien in Lehrentscheidungen irrtumsfrei seien: Auch sie müssten sich an der Heiligen Schrift messen lassen. Nach der Reformation fanden drei Konzilien auf katholischer Seite statt (z. B. Konzil von Trient (1545–1563), 1. (1869–1870) und 2. Vatikanisches Konzil (1962–1965). Auf der Weltkirchenkonferenz von Vancouver 1983 wurde der ökumenische »konziliare Prozess für Frieden Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung« initiiert, für den sich seither Gremien und Gemeinden der verfassten Kirchen sowie christliche Gruppen und Friedensdienste engagieren.
Kreationismus, Kreationisten gehen davon aus, dass die Welt und das Leben durch einen direkten Eingriff Gottes entstanden sind. Sie lesen Gen 1 als einen Tatsachenbericht. In der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie versuchen sie deshalb nachzuweisen, dass die Tiere »jedes nach seiner Art« entstanden seien und sich dann erst weiterentwickelt hätten (Mikroevolution). Dagegen wird die Makroevolution, also die Entwicklung von einer Art aus einer anderen, abgelehnt.
Lapide, Pinchas (1922–1997) war ein jüdischer Religionswissenschaftler, der sich in seinen Publikationen besonders für den jüdisch-christlichen Dialog eingesetzt hat.
Lepanto-Zyklus: Der im Jahr 2001 von Cy Twombly (1928–2011) erschaffene zwölfteilige Bilderzyklus reflektiert die Sicht des Künstlers auf die historische Seeschlacht bei Lepanto am 7. Oktober 1571 zwischen der christlichen »Heiligen Liga« aus spanischen, venezianischen und päpstlichen Truppen und dem osmanischen Heer. Die für die christliche Seite siegreiche Schlacht hat innerhalb weniger Stunden an die 40.000 Menschenleben gekostet. Die großformatigen Ölbilder wurden für die Biennale in Venedig geschaffen und sind heute in München in einem eigens dafür eingerichteten Saal im Museum Brandhorst zu besichtigen. Auf S. 57 ist das siebte von zwölf Bildern dargestellt.
Lessing, Gotthold Ephraim (1729–1789): Dichter und Philosoph der Aufklärung, ist v. a. durch seine Theaterstücke und seine dramentheoretischen und religionsphilosophischen Schriften bekannt, in denen er sich für Toleranz in Fragen von Religion und Weltanschauung einsetzte.
Libet, Benjamin (1916–2007) war ein US-amerikanischer Neurophysiologe. Berühmt wurde das nach ihm benannte und bis heute vielfach diskutierte und kritisierte »Libet-Experiment« von 1979: Hier sollten Probanden mithilfe einer Spezial-Uhr angeben, wann sie die bewusste Entscheidung zu einer Handbewegung getroffen hätten. Da sich bereits ca. 350 Millisekunden davor ein sog. Bereitschaftspotential im Hirn messen ließ, ergab sich daraus die Frage, ob Menschen einen
freien Willen haben können, wenn der bewusste Wille der Hirnaktivität nachfolgt.
Lobotomie bezeichnet einen medizinischen Eingriff mit einer ca. 20 cm langen Stahlnadel, die mit einem Hammer in den Kopf getrieben wird, um dabei Nervenverbindungen im Gehirn zu durchtrennen. Die zwischen 1940 und 1955 überaus populäre Methode sollte Menschen mit psychischen Störungen heilen. Wegen schwerster Nebenwirkungen und Unwirksamkeit wurde sie in der Folgezeit immer stärker abgelehnt und nicht mehr angewandt.
Locke, John (1632–1704) war ein englischer Philosoph und bedeutender Staatstheoretiker, dessen Theorie der Gewaltenteilung wegweisend für die Entwicklung der bürgerlichen Demokratien wurde. In seiner Erkenntnistheorie wendet er sich gegen die rationalistische Auffassung, dass das Denken (ratio) die Grundlage von Erkenntnis sein oder dass es angeborene Ideen oder angeborene Prinzipien im Menschen geben könne. Er sah vielmehr die Erfahrung als einzige Wissensquelle an und unterzog die Mittel und Möglichkeiten des menschlichen Verstandes einer kritischen Prüfung. Daher gilt er als Mitbegründer des Empirismus und wichtiger Vordenker der Aufklärung.
Mahloquet ist ein hebräischer Begriff für die jüdische Diskussionskultur, die sich aus der rabbinischen Auslegung der Tora und des Talmud entwickelt hat. Wahrheitssuche geschieht hier in einem unabschließbaren dialogischen Austausch, in dem jede Antwort wieder neue Fragen hervorbringt. Es geht dabei weder darum, dass jemand recht behält, noch darum, Kompromisse zu finden, sondern unterschiedliche Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben; jede Meinung zählt, auch die vergangener Generationen.
Mandela, Nelson (1918–2013) bekämpfte sein Leben lang die Apartheid, die Diskriminierung der Schwarzen in Südafrika. Aufgrund seines Aktivismus wurde er verhaftet und verbrachte fast 27 Jahre im Gefängnis. Von 1994 bis 1999 war Nelson Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas. Auch in dieser Position setzte er sich für Versöhnung und ein gutes Leben für alle Menschen ein.
March for Science ist eine Initiative, die sich für die Freiheit der Wissenschaft einsetzt. Diese sieht sie u. a. durch den wachsenden Druck auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, möglichst viel zu publizieren und Finanzmittel für die Forschung einzuwerben, gefährdet. Außerdem plädiert sie dafür, dass das Engagement von Forscherinnen und Forschern für eine demokratische Gesellschaft stärker honoriert wird.
materialistisch-positivistisch bezeichnet eine Weltsicht, wonach nur Stoffliches, also »Materie«, existiere und in der Welt wirke (im Gegensatz zur Annahme von z. B. etwas Geistigem) und auch nur beobachtbare, also »positiv« gegebene, Sachverhalte untersucht werden könnten. Eine solche Sicht gilt durch den kritischen Rationalismus Karl Poppers als widerlegt.
Metz, Johann Baptist (1928–2019) war ein einflussreicher katholischer Theologe; er gilt als Initiator einer »Theologie nach Auschwitz« und als einer der führenden Vertreter der politischen Theologie, die Impulse aus der lateinamerikanischen Befreiungstheologie aufnahm. Ein Anliegen von Metz war es, dass Theologie und Kirche die »memoria passionis« bewahren und die Perspektive der Leidenden und Unterdrückten einnehmen.
Midrasch: (Pl. Midraschim, abgeleitet von hebr. darasch: suchen, fragen, forschen) bezeichnet die rabbinische Auslegung der hebräischen Bibel. Sie ist somit Teil der mündlichen Tora. Man versteht darunter sowohl den Vorgang des Studierens als auch dessen Ergebnis, also Schriftwerke, die Bibelauslegungen enthalten. Inhaltlich wird zwischen den gesetzlichen Auslegungen (Halacha) und der nichtgesetzlichen (Haggada) – z. B. Erzählungen, Sprüche – unterschieden.
Mill, John Stuart (1806–1873) war ein britischer Philosoph und Ökonom. Er gilt als einer der wichtigsten liberalen Denker und Utilitaristen des 19. Jahrhunderts. In seinem berühmten Werk »Über die Freiheit« plädiert er für Gedanken- und Meinungsfreiheit sowie allgemein für individuelle und bürgerliche Freiheit und tritt in diesem Zusammenhang auch für eine Begrenzung der Macht von gesellschaftlichen Mehrheiten ein.
Moltmann, Jürgen (*1926) war Professor für Evangelische Theologie, zunächst in Wuppertal und Bonn, von 1967 bis 1994 in Tübingen. Im Rahmen einer immer auch politisch akzentuierten Theologie widmet er sich u. a. dem Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube. Er macht deutlich, dass die Wirklichkeit mehr umfasst, als was naturwissenschaftlich beschreibbar ist, weshalb er für einen Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften plädiert.
Musil, Robert (1880–1942) war ein österreichischer Schriftsteller und Theaterkritiker. Wichtige Werke sind u. a. »Die Verwirrungen des Zöglings Törless« und »Der Mann ohne Eigenschaften«.
nachexilisch Exil, babylonisches
Nathan der Weise: Hintergrund für dieses 1779 erschienene Drama um die gleichnamige Hauptfigur von Gotthold Ephraim Lessing ist der sog. Fragmentenstreit. Der Schriftsteller kündigte 1778 der Tochter von Reimarus dieses Stück wie folgt an: »Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater, wenigstens noch ungestört will predigen lassen.« Der Stoff des Dramas geht zurück auf eine Novelle in Boccaccios »Decamerone«, die um den Juden Melisedech kreist und bereits die Wanderparabel von den drei Ringen enthält. Schon der Untertitel »Dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen« gibt einen Hinweis darauf, dass in diesem Werk eher das Lehrhafte als das Dramatische im Vordergrund steht; Lessing selbst hielt das Stück für kaum aufführbar. Das Drama spielt in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge am Ende des 12. Jahrhunderts, wo Judentum, Christentum und Islam aufeinandertreffen; gedankliches Zentrum ist der Toleranzgedanke der Aufklärung. Dies wird besonders deutlich in der Schlüsselszene im siebten Auftritt des dritten Aktes, in der Nathan der Weise auf die Ringparabel Bezug nimmt.
Naturwissenschaften wie die Physik, Chemie, Biologie oder Geologie versuchen, die unbelebte und belebte Natur wissenschaftlich zu beschreiben und zu erklären. Sie haben einen erfahrungsbezogenen (= empirischen) Zugang zur Wirklichkeit, indem sie gezielt Experimente und Beobachtungen durchführen, um
theoretische Annahmen zu überprüfen oder neue zu entwickeln. Solche Beobachtungen und Experimente müssen dokumentiert sein und sich wiederholen lassen, damit ein höchstes Maß an Zustimmung durch andere Wissenschaftler erzielt wird (wird oft missverständlich als Objektivität bezeichnet). Zu ihrer Exaktheit gehört es, die gefundenen Strukturen in mathematische Formeln zu bringen. Während die Mathematik Beweise kennt, können im Gegensatz zur landläufigen Meinung Naturwissenschaften ihre Theorien nicht beweisen. Ihre Methodik führt gleichwohl zu Erkenntnissen, die überaus vertrauenswürdig sind (wie z. B. die Naturgesetze), weil sie sich über lange Zeit in verschiedenen Gebieten immer wieder bewährt haben.
Orthodoxie, lutherische ist die Bezeichnung für eine Ausprägung des evangelischen Glaubens nach Luthers Tod, der es um den Aufbau eines unumstößlichen, rational-objektiven Lehrgebäudes als Abwehr der katholischen Gegenreformation ging. Dieser Glaubensform wurde später oft der Vorwurf eines engstirnigen, erstar rten und autoritären Dogmatismus gemacht, der dem Geist Luthers völlig entgegenstehe. Um beispielsweise Luthers Lehre von der unhintergehbaren Vorrangstellung der Bibel gegenüber der Autorität der kirchlichen Tradition aufrechtzuerhalten, entwickelt die lutherische Orthodoxie in ihrem Zentrum die Lehre von der Verbalinspiration, wonach jedes Wort der Bibel göttlich inspiriert und den biblischen Autoren direkt von Gott diktiert worden sei. Deshalb könne die Bibel als widerspruchsfrei und vollkommen angesehen werden. Luther hatte demgegenüber auch von dunklen Stellen in der Bibel gesprochen und von der Mitte der Schrift als Auslegungskriterium. Das Lehrgebäude der lutherischen Orthodoxie, allem voran die Vorstellung einer Verbalinspiration, wurde spätestens mit dem Einsetzen der Aufklärung und den Erkenntnissen der historisch-kritischen Forschung fraglich, weshalb es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Lager kam, als deren Höhepunkt der sog. Fragmentenstreit angesehen werden kann.
Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob (1761–1851) studierte Theologie, Philosophie und orientalistische Sprachwissenschaften und war in Letzteren auch Professor an der Universität Jena. Seine Vorstellung von
Religion war angelehnt an Immanuel Kant und in Abgrenzung zur Romantik vor allem durch einen radikalen Rationalismus geprägt. Dieser prägte auch seine theologischen Werke. In der Deutung der biblischen Überlieferung suchte er zum Beispiel im Zusammenhang mit Wundererzählungen vor allem nach vernunftgemäßen Erklärungen. Zudem war er darum bemüht, Jesus als vernünftigen Mann und moralisch integren Menschheitslehrer darzustellen.
Pentagon-Papiere werden die Dokumente genannt, die Interna der amerikanischen Regierung zur Planung des Vietnamkriegs enthalten und die 1971 von der Presse enthüllt wurden. Sie zeigten, dass dieser Krieg von langer Hand vorbereitet worden war.
Physik, klassische: Klassische Physik ist die Bezeichnung für physikalische Modelle zur Mechanik, Akustik, Optik, Wärme- und Elektrizitätslehre sowie zum Magnetismus, die sich im 17. bis 19. Jh. herausgebildet haben. Zentral für sie ist die Überzeugung, dass das gesamte Naturgeschehen auf mechanischer Grundlage mithilfe von Differentialgleichungen beschrieben werden kann. Hieraus ergibt sich ein streng deterministisches Weltbild, wonach im anfangslos gedachten Kosmos alles seit Ewigkeit vorherbestimmt sei und man somit exakt die Zukunft voraussagen könnte, würde man über alle relevanten Daten verfügen. Ein solches materialistisches Weltbild wird als unvereinbar mit christlichen Vorstellungen angesehen. Trotz großer Erfolge der klassischen Physik traten immer mehr theoretische und experimentelle Widersprüche auf, da bspw. Materie nach den bekannten Naturgesetzen gar nicht existieren dürfte, da die negativ geladenen Elektronen in Atomkernen unter Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen in den positiv geladenen Atomkern stürzen müssten. Diese Probleme nötigten zur Entwicklung von Relativitätstheorie und v. a. der Quantenphysik im 20. Jh., also zur sog. modernen Physik. Durch sie ist das Natur- und Wirklichkeitsverständnis des 18. und 19. Jh.s grundlegend überholt und der Physik die Einsicht aufgezwungen worden, dass in der Natur das Ganze mehr ist als die Summe der Teile, aus denen es zusammengesetzt ist, weil die Phänomene in der Natur nicht isoliert sind, sondern miteinander in Wechselwirkung stehen.
Pilgrim Fathers: Die ersten englischen Einwanderer, die 1620 auf der »Mayflower« nach Nordamerika gesegelt waren und das ganz im Nordosten der USA gelegene Gebiet (»Neuengland«) besiedelten, werden Pilgerväter genannt. Sie waren Puritaner und gehörten damit einer Richtung innerhalb des Calvinismus an, die in England nicht geduldet war. Während die Bezeichnung »Pilgerväter« erst Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam, nannten sich die Einwanderer selbst »Heilige« (»saints«).
Pluralismus, theozentrischer: Damit wird ein Modell bezeichnet, das aus christlicher Perspektive zwar einerseits den Exklusivismus überwinden möchte, gleichzeitig aber das Inklusivismusmodell als problematisch empfindet, weil damit letztlich doch am Absolutheitsanspruch des Christentums nicht gerüttelt wird. Zugleich soll auch ein religiöser Relativismus vermieden werden. Vertreter dieser Position rechnen mit unterschiedlichen Erkenntniswegen, halten aber daran fest, dass es eine göttliche Wahrheit gibt, die von den verschiedenen Religionen mehr oder weniger umfassend erkannt wird. In christlicher Ausprägung hieße das, den Reichtum der christlichen Tradition und der in ihr überlieferten Wahrheit selbstbewusst zu betonen und davon auszugehen, der Erkenntnis der Wahrheit besonders nahe zu kommen, ohne sich ein abschließendes Urteil über den Reichtum der anderen Religionen und deren Wahrheitsgehalt anzumaßen. Und es hieße, damit zu rechnen, dass andere Religionen aus ihrer Sicht möglicherweise in einzelnen Bereichen etwas anders und besser erkannt haben als die eigene religiöse Tradition. Entstanden ist der theozentrische Pluralismus im angelsächsischen Bereich, bekannte Vertreter sind John Hick und Paul Knitter.
Polis ( griech.) ist die Bezeichnung für die altgriechischen Stadtstaaten. In der politischen Theorie, wie sie z. B. Hannah Arendt in Aufnahme von Aristoteles vertritt, steht die Polis modellhaft für ein Gemeinwesen, in dem Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt und frei zusammenleben und ihre Gesetze und Ordnungen gemeinsam aushandeln.
Popper, Karl (1902–1994), österreichisch-britischer Philosoph, ist berühmt für seine Arbeiten zur sog. offe-
nen Gesellschaft sowie zum kritischen Rationalismus. Letzterer zeigt auf, dass es kein sicheres empirisches Wissen gebe, sondern Aussagen, die Anspruch auf Wissenschaftlichkeit beanspruchen, allenfalls widerlegbar ( Falsifikation), aber nicht positiv beweisbar, also verifizierbar seien, da hierfür eine unendliche Zahl von Prüfungen notwendig wären. Bei Theorien, die allerdings bisher jeden Falsifikationsversuch bestanden hätten, wie z. B. die Quantentheorie, könne man von einer verlässlichen Theorie sprechen, die man nicht jedes Mal aufs Neue im Sinne eines methodischen Rationalismus kritisch prüfen müsse.
Pro Asyl ist eine als Verein, Stiftung sowie als bundesweit agierende Arbeitsgemeinschaft organisierte Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte von Flüchtenden sowie Migrantinnen und Migranten einsetzt. Mitarbeitende der Organisation unterstützen Menschen z. B. in A sylverfahren, recherchieren und dokumentieren Menschenrechtsverletzung an Grenzen wie willkürliche Verhaftungen und illegale gewaltsame Zurückweisung Schutzbedürftiger (sog. »push-backs«) und sie setzen sich gegen Rassismus und für eine tolerante und offene Gesellschaft ein.
Puritaner, puritanisch: Als Puritaner – also als »Reiniger« – bezeichnete man reformorientierte Gemeinden im England des 17. Jahrhunderts, die u. a. neue Formen der Mitbestimmung in der Gemeinde eingeführt hatten. Diese Form der Gleichberechtigung wollten insbesondere schottische Parlamentarier gegen König Karl I. durchsetzen, der gerne absolutistisch regiert hätte. Die Zuspitzung des Konflikts gipfelte im englischen Bürgerkrieg (1642–1649) zwischen Karl I. und dem Parlament, der auch Puritanische Revolution genannt wird.
Qumran heißt eine antike Siedlung in der Wüste am Toten Meer, die heute als Ruine zugänglich ist. Ihre Bewohner gehörten wohl zur Gruppe der Essener und hatten sich hier in die Wüste zurückgezogen, um ein gottgefälliges Leben nach ihren eigenen Regeln zu führen. Beim jüdischen Aufstand 66–70 n. Chr. wurde die Siedlung von den Römern zerstört. Damals brachte man zahlreiche Schriftrollen, verwahrt in Tonkrügen, in benachbarten Höhlen vor den Römern in Sicherheit.
Diese Schriftrollen vom Toten Meer wurden 1947 zufällig von einem Beduinenjungen entdeckt. Sie enthalten u. a. die ältesten bekannten Handschriften alttestamentlicher Texte und werden seitdem von Wissenschaftlern erforscht.
Reformatorische Grundeinsichten: Zu Martin Luthers reformatorischen Grundeinsichten gehören zum einen die vier sog. Exklusivpartikel. Sie fassen mit dem vierfachen Sola das zusammen, wovon das Heil eines Christen bzw. einer Christin seines Erachtens abhängt: Allein aufgrund des Glaubens (sola fide) wird es ihm von Gott allein durch Christus (solo christo häufig auch: solus christus) aus reiner Gnade (sola gratia) geschenkt. An die Stelle der Lehrautorität durch Päpste oder Bischöfe tritt allein die Heilige Schrift (sola scriptura). Luther will damit ausdrücken, dass das Heil nicht von guten Werken abhängt, sondern der Glaubende es von Gott ohne Gegenleistung erhält. Aus den Exklusivpartikeln folgt eine weitere zentrale Erkenntnis Luthers: das sog. Priestertum aller Gläubigen. Damit ist gemeint, dass alle, die glauben, einen direkten Zugang zu Gott haben und dafür keine Hilfe durch einen Geistlichen benötigen. Ebenso hält er es für die Aufgabe eines jeden Getauften, das Evangelium zu verkündigen und zu lehren.
Reimarus, Hermann Samuel (1694–1768) war ein sehr geachteter Hamburger Gymnasiallehrer für orientalische Sprachen. Als Deist ( Deismus) vertrat er die Sicht einer sog. natürlichen Religion, deren Zentrum die Vorstellung einer unsterblichen Seele, einer vernünftigen Moral und einer naturwissenschaftlich haltbaren Gottesvorstellung bildete. Während manche seiner Publikationen unter den Augen der Zensur eine nur moderate Kritik am zeitgenössischen Christentum enthielten, arbeitete er für einen Kreis Gleichgesinnter eine Schrift aus, die eine Radikalkritik der Bibel als Offenbarungsquelle enthielt und schließlich von Lessing 1774–1778 in drei Teilen als »Fragmente eines Ungenannten« herausgegeben wurden. Dies führte zum sog. Fragmentenstreit. Reimarus gab mit dieser Schrift der historisch-kritischen Forschung wichtige Impulse.
Relativismus: Es wird davon ausgegangen, dass letztlich alle Religionen – trotz anderslautender Aussagen auf der »Oberfläche« – in einem »tieferen« Sinn gleich bzw. gleichwertig sind. Sie konkurrieren somit nicht miteinander um den Anspruch auf Wahrheit oder auf den exklusiven Zugang zum Heil. Dies macht es auch denkbar, nur Teilaspekte einzelner Religionen für sich zu adaptieren und ggf. auch zu kombinieren. Von Vertretern einer exklusivistischen Position wird der Begriff »Relativismus« meist in einem abwertenden Sinn für alle Modelle verwendet, die die Möglichkeit einräumen, dass nicht nur eine Religion allein die Wahrheit erkannt hat und damit alle anderen nicht. Der Relativismus ist vom Anspruch her eine gegenüber anderen Wahrheitsansprüchen tolerante Auffassung; gleichzeitig muss er sich die Frage gefallen lassen, wie tolerant er selbst ist gegenüber der Überzeugung, dass eben nicht alle Wahrheitsansprüche relativ sind.
Reporter ohne Grenzen ist ein deutscher Verein, der zur internationalen Organisation »Reporters sans frontières« mit Hauptsitz in Paris gehört. Das Hauptziel ist der Schutz der Pressefreiheit als ein Menschenrecht (vgl. Art. 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) und als notwendige Basis demokratischer Gesellschaften. Ihre konkreten Aufgaben sieht die Organisation darin, Verstößen gegen die Presse- und Informationsfreiheit zu recherchieren und zu dokumentieren, Öffentlichkeit herzustellen, wenn Journalisten und andere Medienschaffende in Gefahr sind, gegen Zensur in analogen und digitalen Medien sowie gegen restriktive Mediengesetze zu kämpfen sowie verfolgte Journalistinnen und Journalisten und deren Familien auf vielfältige Art zu unterstützen. Der gemeinnützige Verein finanziert sich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Fundraising-Aktionen.
Romantik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Strömung Ende des 18. bis ca. Mitte des 19. Jh.s, die alle Kunstgattungen sowie die Philosophie und Theologie umfasste und ihren Ursprung in Deutschland hatte. Sie stellt eine Gegenbewegung zur einseitigen Vernunftorientierung in der Epoche der Aufklärung dar bzw. entwickelt diese weiter. Die Romantiker fragen nach dem Phantastischen und Traumhaften, nach den unbewussten Kräften der Seele, nach dem Magischen,
Wunderbaren und Geheimnisvollen und suchen darin Zugang zu tieferen Dimensionen der Wirklichkeit.
Roth, Gerhard (*1942) Biologe und Hirnforscher, lehrte an der Universität Bremen; seine Forschungsergebnisse sind v. a. wegen seiner Aussagen zu Determinismus und Willensfreiheit bekannt und umstritten.
Roth, Josef (1894–1939) wuchs als österreichisch-ungarischer Jude im galizischen Schtetl Brody auf, arbeitete als Journalist und Schriftsteller und emigrierte 1933 nach Paris. Seine Bücher wurden in Nazideutschland verbrannt.
Rousseau, Jean Jaques (1712–1778) war ein Schriftsteller, Philosoph, Naturforscher und Pädagoge der Aufklärung. Seiner Auffassung nach war der Mensch im natürlichen Urzustand frei und gut. Erst durch die Zivilisation, durch Privateigentum und Konkurrenz begann der moralische Niedergang. Die Lösung sieht er in einem freiwilligen Gesellschaftsvertrag, dem die Individuen sich zugunsten des Allgemeinwohls unterordnen.
Sachs, Nelly (*1891 in Schöneberg, †1970 in Stockholm) war eine jüdisch-deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin, die 1966 den Literaturnobelpreis erhielt. Sie setzte sich in vielen ihrer Gedichte mit der Shoa auseinander. Im Zweiten Weltkrieg entging sie der Deportation nur knapp durch Flucht nach Schweden.
Satan: Viele Religionen kennen einen Glauben an eine böse Macht und versuchen so, das Böse in der Welt zu erklären. Manchmal wird diese böse Macht als Gegenspieler im Streit mit einer guten Macht vorgestellt (Dualismus, von lat. duo: zwei), manchmal der guten Macht untergeordnet, manchmal als von der guten Macht bereits besiegt gesehen. In der Religionsgeschichte wurden ihr viele Namen gegeben, die dann auch Unterschiedliches bedeuten können: Satan (hebr.: Widersacher), Teufel (griech. diabolos: Durcheinanderwerfer), Beelzebub (hebr. baal zebub: Fliegengott, Name einer aus israelitischer Sicht feindlichen kanaanäischen Gottheit), Lucifer (lat.: Lichtträger, nach dem Mythos ein gefallener Engel, Jes 14,12). Im Alten Testament ist Gott die Ursache für gutes wie böses Geschehen. Sehr
selten und in sehr spät entstandenen Schriften ist dort auch von Satan die Rede. Wahrscheinlich ist die Vorstellung einer bösen Gegenmacht aus benachbarten Religionen eingeflossen. Im Hiobbuch oder in Sach 3,1 gehört Satan zum Hofstaat Gottes und tritt dort als Ankläger auf. Nur in 1 Chr 21 ist Satan ein von Gott gelöster böser Dämon. Im Neuen Testament wird immer wieder mit dem Teufel gerechnet. Er ist dort der böse Herrscher der von Gott abgefallenen Welt, wurde aber von Christus besiegt (Mt 4). In der Kirchengeschichte dagegen gab es immer wieder Epochen großer Teufelsangst, die dann oft zu schrecklichen Auswüchsen führte (Inquisition, Hexenverfolgung). In der heutigen evangelischen Theologie gibt es kein großes Interesse an der Figur des Teufels. Manchmal wird seine Bedeutung als Symbol für das Böse in der Welt gesehen, das um der Opfer willen nicht schön oder klein geredet werden darf. Vor allem aber wird betont, dass Christen an Christus glauben und sie darum der Teufel nicht schert.
Schnorr von Carolsfeld, Julius (1794–1872) war ein Maler der deutschen Romantik. Besonders bekannt sind seine 240 Bibelillustrationen, die für lange Zeit die volkstümliche Rezeption biblischer Geschichten prägten.
Schumann, Johann Daniel (1714–1787) war promovierter Theologe in der Zeit der Aufklärung. Er positionierte sich im Zusammenhang mit dem Fragmentenstreit ( S. 53) gegen Gotthold Ephraim Lessing.
Septuaginta (lat.: siebzig) heißt die griechische Übersetzung der Schriften der Hebräischen Bibel. Sie entstand ca. 250–100 v. Chr. im hellenistischen Judentum (Alexandria) und war die Fassung der Bibel, die den ersten Christen vorlag. Der Legende nach haben 72 Übersetzer die Übersetzung in 72 Tagen geschaffen –daraus wurde später die Zahl 70.
»Shutter Island« ist ein Thriller von Martin Scorsese (2010), der im Jahr 1954 auf einer gleichnamigen fiktiven Gefängnisinsel spielt. Dort befindet sich ein Krankenhaus für psychisch gestörte Schwerverbrecher, aus dem die Patientin Rachel Solando scheinbar spurlos entfliehen konnte. Zur Aufklärung des Falls reisen die US-Marshals Edward »Teddy« Daniels und Chuck Aule
an. Während Teddy mehrere Indizien für verbotene medizinische Experimente an Menschen – möglicherweise an einem nicht auffindbaren 67. Patienten – zu entdecken scheint, wird er von Migräneanfällen und Erinnerungen an seine tote Familie sowie durch Kriegstraumata geplagt. Im Verlauf der Handlung erfährt man, dass Teddy sich für den Fall gemeldet habe, da auch Andrew Laeddis, der ehemalige Hausmeister seines Wohnhauses, einer der Insassen sein müsse. Teddy vermutet in ihm den Mörder seiner Frau sowie den unauffindbaren 67. Patienten. Obwohl die scheinbar entflohene Patientin wieder auftaucht, hält Teddy an seiner Verschwörungsthese fest und glaubt, dass die Menschenversuche im Leuchtturm der Insel vorgenommen würden. Als sein Kollege Chuck plötzlich unauffindbar ist, vermutet ihn Teddy gefangen im Leuchtturm und will ihn mit Gewalt retten. Dort trifft er allerdings auf den Chefarzt Dr. John Cawley sowie auf Chuck, der sich als dessen Kollege Dr. Lester Sheehan vorstellt, der Teddy, der in Wirklichkeit Andrew Laeddis sei, behandle. Die beiden Psychiater hätten ein Rollenspiel entwickelt, um Andrew Laeddis von seiner multiplen Persönlichkeitsstörung zu heilen, die ihn davon abhalte, sich selbst als den Mörder seiner manischdepressiven Frau Dolores Chanal zu sehen, die im Wahn die drei gemeinsamen Kinder getötet habe. Da Laeddis für das Personal und andere Patienten eine Gefahr darstelle, sei dies die letzte Chance, ihn vor einer Lobotomie zu bewahren. Da »Teddy« auf den Chefarzt schießt, dieser zunächst tödlich getroffen scheint, dann aber unversehrt ist, wird sich Laeddis seiner Scheinidentität bewusst. Allerdings habe man diesen Punkt schon mehrfach zuvor erreicht, bevor Laeddis wieder rückfällig geworden sei, so dass sich erst erweisen müsse, ob die Heilung diesmal dauerhaft ist.
Skeptizismus bezeichnet allgemein eine Richtung in der Philosophie bzw. in der Erkenntnistheorie, die den Zweifel zum obersten Denkprinzip erhebt. Bezogen auf die Frage nach der Wahrheit der Religionen werden unter dem Begriff solche Meinungen zusammengefasst, die bestreiten, dass es überhaupt eine »letzte« oder »ewige« Wahrheit gibt oder dass eine solche von Menschen erkannt werden kann.
Sölle, Dorothee (1929–2003) war eine Theologin und Literaturwissenschaftlerin, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzte und u. a. 1968 das Politische Nachtgebet in Köln mitbegründete.
Stosch, Klaus von (*1971) ist ein deutscher römischkatholischer Theologe und Hochschullehrer für Systematische Theologie. Zusammen mit Mouhanad Khorchide hat er unter anderem ein Buch über Jesus im Koran verfasst.
Szientismus bezeichnet die Auffassung, dass die Methoden der exakten Naturwissenschaften auch im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften angewendet werden müssten. Alles, was sich damit nicht beschreiben lasse, wie z. B. bestimmte Fragestellungen der Religion, Philosophie, Kunst, Politik oder Psychologie, sei für wissenschaftliche Erkenntnis irrelevant. Dieser Sicht wird vorgeworfen, sie sei reduktionistisch bzw. materialistisch-positivistisch.
Talmud: Der mehrere tausend Seiten umfassende Talmud ist die zweite für das Judentum maßgebliche Grundlage neben der Hebräischen Bibel. Er besteht aus der Mischna und der Gemara: Die Mischna ist die grundlegende Sammlung der mündlichen Tora und ergänzt die schriftliche Tora. Der Talmud ist in einem langen Prozess zwischen dem 2. Jh. n. Chr. und dem Mittelalter schriftlich fixiert worden. Er liegt in zwei verschiedenen Fassungen vor, dem babylonischen und dem Jerusalemer Talmud. Er enthält einerseits Diskussionen zur Halacha, andererseits erzählende Texte (z B. L egenden, Sagen), die historische Erfahrungen oder Lebensweisheit vermitteln (sog. Haggada). Der Diskussionsprozess, der sich im Talmud spiegelt, ist prinzipiell unabgeschlossen, er bleibt immer neue Aufgabe.
Taylor, Charles (* 1931) lehrte als Politikwissenschaftler und Philosoph u. a. an den Universitäten in Montreal und Oxford. Themen seiner thematisch breitgefächerten Forschungs- und Publikationstätigkeit sind u. a. die philosophische Anthropologie, die Moralphilosophie, die Geschichte der Philosophie, Säkularisierungsprozesse und Fragen eines gelingenden Zusammenlebens in einer multikulturellen Gesellschaft.
Theologie der Natur stellt den Versuch dar, die Natur und ihre Gesetze im Licht des Schöpfungsglaubens zu deuten und somit nicht nur zu prüfen, ob sich hier gewisse Überschneidungspunkte ergeben, sondern ggf. auch einen Beitrag zur Naturerkenntnis zu leisten, indem diese mit Jürgen Moltmann z. B. weisheitlich interpretiert werden. Häufig wird die sog. natürliche Theologie, wie sie z. B. in der Aufklärungszeit populär war, von einer Theologie der Natur abgegrenzt, weil ihr Erkenntnisziel ist, aus der Untersuchung der Natur gleichsam objektive Hinweise auf ein dahinterstehendes (ggf. nur ursprüngliches) Wirken Gottes zu finden.
Tindal, Matthew (1653–1733) war als Deist ( Deismus) Vertreter einer sog. natürlichen Religion in der Frühaufklärung in England. Er vertrat die Position, dass Gotteserkenntnis nur mit Blick in die Natur und auf Basis vernunftgeleiteten Denkens möglich ist. Dieses natürliche Gottesbild soll seiner Ansicht nach Probierstein für jede Offenbarungsreligion sein.
Tora bedeutet wörtlich Lehre, Wegweisung, Lebensorientierung. Der Begriff benennt im Judentum zunächst die fünf Bücher Mose, die schriftliche Tora. Darüber hinaus beschreibt er die nach biblischer Tradition von Gott am Berg Sinai geoffenbarte Gesetzesüberlieferung, die neben der »schriftlichen« auch die »mündliche« Tora (Mischna) umfasst. Schließlich steht der Begriff auch für die gesamte religionsgesetzliche Tradition. Juden betrachten das Gesetz der Tora nicht als Zwang , sondern als Lebenshilfe, als Geschenk Gottes, der sein Volk aus Ägypten befreit hat und der die Freiheit aller Menschen will.
Turgot, Anne Robert Jacques (1727–1781) war französischer Staatsmann, Ökonom und Schriftsteller in der Aufklärung. Er gehörte zu den Vertretern der Physiokratie, eine in Frankreich entstandene Sichtweise auf Wirtschaft, die von einem Naturrecht ausgeht und sich selbst reguliert.
Verbalinspiration: Unter Verbalinspiration versteht man die Auffassung, dass die der jeweiligen Buchreligion zugrunde liegende Schrift Wort für Wort von Gott
den Menschen geoffenbart wurde und aufgrund ihres göttlichen Ursprungs ohne Fehler ist. Diese Überzeugung hat Konsequenzen für die Auslegung der jeweiligen heiligen Schrift. Im Raum der evangelischen Theologie wurde in der lutherischen Orthodoxie nach Luthers Tod eine Lehre von der Verbalinspiration entwickelt, die sich v. a. gegen die katholische Sicht von der Verbindlichkeit auch der kirchlichen Tradition richtete. Die Verbalinspiration wurde seit der Aufklärung durch die historisch-kritische Forschung in Frage gestellt. Heutzutage wird sie in unterschiedlichen Ausprägungen vor allem von evangelikalen Protestanten und Mitgliedern christlicher Sondergemeinschaften, wie z. B. den Zeugen Jehovas, vertreten.
Verschwörungstheorie ist eine abwertende Bezeichnung für bestimmte Versuche, Ereignisse oder Begebenheiten in der Welt dadurch zu erklären, dass diese durch einige mächtige, bisher unerkannte Akteure im Hintergrund und ggf. über lange Zeiträume gezielt gesteuert würden. Da diese Verschwörer-Gruppe im Hintergrund sehr schändliche bzw. gefährliche Ziele verfolge, werde die Öffentlichkeit von ihr über die wahren Absichten getäuscht. Nur dank derjenigen, die dies durchschauten, werde diese geheime Verschwörung aufgedeckt. In Abgrenzung zu Theorien über mögliche echte Geheimoperationen oder Verschwörungen, wie z. B. die Pentagon-Papiere, sind Verschwörungstheorien dadurch gekennzeichnet, dass sie sich gegen eine kritische Prüfung immunisieren: Auf der Hand liegende Ungereimtheiten und Widersprüche werden dabei z. B. als Beleg für die Wahrheit der eigenen Sicht gedeutet, da sich gerade an ihnen das geheime, machtvolle und perfide Handeln der Verschwörer-Gruppe zeige, das eben nicht für jeden zu durchschauen sei.
Vietnamkrieg: Nachdem Vietnam 1954 von der Kolonialmacht Frankreich unabhängig geworden war, spaltete sich das Land und es brach ein Bürgerkrieg zwischen den beiden Landesteilen auf. Als Kriegsparteien standen sich das von einer Militärdiktatur beherrschte Südvietnam und das kommunistisch regierte und wirtschaftlich deutlich schwächere Nordvietnam als Kriegsparteien gegenüber. Seit 1964 unterstützten die USA
Südvietnam massiv militärisch mit Bodentruppen, Nordvietnam wurde mit Waffen von China und der So-
wjetunion beliefert. Da trotz sehr hoher Verluste der Einsatz des amerikanischen Militärs erfolglos blieb, zogen sich die USA seit 1969 zunehmend aus dem Konflikt zurück. Der Krieg endete am 30. April 1975 mit einer Kapitulation Südvietnams; das Land wurde wiedervereint und wird seitdem von der kommunistischen Partei regiert. Millionen von Menschen, hauptsächlich Zivilisten, starben in diesem Krieg. Der Protest gegen den Vietnamkrieg war Teil und z. T. auch Anlass für die Friedensbewegung und Studentenproteste in den USA und in Europa Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre.
Vulgata: Die Vulgata ist die lateinische Übersetzung der Bibel. Sie wurde von Hieronymus um 383 begonnen und konnte sich im 7./8. Jahrhundert gegen eine Reihe anderer lateinischer Bibelübersetzungen durchsetzen. Auf dem Konzil von Trient wurde sie allgemein anerkannt. Die Vulgata ist Grundlage des ersten Kanons der Bibel.
Weisheit meint eine einsichtsvolle Form von Klugheit und die sich aus ihr ergebende Haltung der Welt und den Mitmenschen gegenüber, also eine Mischung aus Weltwissen und sozialen Kompetenzen. Wer weise ist, kann Lebenserfahrung, persönliche Reife und vertiefte Einsicht in Wissenszusammenhänge vereinen, auf die Mitwelt beziehen und anwenden. Ein solches Verständnis von Weisheit findet sich schon im Alten Israel und seiner Umwelt. Weisheit wird hier zudem als göttliches Geschenk angesehen. Die biblischen Bücher Hiob, Kohelet (Prediger), Sprüche, das Hohelied, das Buch der Weisheit und einige Psalmen gehören zur sogenannten Weisheitsliteratur.
Welle-Teilchen-Dualismus: Während ein Teilchen in der klassischen Physik ein Massenpunkt mit einem wohlbestimmten Ort ist und eine Welle ein beliebig weit ausgedehntes Gebilde darstellt, zeigt der bekannte Doppelspaltversuch, dass Licht (also Photonen) beide Eigenschaften gleichzeitig aufweist und es nur von der Ausrichtung der Versuchsanordnung abhängt, welche dieser Größen man misst.
Wolff, Christian (1679–1754) war ein Universalgelehrter: Er lehrte u. a. über Mathematik, Recht und Na-
turphilosophie. Neben Gottfried Wilhelm Leibniz und Immanuel Kant gehört er zu den einflussreichsten Philosophen der Aufklärung.
Zarathustra (griech. Zoroaster), ein persischer Prophet, begründete den Zoroastrismus (ca. 1200 v. Chr.). Diese Religion, die mit der Perserherrschaft auch die antiken Völker beeinflusste, ist geprägt durch einen Dualismus von Gut und Böse; der Mensch hat sich zwischen diesen beiden Mächten zu entscheiden. Auch der Mithras-Kult und Manichäismus gehen auf den Zorastrismus zurück, der heute im Iran ca. 90 000 Anhänger hat (Parsen).
Abraham 16, 49, 64, 66 f., 69, 78, 151
Architektur / architektonisch 9 f., 12, 20 f., 40, 52, 71, 141
Aufklärung 22, 25, 27–30, 36, 40, 76, 92 f., 138, 144, 146, 148, 151–154, 156, 158–161, 166
Bildung 4, 9, 13, 19 f., 23, 27, 29, 31, 39, 46 f., 121, 125, 138, 142 ff., 146, 150 ff.
C hristus 42, 64 f., 87, 96 f., 100, 122 ff., 127 f., 136, 149, 152 f., 158
Dialog 37, 41, 44, 49, 52, 56, 65, 67 f., 70, 78, 85, 91, 93, 101 f., 128, 144, 149, 153 ff.
digital 36, 43, 49, 73, 105, 113, 138, 140, 157
evangelisch 5 ff., 47, 73, 99, 101, 104 f., 127, 134, 139, 142 ff., 147, 149, 152 f., 155, 158, 160
Exodus 15, 64, 94 f., 114 f., 135, 147
Film 13, 29, 35, 43, 49, 73, 77 f., 86, 90 f., 113, 128, 138, 140 f.
Frieden 52, 57, 66 f., 69 f., 81, 83, 89 f., 103, 114 f., 138
Fundamentalismus / fundamentalistisch 73, 98 f., 150, 152
Gewalt 36, 56, 64, 85, 91, 111, 114 f., 118, 141, 148, 151, 154, 157, 159
Glaube 4-7, 18, 22 f., 26, 32 f., 40–45, 47, 53, 56 f., 62, 64, 67, 70, 74, 84, 91, 93, 98 f., 102, 114, 122 ff., 127 ff., 134 f., 139, 142 ff., 146, 150 f., 151, 153, 155, 158
Grundgesetz 105, 111, 116, 131
Internet 7, 14, 42, 113, 142
Islam / islamisch / muslimisch 4, 7, 9, 16, 49, 52, 56–59, 61–69, 73, 78, 97, 100 f., 122, 129, 141 f., 144
Jesus 15, 17, 32 f., 42, 64 f., 87, 96 ff., 122 f., 128, 135, 153, 156
Judentum / jüdisch 4, 7, 9, 17, 49, 52, 56, 61, 64, 66 f., 68 f., 73, 75, 77, 89, 96, 100 f., 114 f., 122, 134 ff., 144, 146 ff., 152 ff., 157 f
Jugend / Jugendliche 31, 46, 77, 102, 19, 125
Kirche 7, 12, 50, 52, 56, 68 ff., 84, 96 f., 99, 102, 134, 137, 142
Koran 56, 58, 62, 64 f., 67, 69, 100
Kultur 18 f., 23, 25, 41, 45, 49, 60–63, 68 ff., 71, 134 ff., 138 f., 141, 144, 150 f., 159
Kunst 69, 73, 76, 78, 91, 94 f., 105, 134, 136, 141, 144, 147, 150, 157, 159
L essing 51, 53, 69, 74, 76 f., 153, 155, 157 f.
Liebe(n) 7, 13, 29, 33, 39, 46, 51, 53, 55, 84, 86, 122, 124 f., 128 f.
Luther, Martin / lutherisch 30, 40, 53, 84, 87, 96 f., 99, 124, 126 f., 146 f., 149 f., 152 f., 155, 160
Menschenrecht 116, 130 f., 146, 150, 156 f. mündig 9, 21, 23, 27, 46, 102
Musik 39, 69, 91, 95, 113, 141, 144, 150
Naturwissenschaft 4, 6 f., 23, 29, 40 ff., 44 f., 47, 138, 146, 149, 155, 157, 159
Ö ffentlichkeit 18, 23, 58, 103, 118, 146, 157, 160
Paulus 7, 122 f., 134, 136
Philosophie 4, 5, 39 f., 95, 105, 121, 134, 138 f., 142, 144, 147, 149, 151, 156 f., 159
Politik / politisch 19, 27, 36, 39, 49, 55, 67, 73, 101, 105, 109, 111, 115–119, 126, 136, 139, 141 f., 144, 146, 148 ff., 154–159
Rechtfertigung 95, 124 f., 128
Reformation / reformatorisch 96 f., 123 ff., 153
Schöpfung 23, 30, 32, 42, 44 f., 94, 98 f., 122, 144, 148, 150, 153, 160
Schule 8 f., 13, 18, 21, 27, 37, 46 f., 58, 69 ff., 107, 119, 121, 129
Stereotyp 7, 49, 62 f., 71
Theologie 4 ff., 40 f., 44 f., 54, 64, 95, 97 f., 105, 122, 134–140, 142 ff., 146 f., 149, 154 ff., 158, 160
Toleranz / tolerant 7, 49, 52 f., 55, 68, 71, 144, 146, 154 f., 157
Vernunft 6 f., 19, 22 f., 27–37, 40 f., 43, 47, 74, 144, 146
Wahrheit 12, 28, 30, 34 f. 41 f., 53, 55, 98 f., 101, 118, 129, 146, 149 f., 152, 156 f., 159 f.
Weisheit / weisheitlich 28, 33, 38, 40 f., 76, 78, 85, 122, 146, 159 ff.
Wissenschaft / wissenschaftlich 6, 29, 39–42, 44 ff., 60, 77, 92, 95, 100, 130, 134–141, 143 f., 148, 150 f., 154–157, 159
Zwischenraum 4, 8, 9, 10, 12 f., 17 f., 20 f., 38, 52, 63, 67, 69, 75, 77, 87, 90, 94, 101, 132, 144, 147
Umschlag: © ginton/Adobe Stock.com
S. 9, S. 14, S. 132: Julia Lassner, globusliebe, Kottenheim
S. 10: Simon Tanner, Zürich
S. 11: DREAMWORKS SKG/AMBLIN/MORTON
S. 12: Nordkirche, Hamburg
S. 13: Jugendzentrum Bregenz, Foto: Nico Tschaikner
S. 15: Granger Historical Picture Archive/Alamy Stock Photo
S. 16: akg-images
S. 17: Heritage-Images/Guildhall Art Gallery (City of London)/akgimages
S. 18: Malikarts, Marc Malik Furer, CH-Rombach
S. 19 o.: picture alliance/Flashpic/Jens Krick, u.: © artikularis/Adobe Stock.com
S. 20 o.: Kurt Hörbst, Photography, A-Rainbach, u.: Foto: Christoph Kern, Planer: Höller & Klotzner – Architekten, Meran
S. 23, S. 38, S. 132: Pinakothek der Moderne, München
S. 24: Dagmar Dörken Vogt, Herdecke
S. 25: Universität Bielefeld
S. 26: Glen Le Lievre/Cartoonstock, GB-Bath
S. 27: Gerhard Mester, Wiesbaden
S. 28: Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen, Foto: Museum
S. 29 Plakat zum Film: 2040 – Wir retten die Welt! von Damon Gameau, 2019
S. 30: © pict rider/Adobe Stock.com
S. 31: picture alliance/Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
S. 32: www.life.de
S. 33: https://www.ubuy.co.de/gr/
S. 34: Alte Nationalgalerie, Berlin/Wikipedia
S. 35 aus dem Film: Shutter Island von Martin Scorsese, 2010
S. 36 o.: Garry Waters/Ikon Images/akg-images, u.: picture alliance/ dpa/Boris Roessler
S. 37: Gerhard Mester, Wiesbaden
S. 38: Pinakothek der Moderne, München
S. 39: Alma Haser, London
S. 40: LMU, Universitätsbibliothek, München
S. 41: Katholische Erwachsenenbildung, Rheinland-Pfalz
S. 42 o.l.: Jim West/Alamy Stock Photo, o.r.: Ark Encounter, Williamstown, KY, USA, u.: Cimerondagert/Wikipedia
S. 43: Alibri Verlag GmbH, Aschaffenburg
S. 44: Bild l.: R.J.GaBany (BBO)/D. Martínez-Delgado (MPIA), r.: Musei Vaticani/dpa picture alliance, Montage: Freistunde
S. 45: Reuters/Jim Young
S. 46 v.o.n.u.: 1: Tobias Kleinschmidt dpa/Ibn, 2: Thomas Trutschel/ picture alliance/photothek, 3: Rudolf Lörine/Bremer Philharmoniker, 4: Jens Büttner/picture alliance, 5: © epd-bild/Meike Böschemeyer
S. 49, S. 57 o., S. 132: Bundesministerium der Finanzen, Berlin
S. 50, S. 52: Stiftung House of One – Bet- und Lehrhaus
Berlin
S. 53: »Nathan der Weise«, Theater für Niedersachsen, 2018. Regie: Bettina Rehm, v.l.n.r. : Dennis Habermehl (Sultan Saladin), Lilli Meinhardt (Recha), Moritz Nikolaus Koch (Tempelherr), Angelina Berger (Sittah), Foto: Falk von Traubenberg, Hamburg
S. 54: Simon Schmidt, München. Zeichnungen nach Georg Langenhorst: »Interreligiöses Lernen« auf dem Prüfstand. Religionspäda-
gogische Konsequenzen aus der Verhältnisbestimmung von Christentum und Weltreligionen, in: Religionspädagogische Beiträge 50 (2003), S. 89–106
S. 55 M.: Christian Moser, Die teuflischen Tricks der Monster des Alltags. © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2009
S. 56: akg-images/British Library
S. 57 o.: Bundesministerium der Finanzen, Berlin, u.: © Cy Twombly/Cy Twombly Foundation/akg-images
S. 59: AMERICAN CRAFT COUNCIL, Minneapolis, USA
S. 60: © sborisov/Adobe Stock.com
S. 61: Michael Holtschulte, Herten
S. 63: Soufeina Hamed, https://www.deviantart.com/tuffix/art/Transform-461228116, http://tuffix.net/portfolio/enjoy-difference/, tuffix, Soufeina Hamed, Dublin
S. 64: Shahid Alam, Atelier Kunst und Kultur, Stolberg
S. 65: Historic Images/Alamy Stock Photo
S. 66 o.: Dein Spiegel 1/2011, SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Hamburg, Logo: Cafe Abraham, Erlangen, r.: Café Abraham, Uni Frankfurt
S. 67: Idealink Photography/Alamy Stock Photo
S. 68: NEL, Ioan Cozacu
S. 69 o.: Music for the ONE GOD/Facebook, u.: Eckhard Lück, Olga Ziegler, Trialog der Religionen. Stationenarbeit zu Judentum, Christentum und Islam. AAP Lehrerwelt GmbH, Hamburg 2022
S. 70: Thomas Plassmann, Essen
S. 73, S. 78, S. 94, S. 132: Simon Schmidt, München
S. 74: dpa/Bernd Weißbrod
S. 75: Miriam Finkelstein/Dreamstime.com
S. 76: akg-images/Erich Lessing
S. 77: www.bibleserver.com, ERF Medien e.V., Wetzlar
S. 79 aus: Paul Huber, Hiob, Dulder oder Rebell? Patmos Verlag, Düsseldorf 1986
S. 80 l.: Flix, Faust. © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2010, r.: Verwalter: Wallraff-Richartz-Museum + Fondation Corboud, WRM 0412, Foto: © Rheinisches Bildarchiv Köln
S. 81 l.: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt Hs 2505, fol. 37r, r.: William Blake, Satan smiting Job with Boils/Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, USA/ Paul Mellon Collection/ Bridgeman, Berlin
S. 83: Thomas Lehnerer, Rechte: VG-Bild-Kunst, Bonn 2022
S. 84: akg-images/Erich Lessing
S. 85: Science History Images/Alamy Stock Photo
S. 86: Will Eisner, Vertrag mit Gott. © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2010
S. 88 o.: Hans Christian Kley, Landshut, u.: Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Bibel in Bildern. Verlag Lothar Borowsky, München o. J.
S. 89: Simon Schmidt, München
S. 90 o.l.: © Andreas Pohlmann, München, o.r.: HOANZL VERTRIEBSGmbH/ORF, u.: David Collingwood/Alamy Stock Photo
S. 91: Adams Äpfel von Anders Thomas Jensen Universum Film, 2005
S. 92: Melanie Köhlmoos, Hiob. W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 2023, Chol-Gu Kang, Behemot und Leviathan. Neukirchener/Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, Markus Witte, Hiobs viele Gesichter. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018
S. 93: Art Heritage/Alamy Stock Photo
S. 96 o.: Foto: Scholz & Friends/Amin Akhtar, u.: PLAYMOBIL
S. 97 o.: Karen Kaspar/Alamy Stock Photo, u.: Heide Bartelmus, Planegg
S. 98: Werner Keller, Und die Bibel hat doch Recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit. Bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Joachim Rehork. Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
2002
S. 99: Bild mit freundlicher Genehmigung durch Ströer Media Deutschland GmbH, Köln, Plakatmotiv © Christlicher Plakatdienst e.V. Bergneustadt
S. 100: Lamya Kaddor/Rabeya Müller, Der Koran für Kinder und Erwachsene. C.H. Beck Verlag, München, 2. Auflage 2022
S. 101: Verlag Roman Kovar, Egling a.d. Paar
S. 102: © Steffen Marklein, Ronnenberg
S. 105, S. 108, S. 132: Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. Oetinger Verlag, Hamburg 1987
S. 106 o.: https://www.yatego.com, Yatego GmbH, Villingen-Schwenningen, M.l.: www.1-2-3-geburtstag.de, Christoph Jacobskötter, Ottersberg, M.r.: Fun-N-More, Thorsten Duhnenkamp, Bremen
S. 107: Bild aus jetzt.de, https://www.jetzt.de/jetzt-freiheit/bedeutetdie-flucht-nach-deutschland-freiheit, Süddeutscher Verlag, München, Foto: Hanna Dürcken
S. 109 l.: Jean Paul Hofmann:: https://blogs.rpi-virtuell.de/artothek/ project/ueberlegungen-zur-freiheit/, Artothek/rpi-virtuell, Rechte beim Künstler
S. 110: Thomas Guggemoos, Pfronten
S. 111: eagle1effi/flickr
S. 112: Barbara/Wikipedia
S. 113: Freiheit digital: Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland.
EKD, Hannover 2021
S. 114: Wolfgang Lettl, Exodus, 1991. © LETTL-Museum für surreale Kunst Augsburg
S. 115: Jan Assmann, Exodus. Verlag C.H. Beck, München 2019
S. 116 l.: MDart/Alamy Stock Photo, r.: Jürgen X. Albrecht, Offenburg
S. 117: Horst Haitzinger, München
S. 118: https://www.amazon.de/Denken-Sie-wie-Hannah-Arendt/dp/ B08YFP1C8J?customId=B0752XQT7N&th=1
S. 119: Karsten Schley, toonpool.com GmbH c/o Max Pohlenz, Berlin, www.toonpool.de
S. 120: Alexander Brückner, Berlin
S. 121 u.: www.kasuwa.de, kasuwa® GmbH, Karlsruhe
S. 122: Julie Mayfeng/Shutterstock.com
S. 123: Shahid Alam, Atelier Kunst und Kultur, Stolberg
S. 124: Franckesche Stiftungen, Halle
S. 125: Garmin Deutschland GmbH, Garching
S. 126: akg/viennaslide/Harald A. Jahn
S. 127: https://www.busstag.de/05/material.htm, Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel
S. 128: Alois Prinz, Dietrich Bonhoeffer. Sei frei und handle!, Suhrkamp Verlag, Berlin 2020
S. 129: »Sieben Wochen ohne«, Chrismon, Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik gGmbH (GEP), Frankfurt
S. 130 o.l.: https://www.amnesty.de/schreib-fuer-freiheit-briefmarathon-2021, Amnesty International Deutschland e. V., Berlin, u.l.: Pro Asyl, Frankfurt, Foto: Tim Wegner, o.r.: https://www.boell. de/de/2017/08/29/wissenschaftsfreiheit-13-thesen-zur-bedeutung-der-wissenschaft-fuer-die-offene-0, »March for Science« in Berlin, Foto: Science March Berlin, u.r.: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/ueber-uns/chronik, Reporter ohne Grenzen e.V., Berlin
S. 132 Hintergrund: picture alliance/JOKER/Marcus Gloger
S. 135 o.: Ilse Müllner, Das hörende Herz. Weisheit in der hebräischen Bibel. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2006, u.: Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011
S. 136: Gerd Theißen, Die Jesusbewegung. Sozialgeschichte einer Revolution der Werte. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2012
S. 137 o.: Thomas Kaufmann, Die Druckmacher. Verlag C. H. Beck, München 2022, u.: Jens Holger Schjørring, Norman A. Hjelm, Kevin Ward (Hrsg.), Geschichte des globalen Christentums. Teil 3: 20. Jahrhundert. W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 2017
S. 138 o.: Klaus von Stosch u.a. (Hrsg,), Streit um die Freiheit. Philosophische und theologische Perspektiven. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2019, u.: Jürgen Moltmann, Wer ist Christus für uns heute?, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1994
S. 139: Peter Dabrock, Renate Augstein, Cornelia Helfferich, Stefanie Schardien, Uwe Sielert, Unverschämt – schön: Sexualethik: evangelisch und lebensnah. Gütersloher Verlagshaus 2015
S. 140 l.: Klaus Kießling Jakob Mertesacker (Hrsg.), Seelsorge interkulturell: Pastoralpsychologische Beiträge. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, r.: Stefan Altmeyer u.a. (Hg.), Reli – keine Lust und keine Ahnung?. Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP) Band 035, Jahr 2019. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019
S. 142: »Sieben Wochen ohne«, Chrismon, Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik gGmbH (GEP), Frankfurt
S. 144: Lukka Marie Wiedenmann, Realschule Giengen
S. 145: © sanktphotoo/Adobe Stock.com
S. 11 gekürzt aus: Henning Luther, Das Leben als Reise. Ideen zu einer theologischen Revision des Bildungsbegriffs, in: Radius Almanach, 1991, S. 63–77. S. 70, Radius-Verlag GmbH, Stuttgart, 1991
S. 13 gekürzt aus: Rita Burrichter, Die Zeit dazwischen. In: Katechetische Blätter 130. Kösel Verlag, München 2005, S. 200 f., Renate Girmes, Der pädagogische Raum, Ein Zwischenraum, in: Liebau, Miller-Kipp, Wulf (Hg.), Metamorphosen des Raums. Erziehungswissenschaftliche Forschungen zur Chronotopologie. Deutscher Studienverlag, Weinheim 1999, S. 90–104, S. 93
S. 14 o.: Julia Lassner, globusliebe, Kottenheim, Albert Camus, Die Ehebrecherin. Rowohlt Verlag, Hamburg 1966
S. 16: Hadith aus der Sammlung Al-Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 183
S. 19 gekürzt aus: Jens Berger, https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/deutsch-und-literatur/friedrich-von-schillerbriefe100.html, 2015, Bayerischer Rundfunk, München
S. 20 Zitat aus folgender Präsentation: Dr. Dorit Günther, TU Kaiserslautern, Selbstlernzentrum, Lernräume der Zukunft – Die Wechselwirkung zwischen Raum und Lernen »Bildung.Regional.Digital: Das Zukunftssymposium der Offenen Digitalisierungsallianz Pfalz« am 29. November 2019 in Kaiserslautern, https://www.offenedigitalisierungsallianzpfalz.de/wp-content/uploads/2019/12/GuentherLernraeume_Fokus_Schulen.pdf, S. 12
S. 26: Isabelle Bach, https://www.lernen.net/artikel/mut-zivilcourage-9979/, Lernen.net, 4pub GmbH, Köln, Lothar Zenetti, Texte der
Zuversicht. Für den einzelnen und die Gemeinde, J. Pfeiffer Verlag, München 1987
S. 27 gekürzt aus: Gerd Schneider/Christiane Toyka-Seid, Das junge Politik-Lexikon von www.hanisaulande.de, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2022
S. 29 Grundsteinurkunde: nach Monika Fick, Lessing-Handbuch, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2010
S. 30: Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Erster Teil, IV.4. (1784). Sammlung Hofenberg, Berlin 2017
S. 31: Wilhelm von Humboldt, Theorie der Bildung des Menschen (1794), Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1792), Bericht der Sektion des Kultus und Unterrichts (1. Dezember 1809).
S. 32: Matthew Tindal, Christianity as old as the creation, or the Gospel a republication of the religion of nature, 1730, von Johann Lorenz Schmidt 1741 ins Deutsche übersetzt; H. E. G. Paulus, nach: Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Bd. 1. Verlag Siebenstern, Hamburg 1966, S. 85
S. 34: Peter von Matt, https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/ radiowissen/romantik100.html, Bayerischer Rundfunk, München, 2013
S. 35: Transkript der Schlussszene aus dem Film »Shutter Island« von Martin Scorsese, 2010
S. 36: Marco Wehr, https://www.neueshandeln-sprich.de/archivartikel/wird-unsere-welt-immer-komplexer/, neues handeln AG, Köln, 2017, Marianne Leuzinger-Bohleber, https://www.faz.net/aktuell/ karriere-hochschule/keine-psychoanalyse-mehr-an-der-goethe-uniin-frankfurt-17627685.html, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt 2021
S. 37: Gisa Funck/Stefan Müller-Doohm, https://www.deutschlandfunk.de/90-geburtstag-von-juergen-habermas-ein-ausserordentlich-100.html, Deutschlandradio, Köln 2019
S. 38: Veit-Mario Thiede, https://www.rnz.de/panorama/magazin_ artikel,-paul-klee-grenzen-des-verstandes-_arid,348354.html, Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, Heidelberg 2018
S. 39: Joachim Willems, zitiert in: Karlo Meyer: Grundlagen interreligiösen Lernens. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, Zitat Bernhard Dressler, https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/ download-alt/schoenberger_hefte/2011/1-11/09-17_Dressler.pdf, Schönberger Hefte, RPI der EKKW und EKHN, Marburg 2017
S. 40: Martin Luther, Disputatio de Homine/Disputation über den Menschen (1536), ders., Der Prophet Jona ausgelegt 1526
S. 41: Jürgen Moltmann, aus: Wissenschaft und Weisheit. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2002, S. 41 f.
S. 42: Homepage Creation Museum, Kentucky, USA, https://creationmuseum.org/dinosaurs-dragons/live-with-humans/, Ken Ham nach: Michael Remke, Noahs neue Arche steht 1000 Kilometer vom Meer entfernt, 2016 in: Welt, https: www.welt.de/vermischtes/article156885793/Noahs-neue-Arche-steht-1000-Kilometervom-Meer-entfernt.html, Lothar Gassmann, Fragen und Antworten zur Wahrheit der Bibel. Vorwort des deutschen Herausgebers, 2019, https://answersingenesis.org/de/antworten/vorwort-desdeutschen-herausgebers/, Answers in Genesis, Petersburg, Kentucky, USA
S. 43: Transkript des Kurzfilms »Susi Neunmalklug erklärt die Evolution«, 2009, https://www.youtube.com/watch?v=X-j3I4kjHWI
S. 44, S. 45: Reiner Anselm, Schöpfung als Deutung der Lebenswirk-
lichkeit, in: Konrad Schmid (Hrsg.), Schöpfung. Themen der Theologie, Band 4, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2012, S. 252 f., Ingolf U. Dalferth, »Glaube und Wissenschaft ergänzen sich«, in: »magazin« der Universität Zürich Nr. 4/10, Dossier; Was wir glauben –Religion und Theologie heute, www.magazin.uzh.ch/dam/ jcr:ffffffff-fa22-5a00-0000-000034159e96/Magazin-2010-4-38.pdf
S. 45 Text angelehnt an Thomas Görnitz, Brigitte Görnitz, Naturwissenschaften und evangelische Spiritualität, in: Peter Zimmerling (Hg.) Handbuch Evangelische Spiritualität Band 2: Theologie, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018, S. 92 f.
S. 52: Gregor Hohberg, https://taz.de/Bau-eines-interreligioesen-Gotteshaus/!5771077/, taz Verlags u. Vertriebs GmbH 2021, Die Organisatoren über das Projekt »House of One«: Andreas Nachama, Osman Örs, Stiftung House of One – Bet- und Lehrhaus Berlin
S. 53: Johannes von Lüpke, Tugend des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe: Lessings Toleranzverständnis im Kontext der Aufklärung, in: Andrea Bieler, Henning Wrogemann (Hrsg.), Was heißt hier Toleranz? Interdisziplinäre Zugänge, S. 44. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014
S. 54: Martin Buber, Nachlese, S. 99 f. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2001
S. 55: to-le-ranz: Christian Moser, Die teuflischen Tricks der Monster des Alltags. © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2009, Josef Fellsches und Werner L. Hohmann, Toleranz: das Fremde – Macht –Identität, Vorträge aus dem VI. Verlagskolloquium. Verlag Die blaue Eule, Essen 1998, S. 75–84, 82 f., Heinrich Schmidinger, Identität und Toleranz. Christliche Spiritualität im interreligiösen Kontext. Salzburger Hochschulwochen 2003. Tyrolia Verlag, Innsbruck 2003
S. 56: Bar Simon, nach Kirche und Synagoge Bd. I, S.118
S. 57: Christian Szyska in: Ralf Elger und Friederike Stolleis (Hrsg), Kleines Islam Lexikon, Verlag C. H.Beck, München 2018, Stichwort Jihad
S. 58 Grafik Kopftuch: Statista GmbH, Hamburg 2021, Rotraut Wieland, Die Vorschrift des Kopftuchtragens für die muslimische Frau: Grundlagen und aktueller innerislamischer Diskussionsstand. Herausgegeben von der Deutschen Islamkonferenz, Auszug aus einem Vortragsmanuskript, 2017
S. 59: Manuel Almeida Vergara https://www.fr.de/kultur/kunst/muslim-wirkt-signalwort-11877292.html, Frankfurter Rundschau GmbH, Frankfurt 2019
S. 60: Ansgar Nünning, Vielfalt der Kulturbegriffe, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, https://www.bpb.de/lernen/kulturelle-bildung/59917/vielfalt-der-kulturbegriffe/, Joachim Willems, Interreligiöses und interkulturelles Lernen: Notwendige Bezüge und notwendige Unterscheidungen, in: interculture journal: Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien, 8(9), 23–44. https:// nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-454415, 2009
S. 62: Das Gegenüber: https://www.zhdk.ch/forschung/ehemalige-forschungsinstitute-7626/iae/glossar-972/othering-5894, Zürcher Hochschule der Künste, Zürich, Interview mit Farid Hafez: https:// www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/180770/wo-endet-islamkritik-und-beginnt-islamfeindlichkeit/, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2014
S. 64: Wolfgang Reinbold, Glauben wir an denselben Gott? Eine christliche Perspektive, https://www.rpi-loccum.de/damfiles/default/rpi_loccum/Materialpool/Pelikan/Pelikanhefte/pelikan1_15c4dfe3fb50c4c93cd74eecd405cf2474.pdf, RPI Loccum, Hamideh Mohagheghi, Glauben wir an denselben Gott? Eine muslimische
Perspektive, in: Loccumer Pelikan. Religionspädagogisches Magazin für Schule und Gemeinde des Religionspädagogischen Instituts Loccum 1/15, S. 15, RPI Loccum, Gábor Lengyel, G’tteserfahrung und G’tteswesen. Eine jüdische Perspektive, in: Loccumer Pelikan. Religionspädagogisches Magazin für Schule und Gemeinde des Religionspädagogischen Instituts Loccum 1/15, S. 14, RPI Loccum
S. 65: Interview Christiane Florin mit Mouhanad Khorchide: https:// www.deutschlandfunk.de/jesus-im-koran-maryams-sohn-100. html, Deutschlandradio, Köln 2018
S. 66: Sylvia Meise, https://www.publik-forum.de/Suche?suchbegriffe=abraham%20am%20tor%20zur%20welt%20des%20Internetauftritts%20von%20Publik%20Forum&redirnotfound=1, Publik-Forum Verlagsgesellschaft mbH, Oberursel
S. 67: Friedmann Eißler, Abraham im Islam, in: Böttrich/Ego/Eißler, Abraham in Judentum, Christentum und Islam, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2009, S. 116–188. S. 182, Hubert Frankemölle, Vater im Glauben?: Abraham/Ibrahim in Tora, Neuem Testament und Koran, Herder Verlag, Freiburg 2016, S. 493
S. 68: Norbert Lammert, Vom Dialog zum Trialog? Geburtstagswünsche zum 50. Jahrestag des Christlich-jüdischen Dialoges. Beitrag auf dem 33. Evangelischen Kirchentag 2011, https://www.norbertlammert.de/01-lammert/texte2.php?id=93
S. 69: Bernhard König, https://trimum.de/start/musik-im-trialog/ hintergrund/13913, TRIMUM e.V., Stuttgart, Schulwettbewerb: https://eks-baunatal.de/aktivitaeten/trialog-der-kulturen/, Erich Kästner Schule Baunatal
S. 70: Thomas de Maizière, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/interviews/DE/2017/05/namensartikel-bild.html, Bundesministerium des Innern und für Heimat, Berlin 2017
S. 74: G. E. Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft, in: H. Thielicke (Hrsg.), G. E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts und andere Schriften, Reclam Verlag, Stuttgart 2002, S. 36
S. 75: Eveline Goodman-Thau, Aufstand der Wasser, Jüdische Hermeneutik zwischen Tradition und Moderne, Philo Verlag, Berlin 2002, S. 34
S. 76: Jochen Hörisch, Die Wut des Verstehens, S. 13–18 (Auszug). Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1988, Aleida Assmann, Texte und Lektüren, S. Fischer Verlag, Frankfurt 1996, S. 8
S. 78: Thomas Brussig, in: Jutta Limbach (Hrsg.), Der schönste erste Satz. Initiative Deutsche Sprache und der Stiftung lesen. Hueber Verlag, München, S. 107
S. 79 gekürzt aus: Sören Kierkegaard, Die Wiederholung, Gesammelte Werke 5 und 6, Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 1955, S. 1–97. S. 68; Jürgen Ebach, gekürzt aus: Rebellion und Frömmigkeit, in: Zum Gedenken an Dorothe Sölle, Hamburg University Press, Hamburg 2004, S. 37–67, S. 57 f.
S. 81 leicht gekürzt aus: Bernd Schaller, Das Testament Hiobs, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1979, S. 301–387, 342–344
S. 84: Dorothee Sölle, Leiden, Kreuz Verlag, Stuttgart 1989, S. 91, Martin Luther gekürzt aus: Vorrede auf den Psalter, 1528, WA DB 10,1, S. 100 f., Jean-Baptiste Metz, Kirche nach Auschwitz. Herder Verlag, Freiburg
S. 85: Gespräch mit Sandra Gassert, private Quelle
S. 86 Zeitungsnachricht: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/gerichtsentscheidung-klage-gegen-gott-abgewiesena-584714.html, SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Hamburg 2008
S. 87: Ernst Bloch, Atheismus im Christentum. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1973, S. 125
S. 88 gekürzt aus: Christoph Türcke, Umsonst leiden, Der Schlüssel zu Hiob, S. 89 f., zu Klampen! Verlag, Springe 2017
S. 89 gekürzt aus: Ludwig Marcuse, Philosophie des Glücks. Von Hiob bis Freud. Diogenes Verlag, Zürich 1972, S. 37 f., Jürgen Ebach, Hiobs Klage, in: Klara Butting (Hrsg.), Hiob, S. 38–51. EREV-RAV Verlag, Berlin, leicht bearbeitet, Martin Buber, Gottesfinsternis, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, Elie Wiesel, gekürzt aus: Hiob oder das revolutionäre Schweigen, in: Adam oder das Geheimnis des Anfangs. Brüderliche Urgestalten. Herder Verlag, Freiburg, 5. Aufl. 1987, S. 228–230
S. 90: Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1961
S. 91: Der Dialog ist aus dem Film Adams Äpfel transkribiert. Adams Äpfel von Anders Thomas Jensen Universum Film, 2005
S. 93: Manfred Oeming, Tiefenpsychologische Schriftauslegung und historisch-kritische Exegese. Ein Leistungsvergleich am Beispiel des Buches Hiob. In: Michaela Bauks, Ulrich Berges, Daniel Krochmalnik, Manfred Oeming, Neue Wege der Schriftauslegung, S. 161–230. S. 205, Probleme: S. 205, LIT Verlag Münster 2019
S. 95: Hermeneutisches Viereck: Nach Manfred Oeming, Biblische Hermeneutik, S. 5. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1998
S. 96: Martin Luther, Vorrede zum Neuen Testament 1545, http:// www.zeno.org/Literatur/M/Luther,+Martin/Luther-Bibel+1545/ Das+Neue+Testament/%5BVorbemer-kungen%5D/Luthers+Vorrede+auf+das+Neue+Testament (sprachlich angeglichen)
S. 97: Barmer Theologische Erklärung, zitiert nach: Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und Thüringen, Evangelischer Presseverband für Bayern e.V.. München 1994, S. 1578, Melanie Köhlmoos, Lutherbibel 2017: Übersetzer sind keine Verräter!, in: https://www.evangelisch.de/inhalte/139947/03-11-201/melanie-koehlmoos-ueber-das-uebersetzen-der-christlichen-theologie, evangelisch.de ist ein Portal des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH, Frankfurt, 2016
S. 98 gekürzt aus: Christian Bühler, Ist die Bibel wahr? In: Godwin Lämmermann, Bibeldidaktik in der Postmoderne, S. 44–49. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1999, Aus der zusammenfassenden Erklärung der Chicagoer Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel; abrufbar z.B. unter: https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/chicago.pdf (S. 7)
S. 99 l.: Katharina Payk, https://www.evangelisch.de/blogs/kreuzqueer/180919/06-01-2021, evangelisch.de ist ein Portal des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH, 2021, r.u.: Text angelehnt an einen Auszug aus den Infotext »Christlicher Fundamentalismus« der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen, https://ezw-berlin.de/html/3_165.php Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Berlin
S. 100 l.: gekürzt aus: Muhammad Salim Abdullah, Islam für das Gespräch mit Christen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1992, S. 28 f., r.: Lale Akgün im Gespräch mit Susanne Fritz, https://www. deutschlandfunk.de/liberaler-islam-fuer-moderne-muslime-hatdie-scharia-gar-100.html, Deutschlandradio, Köln 2015
S. 101 o. gekürzt aus: Marc Alain Ouaknin, Dialog, Übersetzung und Therapie, in: Ingrid Lohmann, Wolfram Weiße (Hrsg.), Dialog zwischen den Kulturen, Waxmann Verlag, Münster 1994, S. 135–144,
137 f., u.: Elisa Klapheck, https://verlag.zeit.de/freunde/lesen/ buchempfehlung/elisa-klapheck-empfiehlt-david-und-salomo-archaeologen-entschluesseln-einen-mythos-von-israel-finkelsteinund-neil-asher-silberman/, ZEIT ONLINE GmbH, Hamburg
S. 102 gekürzt aus: Ingo Baldermann, Einführung in die biblische Didaktik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996, S. 1–9
S. 107 gekürzt aus: https://www.jetzt.de/jetzt-freiheit/bedeutet-dieflucht-nach-deutschland-freiheit, Süddeutsche Zeitung GmbH, München, jetzt.de, 2021
S. 108: Zitate Jugendliche gekürzt aus: https://www.jetzt.de/jetztfreiheit/wird-man-mit-dem-18-geburtstag-wirklich-frei, Süddeutsche Zeitung GmbH, München, jetzt.de, 2021
S. 110 l.: Kann man Freiheit kaufen?, https://www.peaks.com/de/de/ blog/portfolio/freiheit-und-geld-hat-unabhaengigkeit-ein-preisschild/, Peaks BV, Amsterdam, r.: Interview mit Tobi Rosswog gekürzt aus: https://www.fuereinebesserewelt.info/geldfrei-auf-demweg-nach-utopia, Ilona Koglin & Marek Rohde, Hamburg, FÜR
EINE BESSERE WELT, 2018
S. 111 gekürzt aus: Erhard Denninger, Freiheit gegen Sicherheit?, https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/243992/freiheit-gegen-sicherheit, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2017
S. 112: Auffenberg, Lisa, Ambivalenz der Freiheit, in: Psychologie heute (10. 6. 2020), https://www.psychologie-heute.de/leben/artikeldetailansicht/40555-homo-optionis.html, Verlagsgruppe Beltz, Julius Beltz GmbH & Co. KG, Weinheim 2020
S. 113 gekürzt aus: https://www.zeit.de/digital/internet/2012-02/ wir-die-netz-kinder?utm_referrer=https %3A%2F%2Fwww.google. com%2F, ZEIT ONLINE GmbH, Hamburg 2012
S. 114 gekürzt aus: Jürgen Drewermann, Heilende Religion, Herder Verlag, Freiburg 2006
S. 115 l.: gekürzt aus: https://www.deutschlandfunkkultur.de/aegyptologe-jan-assmann-exodus-ist-aufklaerung-100.html, Deutschlandradio, Köln 2015, r.: https://www.juedische-allgemeine.de/religion/hohes-gut/, Jüdische Allgemeine, Berlin 2010
S. 116: Annemarie Pieper, https://philosophie-indebate.de/361/grenzen-der-freiheit/, Stiftung Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, 2013
S. 117: Nils Marquardt, Die Freiheit, die sie meinen, in: Philosophie Magazin, 30. 4. 21. https://www.philomag.de/artikel/die-freiheitdie-sie-meinen, Philomagazin Verlag GmbH, Berlin
S. 118 l.: https://www.zeit.de/2021/19/hannah-arendt-philosophieaktualitaet-freiheit-menschenrechte-demokratie-debatte, ZEIT ONLINE GmbH, Hamburg 2021
S. 119 gekürzt aus: Beate Rössler, Autonomie: Ein Versuch über das gelungene Leben, S. 37 f. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017
S. 120: gekürzt aus: Philipp Mattheis/Klaus Podak, Interview mit Gerhard Roth, in: SZ Magazin vom 15. 4. 2011; https://sz-magazin. sueddeutsche.de/wissen/auf-den-spuren-unseres-denkensii-78081, Süddeutscher Verlag, München 2011
S. 121 gekürzt aus: Julia Decker, Mein Wille geschehe?, in: fluter vom 20. 6. 2005, https://www.fluter.de/mein-wille-geschehe, fluter.de/ Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2005
S. 123: Jörg Lauster, Die Freiheit zur Tat. Predigt im Universitätsgottesdienst St. Markus München, 16. 7. 2017, https://www.evtheol. uni-muenchen.de/einrichtungen/unigottesdienste_alt/archiv/sose2017/freiheit_zur_tat/index.html, Ludwig-Maximilians-Universität München 2017
S. 124 gekürzt aus: https://www.ekd.de/vortrag-von-der-freiheit-eines-christenmenschen-32427.htm, Evangelischen Kirche in Deutschland. EKD, Hannover 2018
S. 125: Iren Schulz, https://www.irenschulz.de/2015/05/, Iren Schulz, Erfurt 2015, Nora Gaupp/Christian Lüders, »mach was aus dir« Selbstinszenierung und Selbstoptimierung bei Jugendlichen – Freiheit oder Zwang?, Zeitschrift Pro Jugend 2016, S. 4–9, S. 8. Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V., München 2015, Mirjam Zimmermann »Werde, der du sein willst!« Selbstoptimierung als Phänomen, seine Interpretation und religionspädagogische Strategien zum Umgang, https://www.theo-web.de/archiv/ archiv-ab-juni-2017/news/werde-der-du-sein-willst-selbst-optimierung-als-phaenomen-seine-interpretation-und-religionspaedag1/?tx_news_pi1%5Bcon-troller%5D=News &tx_news_pi1%5Bactio n%5D=detail&cHash=afadcd9ca0049ba30d1e457d7fa05b0c, THEO WEB Zeitschrift für Religionspädagogik, 2018
S. 126: Elisabeth Gräb-Schmidt, Das Gewissen. Systematisch-theologische Erwägungen. Gekürzt aus: Entwurf 4 /2021. Friedrich Verlag GmbH, Hannover 2021
S. 127 gekürzt aus: Karl Friedrich Haag: Bausteine für ein christliches Reden von Gott und Menschen, S. 198 f. GPM, Religionspädagogisches Zentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
2007
S. 128 l.: Ausschnitt aus dem Film »Die letzte Stufe«. Eric Till/Jones Gareth, Random House, Dietrich Bonhoeffer, Ethik. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, S. 276 f., r.: Dietrich Bonhoeffer, Ethik, zusammengestellt und herausgegeben von Eberhard Bethge, Auszüge aus S. 188–193 (DBW Band 6). Christian Kaiser Verlag, München
1956
S. 129 aus: https://www.evangelisch.de/inhalte/78797/17- 02- 2013/ riskier-was-mensch-mit-gottes-hilfe-uebers-wasser-gehen, evangelisch.de ist ein Portal des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH, Frankfurt, 2013
LIED
S. 108 Songtext gekürzt: Michael Kurth/Marius Müller-Westernhagen, Rechte: More Music Musikverlag GmbH, Hamburg/Hanseatic Musikverlag GmbH & Co. KG, Hamburg